Klimawandel Folgen und Anpassungsmöglichkeiten für den Bergwald
|
|
|
- Bella Beyer
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Klimawandel Folgen und Anpassungsmöglichkeiten für den Bergwald Unterrichtsmaterial für die Klassen 9 und 10 5,50
2 0596/2012 Inhalt Herausgegeben vom aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e.v. Heilsbachstraße 16, Bonn Internet: mit Förderung durch das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Text Friederike Heidenhof Dr. Dagmar Giersberg Rainer Schretzmann, aid Bilder Titelbild: Reiner Schretzmann, aid Grafiken Grafik Klimabedingte Vegetationsgürtel in Europa sowie Klimahüllen Buche, Fichte, Tanne, Bergahorn: Dr. Christian Kölling, Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft Didaktisierung Dr. Dagmar Giersberg Redaktion Rainer Schretzmann, aid Gestaltung Jasmin Friedenburg, aid Wir danken Dr. Franz Binder, LWF, für die inhaltliche Unterstützung; Dr. Christian Kölling, Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, für die Genehmigung zur Nutzung der von ihm erstellten Grafiken (Klimahüllen Fichte, Buche, Tanne, Bergahorn) Für die Genehmigung zum Abdruck von Texten und Grafiken danken wir außerdem dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) der bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) dem Bund Naturschutz Bayern Greenpeace Österreich Soweit nicht andere Urheber genannt werden, liegen die Nutzungsrechte an den Inhalten der PDF - und Word -Dokumente beim aid infodienst e. V. Die Bearbeitung der Inhalte (Text und Grafik) dieser Dateien für die eigene Unterrichtsplanung ist unter Wahrung der Urheberrechte erlaubt. Die Weitergabe der PDF - und Word -Dokumente in der Originalfassung oder in einer bearbeiteten Fassung an Dritte ist unzulässig. Für die nicht vom aid bearbeiteten Inhalte übernimmt der aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (aid) keine Haftung. Einführungsfolie Klimawandel Folgen und Anpassungsmöglichkeiten für den Bergwald Didaktische Hinweise 4 Unterrichtsverlauf 4 1. Doppelstunde 4 2. Doppelstunde 5 Hintergrundinformationen 6 Der Bergwald und seine Funktionen 6 Aufgaben des Schutzwaldes 6 Bergwald: Sorgenkind der Förster 7 Bergwald und Klimawandel in den Alpen 7 Die Probleme des Schutzwalds im Einzelnen 9 1. Wildverbiss und Überalterung der Wälder 9 2. Schadstoffe Klimaveränderung 10 Lösungsansätze Pflege und Sanierung von Schutzwäldern 11 Folie zu Arbeitsblatt 1 12 Arbeitsblatt 1 13 Folie zu Arbeitsblatt 2 16 Arbeitsblatt 2 17 Folie zu Arbeitsblatt 3 18 Arbeitsblatt 3 19 Folie zu Arbeitsblatt Arbeitsblatt 4 23 Arbeitsblatt 5 24 Arbeitsblatt 6 25 Weiterführende Links 26 Lösungsansätze 28 zu Arbeitsblatt 1 28 zu Arbeitsblatt 2 29 zu Arbeitsblatt 3 30 zu Arbeitsblatt 4 31 zu Arbeitsblatt 5 32 zu Arbeitsblatt 6 32 Stichworte zur Schlussdiskussion 25 aid-medientipps 31 3 Der aid infodienst e. V. ist ein gemeinnütziger Verein, der mit öffentlichen Mitteln gefördert wird. Er arbeitet wissenschaftlich fundiert, frei von Werbung und kommerziellen Interessen. 2
3 Klimawandel Folgen und Anpassungsmöglichkeiten für den Bergwald Verbiss Lawinen Stürme und Borkenkäfer Bilder links: Hockenjos (2), Mitte: Stahuber (2), rechts: P. Meyer, aid (oben), Schretzmann, aid (unten)
4 Bilder links: Hockenjos (2), Mitte: Stahuber (2), rechts: P. Meyer, aid (oben), Schretzmann, aid (unten) Didaktische Hinweise Klimawandel Folgen und Anpassungsmöglichkeiten für den Bergwald Verbiss Lawinen Stürme und Borkenkäfer Das vorliegende Unterrichtsmaterial ist für Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 bis 10 an allgemeinbildenden Schulen konzipiert. Das Material ist so aufbereitet, dass es in zwei Doppelstunden (à 90 Minuten) bearbeitet werden kann, wobei jede Doppelstunde eine sinnvolle, geschlossene Einheit bildet. Vorschlag für Unterrichtsverlauf 1. Doppelstunde 1. Einstieg (10 Min.) Aktivierung von Vorwissen zum Thema Bergwald als Schutzwald (eventuell mit Hilfe der Fotos von Folie 1) Klassengespräch: Assoziationen- und Ideensammlung an der Tafel Soweit die Möglichkeit besteht, als Einstieg im Internet ein Video über Hochwasser in den Alpen aufrufen und als Einstieg in die Themenarbeit verwenden, z. B.: ergänzend evtl. auch Video zu einem Murgang z. B.: 2. Expertengruppen zu den Schutzfunktionen der Bergwälder (50 Min.) vgl. Arbeitsblatt 1 a) Vorbereitung in Einzelarbeit. (Material: je nach Gruppe jeweils ein Abschnitt aus dem Artikel Der Bergwald und seine Schutzfunktionen unter (Klickpunkt: Schutzfunktionen) Teilen Sie dazu die Klasse in vier Gruppen. Die Schüler/innen der Gruppe 1 befassen sich in Einzelarbeit mit dem Abschnitt Wussten Sie schon, dass Bergwald, die Schüler/innen der Gruppe 2 mit dem Abschnitt Boden-Erosionsschutz, die Schüler/innen der Gruppe 3 mit dem Abschnitt Lawinenschutz und d ie Schüler/innen der Gruppe 4 mit dem Abschnitt Wasserschutz. b) Expertengruppen: Es werden Vierergruppen gebildet, so dass in jeder Gruppe je ein/e Schüler/in der Gruppen 1 bis 4 vertreten ist (je nach Gesamtzahl der Schüler/innen kann auch eine Gruppe doppelt vertreten sein). In der Expertengruppe stellt jede/r Schüler/in die Inhalte des in a) bearbeiteten Textabschnitts vor. 4
5 3. Klimawandel in den Alpen (20 Min.) Partnerarbeit (Arbeitsblatt 2, Aufgabe 1) Sollten einige Gruppen früher fertig sein als andere, können sie zusätzlich Aufgabe 2 des Arbeitsblatts 2 bearbeiten. Dazu können sie sich mit Hilfe von Kopien der Spiegel - bzw. Focus -Artikel aus der Linkliste unter Zum Klimawandel in den Alpen informieren. 4. Klassengespräch Ergebnissicherung und Diskussion (10 Min.) Welche Folgen hat der Klimawandel in den Alpen für den Bergwald und seine Schutzfunktionen für den Menschen? 2. Doppelstunde 1. Hausaufgabe zu dieser Doppelstunde: Vorbereitende Recherche. Teilen Sie die Klasse in vier Gruppen. Gruppe A klärt in Einzelarbeit den Begriff Permafrost. Gruppe B klärt in Einzelarbeit die Begriffe Wildverbiss und Schalenwild. Gruppe C informiert sich über die Orkane Kyrill, Paula und Emma. Gruppe D informiert sich über Borkenkäfer. 2. Einstieg (10 Min.) Aktivierung von Vorwissen zum Thema Bergwald als Schutzwald (eventuell mit Hilfe der Fotos von Folie 1) Klassengespräch: Assoziationen- und Ideensammlung an der Tafel (Falls Sie die 1. Doppelstunde [s.o.] durchgeführt haben, bietet sich als Einstieg eine kurze Wiederholung der Schutzfunktionen des Bergwalds an.) 3. Folgen des Klimawandels für den Bergwald am Beispiel der Fichte (30 Min.) Partnerarbeit (Arbeitsblatt 3, Aufgaben 1 und 2) Präsentation der Ergebnisse. Anschließend Klassengespräch zur Ergebnissicherung 4. Gruppenarbeit zu Gefahren für den Schutzwald, Maßnahmen zur Pflege und Erhaltung des Schutzwalds (30 Min.) Gruppenarbeit. Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen. Gruppe 1 bearbeitet das Arbeitsblatt 4, Gruppe 2 bearbeitet das Arbeitsblatt 5, Gruppe 3 bearbeitet das Arbeitsblatt 6 5. Präsentation der Gruppen-Ergebnisse und anschließend Klassengespräch zur Ergebnissicherung (20 Min.) mit folgenden Fragestellungen: Was kann man tun, um den Schutzwald zu erhalten? Worauf muss die Forstwirtschaft beim Umbau der Berg- bzw. insbesondere der Schutzwälder besonders achten und welche Maßnahmen müssen ergriffen werden? Wer muss in die Problemlösung mit einbezogen werden? Ausblick: Was ist bei wesentlich stärkeren Temperaturzunahmen als den unterstellten 1,8 Grad Celsius zu berücksichtigen? 5
6 Hintergrundinformationen Foto: Schretzmann, aid Wälder stabilisieren auch extreme Steillagen Der Bergwald und seine Funktionen In den Bergen dienen die Wälder nicht nur der Holzgewinnung oder den Touristen als Erholungsgebiet. Für die menschlichen Siedlungen in den Gebirgen ist es überlebensnotwendig, dass sie der Wald vor Naturkatastrophen schützt bzw. deren Folgen mildert. Daher bezeichnet man Wälder, die wichtige Schutzfunktionen erfüllen, auch als Schutzwälder und misst ihnen in den Waldgesetzen besondere Bedeutung zu. Aufgaben des Schutzwaldes: Viele Bergwälder zum Beispiel in den Alpen haben Schutzaufgaben. Besonders wichtig sind die Steilhangwälder über den Siedlungen und Verkehrswegen. Sie schützen den Menschen unmittelbar. Diese Wälder verringern die Boden-Erosion und die Gefahr von Muren (Schlamm- und Geröllflüssen), Erdrutschen und Steinschlag. Die Baumwurzeln halten den Boden fest und verhindern damit die großflächige Boden-Erosion. Die Bäume fangen mit ihren Stämmen abgehende Steine bis zu einem halben Meter Durchmesser ab. Eine besonders wichtige Aufgabe ist der Lawinenschutz. Hier ist der Bergwald unverzichtbar. Die Wälder verhindern die Entstehung von Lawinen in den Hanglagen der Bergwaldzone. Besonders tief bekronte Fichten und Tannen fangen mit ihren immergrünen Nadeln viel Schnee auf. Unter und zwischen diesen Nadelbäumen ist der Aufbau der Schneeschichten wesentlich stabiler. Das wirkt der Entstehung von Lawinen entgegen. Im Alpenraum richten Hochwasser den größten Schaden an und stellen die häufigste Bedrohung für den Menschen dar, hier hat der Bergwald eine besonders wichtige Aufgabe zu erfüllen. Bergwälder speichern den Niederschlag intakter Waldboden fasst pro Kubikmeter bis zu 250 Liter. Bei starken Niederschlägen, also wenn in kurzer Zeit viel Regen fällt, schießt das Wasser dann nicht als reißender Strom talwärts in die Flüsse, sondern wird langsam abgegeben. Der Bergwald verringert durch diesen gleichmäßigen Wasserabfluss aber nicht nur die Hochwassergefahr. Er dient im Sommer auch als Wasserspeicher und sorgt dafür, dass den Menschen ausreichend Wasser zur Verfügung steht. 6
7 Foto: Schretzmann, aid Besonders tief beastete Nadelbäume halten sehr viel Schnee in ihren Ästen fest Bergwald: Sorgenkind der Förster Aber der Bergwald zum Beispiel in den Alpen hat es nicht leicht. Extreme Klimabedingungen mit eisigen Wintern, kurzen Sommern, sintflutartigen Regenfällen, aber auch Hitzeperioden und starke Sonneneinstrahlung machen den Bäumen zu schaffen. Dazu kommen die Eingriffe der Menschen: Sie haben den Wald über viele Jahrhunderte immer weiter zurückgedrängt, etwa indem sie hochgelegene Bergwaldbereiche an weniger steilen Hängen in Almflächen umgewandelt haben. Gleichzeitig gibt es große Bemühungen zur Pflege und Erhaltung dieser Schutzwälder, weil der Wald in den Steilhängen über den Tälern eine entscheidende Bedeutung für den Schutz der Siedlungen und Verkehrswege vor Naturgefahren hat. Doch trotz vieler Bemühungen sind die Schutzwälder zu einem großen Teil in einem sehr problematischen Zustand. Oft fehlen die jungen Bäumchen (die so genannte Naturverjüngung), die als Nachfolger für die absterbenden alten Bäume die nächste Waldgeneration bilden sollen. Und dort, wo sich Naturverjüngung entwickelt hat, wird sie häufig durch starken Verbiss von Rehen, Gämsen und Rothirschen beeinträchtigt. Der Bergwald leidet heute schon unter sichtbaren Folgen der Klimaerwärmung. Deren Vorboten sind die Sturmkatastrophen der letzten Jahre (Orkane Kyrill 2007, Paula und Emma 2008), die viele Bergwälder geschädigt oder sogar zerstört haben. Dabei werden die Schutzwälder in Zukunft noch wichtiger sein als bisher: Denn wenn die Temperaturen weiter steigen und es häufiger zu sehr heftigen Niederschlägen kommt, wird das Risiko von Murgängen (Strömen aus einem Gemisch von Wasser, Erde und Steinen) und Hochwasser und damit die Gefahr für die Siedlungen in den Gebirgstälern im Alpenraum immer größer. 7
8 Bergwald und Klimawandel in den Alpen Die Klimaerwärmung wirkt sich schon heute in der Alpenregion wesentlich stärker aus als im Flachland. Die Durchschnittstemperaturen sind hier von 1900 bis heute bereits um etwa 2 Grad Celsius angestiegen, nahezu doppelt so stark wie im europäischen Mittel, allein in den letzten 25 Jahren um 1,2 Grad. In den Alpen wird die Klimaänderung besonders offensichtlich am Abschmelzen der Alpengletscher, die in den letzten Jahrzehnten immer kleiner geworden sind. Einige Wissenschaftler rechnen sogar damit, dass die Alpen im Jahr 2100 eisfrei sein könnten. Die Gletscher sind gleichsam das Klima-Fenster der Alpen. Hier zeigen sich die Veränderung von Temperatur, Sonneneinstrahlung und Niederschlag zwar mit einer gewissen Verzögerung, dafür aber umso deutlicher. Zudem hat das Abtauen von Permafrost insbesondere in den Sommermonaten ganze Berghänge destabilisiert und zu schweren Gerölllawinen bzw. Steinschlägen geführt. Auf die Tiere und Pflanzen wirken sich die Veränderungen natürlich auch aus, so haben sich beispielsweise die Lebensbereiche zahlreicher Pflanzen nach oben verschoben. Die Bergwälder leiden heute schon unter den sichtbaren Folgen der Klimaerwärmung. Die Sturmkatastrophen der letzten Jahre haben viele Bergwälder geschädigt oder sogar zerstört. Darüber hinaus profitieren Schädlinge von den Schäden, die Stürme in den Wäldern hinterlassen. Denn umgestürzte Bäume bieten beispielsweise Borkenkäfern wie dem Buchdrucker optimale Brutbedingungen. Diese Schädlinge fühlen sich außerdem bei höheren Temperaturen besonders wohl auch im Gebirge. Sie befallen dann in Gebirgswäldern vor allem die Fichten und können ganze Wälder zum Absterben bringen. Dabei werden die Schutzwälder in Zukunft noch wichtiger sein als bisher: Denn bei ansteigenden Temperaturen und einer Zunahme von sehr starken Niederschlägen wird das Risiko von Murgängen (Strömen aus einem Gemisch von Wasser, Erde und Steinen) und Hochwasser besonders für die Siedlungen in den Gebirgstälern im Alpenraum immer größer. Orkane führen zu großen Zerstörungen im Gebirgswald Das Klima verändert die Alpen Der Gletscherrückgang in den Alpen beschleunigt sich und schon in wenigen Jahrzehnten könnten die Alpen fast gletscherfrei sein. Die zeitlich verzögerte Reaktion der Alpen auf erhöhte Temperaturen führt dazu, dass wir heute die Gletscherschmelze beobachten können, die vor 1 bis 30 Jahren verursacht wurde. Angesichts der Rekordtemperaturen in den 90er-Jahren auch in den Alpenländern ist mit einem weiteren dramatischen Gletscherrückzug in den nächsten Jahren zu rechnen. Die Permafrostgrenze hat sich in den letzten 100 Jahren um 150 bis 200 m nach oben verschoben, ein weiterer Anstieg um m droht (bei einer Erwärmung um 1 2 C bis zum Jahr 2100). Gemeinsam mit dem Rückzug der Gletscher wird dieser Anstieg der Permafrostgrenze für die zunehmende Häufigkeit von Naturkatastrophen verantwortlich gemacht. Muren, Steinschlag, Erdrutsche und Hochwasser werden durch ein wärmeres Klima in den Alpen stark begünstigt und bedrohen zunehmend auch bisher verschonte Alpenregionen. Die alpinen Ökosysteme können durch den Klimawandel zersplittert werden und einzelne Arten wären vom Aussterben bedroht. So zeigen sich besonders bei der Fichte erste Alarmzeichen für ein baldiges großflächiges Absterben. Das Einwandern und vermehrte Auftreten von Schädlingen, wie dem Buchdrucker, wird wahrscheinlicher. Die im Klimastress befindlichen Pflanzen werden dadurch zusätzlich gefährdet. Foto: Schretzmann, aid Quelle: Erwin Meyer, Hrsg. Greenpeace Österreich: Alpen im Treibhaus 8
9 Wild verbeißt häufig die jungen Waldbäume Foto: Hockenjos, DRW-Verlag Erosionsflächen: hier fehlt der schützende Baumbestand Foto: Schretzmann, aid Die Probleme des Schutzwalds im Einzelnen Viele Schutzwälder sind heute in einem problematischen Zustand. 1. Wildverbiss und Überalterung der Wälder Rot-Hirsche das so genannte Rotwild, besonders aber Gämsen und Rehe haben die zarten Triebe junger Bäumchen zum Fressen gern. Dabei werden junge Tannen und Laubbäume besonders stark verbissen. Das Wald-Wild-Problem ist in den letzten 100 Jahren immer größer geworden. Die Folgen: Rot-Buche, Weiß-Tanne, Berg-Ahorn und andere Baumarten des Bergmischwaldes können sich nicht mehr verjüngen. Oft überleben nur die jungen Fichten. Langfristig entstehen dann auch dort reine Fichtenwälder, wo von Natur aus Mischwälder wachsen würden. Diese Fichtenwälder sind häufig einschichtig, das heißt die Bäume sind alle etwa gleich alt, es fehlen jüngere Bäume, die für den zukünftigen Waldaufbau aber dringend benötigt werden. ( ) Zusammenfassend ist festzustellen, dass Wild der Hauptverursacher für die Entmischung der Waldverjüngung im Bergmischwald ist. Die Tanne ist am stärksten vom Wildverbiss betroffen. Sie ist verbissempfindlicher als der Ahorn, der ebenfalls stark unter Verbiss leidet, aber die Verbissschäden oftmals ausheilen kann. Das Weidevieh verschmäht die Nadelbaumverjüngung und verbeißt ausschließlich Laubhölzer. Das Ausmaß der Verbissschäden des Weideviehs ist jedoch erheblich geringer als das des Wildes. Allerdings verursacht das Weidevieh erhebliche Trittschäden an allen Baumarten und am Boden. Der Viehtritt führt zu einer erhöhten Lagerungsdichte des Bodens und einer verminderten Wasserinfiltrationsrate. Eine Begrenzung der Weiderechte und eine Reduzierung der Schalenwildbestände sind unbedingt notwendig für die Erhaltung der Schutzfunktionen des Bergwaldes. ( ) Quelle: Hany El Kateb, Marco Michael Stolz, Reinhard Mosandl: Der Einfluss von Wild und Weidevieh auf die Verjüngung im Bergmischwald in LWF Waldforschung aktuell Nr. 71 Bergwälder Schwerer Stand für stämmige Typen Der Bergschutzwald überaltert zunehmend und beginnt sich aufzulösen. Dieser Prozess ist lange kaum zu erkennen, denn er dauert oft mehrere Jahrzehnte. Sterben aber die Altbäume zum Beispiel wegen Borkenkäferfraß ab, dann löst sich der Waldbestand in sehr kurzer Zeit auf. Fehlen junge Bäume, dann entstehen Lücken, die schnell größer werden: Der Bergschutzwald verliert seine Schutzwirkung. Die Konsequenzen sind dann Lawinen, Murgänge oder Erosionsanrisse
10 2. Schadstoffe Besonders im Bergwald sind die Schädigungen der Baumkronen durch Luftschadstoffe (in den Bergbereichen ganz besonders durch bodennahes Ozon) in den letzten drei Jahrzehnten sehr stark gewesen. Die Baumkronen haben viele ihrer Blätter und Nadeln verloren zum Teil sind auch Bäume abgestorben. Die Folgen: Viele Schutzwälder sind verlichtet und weisen heute Lücken (Blößen) auf. Dort, wo die Hänge besonders steil sind, beginnt auf diesen Flächen die Erosion, das heißt der Boden wird durch Schnee und Regen weggerissen. Mit der Zeit können daraus große Rutschungsflächen entstehen. 3. Klimaveränderung Die Folgen: Höhere Temperaturen: Dadurch können zwar viele Baumarten (auch Laubbäume) in höheren Lagen wachsen als bisher, gleichzeitig entsteht aber auch mehr Trockenheitsstress in Trockenperioden, vor allem im Sommer. Das wird speziell für die Fichte ein immer größeres Problem. Immer mehr Baumschädlinge: Die höheren Temperaturen begünstigen viele Schädlinge, zum Beispiel einige Borkenkäfer-Arten wie der Buchdrucker. Sie können ihren Lebensraum erweitern und sich massenhaft vermehren. Sie nutzen dazu geschwächte Bäume oder frisch geworfenes Sturmholz und breiten sich von hier über große Flächen aus. Aber auch Tierarten, die bisher in der Region gar nicht zu finden sind, könnten sich ansiedeln und sich zu Schädlingen entwickeln, wenn sich das Klima weiter erwärmt. Besonders heftige Niederschläge (Unwetter): Dadurch steigt das Risiko von Bodenrutschungen und Murgängen, besonders an steilen Hängen; auch größere Lücken im Schutzwald können davon betroffen sein. Stärkere Stürme: Sturmkatastrophen haben schon in den letzten Jahren immer häufiger zu Zerstörungen in den Wäldern geführt. Ganze Hänge haben dadurch ihren alten Wald verloren. Die Bäume werden vom Wind umgedrückt ( Sturmwurf ) oder abgerissen ( Sturmbruch ). Dort, wo keine Naturverjüngung vorhanden ist, fehlt nun der Nachwuchs für die nächste Waldgeneration; er muss unter schwierigen Bedingungen gepflanzt werden. Borkenkäfer führen auch im Gebirge immer mehr zum Absterben von Bäumen ( ) Wussten Sie schon, dass derzeit die Bäume im Hochgebirge im Durchschnitt doppelt so alt sind wie im bayerischen Flachland? Wegen der extremen klimatischen Bedingungen im Hochgebirge wachsen die Bäume in den Alpen wesentlich langsamer als im Flachland. Das Durchschnittsalter der Bäume im Schutzwald liegt dabei mit knapp 120 Jahren fast doppelt so hoch wie im Flachland. Damit besteht heute zwar noch keine großflächige Überalterung, mit der Gefahr dass ganze Bestände großflächig zusammenbrechen. Aber bereits jetzt sterben in Altbeständen vermehrt Einzelbäume ab. Dies führt zu einer allmählichen Verlichtung wegen der Durchlöcherung des Kronendachs. Deshalb muss in den älteren Beständen die Verjüngung eingeleitet und gefördert werden, um die Schutzfunktion der Bestände langfristig zu sichern.( ) Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: Die Altersstruktur des Schutzwaldes in: 3 (Klickpunkt: Zustand) Foto: Schretzmann, aid
11 Lösungsansätze Pflege und Sanierung von Schutzwäldern Nur intakte Bergwälder können dauerhaft die vielfältigen Schutzfunktionen gewährleisten. Stufig aufgebaute Mischwälder mit jungen Bäumen für die nächste Waldgeneration bieten die größte Sicherheit, dass auch bei Störungen die Schutzwirkung weiter erhalten bleibt. Diesen Zustand zu erhalten oder zu verbessern, ist Aufgabe der Schutzwaldpflege. Dort, wo lückige, überalterte Bergwälder die Schutzfunktionen nicht mehr erfüllen, muss aktiv eingegriffen werden. In Bayern sind beispielsweise knapp Hektar der alpinen Schutzwälder dringend sanierungsbedürftig (ca. 9 % des Schutzwaldes), davon knapp Hektar vordringlich. Hier sind Maßnahmen, die die Schutzfähigkeit wiederherstellen das heißt: den Wald sanieren besonders wichtig. Sie sind aber nur erfolgreich, wenn sie koordiniert durchgeführt werden: Der Schutzwald braucht ein eigenständiges Management. Konkrete Maßnahmen Vor jeder Schutzwaldsanierung muss genau geprüft werden, welche Schadensursachen und Risiken konkret vorliegen, zum Beispiel die Erosionsgefährdung (Hanglabilität). Daraus ergeben sich die Lösungsansätze und möglichen Abhilfen. Das können beispielsweise sein: Wildmanagement, das heißt Verringerung des Verbissdrucks. Eine geringe Verbissbelastung ist in der Regel eine zwingende Voraussetzung für das Gelingen der Schutzwaldsanierung. Nur dann überleben die jungen Bäume die ersten Jahre und haben die Chance, den Schutzwald von Morgen zu bilden. Pflanzung von Bäumen für die nächste Waldgeneration, die von Natur aus vor Ort vorkommen würden. Dazu gehören Weiß-Tannen und Laubbäume (Buche, Berg-Ahorn, Eberesche u. a.), um dauerhaft einen stabilen, mehrstufigen Mischwald zu entwickeln, der auch bei einer weiteren Klimaerwärmung überleben kann. Förderung der natürlichen Keimung von Baumsamen (Naturverjüngung) und Schutz von gepflanzten Bäumchen; dazu gehört zum Beispiel: - Fällen einzelner Bäume leicht schräg zum Hang: Diese Querleger verhindern zerstörerische Schneebewegungen. Sie schützen so die kleinen Bäumchen und bieten Baumsamen außerdem besonders geeignete Plätze zur Keimung. - Dort, wo schon größere Lücken entstanden sind, ist unter Umständen außer der Pflanzung von Bäumen eine technische Verbauung notwendig. Das sind Holzkonstruktionen, die fest im Boden verankert werden und die die kleinen Bäume davor schützen, von abrutschendem Schnee ausgerissen zu werden. Wenn schon Boden-Erosion eingetreten ist oder im Winter Lawinen abgehen, muss durch umfangreiche technische und biologische Hilfen das weitere Abreißen von Boden und Gestein verhindert werden. Dauerhafte technische Maßnahmen sind dort erforderlich, wo der Schutzwald sich erst über längere Zeit hinweg wieder entwickeln kann oder wo er nicht Fuß fassen kann. Hier muss der technische Schutz die Aufgaben des Schutzwaldes übernehmen. Diese Maßnahmen sind allerdings außerordentlich teuer und bieten auch nicht immer den absoluten Schutz. Foto: Stahuber, LWF
12 1 Folie zu Arbeitsblatt 1 Aufgaben des Schutzwalds im Gebirge Selbst extreme Steilhänge werden durch Wälder stabilisiert, der Boden wird von den Baumwurzeln festgehalten, Steinschlag wird durch die Bäume abgebremst. Der Schnee zwischen den Bäumen rutscht weniger leicht ab als auf unbewaldeten Flächen. Lawinen entstehen daher nur selten an bewaldeten Hängen. Besonders tiefbekronte Nadelbäume können große Mengen an Schnee festhalten. Die Schutzwälder verringern auch bei sehr starkem Regen die Abflussgeschwindigkeit des Niederschlagswassers und führen zu einem gleichmäßigeren Wasserabfluss. Sie verringern so das Hochwasserrisiko für die Siedlungen in den Gebirgstälern. Siedlungen in den Gebirgstälern werden durch die Wälder auch unmittelbar geschützt gegen Lawinen, Muren. Bilder: Schretzmann, aid
13 Arbeitsblatt 1 1 Beantwortet die Fragen und bereitet eine stichwortartige Zusammenstellung zu jeder Schutzaufgabe für ein Expertengespräch vor. Welche Aufgaben hat der Schutzwald in den bayerischen Alpen? 1. Welche Bedeutung hat der Schutzwald für das Ökosystem? 2. Welche Bedeutung hat der Schutzwald für die Menschen? Nutzt dazu auch folgende Materialien zu den Aufgaben des Schutzwaldes: 1. Bergwald schützt vor Erosion, Lawinen und Hochwasser 60 % des Bergwaldes erfüllen vorrangige Schutzfunktionen und sind durch das Waldgesetz für Bayern (BayWaldG) besonders geschützt. Die Erhaltung von Bergwald als intakte Schutzwälder bzw. deren Wiederherstellung ist daher eine forstpolitische und gesellschaftspolitische Aufgabe von hohem Rang. Dazu ist es notwendig, Bergwald zu pflegen und zu bewirtschaften. Mit rund km² nehmen die Alpen in Bayern etwa 7,5 % der Landesfläche ein. Mehr als 5 Millionen Gäste besuchen jährlich diese Region - mit steigender Tendenz. Allein der Fremdenverkehr sichert etwa Arbeitsplätze. Insgesamt leben und arbeiten etwa Menschen im bayerischen Alpenraum. Bezogen auf die tatsächlich bewohnbare Fläche (rund 20 % der Gesamtfläche) entspricht dies der Bevölkerungsdichte von Ballungsgebieten. Der Bergwald ist ein traditionell wichtiger Wirtschaftsfaktor als Lieferant des umweltfreundlichen nachwachsenden Rohstoffs Holz. Er wird außerdem in großem Umfang für Erholungszwecke in Anspruch genommen. Auf den folgenden Seiten können Sie nähere Informationen über die Funktionen des Bergwaldes in den Bayerischen Alpen erhalten. Sie erfahren etwas über seinen aktuellen Altersund Gesundheitszustand und wir zeigen Ihnen, was wir, die Bayerische Forstverwaltung, für die Sanierung des Bergwaldes tun. Die vielfältigen Schutzfunktionen der Gebirgswälder wurden von der Bayerischen Staatsforstverwaltung im Rahmen der Waldfunktionsplanung erfasst und in Karten dargestellt. In den Regionen Allgäu, Oberland und Südostbayern haben 40 % der Waldfläche besondere Bedeutung für den Bodenschutz; 22 % der Waldfläche besondere Bedeutung für den Lawinenschutz; 46 % der Waldfläche sind Wasserschutzwald verschiedener Intensitätsstufen. Viele Waldflächen erfüllen sogar mehrere dieser Funktionen gleichzeitig. Gerade im Lawinenwinter 1989/99 hat sich klar gezeigt: Der Schutzwald ist ein nachhaltiges, kostengünstiges Schutzsystem. Technik kann dieses System in Einzelfällen ergänzen aber niemals ersetzen. Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: Bergwald schützt vor Erosion, Lawinen und Hochwasser 3
14 1 2. Boden-Erosionsschutz Wälder festigen durch ihre intensive und tiefe Durchwurzelung den Boden und verhindern oder dämpfen zumindest Hangrutschungen und andere Erosionsvorgänge. Mischwälder mit einem hohen Tannen- und Laubbaumanteil können diese Bodenschutzfunktion besonders gut erfüllen. Fehlt das schützende Waldkleid, so hat dies neben der lokalen Gefährdung von Siedlungen, Verkehrswegen und Wiesen & Weiden auch einen erheblichen Einfluss auf die Stabilität des Gesamtökosystems. Ohne die bodenbildende und bodenhaltende Kraft des Waldes wären unsere Berge auf weiten Flächen blanker Fels und Schutt. Eine besondere Art des Bodenschutzes erfüllen die Steinschlagschutzwälder. Sie halten abrollende Steine und Felsbrocken zurück und gewährleisten so das gefahrlose Befahren der Alpenstraßen. Insbesondere Wälder mit einem hohen Laubholzanteil und einem dichtem Unterholz aus jungen Bäumen und Sträuchern können den Steinschlag am besten zurückhalten Hektar Wald, das sind 40% des gesamten Bergwaldes, haben ganz besondere Bedeutung für den Erosionsschutz. Sie wurden daher in der Waldfunktionsplanung als Bodenschutzwald ausgewiesen. Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: Bergwald schützt vor Erosion, Lawinen und Hochwasser Lawinenschutz In der Waldfunktionsplanung wurde knapp ein Viertel des Bergwaldes in den bayerischen Alpen, das sind Hektar, als besonders wichtig für den Lawinenschutz ausgewiesen. Aber, wie kann der Bergwald eigentlich Lawinen verhindern oder mildern? In nadelholzreichen Wäldern wird ein großer Teil des Schnees im Kronendach zurückgehalten. Von dort verdunstet er zum Teil wieder, zum Teil fällt er verzögert und schubweise auf den Boden. Die Schneedecke wird so lokal zusammengepresst und stabilisiert. Mit steigendem Laubbaum- oder Lärchenanteil geht dieser Effekt zurück, da die im Winter kahlen Bäume den Schnee kaum auffangen können. Im Wald bläst der Wind weniger stark als auf Freiflächen. Der abgelagerte Schnee wird daher kaum verlagert und es kommt seltener zu mächtigen und gleichförmigen Schneeansammlungen. Das im Vergleich zur Freifläche örtlich stark differenzierte, insgesamt deutlich ausgeglichenere Waldklima verhindert, dass sich großflächige labile Schichten in der Schneedecke ( Schwimmschnee ) bilden. Im Anrissgebiet von Lawinen wird die Schneedecke durch eine dichte, gleichmäßig verteilte Bestockung festgehalten. Nur geschlossene Wälder mit einer unregelmäßigen und ungleichartigen Struktur können den Lawinenschutz voll gewährleisten. Daher hat die ungestörte Entwicklung der Verjüngung entscheidende Bedeutung. Aber: Über der Waldgrenze abbrechende Lawinen kann selbst ein intakter Schutzwald meist nicht auffangen. In den Wald eindringende Fließlawinen können Bäume bis
15 1 etwa 30 cm Durchmesser, Staublawinen sogar Bäume bis über 60 cm Durchmesser brechen. Durch das mitgeführte Holz erhöht sich sogar die Gewalt und Zerstörungskraft. Die Schutzwirkung des Waldes liegt deshalb vorwiegend in seiner Fähigkeit, das Abgehen von Lawinen innerhalb des Waldes zu verhindern. Lawinen, die Siedlungsräume oder wichtige Verkehrswege gefährden, sind im Lawinenkataster der Bayerischen Alpen des Bayerischen Landesamtes für Wasserwirtschaft erfasst. Er enthält mehr als 700 Lawinenstriche. Über die Hälfte der erfassten Lawinen bedrohen unmittelbar Verkehrswege. Ungefähr ein Fünftel der bekannten Lawinen gefährden Bundes- oder Staatsstraßen. Gebäude oder Siedlungsbereiche werden nur relativ selten, das heißt nur in extremen Lawinenwintern, von den Schneemassen erreicht. 22 % der im Kataster eingetragenen Lawinenstriche sind derzeit durch technische Maßnahmen gesichert. Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: Bergwald schützt vor Erosion, Lawinen und Hochwasser Wasserschutz Gut drei Viertel der Bergwaldfläche ist für den Wasserschutz von ganz besonderer Bedeutung Hektar dieser insgesamt Hektar liegen sogar in ausgewiesenen Wasserschutzgebieten. Der Wald schützt das Wasser; er reinigt als natürlicher Filter die versickernden Niederschläge und sorgt so für reines Quell- und Grundwasser. Außerdem beeinflusst der Bergwald das Abflussgeschehen. Die Baumkronen fangen bis zu 15 % des jährlichen Niederschlages auf und lassen ihn nicht auf den Boden dringen. Darüber hinaus nehmen die Bäume Wasser über die Wurzeln auf und verdunsten sie wieder über ihre Nadeln bzw. Blätter. Auch hierdurch kommt es zu einer deutlichen Verminderung des Oberflächenabflusses. Versuche haben nachgewiesen, daß der Wasserabfluss aus einem waldfreien Gebirgshang nach Starkregen deutlich höher ist als aus dem schützenden Wald. Zusätzlich kann der von den Wurzeln durchzogene Waldboden ähnlich wie ein Schwamm große Niederschlagsmengen speichern, die dann erst mit einer zeitlichen Verzögerung abgegeben werden. Der Wald wirkt so ausgleichend auf den Wasserabfluss und die Erosionskraft des Wassers wird gebremst. Besonders bei sommerlichen Starkregenfällen und zur Zeit der Schneeschmelze werden die Abflussspitzen der Wildbäche und Flüsse gemildert und die Gefahr von Überschwemmungen vermindert. Dieser positive Effekt des Bergwaldes wirkt weit ins Alpenvorland hinaus. Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: Bergwald schützt vor Erosion, Lawinen und Hochwasser 3 Foto: Schretzmann, aid
16 2 Folie zu Arbeitsblatt 2 Risiken des Klimawandels im Bergwald Besonders gefährdet sind die baumfreien Bereiche von Steilhängen, in denen die alten Bäume abgestorben sind und junge Bäumchen durch die Schneelast im Winter hangabwärts umgedrückt und herausgerissen werden. Durch zunehmende Extremniederschläge sind auch weniger steile Hänge durch Erosion gefährdet, vor allem auf baumfreien Flächen. Verhau von umgestürzten Bäumen als Ergebnis des Orkans Kyrill. Die Gefahr von Orkanen mit immer höheren Windgeschwindigkeiten nimmt zu. Fichten, die nach Borkenkäferbefall abgestorben sind. Mit zunehmenden Temperaturen können Borkenkäfer auch in höhere Bergregionen vordringen, die bisher für sie zu kalt waren. Bilder von links: Schretzmann, aid; Binder, LWF Bayern, Schretzmann, aid (2)
17 Arbeitsblatt 2 2 Aufgabe 1 Wie wirkt sich der Klimawandel in den Alpen bereits heute aus? Aufgabe 2 Welche weiteren Folgen erwarten die Wissenschaftler für die Zukunft? Foto: Stahuber, LWF
18 3 Folie zu Arbeitsblatt 3 Berg-Ahorn Buche Fichte Weiß-Tanne Die Klimahüllen der Baumarten (d.h. die Farbflächen) zeigen, welche Niederschlags- und Temperaturbedingungen (bezogen auf mittlere Jahrestemperatur und mittlere Jahresniederschlagsmenge) innerhalb des natürlichen Verbreitungsgebiets dieser Baumarten in Mitteleuropa zu finden sind. Die blau gepunkteten Flächen zeigen die aktuelle Klimahülle von Bayern. Orte mit einer Temperatur-Niederschlags-Kombination, die innerhalb der Klimahülle Bayerns liegt, findet man mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwo in Bayern. Die rot umrandete Fläche beschreibt die veränderte Klimahülle Bayerns für ein Szenario mit einer Zunahme der Durchschnittstemperatur um 1,8 Grad Celsius bis zum Jahr 2100 (WETTREG B1). Quelle: Kölling, Ch., Klimahüllen für 27 Waldbaumarten,
19 Arbeitsblatt 3 3 Aufgabe 1 Beschreibt die Verteilung der Baumarten im Schutzwald in den bayerischen Alpen (2007). Was fällt euch auf? Baumartenverteilung im Schutzwald (heute) Edellaubholz Buche Fichte Tanne Kiefer / Lärche Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: Zustand des Bergwaldes Aufgabe 2 a) Was zeigen die Klimahüllen? b) Betrachtet die Klimahüllen von Berg-Ahorn, Buche, Fichte und Weiß-Tanne: Welche Baumart ist angesichts der sich verändernden Klimabedingungen besonders gefährdet? Woran ist das zu erkennen? c) Was bedeutet das für den Bergwald? Vergleicht dazu eure Ergebnisse aus Aufgabe 1.
20 Klimahüllen für Berg-Ahorn und Buche 3 Quelle: Kölling, Ch., Klimahüllen für 27 Waldbaumarten, 3
21 Klimahüllen für Fichte und Weiß-Tanne 3 Quelle: Kölling, Ch., Klimahüllen für 27 Waldbaumarten, 3
22 4 Folie zu Arbeitsblatt 4 6 Schutzmaßnahmen für junge Bäume, um zu verhindern, dass die jungen Bäumchen durch die Schneelast im Winter hangabwärts umgedrückt und herausgerissen werden. Die Dreibeinböcke (im Vordergrund links) und Schnee-Rechen verhindern das Abrutschen von Schnee (Schneegleiten) und die Entstehung von Lawinen. Sie schützen die jungen Bäume, damit sie in den nächsten 30 bis 50 Jahren zu einem geschlossenen Schutzwald heranwachsen können. Oberhalb der Schwarzbachwacht- Straße (Deutsche Alpenstraße bei Berchtesgaden) zerstörte der Orkan Kyrill großflächig die Wälder, die bislang einen natürlichen Schutz für den Verkehr gebildet hatten. Hier wurden umfangreiche technische Maßnahmen zum Schutz gegen Steinschlag erforderlich. Die Straße musste etwa ein halbes Jahr gesperrt werden. Die Folgen treffen auch den Tourismus und die Erholungsuchenden. Die Baustellen in den Steilhängen sind für Waldbesucher gefährlich. Wanderwege müssen deshalb zeitweilig gesperrt werden. Bilder von links: Dimke, LWF; Stahuber, LWF; Schretzmann, aid; Stahuber, LWF
23 Arbeitsblatt 4 4 Beantwortet die Fragen und bereitet eine Präsentation der Ergebnisse vor. Nutzt dazu die Informationen des Hintergrundtextes (Seite 7 10). 1. Mit welchen Problemen hat der Schutzwald zu kämpfen? 2. Welche Probleme ergeben sich daraus für den Bergwald? Foto: Stahuber, LWF
24 Arbeitsblatt 5 5 Beantwortet die Fragen und bereitet eine Präsentation der Ergebnisse vor. 1. Warum ist eine Schutzwald-Sanierung in den bayerischen Alpen notwendig? 2. Womit ist zu rechnen, wenn der Schutzwald nicht mehr schützt? Nutzt dazu auch folgende Materialien: Die Investitionen in den Schutzwald sind die günstigsten und effektivsten Maßnahmen, um Hochwasserschäden zu vermeiden bzw. verringern. Intakte Bergmischwälder in den bayerischen Alpen können den Wasserabfluss deutlich vermindern und dadurch Hochwassersituationen deutlich entschärfen. Dies ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass der Alpenraum bewohnbar und für den Tourismus als bedeutender Wirtschaftsfaktor attraktiv bleibt. Auch in den Allgäuer Gebirgstälern gab es in den vergangenen Jahren Bilder der Zerstörung mit Millionenschweren Schäden. Der technische Hochwasserschutz stößt immer mehr an seine Grenzen. Wesentlich kostengünstiger und effektiver dagegen ist es, die Niederschläge möglichst lange dort zurückzuhalten, wo sie auf den Boden fallen. Dazu ist ein intakter, naturnaher Bergwald unerlässlich, weil er wie keine andere Landnutzungsform den Boden festhält und Niederschläge zurückhält. Doch mittlerweile können große Teile der Schutzwälder ihre Funktion nicht mehr erfüllen. Über ha Schutzwälder sind in Bayern sogar so geschädigt, dass sie aufwändig saniert werden müssen. Die Kosten sind, je nachdem wie intensiv der Bergwald mit Holz-, Stahl oder Betonbauwerke verbaut und gesichert werden muss, immens hoch und können bis zu pro Hektar Sanierungsfläche erreichen. Diese Verbauungen werden notwendig, wenn der Bergwald seine unerlässlichen Schutzfunktionen, wie den Hochwasserschutz oder den Schutz der Tallagen vor Lawinen und Steinschlag, durch ausbleibende Verjüngung und Überalterung nicht mehr erfüllen kann. Im Schutze der Verbauungen werden junge Bäumchen gepflanzt, die über einen sehr langen Zeitraum von Jahren Schutz vor Schneedruck und vor allem vor Wildverbiss brauchen. Erst wenn sie diesen langen Zeitraum überleben, ist der nachwachsende Bergwald in der nächsten Generation gesichert. Entscheidende Voraussetzung, damit die Investitionen in Schutzwaldsanierung und pflege greifen, ist die konsequente Umsetzung des Grundsatzes Wald vor Wild. Angesichts des Klimawandels und des vielerorts zu hohen Wildverbisses droht uns die Zeit davon zu laufen und noch mehr Schutzwälder ihre Schutzfunktion zu verlieren, so Hubert Weiger. Dann drohen immense Schäden und Milliarden schwere Folgekosten für den Steuerzahler, wenn man die Sanierungskosten von bis zu pro Hektar auf die Hektar Schutzwälder in den bayerischen Alpen hochrechnet. Quelle: Ralf Straußberger, Bund Naturschutz Bayern: Hochwasserschutz beginnt im Bergwald 3 Nutzt ergänzend auch die folgende Internetquelle: 3
25 Arbeitsblatt 6 6 Beantwortet die Fragen und bereitet eine Präsentation der Ergebnisse vor. 1. Welche Maßnahmen zur Sanierung der Schutzwälder wurden getroffen? 2. Wie erfolgreich sind diese Maßnahmen? Nutzt dazu auch folgende Materialien: Schutzwaldsanierung: Notfallhilfe für besonders gefährdete Bereiche Ausgehend vom Bergwaldbeschluss des Bayerischen Landtages von 1985 wurden die Schutzwälder gründlich analysiert. Dabei zeigte sich, dass insgesamt rd. 10 % der Schutzwälder im bayerischen Hochgebirge ihre Schutzfunktion nur noch bedingt erfüllen (siehe Tab. 1). Zur Wiederherstellung der Schutzwirkung wurde daher ein Schutzwaldsanierungsprogramm eingeleitet. Dieses zielt auf die Sicherung und Wiederherstellung der Schutzfunktion der Bergwälder in Bereichen, in denen der Zustand des Schutzwaldes gefährdet ist und die Sicherung der Schutzfunktion im Rahmen der regulären Waldpflege nicht oder nur eingeschränkt möglich ist. Der Schwerpunkt liegt bei biologischen Maßnahmen. So wurden bisher fast 10 Mio. herkunftsgerechte Pflanzen bevorzugt auf Sanierungsflächen mit Objektschutz ausgebracht. Um die Waldverjüngung vor Schäden durch Gleitschnee und Lawinen zu schützen, werden soweit notwendig, temporäre Verbauungen aus Holz errichtet. Wichtiger Bestandteil dieses Programms ist es, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass sich Wälder natürlich regenerieren können. Dazu gehören insbesondere die Trennung von Wald und Weide sowie die Anpassung der Schalenwildbestände. Für die Sanierung der Schutzwälder wurden seit 1986 rund 45 Mio. ausgegeben. Anzahl Gesamt Anzahl vordringlich Fläche (ha) gesamt Fläche (ha) vordringlich Sanierungsgebiete Sanierungsflächen Gefährdungsgebiete Die routinemäßigen Erfolgskontrollen aller Flächen zeigen, dass das Programm insgesamt erfolgreich ist. Auf rund 60 % der Flächen wächst wieder Schutzwald nach, teilweise mit Einschränkungen bei der Baumartenzusammensetzung. Lediglich auf 10 % der Flächen misslang die Sanierung bisher, insbesondere in den Anfangsjahren des Programms. Hauptgründe für Rückschläge waren anfängliche Fehleinschätzungen der zum Teil sehr schwierigen und extremen Standortsbedingungen auf den Sanierungsflächen sowie starke Verbissschäden durch Schalenwild Quelle: Franz Brosinger u. Andreas Rothe: Intakter Bergwald unverzichtbar für den Hochwasserschutz in Bayern. Berichte aus der LWF, Nr. 40 (2003); 3
26 6 Die Definitionen zur Tabelle Sanierungsgebiete sind großräumige Bereiche (z.b. Bergflanken, Hänge über Ortschaften und Straßen, Wildbacheinzugsgebiete), in denen auf Teilflächen - den Sanierungsflächen - Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind. Darüber hinaus wurden in Regionen ohne akuten Sanierungsbedarf rund 50 Gefährdungsgebiete mit einer Gesamtfläche von rund Hektar ausgewiesen. Sanierungsflächen sind sanierungsnotwendige Schutzwaldbestände oder Aufforstungsbereiche. Gefährdungsgebiete Foto: Schretzmann, aid sind Bereiche mit hoher Schutzbedeutung des Waldes für Ortschaften und Infrastruktureinrichtungen, in denen derzeit noch keine forstlichen Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind. Negative Entwicklungen müssen hier unter allen Umständen vermieden werden. Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: Schutzwaldsanierung: Notfallhilfe für besonders gefährdete Bereiche 3 (Klickpunkt: Schutzwaldsanierung)
27 Weiterführende Links Zum Bergwald und seinen Schutzfunktionen Bergwald ist Schutzwald Wald für Schutz im Klimawandel, Hrsg. Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Franz Binder: Naturgefahren auf dem Vormarsch Franz Brosinger u. Andreas Rothe: Intakter Bergwald unverzichtbar für den Hochwasserschutz in Bayern, Berichte aus der LWF, 40/2003; Bergwälder schwerer Stand für stämmige Typen, LWF Waldforschung aktuell, 4/ Zur Schutzwaldsanierung Harald Siegler, Fachstelle Schutzwaldmanagement Marquartstein, AELF Rosenheim: Schutzwaldsanierung Schossrinn-Alm Franz Binder, Rainer Blaschke, LWF Bayern Integrale Schutzwaldplanung in : Bergwälder schwerer Stand für stämmige Typen, LWF aktuell, Bd. 71, S. 28 ff. Bergwaldprojekt Erhaltung, Pflege und Schutz des Waldes und der Kulturlandschaft im Berggebiet Zum Klimawandel in den Alpen Klimawandel in den Alpen. Fakten Folgen Anpassung, hrsg. v. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) Die Alpen unter Druck. Vorbeugung und Anpassung der alpinen Schutzgebiete an den Klimawandel, hg v. ALPARC Netzwerk Alpiner Schutzgebiete Zeitschriftenartikel Alpen könnten im Jahr 2100 eisfrei sein Das Matterhorn bröckelt matterhorn/klima_aid_23306.html Pflanzen weichen Hitze aus klimawandel-pflanzen-weichen-hitze-aus_aid_ html 27
28 Lösungsansätze 1 Arbeitsblatt 1 Stichworte für das Expertengespräch: 1. Der Bergwald hat eine Vielzahl von Aufgaben: Holzlieferant (Holz ist ein wichtiger, nachhaltig produzierter Rohstoff) und Arbeitsplatz für alle die mit der Nutzung des Waldes beschäftigt sind Wichtiger Erholungsbereich für den Fremdenverkehr (5 Millionen Gäste pro Jahr) Die bayerischen Alpen haben eine Gesamtfläche von km 2. Davon sind etwa km 2 (= Hektar) Wald. 60 % der Bergwälder in den bayerischen Alpen haben Schutzaufgaben: Bodenschutzwald, Lawinenschutzwald und Wasserschutzwald. Viele Bergwälder erfüllen gleichzeitig mehrere Schutzaufgaben 2. Bodenerosionsschutz: Intensive Durchwurzelung des Bodens verhindert oder dämpft Erosion und Abrutschen des Bodens. Dazu gehören auch Erdrutsche und Murgänge (Muren). Besonders günstig für die Durchwurzelung sind Bergmischwälder mit hohem Tannen- und Laubbaumanteil. Ein wichtiger Aspekt für den Straßenverkehr ist der Schutz gegen Steinschlag; Bäume halten Steine und Felsbrocken zurück; hierfür besonders geeignet sind Laubwälder mit dichtem Unterholz Ca Hektar (40 %) Bergwald in den bayerischen Alpen sind Bodenschutzwald. 3. Lawinenschutz Der Schnee wird von den Bäumen festgehalten. Die Wälder verhindern so die Entstehung von Lawinen in der Bergwaldzone. Besonders Nadelbäume können Schnee in der Baumkrone festhalten. Laubbäume sind im Winter kahl und haben daher einen geringeren Effekt. Günstig sind Bergmischwälder mit vielfältigen Strukturen (Alter und Baumartenzusammensetzung. Lawinen, die oberhalb der Waldgrenze entstehen, können von den Bergwäldern allerdings nicht verhindert und meistens auch nicht aufgehalten werden. Besonders Staublawinen (=Lockerschnee-Lawinen) haben eine enorme Zerstörungswirkung auch im Bergwald. Etwa Hektar Bergwald in den bayerischen Alpen sind Lawinenschutzwald Lösungsansätze Aufgabe 1: Holzlieferant, Erholungsbereich, Schutz vor Steinschlag, Arbeitsplatz
29 4. Wasserschutz Der Bergwald reinigt (wie alle Wälder) das Niederschlagswasser wie ein natürlicher Filter Bäume halten Wasser schon in den Baumkronen fest; ein Teil des Niederschlags gelangt so gar nicht auf den Boden, sondern wird als Wasserdampf an die Atmosphäre zurückgegeben. Der Bergwald beeinflusst die Versickerung des Niederschlagswassers; Regen wird vom Waldboden wie von einem Schwamm aufgesogen; dadurch wird das Regenwasser festgehalten und fließt langsamer ab Dadurch wird die Hochwassergefahr bei Starkregen, besonders im Sommer, aber auch während der Schneeschmelze verringert. Arbeitsblatt 2 Aufgabe 1 Anzeichen des Klimawandels sind in den Alpen deutlich erkennbar: die Gletscher schmelzen ab die Permafrostgrenze hat sich in den letzten 100 Jahren um 150 bis 200 m nach oben verschoben. Die Folgen: zunehmende Häufigkeit von Naturkatastrophen, 2 Muren, Steinschlag, Erdrutsche und Hochwasser werden stark begünstigt, alpine Ökosysteme können zersplittert werden, einzelne Arten sind vom Aussterben bedroht, Einwandern und vermehrtes Auftreten von Schädlingen, wie dem Buchdrucker, wird wahrscheinlicher Aufgabe 2 Einige Wissenschaftler rechnen damit, dass die Alpen im Jahr 2100 eisfrei sein könnten. Das Abtauen von Permafrost insbesondere in den Sommermonaten kann ganze Berghänge destabilisieren und zu schweren Gerölllawinen bzw. Steinschlägen führen. Auf die Tiere und Pflanzen wirken sich die Veränderungen natürlich auch aus, die Lebensbereiche zahlreicher Pflanzen werden sich weiter nach oben verschieben. Kälteliebende Tier- und Pflanzenarten können dadurch ihren Lebensraum verlieren und immer mehr verschwinden, unter Umständen sogar aussterben.
30 Arbeitsblatt 3 3 Aufgabe 1 In den Alpen dominiert in den Bergwäldern die Fichte. In den Hochlagen bildet sie natürliche Fichtenwälder, in den mittleren, oft besonders steilen Lagen dominiert sie jedoch häufig auf Kosten von Tanne, Buche und Bergahorn, nicht zuletzt aufgrund von Wildverbiss, der besonders Tanne und Laubbäume trifft. Die Fichte hat in den Schutzwäldern der bayerischen Alpen einen Anteil von etwa 55 Prozent. Aufgabe 2 a) Die Klimahüllen stellen das Klima bezogen auf die mittlere Jahrestemperatur und mittleren Jahresniederschlag in den bayerischen Wäldern dar. Dargestellt ist das gegenwärtige und zukünftige Klima. Zudem zeigen die Klimahüllen für je eine Baumart, unter welchen Klimabedingungen diese Baumart gedeiht. Vergleicht man die Klimahülle einer Baumart mit der Klimahülle der bayerischen Wälder (Zukunft), so sieht man, inwieweit die beiden Flächen zusammenpassen: Liegen beide Flächen übereinander, dann bestehen für den Baum grundsätzlich günstige Voraussetzungen. Überschneiden sich beide Flächen dagegen nur teilweise, dann hat es diese Baumart in vielen Gegenden sehr schwer. Dann ist es für den Baum eher zu warm, zu trocken, zu kalt oder gar zu feucht je nachdem, in welchem Bereich die Klimahüllen nicht zusammenpassen. b) Die Fichte, die bislang in den Hochlagenwäldern dominiert, wird bei einer Temperaturerhöhung von 1,8 Grad Celsius aus vielen Bergregionen verdrängt. c) Der Bergwald wird besonders stark durch die Klimaveränderung gefährdet. Die Fichte wird bei einer Temperaturerhöhung aus vielen Bergregionen verdrängt. Doch es gibt auch eine Chance für den Bergwald: Zukünftig werden besonders der Berg- Ahorn, die Buche und die Tanne günstigere Bedingungen vorfinden. Hinweis: Diese Veränderungen drücken sich durch die Verschiebung der Klimahülle Bayerns aus (rot umrandete Fläche): Die Bedingungen verschieben sich insgesamt, damit wird es auch in den kältesten Bergregionen wärmer das heißt: neue und bessere Chancen für Buche, Tanne und Berg-Ahorn in den Bergen. Sie können bei ansteigenden Temperaturen auch in Bergregionen vordringen, in denen bislang natürliche Fichtenwälder dominierten. Sie müssen daher schon heute gefördert werden. Foto: Stahuber, LWF
31 Arbeitsblatt Der Schutzwald hat mit verschiedenen Problemen zu kämpfen, die sich gegenseitig verstärken. Probleme: Wildverbiss, immer stärkere Stürme und verstärkter Schädlingsbefall nach Sturmschäden in den Wäldern und höhere Temperaturen, die für die Schädlinge günstig sind: Beispiel Borkenkäfer. Hoher Anteil von Fichten, die im bayerischen Gebirgsschutzwald knapp 55 Prozent der Bäume ausmachen. Fichte ist als Flachwurzler besonders für Sturmschäden anfällig und bei Trockenheitsstress im Sommer anfällig für Schädlinge. Das begünstigt die Borkenkäfer: Sie können sich in vom Sturm umgeworfenen Fichten massenhaft vermehren und dann auch stehende Fichten befallen. Durch die Klimaerwärmung sind sie auch in hohen Gebirgslagen im Bergwald aktiv und eine große Gefahr für die Fichte. Der Wildbestand gefährdet den Schutzwald: Besonders Rehe, aber auch Gämsen und Hirsche fressen die Triebe junger Bäume, vor allem von kleinen Tannen und Laubbäumen. 2. Die Schutzwälder verlieren ihre stabile Struktur, die Wälder werden anfällig für Störungen: Die Schutzwälder überaltern, es sterben immer wieder alte Bäume ab, es fehlt aber oft die neue Generation an Bäumen, die die Schutzaufgaben übernehmen könnten. Viele Schutzwälder verlichten dadurch, das heißt, es entstehen Lücken in den Wäldern, die in den Steilhängen besonders erosionsgefährdet sind: Hier wird der Boden durch heftige Niederschläge abgeschwemmt. Selbst wenn auf diesen offenen Flächen junge Bäume wachsen, werden sie oft vom Schnee umgedrückt. Durch Wildverbiss werden außerdem die jungen Laubbäumchen und Tannen beeinträchtigt, es entstehen dann reine Fichtenwälder, die besonders gefährdet sind durch Borkenkäfer und Stürme. Foto: Peter Meyer, aid
32 Arbeitsblatt Rund Hektar oder 9 Prozent der Schutzwälder in den bayerischen Alpen sind nicht mehr in der Lage, ihre Schutzfunktionen zu erfüllen. Dadurch entstehen Gefahren für das Ökosystem und für die Menschen, die von diesen Wäldern geschützt werden. Das betrifft besonders die Siedlungen und Verkehrswege in den Tälern. 2. Durch den Verlust der Schutzwirkung verstärken sich die Risiken durch Lawinen, durch Muren und durch Steinschlag, die nicht mehr von den Bäumen zurückgehalten werden. Besonders groß ist die Gefahr durch Überschwemmungen nach starken Regenfällen, da das Wasser nicht mehr von den Wurzeln der Bäume zurückgehalten wird. Durch starke Regenfälle wird zusätzlich auch der Boden abgeschwemmt. Dort, wo der Schutzwald sich auflöst, werden daher Bäume gepflanzt, um den Schutzwald wieder aufzubauen. In den Steilhängen ist dies sehr mühsam und teuer. Wenn die Regeneration des Schutzwaldes aber sehr lange dauert, müssen technische Baumaßnahmen diesen Schutz zumindest teilweise erhalten und die Regeneration des Waldes unterstützen. Diese technischen Baumaßnahmen sind außerordentlich teuer. Arbeitsblatt 6 1. Es wurde ein Schutzwaldsanierungsprogramm eingeleitet der Schwerpunkt liegt bei biologischen Maßnahmen, da der Bergwald die Schutzwirkung auf längere Sicht am besten gewährleisten kann. Dazu gehören verschiedene Maßnahmen: 6 Waldverjüngung: Fast 10 Mio. herkunftsgerechte Pflanzen wurden ausgebracht. Zu deren Schutz vor Schäden durch Gleitschnee und Lawinen wurden temporäre Verbau ungen aus Holz errichtet. Anpassung der Schalenwildbestände durch Jagd, * Trennung von Wald und Weide, ** Das Ziel dabei ist, nicht nur kurzfristig Abhilfe zu schaffen, sondern auch die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass sich Wälder natürlich regenerieren können. 2. Das Programm ist insgesamt erfolgreich. Auf rund 60 Prozent der Flächen wächst wieder Schutzwald nach, teilweise mit Einschränkungen bei der Baumartenzusammensetzung. Auf 10 Prozent der Flächen misslang allerdings die Sanierung bisher: anfängliche Fehleinschätzungen der zum Teil sehr schwierigen und extremen Standortsbedingungen und starke Verbissschäden durch Schalenwild. *damit die jungen Bäumchen, vor allem auch die Weiß-Tannen und Laubbäume eine Chance zum überleben bekommen. **um Verbiss-Schäden durch Weidetiere zu verhindern.
33 Stichworte zur Schlussdiskussion: 3 1) Was kann man tun, um den Schutzwald zu erhalten? Worauf muss die Forstwirtschaft beim Umbau der Berg- bzw. insbesondere der Schutzwälder besonders achten und welche Maßnahmen müssen ergriffen werden? Stichworte: Entwicklung von stufigen, möglichst gemischten Bergwäldern, dazu Schutz der Verjüngung gegen Wildverbiss und wenn nötig gegen Schneegleiten, Wildmanagement mit intensiver Jagd in gefährdeten Waldbereichen, Einbringen von Laubholz und Tanne, wo immer dies möglich ist) 2) Wer muss in die Problemlösung mit einbezogen werden? Stichworte: Jäger, Verkehrsplaner, Gemeinden, Touristikmanager 3) Ausblick: Was ist bei wesentlich stärkeren Temperaturzunahmen als den unterstellten 1,8 Grad Celsius zu berücksichtigen? Stichworte: Einbringen von wärmetoleranten bzw. trockenheitsertragenden Baumarten in den Bergmischwald wie z.b. Eichen, Linden, Hainbuchen auf wärmeren Standorten. Foto: Schretzmann, aid
34 aid-medientipps Verantwortung für Generationen Der Wald und seine nachwachsenden Rohstoffe sind heute wichtiger denn je. Doch Schädlingsbefall, Wildbiss, Sturmschäden und Waldsterben zeigen uns: Was das für die moderne Forst und Holzwirtschaft bedeutet, zeigt dieser Film aus dem Jahr 2000 in fünf anschaulichen Kapiteln über das Waldsterben, die Forstwirtschaft, den naturnahen Waldbau, die Jagd und über Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Ideal zum Einsatz im Unterricht und in der Öffentlichkeitsarbeit! Alle Kapitel sind im DVD-Menü einzeln anwählbar. Video (DVD), ca. 40 Minuten Erstauflage 2008 Bestell-Nr ISBN/EAN Wald mit Zukunft Nachhaltige Forstwirtschaft in Deutschland Was passiert heute eigentlich im Wald? Was bedeutet Forstwirtschaft heute? Das Heft spannt einen großen Bogen von der spannenden Waldgeschichte Deutschlands bis zur aktuellen Waldsituation, vom Natur- und Umweltschutz im Wald bis zur Nutzung des Ökostoffs Holz. Ganz oben steht dabei die Nachhaltigkeit: das Wirtschaften im Einklang mit den Lebensgrundlagen für uns und kommende Generationen. Heft, 14 x 21 cm, 84 Seiten Erstauflage 2006 Bestell-Nr ISBN/EAN Forst/Holz 2009 Eine Auswahl besonders wichtiger Kennzahlen aus dem Forst- Holzbereich zu den Themen Waldstruktur, Forstwirtschaft und Holzwirtschaft. Heft (14 x 21 cm), 32 Seiten 9., veränd. Neuauflage 2009 Bestell-Nr ISBN/EAN auch als Download Borkenkäfer an Nadelbäumen überwachen und bekämpfen Das Heft informiert ausführlich über Befallsmerkmale und Lebensweise forstlich wichtiger Borkenkäferarten. Zudem werden kurz- und langfristige Maßnahmen zur Schadensverminderung im Rahmen einer integrierten Bekämpfungsstrategie dargestellt. Heft (14,8 x 21 cm), 48 Seiten 7., veränd. Neuauflage 2008 Bestell-Nr ISBN/EAN auch als Download 34
Film: Bergwald ist Schutzwald Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/7 Arbeitsauftrag Ziel Material Sozialform Die SuS schauen sich das Video Bergwald ist Schutzwald an. Im Anschluss lösen sie das Quiz, dessen erster Teil auch als Lernkontrolle verwendet
Lehrerinformation 1/7 Arbeitsauftrag Ziel Material Sozialform Die SuS schauen sich das Video Bergwald ist Schutzwald an. Im Anschluss lösen sie das Quiz, dessen erster Teil auch als Lernkontrolle verwendet
Auswirkungen des KlimawandelsIS
 Auswirkungen des KlimawandelsIS Die Auswirkungen/Folgen des Klimawandels auf die natürlichen System, Wirtschaft und Gesellschaft sind vielfältig. Nachfolgend wird eine nicht abschliessende Zusammenstellung
Auswirkungen des KlimawandelsIS Die Auswirkungen/Folgen des Klimawandels auf die natürlichen System, Wirtschaft und Gesellschaft sind vielfältig. Nachfolgend wird eine nicht abschliessende Zusammenstellung
Film: Bergwald ist Schutzwald Arbeitsblatt
 Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag Die SuS schauen sich das Video Bergwald ist Schutzwald an. Im Anschluss lösen sie das Quiz, dessen erster Teil auch als Lernkontrolle verwendet werden kann. Ziel Die
Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag Die SuS schauen sich das Video Bergwald ist Schutzwald an. Im Anschluss lösen sie das Quiz, dessen erster Teil auch als Lernkontrolle verwendet werden kann. Ziel Die
Auswirkungen des Klimawandels auf die Naturgefahren
 Österreichischer Sachstandsbericht Klimawandel 2014 Auswirkungen des Klimawandels auf die Naturgefahren Austrian Assessment Report 2014 (AAR14) Hintergrund Naturgefahren werden beinflusst oder ausgelöst
Österreichischer Sachstandsbericht Klimawandel 2014 Auswirkungen des Klimawandels auf die Naturgefahren Austrian Assessment Report 2014 (AAR14) Hintergrund Naturgefahren werden beinflusst oder ausgelöst
Faktensammlung zur Dritten Bundeswaldinventur (BWI 3) für Mecklenburg-Vorpommern
 Faktensammlung zur Dritten Bundeswaldinventur (BWI 3) für Mecklenburg-Vorpommern Erhebungsmethodik BWI Großrauminventur auf Stichprobenbasis. Ziel Erfassung der aktuellen Waldverhältnisse und Produktionsmöglichkeiten
Faktensammlung zur Dritten Bundeswaldinventur (BWI 3) für Mecklenburg-Vorpommern Erhebungsmethodik BWI Großrauminventur auf Stichprobenbasis. Ziel Erfassung der aktuellen Waldverhältnisse und Produktionsmöglichkeiten
Klimawandel und Forstwirtschaft Unterrichtsmaterial für die Klassen 11 und 12 an allgemeinbildenden Schulen 5,50
 Klimawandel und Forstwirtschaft Unterrichtsmaterial für die Klassen 11 und 12 an allgemeinbildenden Schulen 5,50 0595/2011 Inhalt Herausgegeben vom aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz
Klimawandel und Forstwirtschaft Unterrichtsmaterial für die Klassen 11 und 12 an allgemeinbildenden Schulen 5,50 0595/2011 Inhalt Herausgegeben vom aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz
BÄUMCHEN WECHSELT EUCH!
 BÄUMCHEN WECHSELT EUCH! Unser Ziel ist eine gesunde Mischung. Wer heute Waldbau sagt, muss auch Waldumbau und Energiewende meinen. Standortgemäß, naturnah, stabil, leistungsfähig, erneuerbar: Anpassungsfähige
BÄUMCHEN WECHSELT EUCH! Unser Ziel ist eine gesunde Mischung. Wer heute Waldbau sagt, muss auch Waldumbau und Energiewende meinen. Standortgemäß, naturnah, stabil, leistungsfähig, erneuerbar: Anpassungsfähige
300 Jahre Forstliche Nachhaltigkeit DER THÜNGENER WALD
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt 300 Jahre Forstliche Nachhaltigkeit DER THÜNGENER WALD WALDFLÄCHE Das Thüngener Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von insgesamt 1361 Hektar. Davon
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt 300 Jahre Forstliche Nachhaltigkeit DER THÜNGENER WALD WALDFLÄCHE Das Thüngener Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von insgesamt 1361 Hektar. Davon
Wofür brauchen wir eine Waldbewirtschaftung im Bayerischen Alpenraum?
 Wofür brauchen wir eine Waldbewirtschaftung im Bayerischen Alpenraum? Dr. Sebastian Höllerl 11.06.2016 Folie 2 Der Bergwald erfüllt viele Funktionen für uns Schutz Bergwald Nutzung Erholung Folie 3 Erholungsfunktion
Wofür brauchen wir eine Waldbewirtschaftung im Bayerischen Alpenraum? Dr. Sebastian Höllerl 11.06.2016 Folie 2 Der Bergwald erfüllt viele Funktionen für uns Schutz Bergwald Nutzung Erholung Folie 3 Erholungsfunktion
Weihenstephaner Erklärung zu Wald und Forstwirtschaft im Klimawandel
 Weihenstephaner Erklärung zu Wald und Forstwirtschaft im Klimawandel Gemeinsame Erklärung der Bayerischen Staatsregierung und der forstlichen Verbände und Vereine in Bayern Waldtag Bayern Freising-Weihenstephan
Weihenstephaner Erklärung zu Wald und Forstwirtschaft im Klimawandel Gemeinsame Erklärung der Bayerischen Staatsregierung und der forstlichen Verbände und Vereine in Bayern Waldtag Bayern Freising-Weihenstephan
STATION 1: MISCHWALD
 STATION 1: MISCHWALD ENTSPANNEN ERLEBEN ACHTSAMKEIT WAHRNEHMUNG 10 MIN JEDES ALTER ABBILD DER NATUR Achtsames Betrachten LEBENSRAUM: WIESE WALD SEE BERG FLUSS/BACH Betrachten Sie ein Naturphänomen, das
STATION 1: MISCHWALD ENTSPANNEN ERLEBEN ACHTSAMKEIT WAHRNEHMUNG 10 MIN JEDES ALTER ABBILD DER NATUR Achtsames Betrachten LEBENSRAUM: WIESE WALD SEE BERG FLUSS/BACH Betrachten Sie ein Naturphänomen, das
1334/2009. Text: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Redaktion: Rainer Schretzmann, aid
 1334/2009 Herausgegeben vom aid infodienst Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft e. V. Heilsbachstraße 16 53123 Bonn Internet: http://www.aid.de E-Mail: aid@aid.de mit Förderung durch das Bundesministerium
1334/2009 Herausgegeben vom aid infodienst Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft e. V. Heilsbachstraße 16 53123 Bonn Internet: http://www.aid.de E-Mail: aid@aid.de mit Förderung durch das Bundesministerium
Forstliches Gutachten zur Situation der Waldverjüngung 2015 gemäß Artikel 32 Absatz 1 des Bayerischen Jagdgesetzes (BayJG)
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Töging a. Inn Forstliches Gutachten zur Situation der Waldverjüngung 2015 gemäß Artikel 32 Absatz 1 des Bayerischen Jagdgesetzes (BayJG) Hochwildhegegemeinschaft/Hegegemeinschaft
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Töging a. Inn Forstliches Gutachten zur Situation der Waldverjüngung 2015 gemäß Artikel 32 Absatz 1 des Bayerischen Jagdgesetzes (BayJG) Hochwildhegegemeinschaft/Hegegemeinschaft
Ergebnisse der ersten landesweiten Waldinventur in Brandenburg
 Ergebnisse der ersten landesweiten Waldinventur in Brandenburg 30. Juni 2015 Ergebnisse der ersten landesweiten Waldinventur in Brandenburg 1 Brandenburger Waldinventur (LWI) - wichtige Ergänzung zur Bundeswaldinventur
Ergebnisse der ersten landesweiten Waldinventur in Brandenburg 30. Juni 2015 Ergebnisse der ersten landesweiten Waldinventur in Brandenburg 1 Brandenburger Waldinventur (LWI) - wichtige Ergänzung zur Bundeswaldinventur
Das alles leistet der Wald
 Das alles leistet der Wald Im Wald wächst nicht nur Holz. Er leistet für uns Menschen noch viel mehr und das kostenlos. Lawinenschutz Erzeugung von Sauerstoff Luftreinigung Lärmschutz Lebensraum Erholungsraum
Das alles leistet der Wald Im Wald wächst nicht nur Holz. Er leistet für uns Menschen noch viel mehr und das kostenlos. Lawinenschutz Erzeugung von Sauerstoff Luftreinigung Lärmschutz Lebensraum Erholungsraum
VORSCHAU. zur Vollversion. Lehrer-Begleittext: Gletscher im Klimawandel
 Lehrer-Begleittext: Gletscher im Klimawandel Mit dem Rückgang der Gletscher drohen Naturgefahren Überschwemmungen sind in den Alpen die größte Gefahr. Durch den Temperaturanstieg fällt Schnee bis in große
Lehrer-Begleittext: Gletscher im Klimawandel Mit dem Rückgang der Gletscher drohen Naturgefahren Überschwemmungen sind in den Alpen die größte Gefahr. Durch den Temperaturanstieg fällt Schnee bis in große
Klimawandel in Baden-Württemberg
 ZAHL DER SOMMERTAGE +22 +20 +18 +16 Änderung der Anzahl der Sommertage ( 25 C) zwischen 1971-2000 und 2011-2040. +14 +12 +10 +8 5 ZAHL DER FROSTTAGE -7-9 -11-13 Änderung der Anzahl der Frosttage zwischen
ZAHL DER SOMMERTAGE +22 +20 +18 +16 Änderung der Anzahl der Sommertage ( 25 C) zwischen 1971-2000 und 2011-2040. +14 +12 +10 +8 5 ZAHL DER FROSTTAGE -7-9 -11-13 Änderung der Anzahl der Frosttage zwischen
Teil B. Die Hauptaufgaben des Waldes
 Teil B Die Hauptaufgaben des Waldes Auf unserer Exkursion haben wir einige Funktionen des Waldes kennengelernt. Wir greifen diese im Schulunterricht auf und repetieren sowie vervollständigen sie mit den
Teil B Die Hauptaufgaben des Waldes Auf unserer Exkursion haben wir einige Funktionen des Waldes kennengelernt. Wir greifen diese im Schulunterricht auf und repetieren sowie vervollständigen sie mit den
3. Aufzählung von Folgen des Gletschersterbens
 www.planetschule.de Oberstufe (Z3) Natur und Technik Räume, Zeiten, Gesellschaften Ethik, Religionen, Gemeinschaft Regelunterricht, Projekttage Die Zukunftszenarien beschreiben den SuS die drohenden Gefahren
www.planetschule.de Oberstufe (Z3) Natur und Technik Räume, Zeiten, Gesellschaften Ethik, Religionen, Gemeinschaft Regelunterricht, Projekttage Die Zukunftszenarien beschreiben den SuS die drohenden Gefahren
Schutzwald in Tirol im Spannungsfeld aller Landnutzer
 Schutzwald in Tirol im Spannungsfeld aller Dr. Hubert Kammerlander Gruppe Forst Waldfläche wächst langsam aber stetig 540 W aldfläche in [1.000 ha] 520 500 480 460 440 420 400 Quelle: ÖWI 61/70 71/80 81/85
Schutzwald in Tirol im Spannungsfeld aller Dr. Hubert Kammerlander Gruppe Forst Waldfläche wächst langsam aber stetig 540 W aldfläche in [1.000 ha] 520 500 480 460 440 420 400 Quelle: ÖWI 61/70 71/80 81/85
Der Wald und seine Funktionen Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/7 Arbeitsauftrag Ziel Material Die SuS folgen einer Kurz-Präsentation der Lehrkraft (oder lesen alternativ selbstständig einen Informationstext) und lösen dazu ein Arbeitsblatt mit
Lehrerinformation 1/7 Arbeitsauftrag Ziel Material Die SuS folgen einer Kurz-Präsentation der Lehrkraft (oder lesen alternativ selbstständig einen Informationstext) und lösen dazu ein Arbeitsblatt mit
Klimawandel in NRW - die Situation in Städten und Ballungsräumen
 Klimawandel in NRW - die Situation in Städten und Ballungsräumen Dr. Barbara Köllner Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz - LANUV Autorenname, Fachbereich Das Klima in NRW (Quelle: DWD) Jahresmitteltemperatur
Klimawandel in NRW - die Situation in Städten und Ballungsräumen Dr. Barbara Köllner Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz - LANUV Autorenname, Fachbereich Das Klima in NRW (Quelle: DWD) Jahresmitteltemperatur
Wintersport und die Gefahren für die Natur
 Wintersport und die Gefahren für die Natur Winterzeit Wir befinden uns mitten im Winter. Es wird kälter, der Schnee kommt und die Tage werden kürzer. Das Landschaftsbild verändert sich: Die Bäume haben
Wintersport und die Gefahren für die Natur Winterzeit Wir befinden uns mitten im Winter. Es wird kälter, der Schnee kommt und die Tage werden kürzer. Das Landschaftsbild verändert sich: Die Bäume haben
1.Ziele der Anpassung an Klimaveränderung 2.Der Wald in Hessen 3. Naturgemäße Waldwirtschaft 4. Beispielhafte waldbauliche Steuerung 5.
 Umsetzung waldbaulicher Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel Uwe Zindel 1.Ziele der Anpassung an Klimaveränderung 2.Der Wald in Hessen 3. Naturgemäße Waldwirtschaft 4. Beispielhafte waldbauliche
Umsetzung waldbaulicher Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel Uwe Zindel 1.Ziele der Anpassung an Klimaveränderung 2.Der Wald in Hessen 3. Naturgemäße Waldwirtschaft 4. Beispielhafte waldbauliche
Klimawandel und Energie - wo stehen wir?
 Energie - wo Dr. Albert von Däniken 1 Der Klimawandel findet statt Das Ausmass des Klimawandels schwer feststellbar Die Veränderungen beschleunigen sich Es findet eine Erwärmung des Klimasystems statt
Energie - wo Dr. Albert von Däniken 1 Der Klimawandel findet statt Das Ausmass des Klimawandels schwer feststellbar Die Veränderungen beschleunigen sich Es findet eine Erwärmung des Klimasystems statt
Waldsterben Was wurde daraus? Beobachtungen aus dem Stift Schlägl
 Waldsterben Was wurde daraus? Beobachtungen aus dem Stift Schlägl Rahmenbedingungen Höhenlage: 600m 1378m (Plöckenstein) Hauptwindrichtung: W und N (Böhmwinde) Jahresdurchschnittstemperatur: 4,5 Grad
Waldsterben Was wurde daraus? Beobachtungen aus dem Stift Schlägl Rahmenbedingungen Höhenlage: 600m 1378m (Plöckenstein) Hauptwindrichtung: W und N (Böhmwinde) Jahresdurchschnittstemperatur: 4,5 Grad
Die Wälder der Landesforsten in Zahlen
 Die Wälder der Landesforsten in Zahlen Ergebnisse der Bundeswaldinventur 3: 1. Allgemein Die Bundeswaldinventur 3 erfasste zum Stichtag 1. Oktober 12 als Großrauminventur viele Strukturdaten in den Wäldern.
Die Wälder der Landesforsten in Zahlen Ergebnisse der Bundeswaldinventur 3: 1. Allgemein Die Bundeswaldinventur 3 erfasste zum Stichtag 1. Oktober 12 als Großrauminventur viele Strukturdaten in den Wäldern.
Die Fichte im Wandel - Franz Brosinger
 Die Fichte im Wandel Franz Brosinger Referat Waldbau und Nachhaltssicherung Fichtenwälder im Klimawandel am 10. Juli 2009 in Freising Folie 1 Gliederung 1. Geschichte und Bedeutung der Fichte in Bayern
Die Fichte im Wandel Franz Brosinger Referat Waldbau und Nachhaltssicherung Fichtenwälder im Klimawandel am 10. Juli 2009 in Freising Folie 1 Gliederung 1. Geschichte und Bedeutung der Fichte in Bayern
Der Wald Ihr Naherholungsgebiet
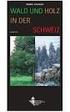 Der Wald Ihr Naherholungsgebiet Informationen über Nutzung und Pflege. Liebe Waldgeniesser Sie kennen und schätzen den Wald als Ort der Kraft, der Ruhe und natürlichen Stille. Manchmal wird diese Stille
Der Wald Ihr Naherholungsgebiet Informationen über Nutzung und Pflege. Liebe Waldgeniesser Sie kennen und schätzen den Wald als Ort der Kraft, der Ruhe und natürlichen Stille. Manchmal wird diese Stille
Besonders extreme Wetterlagen werden durch Klimawandel am stärksten zunehmen
 Gemeinsame Pressekonferenz des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), Umweltbundesamtes (UBA), Technischen Hilfswerks (THW) und Bundesamtes für Bevölkerungsschutz
Gemeinsame Pressekonferenz des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), Umweltbundesamtes (UBA), Technischen Hilfswerks (THW) und Bundesamtes für Bevölkerungsschutz
Das Projekt "Ökonomie und Ökologie im Schutzwald" Der Schutzwald
 Das Projekt "Ökonomie und Ökologie im Schutzwald" Der Schutzwald Inhalt Das Projekt Die Ziele Der Schutzwald Die Schutzfunktion des Waldes ist keine Selbstverständlichkeit Lösungsansätze Die Rolle der
Das Projekt "Ökonomie und Ökologie im Schutzwald" Der Schutzwald Inhalt Das Projekt Die Ziele Der Schutzwald Die Schutzfunktion des Waldes ist keine Selbstverständlichkeit Lösungsansätze Die Rolle der
Zukunftswald. Umsetzung in den Bayerischen Staatsforsten. Florian Vogel Klimakongress 14. Juli 2016, Würzburg
 Zukunftswald Umsetzung in den Bayerischen Staatsforsten Florian Vogel Klimakongress 14. Juli 2016, Würzburg Vivian/Wiebke, Lothar, Kyrill, Niklas. Hochwasser, Feuer Eugen Lehle/www.wikipedia.org BaySF
Zukunftswald Umsetzung in den Bayerischen Staatsforsten Florian Vogel Klimakongress 14. Juli 2016, Würzburg Vivian/Wiebke, Lothar, Kyrill, Niklas. Hochwasser, Feuer Eugen Lehle/www.wikipedia.org BaySF
Einführung Arbeitsblatt
 03/ Lehrerinformation 1/6 Arbeitsauftrag Die Schüler folgen der Präsentation und lösen anschliessend das. Ziel Die Schüler kennen die wesentlichen Herausforderungen der modernen Landwirtschaft. Material
03/ Lehrerinformation 1/6 Arbeitsauftrag Die Schüler folgen der Präsentation und lösen anschliessend das. Ziel Die Schüler kennen die wesentlichen Herausforderungen der modernen Landwirtschaft. Material
Lebensgemeinschaft Wald 3. Funktionen des Waldes
 Lebensgemeinschaft Wald 3. Funktionen des Waldes Film und Beitrag: Anita Bach Inhalt Der Wald als Wirtschaftsfaktor Tausende von Bäumen werden in Deutschland jedes Jahr gefällt. Als nachwachsender Rohstoff
Lebensgemeinschaft Wald 3. Funktionen des Waldes Film und Beitrag: Anita Bach Inhalt Der Wald als Wirtschaftsfaktor Tausende von Bäumen werden in Deutschland jedes Jahr gefällt. Als nachwachsender Rohstoff
Die Stiel- und Traubeneichen
 Die Stiel- und Traubeneichen Stiel- und Traubeneichen sind im Weingartner Gemeindewald mit 11 Prozent an der Gesamtwaldfläche vertreten. Die Stieleiche stockt zumeist auf den kiesig-sandigen Böden im Rheintal.
Die Stiel- und Traubeneichen Stiel- und Traubeneichen sind im Weingartner Gemeindewald mit 11 Prozent an der Gesamtwaldfläche vertreten. Die Stieleiche stockt zumeist auf den kiesig-sandigen Böden im Rheintal.
Obwohl Österreich sehr dicht besiedelt ist, kommt auf jeden Bundesbürger fast ein halber Hektar Wald.
 1. Wald in Österreich Österreich ist mit rund 4 Millionen Hektar Waldfläche - das ist mit 47,6 Prozent nahezu die Hälfte des Bundesgebietes - eines der waldreichsten Länder der EU. Der durchschnittliche
1. Wald in Österreich Österreich ist mit rund 4 Millionen Hektar Waldfläche - das ist mit 47,6 Prozent nahezu die Hälfte des Bundesgebietes - eines der waldreichsten Länder der EU. Der durchschnittliche
Überblick. Ziele. Unterrichtseinheit
 MODUL 3: Lernblatt D 8/9/10 Artenvielfalt Pflanzen in Gefahr Zeit 3 Stunden ORT Botanischer Garten Überblick Die SchülerInnen erfahren, warum Pflanzen vom Aussterben bedroht sind, indem sie in einem Rollenspiel
MODUL 3: Lernblatt D 8/9/10 Artenvielfalt Pflanzen in Gefahr Zeit 3 Stunden ORT Botanischer Garten Überblick Die SchülerInnen erfahren, warum Pflanzen vom Aussterben bedroht sind, indem sie in einem Rollenspiel
Die Natur in den 4 Jahreszeiten. Julian 2012/13
 Die Natur in den 4 Jahreszeiten Julian 2c 2012/13 Die Natur in den vier Jahreszeiten Ein Jahr hat vier Jahreszeiten, die jeweils 3 Monate dauern. Diese heißen Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Zu jeder
Die Natur in den 4 Jahreszeiten Julian 2c 2012/13 Die Natur in den vier Jahreszeiten Ein Jahr hat vier Jahreszeiten, die jeweils 3 Monate dauern. Diese heißen Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Zu jeder
NATUR NÜTZEN. NATUR SCHÜTZEN.
 NATUR NÜTZEN. NATUR SCHÜTZEN. HALTUNG & ERHALTUNG Dem Land verbunden. Der Zukunft verpflichtet. Als freiwillige Interessenvertretung der Eigentümer von land- und forstwirtschaftlich bewirtschaftetem Boden
NATUR NÜTZEN. NATUR SCHÜTZEN. HALTUNG & ERHALTUNG Dem Land verbunden. Der Zukunft verpflichtet. Als freiwillige Interessenvertretung der Eigentümer von land- und forstwirtschaftlich bewirtschaftetem Boden
Klimawandel in NRW und Strategien zur. Dr. Barbara Köllner
 Klimawandel in NRW und Strategien zur Anpassung Dr. Barbara Köllner Der Klimawandel ist in NRW angekommen nicht drastisch aber stetig - Anstieg der Durchschnittstemperaturen: seit Beginn des Jahrhunderts
Klimawandel in NRW und Strategien zur Anpassung Dr. Barbara Köllner Der Klimawandel ist in NRW angekommen nicht drastisch aber stetig - Anstieg der Durchschnittstemperaturen: seit Beginn des Jahrhunderts
Bewirtschaftung von Waldflächen in der Stadt Georgsmarienhütte
 Bewirtschaftung von Waldflächen in der Stadt Georgsmarienhütte Die Waldfläche in der Stadt Georgmarienhütte umfasst ca. 2.000 Hektar. Diese Größe entspricht in etwa dem Bundes- und liegt über dem Landesdurchschnitt
Bewirtschaftung von Waldflächen in der Stadt Georgsmarienhütte Die Waldfläche in der Stadt Georgmarienhütte umfasst ca. 2.000 Hektar. Diese Größe entspricht in etwa dem Bundes- und liegt über dem Landesdurchschnitt
Waldboden. Sucht unter einem Laubbaum Blätter in unterschiedlichem Zersetzungsgrad und klebt sie nacheinander auf ein großes Blatt Papier!
 1 Sucht unter einem Laubbaum Blätter in unterschiedlichem Zersetzungsgrad und klebt sie nacheinander auf ein großes Blatt Papier! Findet heraus, welche Tiere dies bewirken! Schaut euch im Gelände um: Zersetzen
1 Sucht unter einem Laubbaum Blätter in unterschiedlichem Zersetzungsgrad und klebt sie nacheinander auf ein großes Blatt Papier! Findet heraus, welche Tiere dies bewirken! Schaut euch im Gelände um: Zersetzen
Bereit für das Klima von morgen? Klimawandel-Anpassung auf Landes- und Gemeindeebene
 Bereit für das Klima von morgen? Klimawandel-Anpassung auf Landes- und Gemeindeebene Markus Niedermair, Klimaschutzkoordinator im Amt der Vorarlberger Landesregierung, Fachbereich Energie und Klimaschutz
Bereit für das Klima von morgen? Klimawandel-Anpassung auf Landes- und Gemeindeebene Markus Niedermair, Klimaschutzkoordinator im Amt der Vorarlberger Landesregierung, Fachbereich Energie und Klimaschutz
INTEGRALES RISIKOMANAGEMENT BEIM UMGANG MIT NATURGEFAHREN
 INTEGRALES RISIKOMANAGEMENT BEIM UMGANG MIT NATURGEFAHREN Dr. Christian Wilhelm, Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden Infrastrukturtagung 2017 in Graubünden Inhalt Naturgefahren, Raumnutzung und Risiken
INTEGRALES RISIKOMANAGEMENT BEIM UMGANG MIT NATURGEFAHREN Dr. Christian Wilhelm, Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden Infrastrukturtagung 2017 in Graubünden Inhalt Naturgefahren, Raumnutzung und Risiken
Vorbereitungsseminar Staatsprüfung Waldbau Gmunden
 04 05 2012 Vorbereitungsseminar Staatsprüfung Waldbau Gmunden Inhalt > Waldentwicklungsplan > Waldbauliche Planung mit unterschiedlichen Zielsetzungen > Waldbau - Klimaänderung Waldentwicklungsplan Der
04 05 2012 Vorbereitungsseminar Staatsprüfung Waldbau Gmunden Inhalt > Waldentwicklungsplan > Waldbauliche Planung mit unterschiedlichen Zielsetzungen > Waldbau - Klimaänderung Waldentwicklungsplan Der
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Erfolgskontrolle bei Schutzwald- und Schutzwaldsanierungsprojekten in Bayern mündlicher Bericht der Staatsregierung am 27. Februar
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Erfolgskontrolle bei Schutzwald- und Schutzwaldsanierungsprojekten in Bayern mündlicher Bericht der Staatsregierung am 27. Februar
Wasserhaushalt im Wald
 Wasserhaushalt im Wald Lernziele: Die SchülerInnen lernen den Wasserkreislauf im Wald kennen und verstehen. Die SchülerInnen wissen, dass der Wald einen wesentlichen Beitrag zur Trinkwasserversorgung Österreichs
Wasserhaushalt im Wald Lernziele: Die SchülerInnen lernen den Wasserkreislauf im Wald kennen und verstehen. Die SchülerInnen wissen, dass der Wald einen wesentlichen Beitrag zur Trinkwasserversorgung Österreichs
Fachvortrag FW Mittelrheintal/Berneck-Au-Heerbrugg Au, 7. Januar 2014 Naturgefahrenprojekt
 Fachvortrag FW Mittelrheintal/Berneck-Au-Heerbrugg Au, 7. Januar 2014 Naturgefahrenprojekt Tiefbauamt, Sektion Naturgefahren/Talsperren Ralph Brändle Naturgefahrenprojekt Inhalt Ausgangslage Projekt Naturgefahren
Fachvortrag FW Mittelrheintal/Berneck-Au-Heerbrugg Au, 7. Januar 2014 Naturgefahrenprojekt Tiefbauamt, Sektion Naturgefahren/Talsperren Ralph Brändle Naturgefahrenprojekt Inhalt Ausgangslage Projekt Naturgefahren
Waldnaturschutz. Präsident Sepp Spann Bayerischer Waldbesitzerverband e.v.
 Waldnaturschutz Position des Bayerischen Waldesitzerverbandes 10. Bayerischer Waldbesitzertag, 17.09.2015 Präsident Sepp Spann Bayerischer Waldbesitzerverband e.v. Ausgangslage Wälder sind über Jahrhunderte
Waldnaturschutz Position des Bayerischen Waldesitzerverbandes 10. Bayerischer Waldbesitzertag, 17.09.2015 Präsident Sepp Spann Bayerischer Waldbesitzerverband e.v. Ausgangslage Wälder sind über Jahrhunderte
Ein Haus am Hang. 1) In ihrer großen Freude ruft sie Verwandte in Tirol an und erzählt ihnen von ihrem Plan. Sie sagen zu ihr:
 Ein Haus am Hang Marias Mutter erzählt beim Abendessen: Stellt euch vor, ich habe heute einen Brief von Oma bekommen. Sie will mir ein Grundstück in Tirol vererben. Ich habe mir das Grundstück im Internet
Ein Haus am Hang Marias Mutter erzählt beim Abendessen: Stellt euch vor, ich habe heute einen Brief von Oma bekommen. Sie will mir ein Grundstück in Tirol vererben. Ich habe mir das Grundstück im Internet
Klimasystem. Das Klima der Erde und wie es entsteht: Definition Klima
 Das Klima der Erde und wie es entsteht: Definition Klima Unter dem Begriff Klima verstehen wir die Gesamtheit der typischen Witterungsabläufe an einem bestimmten Ort oder in einer bestimmten Region über
Das Klima der Erde und wie es entsteht: Definition Klima Unter dem Begriff Klima verstehen wir die Gesamtheit der typischen Witterungsabläufe an einem bestimmten Ort oder in einer bestimmten Region über
Seelandranger. 4.3 Lebensräume
 4.3 Lebensräume Erst durch die Menschliche Nutzung entstanden in unseren Breitengraden auf Kosten der Waldfläche die ausgedehnten Kulturlandschaften mit ihrer grossen Artenvielfalt. (JidS,S.174) 2 500
4.3 Lebensräume Erst durch die Menschliche Nutzung entstanden in unseren Breitengraden auf Kosten der Waldfläche die ausgedehnten Kulturlandschaften mit ihrer grossen Artenvielfalt. (JidS,S.174) 2 500
Der Hitzetod der Erde
 Der Hitzetod der Erde Der natürliche Treibhauseffekt In der Erdatmosphäre gibt es neben dem für uns lebenswichtigen Sauerstoff einige hoch wirksame Treibhausgase. Dies sind vor allem:! Kohlendioxid! Wasserdampf!
Der Hitzetod der Erde Der natürliche Treibhauseffekt In der Erdatmosphäre gibt es neben dem für uns lebenswichtigen Sauerstoff einige hoch wirksame Treibhausgase. Dies sind vor allem:! Kohlendioxid! Wasserdampf!
Fakten zum Klimawandel und Auswirkungen auf die Waldbewirtschaftung
 Fakten zum Klimawandel und Auswirkungen auf die Waldbewirtschaftung Peter Mayer, BFW Forstwirtschaft unter dem Eindruck von Klimawandel und Kalamitäten Höhere Bundeslehranstalt für Forstwirtschaft, Bruck
Fakten zum Klimawandel und Auswirkungen auf die Waldbewirtschaftung Peter Mayer, BFW Forstwirtschaft unter dem Eindruck von Klimawandel und Kalamitäten Höhere Bundeslehranstalt für Forstwirtschaft, Bruck
Bergwaldbroschüre des ÖJV Bayern (2016). Stimmen aus den Statements der Referenten (S )
 Bergwaldbroschüre des ÖJV Bayern (2016). Stimmen aus den Statements der Referenten (S. 47 92) Axel Döring, Vizepräsident CIPRA Deutschland (S. 47ff) 1. Welche Schutzfunktionen hat der Bergwald zu erfüllen?
Bergwaldbroschüre des ÖJV Bayern (2016). Stimmen aus den Statements der Referenten (S. 47 92) Axel Döring, Vizepräsident CIPRA Deutschland (S. 47ff) 1. Welche Schutzfunktionen hat der Bergwald zu erfüllen?
umweltbewusst drucken - zeichen setzen - vorbild sein blue'protect
 umweltbewusst drucken - zeichen setzen - vorbild sein blue'protect profitieren sie von unserem know-how Das tun wir bereits für die Umwelt: Isopropyl-reduzierte Produktion für weniger Emissionen Umweltfreundliche
umweltbewusst drucken - zeichen setzen - vorbild sein blue'protect profitieren sie von unserem know-how Das tun wir bereits für die Umwelt: Isopropyl-reduzierte Produktion für weniger Emissionen Umweltfreundliche
Klimawandel verstärkt Hitzebelastung der Bevölkerung in NRW bis zur Mitte des Jahrhunderts wären 9 Millionen Bürgerinnen und Bürger betroffen
 Landesamt für Natur Umwelt und Verbraucherschutz Pressemitteilung Klimawandel verstärkt Hitzebelastung der Bevölkerung in NRW bis zur Mitte des Jahrhunderts wären 9 Millionen Bürgerinnen und Bürger betroffen
Landesamt für Natur Umwelt und Verbraucherschutz Pressemitteilung Klimawandel verstärkt Hitzebelastung der Bevölkerung in NRW bis zur Mitte des Jahrhunderts wären 9 Millionen Bürgerinnen und Bürger betroffen
Auswirkungen des Klimawandels auf Regionen Ostdeutschlands
 Auswirkungen des Klimawandels auf Regionen Ostdeutschlands Vortrag von Arun Hackenberger im Rahmen von Leuchtpol Fachtag Ost in Berlin am 27.Mai 2010 Einstieg in das Thema Wetter und Klima Ein wenig Statistik
Auswirkungen des Klimawandels auf Regionen Ostdeutschlands Vortrag von Arun Hackenberger im Rahmen von Leuchtpol Fachtag Ost in Berlin am 27.Mai 2010 Einstieg in das Thema Wetter und Klima Ein wenig Statistik
NATURWALDRESERVAT WEIHERBUCHET
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weilheim i. OB NATURWALDRESERVAT WEIHERBUCHET Naturwaldreservat Weiherbuchet Flache Terrassen und steile Wälle der Endmoräne prägen das Reservat. ALLGEMEINES
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weilheim i. OB NATURWALDRESERVAT WEIHERBUCHET Naturwaldreservat Weiherbuchet Flache Terrassen und steile Wälle der Endmoräne prägen das Reservat. ALLGEMEINES
Niederschlag und Wasserrückhalt
 Projekttag zum Thema Leben am Fluss Niederschlag und Wasserrückhalt Idee, Konzeption und Umsetzung: R. Herold, LfULG Sachsen Mitwirkung, Fotos: M. Grafe, LfULG Sachsen Zusammenarbeit des LfULG mit der
Projekttag zum Thema Leben am Fluss Niederschlag und Wasserrückhalt Idee, Konzeption und Umsetzung: R. Herold, LfULG Sachsen Mitwirkung, Fotos: M. Grafe, LfULG Sachsen Zusammenarbeit des LfULG mit der
Welche Bedeutung hat die Jagd für die naturnahe Waldbewirtschaftung? Christian Ammer
 Welche Bedeutung hat die Jagd für die naturnahe Waldbewirtschaftung? Villigst, 01.02.2012 Christian Ammer Christian Ammer Er hatte grüne Klamotten an und einen grünen Hut mit Puschel auf bei Gott, ich
Welche Bedeutung hat die Jagd für die naturnahe Waldbewirtschaftung? Villigst, 01.02.2012 Christian Ammer Christian Ammer Er hatte grüne Klamotten an und einen grünen Hut mit Puschel auf bei Gott, ich
Themen zu den Klimafolgen
 Themen zu den Klimafolgen 1. Wetterextreme: Hitzewellen, Überschwemmungen, Stürme, Hurrikans 2. Meeresspiegel : aktuell, bis 2100, bis 3000, gefährdete Regionen 3. Eis und Klima: Eiszeit, Meereis, Gebirgsgletscher,
Themen zu den Klimafolgen 1. Wetterextreme: Hitzewellen, Überschwemmungen, Stürme, Hurrikans 2. Meeresspiegel : aktuell, bis 2100, bis 3000, gefährdete Regionen 3. Eis und Klima: Eiszeit, Meereis, Gebirgsgletscher,
Luzerner Wald im Gleichgewicht
 Was zählt im Luzerner Wald? Waldfläche im Kanton Luzern: 40 000 ha (27% der Kantonsfläche) In Privatbesitz: 70% In öffentlichem Besitz: 30% Kanton 6%, Korporationen 17%, Gemeinden 6%, Bund 1% Anzahl Waldeigentümer:
Was zählt im Luzerner Wald? Waldfläche im Kanton Luzern: 40 000 ha (27% der Kantonsfläche) In Privatbesitz: 70% In öffentlichem Besitz: 30% Kanton 6%, Korporationen 17%, Gemeinden 6%, Bund 1% Anzahl Waldeigentümer:
Zukunftssichere Waldwirtschaft trotz Klimaextreme. Dipl.-Ing. Christoph Jasser, Oö. Landesforstdienst
 Zukunftssichere Waldwirtschaft trotz Klimaextreme Dipl.-Ing. Christoph Jasser, Oö. Landesforstdienst Schadholzanteil 30 40 % Tendenz steigend Was kann dagegen getan werden? 1. entsprechende Baumartenwahl
Zukunftssichere Waldwirtschaft trotz Klimaextreme Dipl.-Ing. Christoph Jasser, Oö. Landesforstdienst Schadholzanteil 30 40 % Tendenz steigend Was kann dagegen getan werden? 1. entsprechende Baumartenwahl
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt Leben im Wald. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt Leben im Wald Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Reihe: Veränderbare Arbeitsblätter für
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt Leben im Wald Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Reihe: Veränderbare Arbeitsblätter für
Wie geht man mit gefährdeten Fichtenbeständen um?
 Wie geht man mit gefährdeten Fichtenbeständen um? Thomas Ledermann und Georg Kindermann Institut für Waldwachstum und Waldbau BFW-Praxistag 2017 Wege zum klimafitten Wald Wien, Gmunden, Ossiach, Innsbruck
Wie geht man mit gefährdeten Fichtenbeständen um? Thomas Ledermann und Georg Kindermann Institut für Waldwachstum und Waldbau BFW-Praxistag 2017 Wege zum klimafitten Wald Wien, Gmunden, Ossiach, Innsbruck
NATURWALDRESERVAT DAMM
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Abensberg NATURWALDRESERVAT DAMM Naturwaldreservat Damm Buche gewinnt an Wuchsraum. ALLGEMEINES Das Naturwaldreservat Damm ist das bisher einzige Buchenreservat
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Abensberg NATURWALDRESERVAT DAMM Naturwaldreservat Damm Buche gewinnt an Wuchsraum. ALLGEMEINES Das Naturwaldreservat Damm ist das bisher einzige Buchenreservat
Integralmelioration Zillertal
 Integralmelioration Zillertal Seite 1 16.10.2011 Integralmelioration Was ist das???? integral - umfassend Melioration - Verbesserung Unter dem Begriff Integralmelioration versteht man umfassende, interdisziplinäre
Integralmelioration Zillertal Seite 1 16.10.2011 Integralmelioration Was ist das???? integral - umfassend Melioration - Verbesserung Unter dem Begriff Integralmelioration versteht man umfassende, interdisziplinäre
Helvetia Schutzwald Engagement. Berner Oberland (BE).
 Helvetia Schutzwald Engagement. Berner Oberland (BE). Schutzwälder sind eine wichtige Massnahme zum Schutz vor Elementarschäden durch die Naturgefahren Steinschlag, Erdrutsch, Lawinen und Murgang. Oft
Helvetia Schutzwald Engagement. Berner Oberland (BE). Schutzwälder sind eine wichtige Massnahme zum Schutz vor Elementarschäden durch die Naturgefahren Steinschlag, Erdrutsch, Lawinen und Murgang. Oft
Ergebnisse der Forsteinrichtung im Gemeindewald Bingen
 Ergebnisse der Forsteinrichtung im Gemeindewald Bingen Multifunktionale Waldbewirtschaftung - Ausgleich von Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion - Naturnahe Waldwirtschaft, PEFC-Zertifizierung Waldbauliche
Ergebnisse der Forsteinrichtung im Gemeindewald Bingen Multifunktionale Waldbewirtschaftung - Ausgleich von Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion - Naturnahe Waldwirtschaft, PEFC-Zertifizierung Waldbauliche
Prof. Dr. Rudolf Bretschneider. GfK June 2, 2016 Title of presentation
 Prof. Dr. Rudolf Bretschneider GfK June, 0 Title of presentation Einschätzung zur Waldfläche in Österreich im Zeitvergleich (n=.000) (n=.000) 8 0 5 9 besser als in anderen Ländern schlechter als in anderen
Prof. Dr. Rudolf Bretschneider GfK June, 0 Title of presentation Einschätzung zur Waldfläche in Österreich im Zeitvergleich (n=.000) (n=.000) 8 0 5 9 besser als in anderen Ländern schlechter als in anderen
Geschichte. Die Alpenkonvention und ihre rechtliche Umsetzung in Österreich CIPRA-Österreich Jahresfachtagung 21./22. Oktober 2009 in Salzburg
 Die und ihre rechtliche Umsetzung in Österreich CIPRA-Österreich Jahresfachtagung 21./22. Oktober 2009 in Salzburg Die rechtliche Umsetzung der in Österreich- Ausgangslage und derzeitiger Stand Dr. Ewald
Die und ihre rechtliche Umsetzung in Österreich CIPRA-Österreich Jahresfachtagung 21./22. Oktober 2009 in Salzburg Die rechtliche Umsetzung der in Österreich- Ausgangslage und derzeitiger Stand Dr. Ewald
Anforderungen an die Landund Forstwirtschaft aus dem Blickfeld der Naturgefahrenprävention
 Anforderungen an die Landund Forstwirtschaft aus dem Blickfeld der Naturgefahrenprävention Workshop III Raumordnung und Naturgefahren Wien, 15. November 2005 Johannes Hübl Land- und forstwirtschaftlich
Anforderungen an die Landund Forstwirtschaft aus dem Blickfeld der Naturgefahrenprävention Workshop III Raumordnung und Naturgefahren Wien, 15. November 2005 Johannes Hübl Land- und forstwirtschaftlich
Hintergrundinformationen zum Wald der Ludwig-Maximilians-Universität München
 Hintergrundinformationen zum Wald der Ludwig-Maximilians-Universität München Thomas Knoke, Christoph Dimke, Stefan Friedrich Der Bayerische Kurfürst Max-Joseph gliederte per Erlass vom 8. April 1802 den
Hintergrundinformationen zum Wald der Ludwig-Maximilians-Universität München Thomas Knoke, Christoph Dimke, Stefan Friedrich Der Bayerische Kurfürst Max-Joseph gliederte per Erlass vom 8. April 1802 den
Schutzwaldbewirtschaftung unter betrieblichen und gesellschaftlichen Verpflichtungen. Bundesschutzwaldplattform Mariazell Dr.
 14 06 2012 Schutzwaldbewirtschaftung unter betrieblichen und gesellschaftlichen Verpflichtungen Bundesschutzwaldplattform Mariazell Dr. Georg Erlacher SCHUTZWALD BEI DER ÖBf AG Ausgangssituation Wild-
14 06 2012 Schutzwaldbewirtschaftung unter betrieblichen und gesellschaftlichen Verpflichtungen Bundesschutzwaldplattform Mariazell Dr. Georg Erlacher SCHUTZWALD BEI DER ÖBf AG Ausgangssituation Wild-
Klimawandel und Starkregen in Hessen
 Klimawandel und Starkregen in Hessen Dr. Heike Hübener, Fachzentrum Klimawandel Hessen Was hat Starkregen mit dem Klimawandel zu tun? Wärmere Luft kann mehr Feuchte aufnehmen als kühlere Luft Erreicht
Klimawandel und Starkregen in Hessen Dr. Heike Hübener, Fachzentrum Klimawandel Hessen Was hat Starkregen mit dem Klimawandel zu tun? Wärmere Luft kann mehr Feuchte aufnehmen als kühlere Luft Erreicht
Rolf Weingartner. Das Klima lässt uns nicht kalt Wasser in den Gebirgen der Welt
 Das Klima lässt uns nicht kalt Wasser in den Gebirgen der Welt Gruppe für Hydrologie Geographisches Institut Oeschger Centre for Climate Change Research Universität Bern Storylines Hydrologische Bedeutung
Das Klima lässt uns nicht kalt Wasser in den Gebirgen der Welt Gruppe für Hydrologie Geographisches Institut Oeschger Centre for Climate Change Research Universität Bern Storylines Hydrologische Bedeutung
Klimawandel und Nachhaltige Entwicklung
 Klimawandel und Nachhaltige Entwicklung Irene Roth Amt für Umweltkoordination und Energie, Kanton Bern Ittigen, Mai 2010 Inhalt 1) Einige Fakten zum Klimawandel 2) Klimawandel und Nachhaltige Entwicklung
Klimawandel und Nachhaltige Entwicklung Irene Roth Amt für Umweltkoordination und Energie, Kanton Bern Ittigen, Mai 2010 Inhalt 1) Einige Fakten zum Klimawandel 2) Klimawandel und Nachhaltige Entwicklung
Warum gibt es überhaupt Gebirge?
 Gebirge Es gibt heute viele hohe Gebirge auf der ganzen Welt. Die bekanntesten sind die Alpen in Europa, die Rocky Mountains in Nordamerika und der Himalaya in Asien. Wie sind diese Gebirge entstanden
Gebirge Es gibt heute viele hohe Gebirge auf der ganzen Welt. Die bekanntesten sind die Alpen in Europa, die Rocky Mountains in Nordamerika und der Himalaya in Asien. Wie sind diese Gebirge entstanden
WALD UND FORSTWIRTSCHAFT IM NECKAR-ODENWALD-KREIS
 WALD UND FORSTWIRTSCHAFT IM NECKAR-ODENWALD-KREIS NACHHALTIG NATURNAH MULTIFUNKTIONAL ZUKUNFTSORIENTIERT HOLZLIEFERANT ZUKUNFT HAT, WAS NACHWÄCHST Holz aus heimischen Wäldern ist ein nachhaltiger Rohstoff
WALD UND FORSTWIRTSCHAFT IM NECKAR-ODENWALD-KREIS NACHHALTIG NATURNAH MULTIFUNKTIONAL ZUKUNFTSORIENTIERT HOLZLIEFERANT ZUKUNFT HAT, WAS NACHWÄCHST Holz aus heimischen Wäldern ist ein nachhaltiger Rohstoff
Der Orkan Lothar (26.12.1999) Zehn Jahre danach
 Der Orkan Lothar (26.12.1999) Zehn Jahre danach Folie 2 Meteorologischer Ablauf Entstehung eines Sturmtiefs über dem Nordatlantik am 25. Dezember 1999 Rapider Druckabfall innerhalb weniger Stunden Zugbahn
Der Orkan Lothar (26.12.1999) Zehn Jahre danach Folie 2 Meteorologischer Ablauf Entstehung eines Sturmtiefs über dem Nordatlantik am 25. Dezember 1999 Rapider Druckabfall innerhalb weniger Stunden Zugbahn
Experimente zu den Themen Energie und Klimawandel
 Experimente zu den Themen Energie und Klimawandel Station 5: Klimawandel Schulfach: Biologie/Naturwissenschaften Sekundarstufe 1 Dieses Material ist im Rahmen des Projekts Bildung für einen nachhaltige
Experimente zu den Themen Energie und Klimawandel Station 5: Klimawandel Schulfach: Biologie/Naturwissenschaften Sekundarstufe 1 Dieses Material ist im Rahmen des Projekts Bildung für einen nachhaltige
r e b s r e l l a b e i r t e b t s r , h c s e l e t t i M n i r e t i e l r e i v e r, s s i e w a s i l önnen. hützen zu k
 der wald lebt Lebensräume erhalten und verbessern, Vielfalt gewährleisten und fördern: Das ist der Kern unserer Arbeit. Wir wollen keine räumliche Trennung der wirtschaftlichen und ökologischen Aufgaben
der wald lebt Lebensräume erhalten und verbessern, Vielfalt gewährleisten und fördern: Das ist der Kern unserer Arbeit. Wir wollen keine räumliche Trennung der wirtschaftlichen und ökologischen Aufgaben
Heimat- und Naturerlebnispfad
 Heimat- und Naturerlebnispfad Kohlberg Verehrte Besucher, der Landkreis Deggendorf lädt Sie herzlich zu einem Spaziergang entlang des Heimat- und Naturerlebnispfades Kohlberg ein. Auf ca. 1,5 km führt
Heimat- und Naturerlebnispfad Kohlberg Verehrte Besucher, der Landkreis Deggendorf lädt Sie herzlich zu einem Spaziergang entlang des Heimat- und Naturerlebnispfades Kohlberg ein. Auf ca. 1,5 km führt
Naturgefahren Mögliche Reaktionen. Tagung am 26. Januar 2011 in München. Dr. Jörg Stumpp
 Naturgefahren Mögliche Reaktionen Tagung am 26. Januar 2011 in München Dr. Jörg Stumpp WMO: 2010 war das wärmste Jahr in Geschichte der Wetteraufzeichnungen; Das letzte Jahrzehnt ebenfalls das wärmste
Naturgefahren Mögliche Reaktionen Tagung am 26. Januar 2011 in München Dr. Jörg Stumpp WMO: 2010 war das wärmste Jahr in Geschichte der Wetteraufzeichnungen; Das letzte Jahrzehnt ebenfalls das wärmste
1 NIEDERSCHLAGSMENGEN
 1 NIEDERSCHLAGSMENGEN Im Kanton Solothurn fallen im langjährigen Durchschnitt etwa 1240 mm Niederschläge pro Jahr. Das sind insgesamt rund 980 Mia. Liter Regen und Schnee oder ein 225000 km langer Zug,
1 NIEDERSCHLAGSMENGEN Im Kanton Solothurn fallen im langjährigen Durchschnitt etwa 1240 mm Niederschläge pro Jahr. Das sind insgesamt rund 980 Mia. Liter Regen und Schnee oder ein 225000 km langer Zug,
+++ StMELF aktuell +++ StMELF aktuell +++
 Bayerisches Sttsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Sttsminister Helmut Brunner informiert Ergebnisse der Kronenzustandserhebung 12 in Bayern Dezember 12 +++ StMELF aktuell +++ StMELF
Bayerisches Sttsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Sttsminister Helmut Brunner informiert Ergebnisse der Kronenzustandserhebung 12 in Bayern Dezember 12 +++ StMELF aktuell +++ StMELF
Wald in Leichter Sprache
 Wald in Leichter Sprache Warum müssen wir die Natur schützen? Wir Menschen verändern die Natur. Zum Beispiel: Wir fällen viele Bäume. Aber Bäume sind wichtig für saubere Luft. Wir Menschen brauchen saubere
Wald in Leichter Sprache Warum müssen wir die Natur schützen? Wir Menschen verändern die Natur. Zum Beispiel: Wir fällen viele Bäume. Aber Bäume sind wichtig für saubere Luft. Wir Menschen brauchen saubere
der Bach viele Bäche der Berg viele Berge die Bewölkung der Blitz viele Blitze der Donner Durch das Feld fließt ein kleiner Bach. Der Berg ist hoch.
 der Bach viele Bäche Durch das Feld fließt ein kleiner Bach. der Berg viele Berge Der Berg ist hoch. die Bewölkung Die Bewölkung am Himmel wurde immer dichter. der Blitz viele Blitze In dem Baum hat ein
der Bach viele Bäche Durch das Feld fließt ein kleiner Bach. der Berg viele Berge Der Berg ist hoch. die Bewölkung Die Bewölkung am Himmel wurde immer dichter. der Blitz viele Blitze In dem Baum hat ein
Baumartenwahl im Gebirge mit Berücksichtigung des Klimawandels. Referent: Dipl.-Ing. Christoph Jasser, Oö. Landesforstdienst
 Baumartenwahl im Gebirge mit Berücksichtigung des Klimawandels Referent: Dipl.-Ing. Christoph Jasser, Oö. Landesforstdienst Die Baumartenzusammensetzung entscheidet für die nächsten 70 150 Jahre über Stabilität,
Baumartenwahl im Gebirge mit Berücksichtigung des Klimawandels Referent: Dipl.-Ing. Christoph Jasser, Oö. Landesforstdienst Die Baumartenzusammensetzung entscheidet für die nächsten 70 150 Jahre über Stabilität,
Ökologie der Waldbewirtschaftung
 Ökologie der Waldbewirtschaftung Grundlage für erfolgreiche Wirtschaft Johann Zöscher Forstliche Ausbildungsstätte Ossiach des BFW Leiter Organisation des BFW Standorte Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum
Ökologie der Waldbewirtschaftung Grundlage für erfolgreiche Wirtschaft Johann Zöscher Forstliche Ausbildungsstätte Ossiach des BFW Leiter Organisation des BFW Standorte Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie
 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie Es gilt das gesprochene Wort! Sperrfrist: 16. Februar 2009, 11:30 Uhr Pressestatement des Bayerischen Staatsministers
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie Es gilt das gesprochene Wort! Sperrfrist: 16. Februar 2009, 11:30 Uhr Pressestatement des Bayerischen Staatsministers
1.1 Artenvielfalt. Was die Biodiversität?
 1.1 Artenvielfalt Was die Biodiversität? Bisher haben die Menschen ungefähr 1,7 Millionen Tier- und Pflanzenarten entdeckt. Experten schätzen, dass es noch ungefähr 20 Millionen unerforschte Arten gibt.
1.1 Artenvielfalt Was die Biodiversität? Bisher haben die Menschen ungefähr 1,7 Millionen Tier- und Pflanzenarten entdeckt. Experten schätzen, dass es noch ungefähr 20 Millionen unerforschte Arten gibt.
Schalen- Wildverbiss. und seine Folgen
 Schalen- Wildverbiss und seine Folgen Der Wildverbiss im Jagdrecht Wichtige gesetzliche Bestimmungen: 21, Abs. 1 Bundesjagdgesetz: Der Abschuss des Wildes ist so zu regeln, dass die berechtigten Ansprüche
Schalen- Wildverbiss und seine Folgen Der Wildverbiss im Jagdrecht Wichtige gesetzliche Bestimmungen: 21, Abs. 1 Bundesjagdgesetz: Der Abschuss des Wildes ist so zu regeln, dass die berechtigten Ansprüche
NATURWALDRESERVAT ROHRHALDE
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Mindelheim NATURWALDRESERVAT ROHRHALDE Naturwaldreservat Rohrhalde Laubbäume prägen die Nordteile des Naturwaldreservats. ALLGEMEINES Das Naturwaldreservat
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Mindelheim NATURWALDRESERVAT ROHRHALDE Naturwaldreservat Rohrhalde Laubbäume prägen die Nordteile des Naturwaldreservats. ALLGEMEINES Das Naturwaldreservat
Die Folgen des Klimawandels: Chancen und Herausforderungen für Vorarlberg
 Bereit für das Klima von morgen? Dornbirn, 19. Okt. 2017 Die Folgen des Klimawandels: Chancen und Herausforderungen für Vorarlberg Prof. Dr. Bruno Abegg Ins$tut für Geographie, Universität Innsbruck bruno.abegg@uibk.ac.at
Bereit für das Klima von morgen? Dornbirn, 19. Okt. 2017 Die Folgen des Klimawandels: Chancen und Herausforderungen für Vorarlberg Prof. Dr. Bruno Abegg Ins$tut für Geographie, Universität Innsbruck bruno.abegg@uibk.ac.at
D e r S c h r i t t i n s 2 1. J a h r h u n d e r t
 D e r S c h r i t t i n s 2 1. J a h r h u n d e r t Unsere Welt am Anfang des neuen Jahrtausends Die Welt am Anfang des neuen Jahrtausends unterscheidet sich in wichtigen Punkten von der Welt des 20.
D e r S c h r i t t i n s 2 1. J a h r h u n d e r t Unsere Welt am Anfang des neuen Jahrtausends Die Welt am Anfang des neuen Jahrtausends unterscheidet sich in wichtigen Punkten von der Welt des 20.
Stand: Siehe auch Blätter Nr. E.5 / F.2 / F.3 / F.4 / F.10 / I.1. Dienststelle für Wald und Landschaft
 Kantonaler Richtplan - Koordinationsblatt Wald Natur, Landschaft und Wald Funktionen des Waldes Stand: 21.09.2005 Siehe auch Blätter Nr. E.5 / F.2 / F.3 / F.4 / F.10 / I.1 Instanzen zuständig für das Objekt
Kantonaler Richtplan - Koordinationsblatt Wald Natur, Landschaft und Wald Funktionen des Waldes Stand: 21.09.2005 Siehe auch Blätter Nr. E.5 / F.2 / F.3 / F.4 / F.10 / I.1 Instanzen zuständig für das Objekt
Klimaschutz für Einsteiger
 www.nah.sh Klimaschutz für Einsteiger Wie Sie mit dem Nahverkehr Ihre persönliche CO2-Bilanz verbessern. Schleswig-Holstein. Der echte Norden. 1 Liebe Nahverkehrs- Nutzer, inhalt CO2 und Klimawandel wie
www.nah.sh Klimaschutz für Einsteiger Wie Sie mit dem Nahverkehr Ihre persönliche CO2-Bilanz verbessern. Schleswig-Holstein. Der echte Norden. 1 Liebe Nahverkehrs- Nutzer, inhalt CO2 und Klimawandel wie
Ausgewählte Ergebnisse des Forschungsprogramms Wald und Klimawandel
 Ausgewählte Ergebnisse des Forschungsprogramms Wald und Klimawandel Tagung «Klimawandel und Wald eine ökonomische Sicht» Zollikofen, HAFL, 29. April 2015 Dr. Peter Brang Leiter des Forschungsprogramms
Ausgewählte Ergebnisse des Forschungsprogramms Wald und Klimawandel Tagung «Klimawandel und Wald eine ökonomische Sicht» Zollikofen, HAFL, 29. April 2015 Dr. Peter Brang Leiter des Forschungsprogramms
