INTEGRATION IN DER OBERLAUSITZ
|
|
|
- Daniela Braun
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 INTEGRATION IN DER OBERLAUSITZ Texte zum Symposium Angekommen und nun? am 28. Oktober 2017 in Görlitz KIB KOMMUNIKATION INFORMATION BILDUNG
2 2018 Institut für Kommunikation, Information und Bildung e. V. Lektorat: Luise Träger Satz: Daniel Winkler Fotografie: Institut für Kommunikation, Information und Bildung e. V.
3
4
5 INHALT 5 Angekommen und nun? Eröffnung des Symposiums 7 von Raj Kollmorgen Was sind Vorurteile und wie kann man damit umgehen? Ein Interview 11 von Johannes Marquard und Jörg Heidig Gesprächstechniken zum Umgang mit Vorurteilen 19 von Johannes Marquard und Jörg Heidig Vorurteilsfreies Fragen 19 Vorurteilsfreies Fragen: Fragearten 19 Hart in der Sache weich mit den Menschwen Das Harvard Konzept 21 Bericht zum Symposium 23 von Tom Hohlfeld Die Podiumsdiskussion 23 Die vier Themenrunden Bildung, Arbeitsmarktzugang, Zusammenarbeit und Zivilgesellschaft 27 Fazit der Abschlussdiskussion: Das Symposium als wichtiger Beitrag zur Netzwerkarbeit in der Region 29 Lessons learned 29 von Jörg Heidig Vorurteile gehen nicht weg, wenn man belehrt 31 Texte zum Symposium Angekommen - und nun? am 28. Oktober 2017 in Görlitz
6 Das KIB Institut zu Gast in der Hochschule Zittau/Görlitz. Verschiedene Akteure präsentieren sich beim Markt der Möglichkeiten.
7 ANGEKOMMEN UND NUN? ERÖFFNUNG DES SYMPOSIUMS Raj Kollmorgen Sehr geehrter Herr Ahrens, sehr geehrter Herr Deinege, sehr geehrter Herr Zenker, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter von Ämtern, Unternehmen, Vereinen und Initiativen der Region, sehr geehrte Damen und Herren, wobei ich alle Menschen mit einem Fluchtschicksal in besonders herzlicher Weise begrüßen möchte, ich möchte meine wenigen einführenden Worte mit dem Hinweis darauf beginnen, dass das Thema Integration nicht nur in Sachsen, sondern in der gesamten Bundesrepublik in den vergangenen beiden Jahren in zweierlei Gestalt wahrgenommen und diskutiert wurde: einerseits auf der Ebene der praktischen Arbeit von Verwaltungen, Vereinen und Initiativen, die sich um dieses Problem kümmern, und andererseits in Form politischer Debatten, wie sie in Parteien, Parlamenten und in den Massenmedien stattfanden. Mein Eindruck ist, dass diese beiden Diskussionsstränge oft gänzlich losgelöst voneinander verliefen. Das vom KIB e. V. organisierte und dankenswerterweise von der Bundeszentrale für politische Bildung geförderte Symposium soll auch dieser Diskurstrennung etwas entgegensetzen und strebt ausdrücklich eine kommunikative Öffnung, einen Dialog und wechselseitiges Lernen an. Grundsätzlich geht es in diesem Symposium aber, wie sein Titel verheißt, um die Integrationsperspektiven nach dem Ankommen. Wenn es je eine Flüchtlingskrise gab die sowieso besser Fluchtkrise genannt werden sollte, weil nicht allein die Flüchtenden die Krise verursacht haben und in ihrem Zentrum standen, sondern komplexe Bedingungen und eine Vielzahl von Akteuren in Europa und im Nahen und Mittleren Osten in den Jahren 2014/2015 dazu beitrugen, dass nicht nur hunderttausende Menschen sich auf den Weg machten, sondern dass das überkommene europäische System der Kontrolle und Abwehr, aber auch der Aufnahme und Verteilung von Flüchtenden und Zuwanderern praktisch zusammenbrach und seitdem mühsam neu strukturiert werden muss wenn es also je eine solche Krise gab, dann ist sie jedenfalls seit spätestens März 2016 vorbei. Die Zahl der Flüchtenden, die Europa, die Bundesrepublik und Sachsen seitdem erreichen, ist substanziell gesunken. Sachsen nimmt seit März 2016 im Monat zwischen 500 und Asylsuchende auf. Die ländlichen Regionen Sachsens nehmen kaum noch neue Geflüchtete auf; viele der in den Jahren 2015/2016 in die Oberlausitz gekommenen Fluchtmigrant*innen haben die Region bereits wieder verlassen. In der Stadt Görlitz stellen die ostmitteleuropäischen Zuwanderer, allen voran Polinnen und Polen, mit weitem Abstand die größte Gruppe der Ausländer. Gegenwärtig (Juni 2017) leben etwa Fluchtmigrant*innen (Asylsuchende und Personen mit Aufenthaltsgenehmigung oder Asylstatus) in Görlitz, das ist ein Anteil an der Gesamtbevölkerung von knapp über 2 %. Gibt es also keine Probleme mehr? Nur weil die Fluchtmigration zurzeit erheblich abgenommen und das massenmediale Interesse nachgelassen hat, heißt das nicht, dass die Integration unproblematisch verläuft und wir uns als Staat und Bürger*innen zurücklehnen können. Registrierung, Unterbringung und Erstversorgung wurden gewährleistet, ja. Aber nun? Nicht nur die bürokratischen Mühlen mahlen langsam: Ablehnung oder Anerkennung, Duldung oder Abschiebung, Rückkehr oder Bleibeperspektive? Für viele sind selbst hinsichtlich ihres Status Fragen offen und laufen juristische Überprüfungen. Aber selbst wenn dieser abschließend geklärt wurde und die Geflüchteten hier leben, bleiben die Fragen: Wie weiter? Welche Problem- und Aufgabenfelder stellen sich der Integration vor Ort? Wer hat mit wem worauf zu achten? Was ist wie zu tun? Sucht man nach einem gehaltvollen Erklärungsansatz, ganz gleich ob man sich aus einer eher erklärenden oder eher gestaltenden Perspektive mit dem Thema Integration beschäftigt, empfehlen sich aus sozialwissenschaftlicher Sicht komplexe anerkennungstheoretisch fundierte Zugänge. Diese unterscheiden drei fundamentale Dimensionen von Integration: 1. Die erste Dimension könnte man objektiv zuweisend oder auch systemisch nennen. Hier geht es um Rechte (vor allem Freiheits-, politische Partizipations- und wohlfahrtsstaatliche Anspruchsrechte), aber auch Pflichten (als Staats- und Wohlfahrtsstaatsbürger), die systemischen Charakter tragen, d. h. durch gesellschaftliche Teilsysteme (wie Wirtschaft, Bildung oder öffentliche Wohlfahrt) getragen werden und nicht aus einem bestimmten Handeln Einzelner resultieren, sondern im Kern mit dem rechtlichen Status einer Person verbunden sind. Im Migrationskontext ist also zu klären, ob man überhaupt einen Anspruch hat zu bleiben, welchen Bleibestatus man hat, welche Ressourcen man empfängt, ob man eine Arbeits- 7 Texte zum Symposium Angekommen - und nun? am 28. Oktober 2017 in Görlitz
8 8 erlaubnis erhält oder nicht und wenn man eine bekommt, wie man mindestens entlohnt wird. Wie wichtig die Klärung dieser Fragen ist, liegt auf der Hand. Denn nicht nur sind Ausbildung und Arbeit ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Weg, Einkommen jenseits der Sozialhilfe zu erzielen und insofern am Wirtschaftssystem als gleichberechtigter Tauschpartner (Produzent und Konsument) zu partizipieren, mithin nicht (länger) als Empfänger von,almosen angesehen zu werden und sich selbst zu erfahren. Vielmehr stellt die Erwerbsarbeit damit und durch die Teilhabe an konkreten Arbeitsprozessen und Arbeitsgruppen eine zentrale Quelle sozialer Integration und Wertschätzung dar. Migrant*innen werden durch Erwerbsarbeit nicht nur ökonomisch integriert, sondern auch sozial, was den kontinuierlichen Wissenserwerb über die Aufnahmegesellschaft einschließt wie den Wissensaustausch mit den Einheimischen und: sie erfahren auf diese Weise sich als anerkannte Mitglieder der Gesellschaft (und können andere anerkennen in ihrem Tun). Es geht in dieser Dimension aber auch um Ansprüche, die mit Kindern zu tun haben: Wer hat ein Anrecht auf einen Kita-Platz? Und wenn z.b. alle das Recht haben, bekommt man auch einen Kindergartenplatz in der Nähe oder nicht? Wer wird in welchen Schultyp eingeschult oder darf welche weiterführende Schule besuchen? Vieles was unseren demokratischen Sozialstaat ausmacht, gehört also zu dieser Dimension. Sie betrifft am Ende jede einzelne Person, deren rechtliche und ökonomische Ressourcenausstattung und die gesellschaftliche Zuweisung von Entwicklungschancen. Migrant*innen können langfristig nur dann erfolgreich integriert werden, wenn sie soweit sie einen Aufenthaltstitel erlangen als gleichberechtigte Staatsbürger*innen an allen Teilsystemen und deren Integrationschancen teilhaben und damit als gleichberechtigte Nehmende und Gebende der Systeme und Gesamtgesellschaft agieren sowie anerkannt werden können. 2. Es gibt eine zweite Dimension, die mindestens genauso wichtig ist, und einen intersubjektivorganisatorischen Charakter trägt. Im Kern geht es hier um die Kommunikation und Organisation von Interessen. Gelingende Integration setzt mittelfristig die Wahrnehmung, Artikulation und (demokratische) Durchsetzung von Interessen und daher die Selbstorganisation von Interessengruppen und Gleichgesinnten voraus. Das gilt auch für Migrantinnen und Migranten. Das erfordert einerseits, dass die Mehrheitsgesellschaft dies nicht nur erlauben muss (siehe 1.), sondern dass sie diese Interessenformierung anerkennen sollte. Die Artikulation eigener Interessen auch von Migrant*innen ist kein Makel, sondern ein Gewinn, weil nur über die kooperative wie konfliktuöse Interessenvermittlung, also ein friedliches Mit- wie Gegeneinander von Interessengruppen und darauf gründende Konsensfindung, demokratische Wohlfahrtsstaaten funktionieren können. Nur wenn man weiß, was bestimmte Gesellschaftsgruppen politisch wollen und wenn es darüber zum Streit und einer Vermittlung kommt, können sich alle Gruppen im Gemeinwesen wiederfinden, von den anderen Gruppen als relevante erkannt und anerkannt werden und kann daher eine demokratische Entwicklung der Gesamtgesellschaft realisiert werden. Dies setzt aber andererseits die Einsicht und den Willen bei den Migrant*innen voraus, sich selbst und zwar demokratisch zu organisieren. Das beginnt bei religiösen Organisationen, aber es betrifft auch politische Verbände. Man muss keine eigene,migrantenpartei gründen (wollen). Vermutlich wäre das auch nicht besonders klug, aber selbst das muss grundsätzlich möglich sein und politisch akzeptiert werden. Eigene Interessen werden aber auch in Vereinen oder Bürgerinitiativen artikuliert und zwar sowohl in selbst gegründeten wie in bereits bestehenden. Es geht aber immer um die Frage, dass man/frau artikuliert, welche Bedürfnisse es gibt, wo es hingehen soll, wie man sich als Interessengemeinschaft organisieren und sich am politischen und zivilgesellschaftlichen Diskurs vor allem in den konkreten lokalen Zusammenhängen beteiligen will. Noch einmal, die Mehrheitsgesellschaft sollte das positiv akzeptieren und begreifen, dass sich Interessen vor allem in Konflikten herausschälen und in ihnen vermittelt werden. Wir haben oft die Vorstellung, dass dort, wo Konflikt und Streit sind, keine Integration stattfindet. Das ist vollkommen falsch. Soziale Integration realisiert sich über Konflikte und Auseinandersetzungen. Wir können nur zusammenkommen, wenn wir verstehen, dass wir unterschiedliche Sichtweisen und unterschiedliche Interessen besitzen. Deshalb sollten wir die Aushandlung von Konflikten auch mit Migrant*innen und ihren Interessenvertretungen nicht nur zulassen, sondern befördern. Ob und wie lange es besonderer Migrantenorganisationen braucht, kann nicht prognostiziert werden. Die polnischen Migrant*innen des 19. Jahrhunderts im Ruhrgebiet besaßen über Jahrzehnte eigene Kirchengemeinden und Vereine. Heute gibt es sie nicht mehr. Die nach dem II. Weltkrieg vertriebenen Schlesier oder Sudetendeutschen verfügen heute noch, also nach über 70 Jahren, über eigene,landsmannschaftliche Verbände. An diesen lässt sich im Übrigen gut Integration in der Oberlausitz
9 studieren, was Interessenverbände in Integrationsprozessen leisten können und wo sie problematische Strategien entwickeln. 3. Bei der dritten Dimension handelt es sich um die intersubjektiv-gemeinschaftliche Ebene der Integration und Anerkennung, die stark von Emotionen getragen wird. In der Politikwissenschaft und in der Philosophie gibt es eine lange Tradition, in diesem Zusammenhang von Leidenschaften zu sprechen. Während es sich auf der zweiten Ebene um Interessen, also Produkte des Verstandes, handelt ( Was will ich? ), und es auf der ersten Ebene um Vernunft ( Was ist in einem Gemeinwesen sinnvoll?, Wie kann es am besten funktionieren? ) ging, handelt es sich bei der Ebene der Leidenschaften um emotionalisierte soziale Bindungen und daraus erwachsende wechselseitige Anerkennungen. Es geht um den Austausch in Gruppen, aber auch über Gruppen- und ethnische Grenzen hinweg. Nicht zuletzt geht es hier auch um die Identifikation mit dem Land, in das man migrieren will, in dem man irgendwie gelandet ist und in dem Mann oder Frau bleiben möchte. Insofern handelt es sich zum einen um die gefühlte Identifikation mit der Ankunftsgesellschaft und umgekehrt: mit den Ankommenden durch die Aufnahmegesellschaft. Die Migrant*innen sind erst dann integriert, wenn sie als Gleiche, d.h. grundsätzlich ebenso wertgeschätzte Menschen wie alle anderen, anerkannt und so auch in der Alltagspraxis wie im Ausnahmefall behandelt werden (bei Begegnungen auf Arbeit ebenso wie auf dem Fußballplatz oder in der Dorf-Disco). Zum anderen geht um die Integration in kleinen Gruppen wie Familien, Freundschaftskreise oder Partnerschaften. Wir alle brauchen solche sozialen Nahbeziehungen und Gefühle der Zusammengehörigkeit, die anders als bei den Rechten oder Interessen nicht auf rationalen Erwägungen basieren, sondern sich zwanglos einstellen und gelebt werden. Ohne solche Bindungen sind wir haltlos und in unseren Lebenswelten desintegriert. Eben darum brauchen Migrant*innen einerseits die Chance, sich mit Menschen ihrer Ethnie, ihres Glaubens, ihrer Heimat, ihres Schicksals zu vergemeinschaften (was z. B. den Nachzug von Familienangehörigen einschließen kann). Das ist nichts Hinderliches im Gegenteil. Erst eine zwanglose familiäre Geborgenheit in der Fremde lässt sich uns öffnen gegenüber dem Neuen, dem Anderen, den Fremden (Einheimischen). Andererseits sollte das nicht zur Bildung abgeschotteter ethnischer oder religiöser Subkulturen und Milieus führen. Um das aber zu verhindern oder doch zumindest einzudämmen, braucht es genau jene Teilhaben und Anerkennungen, die unter Punkt 1 und 2 beschrieben wurden. Wenn diese realisiert werden und längerfristig greifen, erhöhen sich die Chancen für eine transkulturelle Integration auch im Bereich der emotionalisierten Nahbeziehungen oder um es zuspitzend zu formulieren: Wenn sich Deutsche und Syrer, Deutsche und Afghanen und so weiter unproblematisch ineinander verlieben können und miteinander Partnerschaften eingehen, Familien gründen, dann ist jedenfalls auf der Ebene der Leidenschaften soziale Integration gelungen. Zusammengefasst lässt uns dieses Modell verstehen: Integration ist kein einfacher, sondern ein komplexer sozialer Prozess. Er hat mehrere Ebenen oder Dimensionen und wird sich nicht schnell vollziehen. Wir brauchen einen langen Atem und wir brauchen mit Sicherheit viele Akteure, die ihre unterschiedlichen Sichtweisen und Interessen einbringen und am Integrationsprozess mitwirken. Integration ist, wenn sie gelingen soll, ein langfristiger Prozess, welchen wir als Gesellschaft nur gemeinsam tragen können. Er ist kein Selbstläufer. Hören wir uns um in Städten und Gemeinden, bei Menschen mit Fluchterfahrung, bei Initiativen und Arbeitgebern, bei Bildungseinrichtungen oder im privaten Umfeld so wird klar, dass die Herausforderungen noch lange nicht bewältigt sind, im Gegenteil. Wenn man aber genau hinsieht, bemerkt man, dass sich viele Menschen auch in unserer Region mit diesen Herausforderungen aus professioneller Perspektive, im Ehrenamt, im familiären Umfeld beschäftigen. Ganz praktisch, jeden Tag. Viele Ideen, Projekte und Ansätze sind aber kaum bekannt. Manchmal sind es sogar ganz einfache Dinge, die helfen. Nur wissen wir (zu) wenig darüber. Das liegt nicht nur daran, dass viele Menschen diese Arbeit zum ersten Mal oder jedenfalls erstmalig in diesem Umfang leisten. Es liegt auch an einem Mangel an Austausch über die Grenzen der Einrichtungen, Behörden, Unternehmen, Initiativen usw. hinweg. Eigentlich sind all diese Beobachtungen und Modellüberlegungen Gemeinplätze. Zugleich markieren sie aber den Grund und in gewisser Weise auch das Ziel des heutigen Symposiums. Es geht genau um diese multiperspektivischen Sichten und Verständnisweisen auf das Problem der Integration in unserer Region. Es geht darum, dass die vielen Akteure, die tätig sind, sich wechselseitig kennenlernen und vernetzen (können). Diesen Austauschund Lernprozess wollen wir mit dem Symposium befördern und damit vielleicht auch einen Beitrag dazu leisten, dass die eingangs angesprochenen Diskursmauern zwischen der lokalen Integrations- 9 Texte zum Symposium Angekommen - und nun? am 28. Oktober 2017 in Görlitz
10 10 Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege begrüßt die Gäste und Teilnehmer. Die Podiumsgäste v. l. n. r.: Prof. Kollmorgen (Hochschule Zittau/Görlitz), Frau Almeida (Steinhaus Bautzen e. V.), Herr Sernow (SQS), Herr Deinege (OB Görlitz), Herr Ahrens (OB Bautzen), Herr Zenker (OB Zittau), Herr Langhammer (Sachsenfenster GmbH & Co. KG), Herr Suliman (Dolmetscher), Frau Tamiri (Leuchtturm-Majak e. V.) Integration in der Oberlausitz
11 praxis und den politischen wie massenmedialen Auseinandersetzungen jedenfalls etwas eingerissen werden oder ins Wanken geraten. Ich hoffe, dass uns das gelingen wird. Ich danke Ihnen allen sehr, dass Sie die Einladung zum Symposium angenommen haben, dass sie gekommen sind, um mit uns und untereinander zu reden, Gemeinsames zu entdecken und nach neuen Ideen zu suchen. Raj Kollmorgen ist Professor für Soziologie/Management sozialen Wandels an der Hochschule Zittau/Görlitz und leitet das Forschungsinstitut Transformation, Wohnen und soziale Raumentwicklung (TRAWOS). WAS SIND VORURTEILE UND WIE KANN MAN DAMIT UMGEHEN? EIN INTERVIEW Johannes Marquard und Jörg Heidig Wenn das wirklich so ist, dann ist richtiger Dialog also tatsächlich nicht möglich? Doch. Allerdings erfordert wirklicher Dialog zunächst, dass man andere Meinungen erträgt, dass man die jeweils andere Seite nicht vorverurteilt. Denn genau das geschieht. Anhänger des rechten Spektrums mögen in Vertretern der Willkommenskultur linksgrün versiffte Aktivisten sehen, während Angehörige des linken Spektrums vielerorts Alltagsrassismus oder gar Nazis wittern. So richtig kann ich mir nicht vorstellen, dass man mit denen wirklich vernünftig reden kann. Da bin ich anderer Meinung: Man kann wohl. Und ich gehe sogar noch weiter: Wir müssen sogar. Nicht, um Rassisten zu bekehren. Vorurteile verschwinden nicht durch Belehrung. Wirkliche Rassisten wird man womöglich auch nicht durch Dialog ändern. 11 In der Tat ist der Umgang mit Vorurteilen wirklich schwierig. Ich habe in solchen Diskussionen manchmal von Anfang an das Gefühl, dass man mit denen einfach nicht reden kann und trotzdem müssen wir es doch zumindest versuchen, oder? Naja, die Frage, die Sie damit stellen ist: Wie ist Kommunikation möglich, wenn sie zumindest auf den ersten Blick nicht möglich scheint? Ich möchte behaupten, dass Kommunikation in vielen Fällen auch gar nicht möglich sein soll, denn die Voreinstellungen der Beteiligten sind meistens derart, dass zwar vorgetragen wird, dass man ja gern kommunizieren würde, dies aber aus Gründen, die meistens an der jeweils anderen Seite festgemacht werden, nicht könnte. Wenn aber Kommunikation schon durch die Voreinstellung verhindert wird, ist die Frage nach einer geeigneten Art und Weise der Kommunikation unnötig. Wollen Sie etwa sagen, dass eine Einigung von vornherein kein erklärtes Ziel und damit unerreichbar ist? Genau das ist nach meiner Beobachtung die selbsterfüllende Prophezeiung, die jeden Tag hundertfach stattfindet: Da diskutieren Menschen mit völlig unterschiedlichen und oft von vornherein gegenläufigen oder gar feindseligen Voreinstellungen miteinander. Es offenbart sich, dass nicht nur ihre Meinungen, sondern auch ihre Sichtweisen auf die Welt insgesamt völlig unvereinbar sind. Mag anfänglich noch Dialogbereitschaft signalisiert worden sein, führen die Diskussionen dann zur Polarisierung und damit indirekt zur Bestätigung der jeweiligen, in der Regel bereits vorher vorhandenen Überzeugung, dass man mit der jeweils anderen Seite nicht reden könne. Jetzt verstehe ich gar nix mehr. Ich dachte es geht darum zu kommunizieren und zu argumentieren, damit diese Leute einsehen, dass sie Unrecht haben, oder? Lassen Sie mich diese Sichtweise ein wenig genauer erläutern: Stellen Sie sich bitte einmal unsere Verfassung als einen Boden vor, auf dem man stehen kann. Die meisten Einwohner Deutschlands stehen auf diesem Boden der Verfassung. Wenn einer jedoch Polizisten verletzen will, mit dem LKW in eine Ansammlung von Menschen fährt oder ein Flüchtlingswohnheim anzündet, dann steht er ganz und gar nicht auf dem Boden der Verfassung. Wir haben einen Grad der Zivilisation erreicht, auf dem wir im Sinne der Mehrheit der Gesellschaft solche Menschen nicht einfach töten, sondern nach Möglichkeit verhaften und quasi per Gerichtsverfahren auf den Boden der Verfassung zurückzerren. Das ist ein wichtiger Unterschied: Wir verlassen nicht den Boden der Verfassung, sondern wir halten uns auch bei der Verfolgung schwerster Straftaten an die verfassungsmäßigen Vorgaben. Nun sind die wenigsten Menschen bereit, ihre radikalen Sichtweisen in solche Taten umzusetzen. Zwischen dem Boden der Verfassung und jenen, die so weit draußen stehen, dass sie solche Taten begehen, ist es ein weiter Weg. Und dieser Weg führt durch das unwegsame Gelände der Radikalisierung. Die ersten Meter stellen quasi den Rand des Bodens der Verfassung dar. Die Wege sind hier noch gut ausgetreten, das ist die Welt der Demonstranten, die einen Galgen zur Demonstration mitbringen, mit Trillerpfeifen den Tag der Einheit vermiesen oder in Hamburg gegen den G20-Gipfel demonstrieren und anderen Menschen gezielt Texte zum Symposium Angekommen - und nun? am 28. Oktober 2017 in Görlitz
12 12 Daniel Sernow auf dem Podium im Gespräch über Berufliche Integration. Hamida Tamiri erzählt über Ihre ganz persönlichen Erfahrungen. Integration in der Oberlausitz
13 Angst einjagen. Die Letzteren verlassen den Boden der Verfassung vollends, wenn sie, quasi an sich selbst aufgeputscht, im Namen der Kapitalismuskritik Autos und Geschäfte demolieren und Polizisten angreifen. Solche Handlungen begehen noch vergleichsweise viele Menschen. Deutlich weniger an Zahl sind jene, die sich trauen, Anschläge auf Infrastruktur zu verüben. Das mag noch ohne explizite Tötungsabsicht geschehen. Von hier aus ist es dann aber nicht mehr weit zu gezielten Angriffen auf Polizisten und Zivilisten mit der Absicht, mindestens schwer zu verletzen, wenn nicht gar zu töten. Dann sprechen wir von Terror. Ich möchte das Gelände zwischen dem Boden der Verfassung und dem Gebiet des tatsächlichen Terrors als Grauzone bezeichnen. In dieser Grauzone gibt es viele Menschen. Die Frage ist nun: Wie kommen diese Menschen zurück auf den Boden der Verfassung? Wir können diese Aufgabe nicht nur der Polizei und den Gerichten überlassen. Wir leben in einer Demokratie und Demokratie bedeutet nicht nur Meinungsfreiheit, sondern auch die Hoffnung auf Dialog. Das ist ja ein ganz schöner Brocken und ziemlich viel Verantwortung für uns. Lassen wir das mal so stehen. Ich habe noch eine andere Frage. Es gibt doch unzählige Trainings und Seminare wie dieses, also solche gegen Rassismus und sowas. Weshalb hält sich das denn dann so hartnäckig? Die meisten Trainings, die zum Thema Toleranz und Demokratisierung, gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit durchgeführt werden, haben meiner Ansicht nach keine Wirkung. Weil die besagten Trainings vor allem belehren und damit vor allem diejenigen zufriedenstellen, die sie durchführen oder finanzieren. Belehrungen helfen nichts, wenn wir wirklich kommunizieren wollen. Stellen Sie sich bitte einmal vor, Sie seien Rassist. Kein richtiger, kein Aktivist oder so, aber eben jemand, der Menschen anderer Herkunft nicht leiden kann. Puh, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht was das bringen sollte. Ehrlich gesagt finde ich, dass es denen, die in der heutigen Zeit noch Rassisten sind, einfach an Bildung fehlt und an Empathie sowieso. Sehen Sie, Sie können das ja auch. Was kann ich? Na das mit den Vorurteilen. Also jetzt drehen Sie mir die Worte ja im Munde um. Wollen Sie etwa sagen, wir sollen die einfach so machen lassen und uns an die eigene Nase fassen? Wofür ich plädiere, ist mehr Offenheit und Dialogbereitschaft unter Diskussionspartnern. Wir müssen in der Lage sein und bleiben, unser Zusammenleben zu organisieren. Vorverurteilungen helfen da wenig. Wenn die einen meinen, dass Deutschland außer der gemeinsamen Sprache keine näher definierbare Kultur besitze, dann erscheint das ebenso wenig hilfreich wie die Einlassung, dass man überhaupt keine Migranten mehr hereinlassen solle. Während die einen sagen, dass der Kapitalismus tiefe Furchen der Ungerechtigkeit hinterlassen habe und sich nicht zuletzt genau deshalb die Welt im Umbruch befinde und man mit den neuen (migrantischen) Realitäten leben müsse, meinen die anderen, dass wir uns gerade jetzt auf eine Leitkultur besinnen und als Westen zusammenrücken sollten, um Migration und andere oft als Gefahren verstandene Themen besser in den Griff zu kriegen. Die entsprechenden Diskussionen werden derzeit in der Regel so geführt, dass am Ende polarisiertere Meinungen herrschen als vorher. Dabei wäre das Gegenteil notwendig, wenn wir langfristig handlungsfähig bleiben wollen von der kommunalen bis hinauf zur europäischen Ebene. Können Sie da mal ein Beispiel machen? Sehr gern. Nehmen wir einmal das Beispiel der Flüchtlingsthematik: In Diskussionen beobachte ich vor allem zwei Gruppen. Die erste Gruppe sind die Vertreter der Willkommenskultur. Auf der anderen Seite stehen die Gegner. Die Sichtweisen beider Seiten kranken meines Erachtens daran, dass sie die Realität nicht vollständig anerkennen bzw. jeweils einen signifikanten Teil der Realität ausblenden. Während die Vertreter der Willkommenskultur vor allem auf die positiven Seiten der Migration schauen und bspw. die Unterscheidung zwischen Flüchtlingen und Migranten weitgehend ablehnen, ignorieren sie das migrantische Binnenspektrum und verorten verfehlte Integration insbesondere beim (unterstellten) Rassismus der deutschen Mehrheit, bei der Schwierigkeit, sich durch den deutschen Behördendschungel zu finden etc. Zum besagten migrantischen Binnenspektrum gehören aber nicht nur Flüchtlinge, die vorübergehend Schutz vor Krieg suchen oder sich hier integrieren möchten. Es sind auch nicht wünschenswerte Motivationen vorhanden von der geplanten Ausnutzung des deutschen Sozialsystems über Partisanen, die zur Organisation der Diaspora-Finanzierung ihrer Verbände hergeschickt werden, über die gezielte Organisation von 13 Texte zum Symposium Angekommen - und nun? am 28. Oktober 2017 in Görlitz
14 14 Rege Reaktionen aus dem Publikum beim Thema Verwaltung. Die Oberbürgermeister der Städte Görlitz, Bautzen und Zittau im Austausch auf dem Podium. Integration in der Oberlausitz
15 kriminellen Aktivitäten bis hin zu perspektivlosen Menschen, die, mit einer Duldung ausgestattet, ebenso angetrunken wie aggressiv in Innenstädten marodieren. Terroristen bleiben die absolute Ausnahme, aber auch diese sind darunter. Das ist Teil der Realität ein Teil nur, aber eben ein Teil, der existiert und mit dem man sich befassen muss. Die andere Seite ist in der Regel generell dagegen und zwar gleichfalls unter Ausblendung eines Teils der Realität. Diese besagt, dass sich die Welt tatsächlich wandelt und dass man sich dazu verhalten muss. Egal, wer gewählt wird das Thema Migration wird in den nächsten Jahrzehnten aktuell bleiben. Eine komplette Abschottung ist wahrscheinlich unmöglich, die Steuerung der Migration und ein vernünftiges Einwanderungsgesetz hingegen nicht. Was wäre, wenn beide Seiten den ausgeblendeten Teil der Realität jeweils anerkennen und anschließend nach Gemeinsamkeiten suchen würden? Naja, Ihre Theorie leuchtet mir schon ein. Allerdings weiß ich jetzt noch immer nicht, wie ich gegen die Vorurteile ankomme. Gegen die der anderen oder, wenn Sie wollen, gegen meine eigenen. Sie werden es nicht schaffen Vorurteile vollkommen auszuschließen. Vorurteile gehören zum Menschen wie Augen, Nase oder Hände. Sie sind so selbstverständlich, dass man sie nicht hinterfragen kann. Und wenn jemand von sich annimmt, dass sie oder er keine Vorurteile habe, dann trägt diese Annahme selbst die Gestalt eines Vorurteils. Der Grund für Vorurteile liegt in den Eigenheiten unseres Denkens. Wenn wir etwas wahrnehmen, kategorisieren wir es. Dieser Vorgang wird auf Grundlage dessen vorgenommen, was wir bereits wissen. Wird etwas wahrgenommen, für das man bereits eine Kategorie besitzt, werden die vorab erlernten Eigenschaften der betreffenden Kategorie auf das Wahrnehmungsobjekt angewandt. Wichtig ist eine Unterscheidung: Kategorisierung basiert auf Wissen. Erfahrung kann als Kriterium hinzukommen, muss aber nicht. Wissen ist also notwendig und hinreichend, Erfahrung ist allenfalls ein Zusatzkriterium. Aber ein entscheidendes, denn gerade das Wissen über Menschen anderer Sprache, Hautfarbe etc. ist oft implizit übertragen worden und basiert eben nicht auf Erfahrung. Dass Afrikaner anders riechen, Afghanen sich nicht waschen, Polen stehlen usw. sind Annahmen, die viele Menschen teilen, ohne sich dieses Wissen jemals bewusst angeeignet zu haben. Vorurteile können bewusst sein, etwa wenn jemand sagt: Polen klauen. oder weniger bewusst, etwa wenn die Lehrerin ihrer Klasse vor dem Besuch der polnischen Partnerschule sagt: Lasst die Brotbüchsen lieber hier. Während die bewussten Vorurteile durch Erfahrung mit Menschen aus anderen Kulturen gemildert werden oder sogar ganz verschwinden können, zeigen sich die weniger bewussten Vorurteile viel hartnäckiger und sind sogar bei Menschen zu finden, die bereits lange in Mischehen leben. Das ist ja wirklich nicht einfach mit Ihnen. Ich bin doch gerade hier um zu erfahren, wie ich mit Vorurteilen umgehen kann und Sie sagen mir, dass es unmöglich sei, Vorurteile loszuwerden? Nun ich sage nur, dass es nicht möglich ist alle Vorurteile loszuwerden. An einigen konkreten kann man schon etwas verändern. Das geschieht beispielsweise dann, wenn ein Mensch direkte Erfahrungen mit Individuen aus einer anderen Kultur macht. Dabei lernt er Dinge, die dem Vorurteil entgegenwirken. Dem bereits vorhandenen Wissen werden also gleichsam gegenläufige Informationen entgegengestellt. Der andere Mensch ist dann nicht mehr ein Afghane oder der Syrer, sondern er bekommt einen Namen und ein Gesicht. Er ist dann Hadjatullah, der aus Herat stammt, einen Vater und eine Mutter hat und drei Brüder und so weiter. Nun werden wenig oder nicht dialogbereite Menschen nicht zwingend auf Migranten zugehen und sich nach ihrer Herkunft, ihrer Geschichte usw. erkundigen. Solche Begegnungen sind selten. Wenn sie jedoch organisiert werden, dann ist es weniger hilfreich, lange Reden zu führen, von Integration zu sprechen oder Migranten auf Podien auszufragen. Hilfreicher ist es bspw. gemeinsam zu essen. Es gibt kaum eine andere auf der ganzen Welt alltägliche Tätigkeit, die mehr dazu geeignet wäre, die Erfahrung einer zumindest rudimentären Gleichheit zu erzeugen und die Voraussetzungen für persönliche Kontaktaufnahme, gegenseitiges Interesse und ggf. späteres Vertrauen zu schaffen, als das gemeinsame Essen. Essen schafft die normalerweise vorhandene Machtdistanz unter den Anwesenden für eine Weile aus dem Weg und sorgt für Augenhöhe im wahrsten Sinne des Wortes. Ja so erlebe ich das auch. Mich treibt aber weniger die Frage nach der Begegnung zwischen angestammter Bevölkerung und (temporär) Zugewanderten her, sondern eher der Umgang mit Vorurteilen in Gesprächen unter Menschen, die sich nicht mit Migranten, sondern über Migration, Migranten usw. unterhalten. Also mir geht es um die Frage, wie ich mich in polarisierten Gesprächen verhalten kann, vielleicht gibt es bestimmte Techniken? 15 Texte zum Symposium Angekommen - und nun? am 28. Oktober 2017 in Görlitz
16 16 Moderierte Gruppen zu den verschiedenen Themenrunden. Erste Lösungsansätze und Anregungen aus den Gruppen wurden festgehalten. Integration in der Oberlausitz
17 Verstehen Sie die folgenden Darstellungen bitte als Katalog mit einer Reihe von Möglichkeiten. Ob eine bestimmte Technik passt, ist von drei Faktoren abhängig: der handelnden Person, dem Gegenüber (oder: Auditorium) und dem Thema, um das es geht. Ihre Aufgabe ist es, dieses Dreieck in ein funktionierendes Gleichgewicht zu bringen. Ich möchte hier einen kleinen Werkzeugkasten jener Dinge vorstellen, die in polarisierenden Diskussionen helfen können wohl wissend, dass die Wirksamkeit dieser Werkzeuge auch Grenzen hat, denn wer Diskussionen nur zur Selbstbestätigung führt, will und kann seinen Standpunkt nicht ändern. Die meines Erachtens hilfreichste Technik besteht darin, das Mitteilen der eigenen Position zu verzögern und erst einmal Fragen zu stellen. Konflikte eskalieren insbesondere dann, wenn sich die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte abwechselnd und in von Runde zu Runde heftigerer Tonart mitteilen. Wird der eigenen Position hingegen erst einmal weniger Relevanz beigemessen und dem anderen Interesse entgegengebracht, wirkt sich das in der Regel deeskalierend auf die Gesprächsführung aus. Solches Interesse signalisiere ich mit Fragen, auf die ich die Antwort noch nicht kenne: Was meinen Sie genau? Was wollen Sie erreichen? Von welchen Annahmen gehen Sie aus? Wie sind Sie darauf gekommen? Was haben Sie erlebt? Ich bewerte also nicht die Meinung der anderen Seite, sondern ich interessiere mich dafür. Das verhindert eskalierende Diskussion und zeigt eine vorurteilsarme Grundhaltung meinerseits. Würde ich andernfalls die Darstellungen der anderen Seite bewerten, führte dies mit beinahe einhundertprozentiger Sicherheit in die Eskalation. Hier gelangen wir zum Kern vieler Konflikte: Wir handeln nicht nur rational, sondern wir haben auch Emotionen, und wenn die stark sind, kommt es schnell zu automatisiertem Verhalten. Emotionen sind vor allem dann sehr stark, wenn wir uns in unserem Status verletzt fühlen oder uns im eigentlichen Wortsinn zu nahe getreten wird. Wenn ich also die Aussagen meines Gegenübers von Vornherein als falsch o. ä. bezeichne, muss ich mich nicht wundern, wenn der Ton schärfer wird. Habe ich hingegen vor der Person einen grundlegenden Respekt, der sich darin äußert, dass ich nicht von vornherein bewerte, sondern Interesse zeige, dann trenne ich die Meinung von der Person und nehme eine vorurteilsarme Grundhaltung ein. Eine zweite wirksame Technik besteht darin, sich selbst andere Fragen zu stellen. Gerät man in einer Diskussion unter Druck (= die Emotionen werden so stark, dass ich nur noch reagiere und nicht mehr agiere), dann stellt man sich in Gedanken Fragen wie: Warum sind die so blöd? oder: Was mache ich falsch? oder: Wie kann ich die anderen besser überzeugen? Solcherlei Gedanken führen in einen Teufelskreis aus (vermeintlich) noch besseren Argumenten und Gegenargumenten und enden in Frustration. Hier hilft es, sich zurückzunehmen, durchzuatmen, einige Sekunden Pause zu machen und sich zu fragen: Was weiß ich noch nicht? oder: Was wollen die anderen wirklich? oder: Wie kann ich anders denken? oder: Welche Optionen habe ich? Sie werden sehen, solche Gedanken führen zu anderen Gesprächsverläufen und zu der Überlegung, dass man sich nicht einigen muss, wohl aber Respekt voreinander haben kann. Was hilft, sind Gelassenheit, Ruhe und die Fähigkeit, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Man muss eine Diskussion nicht gewinnen. Aber man kann Respekt haben und Fragen stellen. Man kann anders denken. Das bleibt nicht ohne Wirkung auf die andere Seite und führt eher zum Nachdenken als zu Diskussion oder gar Belehrung. Das Fazit lautet, dass man nur die eigene Einstellung, nicht aber die Einstellung anderer ändern kann. Ich soll die also ernst nehmen? Ich soll Fragen stellen? Ich soll versuchen ihre Gedanken nachzuvollziehen? Ich würde ja gern, aber das was die sagen macht mich so unfassbar wütend! Ja in der Tat, manchmal macht es uns wirklich stinksauer, was andere Menschen von sich geben und das ist auch völlig normal und legitim. Sagen Menschen etwas, das unserer eigenen Weltanschauung, unseren eigenen Motiven und Zielen im Weg steht, kann uns das natürlich wütend machen. Oder wir haben Angst vor dem was sie sagen oder sind traurig. Gerade in Gesprächen wissen wir oft nicht was wir mit diesen Empfindungen anstellen sollen, wenn wir überhaupt wissen, was für Empfindungen das sind und wie sie heißen. Wollen wir uns also mit Menschen verständigen, die so ganz andere Ansichten besitzen als wir, dann ist es aus meiner Sicht notwendig, sich dieser Gefühle bewusst zu sein und einen Umgang damit zu finden. Ja was kann ich denn tun, wenn mich die Trauer lähmt, die Angst packt oder die Wut in mir kocht, weil der andere etwas gesagt hat, was mir gar nicht passt oder mir, wie Sie sagten, zu nahe getreten ist? Nun landläufig gibt es ja die Redewendung: Die Trauer raubt mir den Atem. Man kann auch beben vor Wut oder ist vor Angst gelähmt. Diese Formulierungen geben einen Hinweis darauf, wie man in Akutsituationen mit seinen Emotionen umgehen kann. Die Verbindung zwischen unse- 17 Texte zum Symposium Angekommen - und nun? am 28. Oktober 2017 in Görlitz
18 18 Gemeinsam wurden die Ergebnisse der Themenrunden diskutiert. Akteure informierten über bestehende Angebote und tauschten sich aus. Integration in der Oberlausitz
19 rem Gehirn und dem Körper ist keine Einbahnstraße. So wie unser Kopf unseren Körper beeinflusst, so ist das auch andersherum möglich. Indem man sich für einen Moment auf seine Atmung konzentriert und einige Male hintereinander tief ein und ausatmet, bekommt man seinen Puls recht gut heruntergefahren. Zusätzlich kann man auch seine Aufmerksamkeit auf die Muskeln lenken. Sind die Fäuste schon geballt? Ist der Kiefer angespannt und mahlen die Zähne aufeinander? Sind die Schultern hochgezogen? Presst sich die Zunge gegen den Gaumen, vielleicht um weitere böse Worte zurückzuhalten? Hier hilft es oft schon, diese Anspannungen bewusst ein Stück weit zu lockern. Außerdem ist es hilfreich, seine Empfindungen mit etwas Abstand zu betrachten ohne sie gleich zu bewerten oder abzulehnen. Die Wut ist nun einmal da und sie hat ihren Sinn. Die Wut hat einen Sinn? Ja natürlich. Alle Emotionen haben ihren Sinn. Sie liefern Informationen über etwas, das in uns passiert. Wut beispielsweise sagt mir, dass jemand anderes verhindert, dass ich meine Ziele erreiche oder er eine Grenze überschritten hat. Sie gibt mir dann Kraft, die ich in einer Auseinandersetzung vielleicht gebrauchen kann. Angst hilft mir, Gefahren zu erkennen und Risiken zu vermeiden. Sie beschützt uns. Trauer macht das Abschied nehmen leichter. Das alles ist allerdings nur dann nützlich, wenn die Gefühle uns unterstützen, wir aber die Kontrolle behalten. Das gelingt uns, wenn wir uns bewusst die Zeit nehmen unseren Körper wieder runterzufahren. Tief in den Bauch einatmen, dann lange ausatmen (deutlich länger als einatmen) und wieder einatmen, ausatmen usw. Helfen kann auch eine Ultrakurzform der progressiven Muskelentspannung nach Jacobson. Dabei werden beim Einatmen so viele Muskeln wie möglich angespannt. Beim Ausatmen entspannt man wieder alle Muskeln und achtet auf den Unterschied zwischen der An- und der Entspannung. Dies sollte man dann zwei bis drei Mal wiederholen. Johannes Marquard ist Kommunikationspsychologe und arbeitet als Trainer und Supervisor im KIB-Institut. Im Rahmen des Projektes war er vor allem für die praktische Durchführung der Trainings verantwortlich. Jörg Heidig arbeitet als Lehrbeauftragter an verschiedenen Universitäten und Hochschulen und leitet das Görlitzer KIB-Institut, in dem das hier beschriebene Projekt durchgeführt wurde. Er ist zudem als Berater und Supervisor für Behörden und soziale Organisationen tätig. GESPRÄCHSTECHNIKEN ZUM UMGANG MIT VORURTEILEN Johannes Marquard und Jörg Heidig Schopenhauer und die Stachelschweine An einem Wintertag preßten sich zwei vor Kälte erstarrte Stachelschweine aneinander, um sich zu wärmen. Als sie sich mit ihren Stacheln gegenseitig wehtaten, trennten sie sich, und froren erneut. Nach zahlreichen Versuchen fanden die Stachelschweine jene Distanz, bei der sie maximale Wärme erreichten, ohne sich allzusehr wehzutun. Arthur Schopenhauer (1851, Parerga und Paralipomena) VORURTEILSFREIES FRAGEN Eine der wirksamsten Techniken zum Umgang mit Vorurteilen ist Humble Inquiry oder vorurteilsfreies Fragen. Die Annahme hinter der Technik lautet, dass Menschen sehr gut darin sind, sich gegenseitig etwas mitzuteilen, ihre jeweiligen Positionen zum Ausdruck zu bringen und ggf. zu verteidigen. Argumentieren und Diskutieren sind verbreitete Kulturtechniken. Fragen und Verstehen ist dagegen weniger geläufig. Der Kern der von Edgar Schein stammenden Technik besteht darin, Fragen zu stellen, auf die man selbst noch nicht die Antwort kennt. Das drückt Interesse am Gegenüber aus und führt zu tatsächlichem Dialog. VORURTEILSFREIES FRAGEN: FRAGEARTEN Interessensfragen: In der Regel werden diese Fragen im deutschen Sprachgebrauch als offene Fragen bezeichnet. Offene Fragen signalisieren dem Gegenüber Interesse und die Bereitschaft, sich auf der Grundlage dieses Interesses mit ihm auszutauschen. Insofern wirken ehrlich gemeinte, offene Fragen einer in die Eskalation führenden Diskussion entgegen. Es fällt vielen Menschen sehr schwer, Interesse an Menschen zu haben, deren Meinungen sie nicht akzeptieren. Aber genau hier liegt der Unterschied zwischen eskalierender Diskussion und produktivem Streit. Die Ursache der Eskalation im ersteren Fall liegt in dem Beharren der Beteiligten auf ihren jeweiligen Positionen. Die Basis produktiven Streits ist das Sich-einlassen-Wollen der Beteiligten. Insofern sollte man die Kunst erlernen, die Sache von der Person zu trennen. Das bleibt schwierig auch und gerade, wenn es um Fragen geht, die den eigenen Wertvorstellungen extrem widersprechen. 19 Texte zum Symposium Angekommen - und nun? am 28. Oktober 2017 in Görlitz
20 20 Prozessfragen Wenn es in einem Gespräch einmal nicht weitergeht, helfen so genannte Prozessfragen. Das sind Fragen, in denen es um den Stand des Gesprächs, die Zufriedenheit der Gesprächspartner mit dem Gespräch oder die Beziehung zwischen den Gesprächspartnern geht. Wo stehen wir eigentlich gerade? Was ist das Problem? Was können wir mit diesem Gespräch erreichen? Was denken Sie über das Gespräch? Was erwarten Sie von diesem Gespräch? oder: Wenn das bisher wenig zufriedenstellend war: Was würden Sie anstelle dessen erwarten? Konfrontative Fragen Konfrontative Fragen sind solche, die dem Gegenüber etwas unterstellen, das man selbst vermutet. Solche Konfrontationen des Gegenübers mit den jeweils eigenen Gedanken oder gar Bewertungen oder Diagnosen ( Kann es sein, dass Sie gar keine Ausländer kennen und dementsprechend gar keine Ahnung haben, wovor Sie eigentlich Angst haben? ) sind nicht hilfreich und steigern den Ärger. Wir raten daher vom Einsatz konfrontativer Fragen ab, bis eine halbwegs tragfähige Beziehung zwischen den Akteuren und ein Mindestmaß an Vertrauen entstanden sind. Abbildung Landkarte der Wahlmöglichkeiten Die Landkarte der Wahlmöglichkeiten drückt aus, dass man in Gesprächen zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden, ob man sein Gegenüber bewerten möchte oder ob man sich selbst andere Fragen stellen will. Dem tatsächlich gesprochenen Wort geht ein innerer Prozess voraus, der auf zweierlei Weise ablaufen kann: 1. Die häufigere automatische Variante: Emotionen übernehmen die Steuerung. Man reagiert automatisch entweder direkt mit einem Gegenargument oder der wohl häufigsten aller Entgegnungen: Ja, aber 2. Die seltenere bedachte Variante: Man führt erst eine Art inneren Dialog, testet eine oder zwei Entgegnungen in Gedanken und sucht sich dann die bessere Variante aus. Wenn man es schafft, den bedachteren Weg auf der Karte als Pfad des Lernens bezeichnet einzuschlagen, diskutiert man nicht sofort los, sondern prüft erst, was man noch nicht weiß, was der andere wirklich will, wie man anders denken oder welche Fragen man stellen könnte. Voraussetzung ist natürlich, dass man den anderen für voll nimmt, also Respekt vor ihm hat. Wenn man das nicht tut, weil man den anderen für einen Rassisten hält, mit dem man nicht reden kann, dann hilft es auch nichts zu reden. In diesem Fall ist es besser zu schweigen und die Situation möglichst zu verlassen, denn ein Gespräch ohne Respekt wird eskalieren. Das gilt freilich für alle beteiligten Seiten. Wenn ich also von meinem Gegenüber nicht respektiert werde, dann helfen Argumente nichts. Die Landkarte der Wahlmöglichkeiten nach Marilee Adams (2009: Change Your Questions, Change Your Life. Erschienen bei Berrett-Koehler Publishers); Abbildung aus: Heidig et al. (2015): Gesprächsführung im Jobcenter. Erschienen in der Edition Humanistische Psychologie des Verlags Andreas Kohlhage.); Zeichnung: Juliane Wedlich Integration in der Oberlausitz
21 Was noch helfen kann, wenn Worte nichts mehr helfen Wenn Hass oder Aggressionen im Spiel sind, helfen Argumente in der Regel nichts mehr. Besonders problematisch wird es, wenn Alkohol im Spiel ist, denn Alkohol wirkt aggressionsverstärkend. Man sollte sich also keine besonders klugen Argumente einfallen lassen, wenn man mit Angetrunkenen redet oder/und selbst unter Alkoholeinfluss steht. Die Ausnahme bildet Alkoholgenuss als eine Art Friedensritual ( Du bist zwar links, aber Bier trinken geht immer. ) zum Zweck der Deeskalation. Was bei Hass und Aggression noch helfen kann die Betonung liegt wie bei allen hier beschriebenen Techniken auf kann, die Wirkung ist immer personen- und situationsabhängig, also nie sicher ist die Körpersprache. Bleiben Sie ruhig, atmen Sie mehrfach tief und langsam, bevor Sie etwas sagen, nicken Sie ggf., schauen Sie Ihrem Gegenüber nicht die ganze Zeit in die Augen. Lassen Sie die Arme am Körper. Argumentieren Sie nicht oder nur sehr wenig, stellen Sie eher Fragen oder bleiben Sie ganz ruhig. Wenn Sie attackiert werden, rufen Sie um Hilfe, ggf. indem Sie auf Menschen zeigen, die Ihnen helfen sollen ( Sie da in dem roten Mantel, helfen Sie mir bitte! ). Die Kunst des Argumentierens Die einfachsten und gleichzeitig wirksamsten Argumentationstechniken beziehen sich auf die Reihenfolge der Argumente, den gekonnten Einsatz von Pausen und die Kunst, Einwände vorwegzunehmen: Einwandsvorwegnahme Indem Sie mögliche Einwände bereits in Ihre eigenen Statements einbauen, zeigen Sie, dass Sie Ihr Gegenüber verstehen und ihm zumindest gedanklich oder theoretisch entgegenkommen können. Indem Sie diese Einwände dann bereits durch eigene Worte entkräften, gehen Sie zwar einerseits theoretisch auf die andere Seite zu, bekräftigen aber gleichzeitig ihre eigene Position. In der Regel wirken sich Einwandsvorwegnahmen günstig auf Gespräche aus, wenn sie nicht nur zur Zementierung der eigenen Position oder gar als Manipulationstechnik verwendet werden, sondern ein wenn auch begrenztes Verständnis oder gar Entgegenkommen signalisieren. HART IN DER SACHE WEICH MIT DEN MENSCHEN DAS HARVARD KONZEPT 1. Menschen und Probleme getrennt voneinander behandeln Hier geht es um die Trennung von Sach- und Beziehungsaspekt. Im Konfliktfall werden Emotionen oft mit der objektiven Sachlage des Problems verwoben. Das Ich identifiziert sich mit den Positionen, die sich verfestigen. Vor der Verhandlung des Sachproblems muss zunächst eine Beziehungsklärung stattfinden bzw. die menschliche Situation bewusst vom Problem gelöst werden. Bildlich gesprochen sollten die Konfliktparteien als Partner Seite an Seite das Problem angehen, anstatt aufeinander los zu gehen. 21 Reihenfolge von Argumenten Nicht die endlose Fülle von Argumenten überzeugt, sondern die sorgfältige Auswahl weniger Argumente. Wählen Sie am besten drei Argumente aus, wobei das stärkste Argument zuerst, das schwächste an zweiter Stelle und das zweitstärkste an dritter Stelle stehen sollte. Es ist sehr vom Thema und vom Gegenüber abhängig, ob man seine These vor den Argumenten oder quasi als logische Schlussfolgerung nach den Argumenten nennt. Der elegantere und gewissermaßen auch leisere Weg ist der letztere. Diskussionen neigen dazu, mit der Zeit schneller und lauter zu werden. Pausen Eine ruhige und langsame Sprechweise in Verbindung mit entsprechenden Pausen hilft dabei, dass die Eskalation unterbleibt. Geschwindigkeitswechsel und insbesondere Pausen sind aber auch geeignet, die Kraft der eigenen Argumente zu verstärken. 2. Auf Interessen konzentrieren, nicht auf Positionen Beharren auf der eigenen Position kann den Verhandlungsverlauf beeinträchtigen. Durch das Loslassen der Positionen können die eigentlichen Bedürfnisse und Interessen der Beteiligten, die oft hinter den Positionen liegen, Einfluss und Berücksichtigung finden (was durch bloße Kompromisse zwischen den Positionen nicht geschieht). 3. Entscheidungsmöglichkeiten zum beiderseitigen Vorteil entwickeln Es wird empfohlen, bereits vor dem Versuch ein Übereinkommen abzuschließen, nach Möglichkeiten für gegenseitigen Nutzen zu suchen, da die Suche nach der einzigen richtigen Lösung oft die Kreativität der Parteien behindert. Dieses Vorgehen führt auch zur Entschleunigung und Beruhigung des Konfliktverlaufs, beide Parteien können sich z.b. für einen vereinbarten Zeitraum zurückziehen und über alternative Lösungen nachdenken. Texte zum Symposium Angekommen - und nun? am 28. Oktober 2017 in Görlitz
22 22 Fazit und Feedback aus dem Publikum bei der Abschlussdiskussion. Professor Raj Kollmorgen eröffnet das Symposium. Integration in der Oberlausitz
23 4. Neutrale Beurteilungskriterien anwenden Fördert eine faire Lösung, der sich beide Parteien unterwerfen können, ohne dass eine Partei nachgeben muss. Die Maßstäbe richten sich nicht nach dem Willen der einen oder anderen Partei sondern nach externen, neutralen Kriterien wie Expertenmeinungen, Sitten, Rechtsnormen, Marktwert etc. Verhindert Machtkämpfe und Gefühle der Übervorteilung, die durch Sturheit entstehen. Die TEK-Sequenz aus dem Training emotionaler Kompetenzen von M. Berking»Wenn Gefühle verletzen,... lass kurz alle Muskeln locker; atme ein paar Mal ruhig und bewusst ein und langsam wieder aus; betrachte dann, was in Dir geschieht, ohne es zu bewerten; benenne dabei Deine Gefühle so genau wie möglich; akzeptiere, dass Du gerade so reagierst, wie Du reagierst, und mache Dir bewusst, dass Du auch unangenehme Gefühle eine ganze Weile aushalten kannst; stehe Dir dabei innerlich liebevoll und unterstützend zur Seite; dann analysiere konstruktiv, warum Du Dich so fühlst, wie Du Dich fühlst und gehe dann in einen konstruktiven Problemlösemodus, in dem Du Dich bei Bedarf darum bemühst, die Gefühle so gut es geht positiv zu beeinflussen. Nach einer kurzen Begrüßung eröffnet Raj Kollmorgen, Professor an der Hochschule Zittau/Görlitz, das Symposium mit dem Titel Angekommen und nun?. Er veranschaulicht, dass eine solche Art von Zusammenkunft Raum für erste gemeinsame Gedankenimpulse ermöglicht. Sie bildet einen Querschnitt verschiedener Perspektiven ab und zeigt auf, dass Konflikte zwischen verschiedenen Gruppen nicht automatisch Fehler bedeuten, sondern Potenzial in sich bergen. Diesem ersten Gedankenanstoß schließt sich der Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege mit einem kurzen Grußwort an. Frei nach dem Grundsatz Es hilft nicht, über gute Kommunikation zu reden, gute Kommunikation muss man machen beginnt die Podiumsdiskussion. Neben den Oberbürgermeistern der Städte Bautzen, Görlitz und Zittau nehmen Führungskräfte aus Unternehmen, Engagierte aus Initiativen und Vereinen sowie Wissenschaftler und als Wichtigste Migrantinnen und Migranten an der Diskussion teil. Niemand verlässt seine Heimat leichtfertig, verdeutlicht der Bautzener Oberbürgermeister Herr Ahrens zu Beginn und erzählt anschließend von seinen Erfahrungen mit Flüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien, die nach den Kriegen in ihre Heimat zurückgekehrt seien und einen essentiellen Anteil am Wiederaufbau ihrer Länder gehabt hätten. OB Deinege meint, dass man den Fokus der Integration auf Familien legen sollte, weil darin ein Mehrwert für die Region liege. Integration müssen wir einfach machen, sagt er, und das insbesondere der Perspektiven wegen, die eine gelingende Integration mit sich bringe. Daniel Sernow vom Görlitzer Standort der Software Quality Systems AG meint, dass es im Einzelfall extrem aufwändig sei, Migranten beruflich zu integrieren. Sein Unternehmen müsse große Netzwerke aktivieren, es sei ein energiefressender Prozess, der strukturierter und konstruktiver gestaltet werden könne und müsse. Andreas Langhammer (Sachsenfenster GmbH) ergänzt: Es ist völlig egal wo die Leute herkommen, denn die Arbeit als gemeinsames Ziel und Interesse verbindet. Der Bedarf an Fachkräften sei da, aber es gebe eine ganze Reihe infrastruktureller, organisatorischer und bürokratischer Probleme, die noch zu lösen seien. Das ginge nur über eine bessere Zusammenarbeit der verschiedenen Institutionen und Organisationen. 23 BERICHT ZUM SYMPOSIUM Tom Hohlfeld DIE PODIUMSDISKUSSION Erfahrungen der Teilnehmer bestätigen die Kontakthypothese Die so genannte Kontakthypothese von Gordon Allport besagt, dass häufiger Kontakt zwischen Mitgliedern verschiedener Gruppen die jeweiligen Vorurteile gegenüber diesen Gruppen reduziert. Allport formuliert vier Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit der Kontakt zwischen zwei Gruppen positive Auswirkungen auf Vorurteile und Konflikte hat. Diese Bedingungen sind: gleicher Status, Zusammenarbeit zwischen den Gruppen, gemeinsame Ziele sowie Unterstützung durch gesellschaftliche und institutionelle Instanzen. Im Laufe der Zeit hat die Forschung gezeigt, dass diese Bedingungen aber nicht zwingend erfüllt sein müssen, damit positive Wirkungen entstehen, sondern dass auch unstrukturierter Kontakt zur Verringerung von Vorurteilen führen kann. Allports Bedingungen sind also eher als förderlich und weniger als notwendig zu betrachten. Auf unserem Symposium wurden einige Beispiele geschildert, die das belegen. So wurde aus einer Jugendeinrichtung berichtet, dass der unstrukturierte Kontakt zwischen Jugendlichen mit rechtsextremem Gedankengut und jungen Texte zum Symposium Angekommen - und nun? am 28. Oktober 2017 in Görlitz
24 24 Oberbürgermeister Herr Deinege verweist auf die Perspektive, welche gelingende Integration mit sich bringt. Als Vertreterin des Steinhaus Bautzen e. V. spricht Ely Almeida aus Sicht der aktiven Vereine. Integration in der Oberlausitz
25 Flüchtlingen ganz wesentlich zum Abbau von gegenseitigen Vorurteilen beigetragen habe. Nach einiger Zeit sei es möglich gewesen, dass Mitglieder beider Gruppen gemeinsam Zeit am Tischkicker verbrachten. Insbesondere gemeinsames Essen sei ein wichtiger Faktor gewesen. Sie sei seit drei Jahren in Deutschland, erzählt Hamida Tamiri aus Syrien, die ebenfalls im Podium sitzt. Hier zu leben fordere große Anpassungsleistungen ( die vielen, vielen Regeln ), sowohl von ihrer Familie insgesamt als auch von ihr als Mensch. Sie merke dies insbesondere an der Veränderung ihrer Rolle als Mutter. Professor Kollmorgen wird gefragt, ob der Osten Deutschlands ein Problem mit dem Thema Integration habe. Das sei keine hilfreiche Frage, meint er. Vielmehr gehe es um zwei konkretere Fragen, nämlich erstens, wie wir mit den Menschen umgehen, die tatsächlich ein Problem mit dem Thema Migration haben, und zweitens, wie wir zukünftig mit dem Mangel an Arbeitskräften umgehen wollen. Er verweist darauf, dass Integration tatsächlich am ehesten durch Arbeit gelingt, und dass dies vor allem eine Frage funktionierender Netzwerke zwischen Unternehmen, Initiativen und Verwaltung sei. Das in Behörden mitunter verbreitete formale Abfertigen ohne Diskussion oder Fragen, die langen Wartezeiten in Verfahren und die vielerorts zu beobachtende Beratungsbedürftigkeit an Schulen beim Umgang mit Migranten seien weitere wesentliche Probleme bei der Integration, sagt Herr Suliman, der ursprünglich aus Syrien stammt und seit seinem Ingenieurstudium an der Zittauer Hochschule in der Region lebt. Junge Menschen, die nach Deutschland kämen, wüssten oft nicht genau, was sie in Deutschland machen können bzw. was für sie in Frage kommt. Dann kommt ein Thema zur Sprache, das die Zuhörer fesselt. Viele Flüchtlinge haben, hier Zuflucht suchend, Angst vor der Politik. Einerseits gebe es da die leichtzüngige Willkommenskultur und andererseits die verwaltungsschwere Realität. All das habe nichts mit der Situation in den Herkunftsländern zu tun: Was sollen wir denn in Syrien arbeiten, wenn doch der Krieg alles zerstört hat? Der Wechsel zwischen verschiedenen Perspektiven sei notwendig. Aus dem Publikum kommt der Einwurf, man könne sich engagieren, wie man wolle die Türen nach oben blieben trotzdem verschlossen. Flüchtlingsunterkünfte seien gerade für junge Menschen in integrationspädagogischer Hinsicht alles andere als geeignet, vielmehr hätten die Heime schwerwiegende Auswirkungen: Vor lauter Dummheit weiß man dort doch nicht, was man machen soll. Jeder von uns, der in so ein Heim eingesperrt wäre, würde einen Kollaps kriegen! Der Zittauer OB Thomas Zenker resümiert, dass viele Ressourcen nicht konstruktiv genutzt würden. Es gehe um kleine Brücken, konkrete zwischenmenschliche Schritte, die verbinden. Es wäre gut, so Zenker weiter, wenn nicht belegte Qualifikationen die Arbeitsaufnahme nicht behindern würden und die Arbeitsfähigkeit mit Prüfungen oder Tests nachweisbar wäre. Gerade mit einer dezentralen Unterbringung von Familien habe man gute Erfahrungen gemacht: Integration organisiert sich dann von selbst. Menschen sind soziale Wesen. Die Politik verlasse sich auf die Zivilgesellschaft, auch wenn sie momentan auf den Felgen fährt, meint Alexander Ahrens und betont die Bedeutung des Im-Kontakt-Bleibens, des steten Anpassens und Lernens. Seine persönlichen Erfahrungen während seiner Zeit in Berlin-Neukölln hätten ihn gelehrt, dass Multikulti durchaus funktioniere. Das sei zwar kein Maßstab für die Oberlausitz, man könne es aber als Inspiration verstehen. Sachsen hat einen Ausländeranteil von drei Prozent. Ein waschechter Neuköllner fragt sich da: Von was redet ihr da eigentlich?! Das ist unter der Nachweisgrenze! Sein Motto für den Umgang mit dem Thema Integration in der Oberlausitz: Wir sollten Mut an den Tag legen, begründen was wir machen und anderen nicht einfach über den Mund fahren. Siegfried Deinege ergänzt: Auf die Bürger kann man sich verlassen, wenn man ihnen zuhört. Besucherstimmen Älterer Herr: Ich bin Jahrgang 1942 und als Flüchtlingskind aufgewachsen. Deshalb engagiere ich mich ehrenamtlich und helfe Flüchtlingen. Diese Arbeit hilft mir auch, viele Dinge in meinem eigenen Leben anders und besser zu begreifen. Studentin (20): Wissen Sie, ich bin zwar noch jung, aber habe selbst länger im Ausland gelebt und weiß daher, welche Probleme es bei der Integration gibt. Man muss sich vorstellen, wie das für die Leute ist, die hierherkommen. Unternehmer (53): Ich begreife die momentane Situation nicht als Bedrohung, sondern als Chance. Wir haben damals bei der Wiedervereinigung einige Dinge verpasst, die wir hätten tun können. Jetzt bekommen wir sozusagen eine nächste Chance. Erzieherin (27): Diese ganze Diskussion um Flucht und Integration nervt mich. Vieles verstehe ich auch nicht. Ich sehe das ganz praktisch: Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung, egal, woher es stammt. Das ist mein Job, und den will ich gut machen. 25 Texte zum Symposium Angekommen - und nun? am 28. Oktober 2017 in Görlitz
26 26 Die Teilnehmer des Symposiums konnten zwischen den Gruppen Verwaltung, Arbeit, Bildung und Zivilgesellschaft wählen. Moderator Thomas Hönel stellt die Ergebnisse der Gruppe Zivilgesellschaft/Vereine vor. Integration in der Oberlausitz
27 DIE VIER THEMENRUNDEN BILDUNG, ARBEITSMARKTZUGANG, ZUSAMMENARBEIT UND ZIVILGESELLSCHAFT Im Rahmen des Symposiums können sich die Gäste in vier Gesprächsrunden aufteilen, die jeweils von einem Moderator angeleitet werden. Die Ergebnisse sollen hier kurz beleuchtet werden. (1) Bildung Bildung ist im Zusammenhang mit Integration ein viel diskutiertes Thema. Die unterschiedlichsten Bildungsaktivitäten seien ausschlaggebend für den erfolgreichen Verlauf der Integration. Die Diskussionsteilnehmer sind sich einig, dass die große Herausforderung beim Thema Bildung und Integration die dafür notwendige Zusammenarbeit der vielen, auf völlig unterschiedlichen Ebenen verteilten Akteure sei von der Kita über Schulen, Ämter, Anbieter von Sprachkursen bis hin zu Ausbildungsbetrieben, Kammern und Hochschulen, um nur einige zu nennen. Neben den Herausforderungen der ebenen- oder sektorübergreifenden Zusammenarbeit erwiesen sich die Aufnahmebedingungen mitunter als problematisch. Die Schaffung einer angemessenen Hochschulzugangsberechtigung kann hier als ein erfolgreiches Beispiel gelten. Eine dritte Herausforderung wird ähnlich wie bereits in der vorangegangenen Podiumsdiskussion beim Verwaltungsapparat gesehen. Dann wechselt die Perspektive der Diskussion: Persönliches Engagement sei eine notwendige Voraussetzung für eine gelingende Integration, zu der auch eine Neukalibrierung des kulturellen Verständnisses auf beiden Seiten gehöre. Es brauche ganzheitliches Denken, das man miteinander entwickelt. (2) Arbeitsmarktzugang Auch in dieser Gruppe sprechen die Teilnehmenden viel über die Gestaltung von Beziehungen zwischen Akteuren unterschiedlicher Institutionen und Ebenen auf der einen Seite und zwischen diesen Akteuren und Migranten auf der anderen Seite. Man ist sich einig, dass es momentan ganz klar ein Vernetzungsproblem gebe. Zwar gebe es eine große Menge an lokalen Netzwerken, und die Probleme lägen auch weniger beim Wie der Netzwerkarbeit, sondern eher beim Wer mit wem. Die Teilnehmer der Diskussionsrunde fragen sich, wie hilfreich Konzepte wie bspw. das Arbeitsmarktmentorenprogramm wirklich seien. In der Praxis werde in vielen Fällen durch das Programm eher die Verwaltung unterstützt als die Betroffenen. Die Komplexität der Bedingungen und Möglichkeiten sei schon für Deutsche nicht leicht durchschaubar. Wie schwer müsse es dann erst für Migranten sein, sich auf dem Arbeitsmarkt und im Paragraphendschungel zu orientieren? Lösungsfokussierte Moderation offenbart viele kreative Problemlösungen Der Fokus der Gesprächsgruppen lag auf der Frage, was bei der Integration funktioniert bzw. welche Lösungen die Teilnehmer bereits erfolgreich gefunden und umgesetzt haben. Anhand der individuellen Berichterstattungen wurde sehr deutlich, wie kreativ die Akteure bei der Bewältigung der täglichen Herausforderungen sind. Der Einbezug dieser Praxis-Experten in die Konzeption von umfassenderen und ganzheitlichen Programmen zur Integration scheint daher nicht nur angemessen, sondern notwendig. Weiterhin wurde in den Diskussionen deutlich, dass es durchaus Anlass zu positiven Prognosen für die gelingende Integration in der Region gibt und dass der erhebliche Kraftakt der Zivilgesellschaft, oft auch in Kooperation mit der Verwaltung, in den vergangenen zwei Jahren sichtbare Früchte trägt. (3) Zusammenarbeit Die Diskussion mündet schnell in eine kritischen Analyse der Rolle des Ehrenamtes. Einerseits sei das Engagement der Ehrenamtlichen zu begrüßen, andererseits seien viele nicht geschult und würden sich in Bereichen und bei Themen engagieren, für die sie kaum Kompetenzen besäßen. Das führe zu Fehlern und oft zu nicht abgestimmter oder gar doppelter Arbeit. Einige an der Gesprächsrunde beteiligte Behördenmitarbeiter lenken das Thema auf die Verwaltung. Problematisch sei, dass häufig direkte Ansprechpartner fehlten oder nicht bekannt seien. Hinzu komme, dass diejenigen Verwaltungsmitarbeiter, die nicht formalistisch handelten, sondern den Menschen zugewandt blieben, kaum Würdigung erführen. Es gebe ein großes Bedürfnis nach Anleitung; wünschenswert seien Leitfäden mit konkreten und realistischen Fallbeispielen. Einerseits blieben Behörden eben Verwaltungen und mahlten die sprichwörtlichen Mühlen sehr langsam, andererseits gebe es Verwaltungsmitarbeiter, die einen Unterschied zu machen in der Lage seien. Ein solcher differenzierender Austausch mache Hoffnung, meint eine Diskussionsteilnehmerin und erzählt, dass sie häufiger erlebt habe, wie in Behörden Unterschiede gemacht würden, die nicht mit der Lage des jeweiligen Falls, sondern mit der Herkunft des Menschen hinter dem Fall erklärbar gewesen seien. So hätten manche Behördenmitarbeiter Lieblingsflüchtlinge oder würden einen Unterschied 27 Texte zum Symposium Angekommen - und nun? am 28. Oktober 2017 in Görlitz
28 28 Johannes Marquard vom KIB Institut berichtet über die lösungsorientierten Gespräche. Bei den Gesprächen im Plenum, den Gruppendiskussionen und beim Markt der Möglichkeiten kamen die Teilnehmer des Symposiums in den aktiven Austausch. Integration in der Oberlausitz
29 zwischen guten und bösen Herkunftsländern machen. Ein gegenseitiger Austausch mache das mitunter schwierige Terrain der organisationsübergreifenden Zusammenarbeit begehbarer. (4) Zivilgesellschaft Die wichtigsten Fragen der Diskussion lauteten: Was verbindet uns? Was ist Normalität? Welche Haltung ist wirksam? Welche Strukturen sorgen für Begegnung? Wie würdest Du ich fühlen? Im Zuge der Diskussion wird deutlich, dass es sich bei Integration um einen Prozess handelt, in dem es auf die Haltung und weniger auf die konkreten Aktivitäten ankommt. Es gehe um geeignete Räume und die Suche nach einer gemeinsamen Sprache. Was in diesen Räumen und bei dieser Suche konkret getan werde, sei vielfältig: Sport, Arbeit, Essen neben vielen weiteren Möglichkeiten. Es gehe nicht um Kommunikation um ihrer selbst willen, sondern um geeignete Anlässe und Räume. Die Kommunikation, das Vor- und Nachmachen, das zum Mitmachen inspiriere all das geschehe dann von ganz allein. sondern was wir schaffen wollen und wie wir das dann schaffen. Wir müssen lernen, Dissens auszuhalten und trotzdem miteinander zu reden, uns zu streiten und trotzdem handlungsfähig zu bleiben. Jenseits der Herausforderungen liegen viele Chancen. Wir sind so sehr mit dem Versuch beschäftigt, die armen Teufel in unsere perfekte Gesellschaft zu integrieren. Was nicht selten bedeutet, die Leute in eine Kältekammer zu stecken. Vielleicht sollten wir es einmal andersherum betrachten. Das Beispiel Kanada zeigt, wie man Integration auch sehen könnte. Dieses Land sucht Akademiker mit Familien, die dann aktiv am Wirtschaftsgeschehen teilnehmen. Letztlich muss klar sein: Eigeninitiative braucht Raum und Möglichkeit. Die deutsche Fokussierung auf die Sprache als Integrationsvoraussetzung bzw. -bedingung ist in vielen Fällen nicht hilfreich. Man sollte eher auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Leute schauen. Wenn man diese nutzen kann, geht das Sprachliche oft von allein. Tom Hohlfeld ist als Trainer und Dozent tätig und studiert Kommunikationspsychologie an der Hochschule Zittau/ Görlitz. 29 FAZIT DER ABSCHLUSSDISKUSSION: DAS SYMPOSIUM ALS WICHTIGER BEITRAG ZUR NETZWERKARBEIT IN DER REGION Das Symposium soll, so wünschen sich viele Teilnehmer, regelmäßig fortgeführt werden. Man wünscht sich mehr Migranten unter den Teilnehmern und möchte die Netzwerkarbeit vertiefen. Vielleicht könne man in der Zukunft an ganz praktischen Lösungen für konkrete Probleme arbeiten, denn es sei gut, dass hier Verwaltung, Ehrenamt, Wirtschaft, Bildung, Verbände und Politik zusammenkämen. Das biete Potential, die im Landkreis vorhandenen Strukturen und Vorgehensweisen weiterzuentwickeln: Wie wollen wir uns im Landkreis die zukünftige Entwicklung vorstellen und gemeinsam strategisch planen? Wünschenswert wäre zudem, die vielen Anlaufstellen, Projekte und Erfahrungen in der Integrationsarbeit praktisch weiter zu vernetzen und etwa im Rahmen eines weiteren Symposiums zu evaluieren. Besucherstimmen während der Abschlussdiskussion Dass es solche Veranstaltungen wie dieses Symposium hier gibt, ist gut. Wir müssen miteinander reden. Nur so verstehen wir einander und finden heraus, was man machen kann und wie das geht. Es geht nicht so sehr darum, dass wir das schaffen, LESSONS LEARNED Jörg Heidig Wir haben mit Unterstützung der Bundeszentrale für politische Bildung ein Projekt durchgeführt, bei dem es um das Thema Integration und den Umgang mit Vorurteilen in der Oberlausitz ging. Die Kerne des Projektes bildeten eine Reihe von Trainings und ein Symposium. Wir möchten hier nicht nur aufschreiben, was wir gemacht haben und wie es gelaufen ist. Viel interessanter ist, was wir gelernt haben. Seit den Herbstmonaten des Jahres 2015 gibt es viele mediale Berichte über Sachsen und die Oberlausitz, die im Großen und Ganzen ein negatives Bild zeichnen. In der Region selbst gibt es, wenn man genau hinsieht, eine ganze Reihe von integrationsfördernden Initiativen und Dialogversuchen. Die Frage ist, welche Perspektive man einnimmt die des Journalisten, der eine Story braucht, oder die des Machers vor Ort, der etwas bewegen will. Die Frage, die uns bewegt hat, das Projekt durchzuführen, war, wie Dialogversuche in der Oberlausitz erfolgreich werden können. Wir waren froh, dass viele Gäste aus unterschiedlichen Bereichen unserer Einladung zum Symposium gefolgt sind. Die Veranstaltung lief gut, und bereits aus der Podiumsdiskussion schallte Texte zum Symposium Angekommen - und nun? am 28. Oktober 2017 in Görlitz
30 30 Das Publikum diskutiert mit. An einzelnen Ständen kommen Gäste und Akteure in den direkten Austausch. Integration in der Oberlausitz
UMGANG MIT VORURTEILEN. Argumentationshilfe zum Umgang mit Vorurteilen gegenüber Geflüchteten KIB KOMMUNIKATION. INFORMATION.
 UMGANG MIT VORURTEILEN Argumentationshilfe zum Umgang mit Vorurteilen gegenüber Geflüchteten KIB KOMMUNIKATION. INFORMATION. BILDUNG KIB KOMMUNIKATION. INFORMATION. BILDUNG UMGANG MIT VORURTEILEN Argumentationshilfe
UMGANG MIT VORURTEILEN Argumentationshilfe zum Umgang mit Vorurteilen gegenüber Geflüchteten KIB KOMMUNIKATION. INFORMATION. BILDUNG KIB KOMMUNIKATION. INFORMATION. BILDUNG UMGANG MIT VORURTEILEN Argumentationshilfe
Mach s Dir selbst. Woran erkenne ich, dass mir Coaching helfen könnte? Wann besteht denn überhaupt Coaching-Bedarf?
 Mach s Dir selbst Via Selbstcoaching in ein erfülltes Leben. Oftmals machen sich die Menschen Gedanken darüber, was denn andere denken könnten, wenn Sie Hilfe von außen für Ihre Probleme in Anspruch nehmen
Mach s Dir selbst Via Selbstcoaching in ein erfülltes Leben. Oftmals machen sich die Menschen Gedanken darüber, was denn andere denken könnten, wenn Sie Hilfe von außen für Ihre Probleme in Anspruch nehmen
Heldin/Held der eigenen Geschichte sein!
 Heldin/Held der eigenen Geschichte sein! Inhalt Recovery Ansatz Faktoren die Recovery fördern Schlüsselkonzepte von Recovery peer Support Aktiver Dialog 1 RECOVERY ANSATZ 28.11.2015 3 Recovery - Definition
Heldin/Held der eigenen Geschichte sein! Inhalt Recovery Ansatz Faktoren die Recovery fördern Schlüsselkonzepte von Recovery peer Support Aktiver Dialog 1 RECOVERY ANSATZ 28.11.2015 3 Recovery - Definition
Negative somatische Marker Solche Marker sind als Alarmsignale zu verstehen und mahnen zur Vorsicht.
 Wahrnehmung, Achtsamkeit, Bewusstsein Somatische Marker Damasio nennt die Körpersignale somatische Marker, die das emotionale Erfahrungsgedächtnis liefert. Soma kommt aus dem Griechischen und heißt Körper.
Wahrnehmung, Achtsamkeit, Bewusstsein Somatische Marker Damasio nennt die Körpersignale somatische Marker, die das emotionale Erfahrungsgedächtnis liefert. Soma kommt aus dem Griechischen und heißt Körper.
Um Lob auszusprechen...
 Einheit 2 Ich möchte dir meine Wertschätzung und Begeisterung zeigen (Grundhaltung) Um Lob auszusprechen... beschreibe ich konkret, was ich sehe oder höre bzw. die einzelnen Schritte, die für das Ergebnis
Einheit 2 Ich möchte dir meine Wertschätzung und Begeisterung zeigen (Grundhaltung) Um Lob auszusprechen... beschreibe ich konkret, was ich sehe oder höre bzw. die einzelnen Schritte, die für das Ergebnis
Ankommen bei uns in Brandenburg Regionalkonferenzen 2016
 Ankommen bei uns in Brandenburg Regionalkonferenzen 2016 Eine Dokumentation der Arbeiterwohlfahrt in Brandenburg Das haben wir auf den Konferenzen gemacht In Brandenburg gab es im September und Oktober
Ankommen bei uns in Brandenburg Regionalkonferenzen 2016 Eine Dokumentation der Arbeiterwohlfahrt in Brandenburg Das haben wir auf den Konferenzen gemacht In Brandenburg gab es im September und Oktober
Reden und streiten miteinander Kommunikation und Konflikte in der Familie
 Reden und streiten miteinander Kommunikation und Konflikte in der Familie Aktives Zuhören 1. Aufmerksam zuhören Nonverbal zeigen: Ich höre dir zu. Deine Äusserungen interessieren mich. Augenhöhe (bei Kindern),
Reden und streiten miteinander Kommunikation und Konflikte in der Familie Aktives Zuhören 1. Aufmerksam zuhören Nonverbal zeigen: Ich höre dir zu. Deine Äusserungen interessieren mich. Augenhöhe (bei Kindern),
Erste Hilfe bei starken Emotionen
 Erste Hilfe bei starken Emotionen Eine Anleitung zum etwas anderen Umgang mit unangenehmen Gefühlen. Für mehr innere Freiheit! Erste Hilfe-Toolkit In wenigen Schritten zur wahren Botschaft Deiner Emotionen
Erste Hilfe bei starken Emotionen Eine Anleitung zum etwas anderen Umgang mit unangenehmen Gefühlen. Für mehr innere Freiheit! Erste Hilfe-Toolkit In wenigen Schritten zur wahren Botschaft Deiner Emotionen
Der ANTREIBER-FRAGEBOGEN unterstützt Sie bei der Beantwortung dieser Fragen.
 ANTREIBER-FRAGEBOGEN Dieser Fragebogen hilft Ihnen, neue und zumeist unbewusste Aspekte Ihrer Motivation und Ihres Handelns zu entdecken und zu verstehen. Wer die Beweggründe und den Sinn seines Handels
ANTREIBER-FRAGEBOGEN Dieser Fragebogen hilft Ihnen, neue und zumeist unbewusste Aspekte Ihrer Motivation und Ihres Handelns zu entdecken und zu verstehen. Wer die Beweggründe und den Sinn seines Handels
Dr. Christoph Werth. Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
 Dr. Christoph Werth Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Grußwort zur Eröffnung des Intensivkurses Deutsch als Fremdsprache für Mediziner am Zentrum für kreatives Sprachtrining Jena
Dr. Christoph Werth Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Grußwort zur Eröffnung des Intensivkurses Deutsch als Fremdsprache für Mediziner am Zentrum für kreatives Sprachtrining Jena
Welche Glaubensätze steuern Sie? im Leben und im Miteinander mit anderen
 Welche Glaubensätze steuern Sie? im Leben und im Miteinander mit anderen Jeder von uns hat eine Menge tief verankerte Überzeugungen über uns selbst und die Welt. Der Wahrheitsgehalt dieser Glaubenssätze
Welche Glaubensätze steuern Sie? im Leben und im Miteinander mit anderen Jeder von uns hat eine Menge tief verankerte Überzeugungen über uns selbst und die Welt. Der Wahrheitsgehalt dieser Glaubenssätze
Janine Berg-Peer: Mit einer psychischen Krankheit im Alter selbständig bleiben eine Elternsicht Vortrag'DGPPN,' '
 Janine Berg-Peer: Selbstständigkeit im Alter 1 Janine Berg-Peer: Mit einer psychischen Krankheit im Alter selbständig bleiben eine Elternsicht Vortrag'DGPPN,'28.11.2014' Manchmal habe ich Angst, was mit
Janine Berg-Peer: Selbstständigkeit im Alter 1 Janine Berg-Peer: Mit einer psychischen Krankheit im Alter selbständig bleiben eine Elternsicht Vortrag'DGPPN,'28.11.2014' Manchmal habe ich Angst, was mit
Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute hier im Namen der Frankfurt School of Finance und Management begrüßen zu dürfen.
 Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute hier im Namen der Frankfurt School of Finance und Management begrüßen zu dürfen. Manch einer wird sich vielleicht fragen: Was hat eigentlich die Frankfurt
Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute hier im Namen der Frankfurt School of Finance und Management begrüßen zu dürfen. Manch einer wird sich vielleicht fragen: Was hat eigentlich die Frankfurt
Das Harvard-Konzept. Blatt 1. Das Harvard-Konzept basiert auf vier Prinzipien: und Probleme getrennt voneinander behandeln
 Das Harvard-Konzept Blatt 1 Das Harvard-Konzept ist eine Methode, um Verhandlungen sachbezogen zu führen. Es beruht auf dem Harvard Negotiation Projekt der Harvard Universität und ist ein wichtiger Baustein
Das Harvard-Konzept Blatt 1 Das Harvard-Konzept ist eine Methode, um Verhandlungen sachbezogen zu führen. Es beruht auf dem Harvard Negotiation Projekt der Harvard Universität und ist ein wichtiger Baustein
1. Beschreibe ein reales oder fiktives Beispiel aus deinem Freundes-, Bekannten- oder Familienkreis:
 1. Beschreibe ein reales oder fiktives Beispiel aus deinem Freundes-, Bekannten- oder Familienkreis: Der Klient findet es schwierig die englische Sprache zu erlernen. Er hat schon mehrere Versuche unternommen,
1. Beschreibe ein reales oder fiktives Beispiel aus deinem Freundes-, Bekannten- oder Familienkreis: Der Klient findet es schwierig die englische Sprache zu erlernen. Er hat schon mehrere Versuche unternommen,
Teilhabe Konkret Migrantenorganisationen in der Einwanderungsgesellschaft
 Teilhabe Konkret Migrantenorganisationen in der Einwanderungsgesellschaft Eröffnung der Bilanztagung am 20.10.2016 in Berlin Grußwort von Dr. Uta Dauke, Vizepräsidentin des Bundesamtes für Migration und
Teilhabe Konkret Migrantenorganisationen in der Einwanderungsgesellschaft Eröffnung der Bilanztagung am 20.10.2016 in Berlin Grußwort von Dr. Uta Dauke, Vizepräsidentin des Bundesamtes für Migration und
Inhalt Vorwort Gespräche analysieren & vorbereiten Gespräche aktiv gestalten
 4 Inhalt 6 Vorwort 7 Gespräche analysieren & vorbereiten 8 Wovon das Gespräch beeinflusst wird 10 Die eigene Rolle kennen 12 Die Beziehung zum Gesprächspartner einschätzen 16 Der Einfluss von Ort und Zeit
4 Inhalt 6 Vorwort 7 Gespräche analysieren & vorbereiten 8 Wovon das Gespräch beeinflusst wird 10 Die eigene Rolle kennen 12 Die Beziehung zum Gesprächspartner einschätzen 16 Der Einfluss von Ort und Zeit
Gewaltfreie Kommunikation - oder anders ausgedrückt: Respektvoller Umgang mit sich selbst und anderen
 Gewaltfreie Kommunikation - oder anders ausgedrückt: Respektvoller Umgang mit sich selbst und anderen Wir werden mit Worten angegriffen, wir reagieren sofort und neigen dazu zurückzuschlagen bzw. uns zu
Gewaltfreie Kommunikation - oder anders ausgedrückt: Respektvoller Umgang mit sich selbst und anderen Wir werden mit Worten angegriffen, wir reagieren sofort und neigen dazu zurückzuschlagen bzw. uns zu
Ist der Beruf des Astrologen/ der Astrologin was für mich?
 Test: Ist der Beruf des Astrologen/ der Astrologin was für mich? Viele, die einmal in die Astrologie reingeschnuppert haben - sei es über eine Beratung bei einem Astrologen, sei es über einen Kurs, den
Test: Ist der Beruf des Astrologen/ der Astrologin was für mich? Viele, die einmal in die Astrologie reingeschnuppert haben - sei es über eine Beratung bei einem Astrologen, sei es über einen Kurs, den
Aggression. Umgang mit einem wichtigen Gefühl
 Aggression Umgang mit einem wichtigen Gefühl Ein familylab Vortrag von Caroline Märki Leiterin familylab.ch Familienberaterin nach Jesper Juul Eltern-und Erwachsenenbildnerin mit eidg. FA Mutter von drei
Aggression Umgang mit einem wichtigen Gefühl Ein familylab Vortrag von Caroline Märki Leiterin familylab.ch Familienberaterin nach Jesper Juul Eltern-und Erwachsenenbildnerin mit eidg. FA Mutter von drei
Test Innere Antreiber
 Das Modell der inneren Antreiber kommt aus der Transaktionsanalyse, die darunter elterliche Forderungen versteht, mit denen konventionelle, kulturelle und soziale Vorstellungen verbunden sind. Diese Handlungsanweisungen
Das Modell der inneren Antreiber kommt aus der Transaktionsanalyse, die darunter elterliche Forderungen versteht, mit denen konventionelle, kulturelle und soziale Vorstellungen verbunden sind. Diese Handlungsanweisungen
Gnade sei mit euch Der vorgeschlagene Predigttext dieses Sonntags steht im 1. Johannesbrief im 4. Kapitel.
 Gnade sei mit euch Der vorgeschlagene Predigttext dieses Sonntags steht im 1. Johannesbrief im 4. Kapitel. Der Apostel schreibt: Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und
Gnade sei mit euch Der vorgeschlagene Predigttext dieses Sonntags steht im 1. Johannesbrief im 4. Kapitel. Der Apostel schreibt: Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und
Es ist eigentlich so einfach, dass es unmöglich ist. Ein Abend mit Daniel, Januar 2012
 Es ist eigentlich so einfach, dass es unmöglich ist. Ein Abend mit Daniel, Januar 2012 Daniel, ich hab eine ganz spannende Überlegung gehabt, die ich aber nicht ganz zu Ende überlegt habe weil Vielleicht
Es ist eigentlich so einfach, dass es unmöglich ist. Ein Abend mit Daniel, Januar 2012 Daniel, ich hab eine ganz spannende Überlegung gehabt, die ich aber nicht ganz zu Ende überlegt habe weil Vielleicht
Grußwort. Junge Islam Konferenz Freitag, 23. September 2016, 13 Uhr Landtag Nordrhein-Westfalen, Plenarsaal. Es gilt das gesprochene Wort!
 Grußwort Junge Islam Konferenz Freitag, 23. September 2016, 13 Uhr Landtag Nordrhein-Westfalen, Plenarsaal Es gilt das gesprochene Wort! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Teilnehmerinnen und
Grußwort Junge Islam Konferenz Freitag, 23. September 2016, 13 Uhr Landtag Nordrhein-Westfalen, Plenarsaal Es gilt das gesprochene Wort! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Teilnehmerinnen und
Wirkungsvoll schreiben : Tipps zu schwierigen Kundensituationen
 Wirkungsvoll schreiben : Tipps zu schwierigen Kundensituationen Schwierige Kundensituationen Strategie 1 Strategie Manche Briefe an Kunden sind besonders schwierig. Zum Beispiel, weil: Sie keine für den
Wirkungsvoll schreiben : Tipps zu schwierigen Kundensituationen Schwierige Kundensituationen Strategie 1 Strategie Manche Briefe an Kunden sind besonders schwierig. Zum Beispiel, weil: Sie keine für den
Die These: Dialogkompetenz ist nicht angeboren: jeder Mensch kann sie erwerben mit Haltung, Wissen und Übung!
 Dialog - Kernfähigkeiten kennenlernen, selbsteinschätzen und weiterentwickeln Quelle: M. & J. F. Hartkemmeyer / L. Freeman Dhority: Miteinander Denken. Das Geheimnis des Dialogs. Stuttgart. 2. Auflage
Dialog - Kernfähigkeiten kennenlernen, selbsteinschätzen und weiterentwickeln Quelle: M. & J. F. Hartkemmeyer / L. Freeman Dhority: Miteinander Denken. Das Geheimnis des Dialogs. Stuttgart. 2. Auflage
Die mentale Stärke verbessern
 1 Die mentale Stärke verbessern 2 Inhaltsverzeichnis Vorwort... 4 Was können wir uns unter der mentalen Stärke vorstellen?... 5 Wir suchen die mentale Stärke in uns... 6 Unsere Gedanken haben mehr Macht,
1 Die mentale Stärke verbessern 2 Inhaltsverzeichnis Vorwort... 4 Was können wir uns unter der mentalen Stärke vorstellen?... 5 Wir suchen die mentale Stärke in uns... 6 Unsere Gedanken haben mehr Macht,
Es gilt das gesprochene Wort!
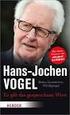 Rede von Frau Oberbürgermeisterin Henriette Reker anlässlich des gemeinsamen Treffens der StadtAGs, des Integrationsrates und des AK Kölner Frauenvereinigungen am 15. April 2016, 13:30 Uhr, Dienststelle
Rede von Frau Oberbürgermeisterin Henriette Reker anlässlich des gemeinsamen Treffens der StadtAGs, des Integrationsrates und des AK Kölner Frauenvereinigungen am 15. April 2016, 13:30 Uhr, Dienststelle
Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen
 Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen Christine Ordnung (Deutsch-Dänisches Institut für Familientherapie und Beratung): Kommunikation Präsentation im Rahmen der Regionalkonferenzen für Tandems an Hauptschulen
Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen Christine Ordnung (Deutsch-Dänisches Institut für Familientherapie und Beratung): Kommunikation Präsentation im Rahmen der Regionalkonferenzen für Tandems an Hauptschulen
Unterstützung von Angehörigen von Menschen mit Behinderungen
 Unterstützung von Angehörigen von Menschen mit Behinderungen Zusammenfassung In der UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen geht es um die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen.
Unterstützung von Angehörigen von Menschen mit Behinderungen Zusammenfassung In der UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen geht es um die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen.
Schritt 1: Welche Glaubenssätze beeinflussen dich?
 WELCHE GLAUBENSSÄTZE STEUERN DICH? im Leben und im Miteinander mit anderen Jeder von uns hat eine Menge tief verankerte Überzeugungen über uns selbst und die Welt. Der Wahrheitsgehalt dieser Glaubenssätze
WELCHE GLAUBENSSÄTZE STEUERN DICH? im Leben und im Miteinander mit anderen Jeder von uns hat eine Menge tief verankerte Überzeugungen über uns selbst und die Welt. Der Wahrheitsgehalt dieser Glaubenssätze
Kritik Sag's doch einfach!
 Kritik Sag's doch einfach! Wissenschaft & Verantwortung Skills Mag. Sabine Volgger 20. Mai 2014 Umgang mit unterschiedlichen Sichtweisen Abwarten und Tee trinken schauen, wie es sich entwickelt. Beschwichtigen
Kritik Sag's doch einfach! Wissenschaft & Verantwortung Skills Mag. Sabine Volgger 20. Mai 2014 Umgang mit unterschiedlichen Sichtweisen Abwarten und Tee trinken schauen, wie es sich entwickelt. Beschwichtigen
FRAUENSTIMME (fiktive Klientin): Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann mit dem Kollegen nicht mehr reden und arbeiten.
 KONFLIKTE LÖSEN IM BÜRO Wenn es am Arbeitsplatz Konflikte gibt, leiden oft nicht nur die betroffenen Personen darunter, sondern auch andere Kollegen. Die Stimmung ist schlecht und manche Mitarbeiter verlassen
KONFLIKTE LÖSEN IM BÜRO Wenn es am Arbeitsplatz Konflikte gibt, leiden oft nicht nur die betroffenen Personen darunter, sondern auch andere Kollegen. Die Stimmung ist schlecht und manche Mitarbeiter verlassen
Wie gewinnst du mehr Freude und Harmonie
 Wie gewinnst du mehr Freude und Harmonie Wie gewinnst du mehr Freude und Harmonie in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen? Der große und starke Elefant Ein junger Elefant wird gleich nach der Geburt
Wie gewinnst du mehr Freude und Harmonie Wie gewinnst du mehr Freude und Harmonie in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen? Der große und starke Elefant Ein junger Elefant wird gleich nach der Geburt
Leseprobe aus Zens und Jacob, Angststörungen, GTIN Programm PVU Psychologie Verlags Union in der Verlagsgruppe Beltz, Weinheim
 http://www.beltz.de/de/nc/verlagsgruppe-beltz/gesamtprogramm.html?isbn=4019172100056 1 Angst ist etwas ganz Alltägliches 1: DIE ANGST KENNENLERNEN PSYCHOEDUKATION Angst ist wie Trauer, Ärger oder Freude
http://www.beltz.de/de/nc/verlagsgruppe-beltz/gesamtprogramm.html?isbn=4019172100056 1 Angst ist etwas ganz Alltägliches 1: DIE ANGST KENNENLERNEN PSYCHOEDUKATION Angst ist wie Trauer, Ärger oder Freude
WER BIN ICH? ENDLICH SEIN!
 WER BIN ICH? ENDLICH SEIN! AUFGABE 1 SETZE DICH NOCH EINMAL MIT DEINER AUFGABE AUSEINANDER EINE SITUATION ZU UNTERSUCHEN, INWIEFERN DIESE VON VERSCHIEDENEN PERSONEN WAHRGENOMMEN UND ERFAHREN WIRD. BEISPIELE
WER BIN ICH? ENDLICH SEIN! AUFGABE 1 SETZE DICH NOCH EINMAL MIT DEINER AUFGABE AUSEINANDER EINE SITUATION ZU UNTERSUCHEN, INWIEFERN DIESE VON VERSCHIEDENEN PERSONEN WAHRGENOMMEN UND ERFAHREN WIRD. BEISPIELE
Das Angebot richtet sich vor allem an SuS, die kurz vor Abschlussrpüfungen stehen. Die Teilnahme ist freiwillig.
 Meditation gegen Prüfungsstress Nur Mut Von Alena Herrmann Kurz vor den Abitur- oder anderen Abschlussprüfungen sind viele SuS extrem angespannt und nervös. Eine gemeinsame Meditation bietet ihnen eine
Meditation gegen Prüfungsstress Nur Mut Von Alena Herrmann Kurz vor den Abitur- oder anderen Abschlussprüfungen sind viele SuS extrem angespannt und nervös. Eine gemeinsame Meditation bietet ihnen eine
"Wachstum braucht Veränderung" Training Beratung Coaching. Hinweise zu Konflikten und Feedback. Rund ums Team. Dez 2016 Wolfgang Schmitt
 Rund ums Team Hinweise zu Konflikten und Feedback Dez 2016 Wolfgang Schmitt "Wachstum braucht Veränderung" Training Beratung Coaching Rund ums Team Rollen (Stärken & Schwächen) Der Koordinator kann seine
Rund ums Team Hinweise zu Konflikten und Feedback Dez 2016 Wolfgang Schmitt "Wachstum braucht Veränderung" Training Beratung Coaching Rund ums Team Rollen (Stärken & Schwächen) Der Koordinator kann seine
KOMMUNIKATION IN DER SCHULE
 KOMMUNIKATION IN DER SCHULE KOMMUNIZIEREN REFLEKTIEREN ENTWICKELN 1 Kommunikation in der Schule der Zukunft Vier Säulen der Bildung (Jacques Delors, UNESCO, 4, 96) 2 Lernen zu lernen Eine Allgemeinbildung
KOMMUNIKATION IN DER SCHULE KOMMUNIZIEREN REFLEKTIEREN ENTWICKELN 1 Kommunikation in der Schule der Zukunft Vier Säulen der Bildung (Jacques Delors, UNESCO, 4, 96) 2 Lernen zu lernen Eine Allgemeinbildung
33. Zweifel an der Abnahme und die Folgen
 33. Zweifel an der Abnahme und die Folgen Es liegt natürlich klar auf der Hand: Jegliches Zweifeln behindert den Start unserer automatischen Abnahme. Was nutzt uns eine 5-Minuten-Übung, wenn wir ansonsten
33. Zweifel an der Abnahme und die Folgen Es liegt natürlich klar auf der Hand: Jegliches Zweifeln behindert den Start unserer automatischen Abnahme. Was nutzt uns eine 5-Minuten-Übung, wenn wir ansonsten
Szenisches Fallverstehen Fall Sophie
 1 Fall Sophie Beteiligte Personen Die alleinerziehende Pflegemutter Frau Brandt, der Fachberater des Pflegekinderdienstes Herr Neumann, die leibliche Tochter Laura (18J.), die Pflegetochter Sophie (14J.),
1 Fall Sophie Beteiligte Personen Die alleinerziehende Pflegemutter Frau Brandt, der Fachberater des Pflegekinderdienstes Herr Neumann, die leibliche Tochter Laura (18J.), die Pflegetochter Sophie (14J.),
Über den Autor: Dein Ziel ist es, deinen Ex-Partner zurückzugewinnen, ich helfe dir dabei! Webseite: daniel-caballero.de
 Über den Autor: Mein Name ist Daniel H. Caballero, ich bin seit über 6 Jahren Motivations- und Beziehungscoach und helfe Menschen den Partner fürs leben zu finden, die Beziehung zu retten, den Ex-Partner
Über den Autor: Mein Name ist Daniel H. Caballero, ich bin seit über 6 Jahren Motivations- und Beziehungscoach und helfe Menschen den Partner fürs leben zu finden, die Beziehung zu retten, den Ex-Partner
Migration works if migrants work
 Migration works if migrants work Migration funktioniert, wenn Migrantinnen und Migranten arbeiten. 23. Januar 2019, Landesinitiative Netzwerk W Johanna Hachmann, SOS Kinderdorf Niederrhein Kompetenzzentrum
Migration works if migrants work Migration funktioniert, wenn Migrantinnen und Migranten arbeiten. 23. Januar 2019, Landesinitiative Netzwerk W Johanna Hachmann, SOS Kinderdorf Niederrhein Kompetenzzentrum
Mit allen Sinnen wahrnehmen
 Mit allen Sinnen wahrnehmen Alles was unser Gehirn verarbeitet, nehmen wir durch unsere fünf Sinne wahr. Der größte Teil davon wird unbewusst erfasst es ist kaum nachvollziehbar, welcher Teil aus welcher
Mit allen Sinnen wahrnehmen Alles was unser Gehirn verarbeitet, nehmen wir durch unsere fünf Sinne wahr. Der größte Teil davon wird unbewusst erfasst es ist kaum nachvollziehbar, welcher Teil aus welcher
Gewaltfreie Kommunikation nachhaltig und wertschätzend
 Gewaltfreie Kommunikation nachhaltig und wertschätzend Was ist das Ziel gewaltfreier Kommunikation?!1 Was bedeutet gewaltfrei? Welche kommunikativen Hilfsmittel gibt es? Wie wird Beobachtung und Interpretation
Gewaltfreie Kommunikation nachhaltig und wertschätzend Was ist das Ziel gewaltfreier Kommunikation?!1 Was bedeutet gewaltfrei? Welche kommunikativen Hilfsmittel gibt es? Wie wird Beobachtung und Interpretation
Schritt 1: Für eine gute Kommunikation sorgen
 Schritt 1: Für eine gute Kommunikation sorgen Schritt 1: Für eine gute Kommunikation sorgen Eine gute Gesprächsatmosphäre, ein angenehmes Gespräch, ein gutes Gesprächsergebnis, ein positiver Eindruck beim
Schritt 1: Für eine gute Kommunikation sorgen Schritt 1: Für eine gute Kommunikation sorgen Eine gute Gesprächsatmosphäre, ein angenehmes Gespräch, ein gutes Gesprächsergebnis, ein positiver Eindruck beim
Es gilt das gesprochene Wort
 Grußwort zur vierten Integrationswoche am 12. Okt. 2014 Es gilt das gesprochene Wort Seien Sie herzlich willkommen hier in dieser wunderbaren Halle zur Eröffnung unserer vierten Integrations-Woche. Mit
Grußwort zur vierten Integrationswoche am 12. Okt. 2014 Es gilt das gesprochene Wort Seien Sie herzlich willkommen hier in dieser wunderbaren Halle zur Eröffnung unserer vierten Integrations-Woche. Mit
ACHTSAMKEIT UND DER INNERE BEOBACHTER. Dr. Monika Veith
 ACHTSAMKEIT UND DER INNERE BEOBACHTER 2 SELBST-DIAGNOSE MIT DEM INNEREN BEOBACHTER Das Konzept der Achtsamkeit im Alltag und in der Arbeit Wozu Achtsamkeit? Das wichtigste Ziel der Achtsamkeitspraxis,
ACHTSAMKEIT UND DER INNERE BEOBACHTER 2 SELBST-DIAGNOSE MIT DEM INNEREN BEOBACHTER Das Konzept der Achtsamkeit im Alltag und in der Arbeit Wozu Achtsamkeit? Das wichtigste Ziel der Achtsamkeitspraxis,
Anstatt einen Menschen wirklich und richtig kennenzulernen, verlieben sich viele lieber in die Oberflächlichkeit.
 Das Geheimnis Anstatt einen Menschen wirklich und richtig kennenzulernen, verlieben sich viele lieber in die Oberflächlichkeit. Die Oberflächlichkeit eines Menschen zu lieben ist leicht, ihm die Maske
Das Geheimnis Anstatt einen Menschen wirklich und richtig kennenzulernen, verlieben sich viele lieber in die Oberflächlichkeit. Die Oberflächlichkeit eines Menschen zu lieben ist leicht, ihm die Maske
KAPITEL 1. Rapport. * aus Wikipedia. Der Unterschied zwischen einem hochgradig einflussreichen Menschen und einem arbeitslosen Bankkaufmann?
 Tom Big Al Schreiter KAPITEL 1 Rapport Rapport (aus dem Französischen für Beziehung, Verbindung ) bezeichnet eine aktuell vertrauensvolle, von wechselseitiger empathischer Aufmerksamkeit getragene Beziehung,
Tom Big Al Schreiter KAPITEL 1 Rapport Rapport (aus dem Französischen für Beziehung, Verbindung ) bezeichnet eine aktuell vertrauensvolle, von wechselseitiger empathischer Aufmerksamkeit getragene Beziehung,
ERFOLGS-IMPULSE FÜR ACHTSAMKEIT IM BERUFSALLTAG
 ERFOLGS-IMPULSE FÜR ACHTSAMKEIT IM BERUFSALLTAG Impuls Nr. 1: Achtsame Kommunikation & Wahrnehmung Impuls Nr. 1: Achtsame Kommunikation & Wahrnehmung Achtsamkeit ist eine wesentliche Voraussetzung für
ERFOLGS-IMPULSE FÜR ACHTSAMKEIT IM BERUFSALLTAG Impuls Nr. 1: Achtsame Kommunikation & Wahrnehmung Impuls Nr. 1: Achtsame Kommunikation & Wahrnehmung Achtsamkeit ist eine wesentliche Voraussetzung für
Konflikte lästige Zeitgenossen oder Salz in der Suppe?
 Konflikte lästige Zeitgenossen oder Salz in der Suppe? Workshop im Rahmen der Fachtagung Hauswirtschaft Dienstag, 15. März 2016, Freiburg Workshop - Leitung: Erna Grafmüller, Dipl. Pädagogin, HBL, Supervisorin
Konflikte lästige Zeitgenossen oder Salz in der Suppe? Workshop im Rahmen der Fachtagung Hauswirtschaft Dienstag, 15. März 2016, Freiburg Workshop - Leitung: Erna Grafmüller, Dipl. Pädagogin, HBL, Supervisorin
Gelassenheit können Sie lernen
 Gelassenheit können Sie lernen Meine Übung für entspanntere Lernsituationen mit Ihrem Kind Sie sind manchmal kurz davor, die Fassung zu verlieren oder Ihr Kind mit Worten zu verletzen? Hier kommt eine
Gelassenheit können Sie lernen Meine Übung für entspanntere Lernsituationen mit Ihrem Kind Sie sind manchmal kurz davor, die Fassung zu verlieren oder Ihr Kind mit Worten zu verletzen? Hier kommt eine
Schlüsselkompetenzen für die psychiatrische Arbeit. Empowerment in der Psychiatrie aber richtig!
 Schlüsselkompetenzen für die psychiatrische Arbeit Empowerment in der Psychiatrie aber richtig! Ausgangspunkt : Recovery in der Praxis Was sollten Mitarbeiterinnen und Genesungsbegleiterinnen können (A.
Schlüsselkompetenzen für die psychiatrische Arbeit Empowerment in der Psychiatrie aber richtig! Ausgangspunkt : Recovery in der Praxis Was sollten Mitarbeiterinnen und Genesungsbegleiterinnen können (A.
Der psychologische Aspekt, in der homöopathischen Behandlung
 Der psychologische Aspekt, in der homöopathischen Behandlung Dr. Sanjay Sehgal Dr. Yogesh Sehgal Band XVI Homöopathie-Seminar Bad Boll 2007 Eva Lang Verlag Homöopathische Literatur INHALT Seite Dr. Yogesh
Der psychologische Aspekt, in der homöopathischen Behandlung Dr. Sanjay Sehgal Dr. Yogesh Sehgal Band XVI Homöopathie-Seminar Bad Boll 2007 Eva Lang Verlag Homöopathische Literatur INHALT Seite Dr. Yogesh
Der 21-Tage SelbsthilfeProzess
 Der 21-Tage SelbsthilfeProzess Übung #16: Werde dein eigener sicherer Hafen Niemand kann dir das Gefühl von Sicherheit, von Geborgenheit, von innerer Ruhe oder von geliebt werden, wirklich geben. Denn
Der 21-Tage SelbsthilfeProzess Übung #16: Werde dein eigener sicherer Hafen Niemand kann dir das Gefühl von Sicherheit, von Geborgenheit, von innerer Ruhe oder von geliebt werden, wirklich geben. Denn
Sie können auf ganz verschiedene Weise üben. Am besten probieren Sie einmal aus, womit Sie gut zurecht kommen.
 Wie läuft eine ab? Sie können auf ganz verschiedene Weise üben. Am besten probieren Sie einmal aus, womit Sie gut zurecht kommen. Sie müssen nicht in einen Unterricht gehen oder sich Bücher kaufen, um
Wie läuft eine ab? Sie können auf ganz verschiedene Weise üben. Am besten probieren Sie einmal aus, womit Sie gut zurecht kommen. Sie müssen nicht in einen Unterricht gehen oder sich Bücher kaufen, um
Downloadmaterialien zum Buch
 Downloadmaterialien zum Buch Björn Migge Handbuch Coaching und Beratung Wirkungsvolle Modelle, kommentierte Falldarstellungen, zahlreiche Übungen ISBN 978-3-407-36539-2 Beltz Verlag 3. Auflag 2014, Weinheim
Downloadmaterialien zum Buch Björn Migge Handbuch Coaching und Beratung Wirkungsvolle Modelle, kommentierte Falldarstellungen, zahlreiche Übungen ISBN 978-3-407-36539-2 Beltz Verlag 3. Auflag 2014, Weinheim
4 Perspektiven für eine verbesserten Kommunikation
 4 Perspektiven für eine verbesserten Kommunikation 23.06.2015-1- 4 Perspektiven für einer verbesserten Kommunikation 23.06.2015 Perspektive 1: Gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg zur pro aktiven
4 Perspektiven für eine verbesserten Kommunikation 23.06.2015-1- 4 Perspektiven für einer verbesserten Kommunikation 23.06.2015 Perspektive 1: Gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg zur pro aktiven
ON THE ROAD - AUF DER REISE ZU DIR SELBST
 ON THE ROAD - AUF DER REISE ZU DIR SELBST V a l u e U p C h a l l e n g e Bist Du schon der wichtigste Mensch in Deinem Leben? Ein Mensch der sich in seiner schwächsten Stunde so annehmen kann wie er ist,
ON THE ROAD - AUF DER REISE ZU DIR SELBST V a l u e U p C h a l l e n g e Bist Du schon der wichtigste Mensch in Deinem Leben? Ein Mensch der sich in seiner schwächsten Stunde so annehmen kann wie er ist,
Es gilt das gesprochene Wort!
 Rede von Frau Oberbürgermeisterin Henriette Reker anlässlich des Werkstattgesprächs mit Minister Dr. de Maizière zum Thema Wie gelingt Integration? Wie hält eine Gesellschaft zusammen? am 25. Oktober 2016,
Rede von Frau Oberbürgermeisterin Henriette Reker anlässlich des Werkstattgesprächs mit Minister Dr. de Maizière zum Thema Wie gelingt Integration? Wie hält eine Gesellschaft zusammen? am 25. Oktober 2016,
Gewaltfreie Kommunikation und Kinderrechte. - Ein Gruß aus der Küche
 Gewaltfreie Kommunikation und Kinderrechte - Ein Gruß aus der Küche Jenseits von richtig und falsch Gibt es einen Ort. Dort treffen wir uns. Rumi Dr. M. Rosenberg entwickelte in den 70er Jahren das Modell
Gewaltfreie Kommunikation und Kinderrechte - Ein Gruß aus der Küche Jenseits von richtig und falsch Gibt es einen Ort. Dort treffen wir uns. Rumi Dr. M. Rosenberg entwickelte in den 70er Jahren das Modell
Schritt 1: Was passiert, wenn ich mich um mich selbst kümmere?
 Schritt 1: Was passiert, wenn ich mich um mich selbst kümmere? Was werden meine Familie, meine Freunde, meine, Kollegen von mir denken? Die Ängste, das schlechte Gewissen, die Schuldgefühle die an dir
Schritt 1: Was passiert, wenn ich mich um mich selbst kümmere? Was werden meine Familie, meine Freunde, meine, Kollegen von mir denken? Die Ängste, das schlechte Gewissen, die Schuldgefühle die an dir
Einfach glücklich er s ein! 4 erstaunlich einfache Tipps, wie Sie glücklicher und zufriedener werden!
 Einfach glücklich er s ein! 4 erstaunlich einfache Tipps, wie Sie glücklicher und zufriedener werden! Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, dass
Einfach glücklich er s ein! 4 erstaunlich einfache Tipps, wie Sie glücklicher und zufriedener werden! Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, dass
HORSEMAN SHIP. Thorsten Gabriel. Körpersprache von Pferden
 HORSEMAN SHIP Thorsten Gabriel 2018 Körpersprache von Pferden SPRACHE DER PFERDE 2 Um die Körpersprache des Pferdes zu verstehen und sich im Umgang mit Pferden richtig zu verhalten, musst Du Dir erst einmal
HORSEMAN SHIP Thorsten Gabriel 2018 Körpersprache von Pferden SPRACHE DER PFERDE 2 Um die Körpersprache des Pferdes zu verstehen und sich im Umgang mit Pferden richtig zu verhalten, musst Du Dir erst einmal
Werte bestimmen und leben
 Werte bestimmen und leben Teil 1 Werte bestimmen Die folgende Übung wird Dir helfen, Deine wahren Werte zu erkennen. Außerdem kannst Du Dir im Rahmen dieser Übung darüber klar werden, wie wichtig die einzelnen
Werte bestimmen und leben Teil 1 Werte bestimmen Die folgende Übung wird Dir helfen, Deine wahren Werte zu erkennen. Außerdem kannst Du Dir im Rahmen dieser Übung darüber klar werden, wie wichtig die einzelnen
Was trägt zum Gelingen einer glücklichen Partnerschaft bei?
 Was trägt zum Gelingen einer glücklichen Partnerschaft bei? 1. Der Partner ist nicht für das Glück des anderen zuständig. Ob ich glücklich oder unglücklich bin, hängt nicht von meinem Freund oder Partner
Was trägt zum Gelingen einer glücklichen Partnerschaft bei? 1. Der Partner ist nicht für das Glück des anderen zuständig. Ob ich glücklich oder unglücklich bin, hängt nicht von meinem Freund oder Partner
Ich begrüsse Sie zum Impulsvortrag zum Thema: «Körpersprache geht uns alle an»
 Ich begrüsse Sie zum Impulsvortrag zum Thema: «Körpersprache geht uns alle an» Meine Ziele oder meine Absicht für Heute Abend: Sie erhalten ein Wissen über die Zusammensetzung der KS Sie erhalten Tipps
Ich begrüsse Sie zum Impulsvortrag zum Thema: «Körpersprache geht uns alle an» Meine Ziele oder meine Absicht für Heute Abend: Sie erhalten ein Wissen über die Zusammensetzung der KS Sie erhalten Tipps
Unser Bild vom Menschen
 Das pädagogische Konzept t des ELKI Naturns: Unser Bild vom Menschen Wir sehen den Menschen als ein einzigartiges, freies und eigenständiges Wesen mit besonderen physischen, emotionalen, psychischen und
Das pädagogische Konzept t des ELKI Naturns: Unser Bild vom Menschen Wir sehen den Menschen als ein einzigartiges, freies und eigenständiges Wesen mit besonderen physischen, emotionalen, psychischen und
CRM-Grundlagen. Modul 1 - Anhänge INCREASE-Weiterbildungscurriculum Intellectual Output 2 Projektnr AT02-KA M1-A13
 CRM-Grundlagen Quelle: Nickson, Ch (2016, May 27): Crisis Resource Management (CRM). Abgerufen von: http://lifeinthefastlane.com/ccc/crisisresource-management-crm/ am 07/07/2016 1. Kennen Sie den Kontext/das
CRM-Grundlagen Quelle: Nickson, Ch (2016, May 27): Crisis Resource Management (CRM). Abgerufen von: http://lifeinthefastlane.com/ccc/crisisresource-management-crm/ am 07/07/2016 1. Kennen Sie den Kontext/das
Bedeutung. Gegenteil Eskalation Synonyme: Entspannung Entkrampfung Entschärfung
 Deeskalation Bedeutung Gegenteil Eskalation Synonyme: Entspannung Entkrampfung Entschärfung Bedeutung Ziel der Deeskalation ist es einen Konflikt zu vermeiden. Verhinderung von psychischen und physischen
Deeskalation Bedeutung Gegenteil Eskalation Synonyme: Entspannung Entkrampfung Entschärfung Bedeutung Ziel der Deeskalation ist es einen Konflikt zu vermeiden. Verhinderung von psychischen und physischen
ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische
 ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische amerikanischen Amt an An andere anderen anderer anderes
ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische amerikanischen Amt an An andere anderen anderer anderes
Wenn Kinder wütend sind- Mit starken Gefühlen umgehen lernen. Auf die innere Haltung kommt es an
 Wenn Kinder wütend sind- Mit starken Gefühlen umgehen lernen Auf die innere Haltung kommt es an Jeanette Schmieder, Dipl. Sozialpäd., Systemische Supervisorin, Coach und Familientherapeutin (SG) Kontakt
Wenn Kinder wütend sind- Mit starken Gefühlen umgehen lernen Auf die innere Haltung kommt es an Jeanette Schmieder, Dipl. Sozialpäd., Systemische Supervisorin, Coach und Familientherapeutin (SG) Kontakt
Hier siehst du ein nützliches Schema, um deine Gefühle und emotionalen Reaktionen richtig zu verstehen:
 6 Die ABC-Methode Hier siehst du ein nützliches Schema, um deine Gefühle und emotionalen Reaktionen richtig zu verstehen: Ereignis Gedanken Emotion bewirkt in deinem Kopf ruft hervor A B C In erster Linie
6 Die ABC-Methode Hier siehst du ein nützliches Schema, um deine Gefühle und emotionalen Reaktionen richtig zu verstehen: Ereignis Gedanken Emotion bewirkt in deinem Kopf ruft hervor A B C In erster Linie
Im Dialog 090 Begrüßung 090 Gesprächseinstieg 092 Klärungsphase 096 Suche nach Lösungsansätzen 101 Eine konkrete (Ziel-)Vereinbarung treffen 104
 Inhalt Kapitel 01 Grundsätzliches vornweg 007 Franz und Emil 008 Häufige Fragen 011 Kapitel 02 Individuelle Betrachtung 022 Situation beschreiben 022 Das Ziel definieren 034 Zielorientierte Auswahl alternativer
Inhalt Kapitel 01 Grundsätzliches vornweg 007 Franz und Emil 008 Häufige Fragen 011 Kapitel 02 Individuelle Betrachtung 022 Situation beschreiben 022 Das Ziel definieren 034 Zielorientierte Auswahl alternativer
Fragebogen zu Gefühlen im Umgang mit Menschen (Vorversion V1.1)
 2007 1 Fragebogen zu Gefühlen im Umgang mit Menschen (Vorversion V1.1) Sie werden gleich eine Reihe von Aussagen lesen, die jeweils bestimmte (verallgemeinerte) menschliche Eigenschaften oder Reaktionen
2007 1 Fragebogen zu Gefühlen im Umgang mit Menschen (Vorversion V1.1) Sie werden gleich eine Reihe von Aussagen lesen, die jeweils bestimmte (verallgemeinerte) menschliche Eigenschaften oder Reaktionen
Wortformen des Deutschen nach fallender Häufigkeit:
 der die und in den 5 von zu das mit sich 10 des auf für ist im 15 dem nicht ein Die eine 20 als auch es an werden 25 aus er hat daß sie 30 nach wird bei einer Der 35 um am sind noch wie 40 einem über einen
der die und in den 5 von zu das mit sich 10 des auf für ist im 15 dem nicht ein Die eine 20 als auch es an werden 25 aus er hat daß sie 30 nach wird bei einer Der 35 um am sind noch wie 40 einem über einen
Leit-Bild der Werkstätten Gottes-Segen
 Leit-Bild der Werkstätten Gottes-Segen An diesem Leit-Bild haben viele Menschen mitgearbeitet: Die Mitarbeiter Die Beschäftigten Und die Angehörigen von den Beschäftigten 1 Das erfahren Sie im Leit-Bild
Leit-Bild der Werkstätten Gottes-Segen An diesem Leit-Bild haben viele Menschen mitgearbeitet: Die Mitarbeiter Die Beschäftigten Und die Angehörigen von den Beschäftigten 1 Das erfahren Sie im Leit-Bild
Wie Beziehungen gelingen!
 Warum ist der Umgang mit unseren Emotionen so wichtig? Weil unsere Beziehungen geprägt sind von unserer Ausstrahlung, der Atmosphäre, die wir schaffen! Weil "Licht und Salz sein" ganz viel mit unseren
Warum ist der Umgang mit unseren Emotionen so wichtig? Weil unsere Beziehungen geprägt sind von unserer Ausstrahlung, der Atmosphäre, die wir schaffen! Weil "Licht und Salz sein" ganz viel mit unseren
Fragebogen zur Borderline-Persönlichkeitsstörung. Borderline Personality Questionnaire (BPQ)
 Fragebogen zur Borderline-Persönlichkeitsstörung Borderline Personality Questionnaire (BPQ) Anleitung: Bitte kreuzen Sie in Bezug auf jede Aussage jeweils die Antwort an, die Ihrem Gefühl nach Ihre Person
Fragebogen zur Borderline-Persönlichkeitsstörung Borderline Personality Questionnaire (BPQ) Anleitung: Bitte kreuzen Sie in Bezug auf jede Aussage jeweils die Antwort an, die Ihrem Gefühl nach Ihre Person
SCHAFF DIR EINE WELT, WIE SIE DIR GEFÄLLT!
 KURZANLEITUNG Norman Brenner Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keine Verantwortung für die Handlungen des Lesers und daraus entstehende Folgen. DIE WELT VERÄNDERN WIE GEHT DAS? In dieser Kurzanleitung
KURZANLEITUNG Norman Brenner Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keine Verantwortung für die Handlungen des Lesers und daraus entstehende Folgen. DIE WELT VERÄNDERN WIE GEHT DAS? In dieser Kurzanleitung
Konstruktive Kommunikation Nach Marshall Rosenbergs Gewaltfreier Kommunikation
 Konstruktive Kommunikation Nach Marshall Rosenbergs Gewaltfreier Kommunikation Quelle: Marshall Rosenberg: Gewaltfreie Kommunikation Paderborn 2001 Die seelischen Funktionen Denken Vorstellungen Interpretationen
Konstruktive Kommunikation Nach Marshall Rosenbergs Gewaltfreier Kommunikation Quelle: Marshall Rosenberg: Gewaltfreie Kommunikation Paderborn 2001 Die seelischen Funktionen Denken Vorstellungen Interpretationen
Erfolgreich Telefonieren
 Körperliche Vorbereitung Hunger vermeiden & Blutzuckerspiegel beachten. Der Blutzuckerspiegel ist elementar für eine gute Konzentrationsfähigkeit Ausreichend trinken hält die Stimmbänder geschmeidig Nase
Körperliche Vorbereitung Hunger vermeiden & Blutzuckerspiegel beachten. Der Blutzuckerspiegel ist elementar für eine gute Konzentrationsfähigkeit Ausreichend trinken hält die Stimmbänder geschmeidig Nase
Achtsamkeit was ist das?
 Auf meinem Blog auf dem ich verschiedene Gesundheitsthemen anbringe habe ich vor einiger Zeit einen Beitrag veröffentlicht, der heißt Multitasking ist OUT Achtsamkeit ist IN. Er war ein Teil meiner Abschlussarbeit
Auf meinem Blog auf dem ich verschiedene Gesundheitsthemen anbringe habe ich vor einiger Zeit einen Beitrag veröffentlicht, der heißt Multitasking ist OUT Achtsamkeit ist IN. Er war ein Teil meiner Abschlussarbeit
Was sind die 5 LERNTYPEN? Das ist der olfaktorische Lerntyp. Du findest sie manchmal in der Gastronomie und Kosmetik. Sie sind aber selten.
 Je mehr du über deine Kunden weisst, desto kundenorientierter kannst du handeln. Die 5 Lerntypen geben dir Hinweise über die Denkweise deiner Kunden. Was sind die 5 LERNTYPEN? 5 LERNTYPEN Kinästhetisch
Je mehr du über deine Kunden weisst, desto kundenorientierter kannst du handeln. Die 5 Lerntypen geben dir Hinweise über die Denkweise deiner Kunden. Was sind die 5 LERNTYPEN? 5 LERNTYPEN Kinästhetisch
Innere Antreiber 1 Test zur Selbsteinschätzung
 Innere Antreiber 1 Test zur Selbsteinschätzung Bewerten Sie anhand der Skala 1-5, in welchem Maße die Aussagen auf Sie zutreffen: 1 = trifft gar nicht auf mich zu; 5 = trifft völlig auf mich zu Bitte antworten
Innere Antreiber 1 Test zur Selbsteinschätzung Bewerten Sie anhand der Skala 1-5, in welchem Maße die Aussagen auf Sie zutreffen: 1 = trifft gar nicht auf mich zu; 5 = trifft völlig auf mich zu Bitte antworten
Überzeugen und Verhandeln
 Überzeugen und Verhandeln Patrick Vonwil Mit dem Kopf durch die Wand Höchstens einer/einem von drei Assessment-Teilnehmenden gelingt es, in Verhandlungen wirklich überzeugende Ergebnisse zu erzielen. Woran
Überzeugen und Verhandeln Patrick Vonwil Mit dem Kopf durch die Wand Höchstens einer/einem von drei Assessment-Teilnehmenden gelingt es, in Verhandlungen wirklich überzeugende Ergebnisse zu erzielen. Woran
Älterer Bruder/ältere Schwester. Tutor/LehrerIn. Eltern/Erziehungsberechtigte/ andere Familienmitglieder. Psychologe/ Schulpädagoge
 Älterer Bruder/ältere Schwester Für junge Menschen ist es manchmal schwierig, mit Erwachsenen über für sie wichtige Dinge zu sprechen. Sie könnten verlegen sein und Angst haben, dass Erwachsene sie nicht
Älterer Bruder/ältere Schwester Für junge Menschen ist es manchmal schwierig, mit Erwachsenen über für sie wichtige Dinge zu sprechen. Sie könnten verlegen sein und Angst haben, dass Erwachsene sie nicht
Fachstelle für Kinder- und Jugendfragen. Worbstrasse Gümligen
 Fachstelle für Kinder- und Jugendfragen Worbstrasse 211 3073 Gümligen Gedanken der Eltern + Anregungen FKJF «Konflikte unter Kindern» Die Rolle der Eltern bei Konflikten ihrer Kinder in unbeaufsichtigter
Fachstelle für Kinder- und Jugendfragen Worbstrasse 211 3073 Gümligen Gedanken der Eltern + Anregungen FKJF «Konflikte unter Kindern» Die Rolle der Eltern bei Konflikten ihrer Kinder in unbeaufsichtigter
ERZIEHUNG GELINGT. Wenn Sie diese 11 Punkte beachten. Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel. J.W.
 ERZIEHUNG GELINGT Wenn Sie diese 11 Punkte beachten Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel. J.W. von Goethe ERZIEHUNG GELINGT Liebe Leserin, lieber Leser Eltern ABC Eigentlich
ERZIEHUNG GELINGT Wenn Sie diese 11 Punkte beachten Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel. J.W. von Goethe ERZIEHUNG GELINGT Liebe Leserin, lieber Leser Eltern ABC Eigentlich
Es ist so gut zu wissen,
 Es ist so gut zu wissen, dass jeder Mensch unermesslich reich an (oft ungenutzten) inneren Schätzen, Potenzialen und Ressourcen ist, dass jeder auf natürliche Weise seine eigene innere Mitte und seinen
Es ist so gut zu wissen, dass jeder Mensch unermesslich reich an (oft ungenutzten) inneren Schätzen, Potenzialen und Ressourcen ist, dass jeder auf natürliche Weise seine eigene innere Mitte und seinen
Was macht Kinder stark?
 Was macht Kinder stark? Elternabend Hinwil, 2.11. 2015 Doris Brodmann Ablauf! Einstieg! Input! Austausch in Gruppen! Präsentation Diskussionsergebnisse! Was macht die Schule! Was tun wenn! Abschluss Prävention
Was macht Kinder stark? Elternabend Hinwil, 2.11. 2015 Doris Brodmann Ablauf! Einstieg! Input! Austausch in Gruppen! Präsentation Diskussionsergebnisse! Was macht die Schule! Was tun wenn! Abschluss Prävention
Herzlich willkommen zum Seminar
 Herzlich willkommen zum Seminar Vereinsinterne Kommunikationwirkungsvoll Feedback geben 9. Internationaler Hamburger Sport-Kongress 4. November 2018, 15.45 17.15 Uhr Vereine sind Nicht-triviale Systeme
Herzlich willkommen zum Seminar Vereinsinterne Kommunikationwirkungsvoll Feedback geben 9. Internationaler Hamburger Sport-Kongress 4. November 2018, 15.45 17.15 Uhr Vereine sind Nicht-triviale Systeme
Führungsstile & Umgang mit Konflikten (Teil II)
 Führungsstile & Umgang mit Konflikten (Teil II) Gastvortrag an der ETH Zürich Vorlesung Management Maya Bentele 17. Mai 2016 Übersicht Sinn von Konflikten Konfliktsymptome Einstellung zu Konflikten Grundmuster
Führungsstile & Umgang mit Konflikten (Teil II) Gastvortrag an der ETH Zürich Vorlesung Management Maya Bentele 17. Mai 2016 Übersicht Sinn von Konflikten Konfliktsymptome Einstellung zu Konflikten Grundmuster
Gelingende Gespräche im Konflikt Wie sag ich s am besten?
 Gelingende Gespräche im Konflikt Wie sag ich s am besten? Gelingende Gespräche im Konflikt 1 Was ist destruktives Verhalten? Was erschwert die Lösung von Konflikten? - Regeln verletzen - Schuld nur bei
Gelingende Gespräche im Konflikt Wie sag ich s am besten? Gelingende Gespräche im Konflikt 1 Was ist destruktives Verhalten? Was erschwert die Lösung von Konflikten? - Regeln verletzen - Schuld nur bei
Psychische Bedürfnisse Hirnforschung Wohlbefinden
 Psychische Bedürfnisse Hirnforschung Wohlbefinden Warum sich mit menschlichen Bedürfnissen beschäftigen? Menschen kaufen dort, wo sie ihre Bedürfnisse am besten erfüllt bekommen Erfüllung körperlicher
Psychische Bedürfnisse Hirnforschung Wohlbefinden Warum sich mit menschlichen Bedürfnissen beschäftigen? Menschen kaufen dort, wo sie ihre Bedürfnisse am besten erfüllt bekommen Erfüllung körperlicher
Andreas Knuf. Gesundung ist möglich! Borderline-Betroffene berichten
 Andreas Knuf Gesundung ist möglich! Borderline-Betroffene berichten 1 16 nur einfache Dinge sind, zum Beispiel Fotos in ein Album einzukleben oder zu putzen. Jede Krise, die ich gemeistert habe, baute
Andreas Knuf Gesundung ist möglich! Borderline-Betroffene berichten 1 16 nur einfache Dinge sind, zum Beispiel Fotos in ein Album einzukleben oder zu putzen. Jede Krise, die ich gemeistert habe, baute
Wir möchten uns noch einmal bei Ihnen für Ihr Vertrauen bedanken, dass Sie sich für den Online-Coaching Kurs entschieden haben.
 1 Beziehungsneustart Teil 2. Online- Coaching Kurs Einen wunderschönen guten Tag! Wir möchten uns noch einmal bei Ihnen für Ihr Vertrauen bedanken, dass Sie sich für den Online-Coaching Kurs entschieden
1 Beziehungsneustart Teil 2. Online- Coaching Kurs Einen wunderschönen guten Tag! Wir möchten uns noch einmal bei Ihnen für Ihr Vertrauen bedanken, dass Sie sich für den Online-Coaching Kurs entschieden
