Makromolekule ~WILEY-VCH. Band 1: Chemische Struktur und Synthesen. Hans-Georg Elias. Sechste, vollstandig uberarbeitete Auflage
|
|
|
- Frieder David Bauer
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Hans-Georg Elias Makromolekule Band 1: Chemische Struktur und Synthesen Sechste, vollstandig uberarbeitete Auflage ~WILEY-VCH Weinheim. New York. Chichester. Brisbane. Singapore.Toronto
2 This Page Intentionally Left Blank
3 Hans-Georg Elias Makromolekiile Band k Chemische Struktur und WI LEY-VCH
4 Hans-Georg Elias Makromolekule Sechste, vollstandig iiberarbeitete Auflage Band 1: Chemische Struktur und Synthesen Band 2: Physikalische Struktur und Eigenschaften Band 3: Rohstoffe, Industrielle Synthesen, Polyrnere Band 4: Anwendungen
5 Hans-Georg Elias Makromolekule Band 1: Chemische Struktur und Synthesen Sechste, vollstandig uberarbeitete Auflage ~WILEY-VCH Weinheim. New York. Chichester. Brisbane. Singapore.Toronto
6 Prof. Dr. Hans-Georg Elias 4009 Linden Drive Midland, MI IJSA r Das vorliegende Werk wurde sorgfaltig erarbeitet. Dennoch iibernehmen Autor und Verlag fur die Richtigkeit von Angaben. Hinweisen und Ratsehlagen sowie fur eventuelle Druckfehler keine Haftung. 1.Auflage uberarbeitete Auflage uberarbeitete und erweiterte Auflage uberarbeitete und erweiterte Auflage ,iiberarbeitete und erweiterte Auflage: Band 1: 190 Band 2: vollstandig iiberarbeitete und erweiterte Auflage: Band I: 1999 Bande 2 his 4: in Vorbereitung Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Elias, Hans-Georg: Makromolekule / Hans-Georg Elias. - Weinheim :New York : Chichester ; Brisbane : Singapore ;Toronto : WILEY-VCH S.Aufl. im Verl. Hiithig und Wepf. Basel, Heidelberg. New York Bd. 1.Chemische Struktur und Synthesen vollst. iiberarb. Aufl ISBN x 0 WILEY-VCH Verlag GmbH. D Weinheini (Federal Republic of Germany), 1999 Gedruckt auf saurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier. Alle Rechte, insbesondere die der Ubersetzung in andere Sprachen. vorbehalten. Kein Teil dieses Buehes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeincr Form - durch Photokopie. Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren - reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, venvendbare Sprache ubertragen oder ubersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Huch berechtigt nicht zu der Annahme, dab diese von jedermann frei benutzt werden diirfen.vielmehr kann es sich auch dann uni eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschutzte Kennzeichen handeln, wenn sic nicht eigens als solche markiert sind. All rights reserved (including those of translation in other languages). No part of this book may be reproduced in any form -by photoprinting,microfilm.or any other means - nor transmitted or translated into machine language without written permission from the publishers. Registered names.trademarks.etc. used in this hook,even when not specifically marked as such. are not to be considered unprotected by law. Druck: Strauss Offsetdruck, D Morlenbach Bindung: Buchbinderei Osswald&Co.. D Neustadt (WeinstraBe) Printed in the Federal Republic of Germany.
7 V Didici in mathematicis ingenio, in natura experimentis. in legibus divinis humanisque auctoritate, in historia testimoniis nitendum esse. Gottfried Wilhelm Leibniz ( ) (Ich lemte, dass man sich in der Mathematik auf die Eingebung des Geistes, in der Naturwissenschaft auf das Experiment, in der Lehre vom gbttlichen und menschlichen Recht auf die AutoritBt und in der Geschichte auf beglaubigte Quellen zu stiitzen habe.)
8 This Page Intentionally Left Blank
9 Vomtort VII Vorwort zu Band I der 6. Auflage Punru rhei - alles fliesst, besonders in den Polymewissenschaften. Um die Fiille der neuen Befunde und Erkennulisse zu bhdigen, wurde entsprechend den Wiinschen des Wiley-VCH-Verlages als neuem Eigentiimer der Verlagsrechte der naturwissenschaftlichen Aktivittiten des Hiithig und Wepf-Verlages die beiden Bade der 5.Auflage in jeweils zwei Bhde der 6.Auflage geteilt: Chemische Strukturen und Synthesen (Band I), Physikalische Strukturen und Eigenschaften (Band II), Technische Synthesen und Polymere (Band 111) und Technologie der Polymeren (Band IV). Jeder Band ist weitgehend in sich abgeschlossen, weist aber auch auf die anderen Bhde hin. Im vorliegenden ersten Band "Chemische Strukturen und Synthesen" wurde die bewtihrte Gliedemg beibehalten: zuerst die chemische Struktur (Konstitution, Konfiguration und Konformation). dann die Synthesen, geordnet nach Mechanismen. An die Stelle des Kapitels "Molmassen und Molmassenverteilungen" tritt nunmehr ein neues Kapitel "Charakterisierung von Polymeren", welches das Riistzeug fiir den prgparativ bzw. mechanistisch arbeitenden Chemiker bereitstellt. In diesem Kapitel werden die wichtigsten Routinemethoden zur molekuloren Charakterisierung von Polymeren beschrieben: Massenspektroskopie. Gr(lssenauschlusschromatographie, Fraktionierung und Viskosimetrie. Aufwendigere und nicht so routinemgssig verwendete physikalische Methoden werden mit ihren Grundlagen in Band I1 behandelt (Osmometrie, Lichtstreuung, usw.). Bei den Synthesemethoden wurde wie bei der 5.Auflage vorgegangen: zuntichst einige Grundlagen (speziell Statistik), dann die Thermodynamik der Polyreaktionen, gefolgt von den ionischen, insertierenden und radikalischen Polymerisationen. anderen Polymerisationsarten. Copolymerisationen, Polykondensationen und Polyadditionen, biologischen Polyreaktionen und Polymertransformationen. Den Abschluss bildet ein neues Kapitel iiber Strategien zur Synthese komplexerer Molekiilarchitekturen. Alle Kapitel wurden iiberarbeitet und in den meisten Fiillen umgeschrieben, Satz fiir Satz und Absatz fiir Absatz, teilweise auch mit neuen Untergliederungen. Mehr als der Abbildungen sind neu. ebenso viele Tabellen. Bei den termini technici und den Polymemamen wurde auf die neuesten Definitionen der IUPAC-NomenkIaturkommission verwiesen. Zu den wichtigsten Fachausdriicken wurden die griechischen und lateinischen Sprachwurzeln angegeben und, weil Englisch nunmehr die intemationaler Wissenschaftssprache ist, auch die entsprechenden englischen Ausdriicke (in amerikanischer Schreibweise). Den meisten Kapiteln wurden ausserdem "Historische Notizen" angehhgt, welche die Befunde und Aussagen der wichtigsten friihen Arbeiten auf den betreffenden Teilgebieten beleuchten. Neu im Band I sind femer: Dendrimere und ihre Synthesen. hyperverzweigte Polymere, pseudolebende anionische Polymerisationen, lebende kationische Polymerisationen. trtigergestiitzte Mehrzentreninsertionen, Metallocen-Katalysen. ring6ffnende Metathese- Polymerisationen (ROMP), acyclische Dien-Synthesen (ADMET). radikalische Polymerisationen mit pulsierenden Lasem (PLP-MMD), radikalische Ringpolymerisationen, radikalische Eliminationspolymerisation, quasilebende radikalische Polymerisationen, Statistik der Polyreaktionen zu Stempolymeren, Dendrimeren und hyperverzweigten Polymeren, Polycatenanen, Polyrotaxanen, Rbhrenpolymeren. und Folienpolymeren. Midland, Michigan, im Friihjahr 1999 Hans-Georg Elias
10 VIII Vorwort Aus dem Vorwort zur 1.4. Auflage Dieses Lehrbuch ist - wie so viele seiner Art - aus den Bedurfnissen des Untemchts entstanden. Im obligatorischen Untemcht in den makromolekularen Wissenschaften fiir die Chemiker und Werkstoffkundler des 3.-7.Semesters (ETH Zurich) hatte ich seit vielen Jahren ein Lehrbuch vermisst, das von den Grundlagen der Chemie und Physik makromolekularer Substanzen bis zu den Anwendungen der Makromolekule in der Technik fiihne. Dieses Lehrbuch soute die Lucke zwischen den kurzen und daher oft zu sehr simplifizierenden Einfuhrungen und den hochspezialisierten Lehrbuchern und Monographien uber Teilgebiete der makromolekularen Wissenschaften schliessen und einen Uberblick uber das Gesamtgebiet vermitteln... Bei den einzelnen Kapiteln wird eine angemessene Kennmis der anorganischen, organischen und physikalischen Chemie einschliesslich der dort verwendeten Methoden vorausgesetzt. Alle fiir die Wissenschaft der Makromolekule wichtigen Uberlegungen und Ableitungen wurden jedoch - wenn immer mtiglich - von den Grundph&omenen und 4berlegungen aus Schritt fiir Schritt vorgenommen. Ich hoffe daher, dass sich dieses Buch zum Selbststudium eignet. In einigen Fiillen war ich gezwungen, strengere Ableitungen mit ihrem zwangsliufig grdsseren mathematischen Aufwand zugunsten halbquantitativer, aber durchsichtigerer Ansitze zu vemachlksigen... In allen Falen wurde weniger Wert darauf gelegt, mdglichst viele Fakten zu vermitteln als vielmehr das Denken zu schulen und die Zusammenhinge zwischen den einzelnen Teilgebieten aufzuzeigen. Ich habe also ihnlich wie Dr. Andreas Libavius den Lehrstoff in "miihevoller Arbeit, hauptsichlich aus den allerorten verstreuten Einzelangaben der besten alten und neueren Autoren, femer auch aus etlichen allgemeinen Lehrvorschriften zusammengetragen und anhand theoretischer Uberlegung und grdsstmdglicher praktischer Erfahrung nach sorgfiltiger Methode dargelegt und zu einem einheitlichen Gesamtwerk verarbeitet." *) Der Leser mdge beurteilen, inwieweit dies fiir das vorliegende Lehrbuch gelungen ist. Hans-Georg Elias *) Gmelin Institut fiir anorganische Chemie, Hrsg., Die Alchernie des Andreas Libavius (Ein Lehrbuch der Chemie aus dem Jahre 1597), VCH, Weinheim, 2.Nachdruck der 1.Auflage 1964.
11 Verzeichnis der Abkiirzungen IX Verzeichnis der Abkiirzungen IUPAC, Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, Blackwell Scientific Publ., Oxford 1988 (Green Book) IUPAC, GrOssen. Einheiten und Symbole in der Physikalischen Chemie. VCH. Weinheim 1996 Abkiirzungen fiir Sprachhinweise: D: Deutsch E: Englisch (in amenkanischer Schreibweise) F: Franz6sisch G: Griechisch L: Lateinisch Bei chemischen Formeln wurden folgende Konventionen getroffen: R: Symbol fiir einen monovalenten Liganden, z.b. CH3-, C6H5- (IUPAC) Z: Symbol flir einen divalenten Rest, z.b. -CHy, -p-c6h4- Y: Symbol fflr einen uivalenten Rest X: Symbol fiir einen tetravalenten Rest Weitere Konventionen in diesem Buch: A, B entweder Monomere, die zu Grundbausteinen -a- bzw. -b- fiihren, oder abspaltbare Reste funktioneller Gruppen (2.B. -OH von ZOOH) L = AB Symbol fur ein Abgangsmolekul, z.b. H2O aus -OH + HOOCp-CbH4 in para-stellung (1,4-) substituierter Benzolrest (para-phenylen) (FOrmeln) pph in para-stellung (1.4-) substituierter Benzolrest (para-phenylen) (Text) MATHEMATISCHE SYMBOLE (entsprechend den IUPAC-Ernpfehlungen) gleich > grosser als ungleich 2 gieich oder gr6sser als identisch gleich >> sehr viel gr6sser als ungef2hr gleich < kleiner als proportional (IUPAC: - oder a) I gleich oder kleiner als nilhert sich an << sehr viel kleiner als unendlich f plus oder minus Differenz Differential partielles Differential Summe Integral Produkt sin Sinus cos Cosinus tan Tangens cot Cotangens sinh Sinus hyperbolicus grad Gradient (identisch mit dem Nablaoperator V) dekadischer Logarithmus (Basis lo); IUPAC: lg oder log,, naturlicher Logarithmus (Basis e); IUPAC: In oder log,
12 X Verzeichnis der Abkiirzungen SYMBOLE UM BUCHSTABEN ( ) Mittelwert bei dumlichen GrUssen (IUPAC), z.b. (rz) = Mittel uber die Quadrate der Fadenendenabstade r [ ] Stoffmengenkonzentration ("Molkonzentration") - - HOCHGESTELLTE SYMBOLE UBER EINEM BUCHSTABEN Partielle Grt5sse. z.b. 3, = partielles spezifisches Volumen der Komponenten A Mittelwertsstrich, 2.B. an = ZaNenmittel der Molmasse HOCHGESTELLTE SYMBOLE HINTER EINEM BUCHSTABEN 0 Winkelgrad Winkelminute Winkelsekunde 0 reine Substanz oder Standardzustand 00 unendlich (z.b. Verdiinnung oder Molmasse) m auf die Stoffmenge (in mol usw.) bezogene GrUsse, wenn ein tiefgestelltes m unzweckmgssig wire. Beide Schreibweisen sind nach RJF'AC zulissig. (4 q.ordnung eines Momentes (immer in Klammem, da niemals zur q.potenz) t aktivierte GrUsse, z.b. Et = Aktivierungsenergie a allgemeiner Exponent in P = KpMa (P = Eigenschaft) a Exponent in der Grenzviskositltszahlhlolmasse-Beziehung [ 171 = KvMa V Exponent in der Beziehung (s*)*/* = KsMV 8 Exponent in der Beziehung D = K a 8 5 Exponent in der Beziehung S = KsMC TIEFGESTELLTE SYMBOLE HINTER EINEM BUCHSTABEN 0 Grund- oder Ausgangszustand (z.b. bei ungesturten Dimensionen) 0 Anfangsbedingung (2.B. zur Zeit Null); nicht: Standardzustand 1 Usungsmittel (jedoch S, falls in Solvathiille) 2 GelUstes, meist Polymeres (in Ausnahmef2llen als P) 3 zusgtzliche Komponente, z.b. Salz, Fallungsmittel, usw. 00 Endzustand A a am B B b b bd be bp br Substanz A, z.b. MA = Molmasse der Substanz A Gruppe, Grundbaustein oder Kettenglied, 2.B. als Masse ma von a amorph Substanz B Bruch Gruppe, Grundbaustein oder Kettenglied b in einem Makromolekiil Bindung (speziell Kettenbindung) Bindung (wenn Venvechslungsgefahr mit b fiir Gruppe, usw.) effektive Bindungslinge (= auf die Kettenrichtung projiziene Linge z.b. der Monomereinheit) Siedeprozess (E: boiling point) Verzweigung oder venweigt (E: branch(ed))
13 Verzeichnis der Abkilrzungen XI C C comb cr crit cryst cycl D e eff el end eq F f G g H h I I2 i i ii is lisl i k L I M M M Mt m Kette (L: catena), z.b. Netzwerkkette kritisch (nur bei thermodynamischen Grenztemperaturen, weil dort international gebrguchlich, sonst "crit") Kombination kristallin kritisch Kristallisation ringf6nnig (cyclisch) bezogen auf Diffusion Verhakung, Verschlaufung (E: entanglement) effektiv elastisch Endgruppe Gleichgewicht (L: aequilibrium) Fiillsto ff biegsam (E: flexural) Glaszustand beliebige statistische Wichtung, z. B. n, m, z oder x, w. 2 hydrodynamisch effektive GrUsse oder Hydratation hydrodynamische Wichtung Lichtintensitzt Initiator Laufzahl, z.b. i.komponente isotaktische Diade (IUPAC schllgt das Symbol m = meso vor, vgi. Kap. 4) isotaktische Triade (IUPAC: mm) heterotaktische Triade (IUPAC: mr) Summe der heterotaktischen Triaden is + si Laufzahl Laufzahl Fliissigkeit, Schmelze (L: liquidus) fliissig Schmelzprozess Monomermolekiil Matrix (bei Blends, verstlrkten Polymeren, usw.) Metal1 Monomereinheit in Makromolekiilen
14 XI1 Verzeichnis der Abkurzungen m md mol mon n P P PO1 PS 9 9 R R r red rep molar (evtl. auch als Hochzahl m) Median Molekiil Monomeres (falls M missverstllndlich ist) menmittel Polymeres Polymerisation, insbesondere Wachstum (E: propagation) Polymeres (falls P missverstlndlich ist) Persistenz variable HilfsgrCisse, fiir jedes Unterkapitel verschieden definien elektrische Ladung Reaktant Verhaltung (E: retention) auf den Fadenendenabstand bezogen, z.b. a, = auf den Fadenendenabstand bezogener Ausdehnungskoeffizient eines Knguels reduziert Repetiereinheit solvatisierendes Usungsmittel bezogen auf die Sedimentation syndiotaktische Diade (IUPAC schl2gt das Symbol r = racerno vor) bezogen auf den Tdgheitsradius Segment beliebiger Llnge heterotaktische Triade (IUPAC: rm) syndiotaktische Triade (IUPAC: rr) Startreaktion t tr U U V W X Y Z Abbmchreaktion ("Terminierung") ijbertragungsreaktion ("Transfer") Gmndbaustein, Monomereinheit im Polymeren Umsatz Viskositatsmittel Massenmittel ("Gewichtsmittel") Vemetzung Streckgrenze (E: yield) z-mittel
15 Verzeichnis der Abkiirzungen XI11 PRhIXES VON WORTEN (in systematischen Namen kursiv geschrieben) alt at altemierend ataktisch b blend br C cb co compl Ct eit g ht ipn it net Per r sipn sr st stat tit n block (IUPAC empfiehlt block) Polymerblend (Polymermischung) verzweigt (nicht spezifiziert; E: branched), IUPAC empfiehlt sh-branch = kurzkettenvenweigt (E: short), 1-branch = langkettenverzweigt. f-branch = verzweigt mit einem Verzweigungspunkt der Funktionalitat f. ringfurmig ("cyclisch"). IUPAC empfiehlt cyclo. kammanig. IUPAC empfiehlt comb. gemeinsam (unspezifiziert) Polymer-Pol ymer-komplex cis-taktisch erythrodiisotaktisch Graft- (Pfropf-) heterotaktisch interpenetrierendes Netzwerk isotaktisch Netzwerk (IUPAC); p-net = Mikronetzwerk periodisch statistisch im Sinne einer Bernoulli-Verteilung (E: random) semi-interpenetrierendes Netzwerk stemfurmig. IUPAC empfiehlt star und f-star, wenn die FunktionalitBt des Kerns bekannt ist; f ist dann eine Zahl. syndiotaktisch statistisch (mit unspezifizierter Verteilung) threodiisotaktisch trans-taktisch ANDERE ABKmZUNGEN AIBN NN-Azobisisobutyronitril BPO Dibenzoylperoxid
16 XIV Bu C cell CP Verteichnis der Abkiirzungen Butylgruppe (ibu = Isobutyl, sbu = sekundire Butylgruppe. rbu = tertilre Butylgruppe; die nonnale Butylgruppe wird nach IUPAC nicht durch n gekennzeichnet). Katalysator (C* = aktiver Katalysator oder aktives Kataiysatorzentrum) Celluloserest Cyclopentadienyl(gruppe) DMF DMSO N&-Dimethylformamid Dimethylsulfoxid Et G GPC I IR L LC Me Mt NMR P Ph SEC THF uv Ethyl(gwpe) gauche Gelpermeationschromatographie Initiator Infrarot Usungsmi ttel fliissig-kristallin (E: liquid crystalline) Methyl(gwpe) Metall(atom) Magnetische Kernresonanz (E: nuclear magnetic resonance) Pol ymeres Phenyl(gruppe) Ausschlusschromatographie (E: size exclusion chromatography) Tetrahydro furan Ultraviolett SYMBOLE Symbole folgen im Allgemeinen den Empfehlungen der IUPAC-Kommissionen. A A A At A2 a Absorptionsvermligen (A = lg (I& = lg (l/q); friiher: Extinktion FllIche Helmholtz-Energie (A = U - TS); friiher: Freie Energie Aktionskonstante (in k = A*.exp(- EVRT)) Zweiter Virialkoeffizient; A3 = dritter Virialkoeffizient Thermodynamische AktivitBt
17 Verzeichnis der Abkiirzungen xv a at b C C C C CN CP c, c C CP c D D d E E E e e e F f f G G G Linearer Absorptionskoeffizient (a = (l/l) lg (I&) Verschiebungsfaktor in der WLF-Gleichung Bindungslhge; b,ff = effektive Bindungslbge Zahlenkonzentration (Anzahl Einheiten pro totales Volumen); siehe auch c hrtragungskonstante (immer mit Index, z.b. C, bei einem Regler) Wlrmekapazitlt (meist in JK); C, = molare Wlrmekapazitlt (z.b. in J/(mol K)) Elektrische Kapazitlt Charakteristisches Verhatnis in der Knluelstatistik; C, = charakteristisches Verhitltnis bei unendlich hoher Molmasse Wlrmekapazitlt bei konstantem Druck Ubertragungskonstante bei Polyreaktionen (C, = k,/kp) Spezifische Wlrmekapazitlt (meist in J/(g K)); cp = isobare spezifische Whnekapazitlt; cv = isochore spezifische WPrmekapazitlt. Friiher: spezifische Warme Massekonzentration (= (Masse GelUstes)/(Volumen Usung), "Gewichtskonzentration". IUPAC schllgt fur diese GrUsse den Namen "Massedichte" und das Symbol p vor, was jedoch zu Verwechslungen mit dem gleichen IUPAC-Symbol fir die "echte" Massedichte (= (Masse Substanz)/(Volumen Substanz)) fiihrt. Bei der ublichen "Dichte" beziehen sich Masse und Volumen immer auf die gleiche Materie, bei der Massekonzentration jedoch auf zwei verschiedene Dinge (Masse Gel6stes pro Volumen LUsung). Nur bei reinen Substanzen werden Massekonzentration und Dichte identisch. Nach DIN 1304 kann man fur andere Gr6ssen als die "echte" Dichte auf andere Buchstaben ausweichen. Spezifische Wlrmekapazitlt bei konstantem Druck Lichtgeschwindigkeit im Vakuum oder Schallgeschwindigkeit (ie nach Kapitel) Diffusionskoeffizient; Dmt = Rotationskoeffizient Zugnachgiebigkeit Durchmesser von kompakten Teilchen (Kugeln. Stlbchen, Scheibchen) Energie Elastizitltsmodul (Young-Modul) Elektrische Feldstlrke Elementarladung Parameter in der Q,e-Copolymerisationsgleichung Kohlsionsenergiedichte Kraft Bruchteil (soweit nicht spezifiziert als Stoffmengenanteil ("Molenbruch) x, Massenanteil ("Massenbruch) w, Volumenanteil usw.) Funktionalitlt (falls Vewechslungsgefahr: fo) Gibbs-Energie (G = H - TS); friiher Freie Enthalpie Schermodul. G' = Scherspeichermodul, G NO = Plateau-Modul Anteil des statistischen Gewichtes (Gi = gi/ gi)
18 XVI Verteichnis der Abkiirtungen Elektrischer Leitwert Erdbeschleunigung Statistisches Gewicht (IUPAC empfiehlt k, was jedoch wegen der vielen anderen Bedeutungen von k problematisch ist und femer den Gebrauch von K als Symbol fiir den Anteil des statistischen Gewichtes (statt G) ausschliesst). Parameter fur das VerMtnis der Dimensionen verzweigter Makromolekule zu denen unverzweigter gleicher Masse (= Verzweigungsindex) H H h h h HUhe Enthalpie H6he Planck-Konstante (h = 6, J s) Verzweigungsindex aus hydrodynamischen Messungen Elektrische Stmmstlrke Intensitit Strahlungsintensitlt eines Molekuls Laufzahl (ire Komponente usw.) J J K K K k kb L L 1 M Mr m N NA n n P P Fluss (von Masse, Volumen, Energie usw.) Schernachgiebigkeit Allgemeine Konstante Gleichgewichtskonstante Kompressionsmodul Geschwindigkeitskonstante chemischer Reaktionen Boltzmann-Konstante (kb = R/NA = 1, J K-l) Linge; LK = Lbge eines Kuhn-Segmcntcs; Lkette = echte (historische) Konturlinge (= Zahl der Bindungen ma1 LInge der Valenzbindungen); Lps = Persistenzlinge; Lseg = SegmentlXnge Phlnomenologischer Koeffizient Llnge Molmasse (physikalische Einheit Massc/Stoffmenge, z.b. g/mol) Relative Molmasse = relative Molekulmasse = "Molekulargewicht" (physikfische Einheit 1 = "dimensionslos") Masse Zahl Avogadro-Konstante (NA = 6, mol-*) Stoffmenge einer Substanz (in mol); friiher: Molzahl B rechungsindex Permeationskoeffizient (P = DS) Leistung
19 Verzeichnis der Abkiirrungen XVII P P P P P P Q Q Q e Q 4 4 R R R R R Re r r r r0 S S s S S T Perrin-Faktor Wahrscheinlichkeit (E: probability) Druck Reaktionsausmass (2.B. PA = Umsatz an Gruppen A) Anzahl konformativer Repetiereinheiten pro Helixwindung Dipolmoment Elektrizitlltsmenge Wkne Parameter in der Q,e-Copolymerisationsgleichung -- Polymolekularit%tsindex, 2.B. Q = M,/M,, Wechselweise verwendeter Hilfsparameter fur kompliziertere physikalische Grlissen, die nur in dem betreffenden Unterkapitel vorkommen. Ladung eines Ions Wechselweise verwendeter Hilfsparametcr fur kompliziertere physikalische Grlissen, die nur in dem betreffenden Unterkapitel vorkommen. Allgemeine Gaskonstante (R = 8, J K-' mol-l) ElekUischer Widerstand Dichroitisches Verhdtnis Reaktionsgeschwindigkeit, z.b. R, = Polymerisationsgeschwindigkeit Radius. Die jeweiligen Indices bedeuten: D = aus Diffusionsmessungen (Stokes- Radius); eq = bei llquivalenter Kugel (aus den llusseren Abmessungen); sph = Minimumswert von Kugeln (aus Molmasse und partiellem spezifischen Volumen); H = hydrodynamischer Wert; S = aus Sedimentationsmessungen; v = aus Viskositlltsmessungen (Einstein-Radius) Rayleigh-Verh8Itnis der Streuintensitllten Radius Fadenendenabstand. rcont = konventionelle KonturlBnge (= Abstand der Fadenenden einer Kette in all-trans-konformation) Copolymerisationsparameter Anfangsverhillmis der Stoffmengen an Gruppen bei der Polykondensation Entropie Uslichkeitskoeffizient Sedimentationskoeffizient (in der Literatur als s, was jedoch leicht mit dem gleichen Symbol s fiir den Trllgheitsradius verwechselt werden kann) Trigheitsradius (IUPAC) Selektivitlltskoeffizient (osmotischer Druck) Temperatur, und zwar sowohl in K (physikalische Gleichungen) als auch in "C (beschreibend). IUPAC empfiehlt fur Celsius-Temperaturen entweder t (was mit dem gleichen Symbol fiir die Zeit verwechselt werden kann) oder 0 (was fzilschlicherweise meist mit dem in dcr makromolekularen Wissenschaft f3ir die Theta-Temperatur verwendeten Symbol 8 identifiziert wird). DIN schlllgt fur Celsius-Temperaturen die Symbolc t oder 19 vor.
20 XVIII t t U U U U V V V V W W X X X Xbr Y Y Y Verzeichnis der Abkurzungen Missverstadnisse beim Venvenden von T fur Kelvin- und Celsius-Temperaturen sind bei Angabe der physikalischen Einheiten nicht mtlglich. In physikalischen Gleichungen ist ausschliesslich Tin K zu verwenden. Zeit Rotationswinkel urn die Helixachse Innere Energie Elektrische Spannung Umsatz an Monornermolekulen (p = Umsatz an Gruppen; y = Ausbeute an Substanz) Ausgeschlossenes Volumen Volumen Elektrisches Potential Spezifisches Volumen Geschwindigkeit (lineare Geschwindigkcit v = dljdt) Arbeit (E: work) Massenanteil (Massenbmch, "Gewichtsbruch') Polymerisationsgrad, bezogen auf den Grundbaustein Elektrischer Widerstand Stoffmengenanteil ("Molenbruch"), z.b. XA = Stoffmengenanteil an A Verzweigungsgrad Brechungsindexinkrement (= dnldc) Polymerisationsgrad, bezogen auf die Repetiereinheit Ausbeute an Substanz (E: yield) z-anteil (Zi = z$& zi) z-statistisches Gewicht Koordinationszahl, Anzahl der Nachbam Dissymmetrie (Lichtstreuung) Parameter in der Theorie des ausgeschlossenen Volumens a a a a Winkel, insbesondere Rotationswinkel der optischen Aktivitlt Linearer Aufweitungsfaktor von Substanzen oder Knlueln (m bei Bezug auf Diffusionsmessungen, bei Bezug auf hydrodynamische Abmessungen (allgemein), a, bei Bezug auf den Fadenendenabstand, a, bei Bezug auf den Trlgheitsradius s, a, bei Bezug auf die Viskositit verdunnter LClsungen) Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient (in der Literatur oft als p bezeichnet, dann mit a fur den kubischen thermischen Ausdehnungskoeffizienten) Kristallinitiltsgrad (jeweils mit Index fur die entsprechende Methode, z.b. X bei Rtlntgenmessungen) Elektrische Polarisierbarkeit eines Molekuls "Spezifische" optische Drehung
21 Verzeichnis der Abkurzungen XIX B P P B rh Y Y Y & & & &I c 7 rli qinh??i rhed VSP [Vl e e 19 K K A Winkel Druckkoeffizient Kubischer Ausdehnungskoeffizient (in der Literatur oft als a bezeichnet, dann mit B fiir den linearen Ausdehnungskoeffizienten) Integral des ausgeschlossenen Volurnens Parameter der Vomgssolvatation (Vonugshydratation) Winkel Oberfllchenspannung, Grenzflichenenergie Vernetzungsindex Geschwindigkeitsgefitlle, Schergeschwindigkeit. Geschwindigkeitsgradient Verlustwinkel Ltislichkeitsparameter Chemische Verschiebung Lineare Dehnung [E = (L - Lo)/Lol Energie pro Molekul Erwartung Relative Permittivitlt (friiher: Dielektrizitatskonstante) Verhlltnis RdRs von hydrodynamischen Radien zu Trigheitsradien, z.b. csph bei Kugeln, ccn bei Kngueln Dynarnische Viskosit2t. z.b. qo = Ruhe-Viskositit, ql= Viskositiit des Ltisungsmittels Relatives Viskosititsinkrernent ( spezifische Viskositit ), qi = (q- qi)/qi Inhiirente Viskositit. logarithmische Viskositltszahl. qifi = (In qr)/c Viskositltsverhiiltnis ( relative Viskositat ), qr = q/ql Reduziertc Viskositlt, Viskosititszahl, qred = (q- ql)/(q,c) Spezifische Viskositlt (= (q- qo)/qo (IUPAC schllgt fiir diese Grosse den Namen relatives Viskositztsinkrernent und das Symbol q; vor; das Symbol ist leicht mit dem Symbol qi fiir die Viskositit der Substanz i zu verwechseln.) Grenzviskositltszahl (Staudinger-Index, intrinsic viscosity), lim qc+o = qred; die Grenzviskositltszahl wird in DIN 1342 J, genannt. Charakteristische Ternperatur, insbesondere Theta-Temperatur Winkel, insbesondere Torsionswinkel (rnakrornolekulare Konvention) Winkel, insbesondere Phasenwinkel bzw. Torsionswinkel (organisch-chernische Konvention) Isotherme (kubi sche) Kompressi bi li tii t Enthalpischer Wechselwirkungspararneter in der Theorie der LCisungen Achsenverhiiltnis bei Stlbchen (Litngc/Durchmesser) oder Rotationsellipsoiden (HauptachsePTebenachse)
22 xx Verzeichnis der Abkiirzungen a a a I.1 I.1 I.1 I.1 Wellenltinge (no = Wellenlange des Einfallslichtes) Warmelei t fahigkei t VerstreckungsverhQtnis, 2 = L/Lo Chernisches Potential Moment (Verteilungen) Dipolrnornent Poisson-VerhPltnis Moment (Verteilungen), bezogen auf einen Referenzwen Kinetische Kettenlinge Frequenz Effektive Stoffinengenkonzentration an Netzketten Geschwindigkeit Zustandssumme Rei bungskoeffizient n x P P Osmotischer Druck Mathematische Konstante pi Dichte (= Masse/Volumen der jeweils gleichen Materie), z.b. Masse Substanz A pin Volumen Substanz A oder Masse Ltisung pro Volumen LUsung Elektrischer Volumenwiderstand Mechanische Spannung; 01 1 = Normalspannung, 021 = Scherspannung Standardabweichung Behinderungsparameter (sterischer Faktor) Kooperativitit Elektrische Leitfahigkeit s 7 7.r 7i Kopplungsgrad von Ketten Bindungswinkel (Valenzwinkel) Relaxationszeit Scherspannung (= (~21) Innere Durchllssigkeit (Transmission, Durchlassigkeitsfaktor) = Flory-Parameter "Molare" optische Drehung Volumenanteil (Volumenbruch) Winkel Potential zwischen zwei durch eincn Abstand r getrennten Segmenten X Wechselwirkungsparameter bei der Theorie der Ltisungen (Flory-Huggins-Parameter)
23 Verzeichnis der Abkurzungen XXI Y w Simha-Faktor fiir Ellipsoide Entropischer Wechselwirkungsfaktor in der Theorie der Losungen 51 Winkel R Thermodynamische Wahrscheinlichkeit R Schiefe einer Verteilung 0 Winkelfrequenz. Winkelgeschwindigkeit
24 XXII Inhaltsverzeichnis In ha1 t sve r ze i chn i s Weiterfiihrende Literatur und Quellennachweise befinden sich jeweils am Kapitelende. Motto... V Vorworte... VII Verzeichnis der Abkiirzungen... IX Chemische Strukturen 1. Einfiihrung Einleitung Grundbegriffe Argumente fur und gegen Makromolckule Erfindungen und Entdeckungcn Konstitution Atombau und MolekiilbiIdung Der Molekiilbegriff Chemische und physikalische Molekule Nomenklatur chemischer Strukturen Ubersicht Typen von Poiymemamen Namen anorganischer Makromolekule Namen organischer Makromolckiile... Ko hlensto f fketten... Kohlenstoffringe... Heteroketten... Heterocyclen Atombau und Kettenbildung Ubersicht Homoketten... Unsubstituierte Homoketten... Substituierte Homokctten... Einfluss des Atombaus Heteroketten Klassifizierung von Polymeren Strukturbezogene Begriffe Verfahrensbezogene Bcgriffc Begriffe bei geladenen Polymcren Molekularchitektur Einfuhrung Lineare Ketten und Ringe Statistisch verzweigte Polymcrc Stemmolekule Dendrimere Arborole
25 Inhaltsverzeichnis XXIII Hyperverzweigte Polymere Kamm-Molekule Leiterpolymere Phyllo- und Tectopolymere Ungeordnete Netzwerke Phhomene Aufbau Charakterisierung Charakterisierung von Polymeren Einleitung Chemische Zusammensetzung Monomereinheiten Endgruppen Verzweigungen Molmassenverteilungen Ubersicht... Verteilungsfunktionen... Typen von Verteilungen... Gauss-Verteilung... Logarithmische Normalverteilung... Poisson-Verteilung Schulz-Zimm- und Schulz-Flory-Verteilungen... Generalisierte Exponentialverteilungen... Bestimmung von Molmassenverteilungen... Massenspektroskopie... Gr6ssenausscNusschromatographie... Fraktionierung... Mittelwerte Mol- und Molekulmassen Einfache Mittelwerte der Molmassen Molekulare Uneinheitlichkeiten Komplexere Mittel der Molmassen... Exponentenmittel... Zusammengesetzte Mittel Polymerisationsgrade Mittelwerte anderer Eigenschaften Bestimmung von Molmassen... Viskosimetrie Grundbegriffe Experimentelle Methoden Konzentrationsabh3ngigkeit bei Nichtelektrolyren Konzentrationsabhhgigkeit bei Polyelektrolyten Grenzviskositltszahlen und Molmassen... Mittelwerte... Einfluss der Teilchenform
26 XXIV In haltsverzeic hnis Historische Notizen: Viskositlt verdiinnter LBsungen Konfiguration Stereoisomere Geschichtliche Entwicklung Konfigurations- und Konformationsisomere Symmetrie Enantiomere und Diastereomere Stereoformeln D. L- und R. S-Systeme Ideal-taktische Polymere Definitionen Relative und absolute Konfigurationen Darstellung relativer Konfigurationen Hemitaktische Polymere Ditaktische Polymere Geometrische Isomere Real-taktische Polymere Ubersicht J-Aden Experimentelle Methoden... Rdntgenographie... Kemresonanzspektroskopie... Infrarotspektroskopie... Kristallinitzt und Losungseigenschaften... Historische Notizen: Prochiralitlt Konformation Grundlagen Mikrokonformationen Definitionen Rotationsbarrieren Konstitutions-Einfliisse Makrokonformationen Kristallinc Polymere... Gleichgewichtszus irnde... NichtgleichgewichtszustBnde Polymerldsungen Schmelzen... Historische Notizen Synthesen 6. Polyreaktionen Ubersicht Voraussetzungen
27 Inhaltsverzeichnis xxv Geschichtliche Entwicklung Klassifikationen Funktionalitlt Cyclopolymerisation Mechanismus und Kinetik von Polyreaktionen Aktivierung von Monomeren Elementarschritte bei Polymerisationen Unterscheidung von Mechanismen Charakterisierung von Polyreaktionen Aktivierungsgrtissen Statistik yon Polyreaktionen Grundbegriffe Bemoulli- und Markow-Mechanismen Enantiomorphe Katalysatoren Geschwindigkeitskonstmten Aktivierungsgrtissen Polymerisation chiraler Monomerer Definitionen Chirale Monomere EnantioasymmeUische Polymerisationen Andere stereoselektive Polymerisationen Enantiogene Polymerisationen Experimentelle Verfolgung von Polyreaktionen Nachweis und quantitative Bestimmung der Polymerbildung Isolieren und Reinigen der Polymeren Historische Notizen: Taktizitlten Gleichgewichte bei Polyreaktionen Ubersicht PoIymer-Monomer-Gleichgewichte Typen Polymerisationsgrade Polymerisationsgrad-Verteilungen Unvollsthdige Gleichgewichte Grenztemperaturen Grundlagen Ceiling- und Floortemperaturen Druckeinflusse Thermodynamische Nichtidealitilt Konstitutionseinflusse Polymerisationsentropien Polymerisationsenthalpien Grenztemperaturen Ring-Kette-Gleichgewichte Thermodynamik Kinetik
28 XXVI tnhaltsverzeic hnis A.7. Anhang: Polymerisationsgrade Ionische Polymerisationen ijbersicht Grundlagen Ionengleichgewichte Lebende Polymerisationen Unsterbliche und lebende Polymere Polymerisationsgrade Kinetik Pseudolebende Polymerisationen... Ubertragung zum Monomeren... Kettenabbruch... Langsamer Kettenstart Anionische Polymerisationen Monomere... Initiatoren... Basenstirke... Metallalkyle... Alkoholate... Alkalimetalle... Ionenpaar-Gleichgewichte... Ionen- Assoziate... Wachstum... Vinyl- und Dien-Polymerisationen... Polymerisation von Lactamen... Polymerisation von Leuchs-Anhydriden der a-aminosiuren... Stereokontrolle... Abbruchreaktionen... Kettenubertragungen Kationische Polymerisationen Ubersicht Initiatoren Initiation durch Salze Initiation durch Bransted- und Lewis-Siuren Wachstum Phantom-Polymerisationen Abbruch und Ubertragung Ubersicht Fragmentierungen Lebende kationische Polymerisationen Zwitterionen-Polymerisationen A-8 Anhang: Ableitung der Poisson-Vertcilung Historische Notizen
29 fnhaltsveneichnis XXVII 9. Polyinsertionen ijbersicht Einfuhrung Geschichtliche Entwicklung Polymerisationen mit Mehrzentren-Katalysatoren Ziegler-Katalysatoren Monomere Verfahren KatalysatorsUuktur Aktiveantren Mechanismen Stereokontrolle bei 1-Olefinen Stereokontrok Annaherung der Monomeren Geometrie der Einlagerung Verkniipfung Kontrolle der Molmassen Technische Katalysatorsysteme fir Ethen und Propen Andere Polymerisationen Kinetik bei Reaktionen ohne Abbruch und Ubertragung Kinetik bei Reaktionen mit Abbruch und Ubenragung Polymerisationen mit Einzentren-Kalalysatoren Aluminoxane Metallocen-Katalysatoren Polymerisierbarkeit Stereo- und Regiokontrolle Metathesen EinfUhrung Metathesen acyclischer Olefine Katalysatoren Polymerisation von Cycloolefinen Produkte Mechanismen Polymerisierbarkeit Acyclische Dien-Synthese Gruppeniibertragungs-Polymerisationen Historische Notizen: Ubergangsmetall-Katalysatoren Historische Notizen: Mechanismen Radikalische Polymerisationen Einfilhrung Ubersicht Polymerisierbare Monomere Radikalische Polymerisation von Ringen Radikalische Polymerisation von Doppelbindungen Initiation und Start
30 XXVIII In haltsverzeichnis Thermische und spontane Polymerisationen Thermische Initiatoren Initiatorzerfall und Radikalausbeute Zerfallsgeschwindigkeit Startreaktionen Redox-Initiatoren Photo-Initiatoren Elektrolytische Polymerisationen Wachstum und Abbmch Polymerisierbarkeit. Regio- und Stereokontrolle Abbruchreaktionen StationXrer Zustand Ideale Kinetik im stationiren Zustand Kinetische Kettenlinge Bestimmung von Geschwindigkeitskonstanten Geschwindigkeitskonstanten Dead End-Polymerisation Gel- und Glaseffekt Nichtideale Kinetik Geschwindigkeit = f(monomerkonzentration) Geschwindigkeit = flhitiatorkonzentration) Polymerisationsgrad = AUmsatz) Vemelzende Polymerisationen Kettenubertragungen Ubersicht Mayo-Gleichung Ubertragung zu Monomeren Ubertragung zu Polymeren Ubertragung zu Initiatoren Ubertragung zu L6sungsmitteln und Reglern Inhibitoren und VerzBgercr Kontrollierte radikalische Polymerisationen Technische Polymerisationen Ubersicht Polymerisation in Substanz PoIymerisation in LCisung und untcr Failung Polymerisation in der Gasphase Polymerisation in Suspension Polymerisation in Emulsion A- 10 Anhang: Schulz-Flory-Verteilung Historische Notizen: Polymerisationsmechanismus Polymerisation durch Strahlung und in geordneten Zustanden ijbersicht Photochemische Polymerisationen Angeregte Zustlnde
Makromoleküle WILEY-VCH. Band 1: Chemische Struktur und Synthesen. Hans-Georg Elias. Sechste, vollständig überarbeitete Auflage
 Hans-Georg Elias Makromoleküle Band 1: Chemische Struktur und Synthesen Sechste, vollständig überarbeitete Auflage WILEY-VCH Weinheim New York Chichester Brisbane Singapore Toronto XXII Inhaltsverzeichnis
Hans-Georg Elias Makromoleküle Band 1: Chemische Struktur und Synthesen Sechste, vollständig überarbeitete Auflage WILEY-VCH Weinheim New York Chichester Brisbane Singapore Toronto XXII Inhaltsverzeichnis
Bernd Tieke. Makromolekulare Chemie. Eine Einführung. Dritte Auflage. 0 0 l-u: U. WlLEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
 Bernd Tieke Makromolekulare Chemie Eine Einführung Dritte Auflage 0 0 l-u: U WlLEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA Inhaltsverzeichnis Vorwort zur ersten Auflage Vorwort zur zweiten Auflage Vorwort zur dritten
Bernd Tieke Makromolekulare Chemie Eine Einführung Dritte Auflage 0 0 l-u: U WlLEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA Inhaltsverzeichnis Vorwort zur ersten Auflage Vorwort zur zweiten Auflage Vorwort zur dritten
Der statistische Charakter der Polymereigenschaften
 Der statistische Charakter der Polymereigenschaften Molmassenverteilungen Molmassenverteilungen Molmasse bei Polymeren Zahlenmittlere Molmasse MMD (Polydispersität) wird mit M w / M n beschrieben Für monodisperse
Der statistische Charakter der Polymereigenschaften Molmassenverteilungen Molmassenverteilungen Molmasse bei Polymeren Zahlenmittlere Molmasse MMD (Polydispersität) wird mit M w / M n beschrieben Für monodisperse
Inhalt der Vorlesung. 1. Eigenschaften der Gase. 0. Einführung
 Inhalt der Vorlesung 0. Einführung 0.1 Themen der Physikal. Chemie 0.2 Grundbegriffe/ Zentrale Größe: Energie 0.3 Molekulare Deutung der inneren Energie U Molekülstruktur, Energieniveaus und elektromagn.
Inhalt der Vorlesung 0. Einführung 0.1 Themen der Physikal. Chemie 0.2 Grundbegriffe/ Zentrale Größe: Energie 0.3 Molekulare Deutung der inneren Energie U Molekülstruktur, Energieniveaus und elektromagn.
Lehrbuch Chemische Technologie
 C. Herbert Vogel Lehrbuch Chemische Technologie Grundlagen Verfahrenstechnischer Anlagen WILEY- VCH WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA IX Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 1 1.1 Das Ziel industrieller Forschung
C. Herbert Vogel Lehrbuch Chemische Technologie Grundlagen Verfahrenstechnischer Anlagen WILEY- VCH WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA IX Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 1 1.1 Das Ziel industrieller Forschung
Basiswissen Physikalische Chemie
 Claus Czeslik Heiko Seemann Roland.Winter Basiswissen Physikalische Chemie 4., aktualisierte Auflage STUDIUM VIEWEG+ TEUBNER Inhaltsverzeichnis Vorwort Liste der wichtigsten Symbole V XI 1 Aggregatzustände.
Claus Czeslik Heiko Seemann Roland.Winter Basiswissen Physikalische Chemie 4., aktualisierte Auflage STUDIUM VIEWEG+ TEUBNER Inhaltsverzeichnis Vorwort Liste der wichtigsten Symbole V XI 1 Aggregatzustände.
Physikalische Chemie Physikalische Chemie I SoSe 2009 Prof. Dr. Norbert Hampp 1/9 1. Das Ideale Gas. Thermodynamik
 Prof. Dr. Norbert Hampp 1/9 1. Das Ideale Gas Thermodynamik Teilgebiet der klassischen Physik. Wir betrachten statistisch viele Teilchen. Informationen über einzelne Teilchen werden nicht gewonnen bzw.
Prof. Dr. Norbert Hampp 1/9 1. Das Ideale Gas Thermodynamik Teilgebiet der klassischen Physik. Wir betrachten statistisch viele Teilchen. Informationen über einzelne Teilchen werden nicht gewonnen bzw.
Einführung in die Physikalische Chemie Teil 1: Mikrostruktur der Materie
 Einführung in die Physikalische Chemie Teil 1: Mikrostruktur der Materie Kapitel 1: Quantenmechanik Kapitel 2: Atome Kapitel 3: Moleküle Mathematische Grundlagen Schrödingergleichung Einfache Beispiele
Einführung in die Physikalische Chemie Teil 1: Mikrostruktur der Materie Kapitel 1: Quantenmechanik Kapitel 2: Atome Kapitel 3: Moleküle Mathematische Grundlagen Schrödingergleichung Einfache Beispiele
Nomenklatur der Anorganischen Chemie
 International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) Nomenklatur der Anorganischen Chemie Deutsche Ausgabe der Empfehlungen 1990 herausgegeben im Auftrag der Gesellschaft Deutscher Chemiker in Zusammenarbeit
International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) Nomenklatur der Anorganischen Chemie Deutsche Ausgabe der Empfehlungen 1990 herausgegeben im Auftrag der Gesellschaft Deutscher Chemiker in Zusammenarbeit
Formelzeichen Bedeutung Wert / SI-Einheit
 CHEMISCHE THERMODYNAMI SYMBOLE UND ONSTANTEN PROF. DR. WOLFGANG CHRISTEN Formelzeichen Bedeutung Wert / SI-Einheit AA Fläche m 2 AA Freie Energie, Helmholtz-Energie Nm = aa Beschleunigung m aa ii CC pp
CHEMISCHE THERMODYNAMI SYMBOLE UND ONSTANTEN PROF. DR. WOLFGANG CHRISTEN Formelzeichen Bedeutung Wert / SI-Einheit AA Fläche m 2 AA Freie Energie, Helmholtz-Energie Nm = aa Beschleunigung m aa ii CC pp
2 Grundbegriffe der Thermodynamik
 2 Grundbegriffe der Thermodynamik 2.1 Thermodynamische Systeme (TDS) Aufteilung zwischen System und Umgebung (= Rest der Welt) führt zu einer Klassifikation der Systeme nach Art der Aufteilung: Dazu: adiabatisch
2 Grundbegriffe der Thermodynamik 2.1 Thermodynamische Systeme (TDS) Aufteilung zwischen System und Umgebung (= Rest der Welt) führt zu einer Klassifikation der Systeme nach Art der Aufteilung: Dazu: adiabatisch
Organon der Heilkunst
 Organon der Heilkunst Von Samuel Hahnemann Aude sapere Standardausgabe der sechsten Auflage Auf der Grundlage der 1992 vom Herausgeber bearbeiteten textkritischen Ausgabe des Manuskriptes Hahnemanns (1842)
Organon der Heilkunst Von Samuel Hahnemann Aude sapere Standardausgabe der sechsten Auflage Auf der Grundlage der 1992 vom Herausgeber bearbeiteten textkritischen Ausgabe des Manuskriptes Hahnemanns (1842)
Bernhard Härder. Einführung in die PHYSIKALISCHE CHEMIE ein Lehrbuch Chemische Thermodynamik W/ WESTAR.P WISSENSCHAFTEN. Skripte, Lehrbücher Band 2
 Bernhard Härder Einführung in die PHYSIKALISCHE CHEMIE ein Lehrbuch Chemische Thermodynamik Skripte, Lehrbücher Band 2 W/ WESTAR.P WISSENSCHAFTEN Inhaltsverzeichnis Vorwort zur ersten Auflage Vorwort zur
Bernhard Härder Einführung in die PHYSIKALISCHE CHEMIE ein Lehrbuch Chemische Thermodynamik Skripte, Lehrbücher Band 2 W/ WESTAR.P WISSENSCHAFTEN Inhaltsverzeichnis Vorwort zur ersten Auflage Vorwort zur
RT N j Mit den Potentialen unter Standardbedingungen können wir die Energien der beiden Zustände identifizieren: = e Ei
 im Gleichgewicht wechseln genauso viele Teilchen aus dem einen Zustand in den zweiten wie umgekehrt, die chemischen Potentiale µ i sind also gleich) N i = e µ i µ N Mit den Potentialen unter Standardbedingungen
im Gleichgewicht wechseln genauso viele Teilchen aus dem einen Zustand in den zweiten wie umgekehrt, die chemischen Potentiale µ i sind also gleich) N i = e µ i µ N Mit den Potentialen unter Standardbedingungen
2. Fluide Phasen. 2.1 Die thermischen Zustandsgrößen Masse m [m] = kg
![2. Fluide Phasen. 2.1 Die thermischen Zustandsgrößen Masse m [m] = kg 2. Fluide Phasen. 2.1 Die thermischen Zustandsgrößen Masse m [m] = kg](/thumbs/75/72774995.jpg) 2. Fluide Phasen 2.1 Die thermischen Zustandsgrößen 2.1.1 Masse m [m] = kg bestimmbar aus: Newtonscher Bewegungsgleichung (träge Masse): Kraft = träge Masse x Beschleunigung oder (schwere Masse) Gewichtskraft
2. Fluide Phasen 2.1 Die thermischen Zustandsgrößen 2.1.1 Masse m [m] = kg bestimmbar aus: Newtonscher Bewegungsgleichung (träge Masse): Kraft = träge Masse x Beschleunigung oder (schwere Masse) Gewichtskraft
Zustandsbeschreibungen
 Aggregatzustände fest Kristall, geordnet Modifikationen Fernordnung flüssig teilgeordnet Fluktuationen Nahordnung gasförmig regellose Bewegung Unabhängigkeit ngigkeit (ideales Gas) Zustandsbeschreibung
Aggregatzustände fest Kristall, geordnet Modifikationen Fernordnung flüssig teilgeordnet Fluktuationen Nahordnung gasförmig regellose Bewegung Unabhängigkeit ngigkeit (ideales Gas) Zustandsbeschreibung
Skript zur Vorlesung
 Skript zur Vorlesung 1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Physikalische Grundeinheiten : Die Internationalen Basiseinheiten SI (frz. Système international d unités) 1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Ein Maß für
Skript zur Vorlesung 1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Physikalische Grundeinheiten : Die Internationalen Basiseinheiten SI (frz. Système international d unités) 1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Ein Maß für
Anhang A Verzeichnis der Abkürzungen
 260 ANHANG A VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN Anhang A Verzeichnis der Abkürzungen A a a Copo A i AIBN B BA β KWW c c I 0,S c i,a c R,I c R 0 c R C tr,x c X D D 12 DMA DMPA E E * ESR ε e i e f E λ E p f f F
260 ANHANG A VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN Anhang A Verzeichnis der Abkürzungen A a a Copo A i AIBN B BA β KWW c c I 0,S c i,a c R,I c R 0 c R C tr,x c X D D 12 DMA DMPA E E * ESR ε e i e f E λ E p f f F
H.-G. Zimmer Geometrische Optik
 H.-G. Zimmer Geometrische Optik H.-G. Zimmer Geometrische Optik Mit 46 Abbildungen Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 1967 Dr. Hans-Georg Zimmer 70820berkochen Lenzhalde 23 ISBN 978-3-642-86835-1
H.-G. Zimmer Geometrische Optik H.-G. Zimmer Geometrische Optik Mit 46 Abbildungen Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 1967 Dr. Hans-Georg Zimmer 70820berkochen Lenzhalde 23 ISBN 978-3-642-86835-1
Inhalt 1 Grundlagen der Thermodynamik
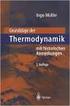 Inhalt 1 Grundlagen der Thermodynamik..................... 1 1.1 Grundbegriffe.............................. 2 1.1.1 Das System........................... 2 1.1.2 Zustandsgrößen........................
Inhalt 1 Grundlagen der Thermodynamik..................... 1 1.1 Grundbegriffe.............................. 2 1.1.1 Das System........................... 2 1.1.2 Zustandsgrößen........................
Modul BCh 1.2 Praktikum Anorganische und Analytische Chemie I
 Institut für Anorganische Chemie Prof. Dr. R. Streubel Modul BCh 1.2 Praktikum Anorganische und Analytische Chemie I Vorlesung für die Studiengänge Bachelor Chemie und Lebensmittelchemie Im WS 08/09 Die
Institut für Anorganische Chemie Prof. Dr. R. Streubel Modul BCh 1.2 Praktikum Anorganische und Analytische Chemie I Vorlesung für die Studiengänge Bachelor Chemie und Lebensmittelchemie Im WS 08/09 Die
4 Thermodynamik mikroskopisch: kinetische Gastheorie makroskopisch: System:
 Theorie der Wärme kann auf zwei verschiedene Arten behandelt werden. mikroskopisch: Bewegung von Gasatomen oder -molekülen. Vielzahl von Teilchen ( 10 23 ) im Allgemeinen nicht vollständig beschreibbar
Theorie der Wärme kann auf zwei verschiedene Arten behandelt werden. mikroskopisch: Bewegung von Gasatomen oder -molekülen. Vielzahl von Teilchen ( 10 23 ) im Allgemeinen nicht vollständig beschreibbar
Physikalisch-chemische Grundlagen der thermischen Verfahrenstechnik
 Lüdecke Lüdecke Thermodynamik Physikalisch-chemische Grundlagen der thermischen Verfahrenstechnik Grundlagen der Thermodynamik Grundbegriffe Nullter und erster Hauptsatz der Thermodynamik Das ideale Gas
Lüdecke Lüdecke Thermodynamik Physikalisch-chemische Grundlagen der thermischen Verfahrenstechnik Grundlagen der Thermodynamik Grundbegriffe Nullter und erster Hauptsatz der Thermodynamik Das ideale Gas
Thermodynamik und Statistische Mechanik
 Theoretische Physik Band 9 Walter Greiner Ludwig Neise Horst Stöcker Thermodynamik und Statistische Mechanik Ein Lehr- und Übungsbuch Mit zahlreichen Abbildungen, Beispielen und Aufgaben mit ausführlichen
Theoretische Physik Band 9 Walter Greiner Ludwig Neise Horst Stöcker Thermodynamik und Statistische Mechanik Ein Lehr- und Übungsbuch Mit zahlreichen Abbildungen, Beispielen und Aufgaben mit ausführlichen
Mathematische und statistische Hilfsmittel für Pharmazeuten
 Mathematische und statistische Hilfsmittel für Pharmazeuten Dr. Helga Lohöfer Fachbereich Mathematik und Informatik der Philipps-Universität Marburg Fassung vom September 2003 Inhaltsverzeichnis I Elementare
Mathematische und statistische Hilfsmittel für Pharmazeuten Dr. Helga Lohöfer Fachbereich Mathematik und Informatik der Philipps-Universität Marburg Fassung vom September 2003 Inhaltsverzeichnis I Elementare
Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen Chemie. Atome
 Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen Chemie Atome Elemente Chemische Reaktionen Energie Verbindungen 361 4. Chemische Reaktionen 4.1. Allgemeine Grundlagen (Wiederholung) 4.2. Energieumsätze chemischer
Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen Chemie Atome Elemente Chemische Reaktionen Energie Verbindungen 361 4. Chemische Reaktionen 4.1. Allgemeine Grundlagen (Wiederholung) 4.2. Energieumsätze chemischer
Hauptsätze der Thermodynamik
 Platzhalter für Bild, Bild auf Titelfolie hinter das Logo einsetzen Hauptsätze der Thermodynamik Dominik Pfennig, 31.10.2012 Inhalt 0. Hauptsatz Innere Energie 1. Hauptsatz Enthalpie Satz von Hess 2. Hauptsatz
Platzhalter für Bild, Bild auf Titelfolie hinter das Logo einsetzen Hauptsätze der Thermodynamik Dominik Pfennig, 31.10.2012 Inhalt 0. Hauptsatz Innere Energie 1. Hauptsatz Enthalpie Satz von Hess 2. Hauptsatz
Makromolekulare Chemie
 Bernd Tieke Makromolekulare Chemie Eine Einführung 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage WILEY- VCH WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA Inhaltsverzeichnis Verzeichnis häufig verwendeter Formelzeichen
Bernd Tieke Makromolekulare Chemie Eine Einführung 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage WILEY- VCH WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA Inhaltsverzeichnis Verzeichnis häufig verwendeter Formelzeichen
Physikalische Chemie 0 Klausur, 22. Oktober 2011
 Physikalische Chemie 0 Klausur, 22. Oktober 2011 Bitte beantworten Sie die Fragen direkt auf dem Blatt. Auf jedem Blatt bitte Name, Matrikelnummer und Platznummer angeben. Zu jeder der 25 Fragen werden
Physikalische Chemie 0 Klausur, 22. Oktober 2011 Bitte beantworten Sie die Fragen direkt auf dem Blatt. Auf jedem Blatt bitte Name, Matrikelnummer und Platznummer angeben. Zu jeder der 25 Fragen werden
ELEMENTAR-MATHEMATIK
 WILLERS ELEMENTAR-MATHEMATIK Ein Vorkurs zur Höheren Mathematik 13., durchgesehene Auflage von Dr.-Ing. G. Opitz und Dr. phil. H. Wilson Mit 189 Abbildungen VERLAG THEODOR STEINKOPFF DRESDEN 1968 Inhaltsverzeichnis
WILLERS ELEMENTAR-MATHEMATIK Ein Vorkurs zur Höheren Mathematik 13., durchgesehene Auflage von Dr.-Ing. G. Opitz und Dr. phil. H. Wilson Mit 189 Abbildungen VERLAG THEODOR STEINKOPFF DRESDEN 1968 Inhaltsverzeichnis
Kinetik zusammengesetzter Reaktionen
 Kinetik zusammengesetzter Reaktionen Kap. 23 1 PC 2 SS 2016 Kinetik zusammengesetzter Reaktionen Kettenreaktionen Explosionen Polymerisationen Schrittweise Polymerisation Kettenpolymerisation Homogene
Kinetik zusammengesetzter Reaktionen Kap. 23 1 PC 2 SS 2016 Kinetik zusammengesetzter Reaktionen Kettenreaktionen Explosionen Polymerisationen Schrittweise Polymerisation Kettenpolymerisation Homogene
Physikalische Chemie 1
 Physikalische Chemie 1 Christian Lehmann 31. Januar 2004 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 2 1.1 Teilgebiete der Physikalischen Chemie............... 2 1.1.1 Thermodynamik (Wärmelehre)............... 2 1.1.2
Physikalische Chemie 1 Christian Lehmann 31. Januar 2004 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 2 1.1 Teilgebiete der Physikalischen Chemie............... 2 1.1.1 Thermodynamik (Wärmelehre)............... 2 1.1.2
Onsagersche Gleichung. Energetische Beziehungen
 Onsagersche Gleichung. Energetische Beziehungen R I 4 V t t 1 r 8... D A p l J LX c x Zustandsgrössen sind Grössen, die zur Beschreibung des Zustandes eines stofflichen Systems dienen, T, V, p, m,... T,
Onsagersche Gleichung. Energetische Beziehungen R I 4 V t t 1 r 8... D A p l J LX c x Zustandsgrössen sind Grössen, die zur Beschreibung des Zustandes eines stofflichen Systems dienen, T, V, p, m,... T,
Ralph S. Becker -.Wayne E. Wentworth. Allgemeine Chemie
 Ralph S. Becker -.Wayne E. Wentworth Allgemeine Chemie Band III: Übergangsmetalle, Kern-, Bio-, Photochemie Übersetzt und bearbeitet von Wolfgang Parr 57 meist zweifarbige Abbildungen, 35 Tabellen Bibliothek
Ralph S. Becker -.Wayne E. Wentworth Allgemeine Chemie Band III: Übergangsmetalle, Kern-, Bio-, Photochemie Übersetzt und bearbeitet von Wolfgang Parr 57 meist zweifarbige Abbildungen, 35 Tabellen Bibliothek
2 Strukturelle Eigenschaften von Makromolekülen und Polymeren
 2 Strukturelle Eigenschaften von Makromolekülen und Polymeren 2.2 Struktur und Charakterisierung eines Makromoleküls 2.3 Ordnungszustand und strukturelle Charakterisierung von Polymeren 2.4 Quellenangaben
2 Strukturelle Eigenschaften von Makromolekülen und Polymeren 2.2 Struktur und Charakterisierung eines Makromoleküls 2.3 Ordnungszustand und strukturelle Charakterisierung von Polymeren 2.4 Quellenangaben
Vortrage Reden Erinnerungen
 Vortrage Reden Erinnerungen Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH MaxPlanck Vorträge Reden Erinnerungen Herausgegeben von Hans Roos und Armin Hermann.~. T Springer Dr. Dr. Hans Roos Professor Dr. Max
Vortrage Reden Erinnerungen Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH MaxPlanck Vorträge Reden Erinnerungen Herausgegeben von Hans Roos und Armin Hermann.~. T Springer Dr. Dr. Hans Roos Professor Dr. Max
Thermodynamik I. Sommersemester 2012 Kapitel 2, Teil 1. Prof. Dr. Ing. Heinz Pitsch
 Thermodynamik I Sommersemester 2012 Kapitel 2, Teil 1 Prof. Dr. Ing. Heinz Pitsch Kapitel 2, Teil 1: Übersicht 2 Zustandsgrößen 2.1 Thermische Zustandsgrößen 2.1.1 Masse und Molzahl 2.1.2 Spezifisches
Thermodynamik I Sommersemester 2012 Kapitel 2, Teil 1 Prof. Dr. Ing. Heinz Pitsch Kapitel 2, Teil 1: Übersicht 2 Zustandsgrößen 2.1 Thermische Zustandsgrößen 2.1.1 Masse und Molzahl 2.1.2 Spezifisches
Thermodynamik un Statistische Mechanik
 Theoretische Physik Band 9 Walter Greiner Ludwig Neise Horst Stöcker Thermodynamik un Statistische Mechanik Ein Lehr- und Übungsbuch Mit zahlreichen Abbildungen, Beispiele n und Aufgaben mit ausführlichen
Theoretische Physik Band 9 Walter Greiner Ludwig Neise Horst Stöcker Thermodynamik un Statistische Mechanik Ein Lehr- und Übungsbuch Mit zahlreichen Abbildungen, Beispiele n und Aufgaben mit ausführlichen
Otto Forster Thomas Szymczak. Übungsbuch zur Analysis 2
 Otto Forster Thomas Szymczak Übungsbuch zur Analysis 2 Otto Forster Thomas Szymczak Übungsbuch zur Analysis 2 Aufgaben und Lösungen 6., aktualisierte Auflage STUDIUM Bibliografische Information der Deutschen
Otto Forster Thomas Szymczak Übungsbuch zur Analysis 2 Otto Forster Thomas Szymczak Übungsbuch zur Analysis 2 Aufgaben und Lösungen 6., aktualisierte Auflage STUDIUM Bibliografische Information der Deutschen
Lehrbuch der Thermodynamik
 Ulrich Nickel Lehrbuch der Thermodynamik Eine verständliche Einführung Ж HANSER Carl Hanser Verlag München Wien VII Inhaltsverzeichnis 1 GRUNDBEGRIFFE DER THERMODYNAMIK 1 Einführung 1 Systeme 3 offene
Ulrich Nickel Lehrbuch der Thermodynamik Eine verständliche Einführung Ж HANSER Carl Hanser Verlag München Wien VII Inhaltsverzeichnis 1 GRUNDBEGRIFFE DER THERMODYNAMIK 1 Einführung 1 Systeme 3 offene
Die innere Energie and die Entropie
 Die innere Energie and die Entropie Aber fangen wir mit der Entropie an... Stellen Sie sich ein System vor, das durch die Entropie S, das Volumen V und die Stoffmenge n beschrieben wird. U ' U(S,V,n) Wir
Die innere Energie and die Entropie Aber fangen wir mit der Entropie an... Stellen Sie sich ein System vor, das durch die Entropie S, das Volumen V und die Stoffmenge n beschrieben wird. U ' U(S,V,n) Wir
Makromoleküle sind keine Erfindung des Menschen. Die Natur produziert jährlich mehr als Tonnen Polysaccharide und Lignin.
 Vorlesung 22 Polymere Allgemein istoriker teilen die Menschheitsgeschichte nach den vorwiegend verwendeten Werkstoffen ein: Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit 1980 hat der Wert der Weltkunststoff-Produktion
Vorlesung 22 Polymere Allgemein istoriker teilen die Menschheitsgeschichte nach den vorwiegend verwendeten Werkstoffen ein: Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit 1980 hat der Wert der Weltkunststoff-Produktion
Vorlesung Allgemeine Chemie Teil Physikalische Chemie WS 2009/10
 Vorlesung Allgemeine Chemie Teil Physikalische Chemie WS 2009/10 Dr. Lars Birlenbach Physikalische Chemie, Universität Siegen Raum AR-F0102 Tel.: 0271 740 2817 email: birlenbach@chemie.uni-siegen.de Lars
Vorlesung Allgemeine Chemie Teil Physikalische Chemie WS 2009/10 Dr. Lars Birlenbach Physikalische Chemie, Universität Siegen Raum AR-F0102 Tel.: 0271 740 2817 email: birlenbach@chemie.uni-siegen.de Lars
Einführung in die Chromatographie
 Einführung in die Chromatographie Vorlesung WS 2007/2008 VAK 02-03-5-AnC2-1 Johannes Ranke Einführung in die Chromatographie p.1/32 Programm 23. 10. 2007 Trennmethoden im Überblick und Geschichte der Chromatographie
Einführung in die Chromatographie Vorlesung WS 2007/2008 VAK 02-03-5-AnC2-1 Johannes Ranke Einführung in die Chromatographie p.1/32 Programm 23. 10. 2007 Trennmethoden im Überblick und Geschichte der Chromatographie
Praxis der Hochleistungs- Flüssigchromatographie
 Veronika R. Meyer Praxis der Hochleistungs- Flüssigchromatographie 9. Auflage Veronika R. Meyer Praxis der Hochleistungs- Flüssigchromatographie Veronika R. Meyer Praxis der Hochleistungs- Flüssigchromatographie
Veronika R. Meyer Praxis der Hochleistungs- Flüssigchromatographie 9. Auflage Veronika R. Meyer Praxis der Hochleistungs- Flüssigchromatographie Veronika R. Meyer Praxis der Hochleistungs- Flüssigchromatographie
Adolf Riede. Mathematik für Biologen. Eine Grundvorlesung. Mit 120 Abbildungen und zahlreichen durchgerechneten Beispielen.
 9vieweg Adolf Riede Mathematik für Biologen Eine Grundvorlesung Mit 120 Abbildungen und zahlreichen durchgerechneten Beispielen IX I Zahlen 1 1.1 Anzahlen 1 1.2 Reelle Zahlen 8 1.3 Dokumentation von Meßwerten
9vieweg Adolf Riede Mathematik für Biologen Eine Grundvorlesung Mit 120 Abbildungen und zahlreichen durchgerechneten Beispielen IX I Zahlen 1 1.1 Anzahlen 1 1.2 Reelle Zahlen 8 1.3 Dokumentation von Meßwerten
1. Wärme und der 1. Hauptsatz der Thermodynamik 1.1. Grundlagen
 IV. Wärmelehre 1. Wärme und der 1. Hauptsatz der Thermodynamik 1.1. Grundlagen Historisch: Wärme als Stoff, der übertragen und in beliebiger Menge erzeugt werden kann. Übertragung: Wärmezufuhr Joulesche
IV. Wärmelehre 1. Wärme und der 1. Hauptsatz der Thermodynamik 1.1. Grundlagen Historisch: Wärme als Stoff, der übertragen und in beliebiger Menge erzeugt werden kann. Übertragung: Wärmezufuhr Joulesche
2 Aufbau der Polymeren
 2 Aufbau der Polymeren Polymer, Kunststoff, makromolekularer Stoff, was ist das jeweils? Um uns richtig über das Thema verständigen zu können, müssen wir zunächst einige Begriffe besprechen: Grundbegriffe:
2 Aufbau der Polymeren Polymer, Kunststoff, makromolekularer Stoff, was ist das jeweils? Um uns richtig über das Thema verständigen zu können, müssen wir zunächst einige Begriffe besprechen: Grundbegriffe:
Die Innere Energie U
 Die Innere Energie U U ist die Summe aller einem System innewohnenden Energien. Es ist unmöglich, diese zu berechnen. U kann nicht absolut angegeben werden! Differenzen in U ( U) können gemessen werden.
Die Innere Energie U U ist die Summe aller einem System innewohnenden Energien. Es ist unmöglich, diese zu berechnen. U kann nicht absolut angegeben werden! Differenzen in U ( U) können gemessen werden.
Kapitel 2 Ion-Lösungsmittel Wechselwirkung (Solvatation) Physikalische Chemie III/2 (Elektrochemie)
 Kapitel 2 Ion-Lösungsmittel Wechselwirkung (Solvatation) 1 2.1. Allgemeines Elektrochemisches System: elektronischer Leiter(Metall/Halbleiter) in Kombination mit Ionenleiter(Elektrolyt). Wie können die
Kapitel 2 Ion-Lösungsmittel Wechselwirkung (Solvatation) 1 2.1. Allgemeines Elektrochemisches System: elektronischer Leiter(Metall/Halbleiter) in Kombination mit Ionenleiter(Elektrolyt). Wie können die
Physikalisch-chemische Grundlagen der Verfahrenstechnik
 Physikalisch-chemische Grundlagen der Verfahrenstechnik Günter Tovar, Thomas Hirth, Institut für Grenzflächenverfahrenstechnik guenter.tovar@igvt.uni-stuttgart.de Physikalisch-chemische Grundlagen der
Physikalisch-chemische Grundlagen der Verfahrenstechnik Günter Tovar, Thomas Hirth, Institut für Grenzflächenverfahrenstechnik guenter.tovar@igvt.uni-stuttgart.de Physikalisch-chemische Grundlagen der
1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Wiederholung
 1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Wiederholung a) Zur Messung der Temperatur verwendet man physikalische Effekte, die von der Temperatur abhängen. Beispiele: Volumen einer Flüssigkeit (Hg-Thermometer), aber
1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Wiederholung a) Zur Messung der Temperatur verwendet man physikalische Effekte, die von der Temperatur abhängen. Beispiele: Volumen einer Flüssigkeit (Hg-Thermometer), aber
Leibniz-Archiv (Arbeitsstelle Hannover der Göttinger Akademie der Wissenschaften)
 Konkordanz zwischen der und den von Onno herausgegebenen Leibniz: Werke Inhalt Leibniz-Archiv (Arbeitsstelle Hannover der Göttinger Akademie der Wissenschaften) Stand: 28.1.2009 Leibniz: Werke, Hrsg.:,
Konkordanz zwischen der und den von Onno herausgegebenen Leibniz: Werke Inhalt Leibniz-Archiv (Arbeitsstelle Hannover der Göttinger Akademie der Wissenschaften) Stand: 28.1.2009 Leibniz: Werke, Hrsg.:,
Vorlesung Organische Chemie II Reaktionsmechanismen (3. Sem.)
 Vorlesung Organische Chemie II Reaktionsmechanismen (3. Sem.) Gliederung Grundlagen der physikalisch-organischen Chemie Radikalreaktionen Nukleophile und elektrophile Substitution am gesättigten C-Atom
Vorlesung Organische Chemie II Reaktionsmechanismen (3. Sem.) Gliederung Grundlagen der physikalisch-organischen Chemie Radikalreaktionen Nukleophile und elektrophile Substitution am gesättigten C-Atom
Die bei chemischen Reaktionen auftretenden Energieumsätze werden nicht durch stöchiometrische Gesetze erfasst. Sie sind Gegenstand der Thermodynamik.
 Die Stöchiometrie ist die Lehre von der Zusammensetzung chemischer Verbindungen, sowie der Massen-, Volumen- und Ladungsverhältnisse bei chemischen Reaktionen. Die bei chemischen Reaktionen auftretenden
Die Stöchiometrie ist die Lehre von der Zusammensetzung chemischer Verbindungen, sowie der Massen-, Volumen- und Ladungsverhältnisse bei chemischen Reaktionen. Die bei chemischen Reaktionen auftretenden
Roland Reich. Thermodynamik. Grundlagen und Anwendungen in der allgemeinen Chemie. Zweite, verbesserte Auflage VCH. Weinheim New York Basel Cambridge
 Roland Reich Thermodynamik Grundlagen und Anwendungen in der allgemeinen Chemie Zweite, verbesserte Auflage VCH Weinheim New York Basel Cambridge Inhaltsverzeichnis Formelzeichen Maßeinheiten XV XX 1.
Roland Reich Thermodynamik Grundlagen und Anwendungen in der allgemeinen Chemie Zweite, verbesserte Auflage VCH Weinheim New York Basel Cambridge Inhaltsverzeichnis Formelzeichen Maßeinheiten XV XX 1.
Grundlagen der Physik II
 Grundlagen der Physik II Othmar Marti 12. 07. 2007 Institut für Experimentelle Physik Physik, Wirtschaftsphysik und Lehramt Physik Seite 2 Wärmelehre Grundlagen der Physik II 12. 07. 2007 Klausur Die Klausur
Grundlagen der Physik II Othmar Marti 12. 07. 2007 Institut für Experimentelle Physik Physik, Wirtschaftsphysik und Lehramt Physik Seite 2 Wärmelehre Grundlagen der Physik II 12. 07. 2007 Klausur Die Klausur
Mathematik für Physiker Band 3
 Helmut Fischer Helmut Kaul Mathematik für Physiker Band 3 Variationsrechnung Differentialgeometrie Mathemati sche Grundlagen der Allgemeinen Relativitätstheorie 4. Auflage Mathematik für Physiker Band
Helmut Fischer Helmut Kaul Mathematik für Physiker Band 3 Variationsrechnung Differentialgeometrie Mathemati sche Grundlagen der Allgemeinen Relativitätstheorie 4. Auflage Mathematik für Physiker Band
Informatik. Christian Kuhn. Web 2.0. Auswirkungen auf internetbasierte Geschäftsmodelle. Diplomarbeit
 Informatik Christian Kuhn Web 2.0 Auswirkungen auf internetbasierte Geschäftsmodelle Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen
Informatik Christian Kuhn Web 2.0 Auswirkungen auf internetbasierte Geschäftsmodelle Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen
Das Konzept der organisationalen Identität
 Wirtschaft Ute Staub Das Konzept der organisationalen Identität Eine kritische Analyse Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen
Wirtschaft Ute Staub Das Konzept der organisationalen Identität Eine kritische Analyse Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen
1. Wärmelehre 1.1. Temperatur. Physikalische Grundeinheiten : Die Internationalen Basiseinheiten SI (frz. Système international d unités)
 1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Physikalische Grundeinheiten : Die Internationalen Basiseinheiten SI (frz. Système international d unités) 1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Ein Maß für die Temperatur Prinzip
1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Physikalische Grundeinheiten : Die Internationalen Basiseinheiten SI (frz. Système international d unités) 1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Ein Maß für die Temperatur Prinzip
Elektrochemie fester Stoffe
 H. Rickert Einführung in die Elektrochemie fester Stoffe Bibliothek^5 d. Instituts f. anorgan. u. physikal. Chemie (er Technischen Hochschale Darmstödt Ä Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 1973
H. Rickert Einführung in die Elektrochemie fester Stoffe Bibliothek^5 d. Instituts f. anorgan. u. physikal. Chemie (er Technischen Hochschale Darmstödt Ä Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 1973
WI LEY-VCH. Band 3 Industrielle Polymere und Synthesen. Hans-Georg Elias. 6., vollig uberarbeitete und enveiterte Auflage
 Hans-Georg Elias Makromolekule Band 3 Industrielle olymere und Synthesen 6., vollig uberarbeitete und enveiterte Auflage @ WI LEY-VCH Weinheim. New York. Chichester. Brisbane * Singapore.Toronto Aus technischen
Hans-Georg Elias Makromolekule Band 3 Industrielle olymere und Synthesen 6., vollig uberarbeitete und enveiterte Auflage @ WI LEY-VCH Weinheim. New York. Chichester. Brisbane * Singapore.Toronto Aus technischen
8. Mehrkomponentensysteme. 8.1 Partielle molare Größen. Experiment 1 unter Umgebungsdruck p:
 8. Mehrkomponentensysteme 8.1 Partielle molare Größen Experiment 1 unter Umgebungsdruck p: Fügen wir einer Menge Wasser n mit Volumen V (molares Volumen v m =V/n) bei einer bestimmten Temperatur T eine
8. Mehrkomponentensysteme 8.1 Partielle molare Größen Experiment 1 unter Umgebungsdruck p: Fügen wir einer Menge Wasser n mit Volumen V (molares Volumen v m =V/n) bei einer bestimmten Temperatur T eine
Chemische Thermodynamik
 Walter Schreiter Chemische Thermodynamik Grundlagen, Ubungen, Lösungen Oe Gruyter Inhalt Verwendete Symbole und Größen................................. XI Theoretische Grundlagen.... 1.1 Nullter Hauptsatz
Walter Schreiter Chemische Thermodynamik Grundlagen, Ubungen, Lösungen Oe Gruyter Inhalt Verwendete Symbole und Größen................................. XI Theoretische Grundlagen.... 1.1 Nullter Hauptsatz
O. Sternal, V. Hankele. 5. Thermodynamik
 5. Thermodynamik 5. Thermodynamik 5.1 Temperatur und Wärme Systeme aus vielen Teilchen Quelle: Wikimedia Commons Datei: Translational_motion.gif Versuch: Beschreibe 1 m 3 Luft mit Newton-Mechanik Beschreibe
5. Thermodynamik 5. Thermodynamik 5.1 Temperatur und Wärme Systeme aus vielen Teilchen Quelle: Wikimedia Commons Datei: Translational_motion.gif Versuch: Beschreibe 1 m 3 Luft mit Newton-Mechanik Beschreibe
4. Stereochemie. Das wichtigste Kriterium für Chiralität ist, dass sich Objekt und Spiegelbild nicht zur Deckung bringen lassen.
 4. Stereochemie Auch die cis-trans-isomerie zählt zur Stereoisomerie: 4.1 Chirale Moleküle Chirale Moleküle besitzen ein asymmetrisches C- Atom = Chiralitätszentrum. Das wichtigste Kriterium für Chiralität
4. Stereochemie Auch die cis-trans-isomerie zählt zur Stereoisomerie: 4.1 Chirale Moleküle Chirale Moleküle besitzen ein asymmetrisches C- Atom = Chiralitätszentrum. Das wichtigste Kriterium für Chiralität
Thermo Dynamik. Mechanische Bewegung (= Arbeit) Wärme (aus Reaktion) maximale Umsetzung
 Thermo Dynamik Wärme (aus Reaktion) Mechanische Bewegung (= Arbeit) maximale Umsetzung Aussagen der Thermodynamik: Quantifizieren von: Enthalpie-Änderungen Entropie-Änderungen Arbeit, maximale (Gibbs Energie)
Thermo Dynamik Wärme (aus Reaktion) Mechanische Bewegung (= Arbeit) maximale Umsetzung Aussagen der Thermodynamik: Quantifizieren von: Enthalpie-Änderungen Entropie-Änderungen Arbeit, maximale (Gibbs Energie)
Physikdepartment. Ferienkurs zur Experimentalphysik 4. Daniel Jost 10/09/15
 Physikdepartment Ferienkurs zur Experimentalphysik 4 Daniel Jost 10/09/15 Inhaltsverzeichnis Technische Universität München 1 Kurze Einführung in die Thermodynamik 1 1.1 Hauptsätze der Thermodynamik.......................
Physikdepartment Ferienkurs zur Experimentalphysik 4 Daniel Jost 10/09/15 Inhaltsverzeichnis Technische Universität München 1 Kurze Einführung in die Thermodynamik 1 1.1 Hauptsätze der Thermodynamik.......................
Lösungen 10 (Kinetik)
 Chemie I WS 2003/2004 Lösungen 10 (Kinetik) Aufgabe 1 Verschiedenes 1.1 Als Reaktionsgeschwindigkeit v c wird die Ableitung der Konzentration eines Reaktanden A nach der Zeit t, dividiert durch dessen
Chemie I WS 2003/2004 Lösungen 10 (Kinetik) Aufgabe 1 Verschiedenes 1.1 Als Reaktionsgeschwindigkeit v c wird die Ableitung der Konzentration eines Reaktanden A nach der Zeit t, dividiert durch dessen
Mathematik in der Biologie
 Erich Bohl Mathematik in der Biologie 4., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage Mit 65 Abbildungen und 16 Tabellen ^J Springer Inhaltsverzeichnis Warum verwendet ein Biologe eigentlich Mathematik?
Erich Bohl Mathematik in der Biologie 4., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage Mit 65 Abbildungen und 16 Tabellen ^J Springer Inhaltsverzeichnis Warum verwendet ein Biologe eigentlich Mathematik?
Lehrbuch der Thermodynamik
 Ulrich Nickel Lehrbuch der Thermodynamik Eine verständliche Einführung PhysChem Verlag Erlangen U. Nickel VII Inhaltsverzeichnis 1 GRUNDLAGEN DER THERMODYNAMIK 1 1.1 Einführung 1 1.2 Materie 2 1.3 Energie
Ulrich Nickel Lehrbuch der Thermodynamik Eine verständliche Einführung PhysChem Verlag Erlangen U. Nickel VII Inhaltsverzeichnis 1 GRUNDLAGEN DER THERMODYNAMIK 1 1.1 Einführung 1 1.2 Materie 2 1.3 Energie
Matthias Moßburger. Analysis in Dimension 1
 Matthias Moßburger Analysis in Dimension 1 Matthias Moßburger Analysis in Dimension1 Eine ausführliche Erklärung grundlegender Zusammenhänge STUDIUM Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Matthias Moßburger Analysis in Dimension 1 Matthias Moßburger Analysis in Dimension1 Eine ausführliche Erklärung grundlegender Zusammenhänge STUDIUM Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Richtung von spontanem Prozeßablauf und Veränderung der G in Abhängigkeit vom Vorzeichen der Enthalpie und der Entropie
 Richtung von spontanem Prozeßablauf und Veränderung der G in Abhängigkeit vom Vorzeichen der Enthalpie und der Entropie H S G= H-T S Prozeß 1. (-) (+) (-) immer exergonisch, erfolgt spontan bei allen Temperaturen
Richtung von spontanem Prozeßablauf und Veränderung der G in Abhängigkeit vom Vorzeichen der Enthalpie und der Entropie H S G= H-T S Prozeß 1. (-) (+) (-) immer exergonisch, erfolgt spontan bei allen Temperaturen
R6ntgenkontrastmittel
 Ulrich Speck (Hrsg.) R6ntgenkontrastmittel Ubersicht, Anwendung und pharmazeutische Aspekte Mit Beitragen von B. Behrends, P. Blaszkiewicz, H.-E. Hempel D. Herrmann, U. Hubner-Steiner, A. Lenzner, W. Mutzel,
Ulrich Speck (Hrsg.) R6ntgenkontrastmittel Ubersicht, Anwendung und pharmazeutische Aspekte Mit Beitragen von B. Behrends, P. Blaszkiewicz, H.-E. Hempel D. Herrmann, U. Hubner-Steiner, A. Lenzner, W. Mutzel,
Vorlesung Chemie für Biologen: Klausur 1 WS Sa
 1 Vorlesung Chemie für Biologen: Klausur 1 WS 02-03 Sa 07.12.02 Name:... Ihre Unterschrift:... Vorname:... Matrikel-Nr.:... Studienbeginn: SS: WS:...... Tutor der Übungen: (Dort Klausureinsicht.) Punkteschlüssel
1 Vorlesung Chemie für Biologen: Klausur 1 WS 02-03 Sa 07.12.02 Name:... Ihre Unterschrift:... Vorname:... Matrikel-Nr.:... Studienbeginn: SS: WS:...... Tutor der Übungen: (Dort Klausureinsicht.) Punkteschlüssel
Grundlagen der Elektrotechnik I Physikalische Größen, physikalische Größenarten, Einheiten und Werte physikalischer Größen
 Grundlagen der Elektrotechnik I 17 11.01.01 Einführung eines Einheitensystems.1 Physikalische Größen, physikalische Größenarten, Einheiten und Werte physikalischer Größen Physikalische Größen: Meßbare,
Grundlagen der Elektrotechnik I 17 11.01.01 Einführung eines Einheitensystems.1 Physikalische Größen, physikalische Größenarten, Einheiten und Werte physikalischer Größen Physikalische Größen: Meßbare,
Der deutsche Föderalismus
 Roland Sturm Nomos Roland Sturm Nomos Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de
Roland Sturm Nomos Roland Sturm Nomos Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de
Theoretische Physik 6: Thermodynamik und Statistik
 Rainer J.Jelitto Theoretische Physik 6: Thermodynamik und Statistik Eine Einführung in die mathematische Naturbeschreibung 2. korrigierte Auflage Mit 82 Abbildungen, Aufgaben und Lösungen dulfc AU LA-Verlag
Rainer J.Jelitto Theoretische Physik 6: Thermodynamik und Statistik Eine Einführung in die mathematische Naturbeschreibung 2. korrigierte Auflage Mit 82 Abbildungen, Aufgaben und Lösungen dulfc AU LA-Verlag
Lösungsvorschlag Übung 1
 Lösungsvorschlag Übung Aufgabe : Physikalische Einheiten a) Es existieren insgesamt sieben Basisgrössen im SI-System. Diese sind mit der zugehörigen physikalischen Einheit und dem Einheitenzeichen in der
Lösungsvorschlag Übung Aufgabe : Physikalische Einheiten a) Es existieren insgesamt sieben Basisgrössen im SI-System. Diese sind mit der zugehörigen physikalischen Einheit und dem Einheitenzeichen in der
T.1 Kinetische Gastheorie und Verteilungen
 T.1 Kinetische Gastheorie und Verteilungen T 1.1 Physik von Gasen T 1.2 Ideales Gas - Makroskopische Betrachtung T 1.3 Barometrische Höhenformel T 1.4 Mikroskopische Betrachtung: kinetische Gastheorie
T.1 Kinetische Gastheorie und Verteilungen T 1.1 Physik von Gasen T 1.2 Ideales Gas - Makroskopische Betrachtung T 1.3 Barometrische Höhenformel T 1.4 Mikroskopische Betrachtung: kinetische Gastheorie
1) Ein offenes System zeichnet sich immer durch eine konstante Temperatur aus. zeichnet sich immer durch eine konstante Masse aus.
 1) Ein offenes System zeichnet sich immer durch eine konstante Temperatur aus. zeichnet sich immer durch eine konstante Masse aus. kann mit der Umgebung Energie austauschen. kann mit der Umgebung Entropie
1) Ein offenes System zeichnet sich immer durch eine konstante Temperatur aus. zeichnet sich immer durch eine konstante Masse aus. kann mit der Umgebung Energie austauschen. kann mit der Umgebung Entropie
4. Reaktionsgeschwindigkeit und chemisches Gleichgewicht
 Chemie RG mit DG, Themenbereiche, Seite 1 von 4 Chemie im Realgymnasium mit DG, 5-stündig Themenbereiche für die Reifeprüfung 1. Atombau und Periodensystem Die geschichtliche Entwicklung der Atommodelle
Chemie RG mit DG, Themenbereiche, Seite 1 von 4 Chemie im Realgymnasium mit DG, 5-stündig Themenbereiche für die Reifeprüfung 1. Atombau und Periodensystem Die geschichtliche Entwicklung der Atommodelle
What is a Fourier transform? A function can be described by a summation of waves with different amplitudes and phases.
 What is a Fourier transform? A function can be described by a summation of waves with different amplitudes and phases. Fourier Synthese/Anaylse einer eckigen periodischen Funktion Fourier Interferomter
What is a Fourier transform? A function can be described by a summation of waves with different amplitudes and phases. Fourier Synthese/Anaylse einer eckigen periodischen Funktion Fourier Interferomter
Inhaltsverzeichnis. Smits, Dr. F. M., Murray Hill, New Jersey (USA) Diffussion in hom6opolaren Halbleitern. Mit 15 Abbildungen...
 Inhaltsverzeichnis Hahn, Priv.-Doz. Dr. D., Berlin-Charlottenburg Die Anregung und Beeinflussung der Luminescenz durch elektrische Felder. Mit 27 Abbildungen....................... 1 Bittel, Prof. Dr.
Inhaltsverzeichnis Hahn, Priv.-Doz. Dr. D., Berlin-Charlottenburg Die Anregung und Beeinflussung der Luminescenz durch elektrische Felder. Mit 27 Abbildungen....................... 1 Bittel, Prof. Dr.
Probeklausur STATISTISCHE PHYSIK PLUS
 DEPARTMENT FÜR PHYSIK, LMU Statistische Physik für Bachelor Plus WS 2011/12 Probeklausur STATISTISCHE PHYSIK PLUS NAME:... MATRIKEL NR.:... Bitte beachten: Schreiben Sie Ihren Namen auf jedes Blatt; Schreiben
DEPARTMENT FÜR PHYSIK, LMU Statistische Physik für Bachelor Plus WS 2011/12 Probeklausur STATISTISCHE PHYSIK PLUS NAME:... MATRIKEL NR.:... Bitte beachten: Schreiben Sie Ihren Namen auf jedes Blatt; Schreiben
4.3 Reaktionsgeschwindigkeit und Katalysator
 4.3 Reaktionsgeschwindigkeit und Katalysator - Neben der thermodynamischen Lage des chemischen Gleichgewichts ist der zeitliche Ablauf der Reaktion, also die Geschwindigkeit der Ein- Einstellung des Gleichgewichts,
4.3 Reaktionsgeschwindigkeit und Katalysator - Neben der thermodynamischen Lage des chemischen Gleichgewichts ist der zeitliche Ablauf der Reaktion, also die Geschwindigkeit der Ein- Einstellung des Gleichgewichts,
Fey nman-vo rles u n ge n über Physik 1
 Richard P. Matthew Sands Feynman, Robert B. Leighton, Fey nman-vo rles u n ge n über Physik 1 Mechanik New Millennium-Edition DE GRUYTER Inhaltsverzeichnis 1 Atome in Bewegung 1 1.1 Einleitung 1 1.2 Materie
Richard P. Matthew Sands Feynman, Robert B. Leighton, Fey nman-vo rles u n ge n über Physik 1 Mechanik New Millennium-Edition DE GRUYTER Inhaltsverzeichnis 1 Atome in Bewegung 1 1.1 Einleitung 1 1.2 Materie
Was ist Physik? Modell der Natur universell es war schon immer so
 Was ist Physik? Modell der Natur universell es war schon immer so Kultur Aus was sind wir gemacht? Ursprung und Aufbau der Materie Von wo/was kommen wir? Ursprung und Aufbau von Raum und Zeit Wirtschaft
Was ist Physik? Modell der Natur universell es war schon immer so Kultur Aus was sind wir gemacht? Ursprung und Aufbau der Materie Von wo/was kommen wir? Ursprung und Aufbau von Raum und Zeit Wirtschaft
Inhalt. Vorwort v Hinweise zur Benutzung vi Über die Autoren vii
 Inhalt Vorwort v Hinweise zur Benutzung vi Über die Autoren vii 1 Phänomenologische Thermodynamik 1 1.1 Die grundlegenden Größen und Konzepte 1 1.1.1 Reduktion des Systems auf wenige ausgewählte Zustandsgrößen
Inhalt Vorwort v Hinweise zur Benutzung vi Über die Autoren vii 1 Phänomenologische Thermodynamik 1 1.1 Die grundlegenden Größen und Konzepte 1 1.1.1 Reduktion des Systems auf wenige ausgewählte Zustandsgrößen
Konzeption und Dokumentation erfolgreicher Webprojekte Design und Planung von Websites strukturiert erstellen, dokumentieren und präsentieren
 Dan M. Brown Konzeption und Dokumentation erfolgreicher Webprojekte Design und Planung von Websites strukturiert erstellen, dokumentieren und präsentieren Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Dan M. Brown Konzeption und Dokumentation erfolgreicher Webprojekte Design und Planung von Websites strukturiert erstellen, dokumentieren und präsentieren Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Formelsammlung Physik1 für Wirtschaftsingenieure und PA Stand Additionstheoreme für sinus und cosinus: Darf in der Klausur verwendet werden!
 Stand Bereich: Mathematik Darf in der Klausur verwendet werden! sin = a c ; cos = b c ; tan = a b sin 2 cos 2 =1 Additionstheoreme für sinus und cosinus: sin ± =sin cos ± cos sin cos ± =cos cos sin sin
Stand Bereich: Mathematik Darf in der Klausur verwendet werden! sin = a c ; cos = b c ; tan = a b sin 2 cos 2 =1 Additionstheoreme für sinus und cosinus: sin ± =sin cos ± cos sin cos ± =cos cos sin sin
Mechanismen in der anorganischen Chemie
 Mechanismen in der anorganischen Chemie Eine Untersuchung von Metall-Komplexen in Lösungen Yon Fred Basolo und Ralph G. Pearson Übersetzt von Eckart Eich und Norbert Sütterlin 143 Abbildungen, 144 Tabellen
Mechanismen in der anorganischen Chemie Eine Untersuchung von Metall-Komplexen in Lösungen Yon Fred Basolo und Ralph G. Pearson Übersetzt von Eckart Eich und Norbert Sütterlin 143 Abbildungen, 144 Tabellen
Physikalische Chemie. Heinz Hug Wolfgang Reiser EHRMITTEL. EUROPA-FACHBUCHREIHE für Chemieberufe. 2. neu bearbeitete Auflage. von
 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. EHRMITTEL EUROPA-FACHBUCHREIHE für Chemieberufe Physikalische Chemie
2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. EHRMITTEL EUROPA-FACHBUCHREIHE für Chemieberufe Physikalische Chemie
Vorwort Wie benutze ich... dieses Buch? I Klassische Mechanik
 Inhaltsverzeichnis Vorwort Wie benutze ich... dieses Buch? I Klassische Mechanik v xv l 1 Grundlagen 3 1.1 Einheiten, Größenordnungen, Zahlenwerte 4 1.2 Impuls 7 1.3 Kraft und die Newton'schen Gesetze
Inhaltsverzeichnis Vorwort Wie benutze ich... dieses Buch? I Klassische Mechanik v xv l 1 Grundlagen 3 1.1 Einheiten, Größenordnungen, Zahlenwerte 4 1.2 Impuls 7 1.3 Kraft und die Newton'schen Gesetze
Auswahl von Prüfungsfragen für die Prüfungen im September 2011
 Auswahl von Prüfungsfragen für die Prüfungen im September 2011 Was ist / sind / bedeutet / verstehen Sie unter... Wie nennt man / lautet / Wann spricht man von / Definieren Sie... Die anschließenden Fragen
Auswahl von Prüfungsfragen für die Prüfungen im September 2011 Was ist / sind / bedeutet / verstehen Sie unter... Wie nennt man / lautet / Wann spricht man von / Definieren Sie... Die anschließenden Fragen
Allgemeine Chemie für Studierende mit Nebenfach Chemie Andreas Rammo
 Allgemeine Chemie für Studierende mit Nebenfach Chemie Andreas Rammo Allgemeine und Anorganische Chemie Universität des Saarlandes E-Mail: a.rammo@mx.uni-saarland.de innere Energie U Energieumsatz bei
Allgemeine Chemie für Studierende mit Nebenfach Chemie Andreas Rammo Allgemeine und Anorganische Chemie Universität des Saarlandes E-Mail: a.rammo@mx.uni-saarland.de innere Energie U Energieumsatz bei
Mit Selbsttests gezielt Mathematik lernen
 Mit Selbsttests gezielt Mathematik lernen Gert Höfner Mit Selbsttests gezielt Mathematik lernen Für Studienanfänger aller Fachrichtungen zur Vorbereitung und studienbegleitend Gert Höfner Langenfeld, Deutschland
Mit Selbsttests gezielt Mathematik lernen Gert Höfner Mit Selbsttests gezielt Mathematik lernen Für Studienanfänger aller Fachrichtungen zur Vorbereitung und studienbegleitend Gert Höfner Langenfeld, Deutschland
