Praktikumsanleitung zum Versuch Energieumsatz und Atmungsregulation
|
|
|
- Alexander Koenig
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Praktikumsanleitung zum Versuch Energieumsatz und Atmungsregulation UNIVERSITÄT LEIPZIG MEDIZINISCHE FAKULTÄT CARL-LUDWIG-INSTITUT FÜR PHYSIOLOGIE AUSGABE FÜR PHARMAZEUTEN VERSION 3 Stichwörter für Energieumsatz: Sauerstoffaufnahme, Sauerstoffverbrauch, Energiebegriff, Energieformen, Metabolismus, Energieumsatzniveaus von Zelle und Organismus, Grundumsatz (Bedingungen, spezifischdynamische Wirkung), Leistungsumsatz, Leistungszuwachs, Wirkungsgrad, direkte Kalorimetrie, indirekte Kalorimetrie (O 2 Messung, respiratorischer Quotient, kalorisches Äquivalent, physikalischer und physiologischer Brennwert) Stichwörter für Atmungsregulation: Partialdruck: po 2, pco 2 ; Sauerstoffsättigung, Sauerstoffbindungskurve des Hämoglobins, alveoläre Ventilation, Totraumventilation, Ventilationskoeffizient, Atemäquivalent, Zusammensetzung von atmosphärischer Luft und Alveolarluft; Atemzentrum, Chemorezeptoren, Propriozeptoren des Thorax und Dehnungsrezeptoren der Lunge (Hering-Breuer-Reflex), CO 2 - und O 2 -Antwortkurven. Lernziele zur Praktikumsvorbereitung: Nach der Vorbereitung zum Praktikumsversuch sind die Studierenden in der Lage: - den Zusammenhang zwischen Sauerstoffaufnahme und Energieumsatz zu erklären, - die Messung der Sauerstoffaufnahme und die Bestimmung des Energieumsatzes mittels der Indirekten Kalorimetrie zu erläutern sowie den Begriff Grundumsatz zu definieren, - den Zusammenhang zwischen Sauerstoffsättigung und Sauerstoffpartialdruck im Blut zu erklären, - die chemische Atmungsregulation zu beschreiben und die unterschiedlich starken Einflüsse von po 2 und pco 2 zu interpretieren. 1 Messung des Energieumsatzes mittels indirekter Kalorimetrie 1.1 Bestimmung des Umsatzes einer ruhenden, sitzenden Versuchsperson mittels indirekter Kalorimetrie Die indirekte Kalorimetrie geht davon aus, dass im lebenden Organismus letztlich alle Energie aus der Oxidation der Nahrungsstoffe stammt. Bei der geringen O 2 -Speicherkapazität des Organismus muss dann der augenblickliche Energieumsatz E dem O 2 -Verbrauch V O2 proportional sein. Es erfolgt die spirographische Messung des Sauerstoffverbrauchs pro Zeit (Sauerstoffaufnahme). Der Energieumsatz ergibt sich als Produkt aus Sauerstoffaufnahme (O 2 -Verbrauch/min) und dem nahrungsabhängigen kalorischen Äquivalent KÄ als Proportionalitätsfaktor. Für europäisches Essen kann KÄ = 20,2 kj/l angenommen werden. Die Sauerstoffaufnahme muss hierzu auf Normalbedingungen (STPD) mit dem wetterabhängigen Faktor k STPD (s. Anhang II) reduziert werden. Die innerhalb der Messzeit t Ruhe umgesetzte Energie ist somit: = Ä = Ä 1
2 Die innerhalb der Messzeit t Ruhe erfolgte Sauerstoffaufnahme (Sauerstoffverbrauch pro Zeit) ist: = Der Energieumsatz (Energie pro Zeit = Leistung) in Ruhe errechnet sich dann zu: Allgemeine Grundsätze: = = = Ä = Ä Die Versuchsperson (Vp) ist über den geplanten Ablauf der einzelnen Versuche genau zu informieren. Kommandos sind vor Beginn zu verabreden. Besondere Beaufsichtigung der Vp bei den Versuchen zur Atmungsregulation (CO 2 - Überschuss, O 2 -Mangel). Bei O 2 -Mangel kann die eigene Wahrnehmung der Vp eingeschränkt sein! Anschluss der Vp an das Spirometer mit Mundstück und Schlauch. Sicherer Verschluss der Nase mit einer Klemme! Kalibrierung des Spirometers in vertikaler Richtung (y-achse): 1 cm = 300 ml Versuchsablauf: 1. Registriergeschwindigkeit (nur bei eingeschaltetem Gerät) einstellen: 60 mm/min 2. Atemsystem mit O 2 spülen und füllen: O 2 gefüllte Spirometerglocke durch Herabdrücken bei gleichzeitiger Öffnung des Ventils am Inspirationsschlauch/Spirometergehäuse (Herabdrücken des Metallhebels) entleeren; anschließend erneute ausreichende O 2 Füllung der Spirometerglocke. 3. Anschluss der Vp: Nasenklammer aufsetzen; Mundstück wie bei einem Schnorchel in den Mund nehmen; maximal 2 Minuten Atmung bei geöffnetem Bypass (oben am Metallmundstück) bis zur Gewöhnung. 4. Bypass am Mundstück durch Drehen am hinteren Ende vollständig (!) verschließen. Der Start des Versuchs ist durch die Aufzeichnung regelmäßiger Atembewegungen zu kontrollieren. Die Aufzeichnung erfolgt dann über einen Zeitraum von maximal 10 Minuten (mind. 5 Minuten). Der Versuch ist bei zu niedrigem Füllungsvolumen der Glocke bzw. unvollständiger Aufzeichnung der Atembewegungen abzubrechen. 5. Zur Kontrolle der Konstanz des Energieumsatzes der Vp ist während des Versuches einmal pro Minute der Puls mittels des mobilen Pulsoximeters/Kapnographen (CAPNOX) zu messen. Die Pulsfrequenz [min -1 ] wird über die gesamte Versuchsdauer gezählt und zeitgerecht in das Spirogramm eingetragen. 2
3 Ergebnisse: 1. mittlerer O 2 Verbrauch pro Minute (O 2 Aufnahme); Korrektur auf STPD 2. Ruhe-Energieumsatz und Abweichung vom Soll-Grundumsatz. Angabe erfolgt in %, wobei Soll-Grundumsatz = 100 %). Schätzung des Soll-Grundumsatz nach: MD Mifflin, ST St Jeor, LA Hill, BJ Scott, SA Daugherty and YO Koh: A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals; American Journal of Clinical Nutrition, Vol 51 (1990), Frauen: Grundumsatz) *+ 45 / = 4,19 (9,99 ö:;<h + 6,25 ö:öß 4,92 DE 161),-. 67 Männer: Grundumsatz) *+ 45 / = 4,19 (9,99 ö:;<h + 6,25 ö:öß 4,92 DE + 5),-. 67 Körpergewicht in kg, Körpergröße in cm, Alter in Jahren Diskussion: Wodurch sind Abweichungen des Ruhe-Umsatzes vom Soll-Grundumsatz zu begründen? 3
4 Probandendaten Geschlecht Alter [Jahr] Größe [cm] Gewicht [kg] Soll-Grundumsatz [kj/tag] Wetterabhängige Daten Luftdruck [hpa] Raumtemperatur [ C] k STPD Energieumsatz Messdauer t Ruhe [min] O 2 -Verbrauch [l] (unkorr.) O 2 -Aufnahme [l/min] (unkorr.) O 2 -Aufnahme [l/min] (STPD) Ruhe-Energieumsatz [kj/min] Ruhe-Energieumsatz [Watt = J/s] Ruhe-Energieumsatz [kj/tag] Abweichung vom Soll-Grundumsatz in % Tabelle 1: Daten der Energieumsatzmessung 2 Versuche zur Atmungsregulation Die Zusammensetzung der in ständigem Gasaustausch mit dem Blut stehenden Alveolarluft wird durch die äußere Atmung in engen Grenzen konstant gehalten. Es wird periodisch ein Teil der Alveolarluft ausgeatmet und durch eingeatmete atmosphärische Luft ersetzt. Die Häufigkeit dieses Vorganges (Atemfrequenz) und die Größe des in die Alveolen gelangten Gasvolumens (Atemzugvol. minus Totraumvol.) sind variabel. Ihre Einstellung erfolgt - in einem noch unvollkommen bekannten Prozess - unter Vermittlung von Rezeptoren (Chemorezeptoren, Mechanorezeptoren) und des nervösen Atemzentrums vorwiegend als Anpassung an die Erfordernisse des Stoffwechsels (O 2 - Verbrauch, CO 2 -Bildung) und an die mechanischen Gegebenheiten im Thorax-Lungenbereich. 4
5 Die Atemform ( Atemmuster ) ist durch Angabe der Atemfrequenz und des Atemhubes (sowie dessen Ausgangsposition) gekennzeichnet. Das als Förderleistung des Atemapparates bezeichnete Atemminutenvolumen (Maß für die Ventilation) AMV ergibt sich aus dem Produkt von Atemzugvolumen und Atemfrequenz. Das Atemminutenvolumen ist in alveoläre Ventilation und Totraumventilation aufteilbar. Nur die alveoläre Ventilation steht in Zusammenhang mit den pro Minute ausgetauschten Volumina an O 2 und CO 2. Ein ungünstiges Atemmuster, wie flache Atmung bei gesteigerter Frequenz (Hechelatmung) führt zu einer Vergrößerung der Totraumventilation und damit des Atemäquivalents (Verhältnis von ventilierter Luftmenge zu aufgenommener O 2 -Menge). Fingerpulsoximeter Auf Intensivstationen, bei Operationen, in der Geburtshilfe usw. gehört mittlerweile die Anwendung von sog. Fingerpulsoximetern zum Standard der Patientenüberwachung. Bei diesem nichtinvasiven und kontinuierlichen Verfahren wird die Fingerkuppe mit zwei verschiedenen Wellenlängen monochromatischen Lichtes durchstrahlt und die Extinktion gemessen. Grundlage der Messung ist im Anhang dargestellt (S. 14). Da sich die Extinktion in Abhängigkeit von der arteriellen Pulsation rhythmisch verändert, lassen sich neben der Sauerstoffsättigung die Herzfrequenz und die periphere Pulskurve erfassen und anzeigen. 2.1 Auswertung der Ruheatmung (siehe Versuch 1.1 zum Ruheumsatz) zu bestimmende Werte: mittleres Atemzugvolumen V T [Liter] (bezogen auf BTPS-Bedingungen): aus einigen Atemzügen mittlere Atemperiodendauer (Dauer eines Atemzugs) T TOT [s]: aus 10 aufeinanderfolgenden Atemzügen mittlere Atmungsfrequenz f R [min -1 ]: Berechnen aus T TOT mittleres Atemminutenvolumen AMV [l/min] (bezogen auf BTPS-Bedingungen) O 2 -Aufnahme [ml/min] (bezogen auf STPD-Bedingungen): aus Versuchsergebnissen zu 1.1 (Tabelle 1) übernehmen Atemäquivalent für Sauerstoff EQ O2 (unkorrigierte Werte = ATPS verwenden) nach der Formel: Pulsfrequenz bei Ruhe [min -1 ] G = DHIE [ E,DLM] O DPh [ E,DLM] 5
6 Abbildung 2: Parameter der Ruheatmung V Volumen T Atemperiodendauer V Inspirationsvolumen Insp t T 10 Zeit Dauer von 10 Atemperioden Ergebnisse: k BTPS : Volumen unkorrigiert korrigiert Normwert Atemzugvolumen [ml] Atemminutenvolumen AMV [l/min] O 2 -Aufnahme [ml/min], aus Tab. 1 BTPS: BTPS: STPD: Atemperiodendauer [s] Atmungsfrequenz [min -1 ] Atemäquivalent EQ O2 Mittlere Pulsfrequenz [min -1 ] Tabelle 3: Wertetabellen für die Ruheatmung 6
7 2.2 Einfluss von Kohlendioxid-Überschuss auf die Atmung: Atmung mit steigendem Kohlendioxid-Gehalt der Einatmungsluft (Rückatmungsversuch) Durchführung: An den Inspirationsstutzen wird ein Plaste-Zwischenstück angesteckt, das zwei Verbindungsschläuche zu einem Messgerät für die fortlaufende CO 2 -Messung enthält. Entleerung der Glocke und Füllung des Spirographen nur zu 2/3 mit Sauerstoff, nachdem der CO 2 -Absorber (vom Assistenten! ) aus dem System entfernt wurde. Anschluss der Vp und diese wieder ca. 2 Minuten mit Raumluft bei geöffnetem Ventil adaptieren lassen. Danach Beginn der Registrierung (Registriergeschwindigkeit 60 mm/min). Puls zählen und protokollieren (s. Aufgabenteil 2.1). Die Registrierung erfolgt so lange, bis erhebliche subjektive Atemnot den Abbruch nötig macht. Bei Abbruch sollten erhebliche Änderungen der Atmung deutlich sichtbar sein. Zusätzlich zu den physiologischen Zeichen der CO 2 -Überschussatmung wird der Partialdruck des CO 2 (pco 2 ) über den Kapnographen/Pulsoximeter (CAPNOX) abgeschätzt. Die Anzeige erfolgt grafisch als ansteigende pco 2 -Kurve (mmhg), wobei der mittlere Abschnitt des Displays folgendermaßen skaliert ist: untere Kante: 0 mmhg; untere gestrichelte Linie: 30 mmhg; obere gestrichelte Linie: 60 mmhg; obere Kante: 100 mmhg. Der Messwert ist in Minutenabständen zu erfassen. Außerdem wird der pco 2 bestimmt, bei dem der Proband subjektiv einen Atemantrieb spürt. Dazu ist vor Versuchsbeginn mit der Vp eine entsprechende Zeichengebung zu vereinbaren (z.b. Heben eines Armes). Der pco 2 beim Versuchsabbruch ist ebenfalls zu registrieren Ergebnisse: letzte 3 AZ Zahl der minütlich minütlich jede Minute Atemzüge ablesen ablesen Min Atemzugvolumen Atemfrequenz AMV Pulsfrequenz pco 2 [mm Hg] (BTPS) [l] [min -1 ] (BTPS) [l/min] [min -1 ] Tabelle 4: Messwerte für CO 2 -Überschuss 7
8 2.2.3 Auswertung: während des Versuches gibt die Vp ein Zeichen, ab wann deutliche Atemnot empfunden wird! Zeitpunkt und ggf. CO 2 -Konzentration markieren! das Atemzugvolumen jeder Registrierminute wird durch den Mittelwert aus den jeweils letzten 5 Atemzügen erfasst und auf BTPS-Bedingungen umgerechnet. die Atemfrequenz wird für jede Minute durch Auszählen der registrierten Atemperioden ermittelt (angefangene Atemzüge werden mitgewertet, wenn die Exspiration bereits begonnen hat) das Atemminutenvolumen jeder Registrierminute wird als Produkt aus Atemzugvolumen und Frequenz berechnet. Protokollieren Sie die Symptome, die Sie am Probanden beobachten konnten: Ab welchem pco 2 wird Atemnot empfunden? Symptome bei Abbruch: - Gesichtsfarbe: - subjektive Empfindungen (Hitze, Kopfschmerzen, ): 2.3 Einfluss von Sauerstoffmangel auf die Atmung Durchführung: Nach ausreichender Erholung der Vp (Rückkehr von Pulsfrequenz und Atmung auf die im Aufgabenteil 2.1 ermittelten Ruhewerte, Pausendauer mind. 15 min, wird der Spirograph, in den der CO 2 -Absorber (vom Assistenten!) wieder eingesetzt wurde, zu 1/2 mit atmosphärischer Luft gefüllt. Es müssen auch die Verbindungsschläuche mit Luft gespült werden. Dazu sind die Schlauchverbindungen am Atemventil vorsichtig zu lösen. Die Spirometerglocke wird mehrfach über die Atemschläuche gefüllt und entleert. Anschluss der Vp und eine 2 minütige Adaptation bei geöffnetem Ventil. Nach Ventilschluss Beginn der Registrierung und Pulskontrolle wie im Aufgabenteil 3.2. Die Registrierung erfolgt bis zum Einsetzen von Hypoxiezeichen (Zyanose, Blässe, Pulsfrequenzanstieg). Die Vp soll während des Versuches eine absteigende Zahlenreihe in 3er Schritten, beginnend bei 1000, schreiben (1000, 997, 994 ). Treten als Anzeichen einer zerebralen Hypoxie Schriftunsicherheit und Schreibfehler auf, wird der Versuch sofort abgebrochen. Subjektive Atemnot wird bei O 2 -Mangel nicht empfunden, die Atmungsvergrößerung ist gering. 8
9 Ebenfalls über den Kapnographen/Pulsoximeter (CAPNOX) lässt sich die O 2 -Sättigung messen. Die O 2 -Sättigung wird einmal pro Minute registriert Ergebnisse: letzte 3 AZ Zahl der minütlich minütlich jede Minute Atemzüge ablesen ablesen Min Atemzugvolumen (BTPS)[l] Atemfrequenz [min -1 ] AMV (BTPS) [l/min] Pulsfrequenz [min -1 ] O 2 -Sättigung [%] Tabelle 5: Messwerte für O 2 -Mangel Auswertung: Welche Veränderungen im Schriftbild sowie bei den Rechenaufgaben waren zu beobachten? Symptome bei Abbruch: - Gesichtsfarbe: - Zyanose? (Ohrläppchen, Fingerkuppen, Lippen): - subjektive Empfindungen (Schwindel, motorische oder sensorische Störungen, Bewusstseinstrübungen, ): Etwa welchem po 2 entspricht die gemessene O 2 -Sättigung bei Abbruch? 9
10 2.4 Graphische Auswertung und Diskussion zu Versuchen 2.2 und2.3: Zeichnen Sie den zeitlichen Verlauf des AMV für Aufgabenteil 2.2 und 2.3 in ein Diagramm (x-achse: Zeit in min, y-achse: AMV in l/min) Beschriften Sie in der Kurve für die CO 2 -Überschussatmung folgende Datenpunkte: o erstmalig pco 2 40 mmhg o Einsetzen des Atemantriebs o Angabe des pco 2 bei Abbruch Vergleichen Sie die in den Aufgabenteilen 2.2 und 2.3 erhaltenen Atmungssteigerungen! Als Maximalwerte der Ventilation (AMV) wurden ermittelt: a) unter CO 2 -Überschuss b) unter O 2 -Mangel Was sagen diese Werte über die Atmungsregulation aus? 10
11 Anhang I: Durchführung aller Versuche 1. Ruheatmung (Energieumsatz + Atmungsregulation) Glocke mit Sauerstoff füllen (einmal spülen) Papiergeschwindigkeit: 60 mm/min; Mundstück in Stabhalterung Vp atmet ca. 10 min (bei großen Probanden kürzer) in sitzender Position 2. Kohlendioxid-Überschuss (Atmungsregulation) CO 2 -Absorber ausbauen lassen! Glocke mit Sauerstoff füllen (einmal spülen) Papiergeschwindigkeit: 60 mm/min; Mundstück in Stabhalterung Vp atmet bis Atemnot eintritt Puls und O 2 -Sättigung kontrollieren (CAPNOX) pco 2 in der Atemluft jede Minute notieren (CAPNOX) min Pause 3. Sauerstoffmangel (Atmungsregulation) CO 2 -Absorber einbauen lassen! Glocke zu 1/2 mit Raumluft füllen (einmal spülen) Papiergeschwindigkeit: 60 mm/min; Mundstück in Stabhalterung Vp beginnt Rechentest (1000, 997, 994 ) O 2 -Sättigung der Vp jede Minute notieren (CAPNOX) Vp atmet bis Anzeichen von Rechenunsicherheit, Schreibunsicherheit und/oder zu geringe O 2 - Sättigung (<80 %) auftreten; Kontrolle und Aufforderung durch externe Person notwendig! Anhang II: Normierung von Gasvolumina Das Gasvolumen im Glockenspirometer hängt von der Raumtemperatur T Raum [K] und dem wetterabhängigen Luftdruck p Raum ab. Für die Normierung auf Standardbedingungen STPD (Standard Temperature T STPD = 273,15 K = 0 C, Pressure p STPD = 760 Torr = Pa, Dry = trockene Luft) nutzt man die ideale Gasgleichung (: 6Q : R ) 6Q L 6Q = : L Da auf trocken Luft normiert wird, muss man gedanklich alle Wassermoleküle aus dem Volumen V Raum entfernen, also den Luftdruck p Raum um den Partialdruck des Wasserdampfes p WD reduzieren. Für = 6Q ergibt sich dann = L L 6Q : 6Q : R : Der Wasserdampfpartialdruck (Sättigungsdampfdruck) p WD ist von der Raumtemperatur abhängig: VW,XYXYZ ( [\]^_W`,VZ a) : R = 610,78 [\]^_`Y,bWZ a Für die Normierung auf Körpertemperatur BTPS (Body Temperature Pressure Saturated) gilt: c = 310,15 : 6Q : R L 6Q : 6Q 6,281 11
12 Anhang III: Messprinzip für die Sauerstoffsättigung Desoxygeniertes oder reduziertes Hämoglobin rhb bindet Sauerstoff und wird zu Oxyhämoglobin O 2 Hb. Die funktionelle Sättigung ist das Verhältnis von der Oxyhämoglobin-Konzentration c O2 Hb zu der Summe der Konzentrationen von desoxygeniertem Hämoglobin c rhb und Oxyhämoglobin c O2 Hb : < e hi M e,fg4 = < e hi + < jhi Werden dysfunktionelle Konzentrationsanteile, wie Carboxyhämoglobin c COHb (das Hämoglobin transportiert Kohlenmonoxid, statt Sauerstoff, z.b. bei Rauchern), Methämoglobin c MetHb und weitere Derivate berücksichtigt, ergibt sich die fraktionelle Sättigung: M e,fj64 = < e hi < e hi + < jhi + < khi + < lmhi + Die einzelnen Konzentrationen können über die Farbe des Blutes, genauer durch Absorption bestimmter Lichtanteile, bestimmt werden. Falls nur eine Substanz mit der Konzentration c in der Flüssigkeit ist, wird monochromatisches Licht der Intensität I o mit der Wellenlänge λ nach dem Lambert-Beer schen Gesetz gedämpft o = o X _p(q) r s Dabei ist ε(λ) der molare Extinktionskoeffizient in Abhängigkeit von der Wellenlänge λ der Substanz und d die Länge des Weges, die das Licht in der Flüssigkeit zurücklegt. Die Extinktion ist = E o o X = t(u) < v Für die funktionelle Sättigung müssen die Konzentrationen c O2 Hb und c rhb bestimmt werden. o = o X _p wexy(q) r w exy s _p zxy(q) r zxy s Das ist eine Gleichung mit 2 unbekannten Konzentrationen. Um diese eindeutig zu lösen, muss man zwei Extinktionen mit verschiedenen Wellenlägen λ 1 und λ 1 messen. (u V ) = t e hi(u V ) < e hi v + t jhi (u V ) < jhi v (u ) = t e hi(u ) < e hi v + t jhi (u ) < jhi v Dieses Gleichungssystem liefert als Lösung die gesuchten Konzentrationen c O2 Hb und c rhb. Fingerpulsoximeter messen die funktionelle Sättigung bei den beiden Wellenlängen λ 1 = 660 nm und λ 2 = 940 nm. Da der Finger als Küvette dient und eine erhebliche Streuung auftritt, lassen sich andere Anteile nur schwierig bestimmen. Will man die fraktionelle Sättigung bestimmen, wird ein Hämoximeter benötigt, welches 6 Extinktionen mit den Wellenlängen 535, 560, 577, 622, 636 und 670 nm (OSM3 von Radiometer) an einer Blutprobe bestimmt. Es ergibt sich dann ein Gleichungsystem mit 6 Gleichungen, welches dann die Konzentrationen c rhb, c O2 Hb, c COHb, c SHb (Sulfhämoglobin), c MetHb und die Trübung liefert. 12
Praktikumsanleitung zum Versuch Energieumsatz und Atmungsregulation
 Praktikumsanleitung zum Versuch Energieumsatz und Atmungsregulation UNIVERSITÄT LEIPZIG MEDIZINISCHE FAKULTÄT CARL-LUDWIG-INSTITUT FÜR PHYSIOLOGIE VERSION 3 Stichwörter für Energieumsatz: Sauerstoffaufnahme,
Praktikumsanleitung zum Versuch Energieumsatz und Atmungsregulation UNIVERSITÄT LEIPZIG MEDIZINISCHE FAKULTÄT CARL-LUDWIG-INSTITUT FÜR PHYSIOLOGIE VERSION 3 Stichwörter für Energieumsatz: Sauerstoffaufnahme,
Praktikumsanleitung zum Versuch Atmungsregulation
 Praktikumsanleitung zum Versuch Atmungsregulation Universität Leipzig Medizinische Fakultät Carl-Ludwig-Institut für Physiologie 7 Januar 2015 Einführung Stichwörter: alveoläre Ventilation, Totraumventilation,
Praktikumsanleitung zum Versuch Atmungsregulation Universität Leipzig Medizinische Fakultät Carl-Ludwig-Institut für Physiologie 7 Januar 2015 Einführung Stichwörter: alveoläre Ventilation, Totraumventilation,
Physiologie der Atmung. Cem Ekmekcioglu
 Physiologie der Atmung Cem Ekmekcioglu Übersicht über den Transportweg des Sauerstoffes beim Menschen Schmidt/Thews: Physiologie des Menschen, 27.Auflage, Kap.25, Springer (1997) Klinke, Pape, Silbernagl,
Physiologie der Atmung Cem Ekmekcioglu Übersicht über den Transportweg des Sauerstoffes beim Menschen Schmidt/Thews: Physiologie des Menschen, 27.Auflage, Kap.25, Springer (1997) Klinke, Pape, Silbernagl,
Versuchsanleitungen zum Praktikum Physikalische Chemie für Anfänger 1. Lambert Beer sches Gesetz - Zerfall des Manganoxalations
 Versuchsanleitungen zum Praktikum Physikalische Chemie für Anfänger 1 A 34 Lambert Beer sches Gesetz - Zerfall des Manganoxalations Aufgabe: 1. Bestimmen Sie die Wellenlänge maximaler Absorbanz λ max eines
Versuchsanleitungen zum Praktikum Physikalische Chemie für Anfänger 1 A 34 Lambert Beer sches Gesetz - Zerfall des Manganoxalations Aufgabe: 1. Bestimmen Sie die Wellenlänge maximaler Absorbanz λ max eines
Versuch Nr.53. Messung kalorischer Größen (Spezifische Wärmen)
 Versuch Nr.53 Messung kalorischer Größen (Spezifische Wärmen) Stichworte: Wärme, innere Energie und Enthalpie als Zustandsfunktion, Wärmekapazität, spezifische Wärme, Molwärme, Regel von Dulong-Petit,
Versuch Nr.53 Messung kalorischer Größen (Spezifische Wärmen) Stichworte: Wärme, innere Energie und Enthalpie als Zustandsfunktion, Wärmekapazität, spezifische Wärme, Molwärme, Regel von Dulong-Petit,
In dieser Zeit ist die Zelle unempfindlich gegenüber erneuten Erregungen.
 Monitoring der Herz - Lungenfunktion EKG-Monitoring Pulsoxymetrie theoretische Grundlagen, praktische Anwendung und Grenzen der Überwachung Elektrophysiologische Grundlagen Elektrophysiologische Grundlagen
Monitoring der Herz - Lungenfunktion EKG-Monitoring Pulsoxymetrie theoretische Grundlagen, praktische Anwendung und Grenzen der Überwachung Elektrophysiologische Grundlagen Elektrophysiologische Grundlagen
Atmung, Stoffwechsel und Blutkreislauf
 Atmung, Stoffwechsel und Blutkreislauf Rainer Müller Lehrstuhl für Didaktik der Physik, Universität München Schellingstr. 4, 80799 München 1. Allgemeine Zusammenhänge Ein Thema, das bei Schülerinnen und
Atmung, Stoffwechsel und Blutkreislauf Rainer Müller Lehrstuhl für Didaktik der Physik, Universität München Schellingstr. 4, 80799 München 1. Allgemeine Zusammenhänge Ein Thema, das bei Schülerinnen und
Physiologie der Atmung
 Beatmungstherapie Grundlagen der maschinellen Beatmung Ambulanter Pflegedienst Holzminden Nordstr. 23 37603 Holzminden 1 Physiologie der Atmung Ventilation (Belüftung der Alveolen) Inspiration (aktiv)
Beatmungstherapie Grundlagen der maschinellen Beatmung Ambulanter Pflegedienst Holzminden Nordstr. 23 37603 Holzminden 1 Physiologie der Atmung Ventilation (Belüftung der Alveolen) Inspiration (aktiv)
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg
 TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg PROTOKOLL SEKUNDARSTUFE II Modul: Versuch: Elektrochemie 1 Abbildung 1:
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg PROTOKOLL SEKUNDARSTUFE II Modul: Versuch: Elektrochemie 1 Abbildung 1:
Obere und untere Luftwege
 Folie 1 Atmung Obere und untere Luftwege Merke: Trennung zwischen oberen und unteren Luftwegen ist der Kehldeckel Folie 2 Anatomie des Kehlkopfes Zungenbein Kehldeckel Ligamentum conicum Schildknorpel
Folie 1 Atmung Obere und untere Luftwege Merke: Trennung zwischen oberen und unteren Luftwegen ist der Kehldeckel Folie 2 Anatomie des Kehlkopfes Zungenbein Kehldeckel Ligamentum conicum Schildknorpel
1. Berechnungen im Zusammenhang mit Beobachtungen am Tier
 B. FACHRECHNEN 1. Berechnungen im Zusammenhang mit Beobachtungen am Tier 1.1 Atmung Begriffe: Atemfrequenz, Atemvolumen, Vitalkapazität der Lunge, Volumseinheiten Formeln: Atemminutenvolumen [ml / min]
B. FACHRECHNEN 1. Berechnungen im Zusammenhang mit Beobachtungen am Tier 1.1 Atmung Begriffe: Atemfrequenz, Atemvolumen, Vitalkapazität der Lunge, Volumseinheiten Formeln: Atemminutenvolumen [ml / min]
Physikalisches Praktikum I
 Fachbereich Physik Physikalisches Praktikum I W21 Name: Verdampfungswärme von Wasser Matrikelnummer: Fachrichtung: Mitarbeiter/in: Assistent/in: Versuchsdatum: Gruppennummer: Endtestat: Folgende Fragen
Fachbereich Physik Physikalisches Praktikum I W21 Name: Verdampfungswärme von Wasser Matrikelnummer: Fachrichtung: Mitarbeiter/in: Assistent/in: Versuchsdatum: Gruppennummer: Endtestat: Folgende Fragen
Physikalische Aspekte der Respiration
 Physikalische Aspekte der Respiration Christoph Hitzenberger Zentrum für Biomedizinische Technik und Physik Themenübersicht Physik der Gase o Ideale Gasgleichung o Atmosphärische Luft o Partialdruck Strömungsmechanik
Physikalische Aspekte der Respiration Christoph Hitzenberger Zentrum für Biomedizinische Technik und Physik Themenübersicht Physik der Gase o Ideale Gasgleichung o Atmosphärische Luft o Partialdruck Strömungsmechanik
Die Atmung. Die Atmung des Menschen. Die Atmung des Menschen
 Die Atmung Die Atmung ist ein lebenswichtiger Vorgang. Dabei wird der Körper mit Sauerstoff aus der eingeatmeten Luft versorgt. Den Sauerstoff benötigt der Körper zur lebenserhaltenden Energiegewinnung
Die Atmung Die Atmung ist ein lebenswichtiger Vorgang. Dabei wird der Körper mit Sauerstoff aus der eingeatmeten Luft versorgt. Den Sauerstoff benötigt der Körper zur lebenserhaltenden Energiegewinnung
AnC I Protokoll: 6.1 Extraktionsphotometrische Bestimmung von Cobalt mit HDEHP! SS Analytische Chemie I. Versuchsprotokoll
 Analytische Chemie I Versuchsprotokoll 6.1 Extraktionsphotometrische Bestimmung von Mikromengen an Cobalt mit Phosphorsäure-bis- (2-ethylhexylester) (HDEHP) 1.! Theoretischer Hintergrund Zur Analyse wird
Analytische Chemie I Versuchsprotokoll 6.1 Extraktionsphotometrische Bestimmung von Mikromengen an Cobalt mit Phosphorsäure-bis- (2-ethylhexylester) (HDEHP) 1.! Theoretischer Hintergrund Zur Analyse wird
Hausaufgaben: Spiroergometrie / Atmungsregulation
 SE G.K. Spiroergometrie / Atmungsregulation 5.7. Atemgastransport im Blut 5.8 Atmungsregulation 5.10 Säure-Basen-Gleichgewicht und Pufferung 6 Arbeits- und Leistungsphysiologie 8 Energie- und Wärmehaushalt
SE G.K. Spiroergometrie / Atmungsregulation 5.7. Atemgastransport im Blut 5.8 Atmungsregulation 5.10 Säure-Basen-Gleichgewicht und Pufferung 6 Arbeits- und Leistungsphysiologie 8 Energie- und Wärmehaushalt
2. Bestimmen Sie die Geschwindigkeitskonstante k der Rohrzuckerinversion in s -1.
 Versuchsanleitungen zum Praktikum Physikalische Chemie für Anfänger 1 A 33 Spezifische Drehung von gelöstem Rohrzucker - Rohrzuckerinversion Aufgabe: 1. Bestimmen Sie den Drehwinkel α für Rohrzucker für
Versuchsanleitungen zum Praktikum Physikalische Chemie für Anfänger 1 A 33 Spezifische Drehung von gelöstem Rohrzucker - Rohrzuckerinversion Aufgabe: 1. Bestimmen Sie den Drehwinkel α für Rohrzucker für
Protokoll zum Teil Sauerstoffbestimmung
 Übung Labormethoden Protokoll zum Teil Sauerstoffbestimmung Vereinfachtes Übungsprotokoll zu Demonstrationszwecken Inhaltsverzeichnis 1. EINLEITUNG...2 1.1 GASOMETRISCHE METHODE...2 2. MATERIAL UND METHODEN...3
Übung Labormethoden Protokoll zum Teil Sauerstoffbestimmung Vereinfachtes Übungsprotokoll zu Demonstrationszwecken Inhaltsverzeichnis 1. EINLEITUNG...2 1.1 GASOMETRISCHE METHODE...2 2. MATERIAL UND METHODEN...3
Atmung, Dissimilation
 Atmung, Dissimilation Peter Bützer Abbildung 1: Atmung Inhalt 1 Physiologisches... 1 2 Atmung, eine Reaktion 0. Ordnung... 2 3 Simulation... 2 4 Interpretation... 4 5 Mikroökologie im Zimmer... 4 6 Interpretation...
Atmung, Dissimilation Peter Bützer Abbildung 1: Atmung Inhalt 1 Physiologisches... 1 2 Atmung, eine Reaktion 0. Ordnung... 2 3 Simulation... 2 4 Interpretation... 4 5 Mikroökologie im Zimmer... 4 6 Interpretation...
Lösungen zu den Übungen zur Einführung in die Spektroskopie für Studenten der Biologie (SS 2011)
 Universität Konstanz Fachbereich Biologie Priv.-Doz. Dr. Jörg H. Kleinschmidt http://www.biologie.uni-konstanz.de/folding/home.html Datum: 26.5.211 Lösungen zu den Übungen zur Einführung in die Spektroskopie
Universität Konstanz Fachbereich Biologie Priv.-Doz. Dr. Jörg H. Kleinschmidt http://www.biologie.uni-konstanz.de/folding/home.html Datum: 26.5.211 Lösungen zu den Übungen zur Einführung in die Spektroskopie
Berechnung des Atemäquivalents für Sauerstoff Das Atemäquivalent gibt das Verhältnis von Ventilation und Sauerstoffaufnahme an.
 Aufgabe XII: UMSATZ und LEISTUNGSPHYSIOLOGIE (Indirekte Kalorimetrie und Ergometrie) HINWEIS: Zum Versuchsteil B "Ergometrie" sind in den Praktikumsgruppen spätestens am Vortag des Versuches geeignete
Aufgabe XII: UMSATZ und LEISTUNGSPHYSIOLOGIE (Indirekte Kalorimetrie und Ergometrie) HINWEIS: Zum Versuchsteil B "Ergometrie" sind in den Praktikumsgruppen spätestens am Vortag des Versuches geeignete
Seminar: Photometrie
 Seminar: Photometrie G. Reibnegger und W. Windischhofer (Teil II zum Thema Hauptgruppenelemente) Ziel des Seminars: Theoretische Basis der Photometrie Lambert-Beer sches Gesetz Rechenbeispiele Literatur:
Seminar: Photometrie G. Reibnegger und W. Windischhofer (Teil II zum Thema Hauptgruppenelemente) Ziel des Seminars: Theoretische Basis der Photometrie Lambert-Beer sches Gesetz Rechenbeispiele Literatur:
Kapitel 2.2 Kardiopulmonale Homöostase. Kohlendioxid
 Kapitel 2.2 Kardiopulmonale Homöostase Kohlendioxid Transport im Plasma Bei der Bildung von im Stoffwechsel ist sein Partialdruck höher als im Blut, diffundiert folglich ins Plasmawasser und löst sich
Kapitel 2.2 Kardiopulmonale Homöostase Kohlendioxid Transport im Plasma Bei der Bildung von im Stoffwechsel ist sein Partialdruck höher als im Blut, diffundiert folglich ins Plasmawasser und löst sich
Energiehaushalt. Cem Ekmekcioglu Valentin Leibetseder. Institut für Physiologie, MUW
 Energiehaushalt Cem Ekmekcioglu Valentin Leibetseder Institut für Physiologie, MUW Vorlesung unter: http://www.meduniwien.ac.at/umweltphysiologie/links.htm Energiehaushalt Die Energie im Organismus wird
Energiehaushalt Cem Ekmekcioglu Valentin Leibetseder Institut für Physiologie, MUW Vorlesung unter: http://www.meduniwien.ac.at/umweltphysiologie/links.htm Energiehaushalt Die Energie im Organismus wird
Vorlesung Medizin I. Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik TU Braunschweig INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE INFORMATIK
 Vorlesung Medizin I Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik TU Braunschweig Lunge und Atmung Übersicht 1. Anatomie der Atemwege und der Lunge a) obere Atemwege b) untere Atemwege c) spezielle
Vorlesung Medizin I Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik TU Braunschweig Lunge und Atmung Übersicht 1. Anatomie der Atemwege und der Lunge a) obere Atemwege b) untere Atemwege c) spezielle
Versuch HP 300. Modul II: KWK Wirkungsgradmessung BHKW Teststände. Dipl. Ing. (FH) Peter Pioch
 Modul II: KWK Wirkungsgradmessung BHKW Teststände Dipl. Ing. (FH) Peter Pioch 5.3.05 Weiterbildungszentrum für innovative Energietechnologien der Handwerkskammer Ulm (WBZU) ersuch HP 300 Quelle: WBZU Energieumwandlung
Modul II: KWK Wirkungsgradmessung BHKW Teststände Dipl. Ing. (FH) Peter Pioch 5.3.05 Weiterbildungszentrum für innovative Energietechnologien der Handwerkskammer Ulm (WBZU) ersuch HP 300 Quelle: WBZU Energieumwandlung
Dr. I. Fahrner WiSe 2016/17 Fakultät Grundlagen Hochschule Esslingen Übungsblatt 2. Statistik
 Dr. I. Fahrner WiSe 2016/17 Fakultät Grundlagen 6.10.2016 Hochschule Esslingen Übungsblatt 2 Statistik Stichworte: arithmetischer Mittelwert, empirische Varianz, empirische Standardabweichung, empirischer
Dr. I. Fahrner WiSe 2016/17 Fakultät Grundlagen 6.10.2016 Hochschule Esslingen Übungsblatt 2 Statistik Stichworte: arithmetischer Mittelwert, empirische Varianz, empirische Standardabweichung, empirischer
BAGEH FORUM Kinderreanimation paediatric life support. Dipl. Med. Raik Schäfer, Referent der medizinischen Leitung
 BAGEH FORUM 2006 Kinderreanimation paediatric life support Dipl. Med. Raik Schäfer, Referent der medizinischen Leitung Wiederbelebungs-Leitlinien 2006 PROBLEME Häufigkeit Schwierigkeit Ursachen respiratorisch
BAGEH FORUM 2006 Kinderreanimation paediatric life support Dipl. Med. Raik Schäfer, Referent der medizinischen Leitung Wiederbelebungs-Leitlinien 2006 PROBLEME Häufigkeit Schwierigkeit Ursachen respiratorisch
Kreislauf + EKG Versuchsprotokoll
 Name, Vorname:... Matr.Nr.:... Kreislauf EKG Versuchsprotokoll Diese WordDatei soll helfen, die Auswertung der Versuchsdaten zu strukturieren und zu erleichtern. Zu jedem Abschnitt finden Sie in roter
Name, Vorname:... Matr.Nr.:... Kreislauf EKG Versuchsprotokoll Diese WordDatei soll helfen, die Auswertung der Versuchsdaten zu strukturieren und zu erleichtern. Zu jedem Abschnitt finden Sie in roter
Lungenfunktionsteste. Dr. Birgit Becke Johanniter-Krankenhaus im Fläming GmbH Klinik III (Pneumologie)
 Lungenfunktionsteste Dr. Birgit Becke Johanniter-Krankenhaus im Fläming GmbH Klinik III (Pneumologie) Meßverfahren 1. einfache Methoden, geringer Aufwand - Peak Flow - Spirometrie - Blutgasanalyse 2. Methoden
Lungenfunktionsteste Dr. Birgit Becke Johanniter-Krankenhaus im Fläming GmbH Klinik III (Pneumologie) Meßverfahren 1. einfache Methoden, geringer Aufwand - Peak Flow - Spirometrie - Blutgasanalyse 2. Methoden
E1: Bestimmung der Dissoziationskonstante einer schwachen Säure durch Messung der elektrischen Leitfähigkeit der Elektrolytlösung
 Versuch E1/E2 1 Versuch E1/E2 E1: Bestimmung der Dissoziationskonstante einer schwachen Säure durch Messung der elektrischen Leitfähigkeit der Elektrolytlösung E2: Konduktometrische Titration I Aufgabenstellung
Versuch E1/E2 1 Versuch E1/E2 E1: Bestimmung der Dissoziationskonstante einer schwachen Säure durch Messung der elektrischen Leitfähigkeit der Elektrolytlösung E2: Konduktometrische Titration I Aufgabenstellung
Praktikum Physik. Protokoll zum Versuch 1: Viskosität. Durchgeführt am 26.01.2012. Gruppe X
 Praktikum Physik Protokoll zum Versuch 1: Viskosität Durchgeführt am 26.01.2012 Gruppe X Name 1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuerin: Wir bestätigen hiermit, dass wir das Protokoll
Praktikum Physik Protokoll zum Versuch 1: Viskosität Durchgeführt am 26.01.2012 Gruppe X Name 1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuerin: Wir bestätigen hiermit, dass wir das Protokoll
Protokoll Grundpraktikum I: T6 Thermoelement und newtonsches Abkühlungsgesetz
 Protokoll Grundpraktikum I: T6 Thermoelement und newtonsches Abkühlungsgesetz Sebastian Pfitzner 5. Juni 03 Durchführung: Sebastian Pfitzner (553983), Anna Andrle (55077) Arbeitsplatz: Platz 3 Betreuer:
Protokoll Grundpraktikum I: T6 Thermoelement und newtonsches Abkühlungsgesetz Sebastian Pfitzner 5. Juni 03 Durchführung: Sebastian Pfitzner (553983), Anna Andrle (55077) Arbeitsplatz: Platz 3 Betreuer:
Arbeitsweisen der Physik
 Übersicht Karteikarten Klasse 7 - Arbeitsweisen - Beobachten - Beschreiben - Beschreiben von Gegenständen, Erscheinungen und Prozessen - Beschreiben des Aufbaus und Erklären der Wirkungsweise eines technischen
Übersicht Karteikarten Klasse 7 - Arbeitsweisen - Beobachten - Beschreiben - Beschreiben von Gegenständen, Erscheinungen und Prozessen - Beschreiben des Aufbaus und Erklären der Wirkungsweise eines technischen
Aufgabe: Untersuchung der Kinetik der Zersetzung von Harnstoff durch Urease.
 A 36 Michaelis-Menten-Kinetik: Hydrolyse von Harnstoff Aufgabe: Untersuchung der Kinetik der Zersetzung von Harnstoff durch Urease. Grundlagen: a) Michaelis-Menten-Kinetik Im Bereich der Biochemie spielen
A 36 Michaelis-Menten-Kinetik: Hydrolyse von Harnstoff Aufgabe: Untersuchung der Kinetik der Zersetzung von Harnstoff durch Urease. Grundlagen: a) Michaelis-Menten-Kinetik Im Bereich der Biochemie spielen
Höhenphysiologische Grundlagen
 Höhenphysiologische Grundlagen LERTWARTEAUSBILDUNG FÜR KLETTERN-ALPIN 2008 Physikalische Veränderungen in der Höhe (1) Temperatur Strahlung Luftdruck Sauerstoffteildruck Dr. Martin Faulhaber Physikalische
Höhenphysiologische Grundlagen LERTWARTEAUSBILDUNG FÜR KLETTERN-ALPIN 2008 Physikalische Veränderungen in der Höhe (1) Temperatur Strahlung Luftdruck Sauerstoffteildruck Dr. Martin Faulhaber Physikalische
Zuordnungen. 2 x g: y = x + 2 h: y = x 1 4
 Zuordnungen Bei Zuordnungen wird jedem vorgegebenen Wert aus einem Bereich ein Wert aus einem anderen Bereich zugeordnet. Zuordnungen können z.b. durch Wertetabellen, Diagramme oder Rechenvorschriften
Zuordnungen Bei Zuordnungen wird jedem vorgegebenen Wert aus einem Bereich ein Wert aus einem anderen Bereich zugeordnet. Zuordnungen können z.b. durch Wertetabellen, Diagramme oder Rechenvorschriften
Versuchsanleitung. Einleitung. Benötigtes Material. Seite 1 von 14
 Versuchsanleitung Spektrometische Bestimmung der Konzentration von Lösungen mit dem ipad (Lambert-Beersches Gesetz) [ VAD_Physik_Beers_Gesetz.doc ] Einleitung Der folgende Versuch zeigt eine einfache Möglichkeit
Versuchsanleitung Spektrometische Bestimmung der Konzentration von Lösungen mit dem ipad (Lambert-Beersches Gesetz) [ VAD_Physik_Beers_Gesetz.doc ] Einleitung Der folgende Versuch zeigt eine einfache Möglichkeit
Dichteanomalie von Wasser
 Prinzip Die Veränderung der Dichte von Wasser bei Änderung der Temperatur lässt sich mit einfachen Mitteln messen. Dazu wird die Volumenänderung in Abhängigkeit von der Temperatur gemessen. Die Daten werden
Prinzip Die Veränderung der Dichte von Wasser bei Änderung der Temperatur lässt sich mit einfachen Mitteln messen. Dazu wird die Volumenänderung in Abhängigkeit von der Temperatur gemessen. Die Daten werden
Die Atmung des Menschen
 Eine Powerpoint Presentation von: Erwin Haigis Die Atmung ist ein lebenswichtiger Vorgang. Dabei wird der Körper K mit Sauerstoff aus der eingeatmeten Luft versorgt. Den Sauerstoff benötigt der Körper
Eine Powerpoint Presentation von: Erwin Haigis Die Atmung ist ein lebenswichtiger Vorgang. Dabei wird der Körper K mit Sauerstoff aus der eingeatmeten Luft versorgt. Den Sauerstoff benötigt der Körper
ARBEITSBLATT STUDIUM EINFACHER BEWEGUNGEN
 ARBEITSBLATT STUDIUM EINFACHER BEWEGUNGEN FREIER FALL NAME:.. KLASSE:.. DATUM:. Verwendete die Simulation: http://www.walter-fendt.de/ph14d/wurf.htm Wir untersuchen zum freien Fall folgende Fragestellungen:
ARBEITSBLATT STUDIUM EINFACHER BEWEGUNGEN FREIER FALL NAME:.. KLASSE:.. DATUM:. Verwendete die Simulation: http://www.walter-fendt.de/ph14d/wurf.htm Wir untersuchen zum freien Fall folgende Fragestellungen:
Standardabweichung und Variationskoeffizient. Themen. Prinzip. Material TEAS Qualitätskontrolle, Standardabweichung, Variationskoeffizient.
 Standardabweichung und TEAS Themen Qualitätskontrolle, Standardabweichung,. Prinzip Die Standardabweichung gibt an, wie hoch die Streuung der Messwerte um den eigenen Mittelwert ist. Sie ist eine statistische
Standardabweichung und TEAS Themen Qualitätskontrolle, Standardabweichung,. Prinzip Die Standardabweichung gibt an, wie hoch die Streuung der Messwerte um den eigenen Mittelwert ist. Sie ist eine statistische
TRAININGSLEHRE. IMSB-Austria 1
 TRAININGSLEHRE KONDITION TECHNIK ERNÄHRUNG KONSTITUTION PSYCHE TAKTIK IMSB-Austria 1 TRAININGSLEHRE AUSDAUER KRAFT BEWEGLICHKEIT SCHNELLIGKEIT IMSB-Austria 2 TRAININGSLEHRE KOORDINATION IMSB-Austria 3
TRAININGSLEHRE KONDITION TECHNIK ERNÄHRUNG KONSTITUTION PSYCHE TAKTIK IMSB-Austria 1 TRAININGSLEHRE AUSDAUER KRAFT BEWEGLICHKEIT SCHNELLIGKEIT IMSB-Austria 2 TRAININGSLEHRE KOORDINATION IMSB-Austria 3
Der Gesamtdruck eines Gasgemisches ist gleich der Summe der Partialdrücke. p [mbar, hpa] = p N2 + p O2 + p Ar +...
![Der Gesamtdruck eines Gasgemisches ist gleich der Summe der Partialdrücke. p [mbar, hpa] = p N2 + p O2 + p Ar +... Der Gesamtdruck eines Gasgemisches ist gleich der Summe der Partialdrücke. p [mbar, hpa] = p N2 + p O2 + p Ar +...](/thumbs/25/5798672.jpg) Theorie FeucF euchtemessung Das Gesetz von v Dalton Luft ist ein Gemisch aus verschiedenen Gasen. Bei normalen Umgebungsbedingungen verhalten sich die Gase ideal, das heißt die Gasmoleküle stehen in keiner
Theorie FeucF euchtemessung Das Gesetz von v Dalton Luft ist ein Gemisch aus verschiedenen Gasen. Bei normalen Umgebungsbedingungen verhalten sich die Gase ideal, das heißt die Gasmoleküle stehen in keiner
Der Ganzkörperplethysmograph / Bodyplethysmograph, Eine Anwendung des Boyle-Mariotte-Gesetzes
 Der Ganzkörperplethysmograph / Bodyplethysmograph, Eine Anwendung des Boyle-Mariotte-Gesetzes C. Stick Der Bodyplethysmograph ist ein Gerät zur Messung von atemphysiologischen Größen, die der direkten
Der Ganzkörperplethysmograph / Bodyplethysmograph, Eine Anwendung des Boyle-Mariotte-Gesetzes C. Stick Der Bodyplethysmograph ist ein Gerät zur Messung von atemphysiologischen Größen, die der direkten
Atemreiz und Schwimmbad-Blackout
 Thema: Atemreiz und Schwimmbad-Blackout Zielgruppe: Medizinisch interessierte Taucher Referent: Martijn Damen, TL1 Tauchsportklub Erlangen e.v. http://www.tske.de 1 Agenda Atemzentrum Steuerung der Atmung
Thema: Atemreiz und Schwimmbad-Blackout Zielgruppe: Medizinisch interessierte Taucher Referent: Martijn Damen, TL1 Tauchsportklub Erlangen e.v. http://www.tske.de 1 Agenda Atemzentrum Steuerung der Atmung
Produktionsergonomie
 Übungen zur Vorlesung Produktionsergonomie Versuch 2: Ergometer (Stand 6/2010) Betreuer: Herr STERR (Tel. -3972) Raum R0.093 Verantwortlich: Prof. Dr. Kurz (Tel. -3934) Raum R5.016 Video-Podcasts Ergometer
Übungen zur Vorlesung Produktionsergonomie Versuch 2: Ergometer (Stand 6/2010) Betreuer: Herr STERR (Tel. -3972) Raum R0.093 Verantwortlich: Prof. Dr. Kurz (Tel. -3934) Raum R5.016 Video-Podcasts Ergometer
Praktikum Physik. Protokoll zum Versuch 4: Schallwellen. Durchgeführt am Gruppe X
 Praktikum Physik Protokoll zum Versuch 4: Schallwellen Durchgeführt am 03.11.2011 Gruppe X Name 1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuer: Wir bestätigen hiermit, dass wir das Protokoll
Praktikum Physik Protokoll zum Versuch 4: Schallwellen Durchgeführt am 03.11.2011 Gruppe X Name 1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuer: Wir bestätigen hiermit, dass wir das Protokoll
Physik für Mediziner und Zahnmediziner
 Physik für Mediziner und Zahnmediziner Vorlesung 21 Prof. F. Wörgötter (nach M. Seibt) -- Physik für Mediziner und Zahnmediziner 1 Gase (insbesondere: im Körper) aus: Klinke/Silbernagel: Lehrbuch der Physiologie
Physik für Mediziner und Zahnmediziner Vorlesung 21 Prof. F. Wörgötter (nach M. Seibt) -- Physik für Mediziner und Zahnmediziner 1 Gase (insbesondere: im Körper) aus: Klinke/Silbernagel: Lehrbuch der Physiologie
HYGROMETRIE. Im Folgenden werden vier unterschiedliche Verfahren zur Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit vorgestellt. 1.
 Versuch 7/1 HYGROMETRIE 04.06.2012 Blatt 1 HYGROMETRIE Im Folgenden werden vier unterschiedliche Verfahren zur Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit vorgestellt. 1. Grundbegriffe Die Luftfeuchtigkeit
Versuch 7/1 HYGROMETRIE 04.06.2012 Blatt 1 HYGROMETRIE Im Folgenden werden vier unterschiedliche Verfahren zur Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit vorgestellt. 1. Grundbegriffe Die Luftfeuchtigkeit
Immer alles im Blick. Ihr COPD-Pass.
 Immer alles im Blick Ihr COPD-Pass. Liebes Mitglied, COPD ist eine ernste und nach dem derzeitigen Stand der Forschung nicht heilbare Erkrankung der Atemwege. COPD-Patienten müssen häufig viele Einschränkungen
Immer alles im Blick Ihr COPD-Pass. Liebes Mitglied, COPD ist eine ernste und nach dem derzeitigen Stand der Forschung nicht heilbare Erkrankung der Atemwege. COPD-Patienten müssen häufig viele Einschränkungen
Zentralabitur 2011 Physik Schülermaterial Aufgabe I ga Bearbeitungszeit: 220 min
 Thema: Eigenschaften von Licht Gegenstand der Aufgabe 1 ist die Untersuchung von Licht nach Durchlaufen von Luft bzw. Wasser mit Hilfe eines optischen Gitters. Während in der Aufgabe 2 der äußere lichtelektrische
Thema: Eigenschaften von Licht Gegenstand der Aufgabe 1 ist die Untersuchung von Licht nach Durchlaufen von Luft bzw. Wasser mit Hilfe eines optischen Gitters. Während in der Aufgabe 2 der äußere lichtelektrische
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Biologie in Experimenten nach Themen der Rahmenrichtlinien
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Biologie in Experimenten nach Themen der Rahmenrichtlinien Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Biologie
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Biologie in Experimenten nach Themen der Rahmenrichtlinien Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Biologie
1 Atmosphäre (atm) = 760 torr = 1013,25 mbar = Pa 760 mm Hg ( bei 0 0 C, g = 9,80665 m s -2 )
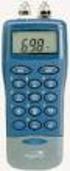 Versuch Nr.51 Druck-Messung in Gasen (Bestimmung eines Gasvolumens) Stichworte: Druck, Druckeinheiten, Druckmeßgeräte (Manometer, Vakuummeter), Druckmessung in U-Rohr-Manometern, Gasgesetze, Isothermen
Versuch Nr.51 Druck-Messung in Gasen (Bestimmung eines Gasvolumens) Stichworte: Druck, Druckeinheiten, Druckmeßgeräte (Manometer, Vakuummeter), Druckmessung in U-Rohr-Manometern, Gasgesetze, Isothermen
Laborpraktikum Grundlagen der Umwelttechnik II
 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig Maschinenbau und Energietechnik Versuchstag: Brennstoff- und Umweltlabor Bearbeiter: Prof. Dr.-Ing. J. Schenk Dipl.- Chem. Dorn Namen: Seminargruppe:
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig Maschinenbau und Energietechnik Versuchstag: Brennstoff- und Umweltlabor Bearbeiter: Prof. Dr.-Ing. J. Schenk Dipl.- Chem. Dorn Namen: Seminargruppe:
Übung 3. Ziel: Bedeutung/Umgang innere Energie U und Enthalpie H verstehen (Teil 2) Verständnis des thermodynamischen Gleichgewichts
 Ziel: Bedeutung/Umgang innere Energie U und Enthalpie H verstehen (Teil 2) adiabatische Flammentemperatur Verständnis des thermodynamischen Gleichgewichts Definition von K X, K c, K p Berechnung von K
Ziel: Bedeutung/Umgang innere Energie U und Enthalpie H verstehen (Teil 2) adiabatische Flammentemperatur Verständnis des thermodynamischen Gleichgewichts Definition von K X, K c, K p Berechnung von K
Bluthochdruck. Inhaltverzeichnis
 Bluthochdruck Inhaltverzeichnis Definition des Blutdrucks Technik der Blutdruckmessung - Direkte Blutdruckmessung - Indirekte Blutduckmessung Wann spricht man von Bluthochdruck? Wodurch entsteht Bluthochdruck?
Bluthochdruck Inhaltverzeichnis Definition des Blutdrucks Technik der Blutdruckmessung - Direkte Blutdruckmessung - Indirekte Blutduckmessung Wann spricht man von Bluthochdruck? Wodurch entsteht Bluthochdruck?
Versuchsprotokoll Kapitel 6
 Versuchsprotokoll Kapitel 6 Felix, Sebastian, Tobias, Raphael, Joel 1. Semester 21 Inhaltsverzeichnis Einleitung...3 Versuch 6.1...3 Einwaagen und Herstellung der Verdünnungen...3 Photospektrometrisches
Versuchsprotokoll Kapitel 6 Felix, Sebastian, Tobias, Raphael, Joel 1. Semester 21 Inhaltsverzeichnis Einleitung...3 Versuch 6.1...3 Einwaagen und Herstellung der Verdünnungen...3 Photospektrometrisches
Versuch V1 - Viskosität, Flammpunkt, Dichte
 Versuch V1 - Viskosität, Flammpunkt, Dichte 1.1 Bestimmung der Viskosität Grundlagen Die Viskosität eines Fluids ist eine Stoffeigenschaft, die durch den molekularen Impulsaustausch der einzelnen Fluidpartikel
Versuch V1 - Viskosität, Flammpunkt, Dichte 1.1 Bestimmung der Viskosität Grundlagen Die Viskosität eines Fluids ist eine Stoffeigenschaft, die durch den molekularen Impulsaustausch der einzelnen Fluidpartikel
Sauerstoffbindung im Blut
 Sauerstoffbindung im Blut Die Fähigkeit uns zu wundern, ist das Einzige, was wir brauchen, um gute Philosophen zu werden. Gaarder Jostein, Sofies Welt 1 Inhalt 1 Einleitung/Theorie... 1 2 Aufgabenstellung...
Sauerstoffbindung im Blut Die Fähigkeit uns zu wundern, ist das Einzige, was wir brauchen, um gute Philosophen zu werden. Gaarder Jostein, Sofies Welt 1 Inhalt 1 Einleitung/Theorie... 1 2 Aufgabenstellung...
Basiskenntnistest - Physik
 Basiskenntnistest - Physik 1.) Welche der folgenden Einheiten ist keine Basiseinheit des Internationalen Einheitensystems? a. ) Kilogramm b. ) Sekunde c. ) Kelvin d. ) Volt e. ) Candela 2.) Die Schallgeschwindigkeit
Basiskenntnistest - Physik 1.) Welche der folgenden Einheiten ist keine Basiseinheit des Internationalen Einheitensystems? a. ) Kilogramm b. ) Sekunde c. ) Kelvin d. ) Volt e. ) Candela 2.) Die Schallgeschwindigkeit
Identifizierung des Farbstoffes in blauen M&Ms durch Dünnschichtchromatographie
 Name Datum Identifizierung des Farbstoffes in blauen M&Ms durch Dünnschichtchromatographie Material: DC-Karten (Kieselgel), Glas mit Deckel(DC-Kammer), Kapillare, Messzylinder Chemikalien: Blaue M&Ms,
Name Datum Identifizierung des Farbstoffes in blauen M&Ms durch Dünnschichtchromatographie Material: DC-Karten (Kieselgel), Glas mit Deckel(DC-Kammer), Kapillare, Messzylinder Chemikalien: Blaue M&Ms,
Gasthermometer. durchgeführt am von Matthias Dräger, Alexander Narweleit und Fabian Pirzer
 Gasthermometer 1 PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN durchgeführt am 21.06.2010 von Matthias Dräger, Alexander Narweleit und Fabian Pirzer 1 Physikalische Grundlagen 1.1 Zustandgleichung des idealen Gases Ein ideales
Gasthermometer 1 PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN durchgeführt am 21.06.2010 von Matthias Dräger, Alexander Narweleit und Fabian Pirzer 1 Physikalische Grundlagen 1.1 Zustandgleichung des idealen Gases Ein ideales
Che1 P / CheU P Praktikum Allgemeine und Anorganische Chemie. Gasmessung. 15. September 2008
 15. September 2008 1 1 Aufgabe und Lernziele... 3 2 Vorbereitung... 3 3 Einführung... 4 3.1 Grundlagen... 4 3.1.1Kohlenstoffdioxid... 4 3.2.2 Luftuntersuchungen mit Prüfröhrchen... 4 4 Praxis... 5 4.1
15. September 2008 1 1 Aufgabe und Lernziele... 3 2 Vorbereitung... 3 3 Einführung... 4 3.1 Grundlagen... 4 3.1.1Kohlenstoffdioxid... 4 3.2.2 Luftuntersuchungen mit Prüfröhrchen... 4 4 Praxis... 5 4.1
Dampfdruck von Flüssigkeiten (Clausius-Clapeyron' sche Gleichung)
 Versuch Nr. 57 Dampfdruck von Flüssigkeiten (Clausius-Clapeyron' sche Gleichung) Stichworte: Dampf, Dampfdruck von Flüssigkeiten, dynamisches Gleichgewicht, gesättigter Dampf, Verdampfungsenthalpie, Dampfdruckkurve,
Versuch Nr. 57 Dampfdruck von Flüssigkeiten (Clausius-Clapeyron' sche Gleichung) Stichworte: Dampf, Dampfdruck von Flüssigkeiten, dynamisches Gleichgewicht, gesättigter Dampf, Verdampfungsenthalpie, Dampfdruckkurve,
Versuch 3: Säure-Base Titrationen Chemieteil, Herbstsemester 2008
 Versuch 3: Säure-Base Titrationen Chemieteil, Herbstsemester 2008 Verfasser: Zihlmann Claudio Teammitglied: Knüsel Philippe Datum: 29.10.08 Assistent: David Weibel E-Mail: zclaudio@student.ethz.ch 1. Abstract
Versuch 3: Säure-Base Titrationen Chemieteil, Herbstsemester 2008 Verfasser: Zihlmann Claudio Teammitglied: Knüsel Philippe Datum: 29.10.08 Assistent: David Weibel E-Mail: zclaudio@student.ethz.ch 1. Abstract
Biochemische Labormethoden
 Biochemische Labormethoden, Seite 1 Biochemische Labormethoden Einführung Mit den Versuchen an diesem ersten Praktikumstag sollen Sie wichtige Methoden wiederholen bzw. ergänzen, die Sie bereits im Chemischen
Biochemische Labormethoden, Seite 1 Biochemische Labormethoden Einführung Mit den Versuchen an diesem ersten Praktikumstag sollen Sie wichtige Methoden wiederholen bzw. ergänzen, die Sie bereits im Chemischen
LF - Leitfähigkeit / Überführung
 Verfasser: Matthias Ernst, Tobias Schabel Gruppe: A 11 Betreuer: G. Heusel Datum: 18.11.2005 Aufgabenstellung LF - Leitfähigkeit / Überführung 1) Es sind die Leitfähigkeiten von zwei unbekanten Elektrolyten
Verfasser: Matthias Ernst, Tobias Schabel Gruppe: A 11 Betreuer: G. Heusel Datum: 18.11.2005 Aufgabenstellung LF - Leitfähigkeit / Überführung 1) Es sind die Leitfähigkeiten von zwei unbekanten Elektrolyten
Physiologische Werte
 Physiologische Werte FiO 2 der Einatemluft = 21% O 2 Zufuhr, CO 2 Elimination Atemantrieb über CO 2 O 2 Gehalt abhg FiO 2 + Lungenzustand Hyperkapnie führt Azidose u. Bewusstseinsstörungen 1 Kleines Vokabular
Physiologische Werte FiO 2 der Einatemluft = 21% O 2 Zufuhr, CO 2 Elimination Atemantrieb über CO 2 O 2 Gehalt abhg FiO 2 + Lungenzustand Hyperkapnie führt Azidose u. Bewusstseinsstörungen 1 Kleines Vokabular
Ausbildung Atemschutzgerätetr
 Ausbildung Atemschutzgerätetr teträger Kapitel PG - - Karsten Mayer + Wolfgang van Balsfort Fachbereich Atemschutz KölnK Stand: 05/2004 - Seite PG 1 Die Atmung Unter Atmung versteht man den Sauerstofftransport
Ausbildung Atemschutzgerätetr teträger Kapitel PG - - Karsten Mayer + Wolfgang van Balsfort Fachbereich Atemschutz KölnK Stand: 05/2004 - Seite PG 1 Die Atmung Unter Atmung versteht man den Sauerstofftransport
6.1.1 Intraoperative Beatmung
 Anästhesieverfahren Allgemeiner Teil 6.1.1 6.1.1 Intraoperative Beatmung F.M. KonRAD und J. REUTERshAn Weltweit werden jährlich derzeit etwa 220 Millionen Allgemeinanästhesien durchgeführt. Bei jedem Patienten,
Anästhesieverfahren Allgemeiner Teil 6.1.1 6.1.1 Intraoperative Beatmung F.M. KonRAD und J. REUTERshAn Weltweit werden jährlich derzeit etwa 220 Millionen Allgemeinanästhesien durchgeführt. Bei jedem Patienten,
Diffusionskapazität UNIVERSITÄT DES SAARLANDES. Indikation, Durchführung, Messergebnisse für MTAF-Schule. Jung R. 28. Juni 2013
 Indikation, Durchführung, Messergebnisse für MTAF-Schule Jung R. Institut für Arbeitsmedizin der UNIVERSITÄT DES SAARLANDES 28. Juni 2013 CO Diffusion Definition Die der Lunge, TLCOSB, ist definiert als
Indikation, Durchführung, Messergebnisse für MTAF-Schule Jung R. Institut für Arbeitsmedizin der UNIVERSITÄT DES SAARLANDES 28. Juni 2013 CO Diffusion Definition Die der Lunge, TLCOSB, ist definiert als
EnzymeLab.
 Das Enzyme Lab ist ein virtuelles Labor in dem enzymatische Reaktionen getestet werden können. Dem Benutzer sollen hier in einfacher Form Prinzipien der Enzymkinetik und die experimentelle Laborarbeit
Das Enzyme Lab ist ein virtuelles Labor in dem enzymatische Reaktionen getestet werden können. Dem Benutzer sollen hier in einfacher Form Prinzipien der Enzymkinetik und die experimentelle Laborarbeit
3. Hämoglobin-Screening bei Blutspendern Spezielle Fragestellung
 3. Hämoglobin-Screening bei Blutspendern 3.1. Spezielle Fragestellung Eine Messung der Hämoglobin-Konzentration ist als Tauglichkeitsuntersuchung vor jeder freiwilligen Blutspende vorgeschrieben. Bei Unterschreiten
3. Hämoglobin-Screening bei Blutspendern 3.1. Spezielle Fragestellung Eine Messung der Hämoglobin-Konzentration ist als Tauglichkeitsuntersuchung vor jeder freiwilligen Blutspende vorgeschrieben. Bei Unterschreiten
Versuch 03: Enzyme. Bestimmung der Serum-Acetylcholinesterase Aktivität: 1. Bestimmung der Acetylcholinesterase-Aktivität
 Versuch 03: Enzyme Lactatdehydrogenase I. Der optische Test: Bestimmung von Pyruvat Acetylcholinesterase II. Bestimmung der Serum-Acetylcholinesterase Aktivität: 1. Bestimmung der Acetylcholinesterase-Aktivität
Versuch 03: Enzyme Lactatdehydrogenase I. Der optische Test: Bestimmung von Pyruvat Acetylcholinesterase II. Bestimmung der Serum-Acetylcholinesterase Aktivität: 1. Bestimmung der Acetylcholinesterase-Aktivität
Handout Die Atmung. Anatomie
 Handout Die Atmung Anatomie Obere Atemwege Zu den oberen Atemwegen zählen die Nase, der Mund und der Rachenraum. Die Trennung zu den unteren Atemwegen gilt der Kehlkopf und dort genauer die Stimmritze.
Handout Die Atmung Anatomie Obere Atemwege Zu den oberen Atemwegen zählen die Nase, der Mund und der Rachenraum. Die Trennung zu den unteren Atemwegen gilt der Kehlkopf und dort genauer die Stimmritze.
K1: Lambert-Beer`sches Gesetz
 K1: Lambert-Beer`sches Gesetz Einleitung In diesem Versuch soll die Entfärbung von Kristallviolett durch atronlauge mittels der Absorptionsspektroskopie untersucht werden. Sowohl die Reaktionskinetik als
K1: Lambert-Beer`sches Gesetz Einleitung In diesem Versuch soll die Entfärbung von Kristallviolett durch atronlauge mittels der Absorptionsspektroskopie untersucht werden. Sowohl die Reaktionskinetik als
Pflichtaufgaben. Die geradlinige Bewegung eines PKW ist durch folgende Zeit-Geschwindigkeit- Messwertpaare beschrieben.
 Abitur 2002 Physik Gk Seite 3 Pflichtaufgaben (24 BE) Aufgabe P1 Mechanik Die geradlinige Bewegung eines PKW ist durch folgende Zeit-Geschwindigkeit- Messwertpaare beschrieben. t in s 0 7 37 40 100 v in
Abitur 2002 Physik Gk Seite 3 Pflichtaufgaben (24 BE) Aufgabe P1 Mechanik Die geradlinige Bewegung eines PKW ist durch folgende Zeit-Geschwindigkeit- Messwertpaare beschrieben. t in s 0 7 37 40 100 v in
Abiturprüfung Physik, Leistungskurs. Aufgabe: Anregung von Vanadium und Silber durch Neutronen
 Seite 1 von 6 Abiturprüfung 2013 Physik, Leistungskurs Aufgabenstellung: Aufgabe: Anregung von Vanadium und Silber durch Neutronen Vanadium besteht in der Natur zu 99,75 % aus dem stabilen Isotop 51 23
Seite 1 von 6 Abiturprüfung 2013 Physik, Leistungskurs Aufgabenstellung: Aufgabe: Anregung von Vanadium und Silber durch Neutronen Vanadium besteht in der Natur zu 99,75 % aus dem stabilen Isotop 51 23
W2 Gasthermometer. 1. Grundlagen: 1.1 Gasthermometer und Temperaturmessung
 W2 Gasthermometer Stoffgebiet: Versuchsziel: Literatur: emperaturmessung, Gasthermometer, Gasgesetze Mit Hilfe eines Gasthermometers ist der Ausdehnungs- und Druckkoeffizient von Luft zu bestimmen. Beschäftigung
W2 Gasthermometer Stoffgebiet: Versuchsziel: Literatur: emperaturmessung, Gasthermometer, Gasgesetze Mit Hilfe eines Gasthermometers ist der Ausdehnungs- und Druckkoeffizient von Luft zu bestimmen. Beschäftigung
a) Welche der folgenden Aussagen treffen nicht zu? (Dies bezieht sind nur auf Aufgabenteil a)
 Aufgabe 1: Multiple Choice (10P) Geben Sie an, welche der Aussagen richtig sind. Unabhängig von der Form der Fragestellung (Singular oder Plural) können eine oder mehrere Antworten richtig sein. a) Welche
Aufgabe 1: Multiple Choice (10P) Geben Sie an, welche der Aussagen richtig sind. Unabhängig von der Form der Fragestellung (Singular oder Plural) können eine oder mehrere Antworten richtig sein. a) Welche
Praktische Einführung in die Chemie Integriertes Praktikum:
 Praktische Einführung in die Chemie Integriertes Praktikum: Versuch 1-1 (ABS) Optische Absorptionsspektroskopie Versuchs-Datum: 13. Juni 2012 Gruppenummer: 8 Gruppenmitgieder: Domenico Paone Patrick Küssner
Praktische Einführung in die Chemie Integriertes Praktikum: Versuch 1-1 (ABS) Optische Absorptionsspektroskopie Versuchs-Datum: 13. Juni 2012 Gruppenummer: 8 Gruppenmitgieder: Domenico Paone Patrick Küssner
Elektrolytische Leitfähigkeit
 Elektrolytische Leitfähigkeit 1 Elektrolytische Leitfähigkeit Gegenstand dieses Versuches ist der Zusammenhang der elektrolytischen Leitfähigkeit starker und schwacher Elektrolyten mit deren Konzentration.
Elektrolytische Leitfähigkeit 1 Elektrolytische Leitfähigkeit Gegenstand dieses Versuches ist der Zusammenhang der elektrolytischen Leitfähigkeit starker und schwacher Elektrolyten mit deren Konzentration.
Atmungsphysiologie II.
 Atmungsphysiologie II. 29. Gasaustausch in der Lunge. 30. Sauerstofftransport im Blut. 31. Kohlendioxidtransport im Blut. prof. Gyula Sáry Gasaustausch in der Lunge Gasdiffusion findet durch die Kapillarmembrane
Atmungsphysiologie II. 29. Gasaustausch in der Lunge. 30. Sauerstofftransport im Blut. 31. Kohlendioxidtransport im Blut. prof. Gyula Sáry Gasaustausch in der Lunge Gasdiffusion findet durch die Kapillarmembrane
Interpretation. Kapitel 4. Kasuistik 1 (1)
 Kapitel 4 Interpretation Kasuistik 1 (1) In der Notaufnahme werden Sie zu einem älteren Herrn gerufen, den seine Tochter gerade wegen Atemnot ins Krankenhaus gebracht hat. Anamnestisch ist ein chronischer
Kapitel 4 Interpretation Kasuistik 1 (1) In der Notaufnahme werden Sie zu einem älteren Herrn gerufen, den seine Tochter gerade wegen Atemnot ins Krankenhaus gebracht hat. Anamnestisch ist ein chronischer
Verwandte Begriffe Maxwell-Gleichungen, elektrisches Wirbelfeld, Magnetfeld von Spulen, magnetischer Fluss, induzierte Spannung.
 Verwandte Begriffe Maxwell-Gleichungen, elektrisches Wirbelfeld, Magnetfeld von Spulen, magnetischer Fluss, induzierte Spannung. Prinzip In einer langen Spule wird ein Magnetfeld mit variabler Frequenz
Verwandte Begriffe Maxwell-Gleichungen, elektrisches Wirbelfeld, Magnetfeld von Spulen, magnetischer Fluss, induzierte Spannung. Prinzip In einer langen Spule wird ein Magnetfeld mit variabler Frequenz
Versuchsprotokoll: Aminosäure- und Proteinbestimmung
 Versuchsprotokoll: Aminosäure- und Proteinbestimmung a) Proteinbestimmung mit Biuret-Reagenz 1.1. Einleitung Das Ziel des Versuchs ist es nach Aufstellen einer Eichgerade mit gegeben Konzentrationen, die
Versuchsprotokoll: Aminosäure- und Proteinbestimmung a) Proteinbestimmung mit Biuret-Reagenz 1.1. Einleitung Das Ziel des Versuchs ist es nach Aufstellen einer Eichgerade mit gegeben Konzentrationen, die
Reaktorvergleich mittels Verweilzeitverteilung
 Reaktorvergleich mittels Verweilzeitverteilung Bericht für das Praktikum Chemieingenieurwesen I WS06/07 Studenten: Francisco José Guerra Millán fguerram@student.ethz.ch Andrea Michel michela@student.ethz.ch
Reaktorvergleich mittels Verweilzeitverteilung Bericht für das Praktikum Chemieingenieurwesen I WS06/07 Studenten: Francisco José Guerra Millán fguerram@student.ethz.ch Andrea Michel michela@student.ethz.ch
NICHTINVASIVE MESSUNG DES DES PERIPHEREN SAUERSTOFFVERBRAUCHS PÄDIATRISCHER PATIENTEN NACH HERZ-CHIRURGISCHEN EINGRIFFEN
 NICHTINVASIVE MESSUNG DES DES PERIPHEREN SAUERSTOFFVERBRAUCHS PÄDIATRISCHER PATIENTEN NACH HERZ-CHIRURGISCHEN EINGRIFFEN J. Gehrmann, Th. Brune, D. Kececioglu*, G. Jorch, J. Vogt* Zentrum für Kinderheilkunde,
NICHTINVASIVE MESSUNG DES DES PERIPHEREN SAUERSTOFFVERBRAUCHS PÄDIATRISCHER PATIENTEN NACH HERZ-CHIRURGISCHEN EINGRIFFEN J. Gehrmann, Th. Brune, D. Kececioglu*, G. Jorch, J. Vogt* Zentrum für Kinderheilkunde,
Exemplar für Prüfer/innen
 Exemplar für Prüfer/innen Kompensationsprüfung zur standardisierten kompetenzorientierten schriftlichen Reifeprüfung AHS Juni 2015 Mathematik Kompensationsprüfung Angabe für Prüfer/innen Hinweise zur Kompensationsprüfung
Exemplar für Prüfer/innen Kompensationsprüfung zur standardisierten kompetenzorientierten schriftlichen Reifeprüfung AHS Juni 2015 Mathematik Kompensationsprüfung Angabe für Prüfer/innen Hinweise zur Kompensationsprüfung
Physikalische Übungen für Pharmazeuten
 Helmholtz-Institut für Strahlen- und Kernphysik Seminar Physikalische Übungen für Pharmazeuten Ch. Wendel Max Becker Karsten Koop Dr. Christoph Wendel Übersicht Inhalt des Seminars Praktikum - Vorbereitung
Helmholtz-Institut für Strahlen- und Kernphysik Seminar Physikalische Übungen für Pharmazeuten Ch. Wendel Max Becker Karsten Koop Dr. Christoph Wendel Übersicht Inhalt des Seminars Praktikum - Vorbereitung
Katalysator vor und nach der Reaktion
 Katalysator vor und nach der Reaktion Braunstein als Katalysator bei der Zersetzung von Wasserstoffperoxid Wasserstoffperoxid ist wenig stabil und zerfällt leicht. Dabei entsteht Sauerstoff, der mit Hilfe
Katalysator vor und nach der Reaktion Braunstein als Katalysator bei der Zersetzung von Wasserstoffperoxid Wasserstoffperoxid ist wenig stabil und zerfällt leicht. Dabei entsteht Sauerstoff, der mit Hilfe
Abb. 1: Exotherme und endotherme Reaktionen Quelle: http://www.seilnacht.com/lexikon/aktivi.htm#diagramm
 Energie bei chemischen Reaktionen Chemische Reaktionen sind Stoffumwandlungen bei denen Teilchen umgeordnet und chemische Bindungen gespalten und neu geknüpft werden, wodurch neue Stoffe mit neuen Eigenschaften
Energie bei chemischen Reaktionen Chemische Reaktionen sind Stoffumwandlungen bei denen Teilchen umgeordnet und chemische Bindungen gespalten und neu geknüpft werden, wodurch neue Stoffe mit neuen Eigenschaften
Verbrennungstechnik. 1. Brennstoffe. 1.Brennstoffe. 2.Heizwert. 2.1 Oberer Heizwert 2.2 Unterer Heizwert. 3.Verbrennungsvorgang
 Verbrennungstechnik 1.Brennstoffe.Heizwert.1 Oberer Heizwert. Unterer Heizwert.Verbrennungsvorgang.1 Verbrennungsgleichungen 4.Ermittlung von Sauerstoff-, Luftbedarf u. Rauchgasmenge 5.Verbrennungskontrolle
Verbrennungstechnik 1.Brennstoffe.Heizwert.1 Oberer Heizwert. Unterer Heizwert.Verbrennungsvorgang.1 Verbrennungsgleichungen 4.Ermittlung von Sauerstoff-, Luftbedarf u. Rauchgasmenge 5.Verbrennungskontrolle
Sport in der Prävention/Gesundheitsförderung Herz-Kreislaufsystem MÖGLICHKEITEN DER BELASTUNGSSTEUERUNG BEI KÖRPERLICHER AKTIVITÄT
 MÖGLICHKEITEN DER BELASTUNGSSTEUERUNG BEI KÖRPERLICHER AKTIVITÄT Methode 1: Puls-/Herzfrequenz Ein einfaches objektives Kriterium für den Grad einer Belastung ist die Pulshöhe (Herzfrequenz). Folgende
MÖGLICHKEITEN DER BELASTUNGSSTEUERUNG BEI KÖRPERLICHER AKTIVITÄT Methode 1: Puls-/Herzfrequenz Ein einfaches objektives Kriterium für den Grad einer Belastung ist die Pulshöhe (Herzfrequenz). Folgende
21-1. K=f c I=I0 e f c d
 21-1 Lichtabsorption 1. Vorbereitung : Extinktions- und Absorptionskonstante, mittlere Reichweite, Unterscheidung zwischen stark und schwach absorbierenden Stoffen, Lambert-Beersches Gesetz, Erklärung
21-1 Lichtabsorption 1. Vorbereitung : Extinktions- und Absorptionskonstante, mittlere Reichweite, Unterscheidung zwischen stark und schwach absorbierenden Stoffen, Lambert-Beersches Gesetz, Erklärung
1 Messfehler. 1.1 Systematischer Fehler. 1.2 Statistische Fehler
 1 Messfehler Jede Messung ist ungenau, hat einen Fehler. Wenn Sie zum Beispiel die Schwingungsdauer eines Pendels messen, werden Sie - trotz gleicher experimenteller Anordnungen - unterschiedliche Messwerte
1 Messfehler Jede Messung ist ungenau, hat einen Fehler. Wenn Sie zum Beispiel die Schwingungsdauer eines Pendels messen, werden Sie - trotz gleicher experimenteller Anordnungen - unterschiedliche Messwerte
V.2 Phasengleichgewichte
 Physikalisch-Chemisches Praktikum II WS 02/03 Josef Riedl BCh Team 4/1 V.2 Phasengleichgewichte V.2.1 Gegenstand des Versuches Als Beispiel für ein Phasengleichgewicht im Einstoffsystem wird die Koexistenzkurve
Physikalisch-Chemisches Praktikum II WS 02/03 Josef Riedl BCh Team 4/1 V.2 Phasengleichgewichte V.2.1 Gegenstand des Versuches Als Beispiel für ein Phasengleichgewicht im Einstoffsystem wird die Koexistenzkurve
Physikalische Chemie Praktikum. Thermodynamik: Verbrennungsenthalpie einer organischen Substanz
 Hochschule Emden/Leer Physikalische Chemie Praktikum Vers. Nr. 18 Nov. 2016 Thermodynamik: Verbrennungsenthalpie einer organischen Substanz Allgemeine Grundlagen 1. Hauptsatz der Thermodynamik, Enthalpie,
Hochschule Emden/Leer Physikalische Chemie Praktikum Vers. Nr. 18 Nov. 2016 Thermodynamik: Verbrennungsenthalpie einer organischen Substanz Allgemeine Grundlagen 1. Hauptsatz der Thermodynamik, Enthalpie,
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg
 TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg GRUNDLAGEN Modul: Versuch: Elektrochemie 1 Abbildung 1: I. VERSUCHSZIEL
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg GRUNDLAGEN Modul: Versuch: Elektrochemie 1 Abbildung 1: I. VERSUCHSZIEL
