Don t gamble with physical properties Kein Glücksspiel mit Stoffdaten Lunch & Learn
|
|
|
- Alwin Brahms
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Don t gamble with physical properties Kein Glücksspiel mit Stoffdaten Lunch & Learn Siemens AG 2016 siemens.de/ec
2 Agenda Motivation Der seltsame Fall der Stoffdaten Wie läuft das bei der Sicherheitstechnik? Was haben wir daraus gelernt? Fazit Seite 2
3 Neuanlage, Kapazitätserweiterung, Retrofit... Die Basis bildet die... evaluate Massen- und Energiebilanz improve engineer Bildquelle: Siemens AG Seite 3
4 Stoffdaten als Basis für profitablen Anlagenbetrieb Funktionierender Prozess Betriebswirtschaftliches Ergebnis Produkt in geplanter Menge und Qualität Sicherheitstechnik Bildquelle: Siemens AG Seite 4
5 Stoffdatenklassen... rund um die Chemieanlage p-v-t Daten kritische Daten, Siede- und Schmelzpunkte, Dampfdrücke Phasengleichgewichte Siede- und Taupunkte, Fugazitäts- & Aktivitätskoeffizienten, Löslichkeiten (z.b. Henry), binäre Wechselwirkungsparameter Kalorische Eigenschaften Spezifische Wärme, Enthalpie Transport- und Grenzflächeneigenschaften Viskosität, Wärmeleitfähigkeit, Oberflächenspannung Chemisches Gleichgewicht Gleichgewichtskonstanten, Geschwindigkeitskonstanten Sicherheitstechnische Kenngrößen Ebulliometer Toxikologische Daten Zündtemperaturbestimmung Seite 5
6 Modellierung eines thermischen Trennprozesses Genauigkeit, Komplexität Black-box- Modell Short-cut Modell Gleichgewichtsstufenmodell Stoffaustauschmodell Exaktes oder Ultimatives Modell reine Mengenbilanz Mengenbilanz mit konstanten Trennfaktoren Wirkungsgrad der einzelnen Stufen Berücksichtigung des Stofftransports an den Phasengrenzen AspenTech, CHEMCAD Quelle: Stoffdaten Input Seite 6
7 Agenda 1 2 Motivation Der seltsame Fall der Stoffdaten Software Modellierung Schätzung Messung, Datenbank, Literatur Probe Wie läuft das bei der Sicherheitstechnik? Was haben wir daraus gelernt? Fazit Seite 7
8 Welchen Weg durchlaufen Stoffdaten? Probe Messung Datenbank Modellierung Prozess- Simulations- Software Literatur Schätzung Seite 8
9 Beispiel 1: Verschiedene Softwareversionen AspenTech mehr als 2 Versionen pro Jahr Ein Projekt läuft über mehrere Jahre wie stellt man sicher, dass Ingenieur A zu den gleichen Ergebnissen kommt wie Ingenieur B Bildquelle: Siemens AG Bildquelle: Seite 9
10 Gas-Flüssig-Gleichgewicht Chlorwasserstoff- Wasser T [ C] VLE HCl-H2O, Aspen V ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 x HCl [mol/mol] Aspen V7.2 Aspen V7.2 Othmer,D.F, Ind. Eng. Chem. Ind. Ed. (1928), 20 (7), pp Othmer,D.F, Ind. Eng. Chem. Ind. Ed. (1928), 20 (7), pp Sako et al., J. Chem. Eng. Jpn. (1984), 17 (4), pp Sako et al., J. Chem. Eng. Jpn. (1984), 17 (4), pp Lutugina et al., J. Appl. Chem. USSR (1965), 38 (7), pp Lutugina et al., J. Appl. Chem. USSR (1965), 38 (7), pp Lutugina et al., J. Appl. Chem. USSR (1965), 38 (7), pp Hawliczek et al., Chem. Stosowana (1962), 3, pp Hawliczek et al., Chem. Stosowana (1962), 3, pp Carriere et al., C. R. Hebd. Seances Acad. Sci. (1924), 179, pp Carriere et al., C. R. Hebd. Seances Acad. Sci. (1924), 179, pp Lu et al., Gaoxiao Huaxue Gongcheng Xuebao (1987), 2 (2), pp 1-12 Lu et al., Gaoxiao Huaxue Gongcheng Xuebao (1987), 2 (2), pp 1-12 Lu et al., Gaoxiao Huaxue Gongcheng Xuebao (1987), 2 (2), pp 1-12 Jablczynski et al., Rocz. Chem. (1923), 3, pp Ahmed et al.,j. Appl. Chem. (1970), 20 (4), pp Seite 10
11 Gas-Flüssig-Gleichgewicht Chlorwasserstoff- Wasser VLE HCl-H2O, Aspen V8.8 Aspen V8.8 Aspen V8.8 Othmer,D.F, Ind. Eng. Chem. Ind. Ed. (1928), 20 (7), pp Othmer,D.F, Ind. Eng. Chem. Ind. Ed. (1928), 20 (7), pp Sako et al., J. Chem. Eng. Jpn. (1984), 17 (4), pp T [ C] Sako et al., J. Chem. Eng. Jpn. (1984), 17 (4), pp Lutugina et al., J. Appl. Chem. USSR (1965), 38 (7), pp Lutugina et al., J. Appl. Chem. USSR (1965), 38 (7), pp Lutugina et al., J. Appl. Chem. USSR (1965), 38 (7), pp Hawliczek et al., Chem. Stosowana (1962), 3, pp Hawliczek et al., Chem. Stosowana (1962), 3, pp Carriere et al., C. R. Hebd. Seances Acad. Sci. (1924), 179, pp Carriere et al., C. R. Hebd. Seances Acad. Sci. (1924), 179, pp Lu et al., Gaoxiao Huaxue Gongcheng Xuebao (1987), 2 (2), pp 1-12 Lu et al., Gaoxiao Huaxue Gongcheng Xuebao (1987), 2 (2), pp 1-12 Lu et al., Gaoxiao Huaxue Gongcheng Xuebao (1987), 2 (2), pp 1-12 Jablczynski et al., Rocz. Chem. (1923), 3, pp ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 x HCl [mol/mol] Ahmed et al.,j. Appl. Chem. (1970), 20 (4), pp Seite 11
12 Beispiel 2: Verschiede Softwaretools Aspen Plus Arabian Light Aspen HYSYS Arabian Light Zusammensetzungen unterschiedlich. Führt zu unterschiedlicher Belastungsdaten Kolonnenauslegung unterschiedlich Lösung: Experimentelle Evaluierung mit diesem Öl im Labor durch skalierbare Versuche! Seite 12
13 Beispiel 3: Methanol - Wasser 1000 Dichte, MeOH-H2O Aspen Plus V8.8 Dichte [kg/m³] Coquelet et al, 2005 Lee et al., 1990 Sakurai et al., ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 x H2O [mol/mol] Seite 13
14 Beispiel 3: Methanol - Wasser Förderhöhe [m] kg/m³ 867 kg/m³ Anlagenkennlinie 140 t/h; 6,4 kw nicht möglich! 140 t/h; 5,8 kw 133 t/h; 5,5 kw -5 % Massenstrom Volumenstrom [m³/h] Seite 14
15 Welchen Weg durchlaufen Stoffdaten? Probe Messung Datenbank Modellierung Prozess- Simulations- Software Literatur Schätzung Seite 15
16 Modellauswahl aus Vielzahl an Optionen Assoziation und unter Druck Eine zuverlässige simultane Beschreibung von Assoziation und realen Effekten in der Dampfphase ist nur begrenzt mittels PC-SAFT und CPA möglich, ansonsten nicht möglich Dampfphase Assoziation real (p> ca. 5 bar) Assoziation + ideal PR, SRK + ideal oder PR, SRK ( - - Ansatz) Assoziation + Wilson, NRTL,UNIQUAC PR, SRK + Wilson, NRTL, UNIQUAC Assoziation + NRTL,UNIQUAC PR, SRK + NRTL,UNIQUAC ENRTL-HF, PC-SAFT, CPA ENRTL (ideal + NRTL für Elektrolyte) PC-SAFT, CPA ENRTL-RK ideal ideal + ideal ideal + Wilson, NRTL, UNIQUAC ideal + NRTL,UNIQUAC ENRTL (ideal + NRTL für Elektrolyte) Definition von Henry- Komponenten ideale Mischung reale Mischung stark reale Mischung (LLE) Elektrolyte in der Mischung überkritische Komopnenten in der Mischung Flüssigkeit Seite 16
17 Falsches Modell Essigsäure Wasser Seite 17
18 Richtiges Modell gewählt Seite 18
19 Stoffdaten sparen IHR Geld Engpassbeseitigung & Kapazitätserhöhung ideal Realverhalten Vorgehensweise: Modellierung mit genauen thermodynamischen Daten Lösung: Verlegung des Zulaufs mehr Trennstufen in Abtriebsteil geringeres Rücklaufverhältnis Kapazitätserhöhung um 15 % Kosten neue Kolonne: 500 keur, Kosten der Maßnahme: 35 keur Seite 19
20 Welchen Weg durchlaufen Stoffdaten? Probe Messung Datenbank Modellierung Prozess- Simulations- Software Literatur Schätzung Seite 20
21 Vorhersage oder Schätzung von Stoffdaten Gruppenbeitragsmethoden z.b. mod. UNIFAC: Aktivitätskoeffizient Toluol 1 x aromatisch CCH3 5 x aromatisch CH Bildquelle: DDBST Seite 21
22 Welchen Weg durchlaufen Stoffdaten? Probe Messung Datenbank Modellierung Prozess- Simulations- Software Literatur Schätzung Seite 22
23 Qualität der Messungen?? Quelle: Experimentell ermittelte Wärmeleitfähigkeit von flüssigem Toluol bei 20 C als Funktion des Publikationsjahres Seite 23
24 Messung - Dampfdruck Ebulliometer Kalibrierung: Druckmessung Temperaturmessung z.b. Dampfdruck-Kurve von Isopropanol Seite 24
25 Messung aktuelles Bespiel VLE Messung und Reinstoffmessung Reinstoffmessung wurde bei uns im Haus gemacht VLE Messung extern Vergleich mit Betriebsdaten Seite 25
26 Messung aktuelles Bespiel VLE Messung und Reinstoffmessung Externen Bericht verglichen Probe wird geliefert mit 2-2,5% Verunreinigung Seite 26
27 Agenda Motivation Der seltsame Fall der Stoffdaten Wie läuft das bei der Sicherheitstechnik? Was haben wir daraus gelernt? Fazit Seite 27
28 GLP-Qualitätssicherungsprogramm Die Gute Laborpraxis (GLP) ist ein Qualitätssicherungssystem, das sich mit dem organisatorischen Ablauf und den Rahmenbedingungen befasst, unter denen nicht-klinische gesundheitsund umweltrelevante Sicherheitsprüfungen geplant, durchgeführt und überwacht werden sowie mit der Aufzeichnung, Archivierung und Berichterstattung der Prüfungen Quelle: Bundesamt für Risikobewertung Seite 28
29 Agenda Motivation Der seltsame Fall der Stoffdaten Wie läuft das bei der Sicherheitstechnik? Was haben wir daraus gelernt? Fazit Seite 29
30 Wie wird das gelebt? Wie kann man Probleme vermeiden? Arbeitsmappen und SOP s sichern Wissen und verhindern, dass Ingenieur A und B verschiedene/falsche Ergebnisse erhalten Schulung des Personals Regelmäßige Auditierung (intern, extern) Bewertung der Stoffdatenbasis mit Noten Verwaltung Stoffdatenpaket Gute Dokumentation Projektspezifische Stoffdatenpaket Änderungen Stoffdatenexperte Software für Prozesssimulation Software für Equipmentdesign Seite 30
31 Agenda Motivation Der seltsame Fall der Stoffdaten Wie läuft das bei der Sicherheitstechnik? Was haben wir daraus gelernt? Fazit Seite 31
32 Fazit Thermodynamisches Verständnis ist essentiell Blindes Vertrauen in Daten oder Vorauswahl kann unangenehme Folgen haben Qualitätsmanagement hilft bei der Fehlervermeidung und -behebung Bildquelle: Siemens AG Seite 32
33 Wobei können wir Sie unterstützen? Prozesssimulation Validierung durch Vergleich von Simulationsergebnissen mit Prozessbeziehungsweise Experimentaldaten Prozessoptimierung Energetische Optimierung (Pinch-Analyse) Modellierung und Modellauswahl Modellerstellung, Auswahl geeigneter Modelle Bestimmung von Modellparametern Zugriff auf Datenbanken (DETHERM, DDB) Schätzung (UNIFAC, Mod. UNIFAC, PSRK) Stoffdatenvermessung Thermophysikalische und sicherheitstechnische Stoffdaten Seite 33
34 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Sebastian Löw PD PA AE EC PRD Industriepark Höchst Frankfurt Telefon: +49 (69) Fax: +49 (69) siemens.de/ec Seite Lunch & Learn Sebastian Löw/ PD PA AE EC PRD
Physikalisch-chemische Grundlagen der thermischen Verfahrenstechnik
 Lüdecke Lüdecke Thermodynamik Physikalisch-chemische Grundlagen der thermischen Verfahrenstechnik Grundlagen der Thermodynamik Grundbegriffe Nullter und erster Hauptsatz der Thermodynamik Das ideale Gas
Lüdecke Lüdecke Thermodynamik Physikalisch-chemische Grundlagen der thermischen Verfahrenstechnik Grundlagen der Thermodynamik Grundbegriffe Nullter und erster Hauptsatz der Thermodynamik Das ideale Gas
Inhalt 1 Grundlagen der Thermodynamik
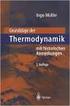 Inhalt 1 Grundlagen der Thermodynamik..................... 1 1.1 Grundbegriffe.............................. 2 1.1.1 Das System........................... 2 1.1.2 Zustandsgrößen........................
Inhalt 1 Grundlagen der Thermodynamik..................... 1 1.1 Grundbegriffe.............................. 2 1.1.1 Das System........................... 2 1.1.2 Zustandsgrößen........................
Prof. Dr. J. Gmehling Universität Oldenburg, Institut für Reine und Angewandte Chemie, Technische Chemie, D Oldenburg
 Abschlussbericht an die Max-Buchner-Forschungsstiftung (FKZ: 277) Messung der Gleichgewichtslage und der Kinetik ausgewählter Veretherungsreaktionen und Überprüfung der Vorhersagbarkeit der Lösungsmitteleffekte
Abschlussbericht an die Max-Buchner-Forschungsstiftung (FKZ: 277) Messung der Gleichgewichtslage und der Kinetik ausgewählter Veretherungsreaktionen und Überprüfung der Vorhersagbarkeit der Lösungsmitteleffekte
Untersuchungen zum Einsatz alternativer
 Prozesswissenschaften Untersuchungen zum Einsatz alternativer Waschmedien für die Rückgewinnung aromatischer Kohlenwasserstoffe aus Kokereigasen vorgelegt von Diplom Ingenieur Diethmar Richter aus Bremen
Prozesswissenschaften Untersuchungen zum Einsatz alternativer Waschmedien für die Rückgewinnung aromatischer Kohlenwasserstoffe aus Kokereigasen vorgelegt von Diplom Ingenieur Diethmar Richter aus Bremen
Vom Dampfdruck zur Destillationskolonne
 Vom Dampfdruck zur Destillationskolonne Teil 2: Prozesssimulation & Apparateauslegung Lunch & Learn Marl 03.07.2013 André Ohligschläger Cape Tools- EC verfügt über eine Integrierte Softwareumgebung: Effektiv
Vom Dampfdruck zur Destillationskolonne Teil 2: Prozesssimulation & Apparateauslegung Lunch & Learn Marl 03.07.2013 André Ohligschläger Cape Tools- EC verfügt über eine Integrierte Softwareumgebung: Effektiv
Manfred Nitsche. Kolonnen-Fibel. Für die Praxis im chemischen Anlagenbau. Springer Vi eweg
 Manfred Nitsche KolonnenFibel Für die Praxis im chemischen Anlagenbau Springer Vi eweg 1 Planung von Destillations und Absorptionskolonnen 1 1.1 Planungshinweise 1 1.2 Mengenbilanz für die gegebene Aufgabenstellung
Manfred Nitsche KolonnenFibel Für die Praxis im chemischen Anlagenbau Springer Vi eweg 1 Planung von Destillations und Absorptionskolonnen 1 1.1 Planungshinweise 1 1.2 Mengenbilanz für die gegebene Aufgabenstellung
Karl Stephan Franz Mayinger. Thermodynamik. Grundlagen und technische Anwendungen. Zwölfte, neubearbeitete und erweiterte Auflage
 Karl Stephan Franz Mayinger Thermodynamik Grundlagen und technische Anwendungen Zwölfte, neubearbeitete und erweiterte Auflage Band 2 Mehrstoffsysteme und chemische Reaktionen Mit 135 Abbildungen Springer-Verlag
Karl Stephan Franz Mayinger Thermodynamik Grundlagen und technische Anwendungen Zwölfte, neubearbeitete und erweiterte Auflage Band 2 Mehrstoffsysteme und chemische Reaktionen Mit 135 Abbildungen Springer-Verlag
ÜBUNGEN ZUR VORLESUNG Physikalische Chemie I (PC I) (Prof. Meerholz, Hertel, Klemmer) Blatt 14,
 ÜBUNGEN ZUR VORLESUNG Physikalische Chemie I (PC I) (Prof. Meerholz, Hertel, Klemmer) Blatt 14, 12.02.2016 Aufgabe 1 Kreisprozesse Mit einem Mol eines idealen, monoatomaren Gases (cv = 3/2 R) wird, ausgehend
ÜBUNGEN ZUR VORLESUNG Physikalische Chemie I (PC I) (Prof. Meerholz, Hertel, Klemmer) Blatt 14, 12.02.2016 Aufgabe 1 Kreisprozesse Mit einem Mol eines idealen, monoatomaren Gases (cv = 3/2 R) wird, ausgehend
Abschlussbericht zu Kennziffer 2472: Experimentelle Bestimmung von Grenzaktivitätskoeffizienten in ternären und höheren Elektrolytsystemen
 Abschlussbericht zu Kennziffer 2472: Experimentelle Bestimmung von Grenzaktivitätskoeffizienten in ternären und höheren Elektrolytsystemen Während es bei Nichtelektrolytsystemen möglich ist, mit Hilfe
Abschlussbericht zu Kennziffer 2472: Experimentelle Bestimmung von Grenzaktivitätskoeffizienten in ternären und höheren Elektrolytsystemen Während es bei Nichtelektrolytsystemen möglich ist, mit Hilfe
Entwicklung einer universellen Gruppenbeitragszustandsgleichung
 Entwicklung einer universellen Gruppenbeitragszustandsgleichung Vom Fachbereich Chemie der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg zur Erlangung des Grades eines Doktors der Naturwissenschaften angenommene
Entwicklung einer universellen Gruppenbeitragszustandsgleichung Vom Fachbereich Chemie der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg zur Erlangung des Grades eines Doktors der Naturwissenschaften angenommene
Bernhard Härder. Einführung in die PHYSIKALISCHE CHEMIE ein Lehrbuch Chemische Thermodynamik W/ WESTAR.P WISSENSCHAFTEN. Skripte, Lehrbücher Band 2
 Bernhard Härder Einführung in die PHYSIKALISCHE CHEMIE ein Lehrbuch Chemische Thermodynamik Skripte, Lehrbücher Band 2 W/ WESTAR.P WISSENSCHAFTEN Inhaltsverzeichnis Vorwort zur ersten Auflage Vorwort zur
Bernhard Härder Einführung in die PHYSIKALISCHE CHEMIE ein Lehrbuch Chemische Thermodynamik Skripte, Lehrbücher Band 2 W/ WESTAR.P WISSENSCHAFTEN Inhaltsverzeichnis Vorwort zur ersten Auflage Vorwort zur
DAMPF-FLÜSSIG-GLEICHGEWICHTE WÄSSRIGER ELEKTROLYT- MISCHUNGEN MIT FLÜCHTIGEN KOMPONENTEN
 DAMPF-FLÜSSIG-GLEICHGEWICHTE WÄSSRIGER ELEKTROLYT- MISCHUNGEN MIT FLÜCHTIGEN KOMPONENTEN Zur Erlangung des akademischen Grades eines DOKTORS DER INGENIEURWISSENSCHAFTEN (Dr.-Ing.) von der Fakultät für
DAMPF-FLÜSSIG-GLEICHGEWICHTE WÄSSRIGER ELEKTROLYT- MISCHUNGEN MIT FLÜCHTIGEN KOMPONENTEN Zur Erlangung des akademischen Grades eines DOKTORS DER INGENIEURWISSENSCHAFTEN (Dr.-Ing.) von der Fakultät für
Lehrbuch der Thermodynamik
 Ulrich Nickel Lehrbuch der Thermodynamik Eine verständliche Einführung Ж HANSER Carl Hanser Verlag München Wien VII Inhaltsverzeichnis 1 GRUNDBEGRIFFE DER THERMODYNAMIK 1 Einführung 1 Systeme 3 offene
Ulrich Nickel Lehrbuch der Thermodynamik Eine verständliche Einführung Ж HANSER Carl Hanser Verlag München Wien VII Inhaltsverzeichnis 1 GRUNDBEGRIFFE DER THERMODYNAMIK 1 Einführung 1 Systeme 3 offene
Inhaltsverzeichnis. Formelzeichen. 1 Einleitung 1. 2 Einheiten physikalischer Größen 3
 Formelzeichen XIII 1 Einleitung 1 2 Einheiten physikalischer Größen 3 3 Systeme 7 3.1 Definition von Systemen 7 3.2 Systemarten 8 3.2.1 Geschlossenes System 8 3.2.2 Offenes System 9 3.2.3 Adiabates System
Formelzeichen XIII 1 Einleitung 1 2 Einheiten physikalischer Größen 3 3 Systeme 7 3.1 Definition von Systemen 7 3.2 Systemarten 8 3.2.1 Geschlossenes System 8 3.2.2 Offenes System 9 3.2.3 Adiabates System
Inhaltsverzeichnis. Formelzeichen...XIII. 1 Einleitung Einheiten physikalischer Größen...3
 Inhaltsverzeichnis Formelzeichen...XIII 1 Einleitung...1 2 Einheiten physikalischer Größen...3 3 Systeme...6 3.1 Definition von Systemen...6 3.2 Systemarten...7 3.2.1 Geschlossenes System...7 3.2.2 Offenes
Inhaltsverzeichnis Formelzeichen...XIII 1 Einleitung...1 2 Einheiten physikalischer Größen...3 3 Systeme...6 3.1 Definition von Systemen...6 3.2 Systemarten...7 3.2.1 Geschlossenes System...7 3.2.2 Offenes
Chemische Thermodynamik
 Walter Schreiter Chemische Thermodynamik Grundlagen, Ubungen, Lösungen Oe Gruyter Inhalt Verwendete Symbole und Größen................................. XI Theoretische Grundlagen.... 1.1 Nullter Hauptsatz
Walter Schreiter Chemische Thermodynamik Grundlagen, Ubungen, Lösungen Oe Gruyter Inhalt Verwendete Symbole und Größen................................. XI Theoretische Grundlagen.... 1.1 Nullter Hauptsatz
Phasengleichgewicht. 1. Experimentelle Bestimmung des Dampfdrucks von Methanol als Funktion der Temperatur. A fl. A g
 Physikalisch-Chemische Praktika Phasengleichgewicht Versuch T-2 Aufgaben 1. Experimentelle Bestimmung des Dampfdrucks von Methanol als Funktion der Temperatur. 2. Ermittlung der Phasenumwandlungsenthalpie
Physikalisch-Chemische Praktika Phasengleichgewicht Versuch T-2 Aufgaben 1. Experimentelle Bestimmung des Dampfdrucks von Methanol als Funktion der Temperatur. 2. Ermittlung der Phasenumwandlungsenthalpie
Modul: Allgemeine Chemie
 Modul: Allgemeine Chemie 5. Grundlagen der chemischen Bindung Ionenbindung Eigenschaften, Ionengitter, Kugelpackung Strukturtypen, Kreisprozesse Kovalente Bindung Lewis Formeln, Oktettregel, Formalladungen
Modul: Allgemeine Chemie 5. Grundlagen der chemischen Bindung Ionenbindung Eigenschaften, Ionengitter, Kugelpackung Strukturtypen, Kreisprozesse Kovalente Bindung Lewis Formeln, Oktettregel, Formalladungen
Phasen, Komponenten, Freiheitsgrade
 Phasendiagramme 1 Lernziele: Ø Phasen, Komponenten, Freiheitsgrade Ø Die Phasenregel Ø Zweikomponentensysteme: Dampfdruckdiagramme, Hebelgesetz Ø Zweikomponentensysteme: Siedediagramme (die Destillation
Phasendiagramme 1 Lernziele: Ø Phasen, Komponenten, Freiheitsgrade Ø Die Phasenregel Ø Zweikomponentensysteme: Dampfdruckdiagramme, Hebelgesetz Ø Zweikomponentensysteme: Siedediagramme (die Destillation
Physikalische Chemie Physikalische Chemie I SoSe 2009 Prof. Dr. Norbert Hampp 1/9 1. Das Ideale Gas. Thermodynamik
 Prof. Dr. Norbert Hampp 1/9 1. Das Ideale Gas Thermodynamik Teilgebiet der klassischen Physik. Wir betrachten statistisch viele Teilchen. Informationen über einzelne Teilchen werden nicht gewonnen bzw.
Prof. Dr. Norbert Hampp 1/9 1. Das Ideale Gas Thermodynamik Teilgebiet der klassischen Physik. Wir betrachten statistisch viele Teilchen. Informationen über einzelne Teilchen werden nicht gewonnen bzw.
Formelzeichen Bedeutung Wert / SI-Einheit
 CHEMISCHE THERMODYNAMI SYMBOLE UND ONSTANTEN PROF. DR. WOLFGANG CHRISTEN Formelzeichen Bedeutung Wert / SI-Einheit AA Fläche m 2 AA Freie Energie, Helmholtz-Energie Nm = aa Beschleunigung m aa ii CC pp
CHEMISCHE THERMODYNAMI SYMBOLE UND ONSTANTEN PROF. DR. WOLFGANG CHRISTEN Formelzeichen Bedeutung Wert / SI-Einheit AA Fläche m 2 AA Freie Energie, Helmholtz-Energie Nm = aa Beschleunigung m aa ii CC pp
Lehrbuch Chemische Technologie
 C. Herbert Vogel Lehrbuch Chemische Technologie Grundlagen Verfahrenstechnischer Anlagen WILEY- VCH WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA IX Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 1 1.1 Das Ziel industrieller Forschung
C. Herbert Vogel Lehrbuch Chemische Technologie Grundlagen Verfahrenstechnischer Anlagen WILEY- VCH WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA IX Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 1 1.1 Das Ziel industrieller Forschung
Lernziele: Phasen, Komponenten, Freiheitsgrade Die Phasenregel Zweikomponentensysteme: Dampfdruckdiagramme,
 Phasendiagramme Lernziele: ee Phasen, Komponenten, Freiheitsgrade Die Phasenregel Zweikomponentensysteme: Dampfdruckdiagramme, Hebelgesetz Zweikomponentensysteme: Siedediagramme (die Distillation von Mischungen,
Phasendiagramme Lernziele: ee Phasen, Komponenten, Freiheitsgrade Die Phasenregel Zweikomponentensysteme: Dampfdruckdiagramme, Hebelgesetz Zweikomponentensysteme: Siedediagramme (die Distillation von Mischungen,
Band 2: Mehrstoffsysteme und chemische Reaktionen. Grundlagen und technische Anwendungen
 Karl Stephan Franz Mayinger n 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. or Band 2: Mehrstoffsysteme und chemische
Karl Stephan Franz Mayinger n 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. or Band 2: Mehrstoffsysteme und chemische
Institut für Umwelttechnik und Energiewirtschaft
 Institut für Umwelttechnik und Energiewirtschaft Modellierung von fester Biomasse für thermo-chemische und bio-chemische Konversionsprozesse in Aspen Plus Hannes Wagner Workshop Fließschemasimulation in
Institut für Umwelttechnik und Energiewirtschaft Modellierung von fester Biomasse für thermo-chemische und bio-chemische Konversionsprozesse in Aspen Plus Hannes Wagner Workshop Fließschemasimulation in
Inhalt der Vorlesung. 1. Eigenschaften der Gase. 0. Einführung
 Inhalt der Vorlesung 0. Einführung 0.1 Themen der Physikal. Chemie 0.2 Grundbegriffe/ Zentrale Größe: Energie 0.3 Molekulare Deutung der inneren Energie U Molekülstruktur, Energieniveaus und elektromagn.
Inhalt der Vorlesung 0. Einführung 0.1 Themen der Physikal. Chemie 0.2 Grundbegriffe/ Zentrale Größe: Energie 0.3 Molekulare Deutung der inneren Energie U Molekülstruktur, Energieniveaus und elektromagn.
11. Der Phasenübergang
 11. Der Phasenübergang - Phasendiagramme, Kritischer Punkt und ripelpunkt - Gibbssche Phasenregel - Phasenübergänge 1. und 2. Ordnung - Das Phasengleichgewicht - Clausius-Clapeyron-Gleichung - Pictet-routon-Regel,
11. Der Phasenübergang - Phasendiagramme, Kritischer Punkt und ripelpunkt - Gibbssche Phasenregel - Phasenübergänge 1. und 2. Ordnung - Das Phasengleichgewicht - Clausius-Clapeyron-Gleichung - Pictet-routon-Regel,
Thermodynamik des Kraftfahrzeugs
 Cornel Stan Thermodynamik des Kraftfahrzeugs Mit 200 Abbildungen und 7 Tabellen Springer Inhaltsverzeichnis Liste der Formelzeichen XV 1 Grundlagen der Technischen Thermodynamik 1 1.1 Gegenstand und Untersuchungsmethodik
Cornel Stan Thermodynamik des Kraftfahrzeugs Mit 200 Abbildungen und 7 Tabellen Springer Inhaltsverzeichnis Liste der Formelzeichen XV 1 Grundlagen der Technischen Thermodynamik 1 1.1 Gegenstand und Untersuchungsmethodik
Thermodynamik I. Sommersemester 2012 Kapitel 3, Teil 3. Prof. Dr.-Ing. Heinz Pitsch
 Thermodynamik I Sommersemester 2012 Kapitel 3, Teil 3 Prof. Dr.-Ing. Heinz Pitsch Kapitel 3, Teil 2: Übersicht 3 Energiebilanz 3.3 Bilanzgleichungen 3.3.1 Massebilanz 3.3.2 Energiebilanz und 1. Hauptsatz
Thermodynamik I Sommersemester 2012 Kapitel 3, Teil 3 Prof. Dr.-Ing. Heinz Pitsch Kapitel 3, Teil 2: Übersicht 3 Energiebilanz 3.3 Bilanzgleichungen 3.3.1 Massebilanz 3.3.2 Energiebilanz und 1. Hauptsatz
Simulation und Optimierung. 7. Vorlesung. Ergänzungen zur Parametrierung eines A+ Projektes. Grundlagen der Simulation von Destillationsprozessen
 Fakultät Maschinenwesen Institut für Verfahrenstechnik und Umwelttechnik Professur Verfahrensautomatisierung Simulation und Optimierung 7. Vorlesung Ergänzungen zur Parametrierung eines A+ Projektes Grundlagen
Fakultät Maschinenwesen Institut für Verfahrenstechnik und Umwelttechnik Professur Verfahrensautomatisierung Simulation und Optimierung 7. Vorlesung Ergänzungen zur Parametrierung eines A+ Projektes Grundlagen
Liste der Formelzeichen. A. Thermodynamik der Gemische 1
 Inhaltsverzeichnis Liste der Formelzeichen XV A. Thermodynamik der Gemische 1 1. Grundbegriffe 3 1.1 Anmerkungen zur Nomenklatur von Mischphasen.... 4 1.2 Maße für die Zusammensetzung von Mischphasen....
Inhaltsverzeichnis Liste der Formelzeichen XV A. Thermodynamik der Gemische 1 1. Grundbegriffe 3 1.1 Anmerkungen zur Nomenklatur von Mischphasen.... 4 1.2 Maße für die Zusammensetzung von Mischphasen....
Transportkoeffizienten von Alkoholen und Wasser: Molekulare Simulation und Messungen mit der Taylor-Dispersions Methode
 ProcessNet Jahrestagung, 8 - September 9, Mannheim Transportkoeffizienten von Alkoholen und Wasser: Molekulare Simulation und Messungen mit der Taylor-Dispersions Methode Gabriela Guevara-Carrión, Jadran
ProcessNet Jahrestagung, 8 - September 9, Mannheim Transportkoeffizienten von Alkoholen und Wasser: Molekulare Simulation und Messungen mit der Taylor-Dispersions Methode Gabriela Guevara-Carrión, Jadran
Moderne Phasengleichgewichtsmodelle
 Moderne Phasengleichgewichtsmodelle NRTL-Unifac-PSRK-SRK Als der Doktorand und Physiker Johannes Diderik van der Waals (1837-1923) 1873 seine Doktorarbeit an der holländischen Universität Leiden über Over
Moderne Phasengleichgewichtsmodelle NRTL-Unifac-PSRK-SRK Als der Doktorand und Physiker Johannes Diderik van der Waals (1837-1923) 1873 seine Doktorarbeit an der holländischen Universität Leiden über Over
Inhaltsverzeichnis Allgemeine Grundlagen Fluide Phasen
 1. Allgemeine Grundlagen... 1 1.1 Energie-undStoffumwandlungen... 1 1.1.1 Energieumwandlungen... 2 1.1.2 Stoffumwandlungen... 6 1.1.3 Energie- und Stoffumwandlungen in technischen Prozessen... 9 1.1.4
1. Allgemeine Grundlagen... 1 1.1 Energie-undStoffumwandlungen... 1 1.1.1 Energieumwandlungen... 2 1.1.2 Stoffumwandlungen... 6 1.1.3 Energie- und Stoffumwandlungen in technischen Prozessen... 9 1.1.4
A 2.6 Wie ist die Zusammensetzung der Flüssigkeit und des Dampfes eines Stickstoff-Sauerstoff-Gemischs
 A 2.1 Bei - 10 o C beträgt der Dampfdruck des Kohlendioxids 26,47 bar, die Dichte der Flüssigkeit 980,8 kg/m 3 und die Dichte des Dampfes 70,5 kg/m 3. Bei - 7,5 o C beträgt der Dampfdruck 28,44 bar. Man
A 2.1 Bei - 10 o C beträgt der Dampfdruck des Kohlendioxids 26,47 bar, die Dichte der Flüssigkeit 980,8 kg/m 3 und die Dichte des Dampfes 70,5 kg/m 3. Bei - 7,5 o C beträgt der Dampfdruck 28,44 bar. Man
Kolligative Eigenschaften
 Prof. Dr. Norbert Hampp 1/8 11. Kolligative Eigenschaften Kolligative Eigenschaften Unter kolligativen Eigenschaften versteht man die Eigenschaften eines Systems die auf der Mischung unterschiedlicher
Prof. Dr. Norbert Hampp 1/8 11. Kolligative Eigenschaften Kolligative Eigenschaften Unter kolligativen Eigenschaften versteht man die Eigenschaften eines Systems die auf der Mischung unterschiedlicher
Erfahrungsbericht aus einer anderen Welt.
 Erfahrungsbericht aus einer anderen Welt. Siemens AG 2017 siemens.de/ec Lebensweisheit (Autor: unbekannt) Seite 2 Was ist ein Owner s Engineer? Owner s Engineer ist ein Begriff für einen unabhängigen Vertreter
Erfahrungsbericht aus einer anderen Welt. Siemens AG 2017 siemens.de/ec Lebensweisheit (Autor: unbekannt) Seite 2 Was ist ein Owner s Engineer? Owner s Engineer ist ein Begriff für einen unabhängigen Vertreter
Zustandsbeschreibungen
 Aggregatzustände fest Kristall, geordnet Modifikationen Fernordnung flüssig teilgeordnet Fluktuationen Nahordnung gasförmig regellose Bewegung Unabhängigkeit ngigkeit (ideales Gas) Zustandsbeschreibung
Aggregatzustände fest Kristall, geordnet Modifikationen Fernordnung flüssig teilgeordnet Fluktuationen Nahordnung gasförmig regellose Bewegung Unabhängigkeit ngigkeit (ideales Gas) Zustandsbeschreibung
Thermodynamik. Grundlagen und technische Anwendungen
 Springer-Lehrbuch Thermodynamik. Grundlagen und technische Anwendungen Band 2: Mehrstoffsysteme und chemische Reaktionen Bearbeitet von Peter Stephan, Karlheinz Schaber, Karl Stephan, Franz Mayinger Neuausgabe
Springer-Lehrbuch Thermodynamik. Grundlagen und technische Anwendungen Band 2: Mehrstoffsysteme und chemische Reaktionen Bearbeitet von Peter Stephan, Karlheinz Schaber, Karl Stephan, Franz Mayinger Neuausgabe
Masterstudiengang Chemie. Bericht zum Modul "Verfahrensentwicklung" Dynamic Simulation and Optimization of an Extractive Batch Distillation
 Masterstudiengang Chemie Bericht zum Modul "Verfahrensentwicklung" Dynamic Simulation and Optimization of an Extractive Batch Distillation Separation of an Azeotropic Mixture of Acetone and Methanol with
Masterstudiengang Chemie Bericht zum Modul "Verfahrensentwicklung" Dynamic Simulation and Optimization of an Extractive Batch Distillation Separation of an Azeotropic Mixture of Acetone and Methanol with
Einführung in die Technische Thermodynamik
 Arnold Frohn Einführung in die Technische Thermodynamik 2., überarbeitete Auflage Mit 139 Abbildungen und Übungen AULA-Verlag Wiesbaden INHALT 1. Grundlagen 1 1.1 Aufgabe und Methoden der Thermodynamik
Arnold Frohn Einführung in die Technische Thermodynamik 2., überarbeitete Auflage Mit 139 Abbildungen und Übungen AULA-Verlag Wiesbaden INHALT 1. Grundlagen 1 1.1 Aufgabe und Methoden der Thermodynamik
Technische Universität Dortmund Fakultät Bio- und Chemieingenieurwesen Lehrstuhl für Thermodynamik
 Technische Universität Dortmund Fakultät Bio- und Chemieingenieurwesen Lehrstuhl für Thermodynamik Adresse Emil-Figge-Straße 70 44227 Dortmund Deutschland Telefon +49 231 755-2635 Telefax +49 231 755-2572
Technische Universität Dortmund Fakultät Bio- und Chemieingenieurwesen Lehrstuhl für Thermodynamik Adresse Emil-Figge-Straße 70 44227 Dortmund Deutschland Telefon +49 231 755-2635 Telefax +49 231 755-2572
Partikel-Dampf-Gemische am Arbeitsplatz - Grundlagen zur Messung -
 Partikel-Dampf-Gemische am Arbeitsplatz - Grundlagen zur Messung - 3. Symposium Gefahrstoffe am Arbeitsplatz, Dr. Dietmar Breuer, IFA Dortmund, 25. 09. 2012 Die einfache Welt der Dampf oder Aerosolprobenahme
Partikel-Dampf-Gemische am Arbeitsplatz - Grundlagen zur Messung - 3. Symposium Gefahrstoffe am Arbeitsplatz, Dr. Dietmar Breuer, IFA Dortmund, 25. 09. 2012 Die einfache Welt der Dampf oder Aerosolprobenahme
Probeklausur STATISTISCHE PHYSIK PLUS
 DEPARTMENT FÜR PHYSIK, LMU Statistische Physik für Bachelor Plus WS 2011/12 Probeklausur STATISTISCHE PHYSIK PLUS NAME:... MATRIKEL NR.:... Bitte beachten: Schreiben Sie Ihren Namen auf jedes Blatt; Schreiben
DEPARTMENT FÜR PHYSIK, LMU Statistische Physik für Bachelor Plus WS 2011/12 Probeklausur STATISTISCHE PHYSIK PLUS NAME:... MATRIKEL NR.:... Bitte beachten: Schreiben Sie Ihren Namen auf jedes Blatt; Schreiben
Grundlagen zur Auswahl, Synthese und Auslegung thermischer Trennprozesse
 Grundlagen zur Auswahl, Synthese und Auslegung thermischer Trennprozesse 3(4)-tägiger Kurs am Lehrstuhl Technische Chemie der Univ. Oldenburg unter Leitung von Herrn Ort: Universität Oldenburg, Standort
Grundlagen zur Auswahl, Synthese und Auslegung thermischer Trennprozesse 3(4)-tägiger Kurs am Lehrstuhl Technische Chemie der Univ. Oldenburg unter Leitung von Herrn Ort: Universität Oldenburg, Standort
Messung von Tieftemperatur-Phasengleichgewichten in binären Gemischen mit R1234yf
 Messung von Tieftemperatur-Phasengleichgewichten in binären Gemischen mit R1234yf INSTITUT FÜR TECHNISCHE THERMODYNAMIK UND KÄLTETECHNIK (ITTK) KIT Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
Messung von Tieftemperatur-Phasengleichgewichten in binären Gemischen mit R1234yf INSTITUT FÜR TECHNISCHE THERMODYNAMIK UND KÄLTETECHNIK (ITTK) KIT Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
Lehrbuch der Thermodynamik
 Ulrich Nickel Lehrbuch der Thermodynamik Eine verständliche Einführung PhysChem Verlag Erlangen U. Nickel VII Inhaltsverzeichnis 1 GRUNDLAGEN DER THERMODYNAMIK 1 1.1 Einführung 1 1.2 Materie 2 1.3 Energie
Ulrich Nickel Lehrbuch der Thermodynamik Eine verständliche Einführung PhysChem Verlag Erlangen U. Nickel VII Inhaltsverzeichnis 1 GRUNDLAGEN DER THERMODYNAMIK 1 1.1 Einführung 1 1.2 Materie 2 1.3 Energie
Ex-Untersuchungen an der Grenze
 Ex-Untersuchungen an der Grenze Hand out Lunch & Learn am 21.01.2011 Agenda Zielsetzung des es und Schutzkonzepte Wichtige sicherheitstechnische und Abhängigkeiten Laboratorien und Apparaturen für die
Ex-Untersuchungen an der Grenze Hand out Lunch & Learn am 21.01.2011 Agenda Zielsetzung des es und Schutzkonzepte Wichtige sicherheitstechnische und Abhängigkeiten Laboratorien und Apparaturen für die
PHYSIKALISCHE GRENZEN BEI DER BESTIMMUNG DER TECHNISCHEN SAUBERKEIT. Prof. Dr. Juliane König-Birk 1
 PHYSIKALISCHE GRENZEN BEI DER BESTIMMUNG DER TECHNISCHEN SAUBERKEIT Prof. Dr. Juliane König-Birk 1 Übersicht Probennahme, Probenaufbereitung Messmethoden für Filmische Verunreinigungen Partikuläre Verunreinigungen
PHYSIKALISCHE GRENZEN BEI DER BESTIMMUNG DER TECHNISCHEN SAUBERKEIT Prof. Dr. Juliane König-Birk 1 Übersicht Probennahme, Probenaufbereitung Messmethoden für Filmische Verunreinigungen Partikuläre Verunreinigungen
Institut für Physikalische Chemie Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
 Institut für Physikalische Chemie Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Lösungen zum Übungsblatt 4 zur Vorlesung Physikalische Chemie II WS 2008/09 Prof. E. Bartsch 4.1 Der Siedepunkt einer flüssigen Mischung
Institut für Physikalische Chemie Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Lösungen zum Übungsblatt 4 zur Vorlesung Physikalische Chemie II WS 2008/09 Prof. E. Bartsch 4.1 Der Siedepunkt einer flüssigen Mischung
Thermodynamik des Kraftfahrzeugs
 Thermodynamik des Kraftfahrzeugs Bearbeitet von Cornel Stan 1. Auflage 2012. Buch. xxiv, 598 S. Hardcover ISBN 978 3 642 27629 3 Format (B x L): 15,5 x 23,5 cm Gewicht: 1087 g Weitere Fachgebiete > Technik
Thermodynamik des Kraftfahrzeugs Bearbeitet von Cornel Stan 1. Auflage 2012. Buch. xxiv, 598 S. Hardcover ISBN 978 3 642 27629 3 Format (B x L): 15,5 x 23,5 cm Gewicht: 1087 g Weitere Fachgebiete > Technik
Simulation von Flüssigkeitsbrücken zwischen Nanopartikeln
 Simulation von Flüssigkeitsbrücken zwischen Nanopartikeln Michael Dörmann, Hans-Joachim Schmid Lehrstuhl für Partikelverfahrenstechnik Universität Paderborn 03.04.2014 Agenda Motivation Methode Ergebnisse
Simulation von Flüssigkeitsbrücken zwischen Nanopartikeln Michael Dörmann, Hans-Joachim Schmid Lehrstuhl für Partikelverfahrenstechnik Universität Paderborn 03.04.2014 Agenda Motivation Methode Ergebnisse
Inhaltsverzeichnis. Zweites Kapitel.
 Vorwort Abkürzungen der.literatvirzitate Seite III X Erstes Kapitel. Die Erzeugung und Messung hoher Drucke. A. Die Druckerzeugung 1 Die Erzeugung eines konstanten Druckes 5 B. Die Messung hoher Drucke
Vorwort Abkürzungen der.literatvirzitate Seite III X Erstes Kapitel. Die Erzeugung und Messung hoher Drucke. A. Die Druckerzeugung 1 Die Erzeugung eines konstanten Druckes 5 B. Die Messung hoher Drucke
Kolonnenregelung Praxisbeispiele und APC
 24. Lunch & Learn 21.02.2014 Kolonnenregelung Praxisbeispiele und APC siemens.com/answers Einleitung 2 Advanced Process Control (APC) 5 Tipps und Tricks 17 Seite 2 Prozessregelungsmethoden Seite 3 Manuelle
24. Lunch & Learn 21.02.2014 Kolonnenregelung Praxisbeispiele und APC siemens.com/answers Einleitung 2 Advanced Process Control (APC) 5 Tipps und Tricks 17 Seite 2 Prozessregelungsmethoden Seite 3 Manuelle
5 Schlußfolgerung und Ausblick
 125 5 Schlußfolgerung und Ausblick Die Zielstellung der vorliegenden Arbeit umfaßt theoretische und experimentelle Untersuchungen zur Struktur und Grenzflächeneigenschaften der räumlich ausgedehnten Phasengrenzschichten
125 5 Schlußfolgerung und Ausblick Die Zielstellung der vorliegenden Arbeit umfaßt theoretische und experimentelle Untersuchungen zur Struktur und Grenzflächeneigenschaften der räumlich ausgedehnten Phasengrenzschichten
4. Freie Energie/Enthalpie & Gibbs Gleichungen
 4. Freie Energie/Enthalpie & Gibbs Gleichungen 1. Eigenschaften der Materie in der Gasphase 2. Erster Hauptsatz: Arbeit und Wärme 3. Entropie und Zweiter Hauptsatz der hermodynamik 4. Freie Enthalpie G,
4. Freie Energie/Enthalpie & Gibbs Gleichungen 1. Eigenschaften der Materie in der Gasphase 2. Erster Hauptsatz: Arbeit und Wärme 3. Entropie und Zweiter Hauptsatz der hermodynamik 4. Freie Enthalpie G,
 www.zaubervorlesung.de Institut für Anorganische Chemie Institut für Anorganische Chemie Universität Erlangen-Nürnberg Donnerstag 19. Okt. 2006 Einlass: 18:00 Uhr Beginn: 20:00 Uhr Getränke dürfen nur
www.zaubervorlesung.de Institut für Anorganische Chemie Institut für Anorganische Chemie Universität Erlangen-Nürnberg Donnerstag 19. Okt. 2006 Einlass: 18:00 Uhr Beginn: 20:00 Uhr Getränke dürfen nur
Thermodynamik I. Sommersemester 2012 Kapitel 2, Teil 2. Prof. Dr. Ing. Heinz Pitsch
 Thermodynamik I Sommersemester 2012 Kapitel 2, Teil 2 Prof. Dr. Ing. Heinz Pitsch Kapitel 2, Teil 2: Übersicht 2 Zustandsgrößen 2.3 Bestimmung von Zustandsgrößen 2.3.1 Bestimmung der Phase 2.3.2 Der Sättigungszustand
Thermodynamik I Sommersemester 2012 Kapitel 2, Teil 2 Prof. Dr. Ing. Heinz Pitsch Kapitel 2, Teil 2: Übersicht 2 Zustandsgrößen 2.3 Bestimmung von Zustandsgrößen 2.3.1 Bestimmung der Phase 2.3.2 Der Sättigungszustand
Institut für Technische Chemie Technische Universität Clausthal. Technisch-chemisches Praktikum TCB. Versuch: Rektifikation
 Institut für Technische Chemie Technische Universität Clausthal Technisch-chemisches Praktikum TCB Versuch: Rektifikation Einleitung In einer Vielzahl von chemischen Produktionsanlagen besteht die Notwendigkeit,
Institut für Technische Chemie Technische Universität Clausthal Technisch-chemisches Praktikum TCB Versuch: Rektifikation Einleitung In einer Vielzahl von chemischen Produktionsanlagen besteht die Notwendigkeit,
Kleine Formelsammlung Technische Thermodynamik
 Kleine Formelsammlung Technische Thermodynamik von Prof. Dr.-Ing. habil. Hans-Joachim Kretzschmar und Prof. Dr.-Ing. Ingo Kraft unter Mitarbeit von Dr.-Ing. Ines Stöcker 2., aktualisierte Auflage Fachbuchverlag
Kleine Formelsammlung Technische Thermodynamik von Prof. Dr.-Ing. habil. Hans-Joachim Kretzschmar und Prof. Dr.-Ing. Ingo Kraft unter Mitarbeit von Dr.-Ing. Ines Stöcker 2., aktualisierte Auflage Fachbuchverlag
Shortcut Simulation. Abbildung 1: Flowsheet Shortcut Kolonne
 Problemstellung/ Zielsetzung: Shortcut Simulation Die Shortcut Simulation grenzt den optimalen Betriebsbereich einer Rektifikationskolonne für sich annähernd ideal verhaltende Gemische ein. Die Ergebnisse
Problemstellung/ Zielsetzung: Shortcut Simulation Die Shortcut Simulation grenzt den optimalen Betriebsbereich einer Rektifikationskolonne für sich annähernd ideal verhaltende Gemische ein. Die Ergebnisse
Thermodynamik für die Energie- und Verfahrenstechnik mittels molekularer und experimenteller Methoden
 Thermodynamik für die Energie- und Verfahrenstechnik mittels molekularer und experimenteller Methoden Jadran Vrabec et al. Forschungsgebiete am 1. Molekulare Modellierung und Simulation Stoffeigenschaften
Thermodynamik für die Energie- und Verfahrenstechnik mittels molekularer und experimenteller Methoden Jadran Vrabec et al. Forschungsgebiete am 1. Molekulare Modellierung und Simulation Stoffeigenschaften
Verflüssigung von Gasen / Joule-Thomson-Effekt
 Sieden und Kondensation: T p T p S S 0 1 RTSp0 1 ln p p0 Dampfdrucktopf, Autoklave zur Sterilisation absolute Luftfeuchtigkeit relative Luftfeuchtigkeit a ( g/m 3 ) a pw rel S ps rel 1 Taupunkt erflüssigung
Sieden und Kondensation: T p T p S S 0 1 RTSp0 1 ln p p0 Dampfdrucktopf, Autoklave zur Sterilisation absolute Luftfeuchtigkeit relative Luftfeuchtigkeit a ( g/m 3 ) a pw rel S ps rel 1 Taupunkt erflüssigung
-aus theoretischen Ansätzen - Approximationen
 2.3 Bestimmung von Zustandsgrößen Zustand wird bestimmt durch zwei unabhängige, intensive Zustandsgrößen Bestimmung anderer Zustandsgrößen aus Stoffmodellen Zustandsgleichungen Stoffmodelle aus - Experimenten
2.3 Bestimmung von Zustandsgrößen Zustand wird bestimmt durch zwei unabhängige, intensive Zustandsgrößen Bestimmung anderer Zustandsgrößen aus Stoffmodellen Zustandsgleichungen Stoffmodelle aus - Experimenten
Thermodynamik I. Sommersemester 2012 Kapitel 3, Teil 2. Prof. Dr.-Ing. Heinz Pitsch
 Thermodynamik I Sommersemester 2012 Kapitel 3, Teil 2 Prof. Dr.-Ing. Heinz Pitsch Kapitel 3, Teil 2: Übersicht 3 Energiebilanz 3.3 Bilanzgleichungen 3.3.1 Massebilanz 3.3.2 Energiebilanz und 1. Hauptsatz
Thermodynamik I Sommersemester 2012 Kapitel 3, Teil 2 Prof. Dr.-Ing. Heinz Pitsch Kapitel 3, Teil 2: Übersicht 3 Energiebilanz 3.3 Bilanzgleichungen 3.3.1 Massebilanz 3.3.2 Energiebilanz und 1. Hauptsatz
Multiple-Choice Test. Alle Fragen können mit Hilfe der Versuchsanleitung richtig gelöst werden.
 PCG-Grundpraktikum Versuch 1- Dampfdruckdiagramm Multiple-Choice Test Zu jedem Versuch im PCG wird ein Vorgespräch durchgeführt. Für den Versuch Dampfdruckdiagramm wird dieses Vorgespräch durch einen Multiple-Choice
PCG-Grundpraktikum Versuch 1- Dampfdruckdiagramm Multiple-Choice Test Zu jedem Versuch im PCG wird ein Vorgespräch durchgeführt. Für den Versuch Dampfdruckdiagramm wird dieses Vorgespräch durch einen Multiple-Choice
Format des Stoffdatensatzes -.dat-datei
 Format des Stoffdatensatzes -.dat-datei Christian Redepenning, Jürgen Bausa 01.12.2015 Dieses Dokument beschreibt den Aufbau des Stoffdatensatzes auf dem alle hier entwickelten Routinen aufbauen. Mit der
Format des Stoffdatensatzes -.dat-datei Christian Redepenning, Jürgen Bausa 01.12.2015 Dieses Dokument beschreibt den Aufbau des Stoffdatensatzes auf dem alle hier entwickelten Routinen aufbauen. Mit der
5.07.241 Grundlagen der Technischen Chemie (SS 2011)
 5.07.241 Grundlagen der Technischen Chemie (SS 2011) J. Rarey, A. Brehm C.v.O.-Universität Oldenburg Oldenburg (Oldb), Deutschland 5.07.241 Grundlagen der Technischen Chemie (SS 2011) Dozenten: 1989 2010
5.07.241 Grundlagen der Technischen Chemie (SS 2011) J. Rarey, A. Brehm C.v.O.-Universität Oldenburg Oldenburg (Oldb), Deutschland 5.07.241 Grundlagen der Technischen Chemie (SS 2011) Dozenten: 1989 2010
Electronic Workflow wie fühlt sich das an?
 Electronic wie fühlt sich das an? Aktueller Stand der COMOS Einführung bei EC Hand out Lunch & Learn am 25.03.2011 - Gestern Heute Morgen Gestern Heute Morgen Prozess seriell seriell, verkürzt durch Werkzeuge
Electronic wie fühlt sich das an? Aktueller Stand der COMOS Einführung bei EC Hand out Lunch & Learn am 25.03.2011 - Gestern Heute Morgen Gestern Heute Morgen Prozess seriell seriell, verkürzt durch Werkzeuge
Phasengleichgewicht und Phasenübergänge. Gasförmig
 Phasengleichgewicht und Phasenübergänge Siedetemperatur Flüssig Gasförmig Sublimationstemperatur Schmelztemperatur Fest Aus unserer Erfahrung mit Wasser wissen wir, dass Substanzen ihre Eigenschaften bei
Phasengleichgewicht und Phasenübergänge Siedetemperatur Flüssig Gasförmig Sublimationstemperatur Schmelztemperatur Fest Aus unserer Erfahrung mit Wasser wissen wir, dass Substanzen ihre Eigenschaften bei
6.4.2 VerdampfenundEindampfen... 427 6.4.3 Destillieren und Rektifizieren... 430 6.4.4 Absorbieren... 436
 Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeine Grundlagen... 1 1.1 Thermodynamik... 1 1.1.1 Von der historischen Entwicklung der Thermodynamik 1 1.1.2 WasistThermodynamik?... 9 1.2 SystemundZustand... 11 1.2.1 SystemundSystemgrenzen...
Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeine Grundlagen... 1 1.1 Thermodynamik... 1 1.1.1 Von der historischen Entwicklung der Thermodynamik 1 1.1.2 WasistThermodynamik?... 9 1.2 SystemundZustand... 11 1.2.1 SystemundSystemgrenzen...
Chemie Ingenieur Technik. Dynamische Methode zur Berechnung thermodynamischer Gleichgewichte in reaktiven Mehrphasensystemen
 Dynamische Methode zur Berechnung thermodynamischer Gleichgewichte in reaktiven Mehrphasensystemen Journal: Chemie Ingenieur Technik Manuscript ID cite.000.r Wiley - Manuscript type: Forschungsarbeit Date
Dynamische Methode zur Berechnung thermodynamischer Gleichgewichte in reaktiven Mehrphasensystemen Journal: Chemie Ingenieur Technik Manuscript ID cite.000.r Wiley - Manuscript type: Forschungsarbeit Date
Thermodynamik I. Sommersemester 2012 Kapitel 2, Teil 1. Prof. Dr. Ing. Heinz Pitsch
 Thermodynamik I Sommersemester 2012 Kapitel 2, Teil 1 Prof. Dr. Ing. Heinz Pitsch Kapitel 2, Teil 1: Übersicht 2 Zustandsgrößen 2.1 Thermische Zustandsgrößen 2.1.1 Masse und Molzahl 2.1.2 Spezifisches
Thermodynamik I Sommersemester 2012 Kapitel 2, Teil 1 Prof. Dr. Ing. Heinz Pitsch Kapitel 2, Teil 1: Übersicht 2 Zustandsgrößen 2.1 Thermische Zustandsgrößen 2.1.1 Masse und Molzahl 2.1.2 Spezifisches
Molzahl: n = N/N A [n] = mol N ist die Anzahl der Atome oder Moleküle des Stoffes. Molmasse oder Molekularmasse: M [M ]= kg/kmol
![Molzahl: n = N/N A [n] = mol N ist die Anzahl der Atome oder Moleküle des Stoffes. Molmasse oder Molekularmasse: M [M ]= kg/kmol Molzahl: n = N/N A [n] = mol N ist die Anzahl der Atome oder Moleküle des Stoffes. Molmasse oder Molekularmasse: M [M ]= kg/kmol](/thumbs/50/26795947.jpg) 2. Zustandsgrößen 2.1 Die thermischen Zustandsgrößen 2.1.1. Masse und Molzahl Reine Stoffe: Ein Mol eines reinen Stoffes enthält N A = 6,02214. 10 23 Atome oder Moleküle, N A heißt Avogadro-Zahl. Molzahl:
2. Zustandsgrößen 2.1 Die thermischen Zustandsgrößen 2.1.1. Masse und Molzahl Reine Stoffe: Ein Mol eines reinen Stoffes enthält N A = 6,02214. 10 23 Atome oder Moleküle, N A heißt Avogadro-Zahl. Molzahl:
Messung und Berechnung von Tieftemperatur- Phasengleichgewichten für kryogene Gemischkältekreisläufe
 Messung und Berechnung von Tieftemperatur- Phasengleichgewichten für kryogene Gemischkältekreisläufe DECHEMA Thermodynamik-Kolloquium, Kaiserslautern, 6. Oktober 2016 INSTITUT FÜR TECHNISCHE THERMODYNAMIK
Messung und Berechnung von Tieftemperatur- Phasengleichgewichten für kryogene Gemischkältekreisläufe DECHEMA Thermodynamik-Kolloquium, Kaiserslautern, 6. Oktober 2016 INSTITUT FÜR TECHNISCHE THERMODYNAMIK
Thomas Wenzel (Autor) Untersuchung von Phasengleichgewichten bei der Reaktivextraktion von Schwermetallionen mit Di(2- ethylhexyl)phosphorsäure
 Thomas Wenzel (Autor) Untersuchung von Phasengleichgewichten bei der Reaktivextraktion von Schwermetallionen mit Di(2- ethylhexyl)phosphorsäure https://cuvillier.de/de/shop/publications/3244 Copyright:
Thomas Wenzel (Autor) Untersuchung von Phasengleichgewichten bei der Reaktivextraktion von Schwermetallionen mit Di(2- ethylhexyl)phosphorsäure https://cuvillier.de/de/shop/publications/3244 Copyright:
Ableitung thermischer Randbedingungen für lineare Antriebseinheiten
 Ableitung thermischer Randbedingungen für lineare Antriebseinheiten Dipl.-Ing. Matthias Ulmer, Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Schinköthe Universität Stuttgart, Institut für Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik
Ableitung thermischer Randbedingungen für lineare Antriebseinheiten Dipl.-Ing. Matthias Ulmer, Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Schinköthe Universität Stuttgart, Institut für Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik
Konstruktion und Aufbau der Trockenlaufverdichter aus dem Produktionsprogramm
 Technisches Handbuch Verdichter Herausgegeben von der Gruppe Werbung und Messen des Energie- und Kraftmaschinenbaues, Halle H - :*tt -' с VEB VERLAG TECHNIK BERLIN INHALTSVERZEICHNIS X 1. Klassifizierung
Technisches Handbuch Verdichter Herausgegeben von der Gruppe Werbung und Messen des Energie- und Kraftmaschinenbaues, Halle H - :*tt -' с VEB VERLAG TECHNIK BERLIN INHALTSVERZEICHNIS X 1. Klassifizierung
d) Das ideale Gas makroskopisch
 d) Das ideale Gas makroskopisch Beschreibung mit Zustandsgrößen p, V, T Brauchen trotzdem n, R dazu Immer auch Mikroskopische Argumente dazunehmen Annahmen aus mikroskopischer Betrachtung: Moleküle sind
d) Das ideale Gas makroskopisch Beschreibung mit Zustandsgrößen p, V, T Brauchen trotzdem n, R dazu Immer auch Mikroskopische Argumente dazunehmen Annahmen aus mikroskopischer Betrachtung: Moleküle sind
Physikalische Chemie. Heinz Hug Wolfgang Reiser EHRMITTEL. EUROPA-FACHBUCHREIHE für Chemieberufe. 2. neu bearbeitete Auflage. von
 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. EHRMITTEL EUROPA-FACHBUCHREIHE für Chemieberufe Physikalische Chemie
2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. EHRMITTEL EUROPA-FACHBUCHREIHE für Chemieberufe Physikalische Chemie
Entwicklung eines Reifegradmodells für einen Prozessmanagement-Prozess an Hochschulen
 Entwicklung eines Reifegradmodells für einen Prozessmanagement-Prozess an Hochschulen improve!2008 Prozesse an einer Hochschule Guter Übergang in die Hochschule Gute Lehre Gute Betreuung Guter Übergang
Entwicklung eines Reifegradmodells für einen Prozessmanagement-Prozess an Hochschulen improve!2008 Prozesse an einer Hochschule Guter Übergang in die Hochschule Gute Lehre Gute Betreuung Guter Übergang
Modelle zur Beschreibung von Gasen und deren Eigenschaften
 Prof. Dr. Norbert Hampp 1/7 1. Das Ideale Gas Modelle zur Beschreibung von Gasen und deren Eigenschaften Modelle = vereinfachende mathematische Darstellungen der Realität Für Gase wollen wir drei Modelle
Prof. Dr. Norbert Hampp 1/7 1. Das Ideale Gas Modelle zur Beschreibung von Gasen und deren Eigenschaften Modelle = vereinfachende mathematische Darstellungen der Realität Für Gase wollen wir drei Modelle
Kolligative Eigenschaften
 Kolligative Eigenschaften Kolligative (lat. colligare, sammeln) Eigenschaften (in verdünnter Lösung): f(nzahl der eilchen des gelösten Stoffs) f(rt der eilchen des gelösten Stoffs) eispiel: Gefrierpunkt,
Kolligative Eigenschaften Kolligative (lat. colligare, sammeln) Eigenschaften (in verdünnter Lösung): f(nzahl der eilchen des gelösten Stoffs) f(rt der eilchen des gelösten Stoffs) eispiel: Gefrierpunkt,
Aufgabe, Bedeutung und Definition der chemischen Reaktionstechnik... 1
 Kapitel 1 Aufgabe, Bedeutung und Definition der chemischen Reaktionstechnik... 1 1. Klassifizierung chemischer Reaktionen 2 2. Grundbegriffe der Reaktionstechnik 3 Kapitel 2 Stöchiometrie chemischer Reaktionen
Kapitel 1 Aufgabe, Bedeutung und Definition der chemischen Reaktionstechnik... 1 1. Klassifizierung chemischer Reaktionen 2 2. Grundbegriffe der Reaktionstechnik 3 Kapitel 2 Stöchiometrie chemischer Reaktionen
 Lösungen flüchtiger Stoffe - Stofftrennung http://ac16.uni-paderborn.de/lehrveranstaltungen/_aac/vorles/skript/kap_7/kap7_5/ Für Lösungen flüchtiger Stoffe ist der Dampfdruck des Gemischs ebenfalls von
Lösungen flüchtiger Stoffe - Stofftrennung http://ac16.uni-paderborn.de/lehrveranstaltungen/_aac/vorles/skript/kap_7/kap7_5/ Für Lösungen flüchtiger Stoffe ist der Dampfdruck des Gemischs ebenfalls von
Hydrochemische System-Modellierung - Master-Kurs - Die Eigendissoziation des Wassers ph -Diagramme, lg c OH. - und lg c OH -Diagramme. K.
 Hydrochemische System-Modellierung - Master-Kurs - Die Eigendissoziation des Wassers ph -Diagramme, lg c OH - und lg c OH -Diagramme K. Molt Universität Duisburg-Essen, FB Chemie, FG Instrumentelle Analytik
Hydrochemische System-Modellierung - Master-Kurs - Die Eigendissoziation des Wassers ph -Diagramme, lg c OH - und lg c OH -Diagramme K. Molt Universität Duisburg-Essen, FB Chemie, FG Instrumentelle Analytik
2. GRUNDLAGEN. 2.1 Kontinuierliche Thermodynamik
 2 GRUNDLAGEN 21 Kontinuierliche Thermodynamik Die Thermodynamik basiert auf Stoffmengen Eine thermodynamische extensive Größe Z wird hierbei als Funktion von der Temperatur T, dem Druck p und den Stoffmengen
2 GRUNDLAGEN 21 Kontinuierliche Thermodynamik Die Thermodynamik basiert auf Stoffmengen Eine thermodynamische extensive Größe Z wird hierbei als Funktion von der Temperatur T, dem Druck p und den Stoffmengen
Inhaltsverzeichnis. 1 Grundlagen der Thermodynamik l VII
 VII Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen der Thermodynamik l 1.1 Einfahrung 1 1.2 Materie 2 1.3 Energie 2 1.3.1 Vorbemerkungen 2 1.3.2 Kinetische und potentielle Energie 3 1.3.3 Äußere und Innere Energie 4
VII Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen der Thermodynamik l 1.1 Einfahrung 1 1.2 Materie 2 1.3 Energie 2 1.3.1 Vorbemerkungen 2 1.3.2 Kinetische und potentielle Energie 3 1.3.3 Äußere und Innere Energie 4
PROGRAMME FÜR KÄLTEMITTEL-STOFFDATEN
 ASEREPwin ASEREPfxl PROGRAMME FÜR KÄLTEMITTEL-STOFFDATEN REFLIBwin REFLIBfxl Seite 2 Programme für Kältemittelstoffdaten 1 Einleitung Am Institut für Luft- und Kältetechnik Dresden (ILK) werden seit vielen
ASEREPwin ASEREPfxl PROGRAMME FÜR KÄLTEMITTEL-STOFFDATEN REFLIBwin REFLIBfxl Seite 2 Programme für Kältemittelstoffdaten 1 Einleitung Am Institut für Luft- und Kältetechnik Dresden (ILK) werden seit vielen
Entwicklung einer Holzgas-Brennkammer für Mikrogasturbinen
 Das Vorhaben wird bearbeitet von Gefördert durch: Projektträger: Entwicklung einer Holzgas-Brennkammer für Mikrogasturbinen 03KB047 A-D, Projekt DeHoGas Programmbegleitung: Workshop Vom Labor zum Markt
Das Vorhaben wird bearbeitet von Gefördert durch: Projektträger: Entwicklung einer Holzgas-Brennkammer für Mikrogasturbinen 03KB047 A-D, Projekt DeHoGas Programmbegleitung: Workshop Vom Labor zum Markt
Modell-Bibliothek Thermo-Fluidtechnik
 Modell-Bibliothek Thermo-Fluidtechnik Thermo-fluidtechnische Systeme und Komponenten können mit Hilfe der Bibliothek Thermo-Fluidtechnik sehr schnell und effektiv untersucht werden. Die Bibliothekselemente
Modell-Bibliothek Thermo-Fluidtechnik Thermo-fluidtechnische Systeme und Komponenten können mit Hilfe der Bibliothek Thermo-Fluidtechnik sehr schnell und effektiv untersucht werden. Die Bibliothekselemente
Die Innere Energie U
 Die Innere Energie U U ist die Summe aller einem System innewohnenden Energien. Es ist unmöglich, diese zu berechnen. U kann nicht absolut angegeben werden! Differenzen in U ( U) können gemessen werden.
Die Innere Energie U U ist die Summe aller einem System innewohnenden Energien. Es ist unmöglich, diese zu berechnen. U kann nicht absolut angegeben werden! Differenzen in U ( U) können gemessen werden.
Ein Vorgehensmodell zur Durchführung einer prozessorientierten Sicherheitsanalyse Daniela Simić-Draws
 Ein Vorgehensmodell zur Durchführung einer prozessorientierten Sicherheitsanalyse Daniela Simić-Draws Institut für Wirtschafts- und Verwaltungsinformatik Forschungsgruppe IT-Risk-Management Universität
Ein Vorgehensmodell zur Durchführung einer prozessorientierten Sicherheitsanalyse Daniela Simić-Draws Institut für Wirtschafts- und Verwaltungsinformatik Forschungsgruppe IT-Risk-Management Universität
Wärmequellen für Wärmepumpen im energetischen und wirtschaftlichen Vergleich
 Institut für Gebäude- und Solartechnik Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch Mühlenpfordtstraße 23 D-38106 Braunschweig www.tu-braunschweig.de/igs Wärmequellen für Wärmepumpen im energetischen und wirtschaftlichen
Institut für Gebäude- und Solartechnik Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch Mühlenpfordtstraße 23 D-38106 Braunschweig www.tu-braunschweig.de/igs Wärmequellen für Wärmepumpen im energetischen und wirtschaftlichen
Inhaltsverzeichnis. Formelzeichen, Indizes, Abkürzungen und Definitionen. 1 Einleitung 1. 2 Grundlagen 3. Inhaltsverzeichnis
 XI Abstract Formelzeichen, Indizes, Abkürzungen und Definitionen VII XI XVI 1 Einleitung 1 2 Grundlagen 3 2.1 Nahe- und überkritische Fluide Begriffsbestimmung und besondere Eigenschaften...3 2.2 Einsatzmöglichkeiten
XI Abstract Formelzeichen, Indizes, Abkürzungen und Definitionen VII XI XVI 1 Einleitung 1 2 Grundlagen 3 2.1 Nahe- und überkritische Fluide Begriffsbestimmung und besondere Eigenschaften...3 2.2 Einsatzmöglichkeiten
Prozessoptimierung im Krankenhausbereich. Ursula-Änna Schmidt. Verlag Dr. Kovac
 Ursula-Änna Schmidt Prozessoptimierung im Krankenhausbereich Logistische Abläufe mit Schwerpunkt Radiologie und deren Verbesserungspotenziale Verlag Dr. Kovac Hamburg 2011 ^ Abbildungsverzeichnis XI Tabellenverzeichnis
Ursula-Änna Schmidt Prozessoptimierung im Krankenhausbereich Logistische Abläufe mit Schwerpunkt Radiologie und deren Verbesserungspotenziale Verlag Dr. Kovac Hamburg 2011 ^ Abbildungsverzeichnis XI Tabellenverzeichnis
Thermodynamik für Werkstoffingenieure und Metallurgen
 Thermodynamik für Werkstoffingenieure und Metallurgen Eine Einführung 2., stark überarbeitete Auflage Von Prof. Dr.-Ing. Martin G. Frohberg Technische Universität Berlin Mit 99 Abbildungen und 14 Tabellen
Thermodynamik für Werkstoffingenieure und Metallurgen Eine Einführung 2., stark überarbeitete Auflage Von Prof. Dr.-Ing. Martin G. Frohberg Technische Universität Berlin Mit 99 Abbildungen und 14 Tabellen
Aufgabe 1: Theorie Punkte
 Aufgabe 1: Theorie.......................................... 30 Punkte (a) (2 Punkte) In einen Mischer treten drei Ströme ein. Diese haben die Massenströme ṁ 1 = 1 kg/s, ṁ 2 = 2 kg/s und ṁ 3 = 2 kg/s.
Aufgabe 1: Theorie.......................................... 30 Punkte (a) (2 Punkte) In einen Mischer treten drei Ströme ein. Diese haben die Massenströme ṁ 1 = 1 kg/s, ṁ 2 = 2 kg/s und ṁ 3 = 2 kg/s.
