Dünne Schichten. Tobias Renz Raphael Schmager. Sebastian Skacel
|
|
|
- Angelika Michel
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 FAKULTÄT FÜR PHYSIK PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FÜR FORTGESCHRITTENE PRAKTIKUM MODERNE PHYSIK Gruppe Nr. 25 Kurs: Mo Mi SS 2014 Versuch: Dünne Schichten Namen: Tobias Renz Raphael Schmager Assistent: Sebastian Skacel durchgeführt am: abgabe am: Note gesamt Datum: anerkannt: Bemerkung:
2
3 Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen Vakuumerzeugung und Vakuummessung Vakuumpumpen Vakuummessung Experiment Ziel des Versuchs Aufbau Vorbereitung der Proben Aufgabe 1: Schichtdickenabhängigkeit R des Widerstands von Silber Aufgabe 2: Zeitlicher Verlauf R(t) nach dem Aufdampfen Aufgabe 3: Abhängigkeit des Widerstandes beim Aufdampfen weniger Monolagen Ag bzw. In Aufgabe 4: Verlauf R(t) Auswertung Aufgabe 1: Messung der Schichtdickenabhangigkeit des Widerstands von Silber Aufgabe 2: Zeitlicher Verlauf des Widerstands nach dem Aufdampfen Aufgabe 3: Abhängigkeit des Widerstands von der Temperatur Aufgabe 4: Widerstand beim weiteren Aufdampfen von Ag und In Anhang 18 Gruppe: 25 1
4 Karlsruher Institut für Technologie (KIT) SS 2014 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene 2 Dünne Schichten von Tobias Renz und Raphael Schmager Gruppe: 25 Durchgeführt am
5 1 Grundlagen 1.1 Vakuumerzeugung und Vakuummessung Zunächst werden die Funktionsweisen der im Versuch verwendeten Instrumente zur Erzeugung und Messung des Vakuums erläutert. Ein Vakuum wird je nach Druck p in die folgenden Druckbereiche eingeteilt [nach: ]: Grobvakuum: 1 mbar < p < 300 mbar Feinvakuum: 10 3 mbar < p < 1 mbar Hochvakuum: 10 7 mbar < p < 10 3 mbar Ultrahochvakuum: mbar < p < 10 7 mbar Extrem hohes Vakuum: p < mbar Vakuumpumpen Drehschieberpumpen: Die Drehschieberpumpe wird meist als Vorpumpe genutzt und kann ein Grobvakuum oder sogar ein Feinvakuum erzeugen. Eine Drehschieberpumpe besteht aus einem im Inneren zylindrischen Gehäuse (Stator). In diesem Gehäuse dreht sich ein exzentrischer Rotor, in dessen Schlitzen Schieber angebracht sind. Diese Schieber werden durch die Zentrifugalkraft an die Gehäusewand gedrückt. Diese Teilen den Raum zwischen Rotor und Stator in unterschiedlich groÿe Volumina ein. Durch den Einlass gelangt das Gas in den sogenannten Schöpfraum, welcher sich bei der Rotation vergröÿert. Die Saugwirkung kommt durch das sich vergröÿernde Volumen zustande. Hat der Schöpfraum das maximale Volumen erreicht, verschlieÿt ein Schieber den Schöpfraum zum Einlass. Beim Weiterdrehen verkleinert sich der Schöpfraum und das Gas wird verdichtet und die Verdichtungskammer wird zum Auslass geönet. Das Gas entweicht und ein neuer Zyklus beginnt. Diusionspumpen: Die Diusionspumpe ist eine Hoch- bis Ultrahochvakuumpumpe und basiert auf dem Prinzip einer Strahlpumpe. Die Pumpe besteht aus einem rohrförmigen Pumpenkörper, der oben mit einem Hochvakuumansch versehen ist. Die darüber bendliche Dampfsperre verhindert das Eindringen von Treibmitteldampf in den Vakuumbehälter. Am Boden bendet sich der Siederaum für das Treibmittel. An der Seite bendet sich das Vakuumrohr, das mit der Vorpumpe verbunden ist. Im Inneren bendet sich das Düsensystem. Das Treibmittel wird erhitzt, verdampft und steigt in den Dampfrohren des Innenteils nach oben, wo es in die Düsen gelangt. Durch die Düsen wird der Treibmitteldampf nach unten umgelenkt. Hinter dem engsten Querschnitt expandiert der Dampf und gelangt in den Bereich zwischen Düsensystem und gekühlter Wand. In dem Raum unter jeder Düsenkappe entsteht ein schirmförmiger Dampfstrahl der mit hoher Übergeschwindigkeit nach unten strömt. Die abzupumpenden Gasteilchen treten durch Gruppe: 25 1
6 Dünne Schichten den Hochvakuum ansch ein, gelangen in den Dampfstrahl der verschiedenen Düsen und nehmen durch Stöÿe deren Geschwindigkeitsrichtung an und werden nach unten abtransportiert. Das komprimierte Gas tritt in das Vorvakuumrohr ein und wird abgepumpt. 1 Abbildung 1: Schematischer Aufbau einer Di usionspumpe. Aus: Vorbereitungsmappe Vakuummessung Wärmeleitungsvakuumeter - Pirani Messröhre Wärmeleitungsvakuummeter messen den druckabhängigen Wärmeverlust eines erhitzen Drahts. Sie dienen zur Messung für das Grob- und Feinvakuum. Der erhitzte Draht wird als Teil einer Wheatstoneschen Brücke verwendet um den Draht mit der nötigen Leistung zu versorgen und seinen Widerstand (und damit die Temperatur) zu messen. Eine Möglichkeit der Druckmessung ist die Drahttemperatur konstant zu halten und die dazu nötige Heizleistung zu messen. Die benötigte Leistung ist ein Maÿ für den Druck. Ionisationsvakuumeter - Penning-Vakuumeter Um niedrige Drücke zu messen, wird beim Ionisationsvakuumeter eine ausreichend hohe Spannung zwischen zwei Metallelektroden angelegt um vorhandene Elektronen zu beschleunigen und durch Stoÿprozesse Gasteilchen zu ionisieren. Es bildet sich eine Gasentladung, wobei der Gasentladungsstrom druckabhängig ist und als Messgröÿe dient. Um sehr niedrige Drücke zu messen, wird ein Magnetfeld so angelegt, dass die Elektronen auf ihrem Weg von der Kathode Gruppe: 25 2
7 Dünne Schichten zur Anode Spiralbahnen durchführen. Dadurch wird der Weg der Elektronen verlängert und eine höhere Ionenausbeute erreicht. Mit einem Ionisationsvakuumeter lassen sich somit Drücke im Hoch- Ultrahochvakuumbreich messen. 2 Experiment 2.1 Ziel des Versuchs In diesem Versuch soll der Umgang mit einer Hochvakuumapparatur zum Aufdampfen dünner metallischer Schichten erlernt werden. Dabei wird während des Schichtwachstums der elektrische Widerstand gemessen. 2.2 Aufbau Abbildung 2: Schematischer Versuchsaufbau. Aus: Vorbereitungsmappe Um die Schichten auf die Probe aufzudampfen wird die in Abbildung 2 und 4 gezeigte Vakuumapparatur genutzt. Die Messvorrichtung ist in Abbildung 3 zu sehen. Durch eine Öldi usionspumpe mit vorgeschalteter Drehschieberpumpe wird im Rezipienten ein Hochvakuum erzeugt. Im Rezipient be nden sich beheizbare Tiegel, die mit Metallen (Ag, In) befüllt sind. Nach Gruppe: 25 3
8 Erreichen des Hochvakuums werden die Tiegel erhitzt und die Metalle verdampft. Trit das Metall auf das Glassubstrat kondensiert es. Durch verschiedene Blenden können die einzelnen Metalle an die gewünschte Probenstelle aufgedampft werden. Die Schichtdicke des aufgedampften Substrats wird durch einen Schwingquarz bestimmt. Durch das Bedampfen des Quarzes nimmt die Masse zu und die Eigenfrequenz wird niedriger. Abbildung 3: Versuchsstand im Praktikumslabor: Messvorrichtung. Gruppe: 25 4
9 Abbildung 4: Versuchsstand im Praktikumslabor: Vakuumapparatur in der die Probe eingebaut wurde. 2.3 Vorbereitung der Proben Um später den elektrischen Widerstand messen zu können, werden zunächst Kontakte auf das Glassubstrat aufgedampft. Dazu wird auf den Halter eine Schicht Indium als Untergrund (ca. Gruppe: 25 5
10 Dünne Schichten 30 Å) und eine Silberschicht als Kontakt (ca. 500 Å) aufgedampft. Es werden drei Kontakte zur elektrischen Kontaktierung aufgetragen, so dass zwei Zwischenräume für die zu untersuchende Schicht frei bleiben. Der Widerstand kann entweder über eine Vierpunkt oder eine Brückenschaltung gemessen werden. Bei der Vierpunktmethode werden vier Messspitzen auf einer Probe angebracht. Über die beiden äuÿeren wird ein bekannter Strom angelegt und zwischen den beiden Inneren wird die Spannung gemessen. 13,46 5,01 Abbildung 5: Bedampfte Probe. Links ist der freie Streifen auf dem Substrat erkennbar. Hier wurde nichts aufgedampft. Die bedeckte Schicht auf der rechten Hälfte der Probe (Blende 1) wurde von uns mit Silber und Indium bedampft und untersucht. Bei den Aufgaben soll neben dem absoluten Widerstand R auch der spezi sche Widerstand ρ bestimmt werden. Dazu benötigt man den Widerstand R, die Schichtdicke ds sowie die von den Probenabmessungen abhängigen Gröÿen b und L. Die Gröÿe b gibt die Breite und L die Länge der Probe an, durch welche der Strom ieÿt. Die Bestimmung dieser Gröÿen ist in Abbildung 5 dargestellt und haben folgende Ausdehnungen: b = 5,01 mm; L = 13,46 mm. Der spezi sche Widerstand lässt sich folgendermaÿen berechnen: ρ= R b ds L (1) 2.4 Aufgabe 1: Schichtdickenabhängigkeit R des Widerstands von Silber Es soll der Widerstand in Abhängigkeit der Silberschichtdicke beim aufdampfen gemessen werden. Beim Aufdampfen werden sich zunächst Inseln aus Silber ausbilden, wobei ein Strom uss somit nur über Tunnele ekte möglich ist. Sobald sich die Inseln verbinden und die Silberschicht homogen ist, sollte der Widerstand stark sinken. Gruppe: 25 6
11 2.5 Aufgabe 2: Zeitlicher Verlauf R(t) nach dem Aufdampfen Die Blende wird geschlossen. Die Menge an Silber ändert sich nun nicht mehr und der Widerstand soll in Abhängigkeit der Zeit gemessen werden. Besitzt das Silber noch Fehler in der Kristallstruktur gibt es Streuung von Elektronen an Störstellen und Defekten, was zu einem höheren Widerstand führt. Diese Fehler werden durch thermische Bewegungen im Laufe der Zeit ausgeglichen und der Widerstand sollte sinken. 2.6 Aufgabe 3: Abhängigkeit des Widerstandes beim Aufdampfen weniger Monolagen Ag bzw. In In diesem Versuchsteil soll untersucht werden, wie sich der Widerstand ändert, wenn weitere Lagen Silber oder Indium aufgedampft werden. Wird die Silberschichtdicke verändert, so besitzt der Widerstand folgende Abhängigkeit: R = A + B d (2) wobei d die Schichtdicke beschreibt. Wir erwarten deshalb eine Abnahme des Widerstandes bei zunehmender Schichtdicke. Wird Indium auf die Silberschicht aufgetragen, so sollte der Widerstand, durch Streuung an der zu Silber verschiedenen Kristallstruktur, zunächst steigen. Bei ausreichend dicker Indium Schicht sollte der Widerstand durch die Leitfähigkeit der Indium Schicht wieder fallen. 2.7 Aufgabe 4: Verlauf R(t) Der Probenhalter soll gekühlt werden und die Abhängigkeit des Widerstands von der Temperatur gemessen werden. Für den temperaturabhängigen Teil des Widerstand ist hauptsächlich die Elektron-Phonon Streuung zuständig. Durch Abkühlen nimmt die thermische Anregung der Gitteratome im Kristall ab und die Elektron-Phonon Streuung nimmt ab. Deshalb sollte der Widerstand für niedrige Temperaturen niedriger sein. 3 Auswertung 3.1 Aufgabe 1: Messung der Schichtdickenabhangigkeit des Widerstands von Silber Nach dem Aufdampfen der Kontaktschicht wurde die Probe nach dem Belüften des Rezipienten ausgebaut und auf einen anderen Halter montiert. Dieser ist in Abbildung 5 zu sehen. Die Kontaktierung wurde wie in Abschnitt 2.3 beschrieben durchgeführt. Anschlieÿend kam die Probe wieder in die Anlage. Ein Vakuum von 2,5 mpa hat sich durch erneutes Evakuieren eingestellt. Nun wurde der Strom, welcher den Tiegel mit Silber beheizt, schrittweise auf I=21 A erhöht. An der Ausleseelektronik des Schwingquarz war ein konstante Rate von 0,6 Å/s abzulesen. Gemessen wurde nun der Spannungsabfall über der Probe bei Gruppe: 25 7
12 konstantem Strom. Die Messwerte benden sich in Tabelle 1 im Anhang. Widerstand R / MΩ Schichtdicke d / Å Abbildung 6: Widerstand R in Abhängigkeit der Schichtdicke d. Fällt der Widerstand unter die Messbare Grenze so fällt er rasch ab bis auf einen Wert von 3,13 kω. Ab einer Schichtdicke von etwa 375 Å fällt die Spannung rasch ab. Folglich verringert sich der Widerstand nach R = U I. In Abbildung 6 ist die gemessene Abhängigkeit dargestellt. Unsere Erwartungen haben sich so bestätigt. Die Leitfähigkeit ( 1 R ) nimmt rasch zu, nachdem sich die einzelnen Inseln zu einer ächendeckenden Silberschicht ausbilden können. Nach Gleichung 1 lässt sich der spezischer Widerstand in Abhängigkeit der Schichtdicke auftragen. Dies ist in Abbildung 7 zu sehen. Die Werte für b = 5, 01 und L = 13, 46 sind in Abbildung 5 zu sehen. Beide Werte werden hier ohne Einheiten angegeben, da sie als Verhältnis in die Formel eingehen und lediglich relative Gröÿenverhältnisse wiedergeben. Zu beachten ist hier, dass der Anstieg des spezischen Widerstands mit zunehmender Schichtdicke in der Tatsache resultiert, dass die gemessene Spannung in diesem Bereich einen Maximalwert besitzt. Dies liegt vermutlich an der Auösungsgrenze des verwendeten Messgeräts. Sinnvolle Ergebnisse für den spezischen Widerstand sind demnach nur ab einer Schichtdicke von 375 Å zu betrachten. Die Abhängigkeit R 1 d sowie ρ 1 d kann nicht explizit erkannt werden. Der Abfall des (spez.) Widerstands ist bei Å deutlich steiler und gegen Ende bei 500 Å acher als eine Kurve nach Gleichung 2. Es ist daher zu Vermuten, dass direkt nach dem Aufdampfen eine Umordnung stattndet. Die permanente Umordnung lässt den Widerstand damit schneller als 1 d abfallen. Gruppe: 25 8
13 spez. Widerstand ρ / MΩ mm2 m Schichtdicke d / Å Abbildung 7: Normierung von Abbildung 6 auf die Schichtdicke und von Strom druchossene Fläche. ρ Bezeichnet den spezischen Widerstand der Probe. 3.2 Aufgabe 2: Zeitlicher Verlauf des Widerstands nach dem Aufdampfen Nachdem die Schichtdicke von 500 Å aufgetragen wurde, wurde durch Schlieÿen der Blende der Aufdampfprozess gestoppt und der zeitliche Verlauf der Spannung gemessen. Der Druck während dieser Messung betrug ca. 1,5 mpa. Der Widerstand lässt sich aus der Spannung und der konstanten Stromstärke berechnen und ist in Abbildung 8 dargestellt. Auÿerdem wurde wie schon in Aufgabe 1 der spezische Widerstand berechnet und in Abbildung 9 über der Zeit aufgetragen. Gruppe: 25 9
14 180 // Widerstand R / 10 Ω // Zeit t / s Abbildung 8: Zeitlicher Verlauf des Widerstands nach dem Aufdampfen. Vergleicht man den absoluten Widerstand R (Abbildung 8) mit dem spezischen Widerstand ρ (Abbildung 9) wird deutlich, dass der Verlauf für beide Gröÿen gleich ist. Dies liegt daran, dass die Schichtdicke von Silber konstant ist und der spezische Widerstand sich vom absoluten Widerstand nur um einen konstanten Faktor unterscheidet. Wird im folgenden von Widerstand gesprochen ist sowohl der Verlauf des absoluten als auch des spezischen Widerstand gemeint. Gruppe: 25 10
15 40 // 35 spez. Widerstand ρ / Ω mm2 m // Zeit t / s Abbildung 9: Zeitlicher Verlauf des spezischen Widerstands nach dem Aufdampfen. Betrachtet man sich nun den Verlauf des Widerstandes über der Zeit, erkennt man zunächst einen starken Abfall des Widerstands, der sich für groÿe Zeiten einem konstanten Wert annähert. Dieser Verlauf ist, wie schon in der Vorbereitung beschrieben, zu erwarten, da sich das aufgedampfte Silber ordnet und somit Störstellen und Korngrenzen im Gitter abgebaut werden. 3.3 Aufgabe 3: Abhängigkeit des Widerstands von der Temperatur Bevor wir den Widerstand in Abhängigkeit der Temperatur gemessen haben, wurde durch Auüllen der Flüssig-N 2 -Kühlfalle mit neuem Sticksto das Vakuum verbessert. Die folgende Messung wurde bei einem Druck von ca. 0,78 mpa durchgeführt. Um die Temperaturabhängigkeit zu messen, wurde der Probenhalter mit üssigem Sticksto auf eine Temperatur von 90 K abgekühlt. Der Widerstand in Abhängigkeit der Temperatur wurde sowohl beim Abkühlvorgang als auch bei Aufwärmvorgang gemessen. Die Temperatur wurde hierbei nicht direkt in Kelvin sondern als Spannung angezeigt. Die angezeigte Spannung kann folgendermaÿen umgerechnet werden: T (K) = 25, 717U(mV ) (3) Da sich auch hier der absolute und der spezische Widerstand nur um einen konstanten Faktor unterscheiden, wird im folgenden nur von Widerstand gesprochen. Schaut man sich den Verlauf des Widerstands in Abhängigkeit der Temperatur beim Abkühlen (Abbildung 10 bzw. 11) an, so erkennt man einen fast linearen Verlauf. Dies entspricht dem Ohmschen Gesetz und ist deshalb auch zu erwarten. Für niedrige Temperaturen hätten wir Gruppe: 25 11
16 nach dem BlochGrüneisen-Gesetz: ( T ρ Θ D ) 5 (4) eine T 5 Abhängigkeit erwartet. Dabei ist Θ D die Debye-Temperatur, oberhalb von ihr sind alle Schwingungsmoden des Kristalls besetzt. Dies ist beim Abkühlvorgang nicht zu sehen. Da sich beim Abkühlen der Widerstand trotz erreichen der niedrigsten Temperatur noch weiter geändert hat, ist der Widerstandsverlauf beim Abkühlen für niedrige Temperaturen auch nicht exakt bestimmbar. Dies liegt vermutlich an der schlechten Wärmeleitfähigkeit des Glasplättchens und die angezeigte Temperatur entspricht bei schnellen Temperaturänderungen somit nicht der Probentemperatur Widerstand R / Ω Temperatur T / K Abbildung 10: Verhalten des Widerstands beim Abkühlen der Probe. Gruppe: 25 12
17 spez. Widerstand ρ / Ω mm2 m Temperatur T / K Abbildung 11: Verhalten des spezischen Widerstands beim Abkühlen der Probe. Der Verlauf des Widerstands beim Aufheizen (Abbildung 12bzw.13) zeigt für hohe Temperaturen auch einen linearen Verlauf. Für niedrige Temperaturen (ab ca. 140K) weicht der Verlauf des Widerstands davon ab. Dies könnte der zu erwartende T 5 Verlauf sein. Die Messwerte für sehr niedrige Temperaturen weichen vom erwarteten Verlauf ab und sind deshalb nicht zu gebrauchen. Dies könnte an der Messungenauigkeit des Widerstands und der Temperatur für solch tiefe Temperaturen liegen. Gruppe: 25 13
18 Widerstand R / Ω Temperatur T / K Abbildung 12: Verhalten des Widerstands beim Aufheizen der Probe spez. Widerstand ρ / Ω mm2 m Temperatur T / K Abbildung 13: Verhalten des spezischer Widerstands beim Aufheizen der Probe. Gruppe: 25 14
19 3.4 Aufgabe 4: Widerstand beim weiteren Aufdampfen von Ag und In Im letzten Versuchsteil sollte die Auswirkung auf den Widerstand bei weiterem Aufdampfen von Ag bzw. In untersucht werden. Zur Messung des Widerstands nutzten wir eine Wheatstonesche Brückenschaltung. Ein variabler Widerstand wird dabei immer so nachgeregelt, dass die Dierenzspannung einen Wert nahe null annimmt. Der so eingestellte Widerstand entspricht somit dem Widerstand unserer Probe. In Abbildung 14 und 15 ist der absolute Widerstand R bzw. der spezische Widerstand ρ bei weiterem Aufdampfen von Silber aufgetragen. Wie erwartet fällt R sowohl auch ρ für eine dicker werdende Silberschicht ab. Der spezische Widerstand bleibt beim zusätzlichen Aufdampfen von Silber zunächst konstant und fällt dann stark ab. Dies könnte daran liegen, dass das Silber sich zunächst wieder als Inseln ausbildet und deshalb noch keine Erniedrigung des spezischen Widerstands bewirkt Widerstand R / Ω Schichtdiche d / Å Abbildung 14: Widerstand in Abhängigkeit von zusätzlich aufgedampftem Ag. Gruppe: 25 15
20 spez. Widerstand ρ / MΩ mm2 m Schichtdiche d / Å Abbildung 15: Spezischer Widerstand von Ag in Abhängigkeit der Gesamtschichtdicke. Dampft man nun eine Schicht Indium auf das Silber auf, so erwartet man einen Anstieg des Widerstands bei dünnen Indiumschichten. Aufgrund der unterschiedlichen Kristallstruktur sollte der Widerstand aufgrund von zusätzlicher Streuung zunächst ansteigen. Ist die Indiumschicht ausreichend dick um selbst einen signikaten Strom zu leiten nimmt der Widerstand ab. Bei unserer Messung des Widerstands (Abbildung 16) ist dieser Anstieg nicht sichtbar. Der Widerstand ist bei dünnen Indiumschichten zunächst konstant und fällt mit steigender Schichtdicke stark ab. Es könnte sein, dass der Eekt durch zusätzliche Streuung bei unserer Probe nicht ausreichend groÿ war um einen Anstieg des Widerstands messen zu können. Bei der Messung des zeitlichen Verlaufs des Widerstandes haben wir gesehen, dass der Widerstand durch Umordnung in der Kristallstruktur noch weiter abnimmt. Es könnte auch sein, dass die in der zuvor aufgedampften Silberschicht noch solche Prozesse stattgefunden haben und dieser Eekt in Konkurrenz zum Eekt durch das aufgedampfte Indium stand. Schaut man sich den Verlauf des spezischen Widerstands an (Abbildung 17) so sieht man einen leichten Anstieg des spezischen Widerstands bei dünner Indiumschichtdicke. Mit steigender Schichtdicke von In fällt er stark und ab einer absoluten Dicke von ca. 930 Å (entspricht einer Indium Schichtdicke von ca. 50 Å ) nimmt ρ einen annähernd konstanten Wert an. Der leichte Anstieg des spezischen Widerstands könnte auf die Streuung an der Silber/Indium Grenzschicht zurückzuführen sein. Gruppe: 25 16
21 Widerstand R / Ω Schichtdiche d / Å Abbildung 16: Widerstand in Abhängigkeit von zusätzlich aufgedampftem In spez. Widerstand ρ / Ω mm2 m Schichtdiche d / Å Abbildung 17: Spezischer Widerstand von Ag+In für im Bereich von zusätzlich aufgedampften In in Abhängigkeit der Gesamtschichtdicke. Gruppe: 25 17
22 4 Anhang Tabelle 1: Aufgabe 1. Widerstand einer dünnen Si-Schicht in Abhängigkeit der Dicke d. Schichtdicke d / Å Spannung U / V Widerstand / Ω spez. Widerstand ρ / Ω Å , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Gruppe: 25 18
23 407 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2259 Gruppe: 25 19
24 Tabelle 2: Aufgabe 2. Widerstand einer dünnen Si-Schicht in Abhängigkeit der Zeit. Zeit t / s Spannung U / mv Widerstand spez. Widerstand ρ / ΩÅ 0 172, , , , , , ,02 560, , ,62 486, , ,39 433, , ,22 402, , ,98 359, , ,04 340, , ,93 319, , ,08 300, , , ,16 281, , ,31 273, , ,45 264, , , , ,34 253, , , , ,24 242, , , , ,09 230, , ,67 226, , ,26 222, , , , ,58 215, , ,27 212, , ,02 210, , ,79 207, , ,55 205, , , , ,09 200, , ,89 198, , ,67 196, , ,36 193, ,10074 Gruppe: 25 20
25 498 19,13 191, , ,96 189, , ,81 188, , ,65 186, , ,41 184, , ,15 181, , ,12 181, , ,95 179, , ,82 178, , ,68 176, , ,57 175, , ,42 174, , ,32 173, , ,19 171, , ,09 170, , ,95 169, , ,84 168, , ,75 167, , ,57 165, , ,37 163, , ,22 162, , ,07 160, , ,92 159, , ,78 157, , ,49 154, , ,88 98, , ,71 97, , ,45 94, , ,34 93, , ,24 92, ,34354 Tabelle 3: Aufgabe 3. Widerstand beim Abkühlen der Si-Schicht. Temperatur / mv Spannung / mv Temperatur / K Widerstand / Ω ρ / ΩÅ 0,09 9,09 275, ,9 1, ,05 9,07 271, ,7 1, ,25 9,05 266, ,5 1, ,45 9,03 261, ,3 1, Gruppe: 25 21
26 -0,61 9,01 257, ,1 1, , , , ,9 8,98 249, ,8 1, ,97 247,283 89,7 1, ,25 8,95 240, ,5 1, ,4 8,92 236, ,2 1, ,75 8,84 227, ,4 1, ,76 221,566 87,6 1, ,25 8,72 215, ,2 1, ,5 8,67 208, ,7 1, ,75 8,63 202, ,3 1, ,01 8,58 195, ,8 1, ,25 8,54 189, ,4 1, ,5 8,5 182, , ,75 8,45 176, ,5 1, ,41 170,132 84,1 1, ,51 8,32 157, ,2 1, ,75 8,28 150, ,8 1, ,24 144,415 82,4 1, ,5 8,16 131, ,6 1, ,01 8,05 118, ,5 1, , , , ,51 7,95 105, ,5 1, ,75 7,88 99, ,8 1, ,81 92,981 78,1 1, Tabelle 4: Aufgabe 3. Widerstand beim Aufheizen der Si-Schicht. Temperatur / mv Spannung / mv Temperatur / K Widerstand / Ω ρ / ΩÅ -6,55 7,32 104, ,2 1, ,54 7,34 104, ,4 1, ,53 7, , ,45 1, ,52 7,36 105, ,6 1, ,42 7, , ,64 1, ,25 7,37 112, ,7 1, ,18 7, , ,73 1, ,1 7, , ,79 1, ,99 7, , ,91 1, Gruppe: 25 22
27 -5,9 7,4 121, , ,8 7, , ,14 1, ,71 7, , ,28 1, ,59 7, , ,44 1, ,49 7, , ,56 1, ,4 7, , ,72 1, ,3 7, , ,87 1, ,19 7, , ,07 1, ,1 7, , ,23 1, , ,415 75,48 1, ,9 7,57 146, ,7 1, ,79 7, , ,95 1, ,7 7, , ,19 1, ,6 7, , ,49 1, ,5 7, , ,71 1, ,4 7, , ,97 1, ,3 7, , ,26 1, ,2 7, , ,55 1, ,1 7,78 167, ,8 1, ,81 170,132 78,1 1, ,75 7, , ,88 1, ,5 7, , ,57 1, ,25 8, , ,38 1, ,12 195,849 81,2 1, ,5 8, , ,68 1, , ,566 84,16 1, ,5 8, , ,67 1, , ,283 87,38 1, ,5 8, , ,77 1, ,25 8,94 266, ,4 1, ,15 8, , ,54 1, ,08 8, , ,651 1, Tabelle 5: Aufgabe 4. Widerstand beim erneuten Aufdampfen von Silber. Schichtdicke / Å Widerstand / Ω spez. Widerstand ρ / ΩÅ ,9 2, ,4 2, Gruppe: 25 23
28 , , , ,1 2, ,3 2, ,4 2, ,3 2, ,4 2, , ,1 2, ,2 2, ,4 2, ,7 2, ,5 2, ,7 2, ,3 2, ,9 2, , ,9 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 0, ,6 0, ,6 0, ,6 0, Gruppe: 25 24
29 Tabelle 6: Aufgabe 4. Widerstand beim erneuten Aufdampfen von Indium. Schichtdicke / Å Widerstand / Ω spez. Widerstand ρ / ΩÅ ,8 0, ,6 0, ,7 0, ,7 0, ,7 0, ,7 0, ,5 0, ,2 0, ,8 0, ,5 0, ,2 0, ,8 0, ,6 0, ,5 0, ,3 0, ,2 0, ,1 0, , ,9 0, ,8 0, ,7 0, ,6 0, ,5 0, ,4 0, ,3 0, ,2 0, ,1 0, , Gruppe: 25 25
Grundlagen-Vertiefung PW10. Ladungstransport und Leitfähigkeit Version
 Grundlagen-Vertiefung PW10 Ladungstransport und Leitfähigkeit Version 2007-10-11 Inhaltsverzeichnis 1 1.1 Klassische Theorie des Ladungstransports.................. 1 1.2 Temperaturabhängigkeit der elektrischen
Grundlagen-Vertiefung PW10 Ladungstransport und Leitfähigkeit Version 2007-10-11 Inhaltsverzeichnis 1 1.1 Klassische Theorie des Ladungstransports.................. 1 1.2 Temperaturabhängigkeit der elektrischen
Labor Elektrotechnik. Versuch: Temperatur - Effekte
 Studiengang Elektrotechnik Labor Elektrotechnik Laborübung 5 Versuch: Temperatur - Effekte 13.11.2001 3. überarbeitete Version Markus Helmling Michael Pellmann Einleitung Der elektrische Widerstand ist
Studiengang Elektrotechnik Labor Elektrotechnik Laborübung 5 Versuch: Temperatur - Effekte 13.11.2001 3. überarbeitete Version Markus Helmling Michael Pellmann Einleitung Der elektrische Widerstand ist
Vakuum (1) Versuch: P Vorbereitung - Inhaltsverzeichnis
 Physikalisches Anfängerpraktikum 2 Gruppe Mo-16 Sommersemester 2006 Jens Küchenmeister (1253810) Julian Merkert (1229929) Versuch: P2-42 Vakuum (1) - Vorbereitung - Vorbemerkung In diesem Versuch beschäftigen
Physikalisches Anfängerpraktikum 2 Gruppe Mo-16 Sommersemester 2006 Jens Küchenmeister (1253810) Julian Merkert (1229929) Versuch: P2-42 Vakuum (1) - Vorbereitung - Vorbemerkung In diesem Versuch beschäftigen
Stromdurchossene Leiter im Magnetfeld, Halleekt
 Physikalisches Anfängerpraktikum 1 Gruppe Mo-16 Wintersemester 2005/06 Jens Küchenmeister (1253810) Versuch: P1-73 Stromdurchossene Leiter im Magnetfeld, Halleekt - Vorbereitung - Inhaltsverzeichnis 1
Physikalisches Anfängerpraktikum 1 Gruppe Mo-16 Wintersemester 2005/06 Jens Küchenmeister (1253810) Versuch: P1-73 Stromdurchossene Leiter im Magnetfeld, Halleekt - Vorbereitung - Inhaltsverzeichnis 1
Physik 4 Praktikum Auswertung Hall-Effekt
 Physik 4 Praktikum Auswertung Hall-Effekt Von J.W., I.G. 2014 Seite 1. Kurzfassung......... 2 2. Theorie.......... 2 2.1. Elektrischer Strom in Halbleitern..... 2 2.2. Hall-Effekt......... 3 3. Durchführung.........
Physik 4 Praktikum Auswertung Hall-Effekt Von J.W., I.G. 2014 Seite 1. Kurzfassung......... 2 2. Theorie.......... 2 2.1. Elektrischer Strom in Halbleitern..... 2 2.2. Hall-Effekt......... 3 3. Durchführung.........
Vorbereitung: elektrische Messverfahren
 Vorbereitung: elektrische Messverfahren Marcel Köpke 29.10.2011 Inhaltsverzeichnis 1 Ohmscher Widerstand 3 1.1 Innenwiderstand des µa Multizets...................... 3 1.2 Innenwiderstand des AVΩ Multizets.....................
Vorbereitung: elektrische Messverfahren Marcel Köpke 29.10.2011 Inhaltsverzeichnis 1 Ohmscher Widerstand 3 1.1 Innenwiderstand des µa Multizets...................... 3 1.2 Innenwiderstand des AVΩ Multizets.....................
Inhalt. 1. Erläuterungen zum Versuch 1.1. Aufgabenstellung und physikalischer Hintergrund 1.2. Messmethode und Schaltbild 1.3. Versuchdurchführung
 Versuch Nr. 02: Bestimmung eines Ohmschen Widerstandes nach der Substitutionsmethode Versuchsdurchführung: Donnerstag, 28. Mai 2009 von Sven Köppel / Harald Meixner Protokollant: Harald Meixner Tutor:
Versuch Nr. 02: Bestimmung eines Ohmschen Widerstandes nach der Substitutionsmethode Versuchsdurchführung: Donnerstag, 28. Mai 2009 von Sven Köppel / Harald Meixner Protokollant: Harald Meixner Tutor:
Protokoll zum Versuch Nichtlineare passive Zweipole
 Protokoll zum Versuch Nichtlineare passive Zweipole Chris Bünger/Christian Peltz 2005-01-13 1 Versuchsbeschreibung 1.1 Ziel Kennenlernen spannungs- und temperaturabhängiger Leitungsmechanismen und ihrer
Protokoll zum Versuch Nichtlineare passive Zweipole Chris Bünger/Christian Peltz 2005-01-13 1 Versuchsbeschreibung 1.1 Ziel Kennenlernen spannungs- und temperaturabhängiger Leitungsmechanismen und ihrer
Versuch V1 Vakuum. durchgeführt von Matthias Timmer Christian Haake. Betreuung Herr Katsch. am
 Versuch V1 Vakuum durchgeführt von Matthias Timmer Christian Haake Betreuung Herr Katsch am 29.04.2004 Übersicht Hintergrund Grundlagen Unterschiede der Vakua Pumpen Druckmessung Versuch Kalibrierung des
Versuch V1 Vakuum durchgeführt von Matthias Timmer Christian Haake Betreuung Herr Katsch am 29.04.2004 Übersicht Hintergrund Grundlagen Unterschiede der Vakua Pumpen Druckmessung Versuch Kalibrierung des
Widerstände. Schulversuchspraktikum WS 2000/2001 Redl Günther und 7.Klasse. Inhaltsverzeichnis:
 Schulversuchspraktikum WS 2000/2001 Redl Günther 9655337 Widerstände 3. und 7.Klasse Inhaltsverzeichnis: 1) Vorraussetzungen 2) Lernziele 3) Verwendete Quellen 4) Ohmsches Gesetz 5) Spezifischer Widerstand
Schulversuchspraktikum WS 2000/2001 Redl Günther 9655337 Widerstände 3. und 7.Klasse Inhaltsverzeichnis: 1) Vorraussetzungen 2) Lernziele 3) Verwendete Quellen 4) Ohmsches Gesetz 5) Spezifischer Widerstand
AUSWERTUNG: ELEKTRISCHE WIDERSTÄNDE
 AUSWERTUNG: ELEKTRISCHE WIDERSTÄNDE TOBIAS FREY, FREYA GNAM 1. R(T)-ABHÄNGIGKEIT EINES HALBLEITERWIDERSTANDES Mit Hilfe einer Wheatstoneschen Brückenschaltung wurde die Temperaturbhängigkeit eines Halbleiterwiderstandes
AUSWERTUNG: ELEKTRISCHE WIDERSTÄNDE TOBIAS FREY, FREYA GNAM 1. R(T)-ABHÄNGIGKEIT EINES HALBLEITERWIDERSTANDES Mit Hilfe einer Wheatstoneschen Brückenschaltung wurde die Temperaturbhängigkeit eines Halbleiterwiderstandes
F-Praktikum Physik: Widerstand bei tiefen Temperaturen
 F-Praktikum Physik: Widerstand bei tiefen Temperaturen David Riemenschneider & Felix Spanier 11. Januar 2001 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 2 Theorie 3 2.1 Grüneisen-Theorie...............................
F-Praktikum Physik: Widerstand bei tiefen Temperaturen David Riemenschneider & Felix Spanier 11. Januar 2001 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 2 Theorie 3 2.1 Grüneisen-Theorie...............................
Brückenschaltung (BRÜ)
 TUM Anfängerpraktikum für Physiker II Wintersemester 2006/2007 Brückenschaltung (BRÜ) Inhaltsverzeichnis 9. Januar 2007 1. Einleitung... 2 2. Messung ohmscher und komplexer Widerstände... 2 3. Versuchsauswertung...
TUM Anfängerpraktikum für Physiker II Wintersemester 2006/2007 Brückenschaltung (BRÜ) Inhaltsverzeichnis 9. Januar 2007 1. Einleitung... 2 2. Messung ohmscher und komplexer Widerstände... 2 3. Versuchsauswertung...
Wärmeleitung und thermoelektrische Effekte Versuch P2-32
 Auswertung Wärmeleitung und thermoelektrische Effekte Versuch P2-32 Iris Conradi und Melanie Hauck Gruppe Mo-02 7. Juni 2011 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Wärmeleitfähigkeit 3 2 Peltier-Kühlblock
Auswertung Wärmeleitung und thermoelektrische Effekte Versuch P2-32 Iris Conradi und Melanie Hauck Gruppe Mo-02 7. Juni 2011 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Wärmeleitfähigkeit 3 2 Peltier-Kühlblock
Gleichstromkreis. 2.2 Messgeräte für Spannung, Stromstärke und Widerstand. Siehe Abschnitt 2.4 beim Versuch E 1 Kennlinien elektronischer Bauelemente
 E 5 1. Aufgaben 1. Die Spannungs-Strom-Kennlinie UKl = f( I) einer Spannungsquelle ist zu ermitteln. Aus der grafischen Darstellung dieser Kennlinie sind Innenwiderstand i, Urspannung U o und Kurzschlussstrom
E 5 1. Aufgaben 1. Die Spannungs-Strom-Kennlinie UKl = f( I) einer Spannungsquelle ist zu ermitteln. Aus der grafischen Darstellung dieser Kennlinie sind Innenwiderstand i, Urspannung U o und Kurzschlussstrom
1 Atmosphäre (atm) = 760 torr = 1013,25 mbar = Pa 760 mm Hg ( bei 0 0 C, g = 9,80665 m s -2 )
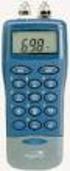 Versuch Nr.51 Druck-Messung in Gasen (Bestimmung eines Gasvolumens) Stichworte: Druck, Druckeinheiten, Druckmeßgeräte (Manometer, Vakuummeter), Druckmessung in U-Rohr-Manometern, Gasgesetze, Isothermen
Versuch Nr.51 Druck-Messung in Gasen (Bestimmung eines Gasvolumens) Stichworte: Druck, Druckeinheiten, Druckmeßgeräte (Manometer, Vakuummeter), Druckmessung in U-Rohr-Manometern, Gasgesetze, Isothermen
Praktikum Materialwissenschaft II. Wärmeleitung
 Praktikum Materialwissenschaft II Wärmeleitung Gruppe 8 André Schwöbel 1328037 Jörg Schließer 1401598 Maximilian Fries 1407149 e-mail: a.schwoebel@gmail.com Betreuer: Markus König 21.11.2007 Inhaltsverzeichnis
Praktikum Materialwissenschaft II Wärmeleitung Gruppe 8 André Schwöbel 1328037 Jörg Schließer 1401598 Maximilian Fries 1407149 e-mail: a.schwoebel@gmail.com Betreuer: Markus König 21.11.2007 Inhaltsverzeichnis
Grundlagen der Elektrotechnik: Wechselstromwiderstand Xc Seite 1 R =
 Grundlagen der Elektrotechnik: Wechselstromwiderstand Xc Seite 1 Versuch zur Ermittlung der Formel für X C In der Erklärung des Ohmschen Gesetzes ergab sich die Formel: R = Durch die Versuche mit einem
Grundlagen der Elektrotechnik: Wechselstromwiderstand Xc Seite 1 Versuch zur Ermittlung der Formel für X C In der Erklärung des Ohmschen Gesetzes ergab sich die Formel: R = Durch die Versuche mit einem
Praktikum I PE Peltier-Effekt
 Praktikum I PE Peltier-Effekt Florian Jessen, Hanno Rein, Benjamin Mück Betreuerin: Federica Moschini 27. November 2003 1 Ziel der Versuchsreihe Der Peltier Effekt und seine Umkehrung (Seebeck Effekt)
Praktikum I PE Peltier-Effekt Florian Jessen, Hanno Rein, Benjamin Mück Betreuerin: Federica Moschini 27. November 2003 1 Ziel der Versuchsreihe Der Peltier Effekt und seine Umkehrung (Seebeck Effekt)
Praktikumsbericht. Gruppe 6: Daniela Poppinga, Jan Christoph Bernack. Betreuerin: Natalia Podlaszewski 11. November 2008
 Praktikumsbericht Gruppe 6: Daniela Poppinga, Jan Christoph Bernack Betreuerin: Natalia Podlaszewski 11. November 2008 1 Inhaltsverzeichnis 1 Theorieteil 3 1.1 Frage 7................................ 3
Praktikumsbericht Gruppe 6: Daniela Poppinga, Jan Christoph Bernack Betreuerin: Natalia Podlaszewski 11. November 2008 1 Inhaltsverzeichnis 1 Theorieteil 3 1.1 Frage 7................................ 3
Ohmscher Spannungsteiler
 Fakultät Technik Bereich Informationstechnik Ohmscher Spannungsteiler Beispielbericht Blockveranstaltung im SS2006 Technische Dokumentation von M. Mustermann Fakultät Technik Bereich Informationstechnik
Fakultät Technik Bereich Informationstechnik Ohmscher Spannungsteiler Beispielbericht Blockveranstaltung im SS2006 Technische Dokumentation von M. Mustermann Fakultät Technik Bereich Informationstechnik
Insitu-Monitoring bei der Herstellung von Dünnfilmen durch Elektronenstrahlverdampfen
 Insitu-Monitoring bei der Herstellung von Dünnfilmen durch Elektronenstrahlverdampfen Dipl.-Ing. Sabine Peters Universität Karlsruhe (TH) Herstellung von Dünnfilmen durch Elektronenstrahlverdampfen Rezipient
Insitu-Monitoring bei der Herstellung von Dünnfilmen durch Elektronenstrahlverdampfen Dipl.-Ing. Sabine Peters Universität Karlsruhe (TH) Herstellung von Dünnfilmen durch Elektronenstrahlverdampfen Rezipient
Aufgabenblatt Z/ 01 (Physikalische Größen und Einheiten)
 Aufgabenblatt Z/ 01 (Physikalische Größen und Einheiten) Aufgabe Z-01/ 1 Welche zwei verschiedenen physikalische Bedeutungen kann eine Größe haben, wenn nur bekannt ist, dass sie in der Einheit Nm gemessen
Aufgabenblatt Z/ 01 (Physikalische Größen und Einheiten) Aufgabe Z-01/ 1 Welche zwei verschiedenen physikalische Bedeutungen kann eine Größe haben, wenn nur bekannt ist, dass sie in der Einheit Nm gemessen
Physikalisches Grundpraktikum Taupunktmessung. Taupunktmessung
 Aufgabenstellung: 1. Bestimmen Sie den Taupunkt. Berechnen Sie daraus die absolute und relative Luftfeuchtigkeit. 2. Schätzen Sie die Messunsicherheit ab! Stichworte zur Vorbereitung: Temperaturmessung,
Aufgabenstellung: 1. Bestimmen Sie den Taupunkt. Berechnen Sie daraus die absolute und relative Luftfeuchtigkeit. 2. Schätzen Sie die Messunsicherheit ab! Stichworte zur Vorbereitung: Temperaturmessung,
Thema Elektrizitätslehre Doppellektion 7
 Natur und Technik 2 Physik Lektionsablauf Thema Elektrizitätslehre Doppellektion 7 Ziele Einblick in das Leben eines Forscher erhalten Das Ohmsche Gesetz herleiten Das Ohmsche Gesetz und die Umformungen
Natur und Technik 2 Physik Lektionsablauf Thema Elektrizitätslehre Doppellektion 7 Ziele Einblick in das Leben eines Forscher erhalten Das Ohmsche Gesetz herleiten Das Ohmsche Gesetz und die Umformungen
Praktikum Grundlagen Elektrotechnik, Prof. Kern
 Praktikum Grundlagen Elektrotechnik, Prof. Kern Christoph Hansen, Christian Große Wörding, Sonya Salam chris@university-material.de Inhaltsverzeichnis Einführung 2 Auswertung und Interpretation 3 Teil
Praktikum Grundlagen Elektrotechnik, Prof. Kern Christoph Hansen, Christian Große Wörding, Sonya Salam chris@university-material.de Inhaltsverzeichnis Einführung 2 Auswertung und Interpretation 3 Teil
Protokoll des Versuches 5: Messungen der Thermospannung nach der Kompensationsmethode
 Name: Matrikelnummer: Bachelor Biowissenschaften E-Mail: Physikalisches Anfängerpraktikum II Dozenten: Assistenten: Protokoll des Versuches 5: Messungen der Thermospannung nach der Kompensationsmethode
Name: Matrikelnummer: Bachelor Biowissenschaften E-Mail: Physikalisches Anfängerpraktikum II Dozenten: Assistenten: Protokoll des Versuches 5: Messungen der Thermospannung nach der Kompensationsmethode
LernJob Naturwissenschaften - Physik Wie funktioniert ein Foliendrucksensor?
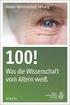 LernJob Naturwissenschaften - Physik Wie funktioniert ein Foliendrucksensor? Lernbereich: Kräfte als Modell zur Erklärung und Vorhersage von Kraftwikungen benutzen Zeitrichtwert: 90 Minuten Index: BGY
LernJob Naturwissenschaften - Physik Wie funktioniert ein Foliendrucksensor? Lernbereich: Kräfte als Modell zur Erklärung und Vorhersage von Kraftwikungen benutzen Zeitrichtwert: 90 Minuten Index: BGY
Experimentelle Übungen I E5 Kleine Widerstände / Thermoelement Protokoll
 Experimentelle Übungen I E5 Kleine Widerstände / Thermoelement Protokoll Jan-Gerd Tenberge 1 Tobias Südkamp 2 6. Januar 2009 1 Matrikel-Nr. 349658 2 Matrikel-Nr. 350069 Experimentelle Übungen I E5 Tenberge,
Experimentelle Übungen I E5 Kleine Widerstände / Thermoelement Protokoll Jan-Gerd Tenberge 1 Tobias Südkamp 2 6. Januar 2009 1 Matrikel-Nr. 349658 2 Matrikel-Nr. 350069 Experimentelle Übungen I E5 Tenberge,
Protokoll Grundpraktikum I: T6 Thermoelement und newtonsches Abkühlungsgesetz
 Protokoll Grundpraktikum I: T6 Thermoelement und newtonsches Abkühlungsgesetz Sebastian Pfitzner 5. Juni 03 Durchführung: Sebastian Pfitzner (553983), Anna Andrle (55077) Arbeitsplatz: Platz 3 Betreuer:
Protokoll Grundpraktikum I: T6 Thermoelement und newtonsches Abkühlungsgesetz Sebastian Pfitzner 5. Juni 03 Durchführung: Sebastian Pfitzner (553983), Anna Andrle (55077) Arbeitsplatz: Platz 3 Betreuer:
Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg, Department F + F
 1 Versuchsdurchführung 1.1 Bestimmung des Widerstands eines Dehnungsmessstreifens 1.1.1 Messung mit industriellen Messgeräten Der Widerstandswert R 0 eines der 4 auf dem zunächst unbelasteten Biegebalken
1 Versuchsdurchführung 1.1 Bestimmung des Widerstands eines Dehnungsmessstreifens 1.1.1 Messung mit industriellen Messgeräten Der Widerstandswert R 0 eines der 4 auf dem zunächst unbelasteten Biegebalken
Auswertung Operationsverstärker
 Auswertung Operationsverstärker Marcel Köpke & Axel Müller 31.05.2012 Inhaltsverzeichnis 1 Emitterschaltung eines Transistors 3 1.1 Arbeitspunkt des gleichstromgegengekoppelter Transistorverstärker....
Auswertung Operationsverstärker Marcel Köpke & Axel Müller 31.05.2012 Inhaltsverzeichnis 1 Emitterschaltung eines Transistors 3 1.1 Arbeitspunkt des gleichstromgegengekoppelter Transistorverstärker....
Elektrische Messverfahren Versuchsauswertung
 Versuche P1-70,71,81 Elektrische Messverfahren Versuchsauswertung Marco A. Harrendorf, Thomas Keck, Gruppe: Mo-3 Karlsruhe Institut für Technologie, Bachelor Physik Versuchstag: 22.11.2010 1 1 Wechselstromwiderstände
Versuche P1-70,71,81 Elektrische Messverfahren Versuchsauswertung Marco A. Harrendorf, Thomas Keck, Gruppe: Mo-3 Karlsruhe Institut für Technologie, Bachelor Physik Versuchstag: 22.11.2010 1 1 Wechselstromwiderstände
Fachhochschule Bielefeld Fachbereich Elektrotechnik. Versuchsbericht für das elektronische Praktikum. Praktikum Nr. 2. Thema: Widerstände und Dioden
 Fachhochschule Bielefeld Fachbereich Elektrotechnik Versuchsbericht für das elektronische Praktikum Praktikum Nr. 2 Name: Pascal Hahulla Matrikelnr.: 207XXX Thema: Widerstände und Dioden Versuch durchgeführt
Fachhochschule Bielefeld Fachbereich Elektrotechnik Versuchsbericht für das elektronische Praktikum Praktikum Nr. 2 Name: Pascal Hahulla Matrikelnr.: 207XXX Thema: Widerstände und Dioden Versuch durchgeführt
Supraleitung. Ilja Homm und Thorsten Bitsch Betreuer: Dr. Alexei Privalov Fortgeschrittenen-Praktikum Abteilung B
 Supraleitung Ilja Homm und Thorsten Bitsch Betreuer: Dr. Alexei Privalov 21.11.2011 Fortgeschrittenen-Praktikum Abteilung B Inhalt 1 Einführung 2 1.1 Ziel des Versuchs........................................
Supraleitung Ilja Homm und Thorsten Bitsch Betreuer: Dr. Alexei Privalov 21.11.2011 Fortgeschrittenen-Praktikum Abteilung B Inhalt 1 Einführung 2 1.1 Ziel des Versuchs........................................
Zugversuch - Versuchsprotokoll
 Gruppe 13: René Laquai Jan Morasch Rudolf Seiler 16.1.28 Praktikum Materialwissenschaften II Zugversuch - Versuchsprotokoll Betreuer: Heinz Lehmann 1. Einleitung Der im Praktikum durchgeführte Zugversuch
Gruppe 13: René Laquai Jan Morasch Rudolf Seiler 16.1.28 Praktikum Materialwissenschaften II Zugversuch - Versuchsprotokoll Betreuer: Heinz Lehmann 1. Einleitung Der im Praktikum durchgeführte Zugversuch
Laboratorium für Grundlagen Elektrotechnik
 niversity of Applied Sciences Cologne Fakultät 07: nformations-, Medien- & Elektrotechnik nstitut für Elektrische Energietechnik Laboratorium für Grundlagen Elektrotechnik Versuch 1 1.1 Aufnahme von Widerstandskennlinien
niversity of Applied Sciences Cologne Fakultät 07: nformations-, Medien- & Elektrotechnik nstitut für Elektrische Energietechnik Laboratorium für Grundlagen Elektrotechnik Versuch 1 1.1 Aufnahme von Widerstandskennlinien
Elektrische Messverfahren
 Physikalisches Anfängerpraktikum 1 Gruppe Mo-16 Wintersemester 2005/06 Julian Merkert (1229929) Versuch: P1-81 Elektrische Messverfahren - Vorbereitung - Vorbemerkung In diesem Versuch geht es um das Kennenlernen
Physikalisches Anfängerpraktikum 1 Gruppe Mo-16 Wintersemester 2005/06 Julian Merkert (1229929) Versuch: P1-81 Elektrische Messverfahren - Vorbereitung - Vorbemerkung In diesem Versuch geht es um das Kennenlernen
Messverstärker und Gleichrichter
 Mathias Arbeiter 11. Mai 2006 Betreuer: Herr Bojarski Messverstärker und Gleichrichter Differenz- und Instrumentationsverstärker Zweiwege-Gleichrichter Inhaltsverzeichnis 1 Differenzenverstärker 3 1.1
Mathias Arbeiter 11. Mai 2006 Betreuer: Herr Bojarski Messverstärker und Gleichrichter Differenz- und Instrumentationsverstärker Zweiwege-Gleichrichter Inhaltsverzeichnis 1 Differenzenverstärker 3 1.1
Kennlinie der Vakuum-Diode
 Physikalisches Praktikum für das Hauptfach Physik Versuch 20 Kennlinie der Vakuum-Diode Wintersemester 2005 / 2006 Name: Mitarbeiter: EMail: Gruppe: Daniel Scholz Hauke Rohmeyer physik@mehr-davon.de B9
Physikalisches Praktikum für das Hauptfach Physik Versuch 20 Kennlinie der Vakuum-Diode Wintersemester 2005 / 2006 Name: Mitarbeiter: EMail: Gruppe: Daniel Scholz Hauke Rohmeyer physik@mehr-davon.de B9
Versuch: Kennlinien von Widerständen und Halbleiterphysik
 Labor Physik und Grundlagen der Elektrotechnik Versuch: Kennlinien von Widerständen und Halbleiterphysik Prof. Dr. Karlheinz Blankenbach Dipl.-Phys. Dipl.-Ing(FH) Frank Gölz Blankenbach / halbleiterphysik_eigeberwärmung.doc
Labor Physik und Grundlagen der Elektrotechnik Versuch: Kennlinien von Widerständen und Halbleiterphysik Prof. Dr. Karlheinz Blankenbach Dipl.-Phys. Dipl.-Ing(FH) Frank Gölz Blankenbach / halbleiterphysik_eigeberwärmung.doc
Protokoll zu Versuch E5: Messung kleiner Widerstände / Thermoelement
 Protokoll zu Versuch E5: Messung kleiner Widerstände / Thermoelement 1. Einleitung Die Wheatstonesche Brücke ist eine Brückenschaltung zur Bestimmung von Widerständen. Dabei wird der zu messende Widerstand
Protokoll zu Versuch E5: Messung kleiner Widerstände / Thermoelement 1. Einleitung Die Wheatstonesche Brücke ist eine Brückenschaltung zur Bestimmung von Widerständen. Dabei wird der zu messende Widerstand
Thermodynamik 1. Typen der thermodynamischen Systeme. Intensive und extensive Zustandsgröße. Phasenübergänge. Ausdehnung bei Erwärmung.
 Thermodynamik 1. Typen der thermodynamischen Systeme. Intensive und extensive Zustandsgröße. Phasenübergänge. Ausdehnung bei Erwärmung. Nullter und Erster Hauptsatz der Thermodynamik. Thermodynamische
Thermodynamik 1. Typen der thermodynamischen Systeme. Intensive und extensive Zustandsgröße. Phasenübergänge. Ausdehnung bei Erwärmung. Nullter und Erster Hauptsatz der Thermodynamik. Thermodynamische
Hall Effekt und Bandstruktur
 Hall Effekt und Bandstruktur Themen zur Vorbereitung (relevant im Kolloquium zu Beginn des Versuchstages und für den Theorieteil des Protokolls): Entstehung von Bandstruktur. Halbleiter Bandstruktur. Dotierung
Hall Effekt und Bandstruktur Themen zur Vorbereitung (relevant im Kolloquium zu Beginn des Versuchstages und für den Theorieteil des Protokolls): Entstehung von Bandstruktur. Halbleiter Bandstruktur. Dotierung
Versuch Q1. Äußerer Photoeffekt. Sommersemester Daniel Scholz
 Demonstrationspraktikum für Lehramtskandidaten Versuch Q1 Äußerer Photoeffekt Sommersemester 2006 Name: Daniel Scholz Mitarbeiter: Steffen Ravekes EMail: daniel@mehr-davon.de Gruppe: 4 Durchgeführt am:
Demonstrationspraktikum für Lehramtskandidaten Versuch Q1 Äußerer Photoeffekt Sommersemester 2006 Name: Daniel Scholz Mitarbeiter: Steffen Ravekes EMail: daniel@mehr-davon.de Gruppe: 4 Durchgeführt am:
Physikalisches Praktikum. Grundstromkreis, Widerstandsmessung
 Grundstromkreis, Widerstandsmessung Stichworte zur Vorbereitung Informieren Sie sich zu den folgenden Begriffen: Widerstand, spezifischer Widerstand, OHMsches Gesetz, KIRCHHOFFsche Regeln, Reihenund Parallelschaltung,
Grundstromkreis, Widerstandsmessung Stichworte zur Vorbereitung Informieren Sie sich zu den folgenden Begriffen: Widerstand, spezifischer Widerstand, OHMsches Gesetz, KIRCHHOFFsche Regeln, Reihenund Parallelschaltung,
Aeromechanik. Versuch: P Vorbereitung - Physikalisches Anfängerpraktikum 1 Wintersemester 2005/06 Julian Merkert ( )
 Physikalisches Anfängerpraktikum 1 Gruppe Mo-16 Wintersemester 2005/06 Julian Merkert (1229929) Versuch: P1-26 Aeromechanik - Vorbereitung - Vorbemerkung In diesem Versuch geht es darum, die physikalischen
Physikalisches Anfängerpraktikum 1 Gruppe Mo-16 Wintersemester 2005/06 Julian Merkert (1229929) Versuch: P1-26 Aeromechanik - Vorbereitung - Vorbemerkung In diesem Versuch geht es darum, die physikalischen
Protokoll Dampfdruck. Punkte: /10
 Protokoll Dampfdruck Gruppe Biologie Assistent: Olivier Evelyn Jähne, Eva Eickmeier, Claudia Keller Kontakt: claudiakeller@teleport.ch Sommersemester 2006 6. Juni 2006 Punkte: /0 . Einleitung Wenn eine
Protokoll Dampfdruck Gruppe Biologie Assistent: Olivier Evelyn Jähne, Eva Eickmeier, Claudia Keller Kontakt: claudiakeller@teleport.ch Sommersemester 2006 6. Juni 2006 Punkte: /0 . Einleitung Wenn eine
2.4 Kinetische Gastheorie - Druck und Temperatur im Teilchenmodell
 2.4 Kinetische Gastheorie - Druck und Temperatur im Teilchenmodell Mit den drei Zustandsgrößen Druck, Temperatur und Volumen konnte der Zustand von Gasen makroskopisch beschrieben werden. So kann zum Beispiel
2.4 Kinetische Gastheorie - Druck und Temperatur im Teilchenmodell Mit den drei Zustandsgrößen Druck, Temperatur und Volumen konnte der Zustand von Gasen makroskopisch beschrieben werden. So kann zum Beispiel
PHYSIKALISCHES INSTITUT F-PRAKTIKUM. Protokoll. Differenz-Thermoanalyse
 PHYSIKALISCHES INSTITUT F-PRAKTIKUM Protokoll Differenz-Thermoanalyse Intsar Ahmad Bangwi und Sven T. Köppel Abgabe: 20.02.2011 Versuchsdurchführung: 24.01.2011 Thermische Analyse Der Begriff Thermische
PHYSIKALISCHES INSTITUT F-PRAKTIKUM Protokoll Differenz-Thermoanalyse Intsar Ahmad Bangwi und Sven T. Köppel Abgabe: 20.02.2011 Versuchsdurchführung: 24.01.2011 Thermische Analyse Der Begriff Thermische
Auswertung: Eigenschaften elektrischer Bauelemente
 Auswertung: Eigenschaften elektrischer Bauelemente Christine Dörflinger (christinedoerflinger@gmail.com) Frederik Mayer (fmayer163@gmail.com) Gruppe Do-9 4. Juli 2012 1 Inhaltsverzeichnis 1 Untersuchung
Auswertung: Eigenschaften elektrischer Bauelemente Christine Dörflinger (christinedoerflinger@gmail.com) Frederik Mayer (fmayer163@gmail.com) Gruppe Do-9 4. Juli 2012 1 Inhaltsverzeichnis 1 Untersuchung
AUSWERTUNG: TRANSISTOR- UND OPERATIONSVERSTÄRKER
 AUSWERTUNG: TRANSISTOR- UND OPERATIONSVERSTÄRKER FREYA GNAM, TOBIAS FREY 1. EMITTERSCHALTUNG DES TRANSISTORS 1.1. Aufbau des einstufigen Transistorverstärkers. Wie im Bild 1 der Vorbereitungshilfe wurde
AUSWERTUNG: TRANSISTOR- UND OPERATIONSVERSTÄRKER FREYA GNAM, TOBIAS FREY 1. EMITTERSCHALTUNG DES TRANSISTORS 1.1. Aufbau des einstufigen Transistorverstärkers. Wie im Bild 1 der Vorbereitungshilfe wurde
Versuchsprotokoll von Thomas Bauer und Patrick Fritzsch. Münster, den
 E6 Elektrische Resonanz Versuchsprotokoll von Thomas Bauer und Patrick Fritzsch Münster, den.. INHALTSVERZEICHNIS. Einleitung. Theoretische Grundlagen. Serienschaltung von Widerstand R, Induktivität L
E6 Elektrische Resonanz Versuchsprotokoll von Thomas Bauer und Patrick Fritzsch Münster, den.. INHALTSVERZEICHNIS. Einleitung. Theoretische Grundlagen. Serienschaltung von Widerstand R, Induktivität L
Physikalisches Praktikum I
 Fachbereich Physik Physikalisches Praktikum I W21 Name: Verdampfungswärme von Wasser Matrikelnummer: Fachrichtung: Mitarbeiter/in: Assistent/in: Versuchsdatum: Gruppennummer: Endtestat: Folgende Fragen
Fachbereich Physik Physikalisches Praktikum I W21 Name: Verdampfungswärme von Wasser Matrikelnummer: Fachrichtung: Mitarbeiter/in: Assistent/in: Versuchsdatum: Gruppennummer: Endtestat: Folgende Fragen
Praktikumsprotokoll. Versuch Nr. 311 Hall-Effekt und Elektrizitätsleitung bei Metallen. Frank Hommes und Kilian Klug
 Praktikumsprotokoll Versuch Nr. 311 Hall-Effekt und Elektrizitätsleitung bei Metallen und Durchgeführt am: 13 Februar 2004 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 2 Theoretische Hintergründe 3 2.1 Hall-Effekt.............................
Praktikumsprotokoll Versuch Nr. 311 Hall-Effekt und Elektrizitätsleitung bei Metallen und Durchgeführt am: 13 Februar 2004 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 2 Theoretische Hintergründe 3 2.1 Hall-Effekt.............................
auf, so erhält man folgendes Schaubild: Temperaturabhängigkeit eines Halbleiterwiderstands
 Auswertung zum Versuch Widerstandskennlinien und ihre Temperaturabhängigkeit Kirstin Hübner (1348630) Armin Burgmeier (1347488) Gruppe 15 2. Juni 2008 1 Temperaturabhängigkeit eines Halbleiterwiderstands
Auswertung zum Versuch Widerstandskennlinien und ihre Temperaturabhängigkeit Kirstin Hübner (1348630) Armin Burgmeier (1347488) Gruppe 15 2. Juni 2008 1 Temperaturabhängigkeit eines Halbleiterwiderstands
Praktikum Nr. 3. Fachhochschule Bielefeld Fachbereich Elektrotechnik. Versuchsbericht für das elektronische Praktikum
 Fachhochschule Bielefeld Fachbereich Elektrotechnik Versuchsbericht für das elektronische Praktikum Praktikum Nr. 3 Manuel Schwarz Matrikelnr.: 207XXX Pascal Hahulla Matrikelnr.: 207XXX Thema: Transistorschaltungen
Fachhochschule Bielefeld Fachbereich Elektrotechnik Versuchsbericht für das elektronische Praktikum Praktikum Nr. 3 Manuel Schwarz Matrikelnr.: 207XXX Pascal Hahulla Matrikelnr.: 207XXX Thema: Transistorschaltungen
Versuch P1-50,51,52 - Transistorgrundschaltungen. Vorbereitung. Von Jan Oertlin. 4. November 2009
 Versuch P1-50,51,52 - Transistorgrundschaltungen Vorbereitung Von Jan Oertlin 4. November 2009 Inhaltsverzeichnis 0. Funktionsweise eines Transistors...2 1. Transistor-Kennlinien...2 1.1. Eingangskennlinie...2
Versuch P1-50,51,52 - Transistorgrundschaltungen Vorbereitung Von Jan Oertlin 4. November 2009 Inhaltsverzeichnis 0. Funktionsweise eines Transistors...2 1. Transistor-Kennlinien...2 1.1. Eingangskennlinie...2
Inhaltsverzeichnis. 1 Einführung Versuchsbeschreibung und Motivation Physikalische Grundlagen... 3
 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 3 1.1 Versuchsbeschreibung und Motivation............................... 3 1.2 Physikalische Grundlagen...................................... 3 2 Messwerte und Auswertung
Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 3 1.1 Versuchsbeschreibung und Motivation............................... 3 1.2 Physikalische Grundlagen...................................... 3 2 Messwerte und Auswertung
Praktikumsprotokoll Photoeffekt
 Praktikumsprotokoll Photoeffekt Silas Kraus und André Schendel Gruppe Do-20 19. April 2012 Inhaltsverzeichnis 1 Demonstrationsversuch: Hallwachs-Effekt 1 2 Elektrometereigenschaften 1 3 Photoeffekt und
Praktikumsprotokoll Photoeffekt Silas Kraus und André Schendel Gruppe Do-20 19. April 2012 Inhaltsverzeichnis 1 Demonstrationsversuch: Hallwachs-Effekt 1 2 Elektrometereigenschaften 1 3 Photoeffekt und
Vorbereitung: Vakuum. Christine Dörflinger Frederik Mayer Gruppe Do
 Vorbereitung: Vakuum Christine Dörflinger (christinedoerflinger@gmail.com) Frederik Mayer (fmayer163@gmail.com) Gruppe Do-9 12. Juli 2012 1 Inhaltsverzeichnis 0 Allgemeines 3 0.1 Vakuum..............................................
Vorbereitung: Vakuum Christine Dörflinger (christinedoerflinger@gmail.com) Frederik Mayer (fmayer163@gmail.com) Gruppe Do-9 12. Juli 2012 1 Inhaltsverzeichnis 0 Allgemeines 3 0.1 Vakuum..............................................
Praktikum Physik. Protokoll zum Versuch 5: Spezifische Wärme. Durchgeführt am Gruppe X
 Praktikum Physik Protokoll zum Versuch 5: Spezifische Wärme Durchgeführt am 10.11.2011 Gruppe X Name 1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuer: Wir bestätigen hiermit, dass wir das
Praktikum Physik Protokoll zum Versuch 5: Spezifische Wärme Durchgeführt am 10.11.2011 Gruppe X Name 1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuer: Wir bestätigen hiermit, dass wir das
Verwandte Begriffe Maxwell-Gleichungen, elektrisches Wirbelfeld, Magnetfeld von Spulen, magnetischer Fluss, induzierte Spannung.
 Verwandte Begriffe Maxwell-Gleichungen, elektrisches Wirbelfeld, Magnetfeld von Spulen, magnetischer Fluss, induzierte Spannung. Prinzip In einer langen Spule wird ein Magnetfeld mit variabler Frequenz
Verwandte Begriffe Maxwell-Gleichungen, elektrisches Wirbelfeld, Magnetfeld von Spulen, magnetischer Fluss, induzierte Spannung. Prinzip In einer langen Spule wird ein Magnetfeld mit variabler Frequenz
Bewegter Leiter im Magnetfeld
 Bewegter Leiter im Magnetfeld Die Leiterschaukel mal umgedreht: Bewegt man die Leiterschaukel im Magnetfeld, so wird an ihren Enden eine Spannung induziert. 18.12.2012 Aufgaben: Lies S. 56 Abschnitt 1
Bewegter Leiter im Magnetfeld Die Leiterschaukel mal umgedreht: Bewegt man die Leiterschaukel im Magnetfeld, so wird an ihren Enden eine Spannung induziert. 18.12.2012 Aufgaben: Lies S. 56 Abschnitt 1
Physikprotokoll: Fehlerrechnung. Martin Henning / Torben Zech / Abdurrahman Namdar / Juni 2006
 Physikprotokoll: Fehlerrechnung Martin Henning / 736150 Torben Zech / 7388450 Abdurrahman Namdar / 739068 1. Juni 2006 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 2 Vorbereitungen 3 3 Messungen und Auswertungen
Physikprotokoll: Fehlerrechnung Martin Henning / 736150 Torben Zech / 7388450 Abdurrahman Namdar / 739068 1. Juni 2006 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 2 Vorbereitungen 3 3 Messungen und Auswertungen
Elektrolytische Leitfähigkeit
 Elektrolytische Leitfähigkeit 1 Elektrolytische Leitfähigkeit Gegenstand dieses Versuches ist der Zusammenhang der elektrolytischen Leitfähigkeit starker und schwacher Elektrolyten mit deren Konzentration.
Elektrolytische Leitfähigkeit 1 Elektrolytische Leitfähigkeit Gegenstand dieses Versuches ist der Zusammenhang der elektrolytischen Leitfähigkeit starker und schwacher Elektrolyten mit deren Konzentration.
Michelson-Interferometer. Jannik Ehlert, Marko Nonho
 Michelson-Interferometer Jannik Ehlert, Marko Nonho 4. Juni 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 1 2 Auswertung 2 2.1 Thermische Ausdehnung... 2 2.2 Magnetostriktion... 3 2.2.1 Beobachtung mit dem Auge...
Michelson-Interferometer Jannik Ehlert, Marko Nonho 4. Juni 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 1 2 Auswertung 2 2.1 Thermische Ausdehnung... 2 2.2 Magnetostriktion... 3 2.2.1 Beobachtung mit dem Auge...
Nimm KL-3 Fragenkatalog, Seite 34, = Formelsammung 1.Seite, oben rechts!
 Die Fragen sind sehr einfach, wenn... siehe. Bild... der Widerstand richtig rum liegt. Hä? Einfach, da in den Aufgaben jeweils das richtigrum, d.h. die Reihenfolge der Farben angegeben ist!! Bei Vierfach
Die Fragen sind sehr einfach, wenn... siehe. Bild... der Widerstand richtig rum liegt. Hä? Einfach, da in den Aufgaben jeweils das richtigrum, d.h. die Reihenfolge der Farben angegeben ist!! Bei Vierfach
Elektrische Messverfahren
 Vorbereitung Elektrische Messverfahren Carsten Röttele 20. Dezember 2011 Inhaltsverzeichnis 1 Messungen bei Gleichstrom 2 1.1 Innenwiderstand des µa-multizets...................... 2 1.2 Innenwiderstand
Vorbereitung Elektrische Messverfahren Carsten Röttele 20. Dezember 2011 Inhaltsverzeichnis 1 Messungen bei Gleichstrom 2 1.1 Innenwiderstand des µa-multizets...................... 2 1.2 Innenwiderstand
Elektrizitätslehre Elektromagnetische Induktion Induktion durch ein veränderliches Magnetfeld
 (2013-06-07) P3.4.3.1 Elektrizitätslehre Elektromagnetische Induktion Induktion durch ein veränderliches Magnetfeld Messung der Induktionsspannung in einer Leiterschleife bei veränderlichem Magnetfeld
(2013-06-07) P3.4.3.1 Elektrizitätslehre Elektromagnetische Induktion Induktion durch ein veränderliches Magnetfeld Messung der Induktionsspannung in einer Leiterschleife bei veränderlichem Magnetfeld
Fortgeschrittenen - Praktikum. Hall - Eekt
 Fortgeschrittenen - Praktikum Hall - Eekt Versuchsleiter: Herr Weisemöller Autor: Daniel Bruns Gruppe: 10, Dienstag Daniel Bruns, Simon Berning Versuchsdatum: 14.11.2006 Hall - Eekt; Gruppe 10 1 Inhaltsverzeichnis
Fortgeschrittenen - Praktikum Hall - Eekt Versuchsleiter: Herr Weisemöller Autor: Daniel Bruns Gruppe: 10, Dienstag Daniel Bruns, Simon Berning Versuchsdatum: 14.11.2006 Hall - Eekt; Gruppe 10 1 Inhaltsverzeichnis
Klausur 12/1 Physik LK Elsenbruch Di (4h) Thema: elektrische und magnetische Felder Hilfsmittel: Taschenrechner, Formelsammlung
 Klausur 12/1 Physik LK Elsenbruch Di 18.01.05 (4h) Thema: elektrische und magnetische Felder Hilfsmittel: Taschenrechner, Formelsammlung 1) Ein Kondensator besteht aus zwei horizontal angeordneten, quadratischen
Klausur 12/1 Physik LK Elsenbruch Di 18.01.05 (4h) Thema: elektrische und magnetische Felder Hilfsmittel: Taschenrechner, Formelsammlung 1) Ein Kondensator besteht aus zwei horizontal angeordneten, quadratischen
Vakuum-, Hochfrequenztechnik und Strahlinstrumentierung
 Vakuum-, Hochfrequenztechnik und Strahlinstrumentierung Im Rahmen des Schülerpraktikums der ISH am CERN 2015 1 Agenda Vakuumtechnik Definition Erzeugung Erhaltung Strahlinstrumentierung Wire Scanner Beam
Vakuum-, Hochfrequenztechnik und Strahlinstrumentierung Im Rahmen des Schülerpraktikums der ISH am CERN 2015 1 Agenda Vakuumtechnik Definition Erzeugung Erhaltung Strahlinstrumentierung Wire Scanner Beam
Versuchsprotokoll. Die Röhrendiode. zu Versuch 25. (Physikalisches Anfängerpraktikum Teil II)
 Donnerstag, 8.1.1998 Dennis S. Weiß & Christian Niederhöfer Versuchsprotokoll (Physikalisches Anfängerpraktikum Teil II) zu Versuch 25 Die Röhrendiode 1 Inhaltsverzeichnis 1 Problemstellung 3 2 Physikalische
Donnerstag, 8.1.1998 Dennis S. Weiß & Christian Niederhöfer Versuchsprotokoll (Physikalisches Anfängerpraktikum Teil II) zu Versuch 25 Die Röhrendiode 1 Inhaltsverzeichnis 1 Problemstellung 3 2 Physikalische
Vorlesung 3: Elektrodynamik
 Vorlesung 3: Elektrodynamik, georg.steinbrueck@desy.de Folien/Material zur Vorlesung auf: www.desy.de/~steinbru/physikzahnmed georg.steinbrueck@desy.de 1 WS 2015/16 Der elektrische Strom Elektrodynamik:
Vorlesung 3: Elektrodynamik, georg.steinbrueck@desy.de Folien/Material zur Vorlesung auf: www.desy.de/~steinbru/physikzahnmed georg.steinbrueck@desy.de 1 WS 2015/16 Der elektrische Strom Elektrodynamik:
Physikalisches Anfängerpraktikum Teil 2 Elektrizitätslehre. Protokollant: Sven Köppel Matr.-Nr Physik Bachelor 2.
 Physikalisches Anfängerpraktikum Teil Elektrizitätslehre Protokoll Versuch 1 Bestimmung eines unbekannten Ohm'schen Wiederstandes durch Strom- und Spannungsmessung Sven Köppel Matr.-Nr. 3793686 Physik
Physikalisches Anfängerpraktikum Teil Elektrizitätslehre Protokoll Versuch 1 Bestimmung eines unbekannten Ohm'schen Wiederstandes durch Strom- und Spannungsmessung Sven Köppel Matr.-Nr. 3793686 Physik
Diplomvorprüfung WS 2010/11 Fach: Elektronik, Dauer: 90 Minuten
 Diplomvorprüfung Elektronik Seite 1 von 8 Hochschule München FK 03 Fahrzeugtechnik Zugelassene Hilfsmittel: Taschenrechner, zwei Blatt DIN A4 eigene Aufzeichnungen Diplomvorprüfung WS 2010/11 Fach: Elektronik,
Diplomvorprüfung Elektronik Seite 1 von 8 Hochschule München FK 03 Fahrzeugtechnik Zugelassene Hilfsmittel: Taschenrechner, zwei Blatt DIN A4 eigene Aufzeichnungen Diplomvorprüfung WS 2010/11 Fach: Elektronik,
TRA - Grundlagen des Transistors
 TRA Grundlagen des Transistors Anfängerpraktikum 1, 2006 Janina Fiehl Daniel Flassig Gruppe 87 Aufgabenstellung n diesem Versuch sollen wichtige Eigenschaften des für unsere nformationsgesellschaft vielleicht
TRA Grundlagen des Transistors Anfängerpraktikum 1, 2006 Janina Fiehl Daniel Flassig Gruppe 87 Aufgabenstellung n diesem Versuch sollen wichtige Eigenschaften des für unsere nformationsgesellschaft vielleicht
Praktikum II TR: Transformator
 Praktikum II TR: Transformator Betreuer: Dr. Torsten Hehl Hanno Rein praktikum2@hanno-rein.de Florian Jessen florian.jessen@student.uni-tuebingen.de 30. März 2004 Made with L A TEX and Gnuplot Praktikum
Praktikum II TR: Transformator Betreuer: Dr. Torsten Hehl Hanno Rein praktikum2@hanno-rein.de Florian Jessen florian.jessen@student.uni-tuebingen.de 30. März 2004 Made with L A TEX and Gnuplot Praktikum
2. Herstellung definierter Probenoberflächen
 2. Herstellung definierter Probenoberflächen 2.1 Ultrahochvakuum (UHV) mittlere Geschwindigkeit der Gasteilchen (kin. Gastheorie): -6 für H:~ 2000 m/s 2 Bei einem Druck von 10 mbar ist die OF in weniger
2. Herstellung definierter Probenoberflächen 2.1 Ultrahochvakuum (UHV) mittlere Geschwindigkeit der Gasteilchen (kin. Gastheorie): -6 für H:~ 2000 m/s 2 Bei einem Druck von 10 mbar ist die OF in weniger
Photoeffekt: Bestimmung von h/e
 I. Physikalisches Institut der Universität zu Köln Physikalisches Praktikum B Versuch 1.4 Photoeffekt: Bestimmung von h/e (Stand: 25.07.2008) 1 Versuchsziel: In diesem Versuch soll der äußere photoelektrische
I. Physikalisches Institut der Universität zu Köln Physikalisches Praktikum B Versuch 1.4 Photoeffekt: Bestimmung von h/e (Stand: 25.07.2008) 1 Versuchsziel: In diesem Versuch soll der äußere photoelektrische
Basiskenntnistest - Physik
 Basiskenntnistest - Physik 1.) Welche der folgenden Einheiten ist keine Basiseinheit des Internationalen Einheitensystems? a. ) Kilogramm b. ) Sekunde c. ) Kelvin d. ) Volt e. ) Candela 2.) Die Schallgeschwindigkeit
Basiskenntnistest - Physik 1.) Welche der folgenden Einheiten ist keine Basiseinheit des Internationalen Einheitensystems? a. ) Kilogramm b. ) Sekunde c. ) Kelvin d. ) Volt e. ) Candela 2.) Die Schallgeschwindigkeit
Spezifische Wärme fester Körper
 1 Spezifische ärme fester Körper Die spezifische, sowie die molare ärme von Kupfer und Aluminium sollen bestimmt werden. Anhand der molaren ärme von Kupfer bei der Temperatur von flüssigem Stickstoff soll
1 Spezifische ärme fester Körper Die spezifische, sowie die molare ärme von Kupfer und Aluminium sollen bestimmt werden. Anhand der molaren ärme von Kupfer bei der Temperatur von flüssigem Stickstoff soll
2.2 Spezifische und latente Wärmen
 1 Einleitung Physikalisches Praktikum für Anfänger - Teil 1 Gruppe 2 Wärmelehre 2.2 Spezifische und latente Wärmen Die spezifische Wärme von Wasser gibt an, wieviel Energie man zu 1 kg Wasser zuführen
1 Einleitung Physikalisches Praktikum für Anfänger - Teil 1 Gruppe 2 Wärmelehre 2.2 Spezifische und latente Wärmen Die spezifische Wärme von Wasser gibt an, wieviel Energie man zu 1 kg Wasser zuführen
Physik-Übung * Jahrgangsstufe 8 * Elektrische Widerstände Blatt 1
 Physik-Übung * Jahrgangsstufe 8 * Elektrische Widerstände Blatt 1 Geräte: Netzgerät mit Strom- und Spannungsanzeige, 2 Vielfachmessgeräte, 4 Kabel 20cm, 3 Kabel 10cm, 2Kabel 30cm, 1 Glühlampe 6V/100mA,
Physik-Übung * Jahrgangsstufe 8 * Elektrische Widerstände Blatt 1 Geräte: Netzgerät mit Strom- und Spannungsanzeige, 2 Vielfachmessgeräte, 4 Kabel 20cm, 3 Kabel 10cm, 2Kabel 30cm, 1 Glühlampe 6V/100mA,
Aufgabe: Untersuchung der Kinetik der Zersetzung von Harnstoff durch Urease.
 A 36 Michaelis-Menten-Kinetik: Hydrolyse von Harnstoff Aufgabe: Untersuchung der Kinetik der Zersetzung von Harnstoff durch Urease. Grundlagen: a) Michaelis-Menten-Kinetik Im Bereich der Biochemie spielen
A 36 Michaelis-Menten-Kinetik: Hydrolyse von Harnstoff Aufgabe: Untersuchung der Kinetik der Zersetzung von Harnstoff durch Urease. Grundlagen: a) Michaelis-Menten-Kinetik Im Bereich der Biochemie spielen
-Q 1 Nach Aufladen C 1
 Verschaltung von Kondensatoren a) Parallelschaltung C 2 Knotensatz: Q 2 -Q 2 Q 1 -Q 1 Nach Aufladen C 1 U Die Kapazitäten addieren sich b) Reihenschaltung C 1 C 2 Q -Q Q -Q Maschenregel: U Die reziproken
Verschaltung von Kondensatoren a) Parallelschaltung C 2 Knotensatz: Q 2 -Q 2 Q 1 -Q 1 Nach Aufladen C 1 U Die Kapazitäten addieren sich b) Reihenschaltung C 1 C 2 Q -Q Q -Q Maschenregel: U Die reziproken
Physikalisches Praktikum I. PTC und NTC Widerstände. Fachbereich Physik. Energielücke. E g. Valenzband. Matrikelnummer:
 Fachbereich Physik Physikalisches Praktikum I Name: PTC und NTC Widerstände Matrikelnummer: Fachrichtung: Mitarbeiter/in: Assistent/in: Versuchsdatum: Gruppennummer: Endtestat: Dieser Fragebogen muss von
Fachbereich Physik Physikalisches Praktikum I Name: PTC und NTC Widerstände Matrikelnummer: Fachrichtung: Mitarbeiter/in: Assistent/in: Versuchsdatum: Gruppennummer: Endtestat: Dieser Fragebogen muss von
2 Elektrischer Stromkreis
 2 Elektrischer Stromkreis 2.1 Aufbau des technischen Stromkreises Nach der Durcharbeitung dieses Kapitels haben Sie die Kompetenz... Stromkreise in äußere und innere Abschnitte einzuteilen und die Bedeutung
2 Elektrischer Stromkreis 2.1 Aufbau des technischen Stromkreises Nach der Durcharbeitung dieses Kapitels haben Sie die Kompetenz... Stromkreise in äußere und innere Abschnitte einzuteilen und die Bedeutung
Schaltzeichen. Schaltzeichen
 Die Eigenschaften des pn-übergangs werden in Halbleiterdioden genutzt. Halbleiterdioden bestehen aus einer p- und einer n-leitenden Schicht. Die Schichten sind in einem Gehäuse miteinander verbunden und
Die Eigenschaften des pn-übergangs werden in Halbleiterdioden genutzt. Halbleiterdioden bestehen aus einer p- und einer n-leitenden Schicht. Die Schichten sind in einem Gehäuse miteinander verbunden und
Grundpraktikum E2 Innenwiderstand von Messgeräten
 Grundpraktikum E2 Innenwiderstand von Messgeräten Julien Kluge 7. November 205 Student: Julien Kluge (56453) Partner: Fredrica Särdquist (568558) Betreuer: Pascal Rustige Raum: 27 Messplatz: 2 INHALTSVERZEICHNIS
Grundpraktikum E2 Innenwiderstand von Messgeräten Julien Kluge 7. November 205 Student: Julien Kluge (56453) Partner: Fredrica Särdquist (568558) Betreuer: Pascal Rustige Raum: 27 Messplatz: 2 INHALTSVERZEICHNIS
Versuch E05: Spannungs-Strom-Kennlinien elektrischer Widerstände
 ersuch E05: Spannungs-Strom-Kennlinien elektrischer Widerstände 4. März 2016 Einleitung Eine wesentliche Eigenschaft elektrischer Widerstände (elektrische Bauelemente, Leitungen, Geräte) kann dadurch ermittelt
ersuch E05: Spannungs-Strom-Kennlinien elektrischer Widerstände 4. März 2016 Einleitung Eine wesentliche Eigenschaft elektrischer Widerstände (elektrische Bauelemente, Leitungen, Geräte) kann dadurch ermittelt
PP Physikalisches Pendel
 PP Physikalisches Pendel Blockpraktikum Frühjahr 2007 (Gruppe 2) 25. April 2007 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 2 2 Theoretische Grundlagen 2 2.1 Ungedämpftes physikalisches Pendel.......... 2 2.2 Dämpfung
PP Physikalisches Pendel Blockpraktikum Frühjahr 2007 (Gruppe 2) 25. April 2007 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 2 2 Theoretische Grundlagen 2 2.1 Ungedämpftes physikalisches Pendel.......... 2 2.2 Dämpfung
T1: Wärmekapazität eines Kalorimeters
 Grundpraktikum T1: Wärmekapazität eines Kalorimeters Autor: Partner: Versuchsdatum: Versuchsplatz: Abgabedatum: Inhaltsverzeichnis 1 Physikalische Grundlagen und Aufgabenstellung 2 2 Messwerte und Auswertung
Grundpraktikum T1: Wärmekapazität eines Kalorimeters Autor: Partner: Versuchsdatum: Versuchsplatz: Abgabedatum: Inhaltsverzeichnis 1 Physikalische Grundlagen und Aufgabenstellung 2 2 Messwerte und Auswertung
E000 Ohmscher Widerstand
 E000 Ohmscher Widerstand Gruppe A: Collin Bo Urbon, Klara Fall, Karlo Rien Betreut von Elektromaster Am 02.11.2112 Inhalt I. Einleitung... 1 A. Widerstand und ohmsches Gesetz... 1 II. Versuch: Strom-Spannungs-Kennlinie...
E000 Ohmscher Widerstand Gruppe A: Collin Bo Urbon, Klara Fall, Karlo Rien Betreut von Elektromaster Am 02.11.2112 Inhalt I. Einleitung... 1 A. Widerstand und ohmsches Gesetz... 1 II. Versuch: Strom-Spannungs-Kennlinie...
Physikalisches Praktikum
 Physikalisches Praktikum Viskosität von Flüssigkeiten Laborbericht Korrigierte Version 9.Juni 2002 Andreas Hettler Inhalt Kapitel I Begriffserklärungen 5 Viskosität 5 Stokes sches
Physikalisches Praktikum Viskosität von Flüssigkeiten Laborbericht Korrigierte Version 9.Juni 2002 Andreas Hettler Inhalt Kapitel I Begriffserklärungen 5 Viskosität 5 Stokes sches
Vorbereitung: Eigenschaften elektrischer Bauelemente
 Vorbereitung: Eigenschaften elektrischer Bauelemente Marcel Köpke & Axel Müller 15.06.2012 Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 3 2 Aufgaben 7 2.1 Temperaturabhängigkeit............................ 7 2.2 Kennlinien....................................
Vorbereitung: Eigenschaften elektrischer Bauelemente Marcel Köpke & Axel Müller 15.06.2012 Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 3 2 Aufgaben 7 2.1 Temperaturabhängigkeit............................ 7 2.2 Kennlinien....................................
Grundwissen. Physik. Jahrgangsstufe 8
 Grundwissen Physik Jahrgangsstufe 8 Grundwissen Physik Jahrgangsstufe 8 Seite 1 1. Energie; E [E] = 1Nm = 1J (Joule) 1.1 Energieerhaltungssatz Formulierung I: Energie kann nicht erzeugt oder vernichtet
Grundwissen Physik Jahrgangsstufe 8 Grundwissen Physik Jahrgangsstufe 8 Seite 1 1. Energie; E [E] = 1Nm = 1J (Joule) 1.1 Energieerhaltungssatz Formulierung I: Energie kann nicht erzeugt oder vernichtet
Wärmeleitung - Versuchsprotokoll
 Gruppe 13: René Laquai Jan Morasch Rudolf Seiler Praktikum Materialwissenschaften II Wärmeleitung - Versuchsprotokoll Betreuerin: Silke Schaab 1. Einleitung: In diesem Versuch wird die Wärmeleitung verschiedener
Gruppe 13: René Laquai Jan Morasch Rudolf Seiler Praktikum Materialwissenschaften II Wärmeleitung - Versuchsprotokoll Betreuerin: Silke Schaab 1. Einleitung: In diesem Versuch wird die Wärmeleitung verschiedener
Leiterkennlinien elektrischer Widerstand
 Leiterkennlinien elektrischer Widerstand Experiment: Wir untersuchen den Zusammenhang zwischen der anliegenden Spannung und der Stromstärke I bei verschiedenen elektrischen Leitern. Als elektrische Leiter
Leiterkennlinien elektrischer Widerstand Experiment: Wir untersuchen den Zusammenhang zwischen der anliegenden Spannung und der Stromstärke I bei verschiedenen elektrischen Leitern. Als elektrische Leiter
