Wie beeinflusst Leistungsbewertung Motivation und Emotionen?
|
|
|
- Wilhelmine Dressler
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Wie beeinflusst Leistungsbewertung Motivation und Emotionen? 1 Potsdamer Zentrum für empirische Inklusionsforschung (ZEIF), 2017, Nr. 11 Wie beeinflusst Leistungsbewertung Motivation und Emotionen? Jannis Bosch Universität Potsdam Zusammenfassung: Aktivitäten, die direkt oder indirekt mit der Leistungsbewertung der Schülerinnen und Schüler zu tun haben, nehmen einen großen Teil der Schulzeit ein. Dabei kann man im Allgemeinen zwischen zwei verschiedenen Systemen unterscheiden: Belohnung nach Fähigkeit und Belohnung nach Anstrengung. Je nach angewandtem Belohnungssystem werden zwei unterschiedliche Referenzrahmen zur Bewertung der Schulleistung herangezogen. Im Rahmen dieses Artikels werden die bisherigen Forschungsergebnisse zu dem Einfluss der genannten Belohnungssysteme im Hinblick auf Motivation und Emotionen zusammengetragen und im Hinblick auf Implikationen für die Praxis analysiert. Abstract: Activities which directly or indirectly relate to evaluation of performance constitute a large amount of time during school. According to Covington (2000) the system of evaluation at school can resemble either an Ability Game or an Equity Game. Depending on which system of evaluation is used, different frames of reference are used to judge the student s school performance. In this paper the described systems of evaluation and their effects on motivation and emotion will be analysed and discussed for potential implications for school. Schlagwörter: Leistungsrückmeldung, Emotion, Referenzrahmen, Motivation Keywords: Performance Feedback, Emotion, Frame of Reference, Motivation
2 2 Jannis Bosch Einleitung Evaluation ist die Beschreibung, Analyse und Bewertung von Prozessen oder Personen (Hussy, Schreier, & Echterhoff, 2013, S. 29). Entsprechend sind Leistungsbewertung und -rückmeldung als Evaluationsprozesse zu verstehen. In der Schule nehmen Aktivitäten, die direkt oder indirekt mit der Evaluation der Leistung der Schülerinnen und Schüler in Zusammenhang stehen, einen großen Teil der Zeit ein. Der Einfluss dieser Aktivitäten auf die Schülerinnen und Schüler, insbesondere auf Motivation und Emotionen, ist bereits seit längerer Zeit Gegenstand der pädagogisch-psychologischen Forschung. Dabei konnte in vielen verschiedenen empirischen Untersuchungen gezeigt werden, dass das heute vorherrschende Modell der Benotung auf Basis des sozialen Vergleichs innerhalb der Klasse speziell bei schwächeren Schülerinnen und Schülern häufig zu einem Motivationsverlust und negativen Emotionen führt (z.b. Ames, 1992; Ingenkamp, 1995; Rheinberg, 1980). Diese Effekte sind speziell im Hinblick auf die zunehmende Heterogenität der Lerngruppen, die im Rahmen der Ausweitung des inklusiven Schulsystems zu erwarten ist, als problematisch anzusehen. Motivation und positive Emotionen sind wichtige Faktoren für einen erfolgreichen Lernprozess (Hattie, 2010; Pintrich, Marx, & Boyle, 1993). In den heute vorherrschenden sozial-kognitiven Modellen wird die Motivation, anders als in den traditionellen Motivationsmodellen, als multidimensionales Konstrukt verstanden. Entsprechend ist die Zielsetzung nicht mehr die Beschreibung von Schülerinnen und Schülern als motiviert bzw. nicht motiviert, sondern die Darstellung unterschiedlicher Zielsetzungen und Gründe für die Beteiligung bzw. nicht- Beteiligung am schulischen Unterricht. Im Rahmen dieses Artikels werden wir uns daher auf die Analyse der Lern- und Leistungszielorientierung als motivationales Konstrukt sowie den Emotionen als Bestandteile von Lernprozessen beschränken. Die Lern- und Leistungszielorientierung beschreibt verschiedene Muster von Zielsetzungen in Lern- und Leistungssituationen. Im Allgemeinen wird dabei zwischen zwei konkurrierenden Zielen unterschieden: den Lernzielen (in der englischsprachigen Literatur auch Learning Goals, Mastery Goals oder Task Involvement Goals genannt) und den Leistungszielen (englisch auch Performance Goals oder Ego Involvement Goals). Letztere können noch einmal in Annäherungs- und Vermeidungs-Leistungsziele unterteilt werden (Elliot & Harackiewicz, 1996). Von einer Lernzielorientierung spricht man, wenn in Leistungssituationen das Lernen an sich im Vordergrund steht. Dem gegenüber stehen die zwei Facetten der Leistungszielorientierung, bei der die Darstellung von Fähigkeit durch das Zeigen besonders guter Leistung im Vergleich zu anderen (Annäherungs-Leistungsziele) bzw. das Vermeiden des Zeigens schlechter Leistung im Vergleich zu anderen (Vermeidungs- Leistungsziele) das primäre Ziel einer Leistungssituation ist.
3 Wie beeinflusst Leistungsbewertung Motivation und Emotionen? 3 Die Emotionen als weiterer wichtiger Einflussfaktor für einen erfolgreichen Lernprozess, werden als direkte und adaptive Reaktion eines Organismus auf einen Stimulus betrachtet, die den menschlichen Organismus auf ein situativ angemessenes Verhalten vorbereiten (Rottenberg & Gross, 2006). Im Bereich der schulischen Emotionsforschung werden dabei meist zweidimensionale Modelle zur Darstellung der Leistungsemotionen genutzt, die nur zwischen positiven und negativen Emotionen differenzieren. Diese grobe Einteilung der emotionalen Reaktionen auf schulische Aufgaben scheint allerdings nicht zu genügen, um der komplexen Realität in schulischen Lernsituationen gerecht zu werden, da sie die qualitativen Unterschiede zwischen Emotionen, wie z.b. Langeweile und Ärger als Beispiele für schulrelevante negative Emotionen, außer Acht lassen (Pekrun, Goetz, Titz, & Perry, 2002). Dementsprechend haben Pekrun, Elliot und Maier (2006, 2009) ein 2x3 Modell der Leistungsemotionen mit den Dimensionen Objektbezogenheit (prospektiv ergebnisbezogen, aktivitätsbezogen und retrospektiv ergebnisbezogen) und Valenz (positiv und negativ) vorgeschlagen (siehe Tabelle 1), das wir auch in diesem Artikel nutzen werden. Bezogen auf die jeweilige Unterrichtsaktivität kann so z.b. als positive Emotion Freude und als negative Emotion Ärger hervorgerufen werden. Tabelle 1 Taxonomie der Leistungsemotionen (nach Pekrun et al., 2006) Valenz Objektbezogenheit Positiv Negativ Aktivitätsbezogen Freude Ärger Ergebnisbezogen Prospektiv Hoffnung Angst Hoffnungslosigkeit Retrospektiv Stolz Scham Die bisherige Forschung deutet darauf hin, dass Personen mit hoher Lernzielorientierung im Lernprozess eine erhöhte Anstrengungsbereitschaft zeigen und tiefergehende Lernstrategien nutzen (Diseth, 2011; Greene, Debacker, Ravindran, & Krows, 1999). Weiterhin scheinen Kinder, die eine hohe Lernzielorientierung aufweisen, auch mehr positive Emotionen beim Lernen zu erleben (Pekrun, Elliot, & Maier, 2006, 2009). Positive Emotionen wie Freude, Hoffnung und Stolz gehen wiederum mit besserer Lernleistung einher, während negative Emotionen wie Ärger, Angst und Scham mit schlechter Lernleistung einhergehen (Pekrun et al., 2004). Dementsprechend ist es das Ziel dieses Beitrags, den Einfluss verschiedener Evaluationspraktiken auf die Lern- und Leistungszielorientierung und die Leistungsemotionen zu analysieren und daraus praktische Handlungsempfehlungen abzuleiten, die eine lernzielorientierte und emotional positive Lernerfahrung für alle Schülerinnen und Schüler ermöglichen.
4 4 Jannis Bosch Schulische Evaluationssysteme Auf eine Leistungsbewertung folgt im schulischen Kontext häufig eine Rückmeldung für die Schülerinnen und Schüler, die auch als Belohnung für einen erfolgreichen Lernprozess (bzw. Bestrafung im gegenteiligen Fall) verstanden werden kann. Covington (2000) bezeichnet die Art und Struktur der schulischen Leistungsevaluation und -rückmeldung daher zusammenfassend als Belohnungssystem im Klassenraum ( Classroom Incentive Structure ) und identifiziert zwei unterschiedliche Belohnungssysteme, die in den vergangenen Jahrzehnten häufig angewandt und entsprechend auch intensiv beforscht wurden: Belohnung nach Fähigkeit und Belohnung nach Anstrengung. Belohnung nach Fähigkeit Bei diesem System werden Schulkinder dafür belohnt, dass sie im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen und -schülern besonders gute Leistungen erzielen. Covington (2000) bezeichnet diese Bewertungs- und Rückmeldungsstruktur auch als Fähigkeitsspiel (engl. Ability Game ), bei dem die Kinder implizit vermittelt bekommen, dass es im Rahmen der Schule wichtig ist, hohe Fähigkeiten zu zeigen. Dadurch, dass positive Rückmeldung, sei es verbal oder durch Noten, in diesem System eine begrenzte Ressource ist (es können nicht alle Kinder besser sein als die anderen), ist das Ziel nicht das Meistern von Lerninhalten, sondern das gute Abschneiden im Vergleich zu den anderen Kindern. Gute Zensuren sprechen in diesem System also nicht unbedingt dafür, dass ein Kind besonders viel gelernt oder sich sehr viel Mühe gegeben hat, sondern dafür, dass es eine relativ hohe Fähigkeit im bewerteten Bereich besitzt. Schlechte Zensuren hingegen stehen für einen Mangel an Fähigkeit, der sich häufig in Gefühlen der Wertlosigkeit und Hilflosigkeit niederschlägt. Belohnung nach Anstrengung Im Gegensatz dazu steht ein System, bei dem Anstrengung und der Wille zur Verbesserung der eigenen Fehler im Fokus der Evaluation des Lernerfolgs steht. Covington (2000) bezeichnet dieses System auch als Spiel der (motivationalen) Gleichheit (engl. Equity Game ), bei dem die Schulkinder trotz unterschiedlicher Fähigkeitsniveaus doch die gleiche Chance haben gut bewertet zu werden. Anders als im weiter oben beschriebenen System der Belohnung nach Fähigkeit, ist die durch Noten und Leistungsrückmeldung von außen vorgegebene Zielsetzung eine Verbesserung der eigenen Leistung, die im Prinzip allen Schülerinnen und Schülern, unabhängig vom jeweiligen Ausgangsniveau, möglich sein sollte. Die Rolle des Referenzrahmens der Leistungsrückmeldung Die Ergebnisse verschiedener Studien legen nahe, dass die Evaluationsstruktur, und damit einhergehend der Referenzrahmen der Leistungsrückmeldung, sowohl kurz- als auch langfristige Auswirkungen auf die Lernmotivation von Schulkindern (und auch Erwachsenen) hat. Die oben beschriebenen Belohnungssysteme setzen implizit jeweils einen
5 Wie beeinflusst Leistungsbewertung Motivation und Emotionen? 5 bestimmten Referenzrahmen der Leistungsbewertung voraus. In der pädagogischpsychologischen Forschung wird dabei zwischen einem sozialen und einem individuellen Referenzrahmen der Leistungsrückmeldung unterschieden (siehe z.b. Dickhäuser, Janke, Praetorius, & Dresel, 2017). Ein sozialer Referenzrahmen bedeutet, dass die Leistung einer Schülerin bzw. eines Schülers mit der Leistung der anderen Schülerinnen und Schüler innerhalb der Klasse oder Schule verglichen wird. Man spricht dabei, parallel zu den weiter oben beschriebenen Belohnungssystemen, auch von einer fähigkeitsbezogenen oder normativen Leistungsrückmeldung. Der individuelle Referenzrahmen hingegen bezeichnet den Vergleich der Leistung einer Schülerin bzw. eines Schülers mit der eigenen Leistung zu einem früheren Zeitpunkt. Sie kann entsprechend auch als anstrengungsbezogene oder individuelle Leistungsrückmeldung bezeichnet werden (Rheinberg, 1980). Die Annahme ist dabei, dass die Art des Referenzrahmens die aktuelle und zukünftige Zielsetzung in Lernsituationen, zusammengefasst als Lern- und Leistungszielorientierung, und darüber auch die erlebten Leistungsemotionen, beeinflusst. Einfluss des Referenzrahmens auf die Lernund Leistungszielorientierung Pekrun, Cusack, Murayama, Elliot und Thomas (2014) haben den Einfluss des Referenzrahmens auf die Lern- und Leistungszielorientierung in einer experimentellen Studie untersucht. Dabei wurden 153 Oberschülerinnen und Oberschülern (durchschnittliches Alter ca. 17 Jahre) vor der Bearbeitung einer Lernaufgabe mit zwei Durchgängen zufällig in drei Gruppen eingeteilt: Die erste Gruppe erhielt die Information, dass sie nach Beendigung des zweiten Durchgangs eine fähigkeitsbezogene Leistungsrückmeldung im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern bekommen würde. Die zweite Gruppe erhielt die Information, dass sie nach Beendigung des zweiten Durchgangs eine anstrengungsbezogene Leistungsrückmeldung über ihre persönliche Verbesserung bekommen würde. Die dritte Gruppe fungierte als Kontrollgruppe und bekam die Information, dass sie keine Rückmeldung bekommen würde. Nachdem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Instruktion und die Information über die bevorstehende Rückmeldung erhalten hatten, wurde ihre Lern- und Leistungszielorientierung erhoben. Dabei zeigte sich, dass Personen, die eine fähigkeitsbezogene Leistungsrückmeldung erwarteten eine niedrigere Lernzielorientierung aufwiesen, als diejenigen die eine anstrengungsbezogene Rückmeldung oder keine Rückmeldung erwarteten. Gegensätzliche Ergebnisse zeigten sich sowohl bei den Annäherungs- als auch bei den Vermeidungs- Leistungszielen. Hier zeigten Personen, die eine fähigkeitsbezogene Leistungsrückmeldung erwarteten, höhere Werte als Personen aus den anderen beiden Gruppen. Diese Ergebnisse zeigen, dass der Referenzrahmen einer antizipierten Leistungsrückmeldung sich schon auf die Zielsetzung der Schülerinnen und Schüler auswirkt.
6 6 Jannis Bosch Einfluss des Referenzrahmens auf das Emotionserleben In einem weiteren Schritt erhoben die Autoren der Studie auch die Leistungsemotionen der Schülerinnen und Schüler vor (prospektiv ergebnisbezogen), während (aktivitätsbezogen) und nach (retrospektiv ergebnisbezogen) der Bearbeitung Lernaufgabe. Dabei zeigte sich, dass Personen, die eine anstrengungsbezogene Leistungsrückmeldung erwarteten, mehr Hoffnung und Stolz und weniger Angst, Hoffnungslosigkeit, Ärger und Scham empfanden als Personen, die eine fähigkeitsbezogene Leistungsrückmeldung erwarteten. Weiterhin konnten Pekrun et al. (2014) zeigen, dass das verstärkte Empfinden negativer Emotionen in der Gruppe mit fähigkeitsbezogener Leistungsrückmeldung auch mit einer Erhöhung der Vermeidungs-Leistungszielorientierung einhergeht. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die Zielsetzung der Schülerinnen und Schüler durch die Art der Leistungsrückmeldung verändert hat und dass die Veränderung in der Zielsetzung dann auch in Unterschieden in der emotionalen Erfahrung niederschlägt. Zusammenfassung Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse dieser Studie, dass bereits die Erwartung einer bestimmten Leistungsrückmeldung die Lern- und Leistungsziele beim Bearbeiten einer Lernaufgabe beeinflussen kann. Damit einhergehend können sich auch die wahrgenommenen Emotionen, und damit die Bewertung der Lernsituation als positiv oder negativ, verändern. Das Ziel Schulkindern eine hohe Lernzielorientierung, sowie eine positive emotionale Erfahrung zu vermitteln, kann also am ehesten erreicht werden, wenn die Leistungsrückmeldung sich auf individuelle Verbesserungen anstatt auf den sozialen Vergleich konzentriert. Eine hohe Lernzielorientierung wirkt sich wiederum positiv auf verschiedene Lernrelevante Faktoren, wie z.b. die Anstrengungsbereitschaft, aus und geht mit mehr positiven Emotionen beim Lernen einher. Worauf sollte man in der Praxis achten? Laut Ames (1992) sollte man als Lehrperson folgende Punkte beachten, um die Entwicklung einer Lernzielorientierung bei Schülerinnen und Schülern zu unterstützen: Der Fokus der Leistungsrückmeldung sollte auf der individuellen Veränderung und den Lernfortschritt gelegt werden und nicht auf den Vergleich mit Mitschülerinnen und Mitschülern. Besondere Anstrengung sollte immer mit Anerkennung belohnt werden, unabhängig davon wie die erbrachte Leistung im sozialen Vergleich bewertet werden würde. Die Bewertung der Schülerinnen und Schüler sollte in privaten Gesprächen oder Briefen geschehen und nicht öffentlich gemacht werden. Materialien sollten so gestaltet werden, dass jeder Schüler und jede Schülerin die Möglichkeit hat sich zu verbessern. Fehler sollten als normaler Teil des Lernprozesses behandelt werden und nicht als Ursache für Kritik und Tadel.
7 Wie beeinflusst Leistungsbewertung Motivation und Emotionen? 7 Literaturverzeichnis Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84(3), Covington, M. V. (2000). Goal Theory, Motivation, and School Achievement: An Integrative Review. Annual Review of Psychology, 51(1), Dickhäuser, O., Janke, S., Praetorius, A.-K., & Dresel, M. (2017). The Effects of Teachers Reference Norm Orientations on Students Implicit Theories and Academic Self-Concepts. Zeitschrift Für Pädagogische Psychologie, 31(3 4), Diseth, Å. (2011). Self-efficacy, goal orientations and learning strategies as mediators between preceding and subsequent academic achievement. Learning and Individual Differences, 21(2), Elliot, A. J., & Harackiewicz, J. M. (1996). Approach and avoidance achievement goals and intrinsic motivation: A mediational analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 70(3), Greene, B. A., Debacker, T. K., Ravindran, B., & Krows, A. J. (1999). Goals, Values, and Beliefs as Predictors of Achievement and Effort in High School Mathematics Classes. Sex Roles, 40(5), Hattie, J. A. C. (2010). Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement (Reprinted). London: Routledge. Hussy, W., Schreier, M., & Echterhoff, G. (2013). Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. Ingenkamp, K. (Ed.). (1995). Die Fragwürdigkeit der Zensurengebung: Texte und Untersuchungsberichte (9., unveränd. Aufl). Weinheim: Beltz. Pekrun, R., Cusack, A., Murayama, K., Elliot, A. J., & Thomas, K. (2014). The power of anticipated feedback: Effects on students achievement goals and achievement emotions. Learning and Instruction, 29,
8 8 Jannis Bosch Pekrun, R., Elliot, A. J., & Maier, M. A. (2006). Achievement goals and discrete achievement emotions: A theoretical model and prospective test. Journal of Educational Psychology, 98(3), Pekrun, R., Elliot, A. J., & Maier, M. A. (2009). Achievement goals and achievement emotions: Testing a model of their joint relations with academic performance. Journal of Educational Psychology, 101(1), Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W., & Perry, R. P. (2002). Academic Emotions in Students Self-Regulated Learning and Achievement: A Program of Qualitative and Quantitative Research. Educational Psychologist, 37(2), Pintrich, P. R., Marx, R. W., & Boyle, R. A. (1993). Beyond Cold Conceptual Change: The Role of Motivational Beliefs and Classroom Contextual Factors in the Process of Conceptual Change. Review of Educational Research, 63(2), Rheinberg, F. (1980). Leistungsbewertung und Lernmotivation. Göttingen ; Toronto ; Zürich: Verlag für Psychologie Hogrefe. Rottenberg, J., & Gross, J. J. (2006). When Emotion Goes Wrong: Realizing the Promise of Affective Science. Clinical Psychology: Science and Practice, 10(2), Urton, K., Börnert-Ringleb, M., Krull, J., Wilbert, J., & Hennemann, T. (in Druck). Inklusives Schulklima: Konzeptionelle Darstellung eines Rahmenmodels. Zeitschrift Für Heilpädagogik.
Arbeitstitel Der Einfluss des räumlichen Vorstellungsvermögens beim Verstehen eines Sachtextes
 Arbeitstitel Der Einfluss des räumlichen Vorstellungsvermögens beim Verstehen eines Sachtextes CHRISTINA WEERS MASTERARBEIT PÄDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE 26.09.2017 1 Theoretischer Hintergrund Lernen ist aktiv
Arbeitstitel Der Einfluss des räumlichen Vorstellungsvermögens beim Verstehen eines Sachtextes CHRISTINA WEERS MASTERARBEIT PÄDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE 26.09.2017 1 Theoretischer Hintergrund Lernen ist aktiv
Konzeptwandelprozesse im Anfangsunterricht Chemie
 Konzeptwandelprozesse im Anfangsunterricht Chemie Erste Ergebnisse einer Längsschnittstudie Gefördert vom Aufbau des Vortrags Fragestellung und Ergebnisse und Ruß ist das, was die Kerze ausatmet! Präkonzepte
Konzeptwandelprozesse im Anfangsunterricht Chemie Erste Ergebnisse einer Längsschnittstudie Gefördert vom Aufbau des Vortrags Fragestellung und Ergebnisse und Ruß ist das, was die Kerze ausatmet! Präkonzepte
Kausalattribution und Leistungsmotivation
 Professur für Allgemeine Psychologie Vorlesung im WS 2011/12 Motivation, Emotion, Volition Kausalattribution und Leistungsmotivation Prof. Dr. Thomas Goschke 1 Überblick und Lernziele Kognitive Ansätze
Professur für Allgemeine Psychologie Vorlesung im WS 2011/12 Motivation, Emotion, Volition Kausalattribution und Leistungsmotivation Prof. Dr. Thomas Goschke 1 Überblick und Lernziele Kognitive Ansätze
What works best?: Hatties Synthese der empirischen Forschung zur Unterrichtsqualität
 13. EMSE-Tagung in Kiel, 29./30.06.2011 What works best?: Hatties Synthese der empirischen Forschung zur Unterrichtsqualität Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN)
13. EMSE-Tagung in Kiel, 29./30.06.2011 What works best?: Hatties Synthese der empirischen Forschung zur Unterrichtsqualität Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN)
Selbstreguliertes Lernen
 Selbstreguliertes Lernen Felix Kapp Workshop Lehren und Lernen mit digitalen Medien TU Dresden 03.-04.12.2009 Gliederung Begriffsdefinition Selbstreguliertes Lernen Modelle des Selbstregulierten Lernens
Selbstreguliertes Lernen Felix Kapp Workshop Lehren und Lernen mit digitalen Medien TU Dresden 03.-04.12.2009 Gliederung Begriffsdefinition Selbstreguliertes Lernen Modelle des Selbstregulierten Lernens
Theorien für den Unterricht
 Theorien für den Unterricht Motivation im Unterricht Daniela Martinek Überblick Defensives Lernen Task vs. Ego-Orientierung Förderung der Lernmotivation Selbstbestimmungstheorie Defensives Lernen (vgl.
Theorien für den Unterricht Motivation im Unterricht Daniela Martinek Überblick Defensives Lernen Task vs. Ego-Orientierung Förderung der Lernmotivation Selbstbestimmungstheorie Defensives Lernen (vgl.
Sportpsychologie. Leistungsmotivation im Sport. Vorlesung/Übung. 2 Gliederung. 1. Definition. 2. Komponenten. 3. Prozessmodell
 Institut für Sportwissenschaften Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/M. Vorlesung/Übung Leistungsmotivation im Sport 2 Gliederung 1. Definition 2. Komponenten 3. Prozessmodell 4. Leistungsmotivation
Institut für Sportwissenschaften Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/M. Vorlesung/Übung Leistungsmotivation im Sport 2 Gliederung 1. Definition 2. Komponenten 3. Prozessmodell 4. Leistungsmotivation
The promotion of perceived physical ability via an intervention using internal teacher frame of reference in
 The promotion of perceived physical ability via an intervention using internal teacher frame of reference in physical education Esther Oswald Institut für Sportwissenschaft, Universität Bern SGS-Tagung,
The promotion of perceived physical ability via an intervention using internal teacher frame of reference in physical education Esther Oswald Institut für Sportwissenschaft, Universität Bern SGS-Tagung,
Eine Schule zum Wohlfühlen mehr als nur eine Utopie?
 Gymnasium Zell am See, 08. Mai 2007 Eine Schule zum Wohlfühlen mehr als nur eine Utopie? Prof. Dr. Tina Hascher, Fachbereich Erziehungswissenschaft (tina.hascher@sbg.ac.at) Vier Schritte 1. Wohlbefinden
Gymnasium Zell am See, 08. Mai 2007 Eine Schule zum Wohlfühlen mehr als nur eine Utopie? Prof. Dr. Tina Hascher, Fachbereich Erziehungswissenschaft (tina.hascher@sbg.ac.at) Vier Schritte 1. Wohlbefinden
Entwicklung der Motivation von Studierenden der Wirtschaftswissenschaften im ersten Studienjahr eine Mixed-Methods-Studie
 Entwicklung der Motivation von Studierenden der Wirtschaftswissenschaften im ersten Studienjahr eine Mixed-Methods-Studie Tobias Jenert & Taiga Brahm Motivationsentwicklung im ersten Studienjahr eine Längsschnittstudie
Entwicklung der Motivation von Studierenden der Wirtschaftswissenschaften im ersten Studienjahr eine Mixed-Methods-Studie Tobias Jenert & Taiga Brahm Motivationsentwicklung im ersten Studienjahr eine Längsschnittstudie
Lehrergesundheit und Unterrichtshandeln: Hat Burnout von Lehrkräften Folgen für die Leistung der Schülerinnen und Schüler?
 Lehrergesundheit und Unterrichtshandeln: Hat Burnout von Lehrkräften Folgen für die Leistung der Schülerinnen und Schüler? Prof. Dr. Uta Klusmann Leibniz Institute for Science and Mathematics Education,
Lehrergesundheit und Unterrichtshandeln: Hat Burnout von Lehrkräften Folgen für die Leistung der Schülerinnen und Schüler? Prof. Dr. Uta Klusmann Leibniz Institute for Science and Mathematics Education,
Vorwort Kapitel: Pädagogische Förderung aus entwicklungspsychologischer
 Vorwort..................................................... XI 1. Kapitel: Lernen, Lehren und die Pädagogische Psychologie... 1 1.1 Kennzeichnung der Pädagogischen Psychologie.................. 4 1.1.1
Vorwort..................................................... XI 1. Kapitel: Lernen, Lehren und die Pädagogische Psychologie... 1 1.1 Kennzeichnung der Pädagogischen Psychologie.................. 4 1.1.1
Fragestellung Fragestellungen
 Fragestellung 107 7 Fragestellungen Im Fokus dieser Studie steht die Frage, welche Auswirkungen individualisierte Rückmeldungen über den aktuellen Cholesterin- und Blutdruckwert auf die Bewertung der eigenen
Fragestellung 107 7 Fragestellungen Im Fokus dieser Studie steht die Frage, welche Auswirkungen individualisierte Rückmeldungen über den aktuellen Cholesterin- und Blutdruckwert auf die Bewertung der eigenen
Selbst organisiertes Lernen an Gymnasien: Ergebnisse einer Evaluationsstudie im Kanton Bern (Schweiz)
 Selbst organisiertes Lernen an Gymnasien: Ergebnisse einer Evaluationsstudie im Kanton Bern (Schweiz) Prof. Dr. Walter Herzog, Universität Bern 12. Mai 2016 Inhalt 1. Bildungssystem der Schweiz 2. Das
Selbst organisiertes Lernen an Gymnasien: Ergebnisse einer Evaluationsstudie im Kanton Bern (Schweiz) Prof. Dr. Walter Herzog, Universität Bern 12. Mai 2016 Inhalt 1. Bildungssystem der Schweiz 2. Das
Emotional Design. Lehren und Lernen mit Medien II. Professur E-Learning und Neue Medien. Institut für Medienforschung Philosophische Fakultät
 Professur E-Learning und Neue Medien Institut für Medienforschung Philosophische Fakultät Lehren und Lernen mit Medien II Emotional Design Überblick Einführung CATLM Vermenschlichung und Farbe Klassifikation
Professur E-Learning und Neue Medien Institut für Medienforschung Philosophische Fakultät Lehren und Lernen mit Medien II Emotional Design Überblick Einführung CATLM Vermenschlichung und Farbe Klassifikation
Intrinsische Motivation und künstliche Neugier
 Intrinsische Motivation und künstliche Neugier Michael Lampert Institut für Informatik, Humboldt-Universität zu Berlin SE Biologisch motivierte Lernverfahren 2012 Gliederung 1 Intrinsische Motivation Der
Intrinsische Motivation und künstliche Neugier Michael Lampert Institut für Informatik, Humboldt-Universität zu Berlin SE Biologisch motivierte Lernverfahren 2012 Gliederung 1 Intrinsische Motivation Der
Kollaboratives Lernen
 Kollaboratives Lernen Prof. Dr. Günter Daniel Rey 1 Überblick Einführung Aufgabenkomplexität als moderierender Einflussfaktor Arten des kollaborativen Lernens Entwicklungsphasen in virtuellen Lerngruppen
Kollaboratives Lernen Prof. Dr. Günter Daniel Rey 1 Überblick Einführung Aufgabenkomplexität als moderierender Einflussfaktor Arten des kollaborativen Lernens Entwicklungsphasen in virtuellen Lerngruppen
Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens
 Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens 8., überarbeitete und erweiterte Auflage von Gerd Mietzel GÖTTINGEN BERN WIEN PARIS OXFORD PRAG TORONTO CAMBRIDGE, MA AMSTERDAM KOPENHAGEN Inhaltsverzeichnis
Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens 8., überarbeitete und erweiterte Auflage von Gerd Mietzel GÖTTINGEN BERN WIEN PARIS OXFORD PRAG TORONTO CAMBRIDGE, MA AMSTERDAM KOPENHAGEN Inhaltsverzeichnis
Diagnostische Fähigkeiten verbessern Aber wie?!
 Diagnostische Fähigkeiten verbessern Aber wie?! Anna Südkamp Workshop im Rahmen der Landestagung Zukunftsschulen NRW 03. September 2015 Agenda 1. Diagnostische Fähigkeiten: Was versteht man darunter und
Diagnostische Fähigkeiten verbessern Aber wie?! Anna Südkamp Workshop im Rahmen der Landestagung Zukunftsschulen NRW 03. September 2015 Agenda 1. Diagnostische Fähigkeiten: Was versteht man darunter und
Lernen und Instruktion Themen- und Literaturliste für die 1. Staatsprüfung
 Sommersemester 2015 Lernen und Instruktion Themen- und Literaturliste für die 1. Staatsprüfung Erziehungswissenschaftliche Fakultät Psychologie des Lernens und Lehrens, der Entwicklung und Erziehung in
Sommersemester 2015 Lernen und Instruktion Themen- und Literaturliste für die 1. Staatsprüfung Erziehungswissenschaftliche Fakultät Psychologie des Lernens und Lehrens, der Entwicklung und Erziehung in
Selbst-Konzept basierte Motivationstheorien
 Selbst-Konzept basierte Motivationstheorien Leonard/Beauvais/Scholl (1999: 969): There is growing realization that traditional models of motivation do not explain the diversity of behavior found in organizational
Selbst-Konzept basierte Motivationstheorien Leonard/Beauvais/Scholl (1999: 969): There is growing realization that traditional models of motivation do not explain the diversity of behavior found in organizational
Mensch konstruiert aktiv und zielgerichtet sich selbst und seine Umwelt.
 THEMA : SELBSTREGULATION ALLGEMEINE ANNAHMEN: Mensch konstruiert aktiv und zielgerichtet sich selbst und seine Umwelt. 1. Menschen konstruieren ihre eigenen Meinungen, Ziele und Strategien aus den verfügbaren
THEMA : SELBSTREGULATION ALLGEMEINE ANNAHMEN: Mensch konstruiert aktiv und zielgerichtet sich selbst und seine Umwelt. 1. Menschen konstruieren ihre eigenen Meinungen, Ziele und Strategien aus den verfügbaren
Zurich Open Repository and Archive. Anatomie von Kommunikationsrollen. Methoden zur Identifizierung von Akteursrollen in gerichteten Netzwerken
 University of Zurich Zurich Open Repository and Archive Winterthurerstr. 190 CH-8057 Zurich http://www.zora.uzh.ch Year: 2008 Anatomie von Kommunikationsrollen. Methoden zur Identifizierung von Akteursrollen
University of Zurich Zurich Open Repository and Archive Winterthurerstr. 190 CH-8057 Zurich http://www.zora.uzh.ch Year: 2008 Anatomie von Kommunikationsrollen. Methoden zur Identifizierung von Akteursrollen
Herzlich willkommen zur Vorlesung in Schulpädagogik
 Herzlich willkommen zur Vorlesung in Schulpädagogik Prof. Dr. L. Haag Heutiges Thema Motivationale Variablen, Angst, Selbstkonzept Motivationale Variablen Fähigkeitsselbstkonzept + Aufgabenmotivation -
Herzlich willkommen zur Vorlesung in Schulpädagogik Prof. Dr. L. Haag Heutiges Thema Motivationale Variablen, Angst, Selbstkonzept Motivationale Variablen Fähigkeitsselbstkonzept + Aufgabenmotivation -
Emotionale Entwicklung I: Emotionsverständnis. Die Entwicklung von Emotionsverständnis und sein Einfluss auf die soziale Kompetenz
 Emotionale Entwicklung I: Emotionsverständnis Die Entwicklung von Emotionsverständnis und sein Einfluss auf die soziale Kompetenz Emotionsverständnis: Definition das Verständnis davon, wie man Emotionen
Emotionale Entwicklung I: Emotionsverständnis Die Entwicklung von Emotionsverständnis und sein Einfluss auf die soziale Kompetenz Emotionsverständnis: Definition das Verständnis davon, wie man Emotionen
1 Einleitung Erster Teil: Theoretischer Hintergrund Warum Mathematik? - Bedeutung des Faches Mathematik... 14
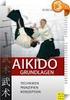 Inhaltsverzeichnis 3 INHALTSVERZEICHNIS 1 Einleitung... 11 Erster Teil: Theoretischer Hintergrund... 14 2 Warum Mathematik? - Bedeutung des Faches Mathematik... 14 2.1 Sieben Gründe für den Mathematikunterricht
Inhaltsverzeichnis 3 INHALTSVERZEICHNIS 1 Einleitung... 11 Erster Teil: Theoretischer Hintergrund... 14 2 Warum Mathematik? - Bedeutung des Faches Mathematik... 14 2.1 Sieben Gründe für den Mathematikunterricht
Rückmeldung als zentrales Element formativen Assessments
 Rückmeldung als zentrales Element formativen Assessments wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Umsetzung im Mathematikunterricht (Projekt Co 2 CA) Katrin Rakoczy & Birgit Harks Formatives Assessment:
Rückmeldung als zentrales Element formativen Assessments wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Umsetzung im Mathematikunterricht (Projekt Co 2 CA) Katrin Rakoczy & Birgit Harks Formatives Assessment:
Motivierung der Unmotivierten: Ein (nicht leicht zu lösendes) Problem des gymnasialen Unterrichts
 Motivierung der Unmotivierten: Ein (nicht leicht zu lösendes) Problem des gymnasialen Unterrichts PROF. DR. WALTER HERZOG, UNIVERSITÄT BERN Referat vom 5. Juli 2013 am Gymnasium Muristalden" 1. Entwicklung
Motivierung der Unmotivierten: Ein (nicht leicht zu lösendes) Problem des gymnasialen Unterrichts PROF. DR. WALTER HERZOG, UNIVERSITÄT BERN Referat vom 5. Juli 2013 am Gymnasium Muristalden" 1. Entwicklung
Praxis trifft Sportwissenschaft Sport mit Spaß Möglichkeiten & Grenzen von Emotionen im Sport. Dr. Peter Kovar
 Praxis trifft Sportwissenschaft Sport mit Spaß Möglichkeiten & Grenzen von Emotionen im Sport Dr. Peter Kovar Emotionen Sind komplexe Muster von Veränderungen, welche physiologische Erregung Gefühle kognitive
Praxis trifft Sportwissenschaft Sport mit Spaß Möglichkeiten & Grenzen von Emotionen im Sport Dr. Peter Kovar Emotionen Sind komplexe Muster von Veränderungen, welche physiologische Erregung Gefühle kognitive
Diversität (Schul- )Kultur Teilhabe
 Diversität (Schul- )Kultur Teilhabe Prof. Dr. Anne Sliwka PH Heidelberg Kassel, 20. Mai 2011 Woher wir kommen 1. Kultur der Homogenität der Lerngruppe, der Selek>on und der Separierung 2. Dominanz der
Diversität (Schul- )Kultur Teilhabe Prof. Dr. Anne Sliwka PH Heidelberg Kassel, 20. Mai 2011 Woher wir kommen 1. Kultur der Homogenität der Lerngruppe, der Selek>on und der Separierung 2. Dominanz der
CURRICULUM VITAE DORIS HOLZBERGER
 CURRICULUM VITAE DORIS HOLZBERGER PERSÖNLICHE INFORMATIONEN Wissenschaftliche Mitarbeiterin Friedl Schöller-Stiftungslehrstuhl für Unterrichts- und Hochschulforschung, TUM School of Education, Technische
CURRICULUM VITAE DORIS HOLZBERGER PERSÖNLICHE INFORMATIONEN Wissenschaftliche Mitarbeiterin Friedl Schöller-Stiftungslehrstuhl für Unterrichts- und Hochschulforschung, TUM School of Education, Technische
Den Lehrberuf salutogen gestalten: Gut, gesund & gerne unterrichten
 Impulstagung SNGS,Achtsam im Schulalltag Ressourcen kennen, entdecken und weiterentwickeln Luzern 29. November 2014 Den Lehrberuf salutogen gestalten: Gut, gesund & gerne unterrichten Dr. Nadja Badr Universität
Impulstagung SNGS,Achtsam im Schulalltag Ressourcen kennen, entdecken und weiterentwickeln Luzern 29. November 2014 Den Lehrberuf salutogen gestalten: Gut, gesund & gerne unterrichten Dr. Nadja Badr Universität
KAPITEL I EINLEITUNG
 KAPITEL I EINLEITUNG A. Hintergrunds Eines des wichtigsten Kommunikationsmittel ist die Sprache. Sprache ist ein System von Lauten, von Wörtern und von Regeln für die Bildung von Sätzen, das man benutzt,
KAPITEL I EINLEITUNG A. Hintergrunds Eines des wichtigsten Kommunikationsmittel ist die Sprache. Sprache ist ein System von Lauten, von Wörtern und von Regeln für die Bildung von Sätzen, das man benutzt,
P u b l i k a t i o n e n
 P u b l i k a t i o n e n B u c h - und Zeitschriftenbeiträge 2011 Dettmers, S., Trautwein, U., Lüdtke, O., Kunter, M., Baumert, J., Goetz, T., Frenzel, A. C., & Pekrun, R. (2011). Students emotions during
P u b l i k a t i o n e n B u c h - und Zeitschriftenbeiträge 2011 Dettmers, S., Trautwein, U., Lüdtke, O., Kunter, M., Baumert, J., Goetz, T., Frenzel, A. C., & Pekrun, R. (2011). Students emotions during
Säulendiagramm & Co.
 Säulendiagramm & Co. Workshop zur Visualisierung von numerischen Daten Michael Evers, B.A. Mentorat für quantitative Datenverarbeitung im Lehramtsstudium Agenda Visualisierungsbasics Was zu beachten ist.
Säulendiagramm & Co. Workshop zur Visualisierung von numerischen Daten Michael Evers, B.A. Mentorat für quantitative Datenverarbeitung im Lehramtsstudium Agenda Visualisierungsbasics Was zu beachten ist.
Das Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern
 Referat an der Eröffnungstagung des Kantonalen Netzwerkes Gesundheitsfördernder Schulen, 20. Januar 2007, Tagungszentrum Schloss Au / ZH Das Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern Tina Hascher (tina.hascher@sbg.ac.at)
Referat an der Eröffnungstagung des Kantonalen Netzwerkes Gesundheitsfördernder Schulen, 20. Januar 2007, Tagungszentrum Schloss Au / ZH Das Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern Tina Hascher (tina.hascher@sbg.ac.at)
Die richtigen Zutaten für eine professionelle Entwicklung
 Die richtigen Zutaten für eine professionelle Entwicklung Dr. Helen Jossberger Was sind Ihrer Meinung nach die richtigen Zutaten für eine professionelle Entwicklung? Was ist für Sie gute Anleitung? Was
Die richtigen Zutaten für eine professionelle Entwicklung Dr. Helen Jossberger Was sind Ihrer Meinung nach die richtigen Zutaten für eine professionelle Entwicklung? Was ist für Sie gute Anleitung? Was
Computerspiele & Sozialverhalten: Effekte gewalttätiger und prosozialer Computerspiele. Prof. Dr. Tobias Greitemeyer Universität Innsbruck
 Computerspiele & Sozialverhalten: Effekte gewalttätiger und prosozialer Computerspiele Prof. Dr. Tobias Greitemeyer Universität Innsbruck 1 Medienkonsum In der heutigen Zeit sind wir vielfältigem Medienkonsum
Computerspiele & Sozialverhalten: Effekte gewalttätiger und prosozialer Computerspiele Prof. Dr. Tobias Greitemeyer Universität Innsbruck 1 Medienkonsum In der heutigen Zeit sind wir vielfältigem Medienkonsum
Goal Setting. Objektivierbare Ziele. Vorlesung Sportpsychologie Raab, Markus SS 2007
 Goal Setting Motivation Definieren Sie intrinsische und extrinsische Motivation und geben sie jeweils einem schultypischen Beispiel an wie die Motivation gefördert werden kann Intrinsisch: Handlung und
Goal Setting Motivation Definieren Sie intrinsische und extrinsische Motivation und geben sie jeweils einem schultypischen Beispiel an wie die Motivation gefördert werden kann Intrinsisch: Handlung und
Wie wirken sich intrinsische Lernmotivation und extrinsische Lernmotivation auf die Studienleistung aus? Corinna Schmidt
 Wie wirken sich intrinsische Lernmotivation und extrinsische Lernmotivation auf die Studienleistung aus? Corinna Schmidt im Forschungskontext (Modul 4), 0.2.205 Gliederung 2 Theoret. 3 Lernmotivation =
Wie wirken sich intrinsische Lernmotivation und extrinsische Lernmotivation auf die Studienleistung aus? Corinna Schmidt im Forschungskontext (Modul 4), 0.2.205 Gliederung 2 Theoret. 3 Lernmotivation =
Haben Professoren Gefühle? Emotionen der Hochschullehrenden
 Haben Professoren Gefühle? Emotionen der Hochschullehrenden Dr. Robert Kordts-Freudinger Universität Paderborn Psychologische Emotionsforschung erlebt gerade Angst/Furcht Ärger/Wut Freude??? Definition
Haben Professoren Gefühle? Emotionen der Hochschullehrenden Dr. Robert Kordts-Freudinger Universität Paderborn Psychologische Emotionsforschung erlebt gerade Angst/Furcht Ärger/Wut Freude??? Definition
Unterschiedliche Zielarten erfordern. unterschiedliche Coaching-Tools
 Unterschiedliche Zielarten erfordern 2 unterschiedliche Coaching-Tools Aus theoretischer Perspektive lassen sich unterschiedliche Arten von Zielen unterscheiden. Die Art des Ziels und die dahinterliegende
Unterschiedliche Zielarten erfordern 2 unterschiedliche Coaching-Tools Aus theoretischer Perspektive lassen sich unterschiedliche Arten von Zielen unterscheiden. Die Art des Ziels und die dahinterliegende
Wie die Jugend von heute tickt und worauf sie bei der Berufswahl besonders Wert legt
 Wie die Jugend von heute tickt und worauf sie bei der Berufswahl besonders Wert legt Berufswahl in einer zunehmend digitalisierten Welt. Internetzugang ist Standard Jugendliche (12-19 Jahre) 99% haben
Wie die Jugend von heute tickt und worauf sie bei der Berufswahl besonders Wert legt Berufswahl in einer zunehmend digitalisierten Welt. Internetzugang ist Standard Jugendliche (12-19 Jahre) 99% haben
Einführung in die pädagogisch-psychologische Forschung zum leistungsbezogenen Denken und Fühlen
 Geisteswissenschaft Udo Schultheis Einführung in die pädagogisch-psychologische Forschung zum leistungsbezogenen Denken und Fühlen Essay Einführung in die pädagogischpsychologische Forschung zum leistungsbezogenen
Geisteswissenschaft Udo Schultheis Einführung in die pädagogisch-psychologische Forschung zum leistungsbezogenen Denken und Fühlen Essay Einführung in die pädagogischpsychologische Forschung zum leistungsbezogenen
Forschungsmethoden VORLESUNG SS 2017
 Forschungsmethoden VORLESUNG SS 2017 SOPHIE LUKES Überblick Letzte Woche: - Stichprobenziehung und Stichprobeneffekte Heute: -Gütekriterien I Rückblick Population und Stichprobe verschiedene Arten der
Forschungsmethoden VORLESUNG SS 2017 SOPHIE LUKES Überblick Letzte Woche: - Stichprobenziehung und Stichprobeneffekte Heute: -Gütekriterien I Rückblick Population und Stichprobe verschiedene Arten der
Frage 2: Die Bedeutung der Lehrermotivation für die Verankerung der Bildung für nachhaltige Entwicklung an Schulen
 Frage 2: Die Bedeutung der Lehrermotivation für die Verankerung der Bildung für nachhaltige Entwicklung an Schulen Kati Trempler Fragestellungen 1. Durch welche Faktoren werden die Formen der Lehrermotivation
Frage 2: Die Bedeutung der Lehrermotivation für die Verankerung der Bildung für nachhaltige Entwicklung an Schulen Kati Trempler Fragestellungen 1. Durch welche Faktoren werden die Formen der Lehrermotivation
Lernmotivation (Interesse)
 Professur E-Learning und Neue Medien Institut für Medienforschung Philosophische Fakultät Lernmotivation (Interesse) Maik Beege M.Sc. / Steve Nebel M.A. Seminaraufbau Lernmotivation Interesse Aktuelle
Professur E-Learning und Neue Medien Institut für Medienforschung Philosophische Fakultät Lernmotivation (Interesse) Maik Beege M.Sc. / Steve Nebel M.A. Seminaraufbau Lernmotivation Interesse Aktuelle
Kooperatives Lernen Solveig Hummel Lima, Mai 2008
 Kooperatives Lernen Solveig Hummel Lima, Mai 2008 1 Grundlagen Entwickelt von David und Roger Johnson Geht auf Sozialpsychologen zurück: Morton Deutsch & Kurt Lewin Ziel: SchülerInnen sollen nicht nur
Kooperatives Lernen Solveig Hummel Lima, Mai 2008 1 Grundlagen Entwickelt von David und Roger Johnson Geht auf Sozialpsychologen zurück: Morton Deutsch & Kurt Lewin Ziel: SchülerInnen sollen nicht nur
Reaktive Anspannungssteigerung und Geschwindigkeit in der Zielverfolgung*
 -------------------- Reaktive Anspannungssteigerung und Geschwindigkeit in der Zielverfolgung* Uwe B. Rohloff und Peter M. Gollwitzer Zusammenfassung Diiker (1963) beschreibt reaktive Anspannungssteigerung
-------------------- Reaktive Anspannungssteigerung und Geschwindigkeit in der Zielverfolgung* Uwe B. Rohloff und Peter M. Gollwitzer Zusammenfassung Diiker (1963) beschreibt reaktive Anspannungssteigerung
Schülerfeedback gestalten
 Feedback: Konstituierendes Element der Schulentwicklung Leistungen beurteilen Chancen eröffnen 7. Schulleitungssymposium 22.09. 23.09.2016 Workshop 5 Schülerfeedback gestalten Dr. Karolin Kuhn (Schulleiterin
Feedback: Konstituierendes Element der Schulentwicklung Leistungen beurteilen Chancen eröffnen 7. Schulleitungssymposium 22.09. 23.09.2016 Workshop 5 Schülerfeedback gestalten Dr. Karolin Kuhn (Schulleiterin
Frederik Blomann (Autor) Randbedingungen und Konsequenzen des Flow-Erlebens
 Frederik Blomann (Autor) Randbedingungen und Konsequenzen des Flow-Erlebens https://cuvillier.de/de/shop/publications/6500 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier, Nonnenstieg
Frederik Blomann (Autor) Randbedingungen und Konsequenzen des Flow-Erlebens https://cuvillier.de/de/shop/publications/6500 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier, Nonnenstieg
LERNE LERNEN MIT Verteiltem Lernen LERNE ÜBER EINEN LÄNGEREN ZEITRAUM
 Verteiltem Lernen LERNE ÜBER EINEN LÄNGEREN ZEITRAUM Fange früh mit der Vorbereitung für Prüfungen an und nimm dir jeden Tag ein wenig Zeit. Fünf Stunden auf zwei Wochen verteilt sind besser als fünf Stunden
Verteiltem Lernen LERNE ÜBER EINEN LÄNGEREN ZEITRAUM Fange früh mit der Vorbereitung für Prüfungen an und nimm dir jeden Tag ein wenig Zeit. Fünf Stunden auf zwei Wochen verteilt sind besser als fünf Stunden
Prädiktoren schulischer Leistungen: Zwischen Diagnostik, Forschung und Praxis
 Projekttag des Instituts Spezielle Pädagogik und Psychologie (16.11.2013) Prädiktoren schulischer Leistungen: Zwischen Diagnostik, Forschung und Praxis Dr.phil. Janine Gut 1. Diagnostik Die Intelligence
Projekttag des Instituts Spezielle Pädagogik und Psychologie (16.11.2013) Prädiktoren schulischer Leistungen: Zwischen Diagnostik, Forschung und Praxis Dr.phil. Janine Gut 1. Diagnostik Die Intelligence
Soziale Integration durch Lehrerfeedback?! Empirische Befunde und ihre Bedeutung für die inklusive Schulentwicklung.
 Soziale Integration durch Lehrerfeedback?! Empirische Befunde und ihre Bedeutung für die inklusive Schulentwicklung. Universität Potsdam Prof. Dr. Professur für Inklusionspädagogik/ Förderung der emotional-sozialen
Soziale Integration durch Lehrerfeedback?! Empirische Befunde und ihre Bedeutung für die inklusive Schulentwicklung. Universität Potsdam Prof. Dr. Professur für Inklusionspädagogik/ Förderung der emotional-sozialen
Fachdidaktik Physik: Guter Physikunterricht
 Fachdidaktik Physik: 1.1.5. Guter Physikunterricht Hans-Otto Carmesin Gymnasium Athenaeum Stade, Studienseminar Stade Hans-Otto.Carmesin@t-online.de 4. April 2012 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Merkmale
Fachdidaktik Physik: 1.1.5. Guter Physikunterricht Hans-Otto Carmesin Gymnasium Athenaeum Stade, Studienseminar Stade Hans-Otto.Carmesin@t-online.de 4. April 2012 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Merkmale
Bildmaterialien und Multimedia
 Bildmaterialien und Multimedia Felix Kapp e-fit Workshop Lehren und Lernen mit digitalen Medien TU Dresden 03.-04.12.2009 Gliederung 1 Medium Bild 1.1 Bildarten 1.2 Bildfunktionen 1.3 Verstehen von Bildern
Bildmaterialien und Multimedia Felix Kapp e-fit Workshop Lehren und Lernen mit digitalen Medien TU Dresden 03.-04.12.2009 Gliederung 1 Medium Bild 1.1 Bildarten 1.2 Bildfunktionen 1.3 Verstehen von Bildern
PD Dr. Sonja Bieg: Vortragsverzeichnis 1
 PD Dr. Sonja Bieg: Vortragsverzeichnis 1 Vortragsverzeichnis Organisation von Arbeitsgruppen/Symposien Bieg, S. (2014). Arbeitsgruppe zum Thema: Unter der Lupe: Aktuelle Forschung zur Lernzielorientierung
PD Dr. Sonja Bieg: Vortragsverzeichnis 1 Vortragsverzeichnis Organisation von Arbeitsgruppen/Symposien Bieg, S. (2014). Arbeitsgruppe zum Thema: Unter der Lupe: Aktuelle Forschung zur Lernzielorientierung
Lernen mit Portfolio Chancen und Grenzen
 Lernen mit Portfolio Chancen und Grenzen Prof. Dr. Tina Hascher, Fachbereich Erziehungswissenschaft "eportfolio im:focus - Erwartungen, Strategien, Modellfälle, Erfahrungen, 09. Mai 2007 Gliederung 1.
Lernen mit Portfolio Chancen und Grenzen Prof. Dr. Tina Hascher, Fachbereich Erziehungswissenschaft "eportfolio im:focus - Erwartungen, Strategien, Modellfälle, Erfahrungen, 09. Mai 2007 Gliederung 1.
DIFFERENTIELLE BENOTUNGEN VON JUNGEN UND MÄDCHEN
 DIFFERENTIELLE BENOTUNGEN VON JUNGEN UND MÄDCHEN Der Einfluss der Einschätzungen von Lehrkräften zur Fähigkeit zum selbstgesteuerten Lernen Prof. Dr. Poldi Kuhl PROF. DR. POLDI KUHL» www.leuphana.de Ausgangspunkt
DIFFERENTIELLE BENOTUNGEN VON JUNGEN UND MÄDCHEN Der Einfluss der Einschätzungen von Lehrkräften zur Fähigkeit zum selbstgesteuerten Lernen Prof. Dr. Poldi Kuhl PROF. DR. POLDI KUHL» www.leuphana.de Ausgangspunkt
LITERATURLISTE ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE DIPLOMSTUDIENGANG Gültig für Prüfungen im Frühjahr und Herbst 2008
 LITERATURLISTE ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE DIPLOMSTUDIENGANG Gültig für Prüfungen im Frühjahr und Herbst 2008 Die folgende Liste für das Jahr 2008 weicht von der für 2007 substantiell ab. Falls sie eine Prüfung
LITERATURLISTE ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE DIPLOMSTUDIENGANG Gültig für Prüfungen im Frühjahr und Herbst 2008 Die folgende Liste für das Jahr 2008 weicht von der für 2007 substantiell ab. Falls sie eine Prüfung
Hinweise zu mündlichen Prüfungen im Staatsexamen (Prof Dr. Tobias Richter) Stand: Oktober 2012
 Prof Dr. Tobias Richter, Universität Kassel, Institut für Psychologie, Allgemeine Psychologie 1 Hinweise zu mündlichen Prüfungen im Staatsexamen (Prof Dr. Tobias Richter) Stand: Oktober 2012 Prüfungsmodalitäten
Prof Dr. Tobias Richter, Universität Kassel, Institut für Psychologie, Allgemeine Psychologie 1 Hinweise zu mündlichen Prüfungen im Staatsexamen (Prof Dr. Tobias Richter) Stand: Oktober 2012 Prüfungsmodalitäten
Kathrin Schack. Liebe zum gleichen Geschlecht Ein Thema für die Schule
 Kathrin Schack Liebe zum gleichen Geschlecht Ein Thema für die Schule Kathrin Schack Liebe zum gleichen Geschlecht Ein Thema für die Schule Aufklärungsarbeit gegen Homophobie Tectum Verlag Kathrin Schack
Kathrin Schack Liebe zum gleichen Geschlecht Ein Thema für die Schule Kathrin Schack Liebe zum gleichen Geschlecht Ein Thema für die Schule Aufklärungsarbeit gegen Homophobie Tectum Verlag Kathrin Schack
Allgemeine Prüfungsberatung Pädagogische Psychologie
 Allgemeine Prüfungsberatung Pädagogische Psychologie Webseiten der Sozialpsychologie und Pädagogischen Psychologie: http://www.ipa.tuberlin.de/menue/studium_und_lehre/pruefungen/ Prüfungstermin 1. August
Allgemeine Prüfungsberatung Pädagogische Psychologie Webseiten der Sozialpsychologie und Pädagogischen Psychologie: http://www.ipa.tuberlin.de/menue/studium_und_lehre/pruefungen/ Prüfungstermin 1. August
Wie kann das Lernverhalten begabter Schüler/innen während des regulären Unterrichts und der Hausaufgaben gefördert werden?
 Dr. Max Mustermann Referat Kommunikation & Marketing Verwaltung Wie kann das Lernverhalten begabter Schüler/innen während des regulären Unterrichts und der Hausaufgaben gefördert werden? Prof. Dr. Heidrun
Dr. Max Mustermann Referat Kommunikation & Marketing Verwaltung Wie kann das Lernverhalten begabter Schüler/innen während des regulären Unterrichts und der Hausaufgaben gefördert werden? Prof. Dr. Heidrun
Selbstwirksamkeit und individuelle Förderung. Präsentation nach einem Vortrag von Prof. Dr. Matthias Jerusalem am 10.6.
 Selbstwirksamkeit und individuelle Förderung Präsentation nach einem Vortrag von Prof. Dr. Matthias Jerusalem am 10.6.2010 in Münster 1 Das Konzept der Selbstwirksamkeit Motivation, Gefühle und Handlungen
Selbstwirksamkeit und individuelle Förderung Präsentation nach einem Vortrag von Prof. Dr. Matthias Jerusalem am 10.6.2010 in Münster 1 Das Konzept der Selbstwirksamkeit Motivation, Gefühle und Handlungen
Diversitätsgerecht Lehren und Lernen (inter-)nationale Perspektiven (Workshop I) Was ist Diversität und wo wird sie sichtbar?
 (Workshop I) Was ist Diversität und wo wird sie sichtbar? Folgen und Lösungsansätze am Praxisbeispiel der asiatischen Kultur Prof. Dr. Frank Linde und Dr. Wilma Viol Lemgo, 15. Mai 2014 FH AACHEN UNIVERSITY
(Workshop I) Was ist Diversität und wo wird sie sichtbar? Folgen und Lösungsansätze am Praxisbeispiel der asiatischen Kultur Prof. Dr. Frank Linde und Dr. Wilma Viol Lemgo, 15. Mai 2014 FH AACHEN UNIVERSITY
Emotionsarbeit und Emotionsregulation Zwei Seiten der selben Medaille?
 Emotionsarbeit und Emotionsregulation Zwei Seiten der selben Medaille? Christian von Scheve Institut für Soziologie, Universität Wien Die Soziologie der Emotionsarbeit Die Soziale Ordnung der Gefühle There
Emotionsarbeit und Emotionsregulation Zwei Seiten der selben Medaille? Christian von Scheve Institut für Soziologie, Universität Wien Die Soziologie der Emotionsarbeit Die Soziale Ordnung der Gefühle There
Maßnahmen zur Verbesserung der Lernmotivation in der Schule
 Maßnahmen zur Verbesserung der Lernmotivation in der Schule 1 Potsdamer Zentrum für empirische Inklusionsforschung (ZEIF), 2015, Nr. 3 Maßnahmen zur Verbesserung der Lernmotivation in der Schule Jannis
Maßnahmen zur Verbesserung der Lernmotivation in der Schule 1 Potsdamer Zentrum für empirische Inklusionsforschung (ZEIF), 2015, Nr. 3 Maßnahmen zur Verbesserung der Lernmotivation in der Schule Jannis
Die tun nix! Die wollen nur spielen Entwicklungspsychologie, Hirnforschung und jugendliches Verhalten
 !"#$%"&&&'(%!()#*$*+" #",%(*-.)*#) Die tun nix! Die wollen nur spielen Entwicklungspsychologie, Hirnforschung und jugendliches Verhalten Peter J. Uhlhaas Jahrestagung Offene Kinder- und Jugendarbeit Arbeitsgemeinschaft
!"#$%"&&&'(%!()#*$*+" #",%(*-.)*#) Die tun nix! Die wollen nur spielen Entwicklungspsychologie, Hirnforschung und jugendliches Verhalten Peter J. Uhlhaas Jahrestagung Offene Kinder- und Jugendarbeit Arbeitsgemeinschaft
CURRICULUM VITAE DR. DORIS HOLZBERGER
 CURRICULUM VITAE DR. DORIS HOLZBERGER PERSÖNLICHE INFORMATIONEN Wissenschaftliche Mitarbeiterin Friedl Schöller Stiftungslehrstuhl für Unterrichts- und Hochschulforschung, TUM School of Education, Technische
CURRICULUM VITAE DR. DORIS HOLZBERGER PERSÖNLICHE INFORMATIONEN Wissenschaftliche Mitarbeiterin Friedl Schöller Stiftungslehrstuhl für Unterrichts- und Hochschulforschung, TUM School of Education, Technische
Interessen von Jugendlichen Freunde, Sport und Konsolenspiele
 Interessen von Jugendlichen Freunde, Sport und Konsolenspiele Durch Zeit und Raum Familien leben in Hannover Familiensonntag der Stadt Hannover 19.10.2014 / Pavillon am Raschplatz Dr. Michael Lichtblau
Interessen von Jugendlichen Freunde, Sport und Konsolenspiele Durch Zeit und Raum Familien leben in Hannover Familiensonntag der Stadt Hannover 19.10.2014 / Pavillon am Raschplatz Dr. Michael Lichtblau
Emotionen und kognitives schulisches Lernen aus interdisziplinärer Perspektive
 Jutta Standop Emotionen und kognitives schulisches Lernen aus interdisziplinärer Perspektive Emotionspsychologische, neurobiologische und schulpädagogische Zusammenhänge - ihre Berücksichtigung im schulischen
Jutta Standop Emotionen und kognitives schulisches Lernen aus interdisziplinärer Perspektive Emotionspsychologische, neurobiologische und schulpädagogische Zusammenhänge - ihre Berücksichtigung im schulischen
Leistungsbewertungskonzept
 1. Allgemeine Grlagen zur Leistungsbewertung Für die Leistungsbewertung an unserer Schule legen wir zwei Ebenen zugre: die rechtlichen Grlagen die pädagogischen Grlagen des Landes Nordrhein- Westfahlen.
1. Allgemeine Grlagen zur Leistungsbewertung Für die Leistungsbewertung an unserer Schule legen wir zwei Ebenen zugre: die rechtlichen Grlagen die pädagogischen Grlagen des Landes Nordrhein- Westfahlen.
Sport und Erziehung: Qualitätsentwicklung im Schulsport
 Sport und Erziehung: Qualitätsentwicklung im Schulsport Vorlesung zum Themenbereich Sport und Erziehung (Modul 4.1 für RPO und GHPO) Fr 10 12 Uhr im Seminarraum des Sportzentrums 1 - Sommersemester 2006
Sport und Erziehung: Qualitätsentwicklung im Schulsport Vorlesung zum Themenbereich Sport und Erziehung (Modul 4.1 für RPO und GHPO) Fr 10 12 Uhr im Seminarraum des Sportzentrums 1 - Sommersemester 2006
Motivationale und Emotionale Aspekte der Psychologie interkulturellen Handelns
 Motivationale und Emotionale Aspekte der Psychologie interkulturellen Handelns Blockseminar: Interkulturelles Lernen und interkulturelle Kompetenz an der HHU 04.-05.05.2007 bei PD Dr. Petra Buchwald Referentin:
Motivationale und Emotionale Aspekte der Psychologie interkulturellen Handelns Blockseminar: Interkulturelles Lernen und interkulturelle Kompetenz an der HHU 04.-05.05.2007 bei PD Dr. Petra Buchwald Referentin:
Publikationsverzeichnis von Gabriele Steuer
 Publikationsverzeichnis von Gabriele Steuer Stand: Januar 2016 Artikel & Buchbeiträge: Steuer, G., Engelschalk, T., Jöstl, G., Roth, A., Wimmer, B., Schmitz, B., Schober, B., Spiel, S., Ziegler, A. & Dresel,
Publikationsverzeichnis von Gabriele Steuer Stand: Januar 2016 Artikel & Buchbeiträge: Steuer, G., Engelschalk, T., Jöstl, G., Roth, A., Wimmer, B., Schmitz, B., Schober, B., Spiel, S., Ziegler, A. & Dresel,
Hinweise zu mündlichen Prüfungen im Staatsexamen (Prof Dr. Tobias Richter) Stand: Juli 2011
 Prof Dr. Tobias Richter, Universität Kassel, Institut für Psychologie, Allgemeine Psychologie 1 Hinweise zu mündlichen Prüfungen im Staatsexamen (Prof Dr. Tobias Richter) Stand: Juli 2011 Prüfungsmodalitäten
Prof Dr. Tobias Richter, Universität Kassel, Institut für Psychologie, Allgemeine Psychologie 1 Hinweise zu mündlichen Prüfungen im Staatsexamen (Prof Dr. Tobias Richter) Stand: Juli 2011 Prüfungsmodalitäten
Selbstgesteuertes Lernen lehren:
 Dr. Dagmar Killus, Gertrud Graf Selbstgesteuertes Lernen lehren: Konzepte, empirische Befunde und Unterrichtsbeispiele 26. Pädagogische Woche (Oldenburg) 23. September 2009 Dagmar.killus@gmx.de Gliederung
Dr. Dagmar Killus, Gertrud Graf Selbstgesteuertes Lernen lehren: Konzepte, empirische Befunde und Unterrichtsbeispiele 26. Pädagogische Woche (Oldenburg) 23. September 2009 Dagmar.killus@gmx.de Gliederung
Anstand heisst Abstand
 Inhalt Die Beziehung macht s! Soziale Beziehungen und Effekte im Unterricht ein altersunabhängiges Phänomen?. Mai 07 Manfred Pfiffner, Prof. Dr. phil. habil. Die Beziehung macht s! Soziale Beziehungen
Inhalt Die Beziehung macht s! Soziale Beziehungen und Effekte im Unterricht ein altersunabhängiges Phänomen?. Mai 07 Manfred Pfiffner, Prof. Dr. phil. habil. Die Beziehung macht s! Soziale Beziehungen
Laura Gunkel. Akzeptanz und Wirkung. von Feedback in. Potenzialanalysen. Eine Untersuchung zur Auswahl. von Führungsnachwuchs.
 Laura Gunkel Akzeptanz und Wirkung von Feedback in Potenzialanalysen Eine Untersuchung zur Auswahl von Führungsnachwuchs 4^ Springer VS Inhalt Danksagung 5 Inhalt 7 Tabellenverzeichnis 11 Abbildungsverzeichnis
Laura Gunkel Akzeptanz und Wirkung von Feedback in Potenzialanalysen Eine Untersuchung zur Auswahl von Führungsnachwuchs 4^ Springer VS Inhalt Danksagung 5 Inhalt 7 Tabellenverzeichnis 11 Abbildungsverzeichnis
Konflikt und die adaptive Regulation kognitiver Kontrolle
 Konflikt und die adaptive Regulation kognitiver Kontrolle Zentrales Kontrollsystem Reiz- Verarbeitung Ziele Reiz- Verarbeitung Handlungsauswahl Reizinput Handlung Probleme der Idee einer zentralen Steuerinstanz
Konflikt und die adaptive Regulation kognitiver Kontrolle Zentrales Kontrollsystem Reiz- Verarbeitung Ziele Reiz- Verarbeitung Handlungsauswahl Reizinput Handlung Probleme der Idee einer zentralen Steuerinstanz
Führung und seelische Gesundheit als Schlüssel für Betriebliche Prävention
 Führung und seelische Gesundheit als Schlüssel für Betriebliche Prävention Labor für Organisationsentwicklung Universität Duisburg-Essen Universitätsstr. 2 45117 Essen Ansprechpartner: Julia Tomuschat
Führung und seelische Gesundheit als Schlüssel für Betriebliche Prävention Labor für Organisationsentwicklung Universität Duisburg-Essen Universitätsstr. 2 45117 Essen Ansprechpartner: Julia Tomuschat
erfahrungsbezogenen (kreative Fähigkeiten) Fähigkeiten und Sozial-Intrapersonale Sozial-interpersonale Sind unabhängig Naturalistische Existentielle
 Spearmann Generalfaktor g-faktor = allgemeine Intelligenz -> wirkt sich auf allgemeine Intelligenz aus s-faktoren = Spezifische Faktoren z.b. Verbale oder mathematische Probleme Annahme eines allgemeinen
Spearmann Generalfaktor g-faktor = allgemeine Intelligenz -> wirkt sich auf allgemeine Intelligenz aus s-faktoren = Spezifische Faktoren z.b. Verbale oder mathematische Probleme Annahme eines allgemeinen
Wissenschaftliche Ergebnisse zu wirksamen Unterricht Lernen sichtbar machen
 Wissenschaftliche Ergebnisse zu wirksamen Unterricht Lernen sichtbar machen Dieter Rüttimann, Prof. ZFH Dozent Institut Unterstrass Lehrer und Schulleiter GSU 10.06.2015 1 Fragestellung Reusser 2009 10.06.2015
Wissenschaftliche Ergebnisse zu wirksamen Unterricht Lernen sichtbar machen Dieter Rüttimann, Prof. ZFH Dozent Institut Unterstrass Lehrer und Schulleiter GSU 10.06.2015 1 Fragestellung Reusser 2009 10.06.2015
The promotion of perceived physical ability via an intervention using internal teacher frame of reference in physical education
 The promotion of perceived physical ability via an intervention using internal teacher frame of reference in physical education Esther Oswald Institut für Sportwissenschaft, Universität Bern SGS-Tagung,
The promotion of perceived physical ability via an intervention using internal teacher frame of reference in physical education Esther Oswald Institut für Sportwissenschaft, Universität Bern SGS-Tagung,
Entwicklung einer Lernumgebung für strukturierte akademische Diskussionen (SAC)
 PROJEKTARBEIT Entwicklung einer Lernumgebung für strukturierte akademische Diskussionen (SAC) Mona Metzner Marc Mühlbauer Betreuer: Sara Streng, Dr. Karsten Stegmann Verantw. Hochschullehrer: Prof. Dr.
PROJEKTARBEIT Entwicklung einer Lernumgebung für strukturierte akademische Diskussionen (SAC) Mona Metzner Marc Mühlbauer Betreuer: Sara Streng, Dr. Karsten Stegmann Verantw. Hochschullehrer: Prof. Dr.
Vorlesung Pädagogische Psychologie. Lernmotivation. Sommersemester Mo Uhr. Alexander Renkl
 Vorlesung Pädagogische Psychologie Lernmotivation Sommersemester 2013 Mo 16-18 Uhr Alexander Renkl Überblick 1 Begriffsbestimmung und Rahmenmodell 2 Personenmerkmale und Lernsituationsmerkmale 3 Aktuelle
Vorlesung Pädagogische Psychologie Lernmotivation Sommersemester 2013 Mo 16-18 Uhr Alexander Renkl Überblick 1 Begriffsbestimmung und Rahmenmodell 2 Personenmerkmale und Lernsituationsmerkmale 3 Aktuelle
Schüchternheit im kulturellen Kontext
 Psychologie in Erziehung und Unterricht 49. Jahrgang, Heft 2, 2002 Schüchternheit im kulturellen Kontext Eine vergleichende Studie zu Korrelaten von Schüchternheit bei Schulkindern in der Schweiz und in
Psychologie in Erziehung und Unterricht 49. Jahrgang, Heft 2, 2002 Schüchternheit im kulturellen Kontext Eine vergleichende Studie zu Korrelaten von Schüchternheit bei Schulkindern in der Schweiz und in
Was ist ein gutes Zeugnis?
 Renate Valtin zusammen mit Corinna Schmude, Heidrun Rosenfeld, Kerstin Darge, Gudula Ostrup, Oliver Thiel, Matthea Wagener und Christine Wagner Was ist ein gutes Zeugnis? Noten und verbale Beurteilungen
Renate Valtin zusammen mit Corinna Schmude, Heidrun Rosenfeld, Kerstin Darge, Gudula Ostrup, Oliver Thiel, Matthea Wagener und Christine Wagner Was ist ein gutes Zeugnis? Noten und verbale Beurteilungen
KURZBERICHT. Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin
 KURZBERICHT DIE EFFEKTE VON ANREIZEN AUF MOTIVATION UND LEISTUNGEN IN MATHEMATIKTESTS Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin Forschungsbereich
KURZBERICHT DIE EFFEKTE VON ANREIZEN AUF MOTIVATION UND LEISTUNGEN IN MATHEMATIKTESTS Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin Forschungsbereich
Literatur. Prof. Dr. Werner Sacher Prof. Dr. Werner Sacher
 Institut für Demoskopie Allensbach (2010): Aktuelle Fragen der Schulpolitik und das Bild der Lehrer in Deutschland. http://www.lehrerpreis.de/documents/81108_allensbach_web.pdf Köller, O.; Knigge, M.;
Institut für Demoskopie Allensbach (2010): Aktuelle Fragen der Schulpolitik und das Bild der Lehrer in Deutschland. http://www.lehrerpreis.de/documents/81108_allensbach_web.pdf Köller, O.; Knigge, M.;
EV 4.4 Aufgabenkultur
 Fakultät MN, Fachrichtung Psychologie, Professur für die Psychologie des Lehrens und Lernens EV 4.4 Aufgabenkultur Dresden, 08.06.2006 Lernen Bild: http://www.finanzkueche.de/aufgaben-der-schule/ TU Dresden,
Fakultät MN, Fachrichtung Psychologie, Professur für die Psychologie des Lehrens und Lernens EV 4.4 Aufgabenkultur Dresden, 08.06.2006 Lernen Bild: http://www.finanzkueche.de/aufgaben-der-schule/ TU Dresden,
Wenn Hänschen schon nicht wollte - Motivationale Aspekte der Weiterbildungsbeteiligung von bildungsfernen Adressaten
 Wenn Hänschen schon nicht wollte - Motivationale Aspekte der Weiterbildungsbeteiligung von bildungsfernen Adressaten Dr. Julia Gorges AE09 Pädagogische Psychologie Dr. Julia Gorges Berliner B-Tag 25. Juni
Wenn Hänschen schon nicht wollte - Motivationale Aspekte der Weiterbildungsbeteiligung von bildungsfernen Adressaten Dr. Julia Gorges AE09 Pädagogische Psychologie Dr. Julia Gorges Berliner B-Tag 25. Juni
Klaus Oberleiter (Autor) Hausaufgaben in der Grundschule Die Bedeutung zeitlicher Aspekte und Auswirkungen eines selbstregulatorischen Trainings
 Klaus Oberleiter (Autor) Hausaufgaben in der Grundschule Die Bedeutung zeitlicher Aspekte und Auswirkungen eines selbstregulatorischen Trainings https://cuvillier.de/de/shop/publications/2115 Copyright:
Klaus Oberleiter (Autor) Hausaufgaben in der Grundschule Die Bedeutung zeitlicher Aspekte und Auswirkungen eines selbstregulatorischen Trainings https://cuvillier.de/de/shop/publications/2115 Copyright:
Tutorium zur Vorlesung Differentielle Psychologie
 Tutorium zur Vorlesung Differentielle Psychologie Heutiges Thema: Das Selbst Larissa Fuchs Das Selbst 1. Wiederholung Ängstlichkeit & Aggressivität 2. Selbstkonzept & Selbstwertgefühl 3. Soziales Selbstkonzept,
Tutorium zur Vorlesung Differentielle Psychologie Heutiges Thema: Das Selbst Larissa Fuchs Das Selbst 1. Wiederholung Ängstlichkeit & Aggressivität 2. Selbstkonzept & Selbstwertgefühl 3. Soziales Selbstkonzept,
Lernstrategien und selbstreguliertes Lernen im regulären Unterricht
 Lernstrategien und selbstreguliertes Lernen im regulären Unterricht Prof. Dr. Heidrun Stöger Lehrstuhl für Schulpädagogik Fakultät für Psychologie, Pädagogik und Sportwissenschaft Gliederung 1) Lernstrategien:
Lernstrategien und selbstreguliertes Lernen im regulären Unterricht Prof. Dr. Heidrun Stöger Lehrstuhl für Schulpädagogik Fakultät für Psychologie, Pädagogik und Sportwissenschaft Gliederung 1) Lernstrategien:
UMGANG MIT KRISEN & NEGATIVER KRITIK
 UMGANG MIT KRISEN & NEGATIVER KRITIK SEMINARREIHE RESILIENZ Krise? Einblicke in die Psychologie Umgang mit negativer Berichterstattung - psychologische Komponente Krisen sind Stress Öffentliche Kritik
UMGANG MIT KRISEN & NEGATIVER KRITIK SEMINARREIHE RESILIENZ Krise? Einblicke in die Psychologie Umgang mit negativer Berichterstattung - psychologische Komponente Krisen sind Stress Öffentliche Kritik
