Strukturaufklärung organischer Moleküle mit NMR-spektroskopischen Methoden
|
|
|
- Harald Siegel
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Fakultät für hemie und Pharmazie Universität Regensburg Strukturaufklärung organischer Moleküle mit MR-spektroskopischen Methoden Vorlesung für das 7. Semester im WS 0304 Prof. Armin Geyer
2 Inhalt In den Kapiteln -7 geht es um die Zuordnung von Spinsystemen. In den Kapitel 8 und 9 steht die Raumstruktur und Dynamik des Moleküls im Mittelpunkt.. Informationsgehalt des MR-Spektrums Logische Verknüpfungsmuster und empirische Korrelationen 2. Strukturaufklärung mit SY-Spektren 2D-Spektroskopie als Verknüpfungsmatrix SY 3. Strukturaufklärung mit -Korrelationen MQ und long-range Korrelationen (MB) 4. Physikalische Grundlagen der Pulsspektroskopie Prinzip der magnetischen Reonanz, Bloch sches Vektormodell, rotierendes Koordiantensystem, Relaxation, Spin-Echo, Inversion Recovery 5. Zustandekommen des 2D-Spektrums Digitalisierung Vom 3 -MR zur invers detektierten -Korrelationen Polarisationstransfer, DEPT, IEPT, Zustandekommen von 2D - Korrelationenen 8. Dynamische MR-Spektroskopie Zeitskalen der Bewegung, Mittelung von MR-Daten. hemischer und konformationeller Austausch, Titration: Komplexierung, Lignad- Rezeptor-Wechselwirkungen 9. E-Spektroskopie ESY, RESY, Spindiffusion Wasserstoffbrücken Seite Ein paar wichtige Bemerkungen vorab: Übungen unter zum Runterladen. Das selbstständige Ausarbeiten von Lösungen ist die beste Kontrolle, ob man den Vorlesungsstoff verstanden hat. Die richtigen Lösungen werden in der Vorlesung vorgestellt. Die Übungen dienen der Klausurvorbereitung. Dieses Skript soll kein Ersatz für den Besuch der Vorlesung oder dem Studium eines Lehrbuches sein. Es ist nur eine knappe Übersicht über die behandelten Themengebiete. Als modernes Lehrbuch parallel zur Vorlesung empfiehlt sich: T. D. W. laridge igh-resolution MR techniques in rganic hemistry, Pergamon Press 999. Wenig moderne Methoden aber schöne Molekülbeispiele, dynamische MR-Spektroskopie finden sich in:. Günther, MR Spektroskopie (Thieme 992). Viele Methoden, leider wenig erklärt: S. Braun, S. Berger,. Kalinowski, 50 and more basic MR experiments V 998. nline: MR-GUIDE der Firma Bruker: Weiterführende Literatur: Protein MR: J.. S. Evans, Biomolecular MR Spektroskopie, xfort Uni Press 995 Vorwissen, Grundlagen Vorlesung 3. Semester Spektroskopie in der. -MR, 3 -MR, chemische Verschiebung, Integrale, chemische bzw. magnetische Äquvalenz, Spinsysteme höherer rdnung. Zur Wiederholung: M. esse, Meier, B. Zeeh, Spektroskopische Methoden in der organischen hemie, Thieme Inhalt der Vorlesung Im Rahmen dieser Vorlesung geht es um die harakterisierung organischer Molekülgerüste. Das heisst Verknüpfung, Substituenten, hiralität, Dynamik und Wechselwirkungen. Im Rahmen dieser Vorlesung werden nur diskrete Moleküle im gelösten Zustand betrachtet. icht behandelt werden können paramagnetische Kerne, Festkörper-MR etc. Abgrenzung zu Lehrverantaltungen der Analytischen hemie: Dort geht es um den achweis oder die Bestimmung der Konzentration bzw. der Verteilung organischer Moleküle in einer komplexen Matrix (Sensorik). Abgrenzung zu Lehrverantaltungen der Physikalischen hemie: Dort geht es um die Prinzipien der Wechselwirkung elektromagnetischer Strahlung mit Materie. äufige Abkürzungen = chemische Verschiebung, = hemische Verschiebungsdifferenz zweier Signale, I = Integral, J = Spin-Spin-Kopplung, 2 J, = 3 - -Kopplung über zwei Bindungen, M = Multiplizität, E = uclear verhauser Effect, c = Korrelationszeit Fehlt noch: 0. Magnetische Feldgradienten, Diffusion, DSY Gedankt sei allen, die durch ihre Moleküle bzw. ihre MR-Fragestellungen zum Inhalt dieses Skripts beigetragen haben. Insbesondere Frau ikola Kastner- Pustet für das Schreiben und die Ausarbeitung vieler Beispiele. Geyer, MR-Spektroskopie
3 MR-spektroskopische Strukturaufklärung in der. Informationsgehalt des MR-Spektrums, Verknüpfungsmatrix IR, Raman, UV, MR-Spektroskopie, Kristallstrukturanalyse, etc..., zahlreiche Methoden stehen uns heute für die Strukturaufklärung unbekannter neuer Moleküle zur Verfügung. Darunter gibt keine beste Methode, es kommt immer nur auf die Fragestellung an, die man (frau oder student) beantworten will. Ein paar wichtige Punkte vorab, die die MR- Spektroskopie ganz grundsätzlich von anderen Methoden unterscheidet. Im MR-Spektrum kann jedem Resonanzsignal genau ein Atom zugeordnet werden (bzw. chemisch äquivalente Atome). Das ist ein enormer Vorteil bei der Aufklärung von -Gerüsten, da man die Resonanzlinien abzählen kann. In der IR- bzw. UV- Spektroskopie gibt es keinen vergleichbaren einfachen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Atome und der Anzahl der Linien im Spektrum. Bei sehr großen Molekülen beobachtet man jedoch sehr viele Linien im MR-Spektrum und der Vorteil kehrt sich ins Gegenteil um. Zahlreiche Resonanzlinien sind überlagert und können nicht mehr separiert (aufgelöst) werden. Da kommt uns die zweite Besonderheit der MR zu ilfe, nämlich die Langlebigkeit der angeregten Zustände. Sie erlaubt uns die Beobachtung von Kernpaaren (zweidimensionale Spektroskopie). Ein solches Paar kann beispielsweise aus einem und dem daran gebundenem bestehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zufällig gleiche Frequenzpaare gibt, ist gering. Erst bei Proteinen muss man auf die dreidimensionale Spektroskopie erweitern, die "Frequenztrios" verknüpft. In dieser Tabelle nimmt nach unten die Qualität der Information von oben nach unten zu. Gleichzeitig spiegelt sie auch die historische Entwicklung des Molekülbegriffs wieder. Strukturaufklärung MR Parameter Elementaranalyse Kernisotop ur ½-Spin-Kerne:, 3, 3 P, 5, 9 F Summenformel Integral Jedes Atom erscheint genau einmal Funktionelle Gruppen Ringstrom etc. Konstitution J Atomverknüpfungen, Spinsysteme Stereostruktur Karplus etc. Topizität Konformation E Globales Minimum Dynamik Relaxation von Picosekunden bis Echtzeitmessung Wechselwirkung Titration Komplexierung Funktion Protein-MR regelbare Mehrkomponentensysteme Möglichkeit : -MR als Fingerabdruck. Identifizierung des Moleküls durch Vergleich mit Spektrenkatalog, Das funktioniert aber nur für bereits bekannte Moleküle. Möglichkeit 2: Mit Zusatzinformationen (Masse, -Analyse) zur eindeutigen Strukturaufklärung, Strukturbeweis, d. h. zu diesem Spektrum kann nur eine Molekülstruktur passen und umgekehrt..) Signallage hemische Verschiebung in ppm 2.) Relative Signalintensität (Integral) : 2 : 3 : 2 : 3 3.) Multiplizität: J-Kopplung 2 J, geminal X 3 3 J, vicinal J, heteronuclear Jedes Atom erscheint genau einmal imspektrum mit festgelegter Signalintensität und informiert über die benachbarten Atome. Geyer, MR-Spektroskopie 2 Geyer, MR-Spektroskopie 3
4 3 Ein Spinsystem besteht aus einer Gruppe von Kernen, die miteinander Koppeln. Das gezeigte Dipeptid besteht aus drei Protonenspinsystemen Probleme: - Spinsysteme höherer rdnung J AB > AB - Molekülsymmetrie gleiche / ungleiche Gruppen - Dynamische Prozesse zeitliche Mitteilung von MR-Parametern Rotation um Einfachbindungen chemischer Austausch etc. chemische Äquivalenz Isochrone Kerne mit unterschiedlicher J-Kopplung zu achbarkernen F AA'XX' F Zuordnungsstrategie Ein einfaches Beispiel: Diisopropylether magnetische Äquivalenz isochrone Kerne mit gleicher Spin-Spin-Wechselwirkung zu achbarkernen F F A 2 X 2 arte Information Logisches Verknüpfungsmuster, Ja/ein-Entscheidungen - Intensität : 6 - Multiplizität Septett 6 gleiche achbarn Weiche Information Empirische Zusammenhänge, Vergleich mit anderen Spektren ca. ppm Alkyl im -MR Je komplexer das Molekül, desto wichtiger wird die harte Information. Empirische Daten sind fehleranfällig Wenn 00 Resonanzsignale mit jeweils 99%iger Sicherheit zugeordnet werden, dann ist die Zuordnung mit 65%iger Wahrscheinlichkeit falsch. Wir wollen eine sichere Strategie der Signalzuordnung entwickeln. Diese muss auf möglichst wenig empirischer Korrelation und auf maximal viel harter Verknüpfungsinformation beruhen. Wir stellen Moleküle gewöhnlich durch über Bindungsstriche verknüpfte Atome dar. Man kann jedoch auch die Atomnummern in einer Kolonne (senkrecht) und daneben nochmal in einer Reihe (waagrecht) anordnen, um dann die Atombindungen in den jeweiligen Matrixelementen einzutragen. Genauso funktioniert die Datenbankrecherche über den omputer. Die aufgezeichnete Struktur wird in eine Verknüpfungsmatrix zerlegt und mit gespeicherten Matrizen verglichen. Eine Teilmatrix wird erstellt, wenn einige Substituenten nicht festgelegt sind. (ier z. B. Rest R) Aufgabe: Aufstellen der Verknüpfungsmatrix der aller Protonen, die über zwei oder drei Bindungen voneinander getrennt sind. Es soll nur die Abfolge der festgelegt werden. (X = Verknüpfung, leer = mehr als 3 Bindungen voneinander entfernt.) X X 6 X X D D 5 X X X 4 X X R 3 X X 2 X [ppm] 3.6. Int. 6 M Septett Dublett Die moderne MR gibt uns viele Möglichkeiten nicht nur Signale zu zählen, sondern Korrelationen (Verknüpfungen) zwischen Atomen aufzustellen. Geyer, MR-Spektroskopie 4 Die Diagonalelemente verlaufen von rechts oben nach links unten, also gespiegelt zur Matrix, wie sie uns aus der Mathematik vertraut ist (l. o. nach r. u.) Toll wäre eine experimentelle Methode, die uns von einem unbekannten Molekül eine derartige Informationsmatrix liefert. Unbekanntes Molekül Spektroskop. Experiment Verknüpfungsmatrix Gibt es dieses Messung? Ja! Geyer, MR-Spektroskopie 5
5 2. SY orrelated Spectroscopy Die Projektion entspricht dem D-Spektrum. SY-Spektren sind symmetrisch bezüglich der Diagonale. Diagonalsignale haben in beiden Dimensionen die gleiche chemische Verschiebung. Kreuzsignale haben unterschiedliche. Diese sind die Verknüpfungen auf denen die Zuordnung der Spinsysteme basiert. Technische Voraussetzung war die Entwicklung der Fouriertransform MR Puls-Spektroskopie (obelpreis R.R. Ernst, 99) A B F2 Schematische Darstellung: F: Senkrechte sog. Indirekte Dimension K AB D BB B F F2: Aquisitionsdimension D AA K AB A schematische Darstellung SY-Spektrum zum obigen Beispiel: Strategie der Signalzuordnung am Beispiel von sec. Butanol Die häufigste Problemstellung sieht so aus. Man hat einen Strukturvorschlag und die Verknüpfungsmatrix der SY-Messung. Gesucht sind die Diagonalelemente,2,3,4,5 Dabei ist nicht zu erwarten, dass die umerierung der Struktur der Abfolge der Signale im Spektrum entspricht. Diagonale Strukturvorschlag Vorgehensweise: Experiment: X 4 X X 3 X X 2 X X 5 X 2-Butanol ist ein verzweigtes Spinsystem, die Verzeigung (2) wird im SY identifiziert. 2 hat drei Kopplungspartner, daher muss es eine Spalte (Reihe) der Matrix geben, die drei Kreuzsignle hat. Damit ist 2 eindeutig zugeordnet. Zwei der drei Kreuzsignale verknüpfen 2 mit Endpunkten des Spinsystems ( und 5). Deren Unterscheidung gelingt über die Signalhöhen (Integrale) im MR. Das dritte Kreuzsignal verknüpft 2 über 3 nach 4. Geyer, MR-Spektroskopie 6 Geyer, MR-Spektroskopie 7
6 Strategie der Signalzuordnung im SY.) Bevorzugt beginnt man am Ende eines Spinsystems und folgt den Verknüpfungen bis zur nächsten Verzeigung. 2.) / / 3 Diag Kreuz Diag Kreuz etc. 3.) Vorsicht bei kleinen J, Kopplungs- konstanten. Diese zeigen nur sehr schwache Kreuzsignale im SY Vorsicht vor Artefakten (Geistersignalen) im 2D Spektrum. Diese sind in der Regel nicht symmetrisch zur Diagonale Meist wird die sog. phasensensitive Darstellung verwendet: Der Vorzeichenwechsel in der Mitte des Kreuzsignals erlaubt die präzise Bestimmung der Signallage. atürlich kann man das -MR von sec. Butanol oder der Zuckeraminosäure auch ohne SY zuordnen. Unerlässlich wird das SY aber, wenn im Molekül zweimal das selbe Spinsystem vorhanden ist. Die beiden Spinsysteme können eindeutig unterschieden werden. Beispiel: In MeD sind alle X-Protonen (X =,) gegen D ausgetauscht. Im 2D-Spektrum ist eine sichere Sequenzierung der beiden Spinsysteme möglich. Solche wiederkehrenden Spinsysteme finden sich oft bei Biopolymeren wie DA, Zuckern, Peptiden. Welche anderen Verknüpfungsmatrizen kann man messen? 3. --Korrelationen Waagrecht Protonen: Zuordnung bekannt aus SY X X 3 X 2 X Senkrecht Kohlenstoffe: 5 x 4 unsymmetrische Matrix ohne Diagonale zweidimensionale Korrelation über die heteronukleare Einfachbindungskopplung: J. Auch das Fehlen einer Korrelation ist Information. Signal 5 im -MR muß X sein (X ). Es gibt prinzipielle Unterschiede zwischen homonuklearen und heteronuklearen Verknüpfungsmatrizen: 400 Mz 400 Mz D z. B. 2 R 400 Mz n J, Diagonale 3 00 Mz n J, keine Diagonale D omonuclear eteronuclear D D D 3 Das MQ enthält viele strukturell wichtige Informationen und ist daher für unbekannte Moleküle in der Regel das erste 2D-Spektrum, das man zur and nimmt. Als erstes wird zusammen mit den Integralen aus dem -MR bilanziert, ob alle n und X (X = eteroatom) da sind. z.b.: Glucitolderivat 6 3 -Gruppen: Jeweils Integral, kein Kreuzsignal im MQ 4 - Gruppen: Jeweils Integral, Boc 3 Kreuzsignal im MQ 3 2 diastereotope 2 -Gruppen: Jeweils zweimal Integral, zwei Kreuzsignale im MQ zur selben 3 -Verschiebung 3 3 -Gruppen: Jeweils Integral 3, Kreuzsignal im MQ tert.butyl-gruppe: Integral 9, Kreuzsignal im MQ Abwesend sind auch alle, die keine tragen (, q etc.) Geyer, MR-Spektroskopie 8 Geyer, MR-Spektroskopie 9
7 Auch gelingt über das MQ die Identifizierung funktioneller Gruppen anhand ihrer charakteristischen Kohlenstoffverschiebungen, z. B. Zucker. Acetal: ~ 00 ppm ( 3 ) / 5 ppm ( ) sek. Alkohol: ~ 70 ppm ( 3 ) / 4 ppm ( ) klare Trennung keine eindeutige Unterscheidung im -MR Übersicht: Die vier wichtigsten 2D MR-Methoden SY: orrelation Spectroscopy n J, 3 J, Voraussetzung ist die über 2 oder 3 (Ausnahme 4) Bindungen vermittelte skalare Kopplung (J-Kopplung) zwischen 2 Protonen Verwendete Technik: DQF-SY (DQF = double-quantum filtered) z.b.: Teilentschütztes Galactosederivat -Korrelationen n J, J, Direkte -Korrelation. Kreuzsignale identifizieren x -Gruppen Verwendete Technik: MQ SQ single eteronuclear multiple quantum coherence 2,3 J, Long-range -Korrelation Kreuzsignale zwischen und, die über 2 oder 3 Bindungen getrennt sind Verwendete Technik MB (eteronuclear multi-bond correlation) 2D E-Spektroskopie < 4 Å Korrelation durch den Raum Verwendete Technik: ESY (uclear verhauser effect spectroscopy) RESY (Rotating frame ESY) Geyer, MR-Spektroskopie 0 Geyer, MR-Spektroskopie
8 Direkte -Korrelation Messtechnik: MQ Long-range -Korrelation Messtechnik: heteronuclear multi-bond correlation MB Das MB liefert komplementäre Informationen zu den aus homonoklearen Spektren zugänglichen Strukturinformationen. Beispiel Galactose: Im DQF-SY muss man entlang der umerierung das Spinsystem aufklären. Im MB sieht man über den Ringsauerstoff hinweg. 3 J 3 3 2,3 J Galactose 2 DQF-SY ,6' 3 J Abkürzung im MB z.b heterocyclische Ringe: SY Mes ! Das MB erlangt seine Bedeutung bei der Verknüpfung von Spinsystemen! z. B. Zucker: Man sieht die Kopplung über den glycosidischen Sauerstoff hinweg in das nächste Spinsystem hinein. Maximal über drei Bindungen. Spinsystem Spinsystem 2 Bis zu 5 Kreuzsignale! Geyer, MR-Spektroskopie 2 Geyer, MR-Spektroskopie 3
9 z.b Schutzgruppen: z.b Peptide: 3 ca. 72 ppm ( 3 ) ca. 70 ppm ( 3 ) 3 Jedes sieht die beiden zweier benachbarter Aminosäuren Sequenzierung von Proteinen / Peptiden 3 Spinsystem Spinsystem Acetonid q bei ca. 00 ppm ( 3 ) Im MQ macht man eine ganz ähnliche Entkopplung, was das Dublett des 3 Spinsystems (die beiden Satelliten) auf die Position der im MQ nicht sichtbaren 2 - gebundenen Protonen zusammenfallen läßt. 3 3 BB-Entkopplung Das heteronukleare 3 Spinsystem hat große Analogie zu dem Spinsystem zweier koppelnder Protonen (homonuklear). omonuklear: J = 0 z J = 0 z 3 Grundlage aller Kohlenstoffmessungen ist das zu einem Prozent vorhandene Isotop 3 (99% 2 haben keinen Kernspin, MR-blind). -MR: 3 -MR: Spin Spin 2 0,5% 99% - 2 Satelliten: - 3 0,5% Die 3 -Signale haben nur /64 der Signalintensität der Satelliten im -MR! eteronuklear: J = 50 z J = 50 z 50 z J 50 z Spin Spin 2 -MR: -entkoppeltes 3 -MR: -Breitbandentkopplung Singulett! Es gibt Fälle, in denen es Sinn macht, die J -Kopplungen zu messen. So besteht ein guter (empirischer) Zusammenhang zwischen der Größe der anomeren -Kopplung und der anomeren Konfiguration der Mannose. Dies ist die sicherste Methode der Konfigurationsanalyse bei Mannosiden! Im eindimensionalen 3 -MR-Spektrum beobachtet man ein Multiplett mit der selben Kopplung, die die Satelliten im -MR zeigen. Dieses wird aber in der Regel durch die sog. Breitbandentkopplung (eine schnelle Abfolge von Radiofrequenzpulsen ) im - Kanal zum Singulett entkoppelt. Geyer, MR-Spektroskopie 4 Geyer, MR-Spektroskopie 5
10 Im Unterschied zu D-Spektren, wo schwache Signale langsam im Rauschen verschwinden, bzw. schwache Kopplungen graduell nicht mehr aufgelöst werden können, gibt es bei MB-Spektren einen "Schwellenwert" oberhalb dessen Signale "plötzlich" im Spektrum erscheinen. Das hängt mit der elektronischen Prozessierung dieses 2D-Spektrums zusammen. Signal / Rauschen = S / oise Je größer S / desto eindeutigere Signale Im -MR: gradueller Übergang S ~ z Kopplungen im bereich von einem z werden zwar nicht mehr aufgelöst, sie können aber trotzdem zu einem Kruezsignal im DQF-SY führen. Diese Entkopplung ist im MB nicht durchführbar Restsignale. Im 2D-Spektrum führt die Kontourliniendarstellung zum plötzlichen Verschwinden schwacher Kreuzsignale. 3 Ja ein Die Klammer kennzeichnet die J -Korrelation im MB Der Grund dafür ist die elektronische Digitalisierung der Spektren. 3 -MR: 2 6 (65536) Datenpunkte -MR: 2 4 (6384) Datenpunkte Die Intensität des Kreuzsignals im MB ist von der Stärke der long-range-kopplung abhängig ( 2-3 J -0 z ). 2D: 2 0 oder 2 (2048) Datenpunkte in der direkten (waagrechten) Dimension 2D: 2 8 oder 2 9 (52) Datenpunkte in der indirekten (senkrechten) Dimension Beispiele: J klein, - 3 z J groß, ~ 9 z J klein, - 3 z J groß, 0 z 2048 = TD 256 oder 52 schlechtere digitale Auflösung in der senkrechten Dimension: Mehrere z Signale im 2D sind in Richtung der schlechteren digitalen Auflösung verzerrt. Geyer, MR-Spektroskopie 6 Geyer, MR-Spektroskopie 7
11 Unterscheidung zweier tetrasubstituierter Benzole als Beispiele für "-arme" -Gerüste: von Die vier geschweiften Klammern kennzeichnen die Positionen im 2D-Spektrum, an denen man die direkte -Korrelation (MQ) erwarten würde. Dort erscheint im MB das Doublett der 3 -Satelliten. Warum? Das führt uns zu einer viel elementareren Frage: Warum sieht man überhaupt ein Kreuzsignal im 2D, wenn doch das Signal im -MR nur durch die an das Isotop 2 gebundene Proton zustande kommt? Geyer, MR-Spektroskopie 8 Geyer, MR-Spektroskopie 9
NMR-Spektroskopie: Struktur und Dynamik organischer Moleküle
 Fachbereich hemie Philipps-Universität Marburg NMR-Spektroskopie: Struktur und Dynamik organischer Moleküle September 2004 Prof. Armin Geyer NMR-Spektroskopie: Struktur und Dynamik organischer Moleküle
Fachbereich hemie Philipps-Universität Marburg NMR-Spektroskopie: Struktur und Dynamik organischer Moleküle September 2004 Prof. Armin Geyer NMR-Spektroskopie: Struktur und Dynamik organischer Moleküle
Einführung in die NMR-Spektroskopie. NMR-Spektroskopie. Teil 1: Einführung und Grundlagen der 1 H NMR. Das NMR Spektrometer
 NMR-Spektroskopie Einführung in die NMR-Spektroskopie m I = - /2 (β) Teil : Einführung und Grundlagen der NMR E E. Physikalische und apparative Grundlagen m I = + /2 (α).2 Das D NMR Experiment.3 Die chemische
NMR-Spektroskopie Einführung in die NMR-Spektroskopie m I = - /2 (β) Teil : Einführung und Grundlagen der NMR E E. Physikalische und apparative Grundlagen m I = + /2 (α).2 Das D NMR Experiment.3 Die chemische
AB-Spinsystem (1) - Ein Spektrenbeispiel
 AB-Spinsystem () - Ein Spektrenbeispiel (A) (B) l N N 60 Mz- -NMR-Spektrum von -hlor-6-ethoxy-pyridazin in l mit Integration; die aromatischen Protonen bilden ein AB-System (aus: orst Friebolin, Ein- und
AB-Spinsystem () - Ein Spektrenbeispiel (A) (B) l N N 60 Mz- -NMR-Spektrum von -hlor-6-ethoxy-pyridazin in l mit Integration; die aromatischen Protonen bilden ein AB-System (aus: orst Friebolin, Ein- und
AQ -1 = 1.2 Hz digitale Auflösung pro 1.2 Hz ein Datenpunkt
 6. Datenaufnahme mit dem FT-Spektrometer: Digitalisierung Anregung Detektion Auswertung RF-Pulse/ Delays Digitalisierung des im AD-Wandler Fouriertransformation, Fensterfunktion, Apodisierung... Der Analog-Digital-onverter
6. Datenaufnahme mit dem FT-Spektrometer: Digitalisierung Anregung Detektion Auswertung RF-Pulse/ Delays Digitalisierung des im AD-Wandler Fouriertransformation, Fensterfunktion, Apodisierung... Der Analog-Digital-onverter
NMR-Spektroskopie Teil 2
 BC 3.4 : Analytische Chemie I NMR Teil 2 NMR-Spektroskopie Teil 2 Stefanie Wolfram Stefanie.Wolfram.1@uni-jena.de Raum 228, TO Vom Spektrum zur Struktur 50000 40000 Peaks u. Integrale 30000 Chemische Verschiebung
BC 3.4 : Analytische Chemie I NMR Teil 2 NMR-Spektroskopie Teil 2 Stefanie Wolfram Stefanie.Wolfram.1@uni-jena.de Raum 228, TO Vom Spektrum zur Struktur 50000 40000 Peaks u. Integrale 30000 Chemische Verschiebung
Kombinierte Übungen zur Spektroskopie Beispiele für die Bearbeitung
 Im folgenden soll gezeigt werden, daß es großen Spaß macht, spektroskopische Probleme zu lösen. Es gibt kein automatisches Lösungsschema, sondern höchstens Strategien, wie beim "Puzzle Lösen"; häufig hilft
Im folgenden soll gezeigt werden, daß es großen Spaß macht, spektroskopische Probleme zu lösen. Es gibt kein automatisches Lösungsschema, sondern höchstens Strategien, wie beim "Puzzle Lösen"; häufig hilft
Teil 2: Spin-Spin Kopplung
 NMR-Spektroskopie Teil 2: Spin-Spin Kopplung 1. Die skalare Spin-Spin Kopplung 2. Multiplizitaet und Intensitaetsverteilung 3. Geminale, vicinale und allylische Kopplungskonstanten 4. Anschauliche Beschreibung
NMR-Spektroskopie Teil 2: Spin-Spin Kopplung 1. Die skalare Spin-Spin Kopplung 2. Multiplizitaet und Intensitaetsverteilung 3. Geminale, vicinale und allylische Kopplungskonstanten 4. Anschauliche Beschreibung
Strukturaufklärung in der Organischen Chemie
 Teil : Grundlagen. Apparatives Strukturaufklärung in der rganischen hemie NMR-Spektroskopie. Grundlagen - - Das in Abb. dargestellte -NMR-Spektrum von Mesitylen in D 3 wurde an einem 60 Mz NMR Gerät aufgenommen.
Teil : Grundlagen. Apparatives Strukturaufklärung in der rganischen hemie NMR-Spektroskopie. Grundlagen - - Das in Abb. dargestellte -NMR-Spektrum von Mesitylen in D 3 wurde an einem 60 Mz NMR Gerät aufgenommen.
III. Strukturbestimmung organischer Moleküle
 III. Strukturbestimmung organischer Moleküle Röntgenstrukturbestimmung g Spektroskopie UV-VIS IR NMR Massenspektrometrie (MS) Röntgenstruktur eines bakteriellen Kohlenhydrats O O O O O O O C3 Röntgenstruktur
III. Strukturbestimmung organischer Moleküle Röntgenstrukturbestimmung g Spektroskopie UV-VIS IR NMR Massenspektrometrie (MS) Röntgenstruktur eines bakteriellen Kohlenhydrats O O O O O O O C3 Röntgenstruktur
Protokoll. Kombinierte Anwendung verschiedener Spektroskopischer Methoden
 Protokoll Kombinierte Anwendung verschiedener Spektroskopischer Methoden Zielstellung: Durch die Auswertung von IR-, Raman-, MR-, UV-VIS- und Massenspektren soll die Struktur einer unbekannten Substanz
Protokoll Kombinierte Anwendung verschiedener Spektroskopischer Methoden Zielstellung: Durch die Auswertung von IR-, Raman-, MR-, UV-VIS- und Massenspektren soll die Struktur einer unbekannten Substanz
Vorlesung Mehrdimensionale NMR-Spektroskopie- Grundlagen und Anwendungen in der Strukturaufklärung Teil VIII. Peter Schmieder AG NMR
 Vorlesung Mehrdimensionale NMR-Spektroskopie- Grundlagen und Anwendungen in der Strukturaufklärung Teil VIII Das Programm 2/100 Beim letztes Mal Heteronukleare NMR an Peptiden Das Programm /100 Heute Methoden
Vorlesung Mehrdimensionale NMR-Spektroskopie- Grundlagen und Anwendungen in der Strukturaufklärung Teil VIII Das Programm 2/100 Beim letztes Mal Heteronukleare NMR an Peptiden Das Programm /100 Heute Methoden
Einführung in die NMR-Spektroskopie im Rahmen des Praktikums OC-II
 Einführung in die NMR-Spektroskopie im Rahmen des Praktikums O-II Till Opatz Kerne im statischen Magnetfeld Zeeman-Aufspaltung -1-3/2 Energie -1/2 +1/2 0 +1-1/2 +1/2-3/2 I = 1/2 I = 1 I = 3/2 Insgesamt
Einführung in die NMR-Spektroskopie im Rahmen des Praktikums O-II Till Opatz Kerne im statischen Magnetfeld Zeeman-Aufspaltung -1-3/2 Energie -1/2 +1/2 0 +1-1/2 +1/2-3/2 I = 1/2 I = 1 I = 3/2 Insgesamt
1 1 H-NMR-Spektroskopie in metallorganischen Komplexen. 1.1 Allgemeines. 1.2 Chiralität in Metallkomplexen 1.3 Dynamische Prozesse
 1 1 H-NMR-Spektroskopie in metallorganischen Komplexen 1.1 Allgemeines Chemische Verschiebungen Beispiele für einfache Komplexe 1.2 Chiralität in Metallkomplexen 1.3 Dynamische Prozesse 1.4 Heteronukleare
1 1 H-NMR-Spektroskopie in metallorganischen Komplexen 1.1 Allgemeines Chemische Verschiebungen Beispiele für einfache Komplexe 1.2 Chiralität in Metallkomplexen 1.3 Dynamische Prozesse 1.4 Heteronukleare
NMR Spektroskopie I = 0 : C, 16 O (sogenannte gg-kerne haben immer I=0!) I = 1/2: 1 H, 13 C, 15 N, 19 F, 31 P,... I = 1: 2. H=D, 6 Li, 14 N I = 3/2: 7
 NMR Spektroskopie folie00 Viele Atomkerne besitzen einen von Null verschiedenen Eigendrehimpuls (Spin) p=ħ I, der ganz oder halbzahlige Werte von ħ betragen kann. I bezeichnet die Kernspin-Quantenzahl.
NMR Spektroskopie folie00 Viele Atomkerne besitzen einen von Null verschiedenen Eigendrehimpuls (Spin) p=ħ I, der ganz oder halbzahlige Werte von ħ betragen kann. I bezeichnet die Kernspin-Quantenzahl.
NMR-Spektroskopie Teil 2
 BC 3.4 : Analytische Chemie I NMR Teil 2 NMR-Spektroskopie Teil 2 Stefanie Wolfram Stefanie.Wolfram.1@uni-jena.de Raum 228, TO Vom Spektrum zur Struktur 50000 40000 Peaks u. Integrale 30000 Chemische Verschiebung
BC 3.4 : Analytische Chemie I NMR Teil 2 NMR-Spektroskopie Teil 2 Stefanie Wolfram Stefanie.Wolfram.1@uni-jena.de Raum 228, TO Vom Spektrum zur Struktur 50000 40000 Peaks u. Integrale 30000 Chemische Verschiebung
Grundlagen zum Verständnis chemischer Reaktionen = Handwerkszeug
 Grundlagen zum Verständnis chemischer Reaktionen = andwerkszeug chemische Bindung: ionische, kovalente, Dipolmomente, Bindungsstärke, Atom- und Molekülorbitale, ybridisierung Substanzklassen, funktionelle
Grundlagen zum Verständnis chemischer Reaktionen = andwerkszeug chemische Bindung: ionische, kovalente, Dipolmomente, Bindungsstärke, Atom- und Molekülorbitale, ybridisierung Substanzklassen, funktionelle
Bestimmung der Primärstruktur kleiner Moleküle mittels 1D-NMR-Spektroskopie
 Bestimmung der Primärstruktur kleiner Moleküle mittels 1D-NMR-Spektroskopie Zusammenfassung Mit Hilfe von 1D 1 H- und 13 C-NMR-Spektren und gegebener Summenformel wird die Primärstruktur eines unbekannten
Bestimmung der Primärstruktur kleiner Moleküle mittels 1D-NMR-Spektroskopie Zusammenfassung Mit Hilfe von 1D 1 H- und 13 C-NMR-Spektren und gegebener Summenformel wird die Primärstruktur eines unbekannten
37 Gauß-Algorithmus und lineare Gleichungssysteme
 37 Gauß-Algorithmus und lineare Gleichungssysteme 37 Motivation Lineare Gleichungssysteme treten in einer Vielzahl von Anwendungen auf und müssen gelöst werden In Abschnitt 355 haben wir gesehen, dass
37 Gauß-Algorithmus und lineare Gleichungssysteme 37 Motivation Lineare Gleichungssysteme treten in einer Vielzahl von Anwendungen auf und müssen gelöst werden In Abschnitt 355 haben wir gesehen, dass
UNIVERSITÄT REGENSBURG Institut für Physikalische und Theoretische Chemie Prof. Dr. B. Dick
 UNIVERSITÄT REGENSBURG Institut für Physikalische und Theoretische hemie Prof. Dr. B. Dick PHYSIKALISH-HEMISHES PRAKTIKUM (Teil Ic) (Spektroskopie) Versuch NMR Protonenresonanz 0 http://www-dick.chemie.uni-regensburg.de/studium/praktikum1c.html
UNIVERSITÄT REGENSBURG Institut für Physikalische und Theoretische hemie Prof. Dr. B. Dick PHYSIKALISH-HEMISHES PRAKTIKUM (Teil Ic) (Spektroskopie) Versuch NMR Protonenresonanz 0 http://www-dick.chemie.uni-regensburg.de/studium/praktikum1c.html
D-(+)-Biotin (Vitamin H)
 D-(+)-Biotin (Vitamin H) Benedikt Jacobi 28. Januar 2005 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 1.1 Aufgabenstellung: Prüfung der Stabilität von Biotin (Vitamin H) unter alltäglichen Bedingungen (Kochen,
D-(+)-Biotin (Vitamin H) Benedikt Jacobi 28. Januar 2005 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 1.1 Aufgabenstellung: Prüfung der Stabilität von Biotin (Vitamin H) unter alltäglichen Bedingungen (Kochen,
Einführung in die Quantentheorie der Atome und Photonen
 Einführung in die Quantentheorie der Atome und Photonen 23.04.2005 Jörg Evers Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg Quantenmechanik Was ist das eigentlich? Physikalische Theorie Hauptsächlich
Einführung in die Quantentheorie der Atome und Photonen 23.04.2005 Jörg Evers Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg Quantenmechanik Was ist das eigentlich? Physikalische Theorie Hauptsächlich
Kernresonanzspektroskopie
 Gleich geht s los! Kernresonanzspektroskopie 1. Geschichtliche Entwicklung 2. Physikalische Grundlagen 3. Das NMR-Spektrometer 4. Anwendung der 1 H-NMR-Spektren zur Analyse der Konstitution von Molekülen
Gleich geht s los! Kernresonanzspektroskopie 1. Geschichtliche Entwicklung 2. Physikalische Grundlagen 3. Das NMR-Spektrometer 4. Anwendung der 1 H-NMR-Spektren zur Analyse der Konstitution von Molekülen
Spezielle, einfache 1 H-NMR-Experimente
 Spezielle, einfache 1 -MR-Experimente Vereinfachung der Spektren (Zuordnung / Interpretation) Isotopen-Austausch Shift-Reagenzien Entkopplungsexperimente Zusatzinformation E: Effekt und E-Differenzspektroskopie
Spezielle, einfache 1 -MR-Experimente Vereinfachung der Spektren (Zuordnung / Interpretation) Isotopen-Austausch Shift-Reagenzien Entkopplungsexperimente Zusatzinformation E: Effekt und E-Differenzspektroskopie
Fundamentale Physik. < Grundfrage der Menschheit: woraus besteht, wie funktioniert alles? Teilchenphysik, Allgemeine Relativitätstheorie, Kosmologie
 Fundamentale Physik > < Grundfrage der Menschheit: woraus besteht, wie funktioniert alles? Teilchenphysik, Allgemeine Relativitätstheorie, Kosmologie Phänomene Phänomene Schwerkraft Radiowellen Licht Phänomene
Fundamentale Physik > < Grundfrage der Menschheit: woraus besteht, wie funktioniert alles? Teilchenphysik, Allgemeine Relativitätstheorie, Kosmologie Phänomene Phänomene Schwerkraft Radiowellen Licht Phänomene
Vorlesung Mehrdimensionale NMR-Spektroskopie- Grundlagen und Anwendungen in der Strukturaufklärung Teil VI. Peter Schmieder AG NMR
 Vorlesung Mehrdimensionale NMR-Spektroskopie- Grundlagen und Anwendungen in der Strukturaufklärung Teil VI Das Programm 2/105 Beim letztes Mal Heteronukleare NMR Ein Beispiel Das Programm 3/105 Heute Peptide
Vorlesung Mehrdimensionale NMR-Spektroskopie- Grundlagen und Anwendungen in der Strukturaufklärung Teil VI Das Programm 2/105 Beim letztes Mal Heteronukleare NMR Ein Beispiel Das Programm 3/105 Heute Peptide
Bestimmung der Struktur einer (un)bekannten Verbindung
 Bestimmung der Struktur einer (un)bekannten Verbindung Elementaranalyse Massenspektroskopie andere spektroskopische Methoden Röntgen- Strukturanalyse Kernmagnetische Resonanz - Spektroskopie neue Produktlinie,
Bestimmung der Struktur einer (un)bekannten Verbindung Elementaranalyse Massenspektroskopie andere spektroskopische Methoden Röntgen- Strukturanalyse Kernmagnetische Resonanz - Spektroskopie neue Produktlinie,
Digitalisierung und ihre Konsequenzen
 Digitalisierung und ihre Konsequenzen Bisher haben wir im Zusammenhang mit dem FID und den daraus resultierenden frequenzabhängigen Spektren immer nur von stetigen Funktionen gesprochen. In Wirklichkeit
Digitalisierung und ihre Konsequenzen Bisher haben wir im Zusammenhang mit dem FID und den daraus resultierenden frequenzabhängigen Spektren immer nur von stetigen Funktionen gesprochen. In Wirklichkeit
Die 1 H-chemische Verschiebung Bereich & Einflüsse
 Spektroskopie in der Organischen hemie Die 1 -chemische Verschiebung Bereich & Einflüsse Der Resonanzbereich der Protonen in organischen Molekülen ist ca. 10 ppm breit. Nur saure Protonen (z.b. OO oder
Spektroskopie in der Organischen hemie Die 1 -chemische Verschiebung Bereich & Einflüsse Der Resonanzbereich der Protonen in organischen Molekülen ist ca. 10 ppm breit. Nur saure Protonen (z.b. OO oder
NMR-Methoden zur chiralen Erkennung
 Spektroskopie in der rganischen hemie NMR-Methoden zur chiralen Erkennung Mit Ausnahme der D-Spektroskopie (D = irculardichroismus) sind alle spektroskopischen Methoden auch die NMR achiral, d.h. sie können
Spektroskopie in der rganischen hemie NMR-Methoden zur chiralen Erkennung Mit Ausnahme der D-Spektroskopie (D = irculardichroismus) sind alle spektroskopischen Methoden auch die NMR achiral, d.h. sie können
Edelgas-polarisierte. NMR- Spektroskopie. Jonas Möllmann Jan Mehlich. SoSe 2005
 Edelgas-polarisierte NMR- Spektroskopie Jonas Möllmann Jan Mehlich SoSe 2005 NMR Prinzip Aufspaltung der Kernspins in verschiedene Niveaus durch angelegtes Magnetfeld Messung des Besetzungs- unterschiedes
Edelgas-polarisierte NMR- Spektroskopie Jonas Möllmann Jan Mehlich SoSe 2005 NMR Prinzip Aufspaltung der Kernspins in verschiedene Niveaus durch angelegtes Magnetfeld Messung des Besetzungs- unterschiedes
Proteine. Claudia Schierbaum WS 04/05 Löffler / Petrides: Biochemie & Pathobiochemie, 7.Auflage, Springer-Verlag Berlin Kapitel 3.4 und 3.
 Proteine Claudia Schierbaum WS 04/05 Löffler / Petrides: Biochemie & Pathobiochemie, 7.Auflage, Springer-Verlag Berlin Kapitel 3.4 und 3.5 Faltung, Fehlfaltung und Denaturierung von Proteinen Denaturierung
Proteine Claudia Schierbaum WS 04/05 Löffler / Petrides: Biochemie & Pathobiochemie, 7.Auflage, Springer-Verlag Berlin Kapitel 3.4 und 3.5 Faltung, Fehlfaltung und Denaturierung von Proteinen Denaturierung
NMR Spektroskopie. Aufgaben
 hemische Verschiebung 1. Zeichnen Sie zu den nachfolgend aufgeführten Stoffen die Strukturformeln! Unterscheiden Sie dann zwischen chemisch äquvalenten und nichtäquivalenten Kernen. Bezeichnen Sie die
hemische Verschiebung 1. Zeichnen Sie zu den nachfolgend aufgeführten Stoffen die Strukturformeln! Unterscheiden Sie dann zwischen chemisch äquvalenten und nichtäquivalenten Kernen. Bezeichnen Sie die
Strukturaufklärung (BSc-Chemie): Einführung
 Strukturaufklärung (BSc-Chemie): Einführung Prof. S. Grimme OC [TC] 13.10.2009 Prof. S. Grimme (OC [TC]) Strukturaufklärung (BSc-Chemie): Einführung 13.10.2009 1 / 25 Teil I Einführung Prof. S. Grimme
Strukturaufklärung (BSc-Chemie): Einführung Prof. S. Grimme OC [TC] 13.10.2009 Prof. S. Grimme (OC [TC]) Strukturaufklärung (BSc-Chemie): Einführung 13.10.2009 1 / 25 Teil I Einführung Prof. S. Grimme
Lineare Gleichungssysteme
 Poelchau-Oberschule Berlin A. Mentzendorff September 2007 Lineare Gleichungssysteme Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 2 2 Das Lösungsverfahren von Gauß 4 3 Kurzschreibweise und Zeilensummenkontrolle 6 4
Poelchau-Oberschule Berlin A. Mentzendorff September 2007 Lineare Gleichungssysteme Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 2 2 Das Lösungsverfahren von Gauß 4 3 Kurzschreibweise und Zeilensummenkontrolle 6 4
Eine zweidimensionale Stichprobe
 Eine zweidimensionale Stichprobe liegt vor, wenn zwei qualitative Merkmale gleichzeitig betrachtet werden. Eine Urliste besteht dann aus Wertepaaren (x i, y i ) R 2 und hat die Form (x 1, y 1 ), (x 2,
Eine zweidimensionale Stichprobe liegt vor, wenn zwei qualitative Merkmale gleichzeitig betrachtet werden. Eine Urliste besteht dann aus Wertepaaren (x i, y i ) R 2 und hat die Form (x 1, y 1 ), (x 2,
Schreiben Sie Ihre ö AUSSCHLIEßLICH!!! auf. die leeren Seiten 5 8!
 1. Ermitteln Sie die Konstitution der Verbindung aus MQ, Protonen und protonenbreitbandentkoppeltem Kohlenstoffspektrum. a. Ermitteln Sie alle chemischen Verschiebungen ( 1 und 13 ) und Kopplungskonstanten
1. Ermitteln Sie die Konstitution der Verbindung aus MQ, Protonen und protonenbreitbandentkoppeltem Kohlenstoffspektrum. a. Ermitteln Sie alle chemischen Verschiebungen ( 1 und 13 ) und Kopplungskonstanten
Vorlesung Moderne Methoden der Strukturaufklärung - NMR-Spektroskopie Teil II. Peter Schmieder AG NMR
 Vorlesung Moderne Methoden der Strukturaufklärung - NMR-Spektroskopie Teil II Programm 2/114 Was haben wir uns letztes Mal angeschaut: Wie kommt es zum Effekt der kernmagnetischen Resonanz Was ist das
Vorlesung Moderne Methoden der Strukturaufklärung - NMR-Spektroskopie Teil II Programm 2/114 Was haben wir uns letztes Mal angeschaut: Wie kommt es zum Effekt der kernmagnetischen Resonanz Was ist das
Quantenphysik in der Sekundarstufe I
 Quantenphysik in der Sekundarstufe I Atome und Atomhülle Quantenphysik in der Sek I, Folie 1 Inhalt Voraussetzungen 1. Der Aufbau der Atome 2. Größe und Dichte der Atomhülle 3. Die verschiedenen Zustände
Quantenphysik in der Sekundarstufe I Atome und Atomhülle Quantenphysik in der Sek I, Folie 1 Inhalt Voraussetzungen 1. Der Aufbau der Atome 2. Größe und Dichte der Atomhülle 3. Die verschiedenen Zustände
Vorlesung Einführung in die NMR- und IR-Spektroskopie
 c) b) a) x 8 50 45 40 35 30 25 20 15 ppm Abb. 22: 75,5 MHz 13 C-NMR-Spektren von Cholesterylacetat in CDCl 3. a) ohne 1 H- Entkopplung; b) mit invers gepulster 1 H-Entkopplung; c) mit 1 H-Breitband- Entkopplung.
c) b) a) x 8 50 45 40 35 30 25 20 15 ppm Abb. 22: 75,5 MHz 13 C-NMR-Spektren von Cholesterylacetat in CDCl 3. a) ohne 1 H- Entkopplung; b) mit invers gepulster 1 H-Entkopplung; c) mit 1 H-Breitband- Entkopplung.
NMR-Lösungsmittel. 1 H-NMR. Bei der Verwendung der normalen, nichtdeuterierten Lösungsmittel. Spektroskopie in der Organischen Chemie
 NMR-Lösungsmittel In der werden i.a. deuterierte Lösungsmittel verwendet. ie Substitution der leichten durch die schweren Wasserstoffatome hat zwei Vorteile: - euterium als Spin-1-Kern hat ebenfalls ein
NMR-Lösungsmittel In der werden i.a. deuterierte Lösungsmittel verwendet. ie Substitution der leichten durch die schweren Wasserstoffatome hat zwei Vorteile: - euterium als Spin-1-Kern hat ebenfalls ein
Outline. 1 Vektoren im Raum. 2 Komponenten und Koordinaten. 3 Skalarprodukt. 4 Vektorprodukt. 5 Analytische Geometrie. 6 Lineare Räume, Gruppentheorie
 Outline 1 Vektoren im Raum 2 Komponenten und Koordinaten 3 Skalarprodukt 4 Vektorprodukt 5 Analytische Geometrie 6 Lineare Räume, Gruppentheorie Roman Wienands (Universität zu Köln) Mathematik II für Studierende
Outline 1 Vektoren im Raum 2 Komponenten und Koordinaten 3 Skalarprodukt 4 Vektorprodukt 5 Analytische Geometrie 6 Lineare Räume, Gruppentheorie Roman Wienands (Universität zu Köln) Mathematik II für Studierende
(Allgemeine) Vektorräume (Teschl/Teschl 9)
 (Allgemeine) Vektorräume (Teschl/Teschl 9) Sei K ein beliebiger Körper. Ein Vektorraum über K ist eine (nichtleere) Menge V, auf der zwei Operationen deniert sind, die bestimmten Rechenregeln genügen:
(Allgemeine) Vektorräume (Teschl/Teschl 9) Sei K ein beliebiger Körper. Ein Vektorraum über K ist eine (nichtleere) Menge V, auf der zwei Operationen deniert sind, die bestimmten Rechenregeln genügen:
Das wissen Sie: 6. Welche Möglichkeiten zur Darstellung periodischer Funktionen (Signalen) kennen Sie?
 Das wissen Sie: 1. Wann ist eine Funktion (Signal) gerade, ungerade, harmonisch, periodisch (Kombinationsbeispiele)? 2. Wie lassen sich harmonische Schwingungen mathematisch beschreiben und welche Beziehungen
Das wissen Sie: 1. Wann ist eine Funktion (Signal) gerade, ungerade, harmonisch, periodisch (Kombinationsbeispiele)? 2. Wie lassen sich harmonische Schwingungen mathematisch beschreiben und welche Beziehungen
Die 13 C-chemische Verschiebung
 Spektroskopie in der rganischen hemie Die 13 -chemische Verschiebung Im Vergleich zur 1 H-chemischen Verschiebung ist der δ( 13 )-Bereich sehr viel größer, weil er durch den paramagnetischen Beitrag zur
Spektroskopie in der rganischen hemie Die 13 -chemische Verschiebung Im Vergleich zur 1 H-chemischen Verschiebung ist der δ( 13 )-Bereich sehr viel größer, weil er durch den paramagnetischen Beitrag zur
4.6 Strukturbestimmung in Proteinen
 - 54-4.6 Strukturbestimmung in Proteinen 4.6.1 Aminosäuren und Proteine Proteine gehören zu den wichtigsten Bestandteilen aller lebenden Organismen: sie spielen nicht nur für die Struktur eine wichtige
- 54-4.6 Strukturbestimmung in Proteinen 4.6.1 Aminosäuren und Proteine Proteine gehören zu den wichtigsten Bestandteilen aller lebenden Organismen: sie spielen nicht nur für die Struktur eine wichtige
Struktur der Materie: Grundlagen, Mikroskopie und Spektroskopie
 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Struktur der Materie: Grundlagen, Mikroskopie und Spektroskopie Von
2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Struktur der Materie: Grundlagen, Mikroskopie und Spektroskopie Von
Grundlagen der NMR-Spektroskopie
 Westfälische Wilhelms-Universität Münster Institut für Pharmazeutische und Medizinische Chemie 8. Semester Übersicht: Einleitung Physikalische Grundlagen Magnetische Kerne Resonanz Spektrometer 1 Chem.
Westfälische Wilhelms-Universität Münster Institut für Pharmazeutische und Medizinische Chemie 8. Semester Übersicht: Einleitung Physikalische Grundlagen Magnetische Kerne Resonanz Spektrometer 1 Chem.
Vokabular zur Stereochemie
 Vokabular zur tereochemie Zwei Moleküle mit gleicher ummenformel sind: deckungsgleich = identisch Isomere Konstitutionsisomere tereoisomere Enantiomere Diastereomere Konstitutionsisomere: Moleküle mit
Vokabular zur tereochemie Zwei Moleküle mit gleicher ummenformel sind: deckungsgleich = identisch Isomere Konstitutionsisomere tereoisomere Enantiomere Diastereomere Konstitutionsisomere: Moleküle mit
Praktikumsversuch: Anwendung analytischer Methoden in der Synthesechemie
 6. Fachsemester, Sommersemester 2014 Praktikumsversuch: Anwendung analytischer Methoden in der Synthesechemie 1. Theoretische Grundlagen... 2 1.1. NMR-Spektroskopie Grundlagen und Probenanalyse... 2 1.2.
6. Fachsemester, Sommersemester 2014 Praktikumsversuch: Anwendung analytischer Methoden in der Synthesechemie 1. Theoretische Grundlagen... 2 1.1. NMR-Spektroskopie Grundlagen und Probenanalyse... 2 1.2.
Die elektrophile Addition
 Die elektrophile Addition Roland Heynkes 3.10.2005, Aachen Die elektrophile Addition als typische Reaktion der Doppelbindung in Alkenen bietet einen Einstieg in die Welt der organisch-chemischen Reaktionsmechanismen.
Die elektrophile Addition Roland Heynkes 3.10.2005, Aachen Die elektrophile Addition als typische Reaktion der Doppelbindung in Alkenen bietet einen Einstieg in die Welt der organisch-chemischen Reaktionsmechanismen.
Das INEPT-Experiment
 Das INEPT-Experiment Das Prinzip des Polarisations-Transfers (PT) ist im Zusammenhang mit dem heteronuklearen ( 13 C, 1 H) Experiment Selective Population Inversion (SPI) beschrieben worden. Hierbei wird
Das INEPT-Experiment Das Prinzip des Polarisations-Transfers (PT) ist im Zusammenhang mit dem heteronuklearen ( 13 C, 1 H) Experiment Selective Population Inversion (SPI) beschrieben worden. Hierbei wird
Teil 3: Spin-Spin Kopplung
 NMR-Spektroskopie Teil 3: Spin-Spin Kopplung 1. Die skalare Spin-Spin Kopplung 2. Multiplizitaet und Intensitaetsverteilung 3. Geminale, vicinale und allylische Kopplungskonstanten 4. Anschauliche Beschreibung
NMR-Spektroskopie Teil 3: Spin-Spin Kopplung 1. Die skalare Spin-Spin Kopplung 2. Multiplizitaet und Intensitaetsverteilung 3. Geminale, vicinale und allylische Kopplungskonstanten 4. Anschauliche Beschreibung
1. Gruppen. 1. Gruppen 7
 1. Gruppen 7 1. Gruppen Wie schon in der Einleitung erläutert wollen wir uns in dieser Vorlesung mit Mengen beschäftigen, auf denen algebraische Verknüpfungen mit gewissen Eigenschaften definiert sind.
1. Gruppen 7 1. Gruppen Wie schon in der Einleitung erläutert wollen wir uns in dieser Vorlesung mit Mengen beschäftigen, auf denen algebraische Verknüpfungen mit gewissen Eigenschaften definiert sind.
= 6,63 10 J s 8. (die Plancksche Konstante):
 35 Photonen und Materiefelder 35.1 Das Photon: Teilchen des Lichts Die Quantenphysik: viele Größen treten nur in ganzzahligen Vielfachen von bestimmten kleinsten Beträgen (elementaren Einheiten) auf: diese
35 Photonen und Materiefelder 35.1 Das Photon: Teilchen des Lichts Die Quantenphysik: viele Größen treten nur in ganzzahligen Vielfachen von bestimmten kleinsten Beträgen (elementaren Einheiten) auf: diese
Ferienkurs Experimentalphysik 4
 Ferienkurs Experimentalphysik 4 Probeklausur Markus Perner, Markus Kotulla, Jonas Funke Aufgabe 1 (Allgemeine Fragen). : (a) Welche Relation muss ein Operator erfüllen damit die dazugehörige Observable
Ferienkurs Experimentalphysik 4 Probeklausur Markus Perner, Markus Kotulla, Jonas Funke Aufgabe 1 (Allgemeine Fragen). : (a) Welche Relation muss ein Operator erfüllen damit die dazugehörige Observable
n r 2.2. Der Spin Magnetische Momente In einem klassischen Atommodell umkreist das Elektron den Kern Drehimpuls
 2.2. Der Spin 2.2.1. Magnetische Momente In einem klassischen Atommodell umkreist das Elektron den Kern Drehimpuls Dies entspricht einem Kreisstrom. n r r I e Es existiert ein entsprechendes magnetisches
2.2. Der Spin 2.2.1. Magnetische Momente In einem klassischen Atommodell umkreist das Elektron den Kern Drehimpuls Dies entspricht einem Kreisstrom. n r r I e Es existiert ein entsprechendes magnetisches
Inhalt. a) Typische Wechselwirkungen im Festkörper. b) Spektrenform für Einkristalle und Pulver. c) Messung und Interpretation einfacher Systeme
 Inhalt. Grundlagen der FK-NMR-Spektroskopie a) Typische Wechselwirkungen im Festkörper b) Spektrenform für Einkristalle und Pulver c) Messung und Interpretation einfacher Systeme. Wichtige Techniken und
Inhalt. Grundlagen der FK-NMR-Spektroskopie a) Typische Wechselwirkungen im Festkörper b) Spektrenform für Einkristalle und Pulver c) Messung und Interpretation einfacher Systeme. Wichtige Techniken und
Bereich der 1 H-chemischen Verschiebung (Abb. nach: Friebolin)
 Bereich der 1 -chemischen Verschiebung (Abb. nach: Friebolin) 1 -NM-Spektroskopie 1 Der esonanzbereich der Protonen in organischen Molekülen ist ca. 10 ppm breit. Nur saure Protonen (z.b. COO oder SO 3
Bereich der 1 -chemischen Verschiebung (Abb. nach: Friebolin) 1 -NM-Spektroskopie 1 Der esonanzbereich der Protonen in organischen Molekülen ist ca. 10 ppm breit. Nur saure Protonen (z.b. COO oder SO 3
10 Kapitel I: Anschauliche Vektorrechnung
 10 Kapitel I: Anschauliche Vektorrechnung haben. In Mengenschreibweise ist G = {x x = a + tb für ein t R}. Wir werden für diese einführenden Betrachtungen im Interesse einer knappen Redeweise jedoch häufig
10 Kapitel I: Anschauliche Vektorrechnung haben. In Mengenschreibweise ist G = {x x = a + tb für ein t R}. Wir werden für diese einführenden Betrachtungen im Interesse einer knappen Redeweise jedoch häufig
4 Vorlesung: 21.11. 2005 Matrix und Determinante
 4 Vorlesung: 2111 2005 Matrix und Determinante 41 Matrix und Determinante Zur Lösung von m Gleichungen mit n Unbekannten kann man alle Parameter der Gleichungen in einem rechteckigen Zahlenschema, einer
4 Vorlesung: 2111 2005 Matrix und Determinante 41 Matrix und Determinante Zur Lösung von m Gleichungen mit n Unbekannten kann man alle Parameter der Gleichungen in einem rechteckigen Zahlenschema, einer
Eigenschaften des Photons
 Eigenschaften des Photons Das Photon ist das Energiequant der elektromagnetischen Wellen, d.h. Licht hat wie von Einstein postuliert nicht nur Wellencharakter, sondern auch Teilchencharakter mit den oben
Eigenschaften des Photons Das Photon ist das Energiequant der elektromagnetischen Wellen, d.h. Licht hat wie von Einstein postuliert nicht nur Wellencharakter, sondern auch Teilchencharakter mit den oben
mathe plus Aussagenlogik Seite 1
 mathe plus Aussagenlogik Seite 1 1 Aussagenlogik 1.1 Grundbegriffe Def 1 Aussage Eine Aussage ist ein beschriebener Sachverhalt, dem eindeutig einer der Wahrheitswerte entweder wahr oder falsch zugeordnet
mathe plus Aussagenlogik Seite 1 1 Aussagenlogik 1.1 Grundbegriffe Def 1 Aussage Eine Aussage ist ein beschriebener Sachverhalt, dem eindeutig einer der Wahrheitswerte entweder wahr oder falsch zugeordnet
Die Hückel-Theorie (HMO)
 Die ückel-theorie (MO) Voraussetzungen: Rechenregeln für Integrale, Matrizen, Determinanten, LCAO-Methode, Überlappungsintegrale/Erwartungswerte, Dirac-Schreibweise, Ritzquotient, Variationsprinzip, Säkulardeterminante
Die ückel-theorie (MO) Voraussetzungen: Rechenregeln für Integrale, Matrizen, Determinanten, LCAO-Methode, Überlappungsintegrale/Erwartungswerte, Dirac-Schreibweise, Ritzquotient, Variationsprinzip, Säkulardeterminante
Chiralitätszentrum X X
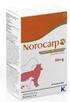 hiralitätszentrum Die weitaus meisten chiralen Verbindungen ist deswegen chiral, weil sie sog. asymmetrische Kohlenstoffatome enthalten. Dies sind tetraedrisch konfigurierte -Atome mit vier verschiedenen
hiralitätszentrum Die weitaus meisten chiralen Verbindungen ist deswegen chiral, weil sie sog. asymmetrische Kohlenstoffatome enthalten. Dies sind tetraedrisch konfigurierte -Atome mit vier verschiedenen
Eigenschaften des Photons
 Eigenschaften des Photons Das Photon ist das Energiequant der elektromagnetischen Wellen, d.h. Licht hat wie von Einstein postuliert nicht nur Wellencharakter, sondern auch Teilchencharakter mit den oben
Eigenschaften des Photons Das Photon ist das Energiequant der elektromagnetischen Wellen, d.h. Licht hat wie von Einstein postuliert nicht nur Wellencharakter, sondern auch Teilchencharakter mit den oben
1 H-NMR ohne Formeln. Dr. Philipp Reiß Fb. Chemie der Philipps-Universität Marburg reiss@chemie.uni-marburg.de
 1 -NMR ohne Formeln Dr. Philipp Reiß Fb. Chemie der Philipps-Universität Marburg reiss@chemie.uni-marburg.de Fb. Chemie Dr. Reiß: 1 -NMR ohne Formeln 1 Inhaltsverzeichnis 0. Einleitung... 2 1. Grundlagen...
1 -NMR ohne Formeln Dr. Philipp Reiß Fb. Chemie der Philipps-Universität Marburg reiss@chemie.uni-marburg.de Fb. Chemie Dr. Reiß: 1 -NMR ohne Formeln 1 Inhaltsverzeichnis 0. Einleitung... 2 1. Grundlagen...
Die meisten Elemente liegen in gebundener Form als einzelne Moleküle, in Flüssigkeiten oder in Festkörpern vor.
 phys4.025 Page 1 13. Moleküle Nur eine kleine Anzahl von Elementen kommt natürlich in Form von einzelnen Atomen vor. Die meisten Elemente liegen in gebundener Form als einzelne Moleküle, in Flüssigkeiten
phys4.025 Page 1 13. Moleküle Nur eine kleine Anzahl von Elementen kommt natürlich in Form von einzelnen Atomen vor. Die meisten Elemente liegen in gebundener Form als einzelne Moleküle, in Flüssigkeiten
3.1 Zur Photochemie von HNO 3 11 Abbildung 3.1: Das UV-Absorptionsspektrum von HNO 3 nach [71] Abbildung 3.2: Das UV-Absorptionsspektrum von HNO 3 nac
![3.1 Zur Photochemie von HNO 3 11 Abbildung 3.1: Das UV-Absorptionsspektrum von HNO 3 nach [71] Abbildung 3.2: Das UV-Absorptionsspektrum von HNO 3 nac 3.1 Zur Photochemie von HNO 3 11 Abbildung 3.1: Das UV-Absorptionsspektrum von HNO 3 nach [71] Abbildung 3.2: Das UV-Absorptionsspektrum von HNO 3 nac](/thumbs/53/31354364.jpg) Kapitel 3 Grundlagen der Photochemie von HNO 3 und Modellentwicklung 3.1 Zur Photochemie von HNO 3 Salpetersaure ist ein wichtiges Nebenprodukt des photochemischen Smogs [67], und es ist ein relevanter
Kapitel 3 Grundlagen der Photochemie von HNO 3 und Modellentwicklung 3.1 Zur Photochemie von HNO 3 Salpetersaure ist ein wichtiges Nebenprodukt des photochemischen Smogs [67], und es ist ein relevanter
Kernphysik I. Kernkräfte und Kernmodelle: Ladungsunabhängigkeit der Kernkräfte Isospin
 Kernphysik I Kernkräfte und Kernmodelle: Ladungsunabhängigkeit der Kernkräfte Isospin Kernphysik I Universität u Köln - Fachgruppe Physik Großes Physikalisches Kolloquium Dienstag, 0. Juni 008, 6:45 Uhr
Kernphysik I Kernkräfte und Kernmodelle: Ladungsunabhängigkeit der Kernkräfte Isospin Kernphysik I Universität u Köln - Fachgruppe Physik Großes Physikalisches Kolloquium Dienstag, 0. Juni 008, 6:45 Uhr
ESR vs. NMR NMR ESR. ESR - Messung. Kernmagneton. 2cm P. m p 1800 µ e = 1800 m p. m e. (Bohr Magneton)
 M-Spektroskopie M ES vs. M M-Spektren von paramagnetischen Verbindungen? M µ e ist 0 3 mal grösser als das Kernmoment µ hν 0 = γ hb 0 µ = e h cm P Kernmagneton longitudinale elaxation wird zu stark (T
M-Spektroskopie M ES vs. M M-Spektren von paramagnetischen Verbindungen? M µ e ist 0 3 mal grösser als das Kernmoment µ hν 0 = γ hb 0 µ = e h cm P Kernmagneton longitudinale elaxation wird zu stark (T
ALLGEMEINE CHEMIE - GRUNDLAGEN
 ALLGEMEINE CHEMIE - GRUNDLAGEN Ziel der Vorlesung: Vermittlung der allgemeinen chemischen Grundlagen und Aspekte, die für alle Bereiche der Chemie notwendig sind; Modellvorstellungen Inhaltsübersicht:
ALLGEMEINE CHEMIE - GRUNDLAGEN Ziel der Vorlesung: Vermittlung der allgemeinen chemischen Grundlagen und Aspekte, die für alle Bereiche der Chemie notwendig sind; Modellvorstellungen Inhaltsübersicht:
Seminar zum Praktikum Anorganische Chemie III III
 Seminar zum Praktikum Anorganische Chemie III III Metallorganische Chemie Dr. J. Wachter IR-Teil3 www.chemie.uni-regensburg.de/anorganische_chemie/scheer/lehre.html www.chemie.uniregensburg.de/anorganische_chemie/wachter/lehre.html
Seminar zum Praktikum Anorganische Chemie III III Metallorganische Chemie Dr. J. Wachter IR-Teil3 www.chemie.uni-regensburg.de/anorganische_chemie/scheer/lehre.html www.chemie.uniregensburg.de/anorganische_chemie/wachter/lehre.html
Vorlesung. Analytik (für Biologen und Pharmazeuten) Einführung in spektroskopische Methoden der Strukturaufklärung organischer Verbindungen
 Vorlesung Analytik (für Biologen und Pharmazeuten) Einführung in spektroskopische Methoden der Strukturaufklärung organischer Verbindungen Zusammenfassung des Teils "Spektroskopie" für die Prüfung BSc
Vorlesung Analytik (für Biologen und Pharmazeuten) Einführung in spektroskopische Methoden der Strukturaufklärung organischer Verbindungen Zusammenfassung des Teils "Spektroskopie" für die Prüfung BSc
10. Der Spin des Elektrons
 10. Elektronspin Page 1 10. Der Spin des Elektrons Beobachtung: Aufspaltung von Spektrallinien in nahe beieinander liegende Doppellinien z.b. die erste Linie der Balmer-Serie (n=3 -> n=2) des Wasserstoff-Atoms
10. Elektronspin Page 1 10. Der Spin des Elektrons Beobachtung: Aufspaltung von Spektrallinien in nahe beieinander liegende Doppellinien z.b. die erste Linie der Balmer-Serie (n=3 -> n=2) des Wasserstoff-Atoms
Die zu dieser Zeit bekannten 63 Elemente konnten trotzdem nach ihren chemischen Eigenschaften in einem periodischen System angeordnet werden.
 phys4.022 Page 1 12.4 Das Periodensystem der Elemente Dimitri Mendeleev (1869): Ordnet man die chemischen Elemente nach ihrer Ladungszahl Z, so tauchen Elemente mit ähnlichen chemischen und physikalischen
phys4.022 Page 1 12.4 Das Periodensystem der Elemente Dimitri Mendeleev (1869): Ordnet man die chemischen Elemente nach ihrer Ladungszahl Z, so tauchen Elemente mit ähnlichen chemischen und physikalischen
3. Kapitel Der Compton Effekt
 3. Kapitel Der Compton Effekt 3.1 Lernziele Sie können erklären, wie die Streuung von Röntgenstrahlen an Graphit funktioniert. Sie kennen die physikalisch theoretischen Voraussetzungen, die es zum Verstehen
3. Kapitel Der Compton Effekt 3.1 Lernziele Sie können erklären, wie die Streuung von Röntgenstrahlen an Graphit funktioniert. Sie kennen die physikalisch theoretischen Voraussetzungen, die es zum Verstehen
Elementare Beweismethoden
 Elementare Beweismethoden Christian Hensel 404015 Inhaltsverzeichnis Vortrag zum Thema Elementare Beweismethoden im Rahmen des Proseminars Mathematisches Problemlösen 1 Einführung und wichtige Begriffe
Elementare Beweismethoden Christian Hensel 404015 Inhaltsverzeichnis Vortrag zum Thema Elementare Beweismethoden im Rahmen des Proseminars Mathematisches Problemlösen 1 Einführung und wichtige Begriffe
Hochpräzise Bestimmung des Brechungsindex mittels FTIR- Spektroskopie. Dr. Denis Czurlok Bruker Optik Anwendertreffen Ettlingen,
 Hochpräzise Bestimmung des Brechungsindex mittels FTIR- Spektroskopie Dr. Denis Czurlok Bruker Optik Anwendertreffen Ettlingen, 15.11.2016 November 21, 2016 Grundlagen Dispersion: Frequenz/Wellenlängenabhängigkeit
Hochpräzise Bestimmung des Brechungsindex mittels FTIR- Spektroskopie Dr. Denis Czurlok Bruker Optik Anwendertreffen Ettlingen, 15.11.2016 November 21, 2016 Grundlagen Dispersion: Frequenz/Wellenlängenabhängigkeit
(geometrische) Anschauung
 (geometrische) Anschauung Marcus Page Juni 28 In dieser Lerneinheit widmen wir uns dem schon oft angesprochenen Zusammenhang zwischen Matrizen und linearen Abbildungen. Außerdem untersuchen wir Funktionen,
(geometrische) Anschauung Marcus Page Juni 28 In dieser Lerneinheit widmen wir uns dem schon oft angesprochenen Zusammenhang zwischen Matrizen und linearen Abbildungen. Außerdem untersuchen wir Funktionen,
( ) Lineare Gleichungssysteme
 102 III. LINEARE ALGEBRA Aufgabe 13.37 Berechne die Eigenwerte der folgenden Matrizen: ( ) 1 1 0 1 1 2 0 3 0 0, 2 1 1 1 2 1. 1 1 0 3 Aufgabe 13.38 Überprüfe, ob die folgenden symmetrischen Matrizen positiv
102 III. LINEARE ALGEBRA Aufgabe 13.37 Berechne die Eigenwerte der folgenden Matrizen: ( ) 1 1 0 1 1 2 0 3 0 0, 2 1 1 1 2 1. 1 1 0 3 Aufgabe 13.38 Überprüfe, ob die folgenden symmetrischen Matrizen positiv
Ausbreitung von elektromagnetischer Strahlung
 Ausbreitung von elektromagnetischer Strahlung E! B Der elektrische Feldvektor und der magnetische Feldvektor stehen senkrecht aufeinander Die elektromagentische Welle ist beschrieben durch x x E = E 0
Ausbreitung von elektromagnetischer Strahlung E! B Der elektrische Feldvektor und der magnetische Feldvektor stehen senkrecht aufeinander Die elektromagentische Welle ist beschrieben durch x x E = E 0
2.4 Stoßprozesse. entweder nicht interessiert o- der keine Möglichkeit hat, sie zu untersuchen oder zu beeinflussen.
 - 52-2.4 Stoßprozesse 2.4.1 Definition und Motivation Unter einem Stoß versteht man eine zeitlich begrenzte Wechselwirkung zwischen zwei oder mehr Systemen, wobei man sich für die Einzelheiten der Wechselwirkung
- 52-2.4 Stoßprozesse 2.4.1 Definition und Motivation Unter einem Stoß versteht man eine zeitlich begrenzte Wechselwirkung zwischen zwei oder mehr Systemen, wobei man sich für die Einzelheiten der Wechselwirkung
Vorlesung Moderne Methoden der Strukturaufklärung - NMR-Spektroskopie Teil I. Peter Schmieder AG NMR
 Vorlesung Moderne Methoden der Strukturaufklärung - NMR-Spektroskopie Teil I Die Vorlesung 2/116 1. Grundlagen der NMR-Spektroskopie NMR-Prinzip, FT-NMR, Signaldetektion 2. Mehrdimensionale NMR (2D) Vektormodell,
Vorlesung Moderne Methoden der Strukturaufklärung - NMR-Spektroskopie Teil I Die Vorlesung 2/116 1. Grundlagen der NMR-Spektroskopie NMR-Prinzip, FT-NMR, Signaldetektion 2. Mehrdimensionale NMR (2D) Vektormodell,
Das Periodensystem der Elemente
 Q34 LK Physik 17. November 2015 Aufbau Die ermittelten Zusammenhänge der Elektronenzustände in der Atomhülle sollen dazu dienen, den der Elemente zu verstehen. Dem liegen folgende Prinzipien zugrunde:
Q34 LK Physik 17. November 2015 Aufbau Die ermittelten Zusammenhänge der Elektronenzustände in der Atomhülle sollen dazu dienen, den der Elemente zu verstehen. Dem liegen folgende Prinzipien zugrunde:
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie II Lösungsvorschlag zu Blatt 5
 Wintersemester 006 / 007 04.1.006 1. Aufgabe Die Wellenfunktionen unterscheiden sich gar nicht. Während der Lösung der elektronischen Schrödingergleichung werden die Kerne als ruhend betrachtet. Es kommt
Wintersemester 006 / 007 04.1.006 1. Aufgabe Die Wellenfunktionen unterscheiden sich gar nicht. Während der Lösung der elektronischen Schrödingergleichung werden die Kerne als ruhend betrachtet. Es kommt
Anorganische-Chemie. Dr. Stefan Wuttke Butenandstr. 11, Haus E, E
 Dr. Stefan Wuttke Butenandstr. 11, Haus E, E 3.039 stefan.wuttke@cup.uni-muenchen.de www.wuttkegroup.de Anorganische-Chemie Grundpraktikum für Biologen 2014/2015 Inhaltliche Schwerpunkte Stöchiometrie
Dr. Stefan Wuttke Butenandstr. 11, Haus E, E 3.039 stefan.wuttke@cup.uni-muenchen.de www.wuttkegroup.de Anorganische-Chemie Grundpraktikum für Biologen 2014/2015 Inhaltliche Schwerpunkte Stöchiometrie
ALLGEMEINE CHEMIE - GRUNDLAGEN
 ALLGEMEINE CHEMIE - GRUNDLAGEN Ziel der Vorlesung: Vermittlung des Wissens allgemeiner chemischen Grundlagen und Vorstellungen, die für alle Bereiche der Naturwissenschaften notwendig sind; Modellvorstellungen
ALLGEMEINE CHEMIE - GRUNDLAGEN Ziel der Vorlesung: Vermittlung des Wissens allgemeiner chemischen Grundlagen und Vorstellungen, die für alle Bereiche der Naturwissenschaften notwendig sind; Modellvorstellungen
Magnetismus der Materie. Bernd Fercher David Schweiger
 Magnetismus der Materie Bernd Fercher David Schweiger Einleitung Erste Beobachtunge in China und Kleinasien Um 1100 Navigation von Schiffen Magnetismus wird durch Magnetfeld beschrieben dieses wird durch
Magnetismus der Materie Bernd Fercher David Schweiger Einleitung Erste Beobachtunge in China und Kleinasien Um 1100 Navigation von Schiffen Magnetismus wird durch Magnetfeld beschrieben dieses wird durch
Grundlagen der Chemie für Studierende der Humanmedizin und der Zahnheilkunde Wiederholungsklausur
 ame: Vorname: Geburtsort: Geburtsdatum: Matrikelnummer: Studiengruppe: Grundlagen der hemie für Studierende der umanmedizin und der Zahnheilkunde Wiederholungsklausur BITTE DEUTLI SREIBE ilfsmittel: Taschenrechner,
ame: Vorname: Geburtsort: Geburtsdatum: Matrikelnummer: Studiengruppe: Grundlagen der hemie für Studierende der umanmedizin und der Zahnheilkunde Wiederholungsklausur BITTE DEUTLI SREIBE ilfsmittel: Taschenrechner,
Spektroskopie Strukturaufklärung in der Organischen Chemie
 Joseph B. Lambert Scott Gronert Herbert F. Shurvell David A. Lightner Spektroskopie Strukturaufklärung in der Organischen Chemie 2., aktualisierte Aulage Aus dem Amerikanischen von Carsten Biele Deutsche
Joseph B. Lambert Scott Gronert Herbert F. Shurvell David A. Lightner Spektroskopie Strukturaufklärung in der Organischen Chemie 2., aktualisierte Aulage Aus dem Amerikanischen von Carsten Biele Deutsche
Technische Universität München Zentrum Mathematik. Übungsblatt 7
 Technische Universität München Zentrum Mathematik Mathematik (Elektrotechnik) Prof. Dr. Anusch Taraz Dr. Michael Ritter Übungsblatt 7 Hausaufgaben Aufgabe 7. Für n N ist die Matrix-Exponentialfunktion
Technische Universität München Zentrum Mathematik Mathematik (Elektrotechnik) Prof. Dr. Anusch Taraz Dr. Michael Ritter Übungsblatt 7 Hausaufgaben Aufgabe 7. Für n N ist die Matrix-Exponentialfunktion
2) In welcher Einheit wird die Energie (x-achse) im NMR-Spektrum angegeben und wie ist sie definiert?
 Aufgabe 1: Verständnisfragen 1) Welche Eigenschaften eines Atomkerns führen zu einem starken NMR-Signal? (man sagt der Kern hat eine große Empfindlichkeit) Ein Isotop eines Elements wird empfindlich genannt,
Aufgabe 1: Verständnisfragen 1) Welche Eigenschaften eines Atomkerns führen zu einem starken NMR-Signal? (man sagt der Kern hat eine große Empfindlichkeit) Ein Isotop eines Elements wird empfindlich genannt,
Thema heute: Das Bohr sche Atommodell
 Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Radioaktive Zerfallsgeschwindigkeit, Altersbestimmungen, Ionisationszähler (Geiger-Müller-Zähler), Szintillationszähler, natürliche radioaktive Zerfallsreihen,
Wiederholung der letzten Vorlesungsstunde: Radioaktive Zerfallsgeschwindigkeit, Altersbestimmungen, Ionisationszähler (Geiger-Müller-Zähler), Szintillationszähler, natürliche radioaktive Zerfallsreihen,
4.2.2.Das Wasserstoff-Molekül H 2 Vergleich der Wellenfunktionen für antiparallele Spinkonfiguration
 g 4.2.2.Das Wasserstoff-Molekül H 2 Vergleich der Wellenfunktionen für antiparallele Spinkonfiguration a () ϕ ( 2) ϕ ( 2) ϕ ( 1) ψ = ϕ + 1 b a b Heitler-London ( ) ϕ ( 2) + ϕ ( 2) ϕ ( 1) + [ ϕ ( 1) ϕ (
g 4.2.2.Das Wasserstoff-Molekül H 2 Vergleich der Wellenfunktionen für antiparallele Spinkonfiguration a () ϕ ( 2) ϕ ( 2) ϕ ( 1) ψ = ϕ + 1 b a b Heitler-London ( ) ϕ ( 2) + ϕ ( 2) ϕ ( 1) + [ ϕ ( 1) ϕ (
6 Vertiefende Themen aus des Mechanik
 6 Vertiefende Themen aus des Mechanik 6.1 Diagramme 6.1.1 Steigung einer Gerade; Änderungsrate Im ersten Kapitel haben wir gelernt, was uns die Steigung (oft mit k bezeichnet) in einem s-t Diagramm ( k=
6 Vertiefende Themen aus des Mechanik 6.1 Diagramme 6.1.1 Steigung einer Gerade; Änderungsrate Im ersten Kapitel haben wir gelernt, was uns die Steigung (oft mit k bezeichnet) in einem s-t Diagramm ( k=
LMPG 2, ÜB21, Molekülbau & UV/VIS-Absorption LÖSUNG 1 von 11
 LMPG 2, ÜB21, Molekülbau & UV/VISAbsorption LÖSUG 1 von 11 Übung 1: Charakterisierung von Absorptionsbanden Veränderungen der Molekülstruktur können zu Verschiebungen der einzelnen Absorptionsbanden im
LMPG 2, ÜB21, Molekülbau & UV/VISAbsorption LÖSUG 1 von 11 Übung 1: Charakterisierung von Absorptionsbanden Veränderungen der Molekülstruktur können zu Verschiebungen der einzelnen Absorptionsbanden im
NMR-spektroskopische Untersuchung der Lithiumaggregate von organischen Verbindungen und von Cyclosporin A
 Zusammenfassung der wissenschaftlichen Ergebnisse zur Dissertation NMR-spektroskopische Untersuchung der thiumaggregate von organischen Verbindungen und von Cyclosporin A Der Fakultät für Chemie und Mineralogie
Zusammenfassung der wissenschaftlichen Ergebnisse zur Dissertation NMR-spektroskopische Untersuchung der thiumaggregate von organischen Verbindungen und von Cyclosporin A Der Fakultät für Chemie und Mineralogie
Spezialfall: Die Gleichung ax = b mit einer Unbekannten x kann mit Hilfe des Kehrwerts 1 a = a 1 gelöst werden:
 Inverse Matritzen Spezialfall: Die Gleichung ax b mit einer Unbekannten x kann mit Hilfe des Kehrwerts 1 a a 1 gelöst werden: ax b x b a a 1 b. Verallgemeinerung auf Ax b mit einer n nmatrix A: Wenn es
Inverse Matritzen Spezialfall: Die Gleichung ax b mit einer Unbekannten x kann mit Hilfe des Kehrwerts 1 a a 1 gelöst werden: ax b x b a a 1 b. Verallgemeinerung auf Ax b mit einer n nmatrix A: Wenn es
DEUTSCHE SCHULE MONTEVIDEO BIKULTURELLES DEUTSCH-URUGUAYISCHES ABITUR ( AUF SPANISCH )
 Grundlegende Bemerkungen : Der Begriff des Vektors wurde in den vergangenen Jahren im Geometrieunterricht eingeführt und das mathematische Modell des Vektors wurde vor allem auch im Physikunterricht schon
Grundlegende Bemerkungen : Der Begriff des Vektors wurde in den vergangenen Jahren im Geometrieunterricht eingeführt und das mathematische Modell des Vektors wurde vor allem auch im Physikunterricht schon
