Verbundlösungen. Forschungsprojekt. Kommentierte Zusammenfassung der Studie «Verbundlösungen für die Pflege und Betreuung im Altersbereich»
|
|
|
- Fanny Lichtenberg
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Forschungsprojekt Verbundlösungen Kommentierte Zusammenfassung der Studie «Verbundlösungen für die Pflege und Betreuung im Altersbereich» Eine Studie der Age Stiftung und von Curaviva Schweiz in Kooperation mit dem Spitex Verband Schweiz, durchgeführt vom Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie
2 Summary Im Gesundheitswesen ist aktuell vermehrt ein Trend hin zur integrierten Versorgung zu erkennen. Politische Entwicklungen und Reformen verlangen eine verstärkte Zusammenarbeit der Dienstleister auf unterschiedlichen Ebenen des Gesundheitswesens. Darüber, wie weit die Bemühungen zur Zusammenarbeit im Bereich Pflege und Betreuung im Altersbereich gediehen sind, gibt eine Studie des Winterthurer Instituts für Gesundheitsökonomie Auskunft. Die Studie wurde im Herbst 2009 von der Age Stiftung und Curaviva Schweiz in Kooperation mit dem Spitex Verband Schweiz in Auftrag gegeben. Die Untersuchung basiert auf einer fragebogengestützten Umfrage, an der sich 471 Deutschschweizer Altersund Pflegeheime sowie Spitex- Organisationen beteiligt haben. Die Studie zeigt, welche und wie viele Organisationen bereits Zusammenarbeitsformen so genannte Verbundlösungen umsetzen, welche Angebote und Spezialisierungen im Rahmen von Verbundlösungen erbracht werden und wie die Zusammenarbeit organisiert ist. Dabei wird deutlich, dass das Potential zur Bildung von Verbundlösungen noch nicht ausgeschöpft ist. Ambulante Dienstleister streben häufiger Verbundlösungen an als Alters- und Pflegeheime. Die Formen der Zusammenarbeit werden allgemein eher situativ und punktuell entwickelt und verfügen selten über durchgängige, organisationsübergreifende Prozesse. Entsprechend uneinheitlich ist das Bild bezüglich der im Rahmen von Verbundlösungen gebildeten Partnerkonstellationen und Angebotspaletten. In der vorliegenden Broschüre werden im Überblick die Resultate präsentiert und Schlussfolgerungen aus Sicht der stationären und ambulanten Pflegedienstleister dargestellt.
3 Einleitung 3 Verbundlösungen sind wir bereit? Die Gesundheitsversorgung in der Schweiz ist im Umbruch. Tiefgreifende Veränderungen verlangen nach neuen Lösungsansätzen auch für die Pflege und Betreuung im Altersbereich tritt die neue Pflegefinanzierung in Kraft und ab 2012 werden im Rahmen der neuen Spitalfinanzierung in den Spitälern tarifwirksame Fallpauschalen eingeführt. Die parlamentarischen Kammern diskutieren die flächendeckende Einführung von Managed-Care-Modellen und in allen Bereichen des Gesundheitswesens wächst der Kostendruck. Die zunehmende Alterung der Bevölkerung stellt die Leistungserbringer von Pflege und Betreuung vor grosse Herausforderungen. Für deren Bewältigung setzt man in der öffentlichen Diskussion wie auch in Fachkreisen auf verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Leistungserbringern. Man erhofft sich von gemeinsamen Projekten, Kooperationen, Fusionen und anderen Formen der Zusammenarbeit, hier unter dem Begriff «Verbundlösungen» subsumiert, Vorteile auf Struktur-, Prozessund Ergebnisebene auch für die Pflege und Betreuung im Altersbereich. Auf der strukturellen Ebene können Synergien erzielt werden, indem gemeinsam Infrastruktur genutzt und Fachstellen eingerichtet werden. Letzteres erlaubt eine bessere Abdeckung des zunehmenden Bedarfs an spezialisierten Dienstleistungen, beispielsweise in den Bereichen der Palliative Care, Demenzbetreuung, Onkologie, Psychiatrie oder der präventiven Beratung. Werden Leistungen im Verbund angeboten, hat das auf der Prozessebene nicht nur betriebliche Vorteile, sondern auch Vorteile für den Endkunden, den alten Menschen, der sich nicht mehr alleine durch den «Dschungel» der Angebote organisieren muss. Es muss davon ausgegangen werden, dass in Zukunft neue Anforderungen auf die Betreuungsinstitutionen zukommen. Patienten werden früher mit rehabilitativen Massnahmen und ambulanter Unterstützung aus den Spitälern wieder nach Hause entlassen oder kommen je nach Gesundheitszustand und familiärer Situation vorübergehend ins Pflegeheim. Das wird zu höheren Anforderungen an die Pflegefachkräfte führen. Durch die Koordination von Behandlungsprozessen und die Definition von Schnittstellen innerhalb eines Verbunds wiederum könnten Abläufe verbessert und vereinfacht werden. Das erscheint nicht nur mit Blick auf die Kosten sinnvoll, sondern kommt auch den Bedürfnissen der alten Menschen entgegen. So viel zur Theorie. Doch wie ist die Praxis im Altersbereich für die kommenden Herausforderungen gerüstet? Welche und wie viele ambulante und stationäre Leistungserbringer haben Verbundlösungen bereits umgesetzt oder planen deren Umsetzung? Wie sehen die Zusammenarbeitsformen aus und mit welchen Angeboten warten sie auf? Haben sich in der Praxis bereits typische Verbundlösungen etabliert? Diesen Fragen geht die Studie «Verbundlösung für die Pflege und Betreuung im Altersbereich» nach, die von der Age Stiftung und Curaviva Schweiz in Kooperation mit dem Spitex Verband Schweiz in Auftrag gegeben und vom Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie durchgeführt wurde. Age Stiftung Andreas Sidler Bereichsleiter Forschung und Wissensvermittlung
4 4 Studie Verbundlösungen für die Pflege und Betreuung im Altersbereich Eine Studie von der Age Stiftung und Curaviva Schweiz in Kooperation mit dem Spitex Verband Schweiz durchgeführt vom Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie. Autoren der Studie: Daniel Imhof, Sylvia De Boni und Holger Auerbach Im Gesundheitswesen ist ein genereller Trend zur integrierten Versorgung zu erkennen. Integrierte Versorgung bedeutet die organisierte Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure auf struktureller und prozessualer Ebene. Auch in der Pflege und Betreuung im Altersbereich lässt sich dieser Trend ausmachen. Für die Schweiz wurden bisher noch keine Informationen über die Anzahl und Art der Zusammenarbeitsformen, in dieser Studie Verbundlösungen genannt, systematisch gesammelt und aufbereitet. Die hier vorgestellte Studie gibt Aufschluss über Quantität und Qualität von Verbundlösungen im Bereich Pflege und Betreuung im Altersbereich in der Deutschschweiz. Vorgehensweise und Methodik In einer ersten Studienphase wurden Erkenntnisse über Verbundlösungen in Theorie (wissenschaftliche Untersuchungen) und Praxis (Berichte von Praxisbeispielen) gesammelt und zusammengefasst. Daraus abgeleitet konnte der Begriff Verbundlösung in einer Arbeitsdefinition festgelegt werden. Die Zusammenarbeit/Kooperation kann zwischen zwei oder Begriffsdefinition «Verbundlösungen»: institutionsübergreifende Zusammenarbeit für die Leistungserbringung gegenüber Patienten/Klienten/Bewohnern in Pflege, Betreuung und/ oder Hauswirtschaft im Altersbereich. mehreren Akteuren aus denselben oder unterschiedlichen Versorgungsgebieten erfolgen. Befinden sich die Akteure im selben Versorgungsgebiet, spricht man von einer horizontalen Integration. Das ist (wie in Grafik 1 ersichtlich) beispielsweise in der Zusammenarbeit zwischen drei Altersheimen der Fall. Bei der Zusammenarbeit von zwei oder mehr in der Versorgungskette vor- bzw. nachgelagerten Akteuren spricht man von einer vertikalen Integration, beispielsweise, wie in Grafik 1 eingezeichnet, bei der Zusammenarbeit zwischen einem Akutspital und einer Spitex-Organisation. In Zusammenarbeit mit Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen wurde ein Kriterienkatalog und daraus abgeleitet ein Fragebogen entwickelt. Mit 26 Kriterien wurden die Merkmale der teilnehmenden Organisationen sowie die Ausprägungen von Verbundlösungen erfasst. Der Fragebogen wurde in elektronischer Form an rund 1100 Alters- und Pflegeheime (Mitglieder Curaviva) und an ca. 500 Spitex-Organisationen in der Deutschschweiz versandt. Die teilnehmenden Organisationen mussten jeweils ihren Organisationstyp angeben «Spitex», «Heim» oder «Zentrum», wobei ein Zentrum eine Organisation ist, die sowohl Spitex als auch Heim(e) unter einem Dach vereint. Die Organisationen konnten an der Umfrage teilnehmen unabhängig davon, ob sie an einer Verbundlösung beteiligt sind oder nicht. Die Antworten wurden statistisch (deskriptiv) ausgewertet und interpretiert. Mittels einer Clusteranalyse wurde nach Mustern und Gruppierungen in den Daten gesucht.
5 5 Mögliche Akteure der Pflege und Betreuung im Altersbereich Grafik 1 Stationäre Akteure Akutspital Ambulante Akteure Langzeitbereich Rehabilitation/Kur 2 Tagesstätten/-kliniken Betreutes Wohnen Pflegeheim 1 Altersheim Übergangspflege Psychogeriatrie Therapeuten Hausarzt Präventive Hausbesuche Domizilbereich Spitex Private Pflegedienste Ferienbett Verbundlösungen Angehörige Vereine Zentrale Anlaufstelle Gemeinden Kirchliche Institutionen Mittagstisch SRK Mahlzeitendienst Apotheken Sonstige Akteure 1 horizontale Integration 2 vertikale Integration
6 6 Studie Resultate Begrifflichkeiten Der vom Projektteam eingeführte Begriff «Verbundlösung» ist in der gängigen Praxis kaum in Verwendung. Im ersten Teil der Studie wurden verschiedene Praxisbeispiele einer Dokumentenanalyse unterzogen. Es zeigt sich, dass in der Praxis, anstelle von «Verbundlösung», folgende Begriffe verwendet werden: 1. Vernetzung/Netzwerk/Versorgungsnetze sowie Koordination (koordiniert) werden häufig verwendet 2. Integrierte Versorgung/Integration sowie Zusammenarbeit/Zusammenfassung/Zusammenlegung werden auch verwendet 3. Kooperation, Ganzheitlichkeit, Verbund, Austausch, Drehscheibe, Hilfe aus einer Hand sowie sektoren- und fachübergreifende Versorgung werden eher selten verwendet In der quantitativen Befragung der Heime und Spitex-Organisationen zeigt sich ein etwas anderes Bild. Hier fallen besonders die Begriffe «Zusammenarbeit» und «Kooperation» als gebräuchlich auf. Die mit diesen Begriffen bezeichnete Sache weist eine grosse Heterogenität hinsichtlich beteiligter Kooperationspartner, gemeinsam erbrachter Leistungen, Zusammenarbeitsform und -intensität auf. Typologien/Ausprägungen Bei der elektronischen Befragung nahmen von insgesamt 1654 angeschriebenen Organisationen 471 teil. 201 Organisationen haben mindestens eine Verbundlösung eingetragen. Insgesamt wurden 230 Verbundlösungen registriert (pro Organisation konnten maximal 3 Verbundlösungen eingetragen werden). Siehe Grafik 2. Die Resultate werden jeweils für die einzelnen Organisationstypen (Heim, Spitex, Zentrum) getrennt dargestellt. Die folgenden Angaben beziehen sich auf jene Organisationen, die sich an der Befragung beteiligten. Zentren und Spitex-Organisationen schliessen sich häufiger in Verbundlösungen zusammen als Heime. Die Spitex-Organisationen sowie die Zentren sind in 60% respektive 68% an Verbundlösungen beteiligt, die Heime zu einem Drittel (siehe nebenstehende Grafik 3). Es sind tendenziell die grösseren Organisationen, die sich zu einer Verbundlösung zusammenschliessen. Anders als erwartet schliessen sich die privatrechtlich gewinnorientierten Organisationen seltener zu Verbundlösungen zusammen als gemeinnützige Organisationen. Über die geographische Verteilung der Verbundlösungen kann aufgrund der Beteiligungen der Organisationen keine eindeutige Aussage gemacht werden. Kooperationspartner Die erfassten Verbundlösungen sind meistens bilaterale Kooperationen. Verbundlösungen, in denen mehr als zwei Partner zusammenarbeiten, sind seltener. Bei den Spitex-Organisationen ist eine Tendenz zur horizontalen Integration feststellbar: Als Kooperationspartner treten bei Spitex-Organisationen häufig ebenfalls Spitex-Organisationen auf. Das ist beinahe bei jeder dritten Verbundlösung mit Spitex-Beteiligung der Fall (31%). Ähnliches, wenn auch weniger ausgeprägt, lässt sich bei den Heimen feststellen. Auch sie kooperieren häufig mit ihresgleichen, nämlich bei jeder fünften Verbundlösung mit Heimbeteiligung (20%). Neben der horizontal integrierten Form gibt es auch zahlreiche vertikal integrierte Zusammenarbeitsformen (siehe Tabelle 1). Sehr oft zählen Spitex-Organisationen zu den Kooperationspartnern der Heime und umgekehrt. Als weitere wichtige Koopera-
7 7 Rücklauf Grafik 2 Verbreitung von Verbundlösungen Grafik 3 Angeschriebene Organisationen 1654 Teilnehmende Organisationen 471 Organisationen mit mind. 1 Verbundlösung 201 Heim Total % 67% Spitex Total % 40% Zentren Total 37 68% 32% Eingetragene Verbundlösungen 230 mit Verbundlösungen ohne Verbundlösungen Häufigste Kooperationspartner in vertikal integrierten Verbundlösungen Tabelle 1 Heime Spitex Zentren 1 Spitex/andere ambulante Pflegedienste 34 % Alters- und/oder Pflegeheim 32 % Freiwillige/Angehörige 69 % 2 Anbieter von Mittagstischen / Mahlzeitendiensten 29 % Anbieter von Mittagstischen / Mahlzeitendiensten 27 % Institution mit Alterswohnungen / für betreutes bzw. begleitetes Wohnen 58 % 3 Freiwillige / Angehörige 28 % Spital/Klinik 26 % Anbieter von Mittagstischen / Mahlzeitendiensten 50 % 4 Institution mit Alterswohnungen / für betreutes bzw. begleitetes Wohnen 26 % Karitative und ähnliche Hilfsorganisationen (z.b. SRK, Pro Senectute, kirchliche Institutionen) 25 % Zentrale Anlauf-/Abklärungs-/ Entscheidungsstelle / Drehscheibe 39 % 5 Grundversorger (Arzt inkl. Ärztenetze mit u. a. Grundversorgern) 22 % Freiwillige/Angehörige 25 % Sozialamt / andere Gemeindebehörden 39 % n = 119 n = 85 n = 26 Bemerkung: Mehrfachnennungen waren möglich
8 8 Bemerkung Tabelle 2 und 3: Mehrfachnennungen waren möglich Die häufigsten Leistungen von Verbundlösungen Tabelle 2 Heime Spitex Zentren 1 Grund-/Behandlungspflege 40 % Grund-/Behandlungspflege 64 % Grund-/Behandlungspflege 85 % 2 Übergangs-/Kurzzeit-/Ferienpflege 32 % Haushaltpflege/Haushalthilfe 55 % Haushaltpflege/Haushalthilfe 77 % 3 Therapien/Aktivitäten (Ergo-/Physio-/Aktivierungstherapie, Animation, Altersturnen) 32 % Betreuung/Begleitung Sterbender und deren Angehöriger 4 Haushaltpflege/Haushalthilfe 30 % Beratung (z.b. Angehörigen-/Sozial-/ Präventions-/Ernährungs-/Diabetes-/ Finanz-/Rechtsberatung) 53 % Übergangs-/Kurzzeit-/Ferienpflege 77 % 38 % Alterswohnungen/betreutes Wohnen/ begleitetes Wohnen 5 24-h-Dienst/Notruf/Nachtwachen 31 % Mobilität/Fahrdienste/Reisebegleitung 69 % 6 Betreuung/Begleitung Sterbender und deren Angehöriger 7 Tagesbetreuung/Entlastungsangebote für pflegerische Angehörige 8 24-h-Dienst/Notruf/Nachtwachen 58 % 69 % 65 % 62 % 9 Ergänzende Dienstleistungen (z.b. Fuss-/ Handpflege, Coiffeur, Hilfsmittelverleih) 10 Freie Arztwahl (z.b. keinen vorgeschriebenen Heimarzt) n = 119 n = 85 n = % 58 % Die häufigsten Spezialisierungen von Verbundlösungen Tabelle 3 Heime Spitex Zentren 1 Betreuung von Menschen mit Demenz 35 % Palliative Care 38 % Betreuung von Menschen mit Demenz 69 % 2 Palliative Care 25 % Onkologie 28 % Palliative Care 62 % 3 Psychiatrische und /oder psychogeriatrische Betreuung 21 % Betreuung von Menschen mit Demenz 26 % Psychiatrische und /oder psychogeriatrische Betreuung n = 119 n = 85 n = % Prozessdefinitionen in Verbundlösungen Tabelle 4 Heime Spitex Zentren Keine Prozesse definieren oder nur innerhalb einer Institution 63 % 65 % 42 % Prozesse mit einigen oder allen Institutionen definiert 25 % 24 % 58 % Nicht bekannt 12 % 11 % 0 % Total 100 % n = % n = % n = 26
9 Studie tionspartner treten Freiwillige/ Angehörige sowie Anbieter von Mittagstischen/Mahlzeitendiensten auf. Leistungen Viele Verbundlösungen haben ein beschränktes Leistungsangebot. Oft wird nur eine bestimmte Leistung im Rahmen der Zusammenarbeit erbracht. Die häufigsten Leistungen von Spitex-Organisationen, Heimen und Zentren, die in den Verbundlösungen gemeinsam erbracht werden, sind: Grund- und Behandlungspflege, Hauspflege/Haushilfe sowie Übergangspflege/Kurzzeitpflege/Ferienpflege. In der Tabelle 2 werden die häufigsten Leistungsangebote dargestellt. Oft werden Verbundlösungen auch genutzt, um spezialisierte Dienstleistungen anzubieten, am häufigsten die Betreuung von Menschen mit Demenz und Palliative Care. In der Tabelle 3 werden die häufigsten Spezialisierungen dargestellt Formalisierungsgrad Gesamthaft basieren Verbundlösungen überwiegend auf vertraglichen Zusammenarbeitsformen oder auf der Rechtsform einer einfachen Gesellschaft, eines Vereins oder einer Stiftung. Dabei werden meist keine durchgängigen Prozesse definiert. Die Schnittstellen sind mehrheitlich individuell, punktuell und situativ ausgestaltet. Die gemeinsame interne und externe Kommunikation sowie die gemeinsam erbrachten Supportdienste (z.b. Administration, Aus- und Weiterbildung, Marketing) sind bei Zentren stärker ausgeprägt als bei Heimen und Spitex-Organisationen. Die Verbundlösungen von Heimen und Spitex-Organisationen haben eher einen in formellen Charakter. In der Tabelle 4 werden die Ausprägungen der Prozessdefinition dargestellt. Clusterung Mittels einer Clusteranalyse wurden Verbundlösungsgruppen mit ähnlichen Eigenschaften gesucht (Cluster). Insgesamt haben sich sieben «schwache» Cluster ergeben, die sich in bestimmten Bereichen ähnlicher sind als die Verbundlösungen in andern Clustern. Die Ähnlichkeit in diesen Gruppen ist jedoch nicht sehr ausgeprägt. Daraus lässt sich schliessen, dass die erfassten Verbundlösungen kaum vergleichbar sind in Bezug auf beteiligte Kooperationspartner, gemeinsam erbrachte Leistungen, Zusammenarbeitsform und -intensität. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal bei den Verbundlösungen ist, welche der drei Organisationstypen «Spitex», «Heim» oder «Zentrum» die Verbundlösung eingetragen hat. Danach sind die Gemeinsamkeiten in den Gruppen und die Unterschiede zwischen den Gruppen wenig ausgeprägt. Im Folgenden werden die grössten drei identifizierten Verbund lösungsgruppen umschrieben: «Die stationäre Minimallösung» 81 Verbundlösungen fallen in diesen grössten Cluster. Sie charakterisieren sich dadurch, dass sie vorwiegend durch Heime eingetragen wurden (91,4%), die häufig mit ihresgleichen und eher selten mit Spitex-Organisationen eine Kooperation eingehen und häufig nur an einer oder wenigen Verbundlösungen beteiligt sind. Zudem werden in diesen Verbundlösungen nur wenige Dienstleistungen und Spezialisierungen angeboten. «Die ambulante Minimallösung» Dieser zweitgrösste Cluster wird durch 60 Verbundlösungen vertreten. Die eintragenden Organisationen sind hauptsächlich Spitex-Organisationen (95%), welche nur in wenigen Fällen Kooperationen mit Heimen eingehen. Tendenziell bieten sie wenige Dienstleistungen in den Verbundlösungen an, rund die Hälfte betreibt jedoch Spezialisierungen. Die Organisationen, welche diese Verbundlösungen eingetragen haben, sind meist nur an dieser oder nur an wenigen anderen Verbundlösungen beteiligt. «Die Breitgefächerten» Mit 38 Verbundlösungen ist dies der drittgrösste Cluster. Er wird zu 50% durch Heime und je einem Viertel durch die Spitex und die Zentren repräsentiert. Diese Gruppe zeichnet sich dadurch aus, dass in jeweils ca. zwei Dritteln der Verbundlösungen mehrere Dienstleistungen gemeinsam erbracht werden. Zudem werden innerhalb dieser Verbundlösungen eine oder mehrere Spezialisierungen erbracht. Die Organisationen, welche diese Verbundlösungen eingetragen haben, sind meist nur an dieser oder nur an wenigen anderen Verbundlösungen beteiligt. Schlussfolgerungen Die Studie zeigt, dass die verwendeten Begriffe im Zusammenhang von integrierter Versorgung und Zusammenarbeit nicht einheitlich gebraucht und verstanden werden. Die Deutschschweizer Heime und Spitex-Organisationen streben durchaus Verbundlösungen an, jedoch noch zaghaft, eher unstrukturiert und in kleinem Umfang. In den meisten Fällen wird eine Kooperation zweier «gleicher» Akteure zur Erbringung einer gemeinsamen Dienstleistung auf Vertragsbasis eingegangen. Komplexe Verbundlösungen zwischen mehreren Leistungserbringern entlang der Behandlungspfade sind die Ausnahme. Es besteht ein hohes Potenzial zur Bildung und Förderung von Verbundlösungen. Insbesondere kleine, ländliche Heime haben einen grossen Nachholbedarf. Supportdienste, beispielsweise administrative Tätigkeiten oder die Nutzung von Infrastruktur, sollten aus betriebswirtschaftlicher Sicht vermehrt gemeinsam und institutionsübergreifend erbracht bzw. genutzt werden. Die Schnittstellen zwischen den Organisationen sollten besser abgestimmt und koordiniert werden. Viele Verbundlösungen sind informell geregelt. Um die Nachhaltigkeit der Angebote zu gewährleisten, sollte die Zusammenarbeit im Bereich Betreuung und Pflege zunehmend in gefestigte rechtliche und organisatorische Strukturen überführt werden. Der Begriff «Verbundlösung» sollte im Bereich Pflege und Betreuung einen festen Platz erhalten und im täglichen Gebrauch sowie in weiteren Studien in Anwendung kommen. Zudem sollte definiert werden, was gute Verbundlösungen sind und wie diese beschrieben werden können. Entsprechend wird die durchgeführte Studie als ein wichtiger erster Schritt im Sinne einer Auslegeordnung verstanden. Allerdings sind vermehrt Anstrengungen der Leistungserbringer bei der Realisierung von Verbundlösungen zu erbringen dies wird zukünftig auch verstärkt von Seiten der Patienten, Klienten und Kostenträger gefordert werden.
10 10 Kommentar zur Studie CURAVIVA Schweiz Dr. Markus Leser Leiter Fachbereich Menschen im Alter Verbundlösungen oder integrierte Versorgungsansätze liegen im Trend. Der vorliegende Bericht zeigt aus Sicht des Fachbereichs Alter klar auf, dass sich hierzu allmählich verschiedene Ansätze herauskristallisieren. Die gesamte Versorgungskette von ambulant bis stationär ist für alle Anbieter wichtiger geworden, nicht zuletzt aufgrund der vorherrschenden Kostendiskussion im Gesundheitswesen. Auch die Kundinnen und Kunden der Anbieter sind anspruchsvoller geworden und fordern immer wieder Dienstleistungen und Serviceangebote aus einer Hand. So verwundert es nicht, wenn sich immer mehr Anbieter im ambulanten wie im stationären Bereich in der einen oder anderen Form zusammen schliessen und Verbünde oder entsprechende Kooperationen bilden. Dies kann im Rahmen des Angebotes geschehen oder aber auch im Rahmen brancheninterner Verbünde wie z.b. Ausbildungsverbünden. Verbundlösungen als Perspektive Curaviva Schweiz befürwortet solche Kooperationen und Zusammenarbeitsformen. Zum einen verhindert es das Denken in «Entweder-oder-Kategorien» wie ambulant oder stationär und zum anderen gibt es die Möglichkeit zur Synergiennutzung und damit auch zur Kostenoptimierung. Unabhängig von den Kosten sollten die Kunden jedoch künftig auf der gesamten Versorgungskette von ambulant bis stationär die Möglichkeit haben, das für sie geeignete Angebot auszuwählen, am besten wie oben erwähnt aus einer Hand, von einer Ansprechperson. Dies entspricht klar einer Vereinfachung und Überschaubarkeit des gesamten Angebotes. Zusammenarbeit ja aber Nun kommt das «Aber». Trotz dieser positiven Signale haben wir im Gesundheitswesen noch immer zu viele Einzelkämpfer, getreu nach dem Motto: jeder gegen jeden. Synergien werden, aus welchen Gründen auch immer, noch zu wenig genutzt. Es gibt nicht wenige Beispiele, die zeigen, wie mehrere Heime in einem engen Umkreis das exakt gleiche Angebot bereithalten. Kosten hin oder her. Die Diskussion um das «Möglichst-langein-den-eigenen-vier-Wändenwohnen-wollen» führt nicht selten dazu, dass ambulante gegen stationäre Angebote und umgekehrt gegeneinander ausgespielt werden. Verbundlösungen oder Ansätze der integrierten Versorgung betonen das Gemeinsame und nicht das Trennende. Auffallend ist weiterhin, dass in Diskussionen grundsätzlich niemand etwas gegen solche Lösungsansätze hat, jedoch sind im zweiten Teil des Satzes dem ABER relativ schnell eine Reihe von Gründen parat, warum es gerade in dieser oder jener Situation ein Sonderfall ist und deshalb der Alleingang einer Verbundlösung vorzuziehen ist. Es erstaunt zumindest, dass wir uns trotz vielerlei Klagen über die (zu hohen) Kosten noch immer sehr viele «Sonderfälle» leisten (können oder wollen). Wie es weitergeht Der vorliegende Bericht bildet die Grundlage für weitere Abklärungsarbeiten im Fachbereich Alter. Im Rahmen einer Resonanzgruppe mit Verantwortlichen aus dem Heimbereich werden wir bis ca. Ende 2010 der Frage nachgehen, was eine «gute Verbundlösung» ist und wie sich eine solche planen und umsetzen lässt. Auch wird es nötig sein, den Begriff zu klären und im Sinne dieses Berichtes «salonfähig» zu machen. Noch gibt es zu viele verschiedene Begriffe, die Ähnliches meinen, es aber unterschiedlich benennen. Die Verwirrung, die dabei entstehen kann, ist mitunter gross, selbst unter Fachpersonen und ganz zu schweigen von den Kunden und ihren Angehörigen. Nicht zuletzt auch deshalb sollte es uns gelingen im Sinne eines eigenständigen Markennamens hier Klarheit zu schaffen. Ansätze für funktionierende Verbundlösungen gibt es einige. Beispiele hierzu finden sich auch in der vorliegenden Studie. Damit sich diese Ansätze weiterentwickeln können, wird der Fachbereich Alter von CURAVIVA Schweiz entsprechende Handlungsansätze und Empfehlungen für die Heimbranche entwickeln. Curaviva Schweiz Dr. Markus Leser
11 11 Spitex Verband Schweiz In der Spitex-Strategie 2015 sind die horizontale und vertikale Vernetzung der Behandlungskette sowie die Koordination der Schnittstellen zwischen den Leistungserbringern erklärte Ziele. Die vorliegende Studie ist eine Bestandesaufnahme der vorhandenen Vernetzungsbestrebungen der Heime und der Spitex in der Deutschschweiz sowie der Versuch, diese Bestrebungen zu gruppieren. Gibt es typische Konstellationen von Kooperationen in der Spitex? Die Vernetzung der Leistungserbringer entlang der Behandlungskette (eine Behandlungskette könnte beispielsweise sein: Spital, Hausarzt, Spitex, Heim) ist ein wichtiges Anliegen des Spitex Verbands Schweiz. Deshalb hat der Verband die Ergebnisse der vorliegenden Studie mit Interesse erwartet. Die Spitex-Organisationen in Verbundlösungen Die Mehrheit (60%) der Spitex- Organisationen, die an der Studie teilgenommen haben, ist an mindestens einer Verbundlösung beteiligt. In dieser Verbundlösung werden in vielen Fällen eine oder zwei spezifische Leistungen gemeinsam erbracht. Die Verbundlösung ist oft eine informelle Abmachung zwischen zwei Akteuren und hat kaum strukturierte Prozesse. Häufigster Verbundpartner der Spitex sind andere Spitex-Organisationen, d.h., sie sind meist horizontal vernetzt. Die gemeinsam erbrachten Leistungen sind in der Mehrheit Spitex-Grundleistungen (Grundund Behandlungspflege sowie Hauspflege/Haushalthilfe). Die häufigste Spezialisierung, die bei Verbundlösungen mit Spitex-Beteiligung genannt wurde, ist die Betreuung und Begleitung Sterbender und deren Angehöriger respektive Palliative Care. Verbundlösungen in der Entwicklungsphase Es ist erfreulich, dass sich die Mehrheit der Spitex-Organisationen an Verbundlösungen beteiligt. Aber die Verbünde sind bescheiden ausgeprägt. Verbundlösungen, die sich an der Behandlungskette orientieren und mehrere Leistungserbringer und Leistungen koordiniert verbinden, sind die Ausnahme. Dieses Ergebnis überrascht aber kaum, denn solange es keine finanziellen Anreize zur Vernetzung gibt, wird sich kaum eine Musterform der Zusammenarbeit herausbilden, und die Bestrebungen bleiben punktuell. Dass sich noch keine typische Verbundlösung durchgesetzt hat, wird durch die Gruppenbildung mittels statistischer Analyse noch unterstrichen. In der Studie werden sieben Gruppierungen sogenannte Cluster unterschieden (die drei grössten werden in dieser Broschüre beschrieben). Die Cluster sind jedoch nur schwach ausgebildet und eher heterogen. Ein Zeichen dafür, dass sich die Vernetzungsbestrebungen in der Entwicklungsphase befinden und sich noch kein Standard durchgesetzt hat. In dieser Entwicklungsphase müssen in einem ersten Schritt neben der Frage der Finanzierung auch Fragen zum Ziel der Vernetzung gestellt und beantwortet werden. Wer kommt für den zusätzlichen Koordinationsaufwand der Vernetzung auf, welches sind die richtigen Kooperationspartner der Spitex und für welche Leistungen? In der Studie ist der häufigste Kooperationspartner der Spitex eine andere Spitex-Organisation. Ist das ein Zeichen dafür, dass sich die Spitex vertieft horizontal vernetzt, oder handelt es sich dabei um eine Vorstufe zum Zusammenschluss zu grösseren Organisationen? Die Spitex-Statistik zeigt, dass sich seit 1997 die Anzahl der Organisationen um ca. 40% verringert hat (1997: ca. 1000, 2008: 604). Die Klientinnen und Klienten sowie das Personal der Spitex-Organisationen haben im gleichen Zeitraum um 6 bis 7% zugenommen. Die Grösse von Spitex-Organisationen ist aber nur eine Möglichkeit, auf die zunehmenden Herausforderungen wie 24-h- Dienst während 7 Tagen in der Woche, Akut- und Übergangspflege oder spezialisierte Pflegeleistungen zu reagieren. Die Vernetzung mit anderen Spitex- Organisationen und weiteren Leistungserbringern entlang der Behandlungskette ist eine andere Möglichkeit. Erste Ansätze und viel Potential Die Studie hat gezeigt, dass für die Spitex Verbünde und Kooperationen mit anderen Akteuren im Gesundheitswesen keine Seltenheit sind. Dennoch besteht noch grosses Potenzial für Weiterentwicklung respektive Vertiefung der bestehenden Kooperationen oder für das Eingehen von neuen Verbünden. Betrachtet man nur die geplanten Verbundlösungen, so zeigt sich bei der Spitex ein Trend hin zur Verbesserung der Schnittstellen zu anderen Leistungserbringern und zur Schaffung von gemeinsamen Anlaufstellen. Vor dem Hintergrund der Einführung der Fallpauschalen (DRGs) und der neuen Pflegefinanzierung sind das Schritte in die richtige Richtung. Diese Schritte müssen nun konsequent umgesetzt werden, damit die Spitex die Herausforderungen weiterhin gut bewältigen kann. Spitex Verband Schweiz Dominik Hadorn Dominik Hadorn Wissenschaftlicher Mitarbeiter Qualität/eHealth
12 Ausblick Impressum Verbundlösungen ein Ausblick Die Resultate bisheriger Vernetzungsbemühungen im Bereich der Pflege im Alter sind noch nicht bahnbrechend, aber durchaus ermutigend. Bereits haben sich eine beachtliche Anzahl stationärer und ambulanter Leistungsanbieter von Betreuung und Pflege in Verbundlösungen zusammengefunden. Diese Organisationen begegnen den Herausforderungen eines sich ständig verändernden Gesundheitssystems und einer zunehmend älteren Bevölkerung proaktiv und nicht reaktiv. Verbundlösungen als zukunftsweisende Option sind keine graue Theorie mehr, sondern bereits heute Zielvorgaben im Feld der Praxis. Die Studie zeigt aber auch, dass trotz vielversprechenden Beispielen noch viel Entwicklungspotential vorhanden und Überzeugungsarbeit zu leisten ist. Organisationsübergreifende Strukturen müssen geschaffen sowie klare Schnittstellen und Prozesse definiert werden. Das erfordert den Mut, aufeinander zuzugehen, um gemeinsame und verbindliche Ziele auszuhandeln und festzulegen. Auch die Verbände sehen sich in der Pflicht: Curaviva Schweiz hat sich für 2010 das Thema «Verbundlösungen» als Schwerpunkt gesetzt und wird gemeinsam mit Verantwortlichen aus dem Heimbereich eruieren, wie sich gute Verbundlösungen planen und umsetzen lassen. Der Spitex Verband Schweiz hat die horizontale und vertikale Vernetzung der Behandlungskette sowie die Koordination der Schnittstellen zwischen den Leistungserbringern in die Spitex-Strategie 2015 integriert. Dass sich beide Verbände partnerschaftlich für die vorliegende Studie engagieren, steht für das Bewusstsein, dass man sich über bisherige Grenzen hinweg für gemeinsame Lösungen einsetzen muss. Die Beteiligung der Age Stiftung an der Erarbeitung dieser Studie hat damit zu tun, wie sie Wohnen im Alter definiert. Damit vielfältige und gute Wohnmöglichkeiten für alte Menschen bestehen, ist es wichtig, dass die Vernetzung unter den Dienstleistern gut ist. Alte Menschen, die körperlich fragil werden, brauchen ein flexibles und durchlässiges Betreuungs- und Pflegeangebot idealerweise aus einer Hand, wenn die privaten Ressourcen optimal unterstützt werden sollen. Die in der Studie dokumentierten ersten Schritte zeigen auf, dass noch viele weitere notwendig sind nicht nur in der Praxis, sondern auch in der Forschung. So ist es zum Beispiel wichtig zu erkennen, welche Faktoren das Zustandekommen von Verbundlösungen begünstigen und welche Massnahmen diese Kooperationen nachhaltig sichern. In Anbetracht der allgemein herrschenden Maxime «ambulant vor stationär» werden wir nicht darum herumkommen, den positiven Effekten, die sich durch Verbundlösungen ergeben, noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Denn angesichts der demographischen Veränderungen sind die Aufgaben klar die Lösungswege müssen noch gefunden werden. Age Stiftung Andreas Sidler Bereichsleiter Forschung und Wissensvermittlung Kommentierte Zusammenfassung der Studie «Verbundlösungen für die Pflege und Betreuung im Altersbereich» Eine Studie der Age Stiftung und von Curaviva Schweiz in Kooperation mit dem Spitex Verband Schweiz. Durchgeführt vom Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie. Redaktion: Andreas Sidler, Age Stiftung Mitarbeit: Holger Auerbach und Sylvia De Boni, Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie; Markus Leser, Curaviva Verband Heime und Institutionen Schweiz; Dominik Hadorn, Spitex Verband Schweiz Gestaltung: medialink, Zürich Druck: Zofinger Tagblatt AG Age Stiftung, 2010 Die vollständige Studie sowie diese Broschüre stehen zum kostenlosen Download bereit
Verbundlösungen für die Pflege und Betreuung im Altersbereich
 Manual Version 3.0 Wissenschaftliche Studie Verbundlösungen für die Pflege und Betreuung im Altersbereich Hotline: Tel. 058 934 68 88 Email: daniel.imhof@zhaw.ch Tel. 058 934 78 98 Email: sylvia.deboni@zhaw.ch
Manual Version 3.0 Wissenschaftliche Studie Verbundlösungen für die Pflege und Betreuung im Altersbereich Hotline: Tel. 058 934 68 88 Email: daniel.imhof@zhaw.ch Tel. 058 934 78 98 Email: sylvia.deboni@zhaw.ch
Projekt daheim. Projektgruppe Umsetzung integrierte Versorgung im Alter. Präsentation Veranstaltung Gesundes Freiamt vom 30. März 2016 Th.
 Projekt daheim Projektgruppe Umsetzung integrierte Versorgung im Alter Präsentation Veranstaltung Gesundes Freiamt vom 30. März 2016 Th. Wernli Aktuelle Situation Überangebot in der Region. Die prognostizierten
Projekt daheim Projektgruppe Umsetzung integrierte Versorgung im Alter Präsentation Veranstaltung Gesundes Freiamt vom 30. März 2016 Th. Wernli Aktuelle Situation Überangebot in der Region. Die prognostizierten
Älter werden in Münchenstein. Leitbild der Gemeinde Münchenstein
 Älter werden in Münchenstein Leitbild der Gemeinde Münchenstein Seniorinnen und Senioren haben heute vielfältige Zukunftsperspektiven. Sie leben länger als Männer und Frauen in früheren Generationen und
Älter werden in Münchenstein Leitbild der Gemeinde Münchenstein Seniorinnen und Senioren haben heute vielfältige Zukunftsperspektiven. Sie leben länger als Männer und Frauen in früheren Generationen und
Checkliste Palliative Care in der Gemeinde
 Checkliste Palliative Care in der Gemeinde Schritt 1: Personen/ Organisationen Alle Personen und Organisationen die in der Gemeinde in einer palliativen Situation zum Einsatz kommen könnten, sind deklariert.
Checkliste Palliative Care in der Gemeinde Schritt 1: Personen/ Organisationen Alle Personen und Organisationen die in der Gemeinde in einer palliativen Situation zum Einsatz kommen könnten, sind deklariert.
Schnittstellen in der Geriatrie
 Schnittstellen in der Geriatrie Schnittstelle zwischen und Geriatrie Max Moor, Geschäftsleiter Verband Aargau Non-Profit- Schweiz 600 NPO--Organisationen für 26 Kantone 2 000 Mitarbeitende (4 00 Vollzeit-Stellen)
Schnittstellen in der Geriatrie Schnittstelle zwischen und Geriatrie Max Moor, Geschäftsleiter Verband Aargau Non-Profit- Schweiz 600 NPO--Organisationen für 26 Kantone 2 000 Mitarbeitende (4 00 Vollzeit-Stellen)
Praxisbeispiele zu Institutionen mit integrierter Versorgung
 Praxisbeispiele zu en mit integrierter Versorgung 1. Ausgangslage CURAVIVA Schweiz hat im Jahr 2012 das Themendossier «Integrierte Versorgung» veröffentlicht. Darin werden fünf Fallbeispiele für integrierte
Praxisbeispiele zu en mit integrierter Versorgung 1. Ausgangslage CURAVIVA Schweiz hat im Jahr 2012 das Themendossier «Integrierte Versorgung» veröffentlicht. Darin werden fünf Fallbeispiele für integrierte
Das neue Hospiz- und Palliativgesetz, ein Beitrag zur würdevollen Versorgung am Ende des Lebens. Till Hiddemann Bundesministerium für Gesundheit
 Das neue Hospiz- und Palliativgesetz, ein Beitrag zur würdevollen Versorgung am Ende des Lebens Till Hiddemann Bundesministerium für Gesundheit Sterbende Menschen gehören in die Mitte der Gesellschaft
Das neue Hospiz- und Palliativgesetz, ein Beitrag zur würdevollen Versorgung am Ende des Lebens Till Hiddemann Bundesministerium für Gesundheit Sterbende Menschen gehören in die Mitte der Gesellschaft
Befragungszeitraum: Ergebnisse einer deutschlandweiten schriftlichen Befragung von pädiatrischen Diabeteszentren.
 Thema: Kinder mit Typ 1 Diabetes (Alter 10 Jahre) Unterstützende Hilfen in Kindergarten, Schule und Hort. Befragungszeitraum: 23.12.2013 1.3.2014 Ergebnisse einer deutschlandweiten schriftlichen Befragung
Thema: Kinder mit Typ 1 Diabetes (Alter 10 Jahre) Unterstützende Hilfen in Kindergarten, Schule und Hort. Befragungszeitraum: 23.12.2013 1.3.2014 Ergebnisse einer deutschlandweiten schriftlichen Befragung
Nationale Strategie Palliative Care
 Nationale Strategie Palliative Care 1 Warum Palliative Care fördern? Entwicklung der Anzahl Todesfälle in der Schweiz 110'000 100'000 Anzahl Todesfälle pro Jahr 90'000 80'000 70'000 60'000 50'000 Die Betreuung
Nationale Strategie Palliative Care 1 Warum Palliative Care fördern? Entwicklung der Anzahl Todesfälle in der Schweiz 110'000 100'000 Anzahl Todesfälle pro Jahr 90'000 80'000 70'000 60'000 50'000 Die Betreuung
Psychische Gesundheit
 Psychische Gesundheit Margreet Duetz Schmucki Leiterin Sektion Nationale Gesundheitspolitik Bundesamt für Gesundheit OECD-Bericht Mental Health and Work in Switzerland Fokus: Gesundheit und Gesundheitsversorgung
Psychische Gesundheit Margreet Duetz Schmucki Leiterin Sektion Nationale Gesundheitspolitik Bundesamt für Gesundheit OECD-Bericht Mental Health and Work in Switzerland Fokus: Gesundheit und Gesundheitsversorgung
Je mehr die Selbständigkeit und Eigenständigkeit eingeschränkt sind, desto mehr wird auf Angebote zur Unterstützung zurückgegriffen.
 Einleitung Im Laufe des Lebens wandeln sich die Bedürfnisse des Menschen: Während für die Jugend Freizeitaktivitäten und Bildungsangebote im Vordergrund stehen, interessiert sich die erwerbstätige Bevölkerung
Einleitung Im Laufe des Lebens wandeln sich die Bedürfnisse des Menschen: Während für die Jugend Freizeitaktivitäten und Bildungsangebote im Vordergrund stehen, interessiert sich die erwerbstätige Bevölkerung
Projekt Zuhause im Quartier. Das Projekt wird unterstützt aus Mitteln:
 Projekt Zuhause im Quartier Das Projekt wird unterstützt aus Mitteln: 1 Verbundprojekt der Firmen vacances Mobiler Sozial- und Pflegedienst GmbH (Projektmanagement) Bremer Pflegedienst GmbH IPP Bremen,
Projekt Zuhause im Quartier Das Projekt wird unterstützt aus Mitteln: 1 Verbundprojekt der Firmen vacances Mobiler Sozial- und Pflegedienst GmbH (Projektmanagement) Bremer Pflegedienst GmbH IPP Bremen,
Strategie ehealth Schweiz
 Strategie ehealth Schweiz Projekte / Aktivitäten / Services A. Schmid Leiter Geschäftsstelle ehealth Suisse Koordinationsorgan ehealth Bund-Kantone 1 INHALT E-Government ehealth Wer ist ehealth Suisse
Strategie ehealth Schweiz Projekte / Aktivitäten / Services A. Schmid Leiter Geschäftsstelle ehealth Suisse Koordinationsorgan ehealth Bund-Kantone 1 INHALT E-Government ehealth Wer ist ehealth Suisse
Sozialräumliche Versorgungsketten Stark fürs Quartier
 Sozialräumliche Versorgungsketten Stark fürs Quartier 09.06.2016 Dagmar Vogt-Janssen Landeshauptstadt Hannover Fachbereich Senioren Kommunaler Seniorenservice Hannover Lokale Akteure medizinischer und
Sozialräumliche Versorgungsketten Stark fürs Quartier 09.06.2016 Dagmar Vogt-Janssen Landeshauptstadt Hannover Fachbereich Senioren Kommunaler Seniorenservice Hannover Lokale Akteure medizinischer und
Die Österreichische Demenzstrategie und ihre Prognose
 Caritas Pflege, Die Österreichische Demenzstrategie und ihre Prognose Ausgangslage Österreich ca. 115.000 bis 130.000 Menschen mit Demenz bis 2050 Verdoppelung neue Herausforderungen sowohl im Gesundheits-
Caritas Pflege, Die Österreichische Demenzstrategie und ihre Prognose Ausgangslage Österreich ca. 115.000 bis 130.000 Menschen mit Demenz bis 2050 Verdoppelung neue Herausforderungen sowohl im Gesundheits-
Prof. Dr. Sigrid Leitner: BEDARFE UND RESSOURCEN EINER ALTERNDEN GESELLSCHAFT: PERSPEKTIVEN FÜR DIE SOZIALE ARBEIT
 : BEDARFE UND RESSOURCEN EINER ALTERNDEN GESELLSCHAFT: PERSPEKTIVEN FÜR DIE SOZIALE ARBEIT Vortrag im Rahmen der Fachtagung Quartiersorientierung in der stationären Altenhilfe, HS Düsseldorf, 13.11.2015
: BEDARFE UND RESSOURCEN EINER ALTERNDEN GESELLSCHAFT: PERSPEKTIVEN FÜR DIE SOZIALE ARBEIT Vortrag im Rahmen der Fachtagung Quartiersorientierung in der stationären Altenhilfe, HS Düsseldorf, 13.11.2015
Palliative Versorgung in Deutschland was haben wir was brauchen wir.?
 Palliative Versorgung in Deutschland was haben wir was brauchen wir.? Sozialmedizinische Begutachtungsgrundlagen ambulanter palliativer Versorgungsbedarfe Hamburg 20.Mai 2015 Dr. Joan Elisabeth Panke Seniorberaterin
Palliative Versorgung in Deutschland was haben wir was brauchen wir.? Sozialmedizinische Begutachtungsgrundlagen ambulanter palliativer Versorgungsbedarfe Hamburg 20.Mai 2015 Dr. Joan Elisabeth Panke Seniorberaterin
Kernelemente sozialräumlicher und flexibler Unterstützungsangebote. Peter Saurer / Saurer Partner GmbH Bern /
 Kernelemente sozialräumlicher und flexibler Unterstützungsangebote Curaviva-Impulstag Baustelle Sozialraumorientierung: Wo stehen wir? Peter Saurer / Saurer Partner GmbH Bern / www.saurer-partner.ch Ausgangslage
Kernelemente sozialräumlicher und flexibler Unterstützungsangebote Curaviva-Impulstag Baustelle Sozialraumorientierung: Wo stehen wir? Peter Saurer / Saurer Partner GmbH Bern / www.saurer-partner.ch Ausgangslage
Pflege von Angehörigen Welche Entlastungen gibt es? Was können Unternehmen tun? Walburga Dietl,
 Pflege von Angehörigen Welche Entlastungen gibt es? Was können Unternehmen tun? Walburga Dietl, 24.09.2013 Gesellschaftliche Entwicklung Demographische Entwicklung Veränderte Familienstrukturen Zunahme
Pflege von Angehörigen Welche Entlastungen gibt es? Was können Unternehmen tun? Walburga Dietl, 24.09.2013 Gesellschaftliche Entwicklung Demographische Entwicklung Veränderte Familienstrukturen Zunahme
Gesundheitspolitik und Psychotherapie
 Gesundheitspolitik und Psychotherapie 4. Gemeinsamer Kongress der Psy-Verbände: Psychotherapeut/in 2025 Bern, 18. Juni 2011 Übersicht Gesundheitspolitischer Kontext: Megatrend Wandel Blick auf die psychischer
Gesundheitspolitik und Psychotherapie 4. Gemeinsamer Kongress der Psy-Verbände: Psychotherapeut/in 2025 Bern, 18. Juni 2011 Übersicht Gesundheitspolitischer Kontext: Megatrend Wandel Blick auf die psychischer
Freiwillig und unentgeltlich, aber nicht umsonst. Herausforderungen und Perspektiven Bürgerschaftlichen Engagements in Rheinland-Pfalz
 Freiwillig und unentgeltlich, aber nicht umsonst. Herausforderungen und Perspektiven Bürgerschaftlichen Engagements in Rheinland-Pfalz Birger Hartnuß, Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung in der Staatskanzlei
Freiwillig und unentgeltlich, aber nicht umsonst. Herausforderungen und Perspektiven Bürgerschaftlichen Engagements in Rheinland-Pfalz Birger Hartnuß, Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung in der Staatskanzlei
Nachbarschaftshilfe mit dem Zeitvorsorgemodell KISS
 Nachbarschaftshilfe mit dem Zeitvorsorgemodell KISS Ruedi Winkler Aufbau des Referats Ausgangslage Vision Ziele und Zielgruppen von KISS Was macht KISS und was nicht? Merkmale der KISS Zeitvorsorge Grundsätze
Nachbarschaftshilfe mit dem Zeitvorsorgemodell KISS Ruedi Winkler Aufbau des Referats Ausgangslage Vision Ziele und Zielgruppen von KISS Was macht KISS und was nicht? Merkmale der KISS Zeitvorsorge Grundsätze
Strategische Neuausrichtung der stationären und ambulanten Pflege in der Gemeinde Hombrechtikon Alles unter einem Dach
 Strategische Neuausrichtung der stationären und ambulanten Pflege in der Gemeinde Hombrechtikon Alles unter einem Dach Neue Herausforderungen der Gemeinden Demographische Alterung der Bevölkerung steigende
Strategische Neuausrichtung der stationären und ambulanten Pflege in der Gemeinde Hombrechtikon Alles unter einem Dach Neue Herausforderungen der Gemeinden Demographische Alterung der Bevölkerung steigende
Nachbarschaftshilfe mit dem Zeitvorsorgemodell KISS
 Nachbarschaftshilfe mit dem Zeitvorsorgemodell KISS Ruedi Winkler Wer ist KISS? KISS ist ein Netzwerk von Non-Profit-Organisationen mit einem Verein als Dachorganisation und zur Zeit zwei KISS-Genossenschaften
Nachbarschaftshilfe mit dem Zeitvorsorgemodell KISS Ruedi Winkler Wer ist KISS? KISS ist ein Netzwerk von Non-Profit-Organisationen mit einem Verein als Dachorganisation und zur Zeit zwei KISS-Genossenschaften
Altersleitbild der Gemeinde Egg (angepasst per ) Lebensqualität im Alter
 Altersleitbild 2013-2016 der Gemeinde Egg (angepasst per 09.01.2015) Lebensqualität im Alter Vorwort Dem Gemeinderat Egg ist es ein wichtiges Anliegen, dass sich auch die älteren Einwohnerinnen und Einwohner
Altersleitbild 2013-2016 der Gemeinde Egg (angepasst per 09.01.2015) Lebensqualität im Alter Vorwort Dem Gemeinderat Egg ist es ein wichtiges Anliegen, dass sich auch die älteren Einwohnerinnen und Einwohner
Palliative Care und Vernetzung: Probleme aus der Sicht des (internistischen) Spitalarztes
 Palliative Care und Vernetzung: Probleme aus der Sicht des (internistischen) Spitalarztes Dr. med. Urs Gössi MBA FH Chefarzt Medizinische Klinik Spital Schwyz FMH Innere Medizin / FMH Hämato-Onkologie
Palliative Care und Vernetzung: Probleme aus der Sicht des (internistischen) Spitalarztes Dr. med. Urs Gössi MBA FH Chefarzt Medizinische Klinik Spital Schwyz FMH Innere Medizin / FMH Hämato-Onkologie
Versorgungskonzept Kriens Gesundheit und Alter
 Versorgungskonzept Kriens Gesundheit und Alter Matthias von Bergen Dozent und Projektleiter, Institut für Betriebs- und Regionalökonomie IBR matthias.vonbergen@hslu.ch Fachtagung «Zukunft Alter in Uri»
Versorgungskonzept Kriens Gesundheit und Alter Matthias von Bergen Dozent und Projektleiter, Institut für Betriebs- und Regionalökonomie IBR matthias.vonbergen@hslu.ch Fachtagung «Zukunft Alter in Uri»
Versorgungskonzept Gesundheit und Alter der Gemeinde Kriens: Chancen und Auswirkungen
 Versorgungskonzept Gesundheit und Alter der Gemeinde Kriens: Chancen und Auswirkungen Matthias von Bergen Dozent und Projektleiter Kompetenzzentrum Public and Nonprofit-Management matthias.vonbergen@hslu.ch
Versorgungskonzept Gesundheit und Alter der Gemeinde Kriens: Chancen und Auswirkungen Matthias von Bergen Dozent und Projektleiter Kompetenzzentrum Public and Nonprofit-Management matthias.vonbergen@hslu.ch
Akut- und Übergangspflege
 Akut- und Übergangspflege Sie dürfen das Akutspital nach einer Operation verlassen, sind aber noch nicht ganz fit, um den eigenen Haushalt zu führen? Sie suchen gezielte Unterstützung und Förderung Ihrer
Akut- und Übergangspflege Sie dürfen das Akutspital nach einer Operation verlassen, sind aber noch nicht ganz fit, um den eigenen Haushalt zu führen? Sie suchen gezielte Unterstützung und Förderung Ihrer
Lissabonner Erklärung zur Gesundheit am Arbeitsplatz in kleinen und mittleren Unternehmen KMU (2001)
 Lissabonner Erklärung zur Gesundheit am Arbeitsplatz in kleinen und mittleren Unternehmen KMU (2001) Diese Erklärung wurde vom ENBGF auf dem Netzwerktreffen am 16. Juni 2001 verabschiedet und auf der anschließenden
Lissabonner Erklärung zur Gesundheit am Arbeitsplatz in kleinen und mittleren Unternehmen KMU (2001) Diese Erklärung wurde vom ENBGF auf dem Netzwerktreffen am 16. Juni 2001 verabschiedet und auf der anschließenden
Krankenhäuser als regionale Gesundheitszentren
 Kommunale Gesundheitspolitik Veranstaltung der Konrad- Adenauer-Stiftung Krankenhäuser als regionale Gesundheitszentren Innovationspanel. Klinikwirtschaft.NRW Köln, 12. Dezember 2013 Dr. Karl Blum, Deutsches
Kommunale Gesundheitspolitik Veranstaltung der Konrad- Adenauer-Stiftung Krankenhäuser als regionale Gesundheitszentren Innovationspanel. Klinikwirtschaft.NRW Köln, 12. Dezember 2013 Dr. Karl Blum, Deutsches
Gut umsorgt. Dank koordinierter Gesundheitsversorgung.
 Gut umsorgt. Dank koordinierter Gesundheitsversorgung. Wenn alles auf einmal kommt. Die Besuche beim Arzt. Die Betreuung durch die Spitex. Die Rechnung vom Spital. Die Kostenbeteiligung der Krankenkasse.
Gut umsorgt. Dank koordinierter Gesundheitsversorgung. Wenn alles auf einmal kommt. Die Besuche beim Arzt. Die Betreuung durch die Spitex. Die Rechnung vom Spital. Die Kostenbeteiligung der Krankenkasse.
Die Entwicklung der Pflegebedürftigen in Thüringen bis 2020
 Die Entwicklung der Pflegebedürftigen in Thüringen bis 2020 Die Anzahl alter und hochbetagter Menschen in Thüringen wird immer größer. Diese an sich positive Entwicklung hat jedoch verschiedene Auswirkungen.
Die Entwicklung der Pflegebedürftigen in Thüringen bis 2020 Die Anzahl alter und hochbetagter Menschen in Thüringen wird immer größer. Diese an sich positive Entwicklung hat jedoch verschiedene Auswirkungen.
Arche Fachstelle für Integration. Beratung und Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags
 Arche Fachstelle für Integration Beratung und Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags Inhaltsverzeichnis 1 // EINLEITUNG 2 // ZIELGRUPPE 3 // Ziele 4 // Angebote 5 // ORGANISATION, STEUERUNG UND
Arche Fachstelle für Integration Beratung und Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags Inhaltsverzeichnis 1 // EINLEITUNG 2 // ZIELGRUPPE 3 // Ziele 4 // Angebote 5 // ORGANISATION, STEUERUNG UND
Projekt ThurVita Wil und Umgebung
 kompetenz im gesundheitswesen. Bronschhofen Niederhelfenschwil Rickenbach Wil Wilen Projekt ThurVita Wil und Umgebung Präsentation für die Mitgliederversammlung der Spitex-Dienste Wil und Umgebung vom
kompetenz im gesundheitswesen. Bronschhofen Niederhelfenschwil Rickenbach Wil Wilen Projekt ThurVita Wil und Umgebung Präsentation für die Mitgliederversammlung der Spitex-Dienste Wil und Umgebung vom
Workshop Hauswirtschaft und Betreuung in der Spitex Unverzichtbarer Teil des Spitex- Gesamtangebotes
 Fachtagung Spitex Verband Kanton Zürich Curaviva Kanton Zürich 14. Januar 2016 Workshop Hauswirtschaft und Betreuung in der Spitex Unverzichtbarer Teil des Spitex- Gesamtangebotes Christina Brunnschweiler
Fachtagung Spitex Verband Kanton Zürich Curaviva Kanton Zürich 14. Januar 2016 Workshop Hauswirtschaft und Betreuung in der Spitex Unverzichtbarer Teil des Spitex- Gesamtangebotes Christina Brunnschweiler
Pflegefinanzierung Chance oder Chaos?
 Pflegefinanzierung Chance oder Chaos? EDI-Podium, Luzern 22. Juni 2012 Curaviva Kanton Zürich Organisation und Aufgaben Bei Curaviva Kanton Zürich sind 225 Alters- und Pflegeheime mit über 14 000 Plätzen
Pflegefinanzierung Chance oder Chaos? EDI-Podium, Luzern 22. Juni 2012 Curaviva Kanton Zürich Organisation und Aufgaben Bei Curaviva Kanton Zürich sind 225 Alters- und Pflegeheime mit über 14 000 Plätzen
Konzept Freiwilligenarbeit. Alterswohnheim Bodenmatt Malters
 Konzept Freiwilligenarbeit Alterswohnheim Bodenmatt Malters Inhalt 1. Einleitung... 2. Definition... 3. Ziel... 4. Anforderungen... 5. Einsatzmöglichkeiten im AWH Bodenmatt... 6. Rahmenbedingungen... 7.
Konzept Freiwilligenarbeit Alterswohnheim Bodenmatt Malters Inhalt 1. Einleitung... 2. Definition... 3. Ziel... 4. Anforderungen... 5. Einsatzmöglichkeiten im AWH Bodenmatt... 6. Rahmenbedingungen... 7.
Die gesundheitliche Versorgung aus unterschiedlichen Perspektiven
 Dr. Klaus Müller Bern/Schweiz Die gesundheitliche Versorgung aus unterschiedlichen Perspektiven Herausfordernd für ALLE. Gesundheitsversorgung für Menschen mit Behinderung Fachtag der Landesvereinigung
Dr. Klaus Müller Bern/Schweiz Die gesundheitliche Versorgung aus unterschiedlichen Perspektiven Herausfordernd für ALLE. Gesundheitsversorgung für Menschen mit Behinderung Fachtag der Landesvereinigung
Versorgungssysteme für psychisch kranke Menschen
 Versorgungssysteme für psychisch kranke Menschen Das psychiatrische Hilfesystem stellt sich vielfach als Dschungel dar. Die Versorgungslandschaft ist sehr differenziert, weshalb wir Ihnen eine grobe Richtlinie
Versorgungssysteme für psychisch kranke Menschen Das psychiatrische Hilfesystem stellt sich vielfach als Dschungel dar. Die Versorgungslandschaft ist sehr differenziert, weshalb wir Ihnen eine grobe Richtlinie
Kooperation Alter Kantonale Tagung vom 26. Juni 2015, Rorschach. Zahlenmässige Entwicklung der älteren Wohnbevölkerung im Kanton St.
 Kooperation Alter Kantonale Tagung vom 26. Juni 2015, Rorschach François Höpflinger Demographische Herausforderungen in den Gemeinden www.hoepflinger.com Seite 2 Zahlenmässige Entwicklung der älteren Wohnbevölkerung
Kooperation Alter Kantonale Tagung vom 26. Juni 2015, Rorschach François Höpflinger Demographische Herausforderungen in den Gemeinden www.hoepflinger.com Seite 2 Zahlenmässige Entwicklung der älteren Wohnbevölkerung
Der Sozialdienst Ein Brückenbauer. Sozialdienst
 Der Sozialdienst Ein Brückenbauer Sozialdienst EinLEITUng Wir bauen Brücken «Es gibt etwas, das höher und heiliger ist als alles Wissen, das Leben selbst.» Alice Salomon (deutsche Pionierin der Sozialarbeit)
Der Sozialdienst Ein Brückenbauer Sozialdienst EinLEITUng Wir bauen Brücken «Es gibt etwas, das höher und heiliger ist als alles Wissen, das Leben selbst.» Alice Salomon (deutsche Pionierin der Sozialarbeit)
Qualität des ambulanten Pflegedienstes
 Qualität des ambulanten Pflegedienstes Häusliche Alten- und Krankenpflege Volker Krause KG Tel.: 0214-26004500 Fax: 0214-260045130 info@volker-krause-kg.de www.volker-krause-kg.de Gesamtergebnis Pflegerische
Qualität des ambulanten Pflegedienstes Häusliche Alten- und Krankenpflege Volker Krause KG Tel.: 0214-26004500 Fax: 0214-260045130 info@volker-krause-kg.de www.volker-krause-kg.de Gesamtergebnis Pflegerische
Das Krankenversicherungsgesetz (KVG) Mehr Autonomie Mehr Erfolg?
 Das Krankenversicherungsgesetz (KVG) Mehr Autonomie Mehr Erfolg? Donnerstag, 27. August Grand Casino Luzern Für den Gesetzgeber: Gleiche Finanzierung von ambulanten und stationären Spitalleistungen Referat
Das Krankenversicherungsgesetz (KVG) Mehr Autonomie Mehr Erfolg? Donnerstag, 27. August Grand Casino Luzern Für den Gesetzgeber: Gleiche Finanzierung von ambulanten und stationären Spitalleistungen Referat
Innovationspanel Klinikwirtschaft NRW
 11. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung Innovationspanel Klinikwirtschaft NRW Krankenhäuser auf dem Weg zu regionalen Gesundheitszentren Dr. Karl Blum, Deutsches Krankenhausinstitut (DKI) Dresden,
11. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung Innovationspanel Klinikwirtschaft NRW Krankenhäuser auf dem Weg zu regionalen Gesundheitszentren Dr. Karl Blum, Deutsches Krankenhausinstitut (DKI) Dresden,
Spitex-Strategie 2015
 Spitex Verband Schweiz Spitex-Strategie 2015 Ziele und Strategien für die Entwicklung der Spitex 1. Die Hilfe und Pflege zu Hause 2 2. Betreuung und Hauswirtschaft 3 3. Beratung und Unterstützung der Pflegenden
Spitex Verband Schweiz Spitex-Strategie 2015 Ziele und Strategien für die Entwicklung der Spitex 1. Die Hilfe und Pflege zu Hause 2 2. Betreuung und Hauswirtschaft 3 3. Beratung und Unterstützung der Pflegenden
Ambulante Palliativmedizinische Versorgung in Westfalen-Lippe René Podehl
 Ambulante Palliativmedizinische Versorgung in Westfalen-Lippe René Podehl Seite: 1 Blick in die Historie 2000 Modellversuch zur ambulanten palliativpflegerischen Versorgung in sechs Modellregionen in NRW
Ambulante Palliativmedizinische Versorgung in Westfalen-Lippe René Podehl Seite: 1 Blick in die Historie 2000 Modellversuch zur ambulanten palliativpflegerischen Versorgung in sechs Modellregionen in NRW
Musterkonzept bewegungseinschränkende Massnahmen
 Herzlich Willkommen Musterkonzept bewegungseinschränkende Massnahmen Dr. Regula Ruflin 1 1. Einleitung 2 Dr. Regula Ruflin 1 Musterkonzept: Zweck Das entwickelte Musterkonzept soll die Alters- und Pflegeheime
Herzlich Willkommen Musterkonzept bewegungseinschränkende Massnahmen Dr. Regula Ruflin 1 1. Einleitung 2 Dr. Regula Ruflin 1 Musterkonzept: Zweck Das entwickelte Musterkonzept soll die Alters- und Pflegeheime
Vernetzung von Dienstleistungen in der Stadt Zürich
 Vernetzung von Dienstleistungen in der Stadt Zürich Claudia Eisenring Stabsmitarbeiterin Gesundheits- und Umweltdepartement der Stadt Zürich 25. März 2011 Agenda 1. Entstehung des Gesundheitsnetzes 2025
Vernetzung von Dienstleistungen in der Stadt Zürich Claudia Eisenring Stabsmitarbeiterin Gesundheits- und Umweltdepartement der Stadt Zürich 25. März 2011 Agenda 1. Entstehung des Gesundheitsnetzes 2025
Gesundheitszentrum Unterengadin. Center da sandà Engiadina Bassa/ PhG
 Gesundheitszentrum Unterengadin 1 Gesundheitszentrum Unterengadin Gesundheitszentrum Unterengadin Integrierte Versorgung in einer peripheren Region lic.rer.pol. Philipp Gunzinger Direktor Gesundheitszentrum
Gesundheitszentrum Unterengadin 1 Gesundheitszentrum Unterengadin Gesundheitszentrum Unterengadin Integrierte Versorgung in einer peripheren Region lic.rer.pol. Philipp Gunzinger Direktor Gesundheitszentrum
Herzlich willkommen in Hannover zum BVMed-Forum Homecare ALTENPFLEGE 2014
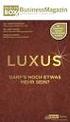 Herzlich willkommen in Hannover zum BVMed-Forum Homecare ALTENPFLEGE 2014 Grundlagen der HOMECARE-Versorgung Zukunftsmodelle in der Homecare-Versorgung Behandlungspfade Hilfsmittelversorgung 2020 Rolle
Herzlich willkommen in Hannover zum BVMed-Forum Homecare ALTENPFLEGE 2014 Grundlagen der HOMECARE-Versorgung Zukunftsmodelle in der Homecare-Versorgung Behandlungspfade Hilfsmittelversorgung 2020 Rolle
Zwischenergebnisse der Versorgungsplanung im Kanton Bern
 Zwischenergebnisse der Versorgungsplanung im Kanton Bern Unter Berücksichtigung des Leitfadens AA-LOSP der GDK Thomas Spuhler, Jonathan Bennett Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern, Spitalamt
Zwischenergebnisse der Versorgungsplanung im Kanton Bern Unter Berücksichtigung des Leitfadens AA-LOSP der GDK Thomas Spuhler, Jonathan Bennett Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern, Spitalamt
Erfordernisse und Ansätze für ein Entlassungsmanagement und Stolpersteine bei der Umsetzung
 Entlassen und was dann? 12. Plattform Gesundheit IKK, 18.03. 2015 Erfordernisse und Ansätze für ein Entlassungsmanagement und Stolpersteine bei der Umsetzung Prof. Dr. Michael Sailer . Gesetzliche Grundlagen
Entlassen und was dann? 12. Plattform Gesundheit IKK, 18.03. 2015 Erfordernisse und Ansätze für ein Entlassungsmanagement und Stolpersteine bei der Umsetzung Prof. Dr. Michael Sailer . Gesetzliche Grundlagen
Kooperationsvereinbarung. zwischen dem ambulanten Hospiz. und. (SAPV-Team)
 Kooperationsvereinbarung zwischen dem ambulanten Hospiz und (SAPV-Team) Präambel Im Mittelpunkt palliativer Arbeit stehen schwerkranke und sterbende Menschen und die ihnen Nahestehenden. Ziel ist es, Menschen
Kooperationsvereinbarung zwischen dem ambulanten Hospiz und (SAPV-Team) Präambel Im Mittelpunkt palliativer Arbeit stehen schwerkranke und sterbende Menschen und die ihnen Nahestehenden. Ziel ist es, Menschen
Leitbild der Jugendarbeit Bödeli
 Leitbild der Jugendarbeit Bödeli Inhaltsverzeichnis Leitbild der Jugendarbeit Bödeli... 3 Gesundheitsförderung... 3 Integration... 3 Jugendkultur... 3 Partizipation... 3 Sozialisation... 4 Jugendgerechte
Leitbild der Jugendarbeit Bödeli Inhaltsverzeichnis Leitbild der Jugendarbeit Bödeli... 3 Gesundheitsförderung... 3 Integration... 3 Jugendkultur... 3 Partizipation... 3 Sozialisation... 4 Jugendgerechte
Die Organisation der Organisation Überlegungen zur Einführung von Case Management aus Sicht der Organisationsentwicklung
 Die Organisation der Organisation Überlegungen zur Einführung von Case Management aus Sicht der Organisationsentwicklung Prof. (FH) Roland Woodtly Hochschule Luzern Soziale Arbeit Einführung von Case Management
Die Organisation der Organisation Überlegungen zur Einführung von Case Management aus Sicht der Organisationsentwicklung Prof. (FH) Roland Woodtly Hochschule Luzern Soziale Arbeit Einführung von Case Management
Optimierung der Schadenbearbeitung. Yves Seydoux
 Optimierung der Schadenbearbeitung Yves Seydoux Inhalt Einführung Verwaltungskosten vs. Leistungen Vergütung der Leistungen und Kontrolle der medizinischen Rechnungen Bearbeitung der Reklamationen Krankenversicherer
Optimierung der Schadenbearbeitung Yves Seydoux Inhalt Einführung Verwaltungskosten vs. Leistungen Vergütung der Leistungen und Kontrolle der medizinischen Rechnungen Bearbeitung der Reklamationen Krankenversicherer
Medizinische Demografie und Ärztebedarf im Jahre 2030
 Bundesamt für Statistik Espace de l Europe 10, CH-2010 Neuchâtel obsan@bfs.admin.ch, www.obsan.ch Reflexionstagung zur medizinischen Grundversorgung Bern, 7. Oktober 2009 Medizinische Demografie und Ärztebedarf
Bundesamt für Statistik Espace de l Europe 10, CH-2010 Neuchâtel obsan@bfs.admin.ch, www.obsan.ch Reflexionstagung zur medizinischen Grundversorgung Bern, 7. Oktober 2009 Medizinische Demografie und Ärztebedarf
Konzept der Pflegeversorgung
 Konzept der Pflegeversorgung gültig ab 1. Januar 2013 Seite 2 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Ziel des Konzepts 3 2. Regelungen und Zuständigkeiten, Geltungsdauer 3 3. Versorgungsauftrag 3 4. Leistungen durch
Konzept der Pflegeversorgung gültig ab 1. Januar 2013 Seite 2 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Ziel des Konzepts 3 2. Regelungen und Zuständigkeiten, Geltungsdauer 3 3. Versorgungsauftrag 3 4. Leistungen durch
Qualität des ambulanten Pflegedienstes
 Qualität des ambulanten Pflegedienstes Diakonie-Sozialstation des Diakonie-Werkes Nordhausen-West e.v. Am Hagen 4, 99735 Günzerode Tel.: 036335-29090 Fax: 036335-290951 i.henkel@diakoniewerk-west.de www.diakoniewerk-west.de
Qualität des ambulanten Pflegedienstes Diakonie-Sozialstation des Diakonie-Werkes Nordhausen-West e.v. Am Hagen 4, 99735 Günzerode Tel.: 036335-29090 Fax: 036335-290951 i.henkel@diakoniewerk-west.de www.diakoniewerk-west.de
Stand der Arbeit. Kinder und Jugendliche mit frühkindlichen Entwicklungsstörungen in der Schweiz Bericht des Bundesrats
 Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Sozialversicherungen BSV Kinder und Jugendliche mit frühkindlichen Entwicklungsstörungen in der Schweiz Bericht des Bundesrats Stand der Arbeit
Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Sozialversicherungen BSV Kinder und Jugendliche mit frühkindlichen Entwicklungsstörungen in der Schweiz Bericht des Bundesrats Stand der Arbeit
Gesundheitsförderung für alle ab 60
 Gesundheitsförderung für alle ab 60 Präsentation der kantonalen Strategie Einführung der kantonalen Plattform 3. November 2015 Cédric Dessimoz, Adjunkt des Kantonsarztes 2 Kantonaler Rahmen Rahmenprogramm
Gesundheitsförderung für alle ab 60 Präsentation der kantonalen Strategie Einführung der kantonalen Plattform 3. November 2015 Cédric Dessimoz, Adjunkt des Kantonsarztes 2 Kantonaler Rahmen Rahmenprogramm
Vernehmlassungsantwort von H+ zu den Nationalen Leitlinien Palliative Care
 Bundesamt für Gesundheit 3003 Bern Ort, Datum Ansprechpartner Bern, 18. Juni 2010 Bernhard Wegmüller Direktwahl E-Mail 031 335 11 00 bernhard.wegmueller@hplus.ch Vernehmlassungsantwort von H+ zu den Nationalen
Bundesamt für Gesundheit 3003 Bern Ort, Datum Ansprechpartner Bern, 18. Juni 2010 Bernhard Wegmüller Direktwahl E-Mail 031 335 11 00 bernhard.wegmueller@hplus.ch Vernehmlassungsantwort von H+ zu den Nationalen
Unsere Vision zieht Kreise... Das Leitbild der NÖ Landeskliniken-Holding.
 Unsere Vision zieht Kreise... Das Leitbild der NÖ Landeskliniken-Holding UNSERE MISSION & UNSERE VISION UNSERE MISSION & UNSERE VISION Unsere Organisation Die NÖ Landeskliniken-Holding ist das flächendeckende
Unsere Vision zieht Kreise... Das Leitbild der NÖ Landeskliniken-Holding UNSERE MISSION & UNSERE VISION UNSERE MISSION & UNSERE VISION Unsere Organisation Die NÖ Landeskliniken-Holding ist das flächendeckende
Gesund älter werden in Deutschland
 Gesund älter werden in Deutschland - Handlungsfelder und Herausforderungen - Dr. Rainer Hess Vorsitzender des Ausschusses von gesundheitsziele.de Gemeinsame Ziele für mehr Gesundheit Was ist gesundheitsziele.de?
Gesund älter werden in Deutschland - Handlungsfelder und Herausforderungen - Dr. Rainer Hess Vorsitzender des Ausschusses von gesundheitsziele.de Gemeinsame Ziele für mehr Gesundheit Was ist gesundheitsziele.de?
DEMENZ EIN LEITFADEN FÜR DAS ARZT- PATIENTEN-GESPRÄCH
 ADDITIONAL SLIDE KIT DEMENZ EIN LEITFADEN FÜR DAS ARZT- PATIENTEN-GESPRÄCH Autoren: Der Leitfaden Demenz wurde durch Schweizer Allgemeinmediziner, Geriater, Neurologen, Neuropsychologen und Psychiater
ADDITIONAL SLIDE KIT DEMENZ EIN LEITFADEN FÜR DAS ARZT- PATIENTEN-GESPRÄCH Autoren: Der Leitfaden Demenz wurde durch Schweizer Allgemeinmediziner, Geriater, Neurologen, Neuropsychologen und Psychiater
Gegenüberstellung Umfrage: strategisch versus operativ
 H e r a u s f o r d e r u n g L a n g z e i t p f l e g e Zweckverband regionales Pflegeheim Sarganserland Gegenüberstellung Umfrage: strategisch versus operativ Version.0 vom.06.16 Inhalt Bedeutung der
H e r a u s f o r d e r u n g L a n g z e i t p f l e g e Zweckverband regionales Pflegeheim Sarganserland Gegenüberstellung Umfrage: strategisch versus operativ Version.0 vom.06.16 Inhalt Bedeutung der
Gesundheitsbarometer. Ergebnisse der vierten Welle
 Gesundheitsbarometer Ergebnisse der vierten Welle Forschungsdesign telefonische Befragung, durchgeführt von der Gesellschaft für Marketing (OGM) Stichprobe n=1.007 ÖsterreicherInnen ab 16 Jahren Feldzeit:
Gesundheitsbarometer Ergebnisse der vierten Welle Forschungsdesign telefonische Befragung, durchgeführt von der Gesellschaft für Marketing (OGM) Stichprobe n=1.007 ÖsterreicherInnen ab 16 Jahren Feldzeit:
Praxisforschungsprojekt Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) des Jugendamtes Duisburg
 Prof. Dr. Peter Bünder Fachgebiet Erziehungswissenschaft Forschungsschwerpunkt Beruf & Burnout-Prävention Prof. Dr. Thomas Münch Fachgebiet Verwaltung und Organisation Forschungsschwerpunkt Wohlfahrtsverbände
Prof. Dr. Peter Bünder Fachgebiet Erziehungswissenschaft Forschungsschwerpunkt Beruf & Burnout-Prävention Prof. Dr. Thomas Münch Fachgebiet Verwaltung und Organisation Forschungsschwerpunkt Wohlfahrtsverbände
Regionale Gesundheitskonferenzen und Gesundheitsregionen plus. Ministerialdirigentin Gabriele Hörl 2. KVB-Versorgungskonferenz München,
 Regionale Gesundheitskonferenzen und Gesundheitsregionen plus Ministerialdirigentin Gabriele Hörl 2. KVB-Versorgungskonferenz München, 10.03.2015 Agenda I. Notwendigkeit regionaler Ansätze II. Bisherige
Regionale Gesundheitskonferenzen und Gesundheitsregionen plus Ministerialdirigentin Gabriele Hörl 2. KVB-Versorgungskonferenz München, 10.03.2015 Agenda I. Notwendigkeit regionaler Ansätze II. Bisherige
Die heile Welt des Pflegeheims: Sind Heime besser als ihr Ruf?
 3. Berliner Runde Die heile Welt des Pflegeheims: Sind Heime besser als ihr Ruf? Argumente gegen die Stigmatisierung einer Angebotsform Berlin, 12. Oktober 2015 3. Berliner Runde 12.10.2015 2 Gliederung
3. Berliner Runde Die heile Welt des Pflegeheims: Sind Heime besser als ihr Ruf? Argumente gegen die Stigmatisierung einer Angebotsform Berlin, 12. Oktober 2015 3. Berliner Runde 12.10.2015 2 Gliederung
Keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit - 10 Folien zum 10. Geburtstag am
 Keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit - 10 Folien zum 10. Geburtstag am 10.10. Dr. Thomas Götz Landesbeauftragter für Psychiatrie Q: Eames Office Keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit aber
Keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit - 10 Folien zum 10. Geburtstag am 10.10. Dr. Thomas Götz Landesbeauftragter für Psychiatrie Q: Eames Office Keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit aber
Sonderbericht: Lebenslagen der. Pflegebedürftigen
 Statistisches Bundesamt Zweigstelle Bonn Sonderbericht: Lebenslagen der Pflegebedürftigen - Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung - Deutschlandergebnisse des Mikrozensus 2003 Bonn, im Oktober 2004 Inhalt
Statistisches Bundesamt Zweigstelle Bonn Sonderbericht: Lebenslagen der Pflegebedürftigen - Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung - Deutschlandergebnisse des Mikrozensus 2003 Bonn, im Oktober 2004 Inhalt
Elektronisches Patientendossier
 Elektronisches Patientendossier Grundlagen und Stand der Arbeiten Dr. Salome von Greyerz, Stv. Leiterin, Bundesamt für Gesundheit Symposium «Die Chancen einer integrierten Versorungsorganisation» 21. September
Elektronisches Patientendossier Grundlagen und Stand der Arbeiten Dr. Salome von Greyerz, Stv. Leiterin, Bundesamt für Gesundheit Symposium «Die Chancen einer integrierten Versorungsorganisation» 21. September
Konzept Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) der Stadt Zug. Kurzfassung
 Konzept Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) der Stadt Zug Kurzfassung Stadträtin Vroni Straub-Müller Kleine Kinder lernen spielend Spielen ist für Kinder die natürlichste und gleichzeitig
Konzept Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) der Stadt Zug Kurzfassung Stadträtin Vroni Straub-Müller Kleine Kinder lernen spielend Spielen ist für Kinder die natürlichste und gleichzeitig
Leitbild Unsere Ziele Pflege- und Betreuungsverständnis Gestaltung der Pflege Zusammenarbeit mit Angehörigen Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern
 Leitbild Unsere Ziele Private-Spitex Rotsee erbringt professionelle Pflegeleistungen in der häuslichen Umgebung mit dem Ziel, die Lebensqualität der Pflegekunden und Gäste zu verbessern oder zu erhalten,
Leitbild Unsere Ziele Private-Spitex Rotsee erbringt professionelle Pflegeleistungen in der häuslichen Umgebung mit dem Ziel, die Lebensqualität der Pflegekunden und Gäste zu verbessern oder zu erhalten,
Palliative Basisversorgung
 Konzept Palliative Basisversorgung Altenpflegeheim St. Franziskus Achern Vernetzte palliative Basisversorgung in den Einrichtungen: Pflegeheim Erlenbad, Sasbach Altenpflegeheim St. Franziskus Sozialstation
Konzept Palliative Basisversorgung Altenpflegeheim St. Franziskus Achern Vernetzte palliative Basisversorgung in den Einrichtungen: Pflegeheim Erlenbad, Sasbach Altenpflegeheim St. Franziskus Sozialstation
Ergebnisse der Studie Freiwillig 2011
 Ergebnisse der Studie Freiwillig 2011 Zusammenfassung der Ergebnisse für die teilnehmenden Freiwilligen Prof. Theo Wehner Lehrstuhlinhaber Dr. Stefan Güntert Projektleiter lic. phil. Jeannette Oostlander
Ergebnisse der Studie Freiwillig 2011 Zusammenfassung der Ergebnisse für die teilnehmenden Freiwilligen Prof. Theo Wehner Lehrstuhlinhaber Dr. Stefan Güntert Projektleiter lic. phil. Jeannette Oostlander
Pflegende und der sich verändernde Pflegebedarf
 Pflegende und der sich verändernde Pflegebedarf Die goldene Zeit der Pflege gab es noch nie weshalb sollte sie ausgerechnet jetzt beginnen? Hartmut Vöhringer Angebot und Nachfrage Berufsbilder im Widerspruch
Pflegende und der sich verändernde Pflegebedarf Die goldene Zeit der Pflege gab es noch nie weshalb sollte sie ausgerechnet jetzt beginnen? Hartmut Vöhringer Angebot und Nachfrage Berufsbilder im Widerspruch
Zuhause im Alter Soziales Wohnen Programme zum Wohnen im Alter
 Zuhause im Alter Soziales Wohnen Programme zum Wohnen im Alter Dr. Barbara Hoffmann, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Referat 314 Zuhause im Alter Soziales Wohnen Demografischer
Zuhause im Alter Soziales Wohnen Programme zum Wohnen im Alter Dr. Barbara Hoffmann, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Referat 314 Zuhause im Alter Soziales Wohnen Demografischer
Vernetzung der Beratung auf Seiten der Leistungserbringer
 13. April 2011 Beratung Perspektiven - Inklusion Forum 2: Zuständigkeiten und Finanzierung Vernetzung der Beratung auf Seiten der Leistungserbringer Dr. Lutz Galiläer (Forschungsinstitut Betriebliche Bildung,
13. April 2011 Beratung Perspektiven - Inklusion Forum 2: Zuständigkeiten und Finanzierung Vernetzung der Beratung auf Seiten der Leistungserbringer Dr. Lutz Galiläer (Forschungsinstitut Betriebliche Bildung,
Unheilbar krank und jetzt?
 Unheilbar krank und jetzt? Wenn eine schwere Krankheit fortschreitet und keine Hoffnung auf Heilung besteht, treten schwierige Fragen in den Vordergrund: Wie viel Zeit bleibt mir noch? Wie verbringe ich
Unheilbar krank und jetzt? Wenn eine schwere Krankheit fortschreitet und keine Hoffnung auf Heilung besteht, treten schwierige Fragen in den Vordergrund: Wie viel Zeit bleibt mir noch? Wie verbringe ich
Vereinbarkeit von Familie und Beruf TIPPS UND INFORMATIONEN. Bildelement: Altenpflege. Betreuung / Pflege von Angehörigen.
 Bildelement: Altenpflege Vereinbarkeit von Familie und Beruf TIPPS UND INFORMATIONEN Betreuung / Pflege von Angehörigen Bildelement: Logo ELDER CARE Betreuung und Pflege von Angehörigen Der englische Begriff
Bildelement: Altenpflege Vereinbarkeit von Familie und Beruf TIPPS UND INFORMATIONEN Betreuung / Pflege von Angehörigen Bildelement: Logo ELDER CARE Betreuung und Pflege von Angehörigen Der englische Begriff
Qualität des ambulanten Pflegedienstes
 Qualität des ambulanten Pflegedienstes Pflegedienst Bethel Bad Oeynhausen ggmbh Tel.: 05731-983983 Fax: 05731-983984 PDOE@BethelNet.de www.bethelnet.de Gesamtergebnis Pflegerische Leistungen Ärztlich verordnete
Qualität des ambulanten Pflegedienstes Pflegedienst Bethel Bad Oeynhausen ggmbh Tel.: 05731-983983 Fax: 05731-983984 PDOE@BethelNet.de www.bethelnet.de Gesamtergebnis Pflegerische Leistungen Ärztlich verordnete
Konzeptbaustein. Ambulant Betreutes Wohnen für Menschen mit psychischen Behinderungen
 Konzeptbaustein Ambulant Betreutes Wohnen für Menschen mit psychischen Behinderungen Inhalt: 1 Zielgruppe 2 Spezifische Ziele der Leistungen 3 Leistungsanbote 4 Spezifisches zur Organisationsstruktur Anlagen:
Konzeptbaustein Ambulant Betreutes Wohnen für Menschen mit psychischen Behinderungen Inhalt: 1 Zielgruppe 2 Spezifische Ziele der Leistungen 3 Leistungsanbote 4 Spezifisches zur Organisationsstruktur Anlagen:
Spitex-Statistik 2009
 Spitex-Statistik 2009 Einleitung Die Spitex-Statistik 2009 für den Kanton Schaffhausen stützt sich auf die Datenerhebung des Bundesamtes für Statistik (BFS). Den Verantwortlichen in den einzelnen Organisationen,
Spitex-Statistik 2009 Einleitung Die Spitex-Statistik 2009 für den Kanton Schaffhausen stützt sich auf die Datenerhebung des Bundesamtes für Statistik (BFS). Den Verantwortlichen in den einzelnen Organisationen,
Netzwerkarbeit im Kinderschutz in Brandenburg an der Havel. Entwicklungsverlauf und Perspektiven
 Netzwerkarbeit im Kinderschutz in Brandenburg an der Havel Entwicklungsverlauf und Perspektiven Das Bundeskinderschutzgesetz beauftragt den öffentlichen Träger der Jugendhilfe, ein Netzwerk Kinderschutz
Netzwerkarbeit im Kinderschutz in Brandenburg an der Havel Entwicklungsverlauf und Perspektiven Das Bundeskinderschutzgesetz beauftragt den öffentlichen Träger der Jugendhilfe, ein Netzwerk Kinderschutz
Qualität des ambulanten Pflegedienstes
 Qualität des ambulanten Pflegedienstes PAsst! ggmbh Persönliche Assistenz für ein selbstbestimmtes Leben Karwendelstr. 2 1/2, 86343 Königsbrunn Tel.: 08231 6004510 Fax: 08231 6004505 passt@passt-assistenz.de
Qualität des ambulanten Pflegedienstes PAsst! ggmbh Persönliche Assistenz für ein selbstbestimmtes Leben Karwendelstr. 2 1/2, 86343 Königsbrunn Tel.: 08231 6004510 Fax: 08231 6004505 passt@passt-assistenz.de
FAMILIENZENTREN. Eine niederschwellige Plattformen für Begegnung, Bildung und Vernetzung Tagung, 21. November 2016 Schloss Ebenrain, Sissach
 FAMILIENZENTREN Eine niederschwellige Plattformen für Begegnung, Bildung und Vernetzung Tagung, 21. November 2016 Schloss Ebenrain, Sissach Maya Mulle, Netzwerk Bildung und Familie, www.bildungundfamilie.net
FAMILIENZENTREN Eine niederschwellige Plattformen für Begegnung, Bildung und Vernetzung Tagung, 21. November 2016 Schloss Ebenrain, Sissach Maya Mulle, Netzwerk Bildung und Familie, www.bildungundfamilie.net
Die Altersmedizin am Universitätsspital
 Die Altersmedizin am Universitätsspital Samstag 31. Januar, 2015 Ist weniger mehr? Grenzen der modernen Medizin Schwerpunkt 3: Am Ende des Lebens Forum für Universität und Gesellschaft Universität Bern
Die Altersmedizin am Universitätsspital Samstag 31. Januar, 2015 Ist weniger mehr? Grenzen der modernen Medizin Schwerpunkt 3: Am Ende des Lebens Forum für Universität und Gesellschaft Universität Bern
Begleiten. Beraten. Bilden. Kranke Menschen begleiten, Angehörige entlasten.
 Begleiten. Beraten. Bilden. Kranke Menschen begleiten, Angehörige entlasten. Unterstützungsangebot für Menschen, die von Krankheit betroffen sind. GGG Voluntas vermittelt in der Region Basel qualifizierte
Begleiten. Beraten. Bilden. Kranke Menschen begleiten, Angehörige entlasten. Unterstützungsangebot für Menschen, die von Krankheit betroffen sind. GGG Voluntas vermittelt in der Region Basel qualifizierte
Konzept "Chüra in Engiadina Bassa. Die Entwicklung des Gesundheitszentrums Unterengadin Chance für die Gesundheitsversorgung einer peripheren Region
 Konzept "Chüra in Engiadina Bassa Die Entwicklung des Gesundheitszentrums Unterengadin Chance für die Gesundheitsversorgung einer peripheren Region Verena Schütz Direktorin Chüra Pflege & Betreuung Mitglied
Konzept "Chüra in Engiadina Bassa Die Entwicklung des Gesundheitszentrums Unterengadin Chance für die Gesundheitsversorgung einer peripheren Region Verena Schütz Direktorin Chüra Pflege & Betreuung Mitglied
Die praktische Umsetzung der geldfreien 4. Vorsorgesäule KISS. Susanna Fassbind, Co-Präsidentin Verein KISS, Zug
 Die praktische Umsetzung der geldfreien 4. Vorsorgesäule KISS Susanna Fassbind, Co-Präsidentin Verein KISS, Zug KISS Schweizweite Verbreitung 20. Februar 2014 Menschen zusammenbringen Warum Zeitvorsorge?
Die praktische Umsetzung der geldfreien 4. Vorsorgesäule KISS Susanna Fassbind, Co-Präsidentin Verein KISS, Zug KISS Schweizweite Verbreitung 20. Februar 2014 Menschen zusammenbringen Warum Zeitvorsorge?
SIMBA Sicherheit im Alter Betreut zu Hause
 Sozialdienst Germering e.v. SIMBA Sicherheit im Alter Betreut zu Hause Inhalt Projektziele Konzeptioneller Rahmen Leistungen Zielgruppe Realisierung Stärken des Betreuten Wohnens Teilnehmerzahlen Betriebswirtschaftlicher
Sozialdienst Germering e.v. SIMBA Sicherheit im Alter Betreut zu Hause Inhalt Projektziele Konzeptioneller Rahmen Leistungen Zielgruppe Realisierung Stärken des Betreuten Wohnens Teilnehmerzahlen Betriebswirtschaftlicher
Vernetzte Kommunikation Erfolgsfaktor integrierter Versorgung.
 Vernetzte Kommunikation Erfolgsfaktor integrierter Versorgung. Dargestellt am Prozess «Gesundheitsnetz 2025» der Stadt Zürich Dr. Erwin Carigiet Departementssekretär Gesundheits- und Umweltdepartement
Vernetzte Kommunikation Erfolgsfaktor integrierter Versorgung. Dargestellt am Prozess «Gesundheitsnetz 2025» der Stadt Zürich Dr. Erwin Carigiet Departementssekretär Gesundheits- und Umweltdepartement
Anlage 1 gemäß 17 Abs. 3 des Rahmenvertrags für vollstationäre Pflege nach 75 Abs. 1 SGB XI für das Land Baden-Württemberg
 Anlage 1 gemäß 17 Abs. 3 des Rahmenvertrags für vollstationäre Pflege nach 75 Abs. 1 SGB XI für das Land Baden-Württemberg Präambel 1 Versorgungsvertrag 2 Personenkreis und persönliche Zugangsvoraussetzungen
Anlage 1 gemäß 17 Abs. 3 des Rahmenvertrags für vollstationäre Pflege nach 75 Abs. 1 SGB XI für das Land Baden-Württemberg Präambel 1 Versorgungsvertrag 2 Personenkreis und persönliche Zugangsvoraussetzungen
Qualität des ambulanten Pflegedienstes
 Qualität des ambulanten Pflegedienstes Wohnstift Rathsberg Rathsberger Str. 63, 91054 Erlangen Tel.: 09131 825271 Fax: 09131 825277 info@wohnstift-rathsberg.de www.wohnstift-rathsberg.de Gesamtergebnis
Qualität des ambulanten Pflegedienstes Wohnstift Rathsberg Rathsberger Str. 63, 91054 Erlangen Tel.: 09131 825271 Fax: 09131 825277 info@wohnstift-rathsberg.de www.wohnstift-rathsberg.de Gesamtergebnis
PflegeNetz Dresden Bericht Arbeitsgruppe 2: Überleitungsmanagement
 PflegeNetz Bericht Arbeitsgruppe 2: Überleitungsmanagement PflegeNetz Pflegeüberleitung: eine Aufgabe des Entlassungsmanagements in der AG erfolgte Positionsbestimmung / Bestandsaufnahme Vom einzelnen
PflegeNetz Bericht Arbeitsgruppe 2: Überleitungsmanagement PflegeNetz Pflegeüberleitung: eine Aufgabe des Entlassungsmanagements in der AG erfolgte Positionsbestimmung / Bestandsaufnahme Vom einzelnen
Die Inanspruchnahme ambulanter ärztlicher Leistungen durch ältere Menschen
 Die Inanspruchnahme ambulanter ärztlicher Leistungen durch ältere Menschen Mit der demographischen Alterung ist es absehbar, dass der Bedarf an medizinischen Leistungen weiter anwachsen wird. Eine wesentliche
Die Inanspruchnahme ambulanter ärztlicher Leistungen durch ältere Menschen Mit der demographischen Alterung ist es absehbar, dass der Bedarf an medizinischen Leistungen weiter anwachsen wird. Eine wesentliche
Nationale Demenzstrategie Zwischen Theorie und praktischer Umsetzbarkeit
 Nationale Demenzstrategie 2014-2017 Zwischen Theorie und praktischer Umsetzbarkeit 20.11.2014 Dr. I. Bopp-Kistler, Dr med. FMH Innere Medizin, spez. Geriatrie Leitende Ärztin ambulante Dienste/ Memory-Klinik
Nationale Demenzstrategie 2014-2017 Zwischen Theorie und praktischer Umsetzbarkeit 20.11.2014 Dr. I. Bopp-Kistler, Dr med. FMH Innere Medizin, spez. Geriatrie Leitende Ärztin ambulante Dienste/ Memory-Klinik
