HMD. Wirtschaftsinformatik. Prozessmanagement. Praxis der. Stefan Reinheimer (Hrsg.) Heft 266 April 2009
|
|
|
- Leopold Baumgartner
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 HMD Heft 266 April 2009 Praxis der Wirtschaftsinformatik Stefan Reinheimer (Hrsg.) Prozessmanagement Û Geschäftsprozessmanagement Û Business Process Maturity Model Û Serviceorientierte Prozesse Û Workflow-Management Û Ready for Value chain competition Û Subjektorientierte Modellierung Û Erfahrungsbericht eines Versicherers Û Praxisbericht ProcessSharePoint Û Informationsmanagement bei Kundenbeschwerden dpunkt.verlag D ISSN
2 HMD 266 Praxis der Wirtschaftsinformatik Inhalt Prozessmanagement 2 Cartoon 3 Editorial 4 Einwurf von Nicolas Bissantz 5 Tobias Bucher, Robert Winter Geschäftsprozessmanagement Einsatz, Weiterentwicklung und Anpassungsmöglichkeiten aus Methodiksicht 17 Frank Hogrebe, Markus Nüttgens Business Process Maturity Model (BPMM): Konzeption, Anwendung und Nutzenpotenziale 26 Susanne Robra-Bissantz, Bernhard Rumpe, Patrick Helmholz, Elena Kozlowski, Dirk Reiß, Silke Siegel Software Engineering serviceorientierter Prozesse 35 Andreas Gadatsch Integriertes Geschäftsprozess- und Workflow-Management Konzeption, Rollen und organisatorische Einbindung 43 Kerstin Gerke, Gerrit Tamm Qualitätsmanagement zur Steuerung von IT-Prozessen auf der Basis von Referenzmodellen und Process Mining Weitere Themen 100 Gernot Gräfe, Christian Maaß Sechs Thesen zum Social Bookmarking 108 Torsten Brendel, Torsten Stein RFID in der Krankenhauslogistik 52 Werner Schmidt, Albert Fleischmann, Oliver Gilbert Subjektorientiertes Geschäftsprozessmanagement 63 Christine Arend-Fuchs, Peter Bielert»Ready for Value chain competition«neue Geschäftsmodelle durch Prozessintegration 71 Carsta Heger, Ursula Rehle, Christoph Prackwieser Prozessmanagement in Zeiten organisatorischer und technologischer Veränderungen Erfahrungsbericht eines Versicherers 80 Volker Nissen, Osman Bayraktar Informationsmanagement bei Kundenbeschwerden 90 Bernd Hilgarth, Jörg Purucker, Harald Mayer, Florian Göldner ProcessSharePoint ein Praxisbericht zur Lösung des Last-Mile-Problems in der Prozessimplementierung 117 Glossar Rubriken 119 Notizen 120 Bücher 123 Vorschau 125 Stichwortverzeichnis 128 Impressum
3
4 Editorial Nachdem die Bedeutung von Prozessen eigentlich schon lange hätte bekannt sein müssen schließlich beruhen schon die frühen Fließbandproduktionen z.b. bei Ford auf dem Grundgedanken, Abläufe so umzusetzen, dass Produktionsdauer und -aufwand reduziert werden, haben sich Prozesse im administrativen und im Dienstleistungsumfeld erst vor sehr viel kürzerer Zeit ihren Platz in der Betriebswirtschaftslehre erkämpft. Dies erfolgte jedoch sehr vehement und nachdrücklich. Die Quintessenz dieses methodischen Reifeprozesses in der Praxis lässt sich zusammenfassen: Prozesse setzen Strategien um und definieren die Anforderungen an die IT. Diese zentrale Positionierung von Prozessen hat in den letzten Jahren auch Auswirkungen auf die Bedeutung des Prozessmanagements gehabt. Die zahlreichen Artikel, die mich erreicht haben, sind ein eindeutiges Indiz dafür, dass das Thema sowohl in der akademischen als auch in der Praxiswelt nicht nur angekommen, sondern auch von hoher Relevanz ist. Die vorliegende Ausgabe der HMD gibt einen Überblick darüber, welche Bereiche unternehmerischen Handelns für das Prozessmanagement relevant und von ihm geprägt werden können. Entsprechend breit gefächert sind die Inhalte, die wir für Sie zusammengestellt haben. Die Beiträge können grob in drei Kategorien klassifiziert werden, die aufgrund der thematischen Komplexität nicht überschneidungsfrei sind: Artikel zum thematischen und methodischen Überblick und Status quo inklusive einer Lifecycle-Betrachtung Beiträge, wie das Prozessmanagement im Unternehmen methodisch und toolseitig unterstützt werden kann (durch ein Reifegradmodell, bei der Ableitung und Organisation von Workflows, bei der Modellierung, im Software Engineering oder bei der operativen Implementierung von Prozessen) Beispiele für die Einsatzgebiete des Prozessmanagements zur operativen Unterstützung unternehmerischer Aufgaben (in einem branchenspezifischen Überblick, im Qualitäts- oder im Beschwerdemanagement) oder auch bei strategischen Ansätzen (Nutzung des Prozessmanagements bei der Definition von innovativen Geschäftsmodellen) Allen Artikeln ist gemein, dass sie von hoher Praxisrelevanz geprägt sind, unabhängig davon, ob sie aus dem akademischen oder dem unternehmerischen Umfeld stammen. Nach meiner persönlichen Einschätzung erreicht das Bewusstsein für die Bedeutung des Prozessmanagements gerade seinen Höhepunkt, die initiale Implementierung in der Praxis wird noch einige Jahre anhalten, bis das Thema dann im Standard der Unternehmensführung angekommen sein wird. Für die vorliegende Ausgabe der HMD wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen und umfangreiche Erkenntnisse für Ihren beruflichen Alltag. Stefan Reinheimer HMD 266 3
5 Einwurf Einwurf Soll ein Unternehmer dieses Heft lesen? Nein. Die Prozessoptimierer sind schuld, dass fleißige Leute heute auf der Autobahn nicht mehr vorankommen. Sie haben nämlich die Produktion heimgesucht,»just in Time«erfunden, die Lager geleert und sie auf die Straße verlagert. In genau den Lkw, der gestern vor Ihnen ein nicht enden wollendes Elefantenrennen veranstaltet hat. Doch. Weil gute Ablauforganisation, Verzeihung, Prozessmanagementoptimierung, seit der Mammutjagd dringend gebraucht wird. Dennoch war es erst einmal bis Taylor sehr still um das Thema, und dann noch einmal sehr ruhig, bis in den 90ern Hammer und andere viel Wirbel verursachten, der mancherorts als Sturm im Wasserglas endete. Auf jeden Fall sind wir immer noch neugierig zu erfahren, wie wir uns besser organisieren können. Die Evolutionsbiologen sagen: Ablauforganisation hat sogar Sprache erst hervorgebracht. Nur mit Sprache konnten wir dem unerfahrenen Kollegen respektive Stammesbruder sagen, was er machen soll, wenn das Mammut kommt. Ein nützlicher Nebeneffekt des Strebens nach besseren Prozessen. Wieder eine andere Wissenschaft, die Wirtschaftspsychologie, sagt: Die Dinge ändern sich so schnell, dass zu viel Organisation schadet. Viel eher komme es darauf an, sich mehr aufs»durchwurschteln«(sic) zu besinnen. Das versteht der Praktiker. Und als Kunde, Kollege, Lieferant, Mensch ist uns jemand, der improvisiert, lieber als jemand, der sagt, unser Wunsch sei so nicht vorgesehen. Mutig ist man, wenn man sich die Prozessverbesserung zum Lebensinhalt gemacht hat. Ein Projekt zum Reengineering leiten zu dürfen, war ein Schritt auf der Karriereleiter. Allzu oft nach unten. Das hat auch viel damit zu tun, wie es zugeht, wenn zum»process Re-Engineering Workshop«geladen wurde. In einem sind sich da alle schnell einig: Der eigene Ablauf passt, davor und danach hapert es halt. Und dennoch: Jeder ist fasziniert, wenn ein Lieferant sagen kann, wo die Ware ist, auf die man wartet, und wann sie bei uns eintrifft. Wenn es klappt wie am Schnürchen. Wenn es gelingt, dass eine Organisation funktioniert wie ein Uhrwerk. Wo die Technik den Takt vorgeben kann und gibt, ist es die Prozesssicht, die alles treibt und auch verbessern hilft. Dort, wo der Anteil an menschlicher Ausführung, Disposition und Entscheidung hoch ist, kommen uns die Elastizität menschlicher Produktivität, der Biorhythmus, die zunehmende Entfernung der Raucherzonen vom Arbeitsplatz, die Herbstdepression, die Frühjahrsmüdigkeit und der Kölner Karneval in die Quere. Für die Prozessverbesserung in Vertrieb, Verwaltung und Management bewegt mich persönlich daher folgende Idee: Sobald unser eigener Beitrag fühl- und ja auch messbar wird, spüren wir Teilnahme und Motivation und mobilisieren die Effizienzpotenziale in unseren Prozessen von ganz allein. Weil das so ist, haben wir im eigenen Unternehmen große Bildschirme platziert, auf denen Tagesleistungen abteilungsweise sichtbar werden. Zum Beispiel tickern so die Namen der am selben Tag kontaktierten Interessenten, Kunden und Partner über die Monitore. Wer viel getan hat, trägt also viel zur Länge der Tickerbänder bei. Auch abstrakte Leistung wird so sichtbar. Die Idee resultierte auch aus der Unzufriedenheit des Kopfarbeiters, sagen zu können: War das ein guter Tag? Wie sehr habe ich zum Gelingen des Ganzen beigetragen? Die bisherigen Erfahrungen mit unserer Interpretation von Prozessmanagement sind überaus erfreulich. Deswegen: Ich werde den Rest des Heftes lesen. Dr. Nicolas Bissantz Bissantz & Company GmbH Nordring Nürnberg 4 HMD 266
6 Tobias Bucher, Robert Winter Geschäftsprozessmanagement Einsatz, Weiterentwicklung und Anpassungsmöglichkeiten aus Methodiksicht Unternehmen setzen das Konzept des Geschäftsprozessmanagements (Business Process Management, BPM) in vollkommen unterschiedlicher Art und Weise um. Durch eine empirische Untersuchung wurden vier Einflussfaktoren identifiziert, auf deren Grundlage vier grundsätzlich unterschiedliche (Ist-)BPM-Ansätze unterschieden werden können. Wenn zusätzlich auch BPM- Weiterentwicklungspläne einbezogen werden, ergeben sich fünf dominierende BPM-Projekttypen. Anhand zweier Beispiele wird illustriert, wie die Unterscheidung von BPM-Ansätzen und -Projekttypen zur situationsspezifischen Fortentwicklung bestehender Referenzmodelle und Methoden im Bereich BPM eingesetzt werden können. Inhaltsübersicht 1 Prozessorganisation und Geschäftsprozessmanagement 2 Geschäftsprozessmanagement in der Praxis 2.1 Charakterisierung der Datengrundlage 2.2 BPM-Gestaltungsfaktoren 2.3 BPM-Ansätze 2.4 BPM-Entwicklungspfade 3 Situative Anpassung von BPM- Referenzmodellen und -Methoden 3.1 Anpassung eines Referenzprozessmodells 3.2 Anpassung einer Methode 4 Konsequenzen und weiterer Forschungsbedarf 5 Literatur 1 Prozessorganisation und Geschäftsprozessmanagement Rein funktionale Arbeitsteilung ist mit einem hohen Maß an Aufgabenspezialisierung verbunden. Es ist das Hauptziel der Prozessorganisation, d. h. der prozessorientierten Organisationsgestaltung, die ausschließlich funktional orientierte Arbeitsteilung durch Arbeitsabläufe zu ersetzen, die sowohl funktionale als auch organisatorische Abteilungsgrenzen überschreiten und den Mitarbeitenden eines Unternehmens eine in deutlich höherem Maße selbstbestimmte und verantwortungsvolle Arbeitsgestaltung ermöglichen [Gaitanides 2004]. In der wissenschaftlichen ebenso wie in der praxisorientierten Literatur finden sich unterschiedlichste Definitionen des Begriffs»Prozess«. Nahezu all diesen Begriffsverständnissen ist gemein, dass sie Prozesse als Ablauffolge von Aktivitäten oder Aufgaben beschreiben, die darauf abzielen, unter Einbeziehung von Eingangsobjekten (Inputs, Ressourcen) eine spezifische Leistung (Output, Prozessleistung) zu erbringen (vgl. bspw. [Davenport 1993], [Hammer & Champy 1993]). Prozessbeschreibungen stellen demnach strukturierte Vorgaben dar, auf welche Art und Weise die Arbeitsabläufe innerhalb eines Unternehmens und/oder zwischen Unternehmen ergebnis- und zielorientiert durchzuführen sind. Im Gegensatz zur funktionsorientierten Organisation steht also nicht die Frage nach dem»was«im Vordergrund, sondern nach dem»wie«[davenport 1993]. Prozesse sind stets auf Prozesskunden hin ausgerichtet, die sowohl im Unternehmen selbst HMD 266 5
7 als auch außerhalb des Unternehmens angesiedelt sein können (vgl. bspw. [Davenport 1993], [Hammer & Champy 1993]). Ziel der Prozessgestaltung ist neben der Sicherstellung, dass die Leistungen für die Prozesskunden in der vereinbarten Qualität erbracht werden (»Effektivität«), auch die Sicherstellung, dass bei der Leistungserzeugung das jeweilige Ziel- und Steuerungssystem beachtet wird (»Effizienz«) [Österle 1995]. Geschäftsprozessmanagement (Business Process Management, BPM) bezeichnet den ganzheitlichen Ansatz zur Gestaltung, Einführung, Lenkung und Fortentwicklung betrieblicher Führungs-, Kern- und Unterstützungsprozesse sowie der Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen diesen Prozessen im Rahmen einer prozessorientierten Organisationsgestaltung. Das Geschäftsprozessmanagement umfasst vier Phasen: (1) Identifikation, Definition und Modellierung von Prozessen, (2) Implementierung und Ausführung von Prozessen, (3) Überwachung und Steuerung von Prozessen sowie (4) Weiterentwicklung von Prozessen [Bucher & Winter 2007]. Diese vier Phasen werden in der Regel in iterativen Zyklen durchlaufen. Obwohl Wissenschaft und Praxis generische Methoden und Referenzmodelle für die Prozessorganisation entwickelt haben, verläuft die Entwicklung hin zu einer reifen Form des Geschäftsprozessmanagements in verschiedenen Stadien, und beinahe jedes Unternehmen entwickelt dabei eigene Vorgehensweisen und Realisierungsformen (vgl. bspw. [Armistead et al. 1999]). Mit dem situativen Methoden- Engineering (vgl. [Bucher et al. 2007]) und mit der konfigurativen Referenzmodellierung (vgl. [Becker et al. 2004]) existieren generische Ansätze, wie entsprechend konstruierte Methoden bzw. Modelle systematisch an Spezifika der jeweiligen Anwendungssituation im Unternehmen angepasst werden können. Obwohl aufgrund der Bedeutung von BPM solche situativen Ansätze von großer Wichtigkeit wären, um bestehende Empfehlungen zur BPM-Einführung und -Weiterentwicklung auf die Spezifika einzelner Unternehmen bzw. der von diesen Unternehmen jeweils verfolgten BPM-Ansätze hin anpassen zu können, wurden situatives Methoden-Engineering und konfigurative Referenzmodellierung noch nicht für BPM angewandt. In Form einer Analyse der verschiedenen Varianten der BPM-Ausgestaltung in der betrieblichen Praxis und deren Entwicklung im Zeitverlauf schafft dieser Beitrag zunächst die Grundlagen für einen methodischen Ansatz situativen Geschäftsprozessmanagements. Anhand zweier Beispiele wird dann illustriert, wie BPM-bezogene Zustands- und Handlungsempfehlungen situationsspezifisch angepasst bzw. ausgestaltet werden können und welche Konsequenzen aus den Erkenntnissen erwachsen. 2 Geschäftsprozessmanagement in der Praxis 2.1 Charakterisierung der Datengrundlage Empirische Grundlage für die nachfolgend dargestellten Erkenntnisse bezüglich der Ausgestaltung des Geschäftsprozessmanagements in der betrieblichen Praxis bildet ein Datensatz, der auch schon unseren früheren Beiträgen zu diesem Themenfeld zugrunde liegt (vgl. [Bucher & Winter 2007], [Bucher & Winter 2009a] und [Bucher & Winter 2009b]). Befragt wurden Fach- und Führungskräfte aus insgesamt 38 Unternehmen. Die hauptsächlich vertretenen Branchen sind Banken, Versicherungen und andere Finanzdienstleister (ca. 32 %), das produzierende Gewerbe und die Konsumgüterindustrie (etwa 15 %), die öffentliche Verwaltung und Organisationen des Gesundheitswesens (rund 11 %) sowie Unternehmen aus dem IT-Umfeld und Energie- und Wasserversorger (jeweils ca. 9 %). Die in die Untersuchung einbezogenen Unternehmen sind primär dem Mittelstand sowie den Groß- 6 HMD 266
8 unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum zuzurechnen. Der Datensatz umfasst eine Vielzahl verschiedener Variablen, die die Ausgestaltung und Reife des Geschäftsprozessmanagements in den befragten Unternehmen charakterisieren. Für jede dieser Variablen wurde sowohl ein Istwert (»aktueller Umsetzungs- bzw. Realisierungsgrad«) wie auch ein Sollwert (»Umsetzungs- bzw. Realisierungsabsicht«, bezogen auf einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren) erhoben. Für die Auswertung kamen, wie in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben, unterschiedliche Verfahren der multivariaten Datenanalyse zum Einsatz. 2.2 BPM-Gestaltungsfaktoren Gestaltungsfaktoren resultieren aus der Verdichtung mehrerer gleichartiger Aussagen bzw. Bestimmungsgrößen, die die Ausgestaltung des Geschäftsprozessmanagements aus einem bestimmten Blickwinkel beschreiben. Um die wesentlichen Gestaltungsfaktoren des Geschäftsprozessmanagements zu identifizieren, wurde zunächst eine Faktorenanalyse auf Basis der Istbeobachtungen durchgeführt. Dieses statistische Verfahren wird im Allgemeinen dafür eingesetzt, um eine kleine Anzahl relevanter, wechselseitig unabhängiger Faktoren aus einer Vielzahl von Ausgangsvariablen zu extrahieren. In unserem Fall konnten mithilfe der Technik der Hauptkomponentenanalyse vier Faktoren extrahiert werden, die zusammengenommen mehr als 69 % der Varianz in den 18 Ausgangsvariablen erklären. Die vier Gestaltungsfaktoren des Geschäftsprozessmanagements fokussieren auf (1) Leistungsmessung als Grundlage des BPM, (2) Dokumentation, Organisation und Ausbildung, (3) Einflussmöglichkeiten der Prozessverantwortlichen und schließlich (4) Standardisierung. Sie werden in Abbildung 1 beschrieben. Abb. 1: Gestaltungsfaktoren des Geschäftsprozessmanagements HMD 266 7
9 2.3 BPM-Ansätze Ansätze bzw. Realisierungsformen des Geschäftsprozessmanagements stellen eine Verallgemeinerung unternehmensspezifischer Herangehensweisen dar. BPM-Ansätze ergeben sich aus bestimmten, in der Praxis beobachtbaren Ausprägungskombinationen der BPM- Gestaltungsfaktoren. Zum Zweck der Identifikation der BPM-Ansätze wurden die 38 Beobachtungen des Datensatzes (entsprechend den 38 befragten Unternehmen) auf Grundlage der Istausprägungen der vier BPM-Gestaltungsfaktoren mithilfe eines hierarchischen Clusteralgorithmus klassifiziert. Clusteranalytische Ansätze kommen unter anderem dafür zum Einsatz, um Beobachtungen zu klassifizieren und um Strukturen und Muster in komplexen Datensätzen zu erkennen. Im vorliegenden Fall erfolgte die Durchführung der hierarchischen Clusteranalyse auf Grundlage des Ward schen Fusionierungsalgorithmus unter Zuhilfenahme der quadrierten euklidischen Distanz als Abstandsmaß zwischen den Clustern. Gemäß den Ergebnissen der Clusteranalyse können die in der betrieblichen Realität beobachteten Realisierungsformen des BPM in vier disjunkte Ansätze unterteilt werden. Im Folgenden werden diese Ansätze als»bpm-neulinge«und»bpm-einsteiger«einerseits sowie als»bpm-kollektivisten«und»bpm-individualisten«andererseits bezeichnet. BPM-Neulinge und BPM-Einsteiger zeichnen sich durch eher schwach ausgeprägtes Bewusstsein für die Bedeutung der prozessorientierten Performance- Messung, des Einflusses der Prozessverantwortlichen sowie der Nutzung etablierter Standards und Methoden (Gestaltungsfaktoren 1, 3 und 4) aus. BPM-Kollektivisten und BPM-Individualisten weisen hingegen signifikant höhere Umsetzungsgrade hinsichtlich der genannten Faktoren auf, sodass hier von»reifen«formen des Geschäftsprozessmanagements ausgegangen werden kann. Unreife Ansätze des Geschäftsprozessmanagements:»BPM-Neulinge«versus»BPM-Einsteiger«. BPM-Neulinge sind von einer außergewöhnlich geringen Professionalisierung des Prozessmanagements (Gestaltungsfaktor 2) geprägt. Durch ebendieses Kriterium unterscheiden sich BPM-Neulinge von der Gruppe der BPM-Einsteiger. BPM-Einsteiger zeichnen sich nämlich dadurch aus, dass sie dem prozessorientierten Management hohe Bedeutung zumessen und deshalb verstärkte Aufmerksamkeit schenken, z. B. durch die Etablierung dedizierter Aus- und Weiterbildungsprogramme für die Prozessverantwortlichen. Reife Ansätze des Geschäftsprozessmanagements:»BPM-Kollektivisten«versus»BPM-Individualisten«. Im Gegensatz zur vorgenannten Klassifikation hinsichtlich der dem Geschäftsprozessmanagement zugemessenen Bedeutung vollzieht sich die Unterscheidung zwischen BPM-Kollektivisten und BPM-Individualisten auf der Ebene der konkreten Ausgestaltung des prozessorientierten Managementkonzepts. BPM-Kollektivisten stützen sich primär auf etablierte Standards sowie auf Vorgehens- und Referenzmodelle, wohingegen BPM-Individualisten eher die Implementierung eines»maßgeschneiderten«bpm-ansatzes verfolgen. Diese beiden als reif zu bezeichnenden Realisierungsformen des BPM unterscheiden sich folglich primär hinsichtlich der Gestaltungsfaktoren 2 und 4, d. h. hinsichtlich der Professionalisierung des BPM sowie der Nutzung etablierter Standards und Methoden. Die vier zuvor identifizierten BPM-Ansätze lassen sich gemäß den drei nachfolgend dargestellten Dimensionen klassifizieren (vgl. Abb. 2): Dimension 1:»Reifegrad des Prozessmanagements«. Als wichtigstes Differenzierungs- bzw. Klassifikationskriterium der identifizierten BPM-Realisierungsformen ist der Reifegrad des Prozessmanagements anzuführen. Diese Betrachtungsdimension ergibt sich auch aus der offenkundigen Trennung der vier Cluster in die 8 HMD 266
10 hohe Reife des Geschäftsprozessmanagements Gestaltungstyp des Prozessmanagements maßgeschneidert BPM- Individualisten standardbasiert BPM- Kollektivisten Abb. 2: Ansätze des Geschäftsprozessmanagements [Bucher & Winter 2007] BPM-Neulinge BPM-Einsteiger geringe Aufmerksamkeit hohe Aufmerksamkeit zugemessene Bedeutung geringe Reife des Geschäftsprozessmanagements Gruppe der BPM-Neulinge und der BPM-Einsteiger einerseits (tendenziell geringe Reife) und diejenige der BPM-Kollektivisten und der BPM- Individualisten andererseits (tendenziell hohe Reife). Dimension 2:»Zugemessene Bedeutung«. Wenn der Reifegrad der Prozessorientierung eher gering ist, kann davon ausgegangen werden, dass BPM in der Vergangenheit eine eher untergeordnete Rolle im Unternehmen gespielt hat. Die Differenzierung anhand der Aufmerksamkeit bzw. der Bedeutung, die dem prozessorientierten Managementkonzept gegenwärtig beigemessen wird, ermöglicht die Unterscheidung zwischen den BPM-Neulingen (geringe Aufmerksamkeit) und den BPM-Einsteigern (hohe Aufmerksamkeit). Der letztgenannte Ansatz kann als Übergangsphase hin zum prozessorientierten Paradigma charakterisiert werden. Dimension 3:»Gestaltungstyp des Prozessmanagements«. Ist der Reifegrad des BPM hingegen eher hoch (d. h., haben sich die Unternehmen bereits längere Zeit mit dem prozessorientierten Denken beschäftigt), so kann zwischen zwei Gestaltungstypen des BPM unterschieden werden. Die BPM-Kollektivisten stützen sich auf etablierte Standards sowie auf Vorgehens- und Referenzmodelle, wohingegen die BPM-Individualisten einen eher»maßgeschneiderten«ansatz des Prozessmanagements verfolgen. Aus diesem Grund bieten Unternehmen, die sich als BPM-Individualisten positionieren, den Prozessmanagern breit gefächerte Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und räumen ihnen weitreichende Entscheidungsbefugnisse bei der Prozessgestaltung und -ausführung ein. 2.4 BPM-Entwicklungspfade BPM-Entwicklungspfade beschreiben die Art und Richtung der Fort- bzw. Weiterentwicklung bestehender, in den Unternehmen angestoßener und/oder langjährig verankerter BPM-Initiativen. Um Aussagen bezüglich zukünftiger Entwicklungspfade treffen zu können, wurden neben den bisher betrachteten Istausprägungen auch die erhobenen Sollausprägungen in die Analyse einbezogen. Mithilfe der Technik der Regressionsanalyse wurden zunächst für alle 38 Beobachtungen (d. h. für alle der 38 befragten Unternehmen) die Sollausprägungen der vier BPM-Gestaltungsfaktoren berechnet. Im Anschluss daran erfolgte die Zuordnung der Sollbeobachtungen zu genau einem der vier zuvor identifizierten (Ist-)BPM-Ansätze. Als Maßzahl für die Zuordnung einer Beobachtung zu einem (Soll-)BPM-Ansatz wurde die minimale euklidische Distanz der Beobachtung zum Mittelwert der bestehenden Istcluster herangezogen. Eine ausführliche, formale Darstellung der verwendeten Methodik findet sich bei [Bucher & Winter 2009a]. HMD 266 9
11 Aus dem Vergleich der Istansätze (»Ausgangszustand«) und der Sollansätze (»Zielzustand«) ergeben sich fünf BPM-Entwicklungspfade (vgl. Abb. 3). Im Sinne von BPM- Projekttypen repräsentieren diese Entwicklungspfade die Transformation eines Unternehmens von einem Ausgangszustand zu einem (vom Ausgangszustand verschiedenen) Zielzustand. Dabei zeigt sich, dass mehr als 86 % der befragten Unternehmen den Übergang zu einem maßgeschneiderten BPM- Ansatz anstreben oder, sofern ein Unternehmen einen solchen Ansatz bereits verfolgt, sich weiterhin als der Realisierungsform der BPM-Individualisten zugehörig positionieren möchten. Demgegenüber stehen weniger als 14 % der Unternehmen, die entweder den Übergang zur Realisierungsform der BPM-Kollektivisten oder, sofern die Unternehmen diesen Ansatz bereits verfolgen, die Beibehaltung des standardbasierten Geschäftsprozessmanagements favorisieren. Die Analyse zeigt weiterhin, dass in Zukunft keines der befragten Unternehmen mehr einen als eher unreif zu bezeichnenden BPM-Ansatz verfolgen möchte (in Abb. 3 deshalb nicht berücksichtigt). Ferner war auch keine Transformation von der Realisierungsform der BPM-Individualisten hin zur Realisierungsform der BPM-Kollektivisten beobachtbar. Aufgrund des mengenmäßigen Übergewichts derjenigen Projekttypen, die eine Transformation hin zur Realisierungsform der BPM- Individualisten umfassen, werden diese drei Projekttypen 1, 2 und 3 im Folgenden als»dominante Entwicklungspfade des BPM«bezeichnet. Im Gegensatz dazu stehen die Projekttypen 4 und 5, die eine Transformation hin zur Realisierungsform der BPM-Kollektivisten beschreiben. Diese werden nachfolgend als»weniger bedeutungsvolle Entwicklungspfade des BPM«bezeichnet was jedoch nicht zum Ausdruck bringen soll, dass diese Entwicklungspfade nicht auch oder gerade deshalb ihre Berechtigung haben und für bestimmte Unternehmen eine konsequente, bestmögliche Weiterentwicklung des BPM repräsentieren. Im Einzelnen lassen sich die fünf Entwicklungspfade des Geschäftspro- Abb. 3: Entwicklungspfade des Geschäftsprozessmanagements 10 HMD 266
12 zessmanagements folgendermaßen charakterisieren: Projekttyp 1:»Transformation von BPM-Neulingen zu BPM-Individualisten«. Mehr als 26 % der befragten Unternehmen stehen zur Befragungszeit erst am Beginn ihrer BPM-Initiative, planen jedoch die Verfolgung eines reifen, maßgeschneiderten BPM-Ansatzes. Diese Unternehmen müssen sowohl den individuellen Reifegrad des Geschäftsprozessmanagements signifikant erhöhen als auch individuelle Herangehensweisen, Verfahren und Techniken für das Geschäftsprozessmanagement entwickeln. Projekttyp 2:»Transformation von BPM-Einsteigern zu BPM-Individualisten«. Gut 13 % der in die Untersuchung einbezogenen Unternehmen bezeichnen sich zur Befragungszeit als BPM-Einsteiger, d. h., sie haben bereits erste Erfahrungen im BPM-Umfeld gesammelt und messen dem Geschäftsprozessmanagement hohe Aufmerksamkeit und Bedeutung zu. Diese Unternehmen verfolgen das Ziel, einen reifen, individuell ausgestalteten und maßgeschneiderten BPM-Ansatz zu entwickeln. Wie bereits im Zusammenhang mit Projekttyp 1 angedeutet, müssen auch diese Unternehmen ihren BPM-Reifegrad erhöhen und gleichzeitig individuelle Herangehensweisen, Verfahren und Techniken für das Geschäftsprozessmanagement entwickeln. Projekttyp 3:»Transformation von BPM-Kollektivisten zu BPM-Individualisten«. Knapp 20 % der Unternehmen, die sich an der Untersuchung beteiligt haben, verfolgen einen standardbasierten BPM-Ansatz, streben jedoch eine Transformation hin zur Realisierungsform der BPM-Individualisten an. Beide BPM-Ansätze zeichnen sich durch hohe Reifegrade aus, weisen jedoch signifikante Unterschiede hinsichtlich der Ausgestaltung des Geschäftsprozessmanagements auf. Projekttypen 4 und 5:»Transformation von BPM-Neulingen zu BPM-Kollektivisten«/»Transformation von BPM-Einsteigern zu BPM-Kollektivisten«. Insgesamt weniger als 10 % der befragten Unternehmen streben, ausgehend von einer der beiden Realisierungsformen der BPM- Neulinge bzw. der BPM-Einsteiger, eine Weiterentwicklung hin zu einer standardbasierten Form des reifen Geschäftsprozessmanagements an. Aufgrund der geringen Verbreitung finden diese Entwicklungspfade des Geschäftsprozessmanagements in den nachfolgenden Betrachtungen keine weitere Berücksichtigung. 3 Situative Anpassung von BPM- Referenzmodellen und -Methoden 3.1 Anpassung eines Referenzprozessmodells Die Erkenntnisse aus der Befragung lassen sich für die situationsbezogene Adaption von Referenzprozessmodellen verwenden. Aus der Vielzahl existierender, teilweise sehr komplexer Referenzprozessmodelle wird als bewusst einfaches Beispiel das Referenzmodell des Relationship Banking nach [Mengue 2008] benutzt (vgl. Abb. 4). Das Modell unterscheidet im Sinne eines Ordnungsrahmens verschiedene Funktionsgruppen und Bereiche (z. B. die Gruppe der Kernfunktionen, die sich wiederum in die Bereiche Marketing, Service und Vertrieb gliedert). Für die im Ordnungsrahmen positionierten Prozesse (z. B. Kunden beraten) werden wiederum Prozessmodelle auf unterschiedlichen Detaillierungsstufen vorgegeben. In Abhängigkeit vom verfolgten BPM-Ansatz wird die Selektion und Implementierung der Referenzprozesse bzw. der Prozessgruppen unterschiedlichen Kriterien folgen. BPM-Neulinge und BPM-Einsteiger stehen am Beginn ihrer BPM-Initiativen. Es empfiehlt sich deshalb, zunächst vergleichsweise wenig komplexe Prozesse auszuwählen und zu implementieren, um erste Erfahrungen mit dem Management von Geschäftsprozessen zu sammeln. Aufgrund der ausschließlich unternehmensinternen Ausrichtung empfehlen sich beispielsweise die Prozesse aus dem Bereich Marketing. Deutlich höhere Komplexität weisen hingegen diejenigen HMD
13 Abb. 4: Relationship-Banking-Referenzmodell (nach [Mengue 2008]) Prozesse auf, die Schnittstellen zu Kunden und/ oder externen Leistungserbringern besitzen, wie z. B. die Leistungserbringung oder die Abwicklung von Kundenaufträgen. Eine Übernahme solcher Prozesse erfordert eine gewisse Professionalisierung des Geschäftsprozessmanagements und eignet sich deshalb eher für die Realisierungsformen der BPM-Kollektivisten oder der BPM-Individualisten. In Ergänzung zur vorstehend skizzierten, vom vorliegenden BPM-Ansatz abhängigen Selektion bestimmter Elemente des Referenzprozessmodells (d. h. einzelner Prozesse oder Prozessgruppen) ist darüber hinaus zu vermuten, dass unterschiedliche Unternehmen im Zuge der unternehmensspezifischen Adaption und Implementierung von Prozessen auf Grundlage des gleichen Referenzmodells zu vollkommen unterschiedlichen unternehmensspezifischen Zustandsempfehlungen gelangen. Als Beispiel seien die zwei»reifen«ansätze der BPM-Kollektivisten und der BPM-Individualisten gegenübergestellt: BPM-Kollektivisten stützen sich gemäß den Befragungsergebnissen stark auf etablierte Standards, Referenzen und»best Practices«, während BPM-Individualisten in deutlich stärkerem Maße eigenständige, individuelle Lösungen entwickeln. Hierzu bedienen sich BPM-Individualisten zwar durchaus bestehender Lösungen, nutzen diese jedoch primär als Ausgangspunkt für die Entwicklung eigener Ideen und Ansätze. BPM-Kollektivisten tendieren hingegen dazu, bestehende Lösungen als»blaupause«zu betrachten und ohne größere Veränderungen und Anpassungen umzusetzen. 3.2 Anpassung einer Methode Die Erkenntnisse aus der Befragung lassen sich auch als Grundlage für die situationsspezifische Anpassung und Ausgestaltung von Handlungsempfehlungen bzw. Methoden im BPM-Umfeld heranziehen. Da die Anwendung einer Methode stets eine Transformation von einem Ausgangszustand zu einem (abweichenden) Zielzustand impliziert, sind hierfür im Unterschied zur Anpassung von Zustandsempfehlungen 12 HMD 266
2.1.1 Modelle des Informationsmanagements ITIL Information Technology Infrastructure Library 36
 Vorwort 6 Zum Gebrauch des Kompaktkurses 8 Inhaltsverzeichnis 12 Abbildungsverzeichnis 16 Tabellenverzeichnis 18 Abkürzungsverzeichnis 20 1 Was ist Wirtschaftsinformatik? 22 1.1 Fallstudie: Reiseveranstalter
Vorwort 6 Zum Gebrauch des Kompaktkurses 8 Inhaltsverzeichnis 12 Abbildungsverzeichnis 16 Tabellenverzeichnis 18 Abkürzungsverzeichnis 20 1 Was ist Wirtschaftsinformatik? 22 1.1 Fallstudie: Reiseveranstalter
Inhaltsübersicht Grundlagen der Organisation: Was ist unter Organisation zu verstehen?
 Inhaltsübersicht. 1 Grundlagen der Organisation: Was ist unter Organisation zu verstehen?... 1 1.1 Ein erster Blick in die Organisationspraxis: Organisation als Erfolgsfaktor... 1 1.2 Grundbegriffe der
Inhaltsübersicht. 1 Grundlagen der Organisation: Was ist unter Organisation zu verstehen?... 1 1.1 Ein erster Blick in die Organisationspraxis: Organisation als Erfolgsfaktor... 1 1.2 Grundbegriffe der
Maturity Model for Business Process Management
 Maturity Model for Business Process Management Erfolg mit Prozessmanagement ist messbar Januar 2013 Copyright BPM Maturity Model eden e.v. 1 Zielsetzungen für eden Das Reifegradmodell eden wird seit 2006
Maturity Model for Business Process Management Erfolg mit Prozessmanagement ist messbar Januar 2013 Copyright BPM Maturity Model eden e.v. 1 Zielsetzungen für eden Das Reifegradmodell eden wird seit 2006
Inhalt 1. Einleitung: Kontrollverlust durch Social Media? Unternehmenskommunikation als wirtschaftliches Handeln 21
 Inhalt Vorwort 11 1. Einleitung: Kontrollverlust durch Social Media? 15 1.1 Forschungsinteresse: Social Media und Anpassungen des Kommunikationsmanagements 16 1.2 Vorgehensweise der Untersuchung 18 2.
Inhalt Vorwort 11 1. Einleitung: Kontrollverlust durch Social Media? 15 1.1 Forschungsinteresse: Social Media und Anpassungen des Kommunikationsmanagements 16 1.2 Vorgehensweise der Untersuchung 18 2.
Vorwort zur 2., überarbeiteten und aktualisierten Auflage... V Vorwort zur 1. Auflage... VII Abbildungsverzeichnis... XIII
 IX Inhaltsverzeichnis Vorwort zur 2., überarbeiteten und aktualisierten Auflage................ V Vorwort zur 1. Auflage......................................... VII Abbildungsverzeichnis........................................
IX Inhaltsverzeichnis Vorwort zur 2., überarbeiteten und aktualisierten Auflage................ V Vorwort zur 1. Auflage......................................... VII Abbildungsverzeichnis........................................
Zielsetzung. Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Ziele können unterschieden werden nach:
![Zielsetzung. Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Ziele können unterschieden werden nach: Zielsetzung. Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Ziele können unterschieden werden nach:](/thumbs/50/26220103.jpg) Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Zielsetzung Jedes Unternehmen setzt sich Ziele Egal ob ein Unternehmen neu gegründet oder eine bestehende Organisation verändert werden soll, immer wieder
Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Zielsetzung Jedes Unternehmen setzt sich Ziele Egal ob ein Unternehmen neu gegründet oder eine bestehende Organisation verändert werden soll, immer wieder
Verstehen als Grundvoraussetzung für Industrie 4.0
 Verstehen als Grundvoraussetzung für Industrie 4.0 Eine Studie der H&D International Group beleuchtet den aktuellen Stand der Zusammenarbeit zwischen IT und Produktion 2 Inhalt Einleitung 3 Aktuelle Situation
Verstehen als Grundvoraussetzung für Industrie 4.0 Eine Studie der H&D International Group beleuchtet den aktuellen Stand der Zusammenarbeit zwischen IT und Produktion 2 Inhalt Einleitung 3 Aktuelle Situation
Benchmarking von Energieversorgern
 Benchmarking von Energieversorgern Eine empirische Studie in Kooperation mit APQC Center für kommunale Energiewirtschaft Benchmarking Center Europe INeKO Institut an der Universität zu Köln DAS CENTER
Benchmarking von Energieversorgern Eine empirische Studie in Kooperation mit APQC Center für kommunale Energiewirtschaft Benchmarking Center Europe INeKO Institut an der Universität zu Köln DAS CENTER
Inhaltsverzeichnis. Abbildungsverzeichnis. Tabellenverzeichnis. Abkürzungsverzeichnis
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis IX XI XVII XIX XXI 1 Einleitung 1 1.1 Problemstellung 1 1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen
Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis IX XI XVII XIX XXI 1 Einleitung 1 1.1 Problemstellung 1 1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen
Inhaltsverzeichnis. Geleitwort 1 Vorwort 3 Abkürzungsverzeichnis 5
 7 Inhaltsverzeichnis Geleitwort 1 Vorwort 3 Abkürzungsverzeichnis 5 1 Zunehmende Prozessorientierung als Entwicklungstendenz im gesundheitspolitischen Umfeld des Krankenhauses 13 Günther E. Braun 1.1 Strukturwandel
7 Inhaltsverzeichnis Geleitwort 1 Vorwort 3 Abkürzungsverzeichnis 5 1 Zunehmende Prozessorientierung als Entwicklungstendenz im gesundheitspolitischen Umfeld des Krankenhauses 13 Günther E. Braun 1.1 Strukturwandel
"Unternehmensziel Qualität" Wettbewerbsvorteile durch Qualitätsmanagementsysteme
 "Unternehmensziel Qualität" Wettbewerbsvorteile durch Qualitätsmanagementsysteme Gliederung 1. Wettbewerbsfaktor Qualität 2. Der Ablauf 3. Die Ist-Analyse 4. Die Dokumentation 5. Werkzeuge, Methoden, Instrumente
"Unternehmensziel Qualität" Wettbewerbsvorteile durch Qualitätsmanagementsysteme Gliederung 1. Wettbewerbsfaktor Qualität 2. Der Ablauf 3. Die Ist-Analyse 4. Die Dokumentation 5. Werkzeuge, Methoden, Instrumente
Strategisches Management. BATCON Business and Technology Consulting GmbH +43/664/
 Strategisches Management BATCON Business and Technology Consulting GmbH www.batcon.at office@batcon.at +43/664/88725724 1 Inhalte der Präsentation I Strategisches Management Abgrenzung der Begriffe und
Strategisches Management BATCON Business and Technology Consulting GmbH www.batcon.at office@batcon.at +43/664/88725724 1 Inhalte der Präsentation I Strategisches Management Abgrenzung der Begriffe und
Struktur der Querschnittsfunktionen und Effektivität: Prozessverbesserung
 Struktur der Querschnittsfunktionen und Effektivität: Prozessverbesserung Unternehmen haben neben der funktionalen Aufbauorganisation auch bereichsübergreifende Aufgaben. Die Zielsetzung einer Querschnittsfunktion
Struktur der Querschnittsfunktionen und Effektivität: Prozessverbesserung Unternehmen haben neben der funktionalen Aufbauorganisation auch bereichsübergreifende Aufgaben. Die Zielsetzung einer Querschnittsfunktion
Konzeption und Evaluation eines Ansatzes zur Methodenintegration im Qualitätsmanagement
 Konzeption und Evaluation eines Ansatzes zur Methodenintegration im Qualitätsmanagement Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Wirtschaftswissenschaft eingereicht an der Wirtschaftswissenschaftlichen
Konzeption und Evaluation eines Ansatzes zur Methodenintegration im Qualitätsmanagement Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Wirtschaftswissenschaft eingereicht an der Wirtschaftswissenschaftlichen
Risiken für die deutsche Lebensmittelindustrie sowie den -handel bezüglich der Lebensmittelsicherheit beim Rohstoffbezug aus China
 Risiken für die deutsche Lebensmittelindustrie sowie den -handel bezüglich der Lebensmittelsicherheit beim Rohstoffbezug aus China Fallstudie am Beispiel des Imports von Obst und Gemüse Charakterisierung
Risiken für die deutsche Lebensmittelindustrie sowie den -handel bezüglich der Lebensmittelsicherheit beim Rohstoffbezug aus China Fallstudie am Beispiel des Imports von Obst und Gemüse Charakterisierung
Publikationsanalyse zur Corporate Governance - Status Quo und Entwicklungsperspektiven
 Wirtschaft Kerstin Dittmann / Matthias Brockmann / Tobias Gödrich / Benjamin Schäfer Publikationsanalyse zur Corporate Governance - Status Quo und Entwicklungsperspektiven Wissenschaftlicher Aufsatz Strategisches
Wirtschaft Kerstin Dittmann / Matthias Brockmann / Tobias Gödrich / Benjamin Schäfer Publikationsanalyse zur Corporate Governance - Status Quo und Entwicklungsperspektiven Wissenschaftlicher Aufsatz Strategisches
Betrieblicher Einsatz von Kompetenzpässen. Navigationssystem für Unternehmen
 Betrieblicher Einsatz von Kompetenzpässen Navigationssystem für Unternehmen Projekt: Transparenz informell erworbener Kompetenzen Nutzung von Kompetenzpässen durch Arbeitgeber Laufzeit: 1. Juni 2008 bis
Betrieblicher Einsatz von Kompetenzpässen Navigationssystem für Unternehmen Projekt: Transparenz informell erworbener Kompetenzen Nutzung von Kompetenzpässen durch Arbeitgeber Laufzeit: 1. Juni 2008 bis
Performance steigern mit dem Team Relation Performance Management Survey (TRPM) Anforderungen an ein zeitgemäßes Performance Management
 Performance steigern mit dem Team Relation Performance Management Survey (TRPM) Anforderungen an ein zeitgemäßes Performance Management Performance Management und die jährlichen Gespräche dazu erleben
Performance steigern mit dem Team Relation Performance Management Survey (TRPM) Anforderungen an ein zeitgemäßes Performance Management Performance Management und die jährlichen Gespräche dazu erleben
Vorwort. Hermann J. Schmelzer, Wolfgang Sesselmann. Geschäftsprozessmanagement in der Praxis
 Vorwort Hermann J. Schmelzer, Wolfgang Sesselmann Geschäftsprozessmanagement in der Praxis Kunden zufrieden stellen - Produktivität steigern - Wert erhöhen ISBN (Buch): 978-3-446-43460-8 Weitere Informationen
Vorwort Hermann J. Schmelzer, Wolfgang Sesselmann Geschäftsprozessmanagement in der Praxis Kunden zufrieden stellen - Produktivität steigern - Wert erhöhen ISBN (Buch): 978-3-446-43460-8 Weitere Informationen
Inhaltsverzeichnis. Vorwort der Herausgeber... V Vorwort des Verfassers zur 1. Auflage... VII Vorwort des Verfassers zur 5. Auflage...
 XI Vorwort der Herausgeber... V Vorwort des Verfassers zur 1. Auflage... VII Vorwort des Verfassers zur 5. Auflage... IX Abkürzungsverzeichnis... XVII Abbildungsverzeichnis... XX 1 Grundlagen der Organisation:
XI Vorwort der Herausgeber... V Vorwort des Verfassers zur 1. Auflage... VII Vorwort des Verfassers zur 5. Auflage... IX Abkürzungsverzeichnis... XVII Abbildungsverzeichnis... XX 1 Grundlagen der Organisation:
Kapitel 2, Führungskräftetraining, Kompetenzentwicklung und Coaching:
 Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? von Tanja Hollinger 1. Auflage Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? Hollinger schnell und portofrei
Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? von Tanja Hollinger 1. Auflage Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? Hollinger schnell und portofrei
Die Neuerungen bei den Anforderungen nach dem DStV-Qualitätssiegel. Anforderungen nach dem DStV-Qualitätssiegel
 Die Neuerungen bei den Anforderungen nach dem DStV-Qualitätssiegel Anforderungen nach dem DStV-Qualitätssiegel Neuerungen bei den Anforderungen des DStV-Qualitätssiegels aufgrund der neuen DIN EN ISO 9001:2015
Die Neuerungen bei den Anforderungen nach dem DStV-Qualitätssiegel Anforderungen nach dem DStV-Qualitätssiegel Neuerungen bei den Anforderungen des DStV-Qualitätssiegels aufgrund der neuen DIN EN ISO 9001:2015
Nachteile: arbeitsplatzbezogene, isolierte Aufgaben Veränderungen sind schwer durchzusetzen hohe Redundanz von Aufgaben hoher Zeitaufwand und Kosten
 Von Aufgaben zu Prozessen Neue Herausforderung für die Kommunalverwaltung DVZ-MV GmbH Jana a Schmidt 12.03.2009 1 Entwicklung der aufgabenorientierten Verwaltung Folgt der traditionellen Organisationsgestaltung:
Von Aufgaben zu Prozessen Neue Herausforderung für die Kommunalverwaltung DVZ-MV GmbH Jana a Schmidt 12.03.2009 1 Entwicklung der aufgabenorientierten Verwaltung Folgt der traditionellen Organisationsgestaltung:
Business Workshop. Reorganisation. Die Entwicklung der idealen Organisation
 Business Workshop Organisation GRONBACH Die Entwicklung der idealen Organisation Jedes Unternehmen steht irgendwann vor der Aufgabe, die Organisation an den aktuellen oder künftigen Gegebenheit anzupassen.
Business Workshop Organisation GRONBACH Die Entwicklung der idealen Organisation Jedes Unternehmen steht irgendwann vor der Aufgabe, die Organisation an den aktuellen oder künftigen Gegebenheit anzupassen.
Komplexität als Chance nutzen
 Komplexität als Chance nutzen White Paper Autor: Jens Blank Januar 2012 Wassermann AG Westendstraße 195 80686 München www.wassermann.de Zusammenfassung Komplexität na und? Unter diesem Motto beschreibt
Komplexität als Chance nutzen White Paper Autor: Jens Blank Januar 2012 Wassermann AG Westendstraße 195 80686 München www.wassermann.de Zusammenfassung Komplexität na und? Unter diesem Motto beschreibt
Positionsprofil. Entwicklungsleiter Messtechnik
 Positionsprofil Entwicklungsleiter Messtechnik Das Unternehmen / Hintergründe Unser Kunde kann auf eine über 90jährige Unternehmenshistorie zurückblicken und zählt heute zu einem der führenden Unternehmen
Positionsprofil Entwicklungsleiter Messtechnik Das Unternehmen / Hintergründe Unser Kunde kann auf eine über 90jährige Unternehmenshistorie zurückblicken und zählt heute zu einem der führenden Unternehmen
2. Funktion von Leitbildern Folgende Funktionen von Leitbildern können unterschieden werden:
 Leitbilder 1. Definition Leitbild Ein Leitbild stellt die Erklärung der allgemeinen Grundsätze einer Schule dar, die sich nach innen an die Mitarbeiter und SchülerInnen wenden und nach außen an Eltern
Leitbilder 1. Definition Leitbild Ein Leitbild stellt die Erklärung der allgemeinen Grundsätze einer Schule dar, die sich nach innen an die Mitarbeiter und SchülerInnen wenden und nach außen an Eltern
MEDIENINFORMATION. Zürich,
 MEDIENINFORMATION Zürich, 6.11. 2013 Emotionale Barrieren im Umgang mit Social Media: Die persönliche Einstellung von Führungskräften zu Social Media ist der relevante Treiber für die Nutzung in Unternehmen.
MEDIENINFORMATION Zürich, 6.11. 2013 Emotionale Barrieren im Umgang mit Social Media: Die persönliche Einstellung von Führungskräften zu Social Media ist der relevante Treiber für die Nutzung in Unternehmen.
HERZLICH WILLKOMMEN. Revision der 9001:2015
 HERZLICH WILLKOMMEN Revision der 9001:2015 Volker Landscheidt Qualitätsmanagementbeauftragter DOYMA GmbH & Co 28876 Oyten Regionalkreisleiter DQG Elbe-Weser Die Struktur der ISO 9001:2015 Einleitung Kapitel
HERZLICH WILLKOMMEN Revision der 9001:2015 Volker Landscheidt Qualitätsmanagementbeauftragter DOYMA GmbH & Co 28876 Oyten Regionalkreisleiter DQG Elbe-Weser Die Struktur der ISO 9001:2015 Einleitung Kapitel
Dietmar Vahs. Organisation. Ein Lehr- und Managementbuch. 8., überarbeitete und erweiterte Auflage Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart
 Dietmar Vahs Organisation Ein Lehr- und Managementbuch 8., überarbeitete und erweiterte Auflage 2012 Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart XIII Vorwort zur 8. Auflage Vorwort zur 1. Auflage Abkürzungsverzeichnis
Dietmar Vahs Organisation Ein Lehr- und Managementbuch 8., überarbeitete und erweiterte Auflage 2012 Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart XIII Vorwort zur 8. Auflage Vorwort zur 1. Auflage Abkürzungsverzeichnis
Bachelorarbeit. Zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B.Sc.) im
 Elektromobilität in Deutschland: eine empirische Untersuchung der Akzeptanz von Elektrofahrzeugen Bachelorarbeit Zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B.Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft
Elektromobilität in Deutschland: eine empirische Untersuchung der Akzeptanz von Elektrofahrzeugen Bachelorarbeit Zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B.Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft
Arbeitsanweisung. Prozessorientierter Ansatz und Wechselwirkung von Prozessen VA
 Arbeitsanweisung Prozessorientierter Ansatz und Wechselwirkung von Prozessen VA04010100 Revisionsstand: 02 vom 24.11.16 Ersetzt Stand: 01 vom 14.10.08 Ausgabe an Betriebsfremde nur mit Genehmigung der
Arbeitsanweisung Prozessorientierter Ansatz und Wechselwirkung von Prozessen VA04010100 Revisionsstand: 02 vom 24.11.16 Ersetzt Stand: 01 vom 14.10.08 Ausgabe an Betriebsfremde nur mit Genehmigung der
Digitale Transformation von Non-Profits wie digital fit ist der Dritte Sektor?
 Digitale Transformation von Non-Profits wie digital fit ist der Dritte Sektor? Eine Blitzlicht-Umfrage der kopf.consulting unter Non-Profit Entscheidern August 2016 1. Einleitung kopf.consulting begleitet
Digitale Transformation von Non-Profits wie digital fit ist der Dritte Sektor? Eine Blitzlicht-Umfrage der kopf.consulting unter Non-Profit Entscheidern August 2016 1. Einleitung kopf.consulting begleitet
Elisabeth-Selbert-Schule. Vortrag Qualitätsentwicklung in berufsbildenden Schulen (EFQM)
 Donnerstag, 12.02.2009 13.00 bis 14.00 Uhr Vortrag Qualitätsentwicklung in berufsbildenden Schulen (EFQM) Gisela Grimme Schulleiterin der Elisabeth-Selbert-Schule in Hameln Susanne Hoffmann Qualitätsbeauftragte
Donnerstag, 12.02.2009 13.00 bis 14.00 Uhr Vortrag Qualitätsentwicklung in berufsbildenden Schulen (EFQM) Gisela Grimme Schulleiterin der Elisabeth-Selbert-Schule in Hameln Susanne Hoffmann Qualitätsbeauftragte
2 Geschäftsprozesse realisieren
 2 Geschäftsprozesse realisieren auf fünf Ebenen Modelle sind vereinfachte Abbilder der Realität und helfen, Zusammenhänge einfach und verständlich darzustellen. Das bekannteste Prozess-Modell ist das Drei-Ebenen-Modell.
2 Geschäftsprozesse realisieren auf fünf Ebenen Modelle sind vereinfachte Abbilder der Realität und helfen, Zusammenhänge einfach und verständlich darzustellen. Das bekannteste Prozess-Modell ist das Drei-Ebenen-Modell.
Transformation bestehender Geschäftsmodelle und -prozesse für eine erfolgreiche Digitalisierung
 Transformation bestehender Geschäftsmodelle und -prozesse für eine erfolgreiche Digitalisierung VPP-Tagung, TU Chemnitz Smarte Fabrik & smarte Arbeit Industrie 4.0 gewinnt Kontur Session 4.0 im Mittelstand
Transformation bestehender Geschäftsmodelle und -prozesse für eine erfolgreiche Digitalisierung VPP-Tagung, TU Chemnitz Smarte Fabrik & smarte Arbeit Industrie 4.0 gewinnt Kontur Session 4.0 im Mittelstand
Welchen Nutzen bringt COBIT 5?
 Welchen Nutzen bringt COBIT 5? Optimale Aufstellung der Unternehmens-IT zur Erreichung der Unternehmensziele: Steigerung des Unternehmenswertes Zufriedenheit der Geschäftsanwender Einhaltung der einschlägigen
Welchen Nutzen bringt COBIT 5? Optimale Aufstellung der Unternehmens-IT zur Erreichung der Unternehmensziele: Steigerung des Unternehmenswertes Zufriedenheit der Geschäftsanwender Einhaltung der einschlägigen
Sozialwissenschaftliche Methoden und Methodologie. Begriffe, Ziele, Systematisierung, Ablauf. Was ist eine Methode?
 Sozialwissenschaftliche Methoden und Methodologie WiSe 2007/ 08 Prof. Dr. Walter Hussy Veranstaltung 1 Begriffe, Ziele, Systematisierung, Ablauf 24.01.2008 1 Was ist eine Methode? Eine Methode ist eine
Sozialwissenschaftliche Methoden und Methodologie WiSe 2007/ 08 Prof. Dr. Walter Hussy Veranstaltung 1 Begriffe, Ziele, Systematisierung, Ablauf 24.01.2008 1 Was ist eine Methode? Eine Methode ist eine
Johannes Christian Panitz
 Johannes Christian Panitz Compliance-Management Anforderungen, Herausforderungen und Scorecard-basierte Ansätze für eine integrierte Compliance-Steuerung Verlag Dr. Kovac Hamburg 2012 VORWORT ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Johannes Christian Panitz Compliance-Management Anforderungen, Herausforderungen und Scorecard-basierte Ansätze für eine integrierte Compliance-Steuerung Verlag Dr. Kovac Hamburg 2012 VORWORT ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse
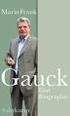 Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse These: Die organisatorische Vermittlung außenpolitischer Entscheidungen ist für die inhaltliche Ausgestaltung der Außenpolitik von Bedeutung
Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse These: Die organisatorische Vermittlung außenpolitischer Entscheidungen ist für die inhaltliche Ausgestaltung der Außenpolitik von Bedeutung
DATENSCHUTZ: NOTWENDIGE BÜROKRATIE ODER WETTBEWERBSVORTEIL IM UMGANG MIT DIGITALEN KUNDENDATEN?
 F R AUNHO F ER -IN S T IT U T F Ü R A N G E WA N D TE IN FORM ATION STECH N IK FIT DATENSCHUTZ: NOTWENDIGE BÜROKRATIE ODER WETTBEWERBSVORTEIL IM UMGANG MIT DIGITALEN KUNDENDATEN? DATENSCHUTZ GEWINNT ZUNEHMEND
F R AUNHO F ER -IN S T IT U T F Ü R A N G E WA N D TE IN FORM ATION STECH N IK FIT DATENSCHUTZ: NOTWENDIGE BÜROKRATIE ODER WETTBEWERBSVORTEIL IM UMGANG MIT DIGITALEN KUNDENDATEN? DATENSCHUTZ GEWINNT ZUNEHMEND
Teil I: Offenes Beispiel
 Methodenlehreklausur 3/98 1 Teil I: Offenes Beispiel Sperka, Markus (1997). Zur Entwicklung eines Fragebogens zur Erfassung der Kommunikation in Organisationen (KomminO). Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie,
Methodenlehreklausur 3/98 1 Teil I: Offenes Beispiel Sperka, Markus (1997). Zur Entwicklung eines Fragebogens zur Erfassung der Kommunikation in Organisationen (KomminO). Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie,
NUTZEN UND UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN VON BETRIEBLICHER GESUNDHEITSFÖRDERUNG IM UNTERNHEMEN JOB UND FIT IN FORM Symposium 2013
 NUTZEN UND UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN VON BETRIEBLICHER GESUNDHEITSFÖRDERUNG IM UNTERNHEMEN JOB UND FIT IN FORM Symposium 2013 Bonn, am 17.10.2013 Prof. Dr. Volker Nürnberg Leiter Health Management Mercer
NUTZEN UND UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN VON BETRIEBLICHER GESUNDHEITSFÖRDERUNG IM UNTERNHEMEN JOB UND FIT IN FORM Symposium 2013 Bonn, am 17.10.2013 Prof. Dr. Volker Nürnberg Leiter Health Management Mercer
Ein Integriertes Berichtswesen als Führungshilfe
 Ein Integriertes Berichtswesen als Führungshilfe Begleitung eines kennzahlgestützten Berichtswesens zur Zielerreichung Tilia Umwelt GmbH Agenda 1. Was bedeutet Führung? 2. Was bedeutet Führung mit Hilfe
Ein Integriertes Berichtswesen als Führungshilfe Begleitung eines kennzahlgestützten Berichtswesens zur Zielerreichung Tilia Umwelt GmbH Agenda 1. Was bedeutet Führung? 2. Was bedeutet Führung mit Hilfe
Reflexionsworkshop Strategischer Einbezug von Akteuren. 19. November 2010 Regiestelle Weiterbildung
 Reflexionsworkshop 19.11.2010 Strategischer Einbezug von Akteuren 19. November 2010 Regiestelle Weiterbildung Projekttypen Projekttyp I. Ermittlung des branchenspezifischen Qualifizierungsbedarfs II. Qualifizierungsmaßnahmen
Reflexionsworkshop 19.11.2010 Strategischer Einbezug von Akteuren 19. November 2010 Regiestelle Weiterbildung Projekttypen Projekttyp I. Ermittlung des branchenspezifischen Qualifizierungsbedarfs II. Qualifizierungsmaßnahmen
6. Movano-Verbundtreffen Gera,
 6. Movano-Verbundtreffen Gera, 26.-27.04.2010 Überblick 1. Der Movano-Ansatz: Innovation und gute Arbeit 2. Gute Arbeit: große Hoffnungen, ernüchternde Realitäten 3. Gute Arbeit kein Selbstläufer! 4 Die
6. Movano-Verbundtreffen Gera, 26.-27.04.2010 Überblick 1. Der Movano-Ansatz: Innovation und gute Arbeit 2. Gute Arbeit: große Hoffnungen, ernüchternde Realitäten 3. Gute Arbeit kein Selbstläufer! 4 Die
Gerit Grübler (Autor) Ganzheitliches Multiprojektmanagement Mit einer Fallstudie in einem Konzern der Automobilzulieferindustrie
 Gerit Grübler (Autor) Ganzheitliches Multiprojektmanagement Mit einer Fallstudie in einem Konzern der Automobilzulieferindustrie https://cuvillier.de/de/shop/publications/2491 Copyright: Cuvillier Verlag,
Gerit Grübler (Autor) Ganzheitliches Multiprojektmanagement Mit einer Fallstudie in einem Konzern der Automobilzulieferindustrie https://cuvillier.de/de/shop/publications/2491 Copyright: Cuvillier Verlag,
Vom steuerlichen Kontrollsystem zum Tax Performance Management System. Das innerbetriebliche Kontrollsystem zur Erfüllung der steuerlichen Pflichten
 Vom steuerlichen Kontrollsystem zum Tax Performance Management System Das innerbetriebliche Kontrollsystem zur Erfüllung der steuerlichen Pflichten Anforderungen Risiko Tax Compliance? Unternehmen sind
Vom steuerlichen Kontrollsystem zum Tax Performance Management System Das innerbetriebliche Kontrollsystem zur Erfüllung der steuerlichen Pflichten Anforderungen Risiko Tax Compliance? Unternehmen sind
Produktbaukästen entwickeln. Unsere Roadmap zum Erfolg
 Produktbaukästen entwickeln Unsere Roadmap zum Erfolg Welche Varianten / Optionen sollen entwickelt werden? Die Fähigkeit, kundenindividuelle Lösungen zu marktfähigen Preisen anzubieten, wird in Zeiten
Produktbaukästen entwickeln Unsere Roadmap zum Erfolg Welche Varianten / Optionen sollen entwickelt werden? Die Fähigkeit, kundenindividuelle Lösungen zu marktfähigen Preisen anzubieten, wird in Zeiten
STUDIE: Psychologische Verfahren der externen Personalauswahl aus Sicht der Bewerber
 STUDIE: Psychologische Verfahren der externen Personalauswahl aus Sicht der Bewerber personnel insight Deinhardplatz 3 56068 Koblenz Tel.: 0261 9213900 nicole.broockmann@personnel-insight.de Theoretischer
STUDIE: Psychologische Verfahren der externen Personalauswahl aus Sicht der Bewerber personnel insight Deinhardplatz 3 56068 Koblenz Tel.: 0261 9213900 nicole.broockmann@personnel-insight.de Theoretischer
2. BPM Symposium am 28. November 2013 in Iserlohn
 2. BPM Symposium am 28. November 2013 in Iserlohn BPM für den Mittelstand IYOPRO Projekte, Erfahrungsberichte und Trends BPM & Projektmanagement Wie kann BPM in methodisch strukturierten Projekten erfolgreich
2. BPM Symposium am 28. November 2013 in Iserlohn BPM für den Mittelstand IYOPRO Projekte, Erfahrungsberichte und Trends BPM & Projektmanagement Wie kann BPM in methodisch strukturierten Projekten erfolgreich
2.2. Wissenschaftstheoretische Grundzüge der Gewinnung von Erkenntnissen über Märkte 10
 Vorwort V Abbildungsverzeichnis XIII 1. Überblick über die behandelten Problembereiche 3 2. Aufgaben und wissenschaftstheoretische Grundzüge der Marktforschung 9 2.1. Klassische Aufgaben der Marktforschung
Vorwort V Abbildungsverzeichnis XIII 1. Überblick über die behandelten Problembereiche 3 2. Aufgaben und wissenschaftstheoretische Grundzüge der Marktforschung 9 2.1. Klassische Aufgaben der Marktforschung
Informationssystemanalyse People Capability Maturity Model 6 1
 Informationssystemanalyse People Capability Maturity Model 6 1 People Capability Maturity Model Neben dem CMM, welches primär zur Verbesserung des Entwicklunsprozesses eingesetzt wird, existiert mit dem
Informationssystemanalyse People Capability Maturity Model 6 1 People Capability Maturity Model Neben dem CMM, welches primär zur Verbesserung des Entwicklunsprozesses eingesetzt wird, existiert mit dem
Der Forschungsprozess in der Quantitativen Sozialforschung. Crash-Kurs
 Der Forschungsprozess in der Quantitativen Sozialforschung Eine jede empirische Studie ist ein PROZESS. Definition: Unter PROZESS ist der Ablauf von Strukturen zu verstehen. Definition: Unter STRUKTUR
Der Forschungsprozess in der Quantitativen Sozialforschung Eine jede empirische Studie ist ein PROZESS. Definition: Unter PROZESS ist der Ablauf von Strukturen zu verstehen. Definition: Unter STRUKTUR
Volker Gruhn paluno. Industrialisierung, Standardisierung und Wettbewerbsvorteile Digitalisierung von Geschäftsprozessen
 Volker Gruhn Industrialisierung, Standardisierung und Wettbewerbsvorteile Digitalisierung von Geschäftsprozessen Unsere Dienstleistungen Unsere Schwerpunkte Standard Norm 4 Standardisierung von Prozessen
Volker Gruhn Industrialisierung, Standardisierung und Wettbewerbsvorteile Digitalisierung von Geschäftsprozessen Unsere Dienstleistungen Unsere Schwerpunkte Standard Norm 4 Standardisierung von Prozessen
Controlling in Nonprofit- Organisationen
 Christian Horak Controlling in Nonprofit- Organisationen Erfolgsfaktoren und Instrumente 2. Auflage DeutscherUniversitätsVerlag GABLER VIEWEG WESTDEUTSCHER VERLAG INHALTSVERZEICHNIS 0 Einleitung 1 0.0
Christian Horak Controlling in Nonprofit- Organisationen Erfolgsfaktoren und Instrumente 2. Auflage DeutscherUniversitätsVerlag GABLER VIEWEG WESTDEUTSCHER VERLAG INHALTSVERZEICHNIS 0 Einleitung 1 0.0
Strategie ist ein Erfolgsfaktor gute Strategiearbeit steigert das Ergebnis
 Strategie ist ein Erfolgsfaktor gute Strategiearbeit steigert das Ergebnis 2 Die Strategie legt die grundsätzliche Ausrichtung eines Unternehmens fest und bestimmt die Gestaltung der Ressourcen und Kompetenzen
Strategie ist ein Erfolgsfaktor gute Strategiearbeit steigert das Ergebnis 2 Die Strategie legt die grundsätzliche Ausrichtung eines Unternehmens fest und bestimmt die Gestaltung der Ressourcen und Kompetenzen
Maturity Model for Business Process Management
 Maturity Model for Business Process Management Erfolg mit Prozessmanagement ist messbar Januar 2011 Copyright BPM Maturity Model eden e.v. 1 Entwicklungspartner und Mitglieder Entwickelt aus der Praxis
Maturity Model for Business Process Management Erfolg mit Prozessmanagement ist messbar Januar 2011 Copyright BPM Maturity Model eden e.v. 1 Entwicklungspartner und Mitglieder Entwickelt aus der Praxis
your IT in line with your Business Geschäftsprozessmanagement (GPM)
 your IT in line with your Business Geschäftsprozessmanagement (GPM) Transparenz schaffen und Unternehmensziele effizient erreichen Transparente Prozesse für mehr Entscheidungssicherheit Konsequente Ausrichtung
your IT in line with your Business Geschäftsprozessmanagement (GPM) Transparenz schaffen und Unternehmensziele effizient erreichen Transparente Prozesse für mehr Entscheidungssicherheit Konsequente Ausrichtung
Was geht Qualitätsmanagement/ Qualitätsicherung die Physiotherapeutenan? Beispiel einer zertifizierten Abteilung
 Was geht Qualitätsmanagement/ Qualitätsicherung die Physiotherapeutenan? Beispiel einer zertifizierten Abteilung Angestellten Forum des ZVK Stuttgart 04.03.2016 Birgit Reinecke ZentraleEinrichtungPhysiotherapieund
Was geht Qualitätsmanagement/ Qualitätsicherung die Physiotherapeutenan? Beispiel einer zertifizierten Abteilung Angestellten Forum des ZVK Stuttgart 04.03.2016 Birgit Reinecke ZentraleEinrichtungPhysiotherapieund
Einleitung: Ausgangslage:
 Einleitung: Die Institut für Vermögensaufbau (IVA) AG (folgend IVA ) beschäftigt sich seit Jahren mit der umfangreichen Betrachtung von Beratungsprozessen aus Sicht eines Kunden. Die Schwerpunkte liegen
Einleitung: Die Institut für Vermögensaufbau (IVA) AG (folgend IVA ) beschäftigt sich seit Jahren mit der umfangreichen Betrachtung von Beratungsprozessen aus Sicht eines Kunden. Die Schwerpunkte liegen
Strategie: Umgesetzt. München Mai 2014
 Strategie: Umgesetzt München Mai 2014 Ansatz (1/2) TAH hilft Stadtwerken und EVUs bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Strategie Ausgangspunkt ist eine Analyse des Strategieprozesses 1 Dokumente 2 Strategieprozess
Strategie: Umgesetzt München Mai 2014 Ansatz (1/2) TAH hilft Stadtwerken und EVUs bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Strategie Ausgangspunkt ist eine Analyse des Strategieprozesses 1 Dokumente 2 Strategieprozess
Governance. CHE-Forum Fakultätsmanagement Dr. Christian Berthold 9. Dezember 2013
 Governance zentral/dezentral CHE-Forum Fakultätsmanagement Dr. Christian Berthold 9. Dezember 2013 3. Zunehmend Kompetenzverlagerung als Konsequenz der neuen Steuerung 2 3. Zunehmend Kompetenzverlagerung
Governance zentral/dezentral CHE-Forum Fakultätsmanagement Dr. Christian Berthold 9. Dezember 2013 3. Zunehmend Kompetenzverlagerung als Konsequenz der neuen Steuerung 2 3. Zunehmend Kompetenzverlagerung
Inhaltsverzeichnis. Literatur Schlagwortverzeichnis
 Inhaltsverzeichnis 1 Wesen von Geschäftsprozessen?... 1 1.1 Aufbauorganisation: Ordnung des Systems... 2 1.2 Ablauforganisation: Organisationsverbindende Prozesse... 4 1.3 Organisation ist Kommunikation...
Inhaltsverzeichnis 1 Wesen von Geschäftsprozessen?... 1 1.1 Aufbauorganisation: Ordnung des Systems... 2 1.2 Ablauforganisation: Organisationsverbindende Prozesse... 4 1.3 Organisation ist Kommunikation...
Dezentralisierung in der deutschen Investitionsgüterindustrie
 Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen Kulturwissenschaftliches Institut Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie Institut Arbeit und Technik Dr. Erich Latniak Dezentralisierung in der deutschen
Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen Kulturwissenschaftliches Institut Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie Institut Arbeit und Technik Dr. Erich Latniak Dezentralisierung in der deutschen
Prozess Projekt Produkt
 Prozess Projekt Produkt Integratives Prozess-, Projekt- und Produktmanagement Stefan Hagen, startup euregio Management GmbH Einleitung Kontinuierliches organisationales Lernen, Innovationsfähigkeit sowie
Prozess Projekt Produkt Integratives Prozess-, Projekt- und Produktmanagement Stefan Hagen, startup euregio Management GmbH Einleitung Kontinuierliches organisationales Lernen, Innovationsfähigkeit sowie
Geschäftsprozessmanagement in der Praxis
 Geschäftsprozessmanagement in der Praxis Kunden zufrieden stellen - Produktivität steigern - Wert erhöhen von Hermann J. Schmelzer, Wolfgang Sesselmann 7., überarbeitete und erweiterte Auflage 2010 Hanser
Geschäftsprozessmanagement in der Praxis Kunden zufrieden stellen - Produktivität steigern - Wert erhöhen von Hermann J. Schmelzer, Wolfgang Sesselmann 7., überarbeitete und erweiterte Auflage 2010 Hanser
Konzeption eines Vorgehensmodells für die Analyse zur Geschäftsprozessmodellierung und den Einsatz von Workflows im mittelständischen Unternehmen
 Torsten Neumann Konzeption eines Vorgehensmodells für die Analyse zur Geschäftsprozessmodellierung und den Einsatz von Workflows im mittelständischen Unternehmen Die 1. Phase zur Softwareentwicklung -
Torsten Neumann Konzeption eines Vorgehensmodells für die Analyse zur Geschäftsprozessmodellierung und den Einsatz von Workflows im mittelständischen Unternehmen Die 1. Phase zur Softwareentwicklung -
Definition Prozessmanagement
 Lektion 1 Lernobjekt 1 Definition Prozessmanagement Was ist Prozessmanagement? Attributname Autoren Zielgruppe Vorwissen Lernziel Beschreibung Bearbeitungsdauer Keywords Beschreibung Fischer Simone; Flatz
Lektion 1 Lernobjekt 1 Definition Prozessmanagement Was ist Prozessmanagement? Attributname Autoren Zielgruppe Vorwissen Lernziel Beschreibung Bearbeitungsdauer Keywords Beschreibung Fischer Simone; Flatz
Arbeitszeitwünsche von Frauen und Männern Einflussfaktoren und Realisierungschancen
 Dr. Peter Sopp / Dr. Alexandra Wagner Arbeitszeitwünsche von Frauen und Männern Einflussfaktoren und Realisierungschancen Workshop Vom Nachbar lernen? Determinanten weiblicher Erwerbstätigkeit in der EU
Dr. Peter Sopp / Dr. Alexandra Wagner Arbeitszeitwünsche von Frauen und Männern Einflussfaktoren und Realisierungschancen Workshop Vom Nachbar lernen? Determinanten weiblicher Erwerbstätigkeit in der EU
Fragestellungen. 2 Unternehmensführung und Management 2.1 Grundfunktionen der Unternehmensführung
 Fragestellungen 1 Unternehmen und Umwelt Als Stakeholder bezeichnet man die Kapitalgeber einer Unternehmung. (R/F) Bitte begründen! Nennen Sie beispielhaft 3 Stakeholder und ihre Beziehungen zum Unternehmen!
Fragestellungen 1 Unternehmen und Umwelt Als Stakeholder bezeichnet man die Kapitalgeber einer Unternehmung. (R/F) Bitte begründen! Nennen Sie beispielhaft 3 Stakeholder und ihre Beziehungen zum Unternehmen!
Wirtschaftsinformatik Bachelor & Master
 Schülerinformationstag Wirtschaftsinformatik Bachelor & Master Prof. Dr. Stefan Eicker Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Softwaretechnik ICB Institut für Informatik und Wirtschaftsinformatik Institut
Schülerinformationstag Wirtschaftsinformatik Bachelor & Master Prof. Dr. Stefan Eicker Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Softwaretechnik ICB Institut für Informatik und Wirtschaftsinformatik Institut
EINLADUNG Expertentag Code of Conduct Datenschutz
 EINLADUNG Expertentag Wie jedes Jahr lädt ITGAIN zur Expertenrunde ein. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf dem Thema Code of Conduct (CoC) Datenschutz der deutschen Versicherungen. Inhaltlich geht
EINLADUNG Expertentag Wie jedes Jahr lädt ITGAIN zur Expertenrunde ein. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf dem Thema Code of Conduct (CoC) Datenschutz der deutschen Versicherungen. Inhaltlich geht
Inhaltsverzeichnis. I Geschäftsprozesse - Warum?.' 1
 I Geschäftsprozesse - Warum?.' 1 1.1 Aufbauorganisation 1 1.2 Ablauforganisation: Organisationsverbindende Prozesse 3 1.3 Geschäftsprozess - Definition 4 1.4 Statische und dynamische Prozesse 8 1.5 Detaillierungsgrade
I Geschäftsprozesse - Warum?.' 1 1.1 Aufbauorganisation 1 1.2 Ablauforganisation: Organisationsverbindende Prozesse 3 1.3 Geschäftsprozess - Definition 4 1.4 Statische und dynamische Prozesse 8 1.5 Detaillierungsgrade
Übersicht Reifegradmodelle. Referat Stefan Wolf anlässlich 2. PMA Kongress Dienstag, 26. November 2013
 Übersicht Reifegradmodelle Referat Stefan Wolf anlässlich 2. PMA Kongress Dienstag, 26. November 2013 Inhalt Vorstellung Qualinet Consulting AG Zielsetzung und Ausgangslange Übersicht über die Reifegradmodelle
Übersicht Reifegradmodelle Referat Stefan Wolf anlässlich 2. PMA Kongress Dienstag, 26. November 2013 Inhalt Vorstellung Qualinet Consulting AG Zielsetzung und Ausgangslange Übersicht über die Reifegradmodelle
Exposé zur Safari-Studie 2002: Der Mensch in IT-Projekten Tools und Methoden für den Projekterfolg durch Nutzerakzeptanz
 Exposé zur Safari-Studie 2002: Der Mensch in IT-Projekten Tools und Methoden für den Projekterfolg durch Nutzerakzeptanz Inhalt: Viele IT-Projekte scheitern nicht aus technisch bedingten Gründen, sondern
Exposé zur Safari-Studie 2002: Der Mensch in IT-Projekten Tools und Methoden für den Projekterfolg durch Nutzerakzeptanz Inhalt: Viele IT-Projekte scheitern nicht aus technisch bedingten Gründen, sondern
Die wichtigsten Begriffe und ihre Verwendung
 Die wichtigsten Begriffe und ihre Verwendung Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die wichtigsten Begriffe zu Wirkungsmessung und deren Definitionen. Zudem wird der Begriff Wirkungsmessung zu Qualitätsmanagement
Die wichtigsten Begriffe und ihre Verwendung Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die wichtigsten Begriffe zu Wirkungsmessung und deren Definitionen. Zudem wird der Begriff Wirkungsmessung zu Qualitätsmanagement
Supply Chain Risk Management - Risiken in der Logistik sicher beherrschen
 Workshop Supply Chain Risk Management - Risiken in der Logistik sicher beherrschen 31. Deutscher Logistik-Kongress Berlin 23. Oktober 2014 Technische Universität Hamburg-Harburg Institut für Logistik und
Workshop Supply Chain Risk Management - Risiken in der Logistik sicher beherrschen 31. Deutscher Logistik-Kongress Berlin 23. Oktober 2014 Technische Universität Hamburg-Harburg Institut für Logistik und
Systemen im Wandel. Autor: Dr. Gerd Frenzen Coromell GmbH Seite 1 von 5
 Das Management von Informations- Systemen im Wandel Die Informations-Technologie (IT) war lange Zeit ausschließlich ein Hilfsmittel, um Arbeitsabläufe zu vereinfachen und Personal einzusparen. Sie hat
Das Management von Informations- Systemen im Wandel Die Informations-Technologie (IT) war lange Zeit ausschließlich ein Hilfsmittel, um Arbeitsabläufe zu vereinfachen und Personal einzusparen. Sie hat
Übersicht. Grundlagen der Prozessorientierung. Prozessmanagement. Managementinstrumente. Thomas Stütz
 Managementinstrumente Grundlagen der Prozessorientierung Thomas Stütz IBGU / 1 Übersicht Prozessmanagament 2 Prozessmanagement die prozessorientierte Unternehmensorganisation Merkmale von Prozessen Prozessgestaltung
Managementinstrumente Grundlagen der Prozessorientierung Thomas Stütz IBGU / 1 Übersicht Prozessmanagament 2 Prozessmanagement die prozessorientierte Unternehmensorganisation Merkmale von Prozessen Prozessgestaltung
Aufgaben Sigrun Schroth-Wiechert, Hannover Seite 1 von 6
 Aufgaben Die folgende Auflistung von Wortpaaren ist ein Ergebnis des Kurses Deutsch der Technik: Forschungskurs Aufgabenstellung schriftlicher Arbeiten (C1), der in dieser Form am Fachsprachenzentrum erstmalig
Aufgaben Die folgende Auflistung von Wortpaaren ist ein Ergebnis des Kurses Deutsch der Technik: Forschungskurs Aufgabenstellung schriftlicher Arbeiten (C1), der in dieser Form am Fachsprachenzentrum erstmalig
Praxisrelevanz des Modells von DeLone und McLean zur Erfolgsmessung von Informationssystemen
 Praxisrelevanz des Modells von DeLone und McLean zur Erfolgsmessung von Informationssystemen Seite 1 Agenda 1. Ausgangssituation und Applicability Check 2. IS-Erfolgsmodell von DELONE/MCLEAN 3. Untersuchungsdesign
Praxisrelevanz des Modells von DeLone und McLean zur Erfolgsmessung von Informationssystemen Seite 1 Agenda 1. Ausgangssituation und Applicability Check 2. IS-Erfolgsmodell von DELONE/MCLEAN 3. Untersuchungsdesign
25.09.2013 buss Fachtagung. Am Anfang erschien alles so einfach vom Versuch, eine neue Software einzuführen
 IT-Einführung 25.09.2013 buss Fachtagung Am Anfang erschien alles so einfach vom Versuch, eine neue Software einzuführen Was macht Projekte grundsätzlich aus Transformationsprozesse Zielzustand ZUSTANDSGRÖSSEN
IT-Einführung 25.09.2013 buss Fachtagung Am Anfang erschien alles so einfach vom Versuch, eine neue Software einzuführen Was macht Projekte grundsätzlich aus Transformationsprozesse Zielzustand ZUSTANDSGRÖSSEN
Dritte Aalener KMU-Konferenz Innovation in KMU
 Aalener Schriften zur Betriebswirtschaft hrsg. von Prof. Dr. Robert Rieg Band 7 herausgegeben von Prof. Dr. Alexander Haubrock, Prof. Dr. Robert Rieg und Prof. Dr. Jürgen Stiefl Dritte Aalener KMU-Konferenz
Aalener Schriften zur Betriebswirtschaft hrsg. von Prof. Dr. Robert Rieg Band 7 herausgegeben von Prof. Dr. Alexander Haubrock, Prof. Dr. Robert Rieg und Prof. Dr. Jürgen Stiefl Dritte Aalener KMU-Konferenz
Transformation der IT mit Geschäftsfähigkeiten
 Transformation der IT mit Geschäftsfähigkeiten Silo-unabhängige Domänen und Fähigkeiten sind die Brückenpfeiler für die gemeinsame Gesamtsicht auf das Unternehmen IT Strategie Prozesse Domänen & Fähigkeiten
Transformation der IT mit Geschäftsfähigkeiten Silo-unabhängige Domänen und Fähigkeiten sind die Brückenpfeiler für die gemeinsame Gesamtsicht auf das Unternehmen IT Strategie Prozesse Domänen & Fähigkeiten
Modellierung der Business Architecture mit BPM 12c
 Modellierung der Business Architecture mit BPM 12c Michael Stapf DOAG 2014 Oracle Deutschland B.V. & Co. KG 18. November 2014 Safe Harbor Statement The following is intended to outline our general product
Modellierung der Business Architecture mit BPM 12c Michael Stapf DOAG 2014 Oracle Deutschland B.V. & Co. KG 18. November 2014 Safe Harbor Statement The following is intended to outline our general product
Regine Buri-Moser. Betriebliches Gesundheitsmanagement. Stand und Entwicklungsmöglichkeiten in Schweizer Unternehmen
 Regine Buri-Moser Betriebliches Gesundheitsmanagement Stand und Entwicklungsmöglichkeiten in Schweizer Unternehmen Rainer Hampp Verlag München, Mering 2013 Verzeichnisse V Inhaltsverzeichnis Geleitwort
Regine Buri-Moser Betriebliches Gesundheitsmanagement Stand und Entwicklungsmöglichkeiten in Schweizer Unternehmen Rainer Hampp Verlag München, Mering 2013 Verzeichnisse V Inhaltsverzeichnis Geleitwort
Prozessorganisation Mitschriften aus den Vorlesung bzw. Auszüge aus Prozessorganisation von Prof. Dr. Rudolf Wilhelm Feininger
 Prozesse allgemein Typische betriebliche Prozesse: Bearbeitung von Angeboten Einkauf von Materialien Fertigung und Versand von Produkten Durchführung von Dienstleistungen Prozessorganisation befasst sich
Prozesse allgemein Typische betriebliche Prozesse: Bearbeitung von Angeboten Einkauf von Materialien Fertigung und Versand von Produkten Durchführung von Dienstleistungen Prozessorganisation befasst sich
Fragenkatalog 2 CAF-Gütesiegel - Fragenkatalog für den CAF-Aktionsplan (Verbesserungsplan)
 Fragenkatalog 2 CAF-Gütesiegel - Fragenkatalog für den CAF-Aktionsplan (Verbesserungsplan) Der Fragenkatalog deckt die Schritte sieben bis neun ab, die in den Leitlinien zur Verbesserung von Organisationen
Fragenkatalog 2 CAF-Gütesiegel - Fragenkatalog für den CAF-Aktionsplan (Verbesserungsplan) Der Fragenkatalog deckt die Schritte sieben bis neun ab, die in den Leitlinien zur Verbesserung von Organisationen
Wertorientiertes Informationsmanagement
 Markus Neumann Wertorientiertes Informationsmanagement Empirische Erkenntnisse und ein Referenzmodell zur Entscheidungsunterstützung Verlag Dr. Kovac Hamburg 2011 Vorwort Zusammenfassung / Abstract Management
Markus Neumann Wertorientiertes Informationsmanagement Empirische Erkenntnisse und ein Referenzmodell zur Entscheidungsunterstützung Verlag Dr. Kovac Hamburg 2011 Vorwort Zusammenfassung / Abstract Management
Mag. Josef Trawöger Vorstandsvorsitzender der ÖBV. Das Leitbild der Österreichischen Beamtenversicherung
 Stand Februar 2011 Das vorliegende Leitbild ist eine schriftliche Erklärung der ÖBV über ihr Selbstverständnis und ihre Grundprinzipien. Nach innen ist es eine Orientierung für alle Mitarbeiterinnen und
Stand Februar 2011 Das vorliegende Leitbild ist eine schriftliche Erklärung der ÖBV über ihr Selbstverständnis und ihre Grundprinzipien. Nach innen ist es eine Orientierung für alle Mitarbeiterinnen und
Teil: lineare Regression
 Teil: lineare Regression 1 Einführung 2 Prüfung der Regressionsfunktion 3 Die Modellannahmen zur Durchführung einer linearen Regression 4 Dummyvariablen 1 Einführung o Eine statistische Methode um Zusammenhänge
Teil: lineare Regression 1 Einführung 2 Prüfung der Regressionsfunktion 3 Die Modellannahmen zur Durchführung einer linearen Regression 4 Dummyvariablen 1 Einführung o Eine statistische Methode um Zusammenhänge
Manfred Bruhn Sieglinde Martin. Stefanie Schnebelen. Integrierte Kommunikation. in der Praxis. Entwicklungsstand in. deutschsprachigen Unternehmen
 Manfred Bruhn Sieglinde Martin Stefanie Schnebelen Integrierte Kommunikation in der Praxis Entwicklungsstand in deutschsprachigen Unternehmen 4^1 Springer Gabler Inhaltsverzeichnis Vorwort Inhaltsverzeichnis
Manfred Bruhn Sieglinde Martin Stefanie Schnebelen Integrierte Kommunikation in der Praxis Entwicklungsstand in deutschsprachigen Unternehmen 4^1 Springer Gabler Inhaltsverzeichnis Vorwort Inhaltsverzeichnis
Verhaltenswissenschaftliche Determinanten der Spenderbindung
 Marktorientierte Unternehmensführung 33 Verhaltenswissenschaftliche Determinanten der Spenderbindung Eine empirische Untersuchung und Implikationen für das Spenderbindungsmanagement Bearbeitet von Julia
Marktorientierte Unternehmensführung 33 Verhaltenswissenschaftliche Determinanten der Spenderbindung Eine empirische Untersuchung und Implikationen für das Spenderbindungsmanagement Bearbeitet von Julia
Business Process Brunch. BearingPoint, Microsoft und YAVEON laden Sie ein zum. am 17. und 23.09.2013, von 08:30 13:00 Uhr
 BearingPoint, Microsoft und YAVEON laden Sie ein zum Das Event am 17. und 23.09.2013, von 08:30 13:00 Uhr Agenda am 17. und 23.09.2013, von 08:30 13:00 Uhr Agenda 08:30 Uhr 09:15 Uhr 10:00 Uhr 11:00 Uhr
BearingPoint, Microsoft und YAVEON laden Sie ein zum Das Event am 17. und 23.09.2013, von 08:30 13:00 Uhr Agenda am 17. und 23.09.2013, von 08:30 13:00 Uhr Agenda 08:30 Uhr 09:15 Uhr 10:00 Uhr 11:00 Uhr
Abbildungsverzeichnis...VI Tabellenverzeichnis... VII Abkürzungsverzeichnis...VIII
 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis...VI Tabellenverzeichnis... VII Abkürzungsverzeichnis...VIII 1 Einführung... 1 1.1 Problemstellung und Zielsetzung... 1 1.2 Aufbau und Vorgehensweise der Untersuchung...
Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis...VI Tabellenverzeichnis... VII Abkürzungsverzeichnis...VIII 1 Einführung... 1 1.1 Problemstellung und Zielsetzung... 1 1.2 Aufbau und Vorgehensweise der Untersuchung...
Benutzerhandbuch für eine Software-Anwendung gestalten
 Benutzerhandbuch für eine Software-Anwendung gestalten Arbeitspapier zur Klärung der Zielvorgaben Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis...2 1 Kriterien für ein gutes Benutzerhandbuch...3
Benutzerhandbuch für eine Software-Anwendung gestalten Arbeitspapier zur Klärung der Zielvorgaben Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis...2 1 Kriterien für ein gutes Benutzerhandbuch...3
Empirische Überprüfung der relevanten Choice-Driver im Retail Banking der Region Interlaken
 Empirische Überprüfung der relevanten Choice-Driver im Retail Banking der Region Interlaken Bachelor Thesis zur Erlangung des akademischen Grades: Bachelor of Science in Business Administration FH mit
Empirische Überprüfung der relevanten Choice-Driver im Retail Banking der Region Interlaken Bachelor Thesis zur Erlangung des akademischen Grades: Bachelor of Science in Business Administration FH mit
4 Architektur-Perspektiven (WO)
 4 Architektur-Perspektiven (WO) Abb. 4-1: Positionierung des Kapitels im Ordnungsrahmen. Dieses Kapitel befasst sich mit der WO-Dimension des architektonischen Ordnungsrahmens. Es erläutert, auf welchen
4 Architektur-Perspektiven (WO) Abb. 4-1: Positionierung des Kapitels im Ordnungsrahmen. Dieses Kapitel befasst sich mit der WO-Dimension des architektonischen Ordnungsrahmens. Es erläutert, auf welchen
Qualitätscontrolling Leitfaden zur qualitätsgerechten Planung und Steuerung von Geschäftsprozessen
 Qualitätscontrolling Leitfaden zur qualitätsgerechten Planung und Steuerung von Geschäftsprozessen Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Horst Wildemann TCW Transfer-Centrum für Produktions-Logistik und Technologie-Management
Qualitätscontrolling Leitfaden zur qualitätsgerechten Planung und Steuerung von Geschäftsprozessen Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Horst Wildemann TCW Transfer-Centrum für Produktions-Logistik und Technologie-Management
