Schwämme machen Schule Poriferen im Biologieunterricht
|
|
|
- Brit Graf
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 SCHULPRAXIS Schwämme machen Schule Poriferen im Biologieunterricht KATHRIN KIRSTE UWE HOSSFELD MICHAEL NICKEL Der heutige praxisorientierte Biologieunterricht lebt in erster Linie auch von einer Biologie zum/des Anfassen(s). Erweckten die Schwämme bisher vorwiegend nur ein wissenschaftliches oder ökonomisches Interesse, wird nach unseren Ausführungen deutlich, dass auch Schwämme»Schule machen können«. Tafelschwämme sind bis heute in jedem Klassenzimmer zu finden und Spongebob Schwammkopf begeistert seit Jahren im TV neben Kindern auch Erwachsene. Eine deutschlandweite Analyse von Lehrplänen und Lehrmaterialien für den Biologieunterricht zeigt, dass Schwämme bisher keine Schule machen. Die Integration in bestehende Stoffgebiete ist jedoch mit diesem hier vorgestellten Unterrichtsmodul vielfältig möglich, etwa in Unterrichtseinheiten wie Evolution, Zellbiologie und Ökologie. Die Keimung von Gemmulae als Schülerexperiment integriert dabei theoretisches wie auch praktisches Wissens über die Biologie der Schwämme, deren Entwicklung aus Dauerstadien und die Funktionsteilung von Zellen. Neben der umfassenden didaktischen Aufarbeitung des Experimentes und der Anleitung für Schüler und Lehrer wurden von uns ebenso zahlreiche Lehrmittel für den Unterricht wie Texte, Tafelbilder, Kopiervorlagen und eine Arbeitsanleitung zum Auskeimungsexperiment für Schüler und Lehrer entwickelt. Desweiteren konnte das Unterrichtsmodul an einer Regelschule bereits praktisch umgesetzt werden. Um diese Unterrichtsmittel für interessierte Lehrer verfügbar zu machen, wurde die Homepage Schwämme machen Schule entwickelt ( 1 Hintergrund Die Biologiedidaktik und der Biologieunterricht leben von einer beispielhaften und oftmals experimentell vertiefenden Themenwahl (STAECK, 1987; BAYRHUBER, et al. 1994; ESCHEN- HAGEN et al., 1998; KLEESATTEL, 2006; KILLERMANN et al., 2008). Zwangsläufig sind einzelne Themen unterrepräsentiert, obwohl sie wissenschaftlich großes Interesse wecken. Ein solches Beispiel stellen die Schwämme (Porifera) dar. Das Ziel unserer Arbeit war es, ein Biologie- Unterrichtsmodul zu entwickeln, 40 MNU 64/1 ( ) Seiten 40 47, ISSN , Verlag Klaus Seeberger, Neuss
2 das Schwämme im Stoffgebiet Vom Einzeller zum Vielzeller unter Einbezug heimischer Süßwasserschwämme (Spongilidae) etabliert. Rezent sind die Porifera (Schwämme) in allen aquatischen Lebensräumen zu finden, vom Seichtwasser der Meere, bis in die Tiefen von Ozeangräben. Außerhalb der Antarktis sind sie auch im Süßwasser aller Kontinente verbreitet (WESTHEIDE & RIEGER, 2004:98). Porifera sitzen auf festen Unterlagen wie Felsen, Steinen, Hafenanlagen oder Stahlträgern auf. Manchmal sind sie auch auf lebenden Organismen wie Wasserpflanzen, Krebspanzern und Muschelschalen zu finden (BRÜMMER et al., 2003:302). Die Porifera können dünne Krusten bilden und in»schlauch-, becher- oder trichterförmiger Gestalt«beachtliche Größe annehmen, auch»baum-, geweih- und strauchförmige Formen«sind möglich (BRÜMMER et al., 2003:303). Im einfachsten Fall ist der Körper schlauchförmig (MUNK, 2002:1 19). Zwischen Standort und Habitus existiert eine direkte Beziehung. Auf Brandungsfelsen oder in lebhaft, fließenden Flüssen bilden Porifera flache Polster oder Krusten ohne in die Höhe zu wachsen. Im ruhigen Wasser dagegen bilden sie aufrecht stehende Äste oder Zweige bzw. haben eine trichter- oder lamellenförmige Gestalt (KAESTNER, 1993:269). Die Porifera vermehren sich sexuell durch verschiedenartige Larvenformen oder asexuell durch Knospung. Es kann ebenso zur Ausbildung von Dauerstadien kommen. Derzeit befindet sich das System der Porifera im Umbruch. Über die genaue Artenzahl existieren nur Schätzungen. Informationen diesbezüglich lassen sich der World Porifera Database entnehmen (VAN SOEST et al., 2008). Im Grundplan sind die Porifera aus zwei Zellschichten aufgebaut. Die Oberfläche besteht aus einem Epithelverband von Pinacocyten. Im Inneren begrenzt das Choanoderm den Zentralraum oder Spongocoel. Zwischen diesen beiden (Pinacoderm, Choanoderm) liegt eine gelatinöse Bindegewebsschicht, Mesogloea oder Mesohyl genannt. Eigentliche Organe, Blutgefäße und auch ein Nervensystem fehlen. Die Stützfunktion des Schwammkörpers wird von»skelettelementen aus Kalk- bzw. Kieselnadeln und/oder Sponginfasern«übernommen (BRÜM- MER et al., 2003:302). Das wichtigste funktionelle Element der Porifera ist der Filterapparat. Der Wasserstrom wird von den oben genannten Kragengeißelzellen erzeugt. Die Nahrungsaufnahme in Form kleiner Partikel erfolgt über Endocytose. Desweiteren versorgt der Wasserstrom den Schwammkörper mit Sauerstoff, entfernt anfallende Exkrete, Exkremente und Fremdstoffe (KAESTNER, 1993:251). Je nach Baukonzept werden drei Grundtypen unterschieden: der Ascon- Typ (Abb. 1) ist die einfachste Form. Hier besteht der Schwammkörper aus einem dünnwandigen Schlauch mit distalem Osculum. Die Choanocyten kleiden lediglich den Zentralraum aus. Nur eine dünne Bindegewebsschicht befindet sich zwischen äußerem Pinacoderm und innerem Choanoderm. Hier befinden sich auch zahlreiche Skelettelemente. Aus statischen und hydrodynamischen Gründen bildet der Ascon- Typ Formen mit wenigen mm Durchmesser, die dünn, lang und schlauchförmig sind. Beim Sycon- Typ (Abb. 1) sind die Choanocyten in Form von Radiärkanälen in die Körperwand verlagert, welche hierdurch dick und robust erscheint. Vor allem durch massive Zellansammlungen in der Rinden- und Cortex- Schicht, wächst der Schwamm deutlich voluminöser. Porifera des Sycon- Typus werden 2 bis 4 cm, selten 10 cm hoch. Letztlich sind beim Leucon- Typus (Abb. 1) die Choanocyten in Form von Kragengeißelkammern in die Bindegewebsschicht eingesenkt. Die Ausströmöffnungen der Kragengeißelkammern erhalten dabei Anschluss an ein weit verzweigtes Kanalsystem. Hierdurch werden eine ausreichende Versorgung mit Wasser und Nährstoffen sowie die Entwässerung des Gewebes gewährleistet. Diese komplexe Bauweise lässt durch eine beträchtlich dimensionierte Körperwand ein enormes Höhenwachstum zu. Eine erhöhte Anzahl an Geißelkammern, welche dicht an dicht den verzweigten Kanälen ansitzen, ermöglichen eine ausreichende Filterfunktion (KAES- TNER, 1993:253ff; STORCH & WELSCH, 2004: 38ff). Eigentliche Organe bilden Porifera nicht aus. Sie besitzen auch kein spezielles Verdauungs- und Exkretionssystem. Phagocytose und Pinacocytose werden von Choanocyten und Amoebocyten übernommen (KAESTNER, 1993:261). Nahrungssubstanzen werden in Nahrungsvakuolen eingelagert, mitunter auch durch Exocytose auf umliegende Zellen übertragen. Die Verdauung läuft intrazellulär ab. Bisher umstritten ist, welche Zellen daran beteiligt sind. Neben Archaeocyten sind wahrscheinlich noch viele andere Zellen verdauungsfähig. Die Exkretion erfolgt durch Exocytose in die Kanäle (WESTHEIDE & RIEGER, 2004:103). Abb. 1. Die 3 Grundtypen des Bauplans der Porifera (aus: MUNK, 2002:1 20) 41
3 Trotz fehlenden Nervensystems sind Porifera zu koordinierten Funktionsabläufen fähig. Eine extrazelluläre, humorale Koordination verläuft längs eines Konzentrationsgradienten. Dies tritt bei der Bildung der Gemmulae, der Ausbreitung des Zellmaterials während der Keimung aus den Gemmulae, bei der Gametogenese, der Wundheilung und Regeneration in Funktion. Stoffe wie Gemmulostatin, Theophyllin, Acetycholin, Epinephrin, Catecholamin, Serotonin und ein Aggregationsstoff konnten nachgewiesen werden. Desweiteren können amoeboid bewegliche Zellen vorübergehend Zellkontakte knüpfen. Im adulten Tier nimmt die Zellzahl und Mobilität der amoeboid beweglichen Zellen zunehmend ab. Mikroskopische Bilder deuten darauf hin, dass die Möglichkeit einer Materialübertragung von Zelle zu Zelle möglich ist. Weitere koordinierte Funktionsabläufe stellen die Ausbildung von Zellsträngen dar. Durch diese Zellstränge tritt die gesamte Mesogloea mit dem Oskularrohr in Kontakt. Kontraktionswellen können so zu einem momentanen Verschluss eines Teilbereiches oder des gesamten Porensystems führen. Die Kontraktionswellen breiten sich in vier bis sechs Minuten über eine Strecke von wenigen Zentimetern aus (WEISSENFELS, 1989:29f.). Es fehlen ebenso Geschlechtsorgane, wobei sich die Geschlechtzellen wahrscheinlich aus den Amoebocyten ableiten. Aus heutiger Sicht ist die Spermato- und Oogenese von den Choanocyten ausgehend. Spermatocyten und Oocyten reifen in einer Follikelhülle heran (KAESTNER, 1993:263). 2 Was macht die Schwämme so interessant? Die Hälfte der 750 bis 800 neu entdeckten Naturstoffe lieferten marine Schwämme (BRÜMMER et al., 2003:382). Porifera synthetisieren biologisch aktive Sekundärmetabolite der Substanzgruppen Alkaloide und Terpenoide. Ihr vielfältiges Wirkspektrum umfasst dabei u. a. die inhibierende Wirkung auf das Tumorwachstum sowie entzündungshemmende, antivirale, fungizide und bakterizide Wirkungen. Die toxische Wirkung auf das Aids-Virus von Substanzen aus Porifera konnte in Zellversuchen bereits nachgewiesen werden (ebd.:383). In den Focus der Wissenschaft sind die Porifera seit langem hinsichtlich einer Beantwortung von Fragen zum Zellverhalten bzw. zur Lösung entwicklungsphysiologischer Probleme gerückt. Als günstige Untersuchungsobjekte gewinnen sie zunehmend an Bedeutung. Außerdem nehmen die Porifera eine wichtig Stellung im System der biologischen Grundwassereinigung ein, da sie schwebende Partikel aus dem Wasser filtern (ebd.:271). Ihre Filterkapazität reicht so weit, dass ein 1000 cm 3 großer Schwamm fähig Tunesien Sizilien Italien Griechenland Kreta Abb. 2. Karte von Libyen mit Lokalisation der Untersuchungsgebiete (verändert nach: MILANESE et al. 2007:91) ist, einen 10 Liter Eimer Wasser in zehn Sekunden zu filtrieren. In großer Populationsdichte infiltrieren Porifera alle Primärproduzenten und binden dieses organische Material langfristig. Der Energiehaushalt eines Ökosystems wird hierdurch nachhaltig beeinflusst (WESTHEIDE & RIEGER, 2004:103). Desweiteren sind Porifera im Hinblick auf die Schwammfischerei von ökonomischer Bedeutung. Die Saugfähigkeit von Naturschwämmen konnte bisher noch von keinem synthetischen Produkt erreicht werden. Das elastische und saugfähige Skelett von Badeschwämmen ist bis heute ein Gebrauchsgegenstand von vielseitigem Nutzen. Bis etwa 1960»wurden Spongia officinalis und Hippospongia communis im Mittelmeer östlich der Linie Sizilien- Cap Horn (Tunesien) bis hinauf zum Marmarameer regelmäßig gefischt«(kaestner, 1993:273). Spongia officinalis besteht fast ausschließlich aus Sponginfasern und findet Verwendung als Badeschwamm. Sie sind in der Lage das bis zu 25-fache ihres Gewichtes aufzunehmen (WESTHEIDE & RIEGER, 2004:119). Der Pferdeschwamm, Hippospongia communis, findet durch kratzige Sandkorneinlagerung hingegen industrielle Verwendung. Neben Griechenland, welches einen großen Anteil an der Schwammfischerei hat(te), fischte man zudem zwischen den japanischen Inseln und den Philippinen nach Porifera. 200 Handelsorte können unterschieden werden. Die Schwammgewinnung erfolgt entweder durch Tauchen mit Scaphandern oder Pressluftgeräten, Schleppnetzfischerei oder Fischen mit Stechgabel von der Oberfläche aus. Die gesammelten Porifera sterben außerhalb des Wassers ab. Durch Treten und Spülen wird der faulende Weichkörper entfernt. Anschließend werden sie auf Schnüre gereiht und getrocknet. Hauptabnehmer für Naturschwämme ist die Industrie dort werden sie zum Schleifen, Lackieren oder Polieren benötigt. In der näheren Vergangenheit wurde die mediterrane, kommerzielle Schwammzucht von Serien starker Epidemien befallen, so dass die übrig gebliebenen, überfischten Schwammvorkommen noch weiter geschädigt wurden. Mediterrane Schwämme erreichen den höchsten Preis im Vergleich zu karibischen oder indopazifischen Schwämmen. Die feinsten aller mediterranen Schwämme wachsen in Libyen. Nach der Analyse der dortigen Schwammpopulationsentwicklung wurde eine Handelssperre für Naturschwämme verhängt. Eine italienisch-libysche Kooperationsverbindung untersuchte die Entwicklung der Schwammfischerei in einer ungefähren Periode von 150 Jahren (Abb. 3). Nach einem niedrigen Ernteertrag in den Jahren 1860 bis 1879 überschritt die Schwammernte in den Jahren 1880 bis 1929 einen Durchschnitt von 40 Tonnen im Jahr. Der Spitzenrekord wurde in den Jahren 1920 bis 1929 mit über 70 Tonnen pro Jahr erreicht. Heute beschränkt sich die Schwammfischerei auf ein Gebiet im Osten Libyens. Weniger als 10 Tonnen pro Jahr werden geerntet. Taucherkundungen entlang der Küste ergaben, dass nicht kommerziell nutzbare Schwämme, z. B. Schwämme der Familien Ircinia und Sarcotragus, in höheren Populationen auftreten als die kommerziell nutzbaren Schwämme der Familien Spongia und Hippospongia. Eine Annäherung an den umweltverträglichen Abbau dieser wertvollen Naturressource ist vorgesehen und wird derzeit noch diskutiert (MILANESE et al., 2007:90f.). Da die Schwammfischerei zusammen mit den starken Epidemien die Populationszahlen im hohen Maße, teilweise bis zur Extinktion, reduzierte, sollen die stark überfischten, natürlichen Schwammvorkommen zukünftig durch kommerzielle Schwammzucht entlastet werden. Auf Cuba, den Philippinen und Mikronesien, wurde mit der kommerziellen Schwammzucht bereits begonnen. Schwämme sind in der Lage, gelöstes organisches Material, organische Partikel und Bakterien aus dem Wasser aufzunehmen. Freischwimmende Käfige 42 MNU 64/1 ( )
4 Abb. 3. Schwammfischerei- Ertrag im mediterranen Gebiet: Tunesien, Griechenland und Libyen im Vergleich. Daten von Libyen sind erst seit 1984 verfügbar, : solide horizontale Linie zeigt die durchschnittliche Produktion von 154 Tonnen pro Jahr, : gepunktete Linie zeigt durchschnittliche Produktion von 60 Tonnen pro Jahr, die Pfeile weisen auf schwere Schwamm- Epidemien hin (aus: MILANESE et al. 2007:93). der Fischzucht entlassen große Mengen organisches Material in die Umgebung. Dieses kann als Futterquelle für intensive Schwammzucht genutzt werden. Ein solch integrierendes System könnte eine effektive Eutrophierungskontrolle, eine kommerzielle Schwammzucht und letztlich eine Reduzierung der Ernteerträge natürlicher Schwammpopulationen zur Folge haben (PRONZATO, 1999:485). Das Vorkommen des Bohrschwammes erfreut die Menschen dagegen weniger. Durch ihn kommt es zu beträchtlichen ökonomischen Schäden bei der Austernernte, da ihre Schalen durch den Bohrschwamm befallen werden. Bohrschwämme sind auch als ökologischer Faktor in marinen Ökosystemen nicht zu unterschätzen. Sie sind die ersten Organismen, die das Substratinnere besiedeln. Innertropisch werden Korallenriffe und Kalksteinriffe maßgeblich durch sie geschwächt. Den Bohrschwämmen lässt sich allerdings auch etwas Positives abgewinnen. In der Erdgeschichte haben sie entscheidend bei der geomorphologischen Ausbildung der Erdoberfläche der gemäßigten Breiten mitgewirkt. Als Kalk- und Kreideschichtbildner könnten sie aus globaler Sicht als wichtigste Schwämme überhaupt angesehen werden (BRÜMMER et al., 2003:327). 3 Auskeimungsexperiment mit Gemmulae von Süßwasserschwämmen Biologische Experimente werden meist dem induktiven Erkenntnisgewinn, d. h. der Generalisierung von Beobachtungen, zugeordnet. Da Unterrichtsexperimente meist als Demonstrationsversuch oder Schülerübung dienen, haben sie zudem einen hohen deduktiven Erkenntnisanteil (MOISL, 1988:7). Beim Auskeimungsversuch mit Gemmulae kann diese als reine Beobachtung, d. h. ohne Abwandlung der Rahmenbedingungen oder als Experiment mit kontrollierten, modifizierten Rahmenbedingungen ablaufen. Die Inkubation der Gemmulae kann z. B. bei verschiedenen Temperaturen, im Licht oder Dunkeln bzw. mit Wasser unterschiedlicher Wasserhärte erfolgen. Bei Schülerexperimenten sollte eine klare Vorhergehensweise gewahrt werden. Ausgehend von ihren Beobachtungen sollten die Schüler lernen, Versuchsergebnisse zeichnerisch darzustellen und in der Auswertung die faktischen Versuchsergebnisse anzuwenden (MOISL, 1988:7). Der Auskeimungsversuch mit Gemmulae ist ein Beobachtungs- oder Entdeckungsexperiment, das sich als Langzeitexperiment über mehrere Tage und Wochen erstrecken kann. Für den Lehrer bedeutet dies, dass er die Schüler immer wieder auf das Thema Porifera hinlenken, neu motivieren muss. Der Auskeimungsversuch mit Gemmulae sollte stets ein Schülerversuch sein, d. h. von den Schülern selbst ausgeführt werden. Die eigenständige Ausgabe der Gemmulae in die Petrischalen sollte bei den Schülern ein Verantwortungsbewusstsein indizieren, welches den Lernerfolg im hohen Maße heben kann. Im Falle einer Zweiergruppenbildung gilt es, die anstehenden Arbeitsschritte zu ordnen, aufzuteilen und effektiv durchzuführen. Hierbei soll die Sozialkompetenz der Schüler gefördert werden, sich in einer Gruppe ein- und unterzuordnen. Im Falle eines demonstrativen Versuches sollte vom Lehrer die Möglichkeit zum eigenständigen Mikroskopieren jedes Schülers geschaffen werden. Die Auskeimung des Versuches kann sowohl qualitativ als auch quantitativ erfolgen. Bei letzterem ist die Keimrate zu bestimmen, indem die Gemmulae ausgezählt und das Auskeimen über einen längeren Zeitraum, in regelmäßigen Abständen, datiert wird. Eine regelmäßige Kontrolle des Auskeimungsstandes ist bei einer qualitativen Auswertung nicht notwendig. Hierbei kann der Versuch zu Beginn der Lerneinheit gestartet werden und die Auswertung am Ende durch eine mikroskopische Zeichnung mit schriftlicher Formulierung erfolgen, wobei sich beide Auswertungsarten nicht ausschließen. Der Auskeimungsversuch mit Gemmulae eignet sich, um zu einer gezielten Beobachtung sachliche Bezüge herzustellen. Es gilt die verschiedenen Entwicklungsstadien theoretisch einzuordnen, zu benennen, zu vergleichen und Beobachtungen letztlich zu beschreiben. Aufbauend auf diesem Fundament sollte es den Schüler möglich sein, Hypothesen zu abweichenden Rahmenbedingungen des Experiments zu entwickeln. Auch, wenn die Auskeimungsrate nicht allzu hoch ist, sollte der Veränderungsprozess der Gemmulae gut erkennbar sein. Tierexperimente wecken meist eine größere Neugier bei Schülern als Pflanzenversuche. Da Schwämme kein Nervensystem besitzen, fallen sie zudem nicht unter die bekannten Tierschutzbestimmungen und in Hinblick auf eine große Sympathie der Schüler mit der Trickfilmfigur Spongebob Schwammkopf sollte das Versuchsobjekt 43
5 keine Angst- oder Ekelreaktionen hervorrufen. Für die Versuchsdurchführung wird kein spezifisches Vorwissen abverlangt, lediglich instrumentale Fertigkeiten in Form von Pipettieren und Mikroskopieren sind für den Auskeimungsversuch von Nöten. Während die eigentliche Versuchszeit relativ kurz ist, kann die Beobachtungsdauer, je nach Temperatur, variieren. Dies sollte man bei der Planung der Stoffeinheiten beachten und bei Bedarf eine oder mehrere Auswertungsstunden innerhalb eines späteren Stoffgebietes einplanen. 3.1 Material Im Folgen wird der Materialbedarf für das Auskeimungsexperiment beschrieben. Zu Gunsten der Übersichtlichkeit gliedert sich der Materialbedarf zum einen für ein bis zwei Schüler und zum anderen für die ganze Klasse auf. Desweiteren werden Hinweise zur Beschaffung der jeweiligen Materialien gegeben. Spezielle Protokollbögen finden sich unter Abb. 5. Pasteur- Pipetten aus Polyethylen (eigenes Foto) Materialbedarf für 1 2 Schüler etwa Gemmulae etwa 100 ml natürliches Mineralwasser ohne Kohlensäure (z. B.: Volvic) 2 Petrischalen mit Deckel aus optisch klarem Polystyrol (Abb. 4) 1 Pasteur- Pipetten aus Polyethylen (Abb. 5) 1 wasserfester Permanent- Marker 1 Binokular-Lupe und/oder Mikroskop mit schwacher Vergrößerung (15 100fach) Materialbedarf für die ganze Klasse Aufbewahrungsbox mit Deckel (Abb. 6, 7) Glasscheibe oder Plexiglasplatte etwa 4 weitere Petrischalen zum Unterlegen der Glasscheibe oder Plexiglasplatte Thermometer Abb. 6. Aufbewahrungsbox mit Deckel (eigenes Foto) 3.2 Versuchsdurchführung Im Folgenden erfolgt eine detaillierte Versuchbeschreibung. Sie soll dem Lehrer zu Unterrichtsvorbereitung dienen. Abb. 7. Schemazeichnung Aufbewahrungsbox mit Deckel (eigene Darstellung) Extrahieren der Gemmulae aus altem Schwammgewebe (nach selbstständiger Sammlung) Abb. 4. Petrischale mit Deckel (eigenes Foto) Künstliche Überwinterung im Kühlschrank Spülen Schwammgewebe zerreißen Gemmulae durch Waschstraße pipettieren 44 MNU 64/1 ( )
6 3.2.2 Arbeitsanleitung zum Auskeimungsexperiment mit Gemmulae von Süßwasserschwämmen Nr. Beschreibung des Arbeitsschrittes Skizze 1 beide Petrischalen zur Hälfte mit Mineralwasser auffüllen 2 Pipette mit zusammengedrückten Ballon in das Mineralwasser führen und durch das Nachgeben des Drucks die Gemmulae aus dem Becherglas entnehmen 3 Pipette ohne den Ballon zu drücken senkrecht halten und die Gemmulae zur Öffnung sinken lassen 4 Gemmulae zusammen mit einem Tropfen Mineralwasser aus der Pipette in die Petrischale entlassen, dazu mäßigen Druck auf den Ballon ausüben 5 Anzahl der Gemmulae in der Petrischale auszählen 6 Deckel der Petrischale mit Gruppennummer, Probennummer, Datum und Anzahl der Gemmulae durch einen Permanent- Marker beschriften 7 beide Petrischalen mit geschlossenem Deckel zur Inkubation in die Aufbewahrungsbox stellen Erwartungshorizont Wie aus Abb. 8 deutlich wird, ist die Auskeimrate der gelben Gemmulae deutlich höher als die der grünen. Hier lag die Auskeimrate bei unserem Versuch bei 50 %. Vermutlich sind die gelben Gemmulae ausgereifter. Die grünen Gemmulae keimten hingegen nur in geringer Zahl aus. Daher eignen sich die gelben Gemmulae eher zur Umsetzung eines Auskeimungsversuches. Die geringe Auskeimrate gilt es mit einer hohen Gemmulaeanzahl zu kompensieren. Bei etwa 20 bis 30 Gemmulae sollte wenigstens eine gekeimte Gemmula zu beobachten sein. Natürlich hängt auch der Keimzeitpunkt von der Inkubationstemperatur ab. Eine universell geltende Aussage über den Keimzeitpunkt bei Auskeimungsversuchen lässt sich nicht formulieren. 45
7 Auskeimrate Auskeimrate in % in % Ggelb I/I 24 Ggrün MW Inkubationszeit in Tagen Abb. 8. Auskeimrate gelber und grüner Gemmulae im Vergleich Der Auskeimungsbeginn der Gemmulae äußert sich oft zunächst mit der Aufwölbung der Mikropyle. Das nach außen tretende Jungschwammgewebe ist durch eine weiße, blasenförmige Struktur erkennbar (Abb. 9). Nach wenigen Tagen umwächst der Jungschwamm die Gemmula vollständig und bildet einen weiß-milchigen Hof. Die Gemmulaschale im Zusammenhang mit dem Jungschwamm ähnelt dem Aussehen eines Spiegeleis (Abb. 10, 11). Mit dem Erreichen dieses Entwicklungsstandes verlief der Auskeimungsversuch erfolgreich. Literatur BAYRHUBER, H.; K. ESCHENEBRG et al. (Hg.) (1994). Interdisziplinäre Themenbereiche und Projekte im Biologieunterricht. Kiel: IPN. BRÜMMER, F., NICKEL, M., SIDRI, M. (2003). Porifera (Schwämme). In: R. HOFRICHTER (Hg.). Das Mittelmeer. Band II/1. Heidelberg: Spektrum, Abb. 10. Gemmula mit Jungschwamm (Draufsicht) (eigenes Foto) Abb. 9. Auskeimende Gemmulae mit Aufwölbung der Mikropyle (eigenes Foto) Abb. 11. Gemmula mit Jungschwamm (Seitenansicht) 46 MNU 64/1 ( )
8 ZUR DISKUSSION GESTELLT ESCHENHAGEN, D., KATTMANN, U. & RODI, D. (1998). Fachdidaktik Biologie. Köln: Aulis. KAESTNER, A. (1993). Lehrbuch der speziellen Zoologie. Band I Wirbellose Tiere. Jena: Gustav Fischer, KILLERMANN, W, HIERING, P. & STAROSTA. B. (2008). Biologieunterricht heute. Donauwörth: Auer. KIRSTE, K. (2009). Süßwasserschwämme als Unterrichtsmodul. Wissenschaftliche Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Regelschulen. Jena. KLEESATTEL, W. (Hg.) (2006). Fundgrube Biologie. Berlin: Cornelsen. MILANESE, M., SARÁ, A., MANCONI, R., ABDALLA, A. B. & PRONZATO, R. (2007). Commercial sponge fishing in Libya: Historical records, present status and perspectives. Genova, Sassari, Tripoly: Elsevier B.V., MOISL, F. (1988). Experimente. Unterricht Biologie, 12, H. 132, MUNK, K. (2002). Grundstudium Biologie. Heidelberg: Spektrum, PRONZATO, R. (1999). Sponge-fishing, disease and farming in Mediterranean Sea. Genova: Wiley, STAECK, L. (1987). Zeitgemäßer Biologieunterricht. Eine Didaktik. Stuttgart: Metzler. STORCH, V. & WELSCH, U. (2004). Systematische Zoologie. Berlin: Spektrum Akademischer Verlag, VAN SOEST, R. W. M., BOURY-ESNAULT, N., HOOPER, J. N. A., RÜTZLER, K, DE VOOGD, N. J., ALVAREZ, B., HAJDU, E., PISERA, A. B., VACELET, J., MANCONI, R., SCHOENBERG, C., JANUSSEN, D., TABACHNICK, K. R., KLAUTAU, M. (2008): World Porifera database. < (Stand: ) (u. a. Zugriff am: ). WEISSENFELS, N. (1989). Biologie und Mikroskopische Anatomie der Süßwasserschwämme (Spongillidae). Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, WESTHEIDE, W., RIEGER, R. (2004). Spezielle Zoologie. Teil 1: Einzeller und Wirbellose Tiere. Heidelberg, Berlin: Spektrum, KATHRIN KIRSTE, schuetz_kathrin@arcor.de; Prof. Dr. UWE HOSSFELD (korrespondierender Autor), uwe.hossfeld@uni-jena.de, Arbeitsgruppe Biologiedidaktik, Biologisch-Pharmazeutische Fakultät, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Am Steiger 3, Bienenhaus, Jena; PD Dr. MICHAEL NICKEL; m.nickel@uni-jena.de gc MNU 64/1 ( ) Seiten 47 52, ISSN , Verlag Klaus Seeberger, Neuss 47
* Phylogenie Im Umbruch begriffen
 Arthropoda Gliederfüßer Annelida Ringelwürmer Mollusca Weichtiere Protostomia* Deuterostomia Chordata Chordatiere Echinodermata Stachelhäuter Bilateria Eumetazoa Nematoda Fadenürmer Plathelminthes Plattwürmer
Arthropoda Gliederfüßer Annelida Ringelwürmer Mollusca Weichtiere Protostomia* Deuterostomia Chordata Chordatiere Echinodermata Stachelhäuter Bilateria Eumetazoa Nematoda Fadenürmer Plathelminthes Plattwürmer
Vorlesung: Spezielle Zoologie WS 2018/2019
 Vorlesung: Spezielle Zoologie WS 2018/2019 Modul: Zoologische Systematik und Artenkenntnis Porifera Dr. Wolfgang Jakob ITZ, Ecology & Evolution Bünteweg 17d D-30559 Hannover Phone: +49 511-953 8481 Email:
Vorlesung: Spezielle Zoologie WS 2018/2019 Modul: Zoologische Systematik und Artenkenntnis Porifera Dr. Wolfgang Jakob ITZ, Ecology & Evolution Bünteweg 17d D-30559 Hannover Phone: +49 511-953 8481 Email:
Experimente zu den Themen Energie und Klimawandel
 Experimente zu den Themen Energie und Klimawandel Station 5: Klimawandel Schulfach: Biologie/Naturwissenschaften Sekundarstufe 1 Dieses Material ist im Rahmen des Projekts Bildung für einen nachhaltige
Experimente zu den Themen Energie und Klimawandel Station 5: Klimawandel Schulfach: Biologie/Naturwissenschaften Sekundarstufe 1 Dieses Material ist im Rahmen des Projekts Bildung für einen nachhaltige
Aufgabe: Laborgeräte II Angepasstheit der Vögel
 Aufgabe: Laborgeräte II Angepasstheit der Vögel Stand: 07.06.2016 Jahrgangsstufe 6 Fach/Fächer Übergreifende Bildungs- und Erziehungsziele Biologie Alltagskompetenz und Lebensökonomie Berufliche Orientierung
Aufgabe: Laborgeräte II Angepasstheit der Vögel Stand: 07.06.2016 Jahrgangsstufe 6 Fach/Fächer Übergreifende Bildungs- und Erziehungsziele Biologie Alltagskompetenz und Lebensökonomie Berufliche Orientierung
4 Kompetenzen und Inhalte (Leistungskurs)
 4 (Leistungskurs) 4.1 Physiologische Grundlagen ausgewählter Lebensprozesse am Beispiel der Nervenzelle - Aufbau lebender Organismen aus Zellen - Vorgänge an Biomembranen - Enzyme und ihre Bedeutung -
4 (Leistungskurs) 4.1 Physiologische Grundlagen ausgewählter Lebensprozesse am Beispiel der Nervenzelle - Aufbau lebender Organismen aus Zellen - Vorgänge an Biomembranen - Enzyme und ihre Bedeutung -
Inhalte Klasse 5 Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen
 Inhalte Klasse 5 Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Biologie eine Naturwissenschaft 1. Womit beschäftigt sich die Biologie? Kennzeichen des Lebendigen bei Pflanzen und Tieren 2. So
Inhalte Klasse 5 Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Biologie eine Naturwissenschaft 1. Womit beschäftigt sich die Biologie? Kennzeichen des Lebendigen bei Pflanzen und Tieren 2. So
Kantonsschule Ausserschwyz. Biologie. Kantonsschule Ausserschwyz
 Kantonsschule Ausserschwyz Biologie Kantonsschule Ausserschwyz 13 Bildungsziele Für das Grundlagen-, Schwerpunkt- und Ergänzungsfach Der Biologieunterricht verhilft dazu, die Natur bewusster wahrzunehmen
Kantonsschule Ausserschwyz Biologie Kantonsschule Ausserschwyz 13 Bildungsziele Für das Grundlagen-, Schwerpunkt- und Ergänzungsfach Der Biologieunterricht verhilft dazu, die Natur bewusster wahrzunehmen
Warum werden Möhren und Erbsen schon im März gesät, Bohnen und Gurken aber erst im Mai?
 Naturwissenschaften - Biologie - Allgemeine Biologie - 2 Vom Keimen der Samen und Wachsen der Pflanzen (P800900) 2.5 Keimung und Jahreszeiten Experiment von: Phywe Gedruckt: 07.0.203 5:2:3 intertess (Version
Naturwissenschaften - Biologie - Allgemeine Biologie - 2 Vom Keimen der Samen und Wachsen der Pflanzen (P800900) 2.5 Keimung und Jahreszeiten Experiment von: Phywe Gedruckt: 07.0.203 5:2:3 intertess (Version
- beschreiben Aufbau und beschreiben Aufbau und Funktion des menschlichen Skeletts und vergleichen es mit dem eines anderen Wirbeltiers.
 Stadtgymnasium Detmold Schulinternes Curriculum für das Fach Biologie Jahrgangsstufe 5 Stand: 20.06.2016 Klasse / Halbjahr 5.1 Inhaltsfelder Angepasstheit von Tieren an verschiedene Lebensräume (Aspekt
Stadtgymnasium Detmold Schulinternes Curriculum für das Fach Biologie Jahrgangsstufe 5 Stand: 20.06.2016 Klasse / Halbjahr 5.1 Inhaltsfelder Angepasstheit von Tieren an verschiedene Lebensräume (Aspekt
Lernen mit Alltagsvorstellungen: Schwimmblase
 Lernen mit Alltagsvorstellungen: Schwimmblase Biologie Lernen mit Alltagsvorstellungen, 19. September 2016 Ballon-Vorstellung Tauchboot Die Schwimmblase ist mit Luft gefüllt und erhöht so den Auftrieb
Lernen mit Alltagsvorstellungen: Schwimmblase Biologie Lernen mit Alltagsvorstellungen, 19. September 2016 Ballon-Vorstellung Tauchboot Die Schwimmblase ist mit Luft gefüllt und erhöht so den Auftrieb
Vorlesung: Spezielle Zoologie WS 2017/2018
 Vorlesung: Spezielle Zoologie WS 2017/2018 Modul: Zoologische Systematik und Artenkenntnis Porifera Dr. Wolfgang Jakob ITZ, Ecology & Evolution Bünteweg 17d D-30559 Hannover Phone: +49 511-953 8481 Email:
Vorlesung: Spezielle Zoologie WS 2017/2018 Modul: Zoologische Systematik und Artenkenntnis Porifera Dr. Wolfgang Jakob ITZ, Ecology & Evolution Bünteweg 17d D-30559 Hannover Phone: +49 511-953 8481 Email:
Wie fließt das Blut durch unsere Blutgefäße?
 Wie fließt das Blut durch unsere Blutgefäße? zpg, 01.06.2016 Schülerin bei Fahrradunfall verletzt Auf dem Weg zur Schule kollidierte eine 12-jährige Schülerin mit einem 65-jährigen Radfahrer. Das Mädchen
Wie fließt das Blut durch unsere Blutgefäße? zpg, 01.06.2016 Schülerin bei Fahrradunfall verletzt Auf dem Weg zur Schule kollidierte eine 12-jährige Schülerin mit einem 65-jährigen Radfahrer. Das Mädchen
Nährstoffe und Nahrungsmittel
 1 Weitere Lehrerversuche Schulversuchspraktikum Annika Nüsse Sommersemester 2016 Klassenstufen 5 & 6 Nährstoffe und Nahrungsmittel Kurzprotokoll 1 Weitere Lehrerversuche Auf einen Blick: Der Lehrerversuch
1 Weitere Lehrerversuche Schulversuchspraktikum Annika Nüsse Sommersemester 2016 Klassenstufen 5 & 6 Nährstoffe und Nahrungsmittel Kurzprotokoll 1 Weitere Lehrerversuche Auf einen Blick: Der Lehrerversuch
Einführung in die Marinen Umweltwissenschaften
 Einführung in die Marinen Umweltwissenschaften www.icbm.de/pmbio Mikrobiologische Grundlagen - Rolle der Mikroorganismen in der Natur - Beispiel Meer - Biogeochemie, Mikrobielle Ökologie, Umweltmikrobiologie
Einführung in die Marinen Umweltwissenschaften www.icbm.de/pmbio Mikrobiologische Grundlagen - Rolle der Mikroorganismen in der Natur - Beispiel Meer - Biogeochemie, Mikrobielle Ökologie, Umweltmikrobiologie
Die Kröte im Schnee Stand:
 Die Kröte im Schnee Stand: 25.08.2016 Jahrgangsstufen 6 Fach/Fächer Übergreifende Bildungs- und Erziehungsziele Biologie Alltagskompetenz und Lebensökonomie Berufliche Orientierung Bildung für nachhaltige
Die Kröte im Schnee Stand: 25.08.2016 Jahrgangsstufen 6 Fach/Fächer Übergreifende Bildungs- und Erziehungsziele Biologie Alltagskompetenz und Lebensökonomie Berufliche Orientierung Bildung für nachhaltige
Modulhandbuch des Studiengangs Biologie im Master of Education - Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen
 Modulhandbuch des Studiengangs Biologie im Master of Education Lehramt an Haupt, Real und Gesamtschulen Inhaltsverzeichnis Vertiefung Fachwissenschaft Biologie (HRGe)..................................
Modulhandbuch des Studiengangs Biologie im Master of Education Lehramt an Haupt, Real und Gesamtschulen Inhaltsverzeichnis Vertiefung Fachwissenschaft Biologie (HRGe)..................................
Kantonsschule Ausserschwyz. Biologie. Kantonsschule Ausserschwyz 113
 Kantonsschule Ausserschwyz Biologie Kantonsschule Ausserschwyz 113 Bildungsziele Für das Grundlagen- und Schwerpunktfach Der Biologieunterricht verhilft dazu, die Natur bewusster wahrzunehmen und sich
Kantonsschule Ausserschwyz Biologie Kantonsschule Ausserschwyz 113 Bildungsziele Für das Grundlagen- und Schwerpunktfach Der Biologieunterricht verhilft dazu, die Natur bewusster wahrzunehmen und sich
Die Haut ist individuell - wir vergleichen Fingerabdrücke als Abbild der 3 Grundtypen der Fingermuster
 Naturwissenschaft Marcus Lüpke Die Haut ist individuell - wir vergleichen Fingerabdrücke als Abbild der 3 Grundtypen der Fingermuster Unterrichtsentwurf Studienseminar für das Lehramt der Sekundarstufe
Naturwissenschaft Marcus Lüpke Die Haut ist individuell - wir vergleichen Fingerabdrücke als Abbild der 3 Grundtypen der Fingermuster Unterrichtsentwurf Studienseminar für das Lehramt der Sekundarstufe
fi Mikrobiologie > Teaching Vorlesung Allgemeine Biologie 21., 23., : Heribert Cypionka
 Vorlesung Allgemeine Biologie fi Mikrobiologie 21., 23., 29.11.: Heribert Cypionka 30.11.: Meinhard Simon Institut für Chemie und Biologie des Meeres Anreicherungskultur aus dem Watt vor Borkum weitere
Vorlesung Allgemeine Biologie fi Mikrobiologie 21., 23., 29.11.: Heribert Cypionka 30.11.: Meinhard Simon Institut für Chemie und Biologie des Meeres Anreicherungskultur aus dem Watt vor Borkum weitere
Beratung im Tagesfachpraktikum
 Beratung im Tagesfachpraktikum MNK- MNT- NWA Pädagogische Hochschule Karlsruhe Gliederung 1. Ziele des Tagesfachpraktikums 2. Anforderungen an Studierende 3. Strukturierung des Beratungsgesprächs 4. Bewertung
Beratung im Tagesfachpraktikum MNK- MNT- NWA Pädagogische Hochschule Karlsruhe Gliederung 1. Ziele des Tagesfachpraktikums 2. Anforderungen an Studierende 3. Strukturierung des Beratungsgesprächs 4. Bewertung
Zelldifferenzierung Struktur und Funktion von Pflanzenzellen (A)
 Struktur und Funktion von Pflanzenzellen (A) Abb. 1: Querschnitt durch ein Laubblatt (Rasterelektronenmikroskop) Betrachtet man den Querschnitt eines Laubblattes unter dem Mikroskop (Abb. 1), so sieht
Struktur und Funktion von Pflanzenzellen (A) Abb. 1: Querschnitt durch ein Laubblatt (Rasterelektronenmikroskop) Betrachtet man den Querschnitt eines Laubblattes unter dem Mikroskop (Abb. 1), so sieht
Arbeitsblatt Pip und Lucky: Was atmen Tiere im Wasser?
 http://www.kostenloseausmalbilder.de/media/.gallery/main606.jpg (02.08.2015) Arbeitsblatt Pip und Lucky: Was atmen Tiere im Wasser? Pip, die kleine Maus, benötigt zum Atmen Luft, vor allem den Sauerstoff,
http://www.kostenloseausmalbilder.de/media/.gallery/main606.jpg (02.08.2015) Arbeitsblatt Pip und Lucky: Was atmen Tiere im Wasser? Pip, die kleine Maus, benötigt zum Atmen Luft, vor allem den Sauerstoff,
Schulcurriculum Fachbereich Biologie Jg. 7/8
 1. Unterrichtseinheit: Lebewesen bestehen aus Zellen Themen Wovon ernähren sich Pflanzen? Naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung bei der Fotosynthese Das Mikroskop als naturwissenschaftliches Arbeitsgerät
1. Unterrichtseinheit: Lebewesen bestehen aus Zellen Themen Wovon ernähren sich Pflanzen? Naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung bei der Fotosynthese Das Mikroskop als naturwissenschaftliches Arbeitsgerät
Wir untersuchen Mineralwasser
 Wir untersuchen Mineralwasser Jeder von uns kennt es: Mineralwasser. Im Geschäft wird es mit viel, wenig oder gar keiner Kohlensäure angeboten. Kohlensäure beschreibt die Form, in der das Gas Kohlenstoffdioxid
Wir untersuchen Mineralwasser Jeder von uns kennt es: Mineralwasser. Im Geschäft wird es mit viel, wenig oder gar keiner Kohlensäure angeboten. Kohlensäure beschreibt die Form, in der das Gas Kohlenstoffdioxid
Grundlegende Mechanismen der Verhaltenssteuerung
 Grundlegende Mechanismen der Verhaltenssteuerung CLAAS WEGNER SVEN GRÜGELSIEPE Online-Ergänzung MNU 65/3 (15.4.2012) Seiten xx xx, ISSN 0025-5866, Verlag Klaus Seeberger, Neuss 1 Grundlegende Mechanismen
Grundlegende Mechanismen der Verhaltenssteuerung CLAAS WEGNER SVEN GRÜGELSIEPE Online-Ergänzung MNU 65/3 (15.4.2012) Seiten xx xx, ISSN 0025-5866, Verlag Klaus Seeberger, Neuss 1 Grundlegende Mechanismen
Biologie. Bildungsziele
 Kantonsschule Ausserschwyz Biologie Bildungsziele Der Biologieunterricht verhilft dazu, die Natur bewusster wahrzunehmen und sich dieser gegenüber verantwortungsvoll zu verhalten. Lernen im Biologieunterricht
Kantonsschule Ausserschwyz Biologie Bildungsziele Der Biologieunterricht verhilft dazu, die Natur bewusster wahrzunehmen und sich dieser gegenüber verantwortungsvoll zu verhalten. Lernen im Biologieunterricht
Einführung in die Umweltwissenschaften
 Einführung in die Umweltwissenschaften Heribert Cypionka Mikrobiologische Grundlagen - Rolle der Mikroorganismen in der Natur - Beispiel Meer - Biogeochemie, Mikrobielle Ökologie, Umweltmikrobiologie -
Einführung in die Umweltwissenschaften Heribert Cypionka Mikrobiologische Grundlagen - Rolle der Mikroorganismen in der Natur - Beispiel Meer - Biogeochemie, Mikrobielle Ökologie, Umweltmikrobiologie -
Schulinterner Arbeitsplan für den Doppeljahrgang 7./8. im Fach Biologie Verwendetes Lehrwerk: BIOSKOP 7/8
 Thema Inhaltskompetenzen Prozesskompetenzen Bezug zum Methodencurriculum (in Zukunft) Vorschlag Stunden - zahl Lebewesen bestehen aus Zellen 6 Die Schülerinnen und Schüler Das Mikroskop Pflanzen- und Tierzellen
Thema Inhaltskompetenzen Prozesskompetenzen Bezug zum Methodencurriculum (in Zukunft) Vorschlag Stunden - zahl Lebewesen bestehen aus Zellen 6 Die Schülerinnen und Schüler Das Mikroskop Pflanzen- und Tierzellen
Aufgabe: Wie stellt man ein mikroskopisches Präparat her? Stand:
 Aufgabe: Wie stellt man ein mikroskopisches Präparat her? Stand: 06.06.2016 Jahrgangsstufe 5 Fach/Fächer Übergreifende Bildungs- und Erziehungsziele Biologie Alltagskompetenz und Lebensökonomie Berufliche
Aufgabe: Wie stellt man ein mikroskopisches Präparat her? Stand: 06.06.2016 Jahrgangsstufe 5 Fach/Fächer Übergreifende Bildungs- und Erziehungsziele Biologie Alltagskompetenz und Lebensökonomie Berufliche
Tiere in Polarregionen
 Tiere in Polarregionen Warum es Eisbären gibt, aber keine Eismäuse Bergmannsche Regel Verwandte Tiere sind in kalten Regionen generell als in warmen Regionen. Mit der Größe eines Tieres wächst die im Quadrat,
Tiere in Polarregionen Warum es Eisbären gibt, aber keine Eismäuse Bergmannsche Regel Verwandte Tiere sind in kalten Regionen generell als in warmen Regionen. Mit der Größe eines Tieres wächst die im Quadrat,
Station: Bromelien als Lebensraum
 Station: Bromelien als Lebensraum Klassenstufe: 8. Klasse Benötigte Zeit: 30 min Materialien: Objektträger, Bromelie mit gefülltem Wassertrichter, Pipette, Mikroskop, Deckgläschen, Heuaufguss Überblick:
Station: Bromelien als Lebensraum Klassenstufe: 8. Klasse Benötigte Zeit: 30 min Materialien: Objektträger, Bromelie mit gefülltem Wassertrichter, Pipette, Mikroskop, Deckgläschen, Heuaufguss Überblick:
Präsentation im Rahmen des Proseminars Marinbiologie 10. Juni, 2016 Von Stephanie Waich
 Präsentation im Rahmen des Proseminars Marinbiologie 10. Juni, 2016 Von Stephanie Waich Grob-ökologische Gliederung des marinen Lebensraumes: http://www.spektrum.de/lexikon/biologie/meeresbiologie/41670
Präsentation im Rahmen des Proseminars Marinbiologie 10. Juni, 2016 Von Stephanie Waich Grob-ökologische Gliederung des marinen Lebensraumes: http://www.spektrum.de/lexikon/biologie/meeresbiologie/41670
EG 1.4 zeichnen lichtmikroskopische. Präparate )
 Zellen, Fotosynthese und Zellatmung: 1. Lebewesen bestehen aus Zellen; 1.1 Das Mikroskop als naturwissenschaftliches Arbeitsgerät FW 2.2 beschreiben Zellen als Grundeinheiten; beschreiben einzelne Zellbestandteile
Zellen, Fotosynthese und Zellatmung: 1. Lebewesen bestehen aus Zellen; 1.1 Das Mikroskop als naturwissenschaftliches Arbeitsgerät FW 2.2 beschreiben Zellen als Grundeinheiten; beschreiben einzelne Zellbestandteile
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Hausaufgaben Mathematik Klasse 6. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Hausaufgaben Mathematik Klasse 6 Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de InhaltsverzeIchnIs Vorwort.... 5 Brüche:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Hausaufgaben Mathematik Klasse 6 Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de InhaltsverzeIchnIs Vorwort.... 5 Brüche:
Geräte und Maschinen im Alltag
 und Maschinen im Alltag Dieses Skript gehört: und Maschinen im Alltag Seite 2 Versuch 1: Fotos ohne Fotoapparat In dem folgenden Versuch wollen wir uns ein altes fotografisches Verfahren genauer anschauen
und Maschinen im Alltag Dieses Skript gehört: und Maschinen im Alltag Seite 2 Versuch 1: Fotos ohne Fotoapparat In dem folgenden Versuch wollen wir uns ein altes fotografisches Verfahren genauer anschauen
Abb. 2: Mögliches Schülermodell
 Einzeller Ein Unterrichtskonzept von Dirk Krüger und Anke Seegers Jahrgang Klasse 7 / 8 Zeitumfang Unterrichtsreihe Fachinhalt Kompetenzen MK Methoden Materialien 90 Minuten Tiergruppe der Einzeller (Bauplan
Einzeller Ein Unterrichtskonzept von Dirk Krüger und Anke Seegers Jahrgang Klasse 7 / 8 Zeitumfang Unterrichtsreihe Fachinhalt Kompetenzen MK Methoden Materialien 90 Minuten Tiergruppe der Einzeller (Bauplan
XXX P-NW 10/09. Online-Ergänzung. MNU PRIMAR 2/4 ( ) Seiten 1 7, ISSN , Verlag Klaus Seeberger, Neuss
 XXX Online-Ergänzung P-NW 10/09 MNU PRIMAR 2/4 (15.10.2010) Seiten 1 7, ISSN 1867-9439, Verlag Klaus Seeberger, Neuss 1 Name: Klasse: Datum: Name des Versuchs Für den Versuch benötigst du: 2 Bechergläser
XXX Online-Ergänzung P-NW 10/09 MNU PRIMAR 2/4 (15.10.2010) Seiten 1 7, ISSN 1867-9439, Verlag Klaus Seeberger, Neuss 1 Name: Klasse: Datum: Name des Versuchs Für den Versuch benötigst du: 2 Bechergläser
Das Verhalten von Algen zu Licht (Artikelnr.: P )
 Lehrer-/Dozentenblatt Das Verhalten von Algen zu Licht (Artikelnr.: P8013900) Curriculare Themenzuordnung Fachgebiet: Biologie Bildungsstufe: Klasse 7-10 Lehrplanthema: Sinnesorgane Unterthema: Lichtsinn
Lehrer-/Dozentenblatt Das Verhalten von Algen zu Licht (Artikelnr.: P8013900) Curriculare Themenzuordnung Fachgebiet: Biologie Bildungsstufe: Klasse 7-10 Lehrplanthema: Sinnesorgane Unterthema: Lichtsinn
Leben im Wassertropfen
 Forscherheft Leben im Wassertropfen Dieses Heft gehört: Klasse: Schuljahr: 1 Inhaltsverzeichnis 1. Aufbau des Mikroskops Dino-Lite...1 2. Bedienungsanleitung des Mikroskops Dino-Lite...3 3. Aufgabe 1:
Forscherheft Leben im Wassertropfen Dieses Heft gehört: Klasse: Schuljahr: 1 Inhaltsverzeichnis 1. Aufbau des Mikroskops Dino-Lite...1 2. Bedienungsanleitung des Mikroskops Dino-Lite...3 3. Aufgabe 1:
Prüfungsreferat der Naturwissenschaftlichen Fakultät. Ansuchen um Überprüfung des Bachelorstudiums
 Prüfungsreferat der Naturwissenschaftlichen Fakultät Matrikelnummer D Studienkennzahl(en) Ansuchen um Überprüfung des Bachelorstudiums der Studienrichtung Lehramt des Unterrichtsfaches BIOLOGIE UND UMWELTKUNDE
Prüfungsreferat der Naturwissenschaftlichen Fakultät Matrikelnummer D Studienkennzahl(en) Ansuchen um Überprüfung des Bachelorstudiums der Studienrichtung Lehramt des Unterrichtsfaches BIOLOGIE UND UMWELTKUNDE
Voransicht. Mikroskopier-Führerschein erfolgreich bestanden I/A. hat den. Arbeiten mit dem Mikroskop Reihe 2 S 4. LEK Glossar Mediothek S 4
 S 4 Verlauf Material S 4 (Name des Schülers) hat den Mikroskopier-Führerschein erfolgreich bestanden Pflichtstationen Station titel der Station Nr. Erledigt 1 Der Aufbau eines Mikroskops 2 Auf der Spur
S 4 Verlauf Material S 4 (Name des Schülers) hat den Mikroskopier-Führerschein erfolgreich bestanden Pflichtstationen Station titel der Station Nr. Erledigt 1 Der Aufbau eines Mikroskops 2 Auf der Spur
Kultusministerium. Name, Vorname: Klasse: Schule: Seite 1 von 6
 Kultusministerium Name, Vorname: Klasse: Schule: Seite 1 von 6 Aufgabe 1: Stoffe und ihre Eigenschaften a) Die Chemie ist wie die Biologie und die Geschichte eine auf Erfahrungen und Befragungen beruhende
Kultusministerium Name, Vorname: Klasse: Schule: Seite 1 von 6 Aufgabe 1: Stoffe und ihre Eigenschaften a) Die Chemie ist wie die Biologie und die Geschichte eine auf Erfahrungen und Befragungen beruhende
VORANSICHT. Harte Schale, weicher Kern wirbellose Tiere im Gruppenpuzzle kennenlernen. Das Wichtigste auf einen Blick
 III Tiere Beitrag 17 Wirbellose Tiere (Kl. 6/7) 1 von 24 Harte Schale, weicher Kern wirbellose Tiere im Gruppenpuzzle kennenlernen Ein Beitrag von Sabine Nelke, Haltern am See Mit Illustrationen von Julia
III Tiere Beitrag 17 Wirbellose Tiere (Kl. 6/7) 1 von 24 Harte Schale, weicher Kern wirbellose Tiere im Gruppenpuzzle kennenlernen Ein Beitrag von Sabine Nelke, Haltern am See Mit Illustrationen von Julia
Flugbahnen von Bomben bei strombolianischen Ausbrüchen
 Flugbahnen von Bomben bei strombolianischen Ausbrüchen Lernziele Eruptionen zweier Krater des Stromboli am 27.4.1996, Foto J. Alean 1.) Sie können den Begriff «strombolianische Eruption» erklären. 2.)
Flugbahnen von Bomben bei strombolianischen Ausbrüchen Lernziele Eruptionen zweier Krater des Stromboli am 27.4.1996, Foto J. Alean 1.) Sie können den Begriff «strombolianische Eruption» erklären. 2.)
Schulversuch-Protokoll Jan gr. Austing
 rganisch-chemisches Praktikum für Studierende des Lehramts WS 06/07 Leitung: Prof. Hilt/ Dr. Reiß Schulversuch-Protokoll 26.12.2007 Jan gr. Austing 1) Versuchsbezeichnung: Darstellung von Nitroglycerin
rganisch-chemisches Praktikum für Studierende des Lehramts WS 06/07 Leitung: Prof. Hilt/ Dr. Reiß Schulversuch-Protokoll 26.12.2007 Jan gr. Austing 1) Versuchsbezeichnung: Darstellung von Nitroglycerin
Voraussetzungen für Keimung (Artikelnr.: P )
 Lehrer-/Dozentenblatt Voraussetzungen für Keimung (Artikelnr.: P8010600) Curriculare Themenzuordnung Fachgebiet: Biologie Bildungsstufe: Klasse 7-10 Lehrplanthema: Pflanzen Unterthema: Keimung und Wachstum
Lehrer-/Dozentenblatt Voraussetzungen für Keimung (Artikelnr.: P8010600) Curriculare Themenzuordnung Fachgebiet: Biologie Bildungsstufe: Klasse 7-10 Lehrplanthema: Pflanzen Unterthema: Keimung und Wachstum
Beiblatt Lehramt UF Biologie 1 von 6 Name Antragsteller/in Matrikelnummer ab
 UF Biologie 1 von 6 Betrifft: Anerkennung von Prüfungen für das Lehramtsstudium an der Naturwissenschaftlichen Fakultät, Unterrichtsfach Biologie und Umweltkunde, der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
UF Biologie 1 von 6 Betrifft: Anerkennung von Prüfungen für das Lehramtsstudium an der Naturwissenschaftlichen Fakultät, Unterrichtsfach Biologie und Umweltkunde, der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
MITTEILUNGSBLATT. Studienjahr 2015/2016 Ausgegeben am Stück Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.
 MITTEILUNGSBLATT Studienjahr 0/06 Ausgegeben am 9.09.06. Stück Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. V E R O R D N U N G E N, R I C H T L I N I E N 7. Verordnung über die
MITTEILUNGSBLATT Studienjahr 0/06 Ausgegeben am 9.09.06. Stück Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. V E R O R D N U N G E N, R I C H T L I N I E N 7. Verordnung über die
2. Klassenarbeiten Im Fach Biologie werden in der Sekundarstufe I keine Klassenarbeiten geschrieben.
 1. Einleitung und Vorgaben durch Kernlehrpläne Die im allgemeinen Leistungskonzept aufgeführten Formen der sonstigen Mitarbeit gelten auch für das Fach Biologie. Dabei werden sowohl die Ausprägung als
1. Einleitung und Vorgaben durch Kernlehrpläne Die im allgemeinen Leistungskonzept aufgeführten Formen der sonstigen Mitarbeit gelten auch für das Fach Biologie. Dabei werden sowohl die Ausprägung als
Experimente zum Kreis-Lauf der Gesteine. Aufbau der Erde
 Experimente zum Kreis-Lauf der Gesteine Aufbau der Erde Foto Nasa Male das Schnitt-Bild auf das Papier 1 Erdapfel Du hast 1 Apfel-Hälfte, Becher mit Wasser, Pinsel und 1 Tusch-Kasten Bemale dein Apfel-Kern
Experimente zum Kreis-Lauf der Gesteine Aufbau der Erde Foto Nasa Male das Schnitt-Bild auf das Papier 1 Erdapfel Du hast 1 Apfel-Hälfte, Becher mit Wasser, Pinsel und 1 Tusch-Kasten Bemale dein Apfel-Kern
Kattmann, U. (Hrsg.): Fachdidaktik Biologie /Eschenhagen; Kattmann; Rodi. Köln: Aulis-Deubner;
 Pro Aktuelle Ereignisse können aufgegriffen und punktuell besprochen werden Aktualität fördert Interesse und Motivation Durch Nachfragen der Schüler kann deren Interessenlage erforscht werden Kann dem
Pro Aktuelle Ereignisse können aufgegriffen und punktuell besprochen werden Aktualität fördert Interesse und Motivation Durch Nachfragen der Schüler kann deren Interessenlage erforscht werden Kann dem
Hintergrund zur Ökologie von C. elegans
 GRUPPE: NAME: DATUM: Matrikelnr. Genereller Hinweis: Bitte den Text sorgsam lesen, da er Hinweise zur Lösung der Aufgaben enthält! Hintergrund zur Ökologie von C. elegans Der Fadenwurm Caenorhabditis elegans
GRUPPE: NAME: DATUM: Matrikelnr. Genereller Hinweis: Bitte den Text sorgsam lesen, da er Hinweise zur Lösung der Aufgaben enthält! Hintergrund zur Ökologie von C. elegans Der Fadenwurm Caenorhabditis elegans
Finde heraus, ob Samen in den Früchten wegen des Fehlens von Luft oder aus anderen Gründen nicht keimen.
 Naturwissenschaften - Biologie - Allgemeine Biologie - 2 Vom Keimen der Samen und Wachsen der Pflanzen (P8011100) 2.7 Keimhemmung in Früchten Experiment von: Phywe Gedruckt: 07.10.2013 15:15:51 intertess
Naturwissenschaften - Biologie - Allgemeine Biologie - 2 Vom Keimen der Samen und Wachsen der Pflanzen (P8011100) 2.7 Keimhemmung in Früchten Experiment von: Phywe Gedruckt: 07.10.2013 15:15:51 intertess
Beiblatt BA Lehramt UF Biologie 1 von 5 Name Antragsteller/in Matrikelnummer ab
 UF Biologie 1 von 5 Betrifft: Anerkennung von Prüfungen für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung), Unterrichtsfach Biologie und Umweltkunde, an der Universität Innsbruck (Curriculum
UF Biologie 1 von 5 Betrifft: Anerkennung von Prüfungen für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung), Unterrichtsfach Biologie und Umweltkunde, an der Universität Innsbruck (Curriculum
Ein "Lernbüffet" zum Themenbereich "Wasser - Gewässer - Gewässerverschmutzung"
 Naturwissenschaft Marcus Lüpke Ein "Lernbüffet" zum Themenbereich "Wasser - Gewässer - Gewässerverschmutzung" Unterrichtsentwurf Studienseminar für das Lehramt der Sekundarstufe I Neuer Schulweg 13 59821
Naturwissenschaft Marcus Lüpke Ein "Lernbüffet" zum Themenbereich "Wasser - Gewässer - Gewässerverschmutzung" Unterrichtsentwurf Studienseminar für das Lehramt der Sekundarstufe I Neuer Schulweg 13 59821
Unsere Umwelt ein großes Recyclingsystem
 Unsere Umwelt ein großes Recyclingsystem Zuordnung zum Kompetenzmodell (KM) Aufgabe(n) KM Beschreibung B2.1 Stoffkreislauf, Energieumwandlung und Wechselwirkungen in Modellökosystemen W2 Ich kann aus unterschiedlichen
Unsere Umwelt ein großes Recyclingsystem Zuordnung zum Kompetenzmodell (KM) Aufgabe(n) KM Beschreibung B2.1 Stoffkreislauf, Energieumwandlung und Wechselwirkungen in Modellökosystemen W2 Ich kann aus unterschiedlichen
Konsequenzen der Ozeanversauerung
 Thema: Stoffkreisläufe Jahrgang 9 & 10 Konsequenzen der Ozeanversauerung Lies den Ausschnitt aus dem nachfolgenden Zeitungsartikel eines Wissenschaftsmagazins aufmerksam durch und betrachte im Diagramm
Thema: Stoffkreisläufe Jahrgang 9 & 10 Konsequenzen der Ozeanversauerung Lies den Ausschnitt aus dem nachfolgenden Zeitungsartikel eines Wissenschaftsmagazins aufmerksam durch und betrachte im Diagramm
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Im Moos ist was los. Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Im Moos ist was los Das komplette finden Sie hier: School-Scout.de S 1 LEK Glossar Mediothek Im Moos ist was los Erarbeitung ökologischer
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Im Moos ist was los Das komplette finden Sie hier: School-Scout.de S 1 LEK Glossar Mediothek Im Moos ist was los Erarbeitung ökologischer
W o r k s h o p P r i m a r s t u f e 3-4
 Workshop 1 (WS1) : Bäume erkennen Es existieren zahlreiche unterschiedliche Bäume. In diesem Projekt wirst du dich auf eine einzige Art konzentrieren. Dazu musst du aber fähig sein deine Baumart zu erkennen
Workshop 1 (WS1) : Bäume erkennen Es existieren zahlreiche unterschiedliche Bäume. In diesem Projekt wirst du dich auf eine einzige Art konzentrieren. Dazu musst du aber fähig sein deine Baumart zu erkennen
Biologieunterricht heute
 Wilhelm Killermann/Peter Hiering/Bernhard Starosta Biologieunterricht heute Eine moderne Fachdidaktik Neuauflage Auer Verlag GmbH Vorwort 7 1. Bedeutung und Stellung der Biologie im Kanon der Unterrichtsfächer..
Wilhelm Killermann/Peter Hiering/Bernhard Starosta Biologieunterricht heute Eine moderne Fachdidaktik Neuauflage Auer Verlag GmbH Vorwort 7 1. Bedeutung und Stellung der Biologie im Kanon der Unterrichtsfächer..
Kükenthal - Zoologisches Praktikum. Click here if your download doesn"t start automatically
 Kükenthal - Zoologisches Praktikum Click here if your download doesn"t start automatically Kükenthal - Zoologisches Praktikum Volker Storch, Ulrich Welsch Kükenthal - Zoologisches Praktikum Volker Storch,
Kükenthal - Zoologisches Praktikum Click here if your download doesn"t start automatically Kükenthal - Zoologisches Praktikum Volker Storch, Ulrich Welsch Kükenthal - Zoologisches Praktikum Volker Storch,
GYMNASIUM ISERNHAGEN. Was essen eigentlich Pflanzen? Inhaltsbezogene Kompetenzen. Prozessbezogene. Medien/ Hinweise. fächerverbindende.
 Fachbereich Biologie GYMNASIUM ISERNHAGEN Schulinternes Curriculum 8. Jg. Thema Inhaltsbezogene Kompetenzen (FW) Was essen eigentlich Pflanzen? Prozessbezogene Kompetenzen (EG, KK, BW) Medien/ Hinweise
Fachbereich Biologie GYMNASIUM ISERNHAGEN Schulinternes Curriculum 8. Jg. Thema Inhaltsbezogene Kompetenzen (FW) Was essen eigentlich Pflanzen? Prozessbezogene Kompetenzen (EG, KK, BW) Medien/ Hinweise
Modulbeschreibung: Bachelor of Education Chemie
 Modulbeschreibung: Bachelor of Education Chemie Modul 1: Allgemeine und anorganische Chemie 1 - Grundlagen 1 210 h 7 LP 1. Sem 1 Semester a) Vorlesung: Vorlesung Anorganische und Allgemeine Chemie (P)
Modulbeschreibung: Bachelor of Education Chemie Modul 1: Allgemeine und anorganische Chemie 1 - Grundlagen 1 210 h 7 LP 1. Sem 1 Semester a) Vorlesung: Vorlesung Anorganische und Allgemeine Chemie (P)
Schulcurriculum des Evangelischen Gymnasiums Siegen-Weidenau im Fache Chemie, Einführungsphase:
 Schulcurriculum des Evangelischen Gymnasiums Siegen-Weidenau im Fache Chemie, Einführungsphase: Inhaltsfeld_1 (Kohlenstoffverbindungen und Gleichgewichtsreaktionen) 1) Organische Kohlenstoffverbindungen
Schulcurriculum des Evangelischen Gymnasiums Siegen-Weidenau im Fache Chemie, Einführungsphase: Inhaltsfeld_1 (Kohlenstoffverbindungen und Gleichgewichtsreaktionen) 1) Organische Kohlenstoffverbindungen
Vergrößerung des Mikroskops (Artikelnr.: P )
 Lehrer-/Dozentenblatt Vergrößerung des Mikroskops (Artikelnr.: P44020) Curriculare Themenzuordnung Fachgebiet: Biologie Bildungsstufe: Klasse 7-0 Lehrplanthema: Biologie der Zelle, Mikroskopie Unterthema:
Lehrer-/Dozentenblatt Vergrößerung des Mikroskops (Artikelnr.: P44020) Curriculare Themenzuordnung Fachgebiet: Biologie Bildungsstufe: Klasse 7-0 Lehrplanthema: Biologie der Zelle, Mikroskopie Unterthema:
Experimente zu den Themen Energie und Klimawandel
 Experimente zu den Themen Energie und Klimawandel Station 6: Kohlenstoffdioxid Schulfach: Biologie/Naturwissenschaften Sekundarstufe 1 Dieses Material ist im Rahmen des Projekts Bildung für einen nachhaltige
Experimente zu den Themen Energie und Klimawandel Station 6: Kohlenstoffdioxid Schulfach: Biologie/Naturwissenschaften Sekundarstufe 1 Dieses Material ist im Rahmen des Projekts Bildung für einen nachhaltige
phänomenale Tools in NMM - Lernaufgaben
 phänomenale Tools in NMM - Lernaufgaben Atelier A11 Primarstufe 3. 6. Klasse 4. SWiSE-Innovationstag 2013 Luzia Hedinger, Dozentin IWB, Fachteam NMM Luzia Hedinger, Dozentin IWB NMM 11.03.13 Phänomenal
phänomenale Tools in NMM - Lernaufgaben Atelier A11 Primarstufe 3. 6. Klasse 4. SWiSE-Innovationstag 2013 Luzia Hedinger, Dozentin IWB, Fachteam NMM Luzia Hedinger, Dozentin IWB NMM 11.03.13 Phänomenal
Das Studienfach Grundlagen der Naturwissenschaften und der Technik gliedert sich in drei Bereiche:
 Empfehlungen zum Studienverlaufsplan ombinatorischer Bachelor of Arts Grundlagen der Naturwissenschaften und der Technik Studienbeginn S 008 Stand:.08.008 Die Prüfungsordnung für das Studienfach ist neu
Empfehlungen zum Studienverlaufsplan ombinatorischer Bachelor of Arts Grundlagen der Naturwissenschaften und der Technik Studienbeginn S 008 Stand:.08.008 Die Prüfungsordnung für das Studienfach ist neu
Die Entwicklung des Mittelmeeres
 Anastasia Landis 26.11.2014 Wintersemester 14/15 Seminar: Geographie der Meere und Küsten Leitung: P. Michael Link Universität Hamburg Institut für Geographie Die Entwicklung des Mittelmeeres Abb.1.: Eigene
Anastasia Landis 26.11.2014 Wintersemester 14/15 Seminar: Geographie der Meere und Küsten Leitung: P. Michael Link Universität Hamburg Institut für Geographie Die Entwicklung des Mittelmeeres Abb.1.: Eigene
Welche Aufgabe haben die Keimblätter bei der Entwicklung der Pflanze?
 Naturwissenschaften - Biologie - Allgemeine Biologie - 2 Vom Keimen der Samen und Wachsen der Pflanzen (P80200) 2.8 Die Funktion der Keimblätter Experiment von: Phywe Gedruckt: 07.0.203 5:7:46 intertess
Naturwissenschaften - Biologie - Allgemeine Biologie - 2 Vom Keimen der Samen und Wachsen der Pflanzen (P80200) 2.8 Die Funktion der Keimblätter Experiment von: Phywe Gedruckt: 07.0.203 5:7:46 intertess
Bewegungsapparat. Warum Gelenke nicht quietschen. Unterrichtsmaterialien zum Thema. (Version vom August 2014)
 Unterrichtsmaterialien zum Thema Bewegungsapparat Warum Gelenke nicht quietschen (Version vom August 2014) Herausgegeben von: Entwickelt von: Dr. Sanja Perkovska Dr. Eva Kölbach Angela Bonetti Kirsten
Unterrichtsmaterialien zum Thema Bewegungsapparat Warum Gelenke nicht quietschen (Version vom August 2014) Herausgegeben von: Entwickelt von: Dr. Sanja Perkovska Dr. Eva Kölbach Angela Bonetti Kirsten
Veranstaltung 5: Chemie macht hungrig!
 Veranstaltung 5: Chemie macht hungrig! Station 1: Kohlenhydrate E1 Gummibärchen gehen baden! E2 Ist Zucker gleich Zucker? E3 Was macht eine Kartoffel stark? Station 2: Fette E4 Können Fette verschwinden?
Veranstaltung 5: Chemie macht hungrig! Station 1: Kohlenhydrate E1 Gummibärchen gehen baden! E2 Ist Zucker gleich Zucker? E3 Was macht eine Kartoffel stark? Station 2: Fette E4 Können Fette verschwinden?
VORANSICHT. Erlebnis Natur Böden und Tiere im Ökosystem Wald. Mit Programmvorschlägen. für eine Waldexkursion. Das Wichtigste auf einen Blick
 VIII Ökologie Beitrag 2 Böden und Tiere im Ökosystem Wald (Klasse 7/8) 1 von 26 Erlebnis Natur Böden und Tiere im Ökosystem Wald Christoph Randler, Schriesheim, und Eberhard Hummel, Korntal Der Wald gehört
VIII Ökologie Beitrag 2 Böden und Tiere im Ökosystem Wald (Klasse 7/8) 1 von 26 Erlebnis Natur Böden und Tiere im Ökosystem Wald Christoph Randler, Schriesheim, und Eberhard Hummel, Korntal Der Wald gehört
AMTLICHE MITTEILUNGEN
 REKTOR AMTLICHE MITTEILUNGEN Nr. 931 Datum: 17.02.2014 Dritte Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Hohenheim für die Akademische Zwischenprüfung und die Modulprüfungen,
REKTOR AMTLICHE MITTEILUNGEN Nr. 931 Datum: 17.02.2014 Dritte Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Hohenheim für die Akademische Zwischenprüfung und die Modulprüfungen,
Der ph-wert des Wassers kann mit einem ph-meter, mit ph-indikatorpapier oder mit ph-indikatorstäbchen gemessen werden.
 Wasserchemie: Für die Bestimmung einzelnen Parameter können je nach Ausrüstung verschiedene Methoden angewendet werden. Für die Vergleichbarkeit Ergebnisse ist es jedoch unbedingt notwendig, dass im Ergebnisformular
Wasserchemie: Für die Bestimmung einzelnen Parameter können je nach Ausrüstung verschiedene Methoden angewendet werden. Für die Vergleichbarkeit Ergebnisse ist es jedoch unbedingt notwendig, dass im Ergebnisformular
Hitzeschäden an Moosen?
 Hitzeschäden an Moosen 1 Hitzeschäden an Moosen? Jan-Peter Frahm In den letzten Jahren sind mir eigenartige Schäden an Moosen aufgefallen, speziell an Epiphyten auf Holundern. Die darauf wachsenden Moose,
Hitzeschäden an Moosen 1 Hitzeschäden an Moosen? Jan-Peter Frahm In den letzten Jahren sind mir eigenartige Schäden an Moosen aufgefallen, speziell an Epiphyten auf Holundern. Die darauf wachsenden Moose,
Merkblatt 1: Spuren und Zeichen des Bibers, Symbole und Illustrationen
 Merkblatt 1: Spuren und Zeichen des Bibers, e und Illustrationen Baue und Burgen des Bibers Skizze Bezeichnung Beschreibung Bau In hohen und stabilen Damm gebaut. Das Luftloch ist entweder nicht sichtbar
Merkblatt 1: Spuren und Zeichen des Bibers, e und Illustrationen Baue und Burgen des Bibers Skizze Bezeichnung Beschreibung Bau In hohen und stabilen Damm gebaut. Das Luftloch ist entweder nicht sichtbar
Aufgabe: Keimungsbedingungen
 Jahrgangsstufe 6 Aufgabe: Keimungsbedingungen Stand: 06.06.2016 Fach/Fächer Übergreifende Bildungs- und Erziehungsziele Biologie Alltagskompetenz und Lebensökonomie Berufliche Orientierung Bildung für
Jahrgangsstufe 6 Aufgabe: Keimungsbedingungen Stand: 06.06.2016 Fach/Fächer Übergreifende Bildungs- und Erziehungsziele Biologie Alltagskompetenz und Lebensökonomie Berufliche Orientierung Bildung für
Rauben Sie dem Tumor seine Energie zum Wachsen
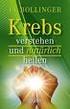 Rauben Sie dem Tumor seine Energie zum Wachsen Woher nimmt ein Tumor die Kraft zum Wachsen? Tumorzellen benötigen wie andere Zellen gesunden Gewebes auch Nährstoffe und Sauerstoff, um wachsen zu können.
Rauben Sie dem Tumor seine Energie zum Wachsen Woher nimmt ein Tumor die Kraft zum Wachsen? Tumorzellen benötigen wie andere Zellen gesunden Gewebes auch Nährstoffe und Sauerstoff, um wachsen zu können.
Aufgabe: Die Aktivität des Igels im Jahresverlauf
 Aufgabe: Die Aktivität des Igels im Jahresverlauf Jahrgangsstufe 5 Stand 06. Juni 2016 Fach/Fächer Übergreifende Bildungs- und Erziehungsziele Zeitrahmen Benötigtes Material Biologie 20 Minuten Arbeitsblätter
Aufgabe: Die Aktivität des Igels im Jahresverlauf Jahrgangsstufe 5 Stand 06. Juni 2016 Fach/Fächer Übergreifende Bildungs- und Erziehungsziele Zeitrahmen Benötigtes Material Biologie 20 Minuten Arbeitsblätter
Unsere Umwelt ein großes Recyclingsystem
 Unsere Umwelt ein großes Recyclingsystem 1. Der Regenwurm in seinem Lebensraum Im Biologiebuch findest du Informationen über den Regenwurm. Lies den Text durch und betrachte die Abbildung. Regenwürmer
Unsere Umwelt ein großes Recyclingsystem 1. Der Regenwurm in seinem Lebensraum Im Biologiebuch findest du Informationen über den Regenwurm. Lies den Text durch und betrachte die Abbildung. Regenwürmer
Arbeitsblatt Sollte eine Wasserflasche aus Glas im Gefrierfach gekühlt werden?
 Arbeitsblatt Sollte eine Wasserflasche aus Glas im Gefrierfach gekühlt werden? Beschrifte die Kästchen mit je einem Aggregatzustand. Benenne die Nummern, es handelt sich dabei um Fachbegriffe für die Übergänge
Arbeitsblatt Sollte eine Wasserflasche aus Glas im Gefrierfach gekühlt werden? Beschrifte die Kästchen mit je einem Aggregatzustand. Benenne die Nummern, es handelt sich dabei um Fachbegriffe für die Übergänge
1 Was ist Leben? Kennzeichen der Lebewesen
 1 In diesem Kapitel versuche ich, ein großes Geheimnis zu lüften. Ob es mir gelingt? Wir werden sehen! Leben scheint so selbstverständlich zu sein, so einfach. Du wirst die wichtigsten Kennzeichen der
1 In diesem Kapitel versuche ich, ein großes Geheimnis zu lüften. Ob es mir gelingt? Wir werden sehen! Leben scheint so selbstverständlich zu sein, so einfach. Du wirst die wichtigsten Kennzeichen der
Unterrichtsfach Biologie und Umweltkunde / 402 Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe - Studienplan Cluster Mitte. Studienrichtung: Matr.Nr.
 Name: Matr.Nr. Tel.Nr.: Fach / SKZ Studienrichtung: E-Mail: Unterrichtsfach Biologie und Umweltkunde / 40 Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe - Studienplan 06 - Cluster Mitte. Tragen Sie bitte für jede
Name: Matr.Nr. Tel.Nr.: Fach / SKZ Studienrichtung: E-Mail: Unterrichtsfach Biologie und Umweltkunde / 40 Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe - Studienplan 06 - Cluster Mitte. Tragen Sie bitte für jede
Leben im Wassertropfen
 Forscherheft Leben im Wassertropfen (geeignet für die 6. Jahrgangsstufe Mittelschule Lehrplan PLUS) Dieses Heft gehört: Klasse: Schuljahr: 1 Inhaltsverzeichnis 1.Aufbau des Mikroskops Dino-Lite...1 2.
Forscherheft Leben im Wassertropfen (geeignet für die 6. Jahrgangsstufe Mittelschule Lehrplan PLUS) Dieses Heft gehört: Klasse: Schuljahr: 1 Inhaltsverzeichnis 1.Aufbau des Mikroskops Dino-Lite...1 2.
Leben im Wassertropfen
 Forscherheft Leben im Wassertropfen (geeignet für die 8. Klasse Realschule Lehrplan PLUS) Dieses Heft gehört: Klasse: Schuljahr: Inhaltsverzeichnis 1.Aufbau des Mikroskops Dino-Lite...1 2. Bedienungsanleitung
Forscherheft Leben im Wassertropfen (geeignet für die 8. Klasse Realschule Lehrplan PLUS) Dieses Heft gehört: Klasse: Schuljahr: Inhaltsverzeichnis 1.Aufbau des Mikroskops Dino-Lite...1 2. Bedienungsanleitung
Schulinternes Curriculum für die Einführungsphase
 Schulinternes Curriculum für die Einführungsphase Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema/Kontext: Kein Leben ohne Zelle I Wie sind Zellen aufgebaut und organisiert? UF1 Wiedergabe UF2 Auswahl K1
Schulinternes Curriculum für die Einführungsphase Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema/Kontext: Kein Leben ohne Zelle I Wie sind Zellen aufgebaut und organisiert? UF1 Wiedergabe UF2 Auswahl K1
Wehrlose Pflanzen? Von wegen! Online-Ergänzung. Wie sich Pflanzen vor Fraßfeinden schützen eine Unterrichtseinheit für die 7. 9.
 Wehrlose Pflanzen? Von wegen! Wie sich Pflanzen vor Fraßfeinden schützen eine Unterrichtseinheit für die 7. 9. Klasse CLAAS WEGNER MAX BENTRUP CAROLINE MÜLLER Online-Ergänzung MNU 66/6 (1.9.2013) Seiten
Wehrlose Pflanzen? Von wegen! Wie sich Pflanzen vor Fraßfeinden schützen eine Unterrichtseinheit für die 7. 9. Klasse CLAAS WEGNER MAX BENTRUP CAROLINE MÜLLER Online-Ergänzung MNU 66/6 (1.9.2013) Seiten
Biologie Lehren und Lernen in der Grundschule
 Biologie Lehren und Lernen in der Grundschule Biologie Lehren und Lernen in der Grundschule Lehramt Grundschule mit Biologie als Didaktikfach Pflichtmodul im Studium für das Lehramt an Grundschulen mit
Biologie Lehren und Lernen in der Grundschule Biologie Lehren und Lernen in der Grundschule Lehramt Grundschule mit Biologie als Didaktikfach Pflichtmodul im Studium für das Lehramt an Grundschulen mit
Ökologie Grundkurs. Unterrichtsvorhaben IV:
 Ökologie Grundkurs Unterrichtsvorhaben IV: Thema/Kontext: Autökologische Untersuchungen Welchen Einfluss haben abiotische Faktoren auf das Vorkommen von Arten? Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: E1
Ökologie Grundkurs Unterrichtsvorhaben IV: Thema/Kontext: Autökologische Untersuchungen Welchen Einfluss haben abiotische Faktoren auf das Vorkommen von Arten? Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: E1
Atmung und Energie. Biologie und Umweltkunde. Zuordnung zum Kompetenzmodell (KM)
 Atmung und Energie Zuordnung zum Kompetenzmodell (KM) Aufgabe(n) KM Beschreibung B3.2 Charakteristische Merkmale von Tiergruppen W3 Ich kann Vorgänge und Phänomene in Natur, Umwelt und Technik in verschiedenen
Atmung und Energie Zuordnung zum Kompetenzmodell (KM) Aufgabe(n) KM Beschreibung B3.2 Charakteristische Merkmale von Tiergruppen W3 Ich kann Vorgänge und Phänomene in Natur, Umwelt und Technik in verschiedenen
Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS
 Wie kann ich eine stabile Mauer bauen? Standfestigkeit bei Mauern Jahrgangsstufen 1/2 Fach Zeitrahmen Benötigtes Material Heimat- und Sachunterricht ca. 1 Unterrichtseinheit Pro Gruppe: ca. 50 Holzbausteine
Wie kann ich eine stabile Mauer bauen? Standfestigkeit bei Mauern Jahrgangsstufen 1/2 Fach Zeitrahmen Benötigtes Material Heimat- und Sachunterricht ca. 1 Unterrichtseinheit Pro Gruppe: ca. 50 Holzbausteine
Saugschuppen. Station: Saugschuppen mikroskopieren. Klassenstufe: 8. Klasse (Sek I) Benötigte Zeit: 30 Minuten
 Station: Saugschuppen mikroskopieren Klassenstufe: 8. Klasse (Sek I) Benötigte Zeit: 30 Minuten Überblick: Die Schüler/innen sollen Abdrücke von den Blattoberflächen nehmen und durch das Mikroskopieren
Station: Saugschuppen mikroskopieren Klassenstufe: 8. Klasse (Sek I) Benötigte Zeit: 30 Minuten Überblick: Die Schüler/innen sollen Abdrücke von den Blattoberflächen nehmen und durch das Mikroskopieren
Aufgabe: Fehler und Fehlerquellen am Bsp. Knochenaufbau
 Aufgabe: Fehler und Fehlerquellen am Bsp. Knochenaufbau Jahrgangsstufe 5 Stand: 10.12.2016 Fach/Fächer Übergreifende Bildungsund Erziehungsziele Biologie Alltagskompetenz und Lebensökonomie Berufliche
Aufgabe: Fehler und Fehlerquellen am Bsp. Knochenaufbau Jahrgangsstufe 5 Stand: 10.12.2016 Fach/Fächer Übergreifende Bildungsund Erziehungsziele Biologie Alltagskompetenz und Lebensökonomie Berufliche
Studien- und Prüfungsordnung der Albert-Ludwigs-Universität für den Studiengang Lehramt an Gymnasien
 Vom 24. März 2011 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 42, Nr. 7, S. 25 252) Studien- und Prüfungsordnung der Albert-Ludwigs-Universität für den Studiengang Lehramt an Gymnasien Anlage B Fachspezifische Bestimmungen
Vom 24. März 2011 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 42, Nr. 7, S. 25 252) Studien- und Prüfungsordnung der Albert-Ludwigs-Universität für den Studiengang Lehramt an Gymnasien Anlage B Fachspezifische Bestimmungen
Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS
 Was passiert, wenn s heiß wird? - Wir untersuchen Stoffe Jahrgangsstufen 1/2 Stand: 13.12.2015 Fach Zeitrahmen Benötigtes Material Heimat- und Sachunterricht 4 Unterrichtseinheiten Papier für Zeichnungen
Was passiert, wenn s heiß wird? - Wir untersuchen Stoffe Jahrgangsstufen 1/2 Stand: 13.12.2015 Fach Zeitrahmen Benötigtes Material Heimat- und Sachunterricht 4 Unterrichtseinheiten Papier für Zeichnungen
Baustein Aufgabe Material Niveau Textarbeit. * Anwendung von Informationen aus dem Text auf die Abbildung
 Baustein 8: BP2016BW-ALLG-GYM-BIO/InhaltlicherStand:23.März2016/PDFgeneriertam07.04.201600:24 Baustein Aufgabe Material Niveau A Textarbeit AB, Begriffskärtchen * Anwendung von Informationen aus dem Text
Baustein 8: BP2016BW-ALLG-GYM-BIO/InhaltlicherStand:23.März2016/PDFgeneriertam07.04.201600:24 Baustein Aufgabe Material Niveau A Textarbeit AB, Begriffskärtchen * Anwendung von Informationen aus dem Text
Abschlussorientiertes Differenzierungsangebot. Biologie
 Abschlussorientiertes Differenzierungsangebot Biologie Mikroskopische Beobachtung von Hefepilzen Schuljahrgänge 7/8 (Arbeitsstand: 28.3.2017) Die nachfolgende Aufgabe ist an den Lehrplanvorgaben des Gymnasiums
Abschlussorientiertes Differenzierungsangebot Biologie Mikroskopische Beobachtung von Hefepilzen Schuljahrgänge 7/8 (Arbeitsstand: 28.3.2017) Die nachfolgende Aufgabe ist an den Lehrplanvorgaben des Gymnasiums
Kommentierte Aufgabenbeispiele Biologie Jahrgangsstufe 10
 Kommentierte Aufgabenbeispiele Biologie Jahrgangsstufe 10 Kompetenzen werden an Inhalten erworben. Für den Mittleren Schulabschluss werden die Inhalte im Fach Biologie in den folgenden drei Basiskonzepten
Kommentierte Aufgabenbeispiele Biologie Jahrgangsstufe 10 Kompetenzen werden an Inhalten erworben. Für den Mittleren Schulabschluss werden die Inhalte im Fach Biologie in den folgenden drei Basiskonzepten
