Leonhard Hennen Reinhard Grünwald Christoph Revermann Arnold Sauter. Hirnforschung. Zusammenfassung. April 2007 Arbeitsbericht Nr.
|
|
|
- Frida Gerhardt
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Leonhard Hennen Reinhard Grünwald Christoph Revermann Arnold Sauter Hirnforschung Zusammenfassung April 2007 Arbeitsbericht Nr. 117
2 Umschlagbild: Jürgen Berger, Bernhard Götze und Michael Kiebler, Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie, Tübingen
3 Die Neurowissenschaften, d. h. die Erforschung des Nervensystems und seiner Bedeutung für Wahrnehmung, inneres Erleben und Verhalten des Menschen, haben in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte hinsichtlich des Verständnisses von Aufbau und Funktion des Gehirns einerseits sowie von Krankheiten und der Entwicklung verschiedener technischer und pharmazeutischer Anwendungsmöglichkeiten andererseits gemacht. Innerhalb der Biowissenschaften bilden die Neurowissenschaften mittlerweile eines der am meisten beachteten Forschungsfelder. Ihre breite öffentliche Aufmerksamkeit ist auch darauf zurückzuführen, dass ihr zentraler Gegenstand, das menschliche Gehirn als biologische Grundlage unserer kognitiven Fähigkeiten und emotionalen Erlebnisweisen, den Menschen sozusagen im Kern konstituiert. ZUM STAND DER GRUNDLAGENFORSCHUNG Die modernen Neurowissenschaften bedienen sich einer Vielzahl naturwissenschaftlicher Arbeits- und Methodenbereiche und stellen damit keine einzelne Disziplin dar, sondern bilden ein multidisziplinäres Forschungsfeld. Durch Beiträge und Erkenntnisfortschritte in verschiedenen Bereichen (klassische Neurologie, Genforschung, Informationswissenschaften) sowie durch die Nutzung neuer Methoden (wie hochauflösende bildgebende Verfahren) sind die Datenbestände zur Funktion des Nervensystems und mit ihnen auch das Verständnis der biologischen Grundlagen kognitiver Leistungen enorm gewachsen. Die Fortschritte der neurowissenschaftlichen Grundlagenforschung schlagen sich längst in differenzierter Weise in der Behandlung nicht nur neurologischer, sondern auch psychiatrischer Erkrankungen einschließlich pharmakologischer und psychotherapeutischer Anwendungen nieder. Daneben stoßen die Neurowissenschaften auch die Entwicklung technologischer Anwendungen in der Informatik an. Sie tragen sowohl zur Optimierung von informationsverarbeitenden Systemen als auch zur Entwicklung von Mensch-Maschine-Schnittstellen bei, die für die Unterstützung von Personen, die von Funktionsverlusten etwa der Sinnesorgane betroffen sind, genutzt werden können. Üblicherweise werden die verschiedenen Zugangsweisen und Forschungsgegenstände der Neurowissenschaften grob drei Beschreibungsebenen zugeordnet: der subzellulären und zellulären Ebene, einer mittleren Ebene neuronaler Netzwerkverbände sowie der Ebene funktioneller Systeme, die die verschiedenen mentalen Leistungen des Hirns umfasst. Die Fortschritte der letzten Jahre betreffen insbesondere die subzelluläre und zelluläre sowie die (übergeordnete) Ebene der funktionellen Systeme. Es ist auf der Ebene der funktionellen Systeme (insbesondere 1
4 durch bildgebende Verfahren) gelungen, die Kartierung des Gehirns deutlich zu verfeinern, d. h. verschiedene mentale Leistungen bestimmten Hirnregionen zuzuordnen. Damit ist unzweifelhaft, dass es Funktionsspezialisierungen im Gehirn gibt; andererseits ist im Zuge der Forschung deutlich geworden, dass komplexe kognitive Funktionen in der Regel über zahlreiche, verschiedene Hirnregionen verteilt sind, sodass lediglich von Spezialisierungen, aber nicht von einer exklusiven Funktion die Rede sein kann. Auf der zellulären und subzellulären Ebene konnten der Aufbau, die elektrophysiologische Wirkungsweise und die Zusammenarbeit von Neuronen aufgeklärt werden. Durch die Molekulargenetik ist es gelungen, bestimmte Neuronengruppen molekular zu charakterisieren und bestimmten Leistungen zuzuordnen. Ebenso ist man bei der Lokalisierung und der Klärung der Bedeutung von Neurotransmittern als Boten- und Überträgerstoffe zwischen Nervenzellen deutlich vorangekommen, womit auch neue Therapiemöglichkeiten für psychische Erkrankungen eröffnet wurden. Die bisherigen Grenzen für das Verständnis der biologischen Grundlagen mentaler Leistungen und Vorgänge und damit die wesentlichen Herausforderungen für die Forschung liegen auf der sogenannten mittleren Ebene der Neuronenverbände. Hier werden die durch die Sinnesorgane in das Gehirn geleiteten Reize in Informationen und sinnhafte mentale Inhalte (Emotionen, Begriffe, Gedanken) übersetzt. Die Zusammenarbeit der neuronalen Netze bildet die Ebene, auf der sich letztlich Bewusstsein konstituiert. Trotz der Fortschritte bei der Charakterisierung verschiedener Neuronenverbände oder auch einer verbesserten Beschreibung ihres Zusammenwirkens (z. B. bei bestimmten Wahrnehmungsvorgängen) ist man von einem tatsächlichen Verständnis, wie Neurone Bewusstsein realisieren, noch weit entfernt. Neben dem Verständnis der Kooperation von Neuronen in neuronalen Netzwerken bilden die Hirnplastizität, d. h. die Veränderung von Hirnstrukturen über die Zeit (wie sie etwa für Lernprozesse charakteristisch ist), und die interindividuelle Varianz des Hirnaufbaus die zentralen Fragen der gegenwärtigen Hirnforschung. GEIST UND GEHIRN Neben dem wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt an sich sowie den bisherigen und möglichen zukünftigen Interventionsmöglichkeiten in das menschliche Gehirn haben vor allem weitreichende erkenntnistheoretische und philosophische Thesen führender Neurowissenschaftler zu den Möglichkeiten einer naturwissenschaftlichen Erklärung geistiger Prozesse in den vergangenen Jahren für öffentliche Aufmerksamkeit gesorgt. Diesen Thesen zufolge würden die Erkenntnisse der modernen Neurowissenschaften zu einer Umwälzung des menschlichen Selbstverständnisses, d. h. unserer Vorstellungen von Subjektivität und personaler Identität, von Selbstbewusstsein, Willen und Handlungssteuerung führen. 2
5 Der im vorliegenden Bericht unternommene Durchgang durch die Diskussion zwischen Neurowissenschaften, Philosophie und Kulturwissenschaften zeigt allerdings, dass weitreichende Thesen zur Determination geistiger Vorgänge durch neuronales Geschehen im Gehirn und zum illusionären Charakter der Willensfreiheit bisher empirisch nicht hinreichend gestützt sind. Sowohl Neurowissenschaftler als auch Vertreter der Geistes- und Kulturwissenschaften stehen vor dem Problem der Übersetzung von Mentalem in Neuronales bzw. von Neuronalem in Mentales. Der Vorwurf einiger Protagonisten der Neurowissenschaften an die Geisteswissenschaften lautet, ihre Konzepte zum Verhältnis von Geist und Gehirn liefen letztlich entgegen ihren eigenen Intentionen auf die naturwissenschaftlich unhaltbare Annahme der Existenz einer unabhängigen geistigen Substanz neben dem Materiellen hinaus, weil sie nicht erklären könnten, wie geistige Prozesse auf der Basis neuronaler Aktivität realisiert werden. Der Vorwurf einer»erklärungslücke«trifft aber die Neurowissenschaften selbst, solange sie das Problem der Herstellung von Bedeutung durch einen wie auch immer gearteten»neuronalen Code«nicht lösen können. Bedeutungsinhalte des Bewusstseins sind gesellschaftlich konstituiert und über Sprache und Schrift oder andere Symbolsysteme objektiviert. Wie dies auf neuronaler Ebene realisiert wird, ist bisher unverstanden. Die Frage nach den möglichen gesellschaftlichen Konsequenzen der Erkenntnisse oder Thesen der Neurowissenschaften zum Verhältnis von Geist und Gehirn lässt sich einer in der philosophischen Diskussion gängigen Position folgend mit einem (vorläufigen)»so what?«beantworten, bis die neuronal basierten Gesetzmäßigkeiten mentaler Zustände und Vorgänge in einem Maße entschlüsselt sind, dass Fühlen, Denken, Verhalten und Entscheidungen auf der Basis beobachteter Vorgänge im Hirn vorhersagbar sind. In Bezug auf die oft genannten eventuellen Konsequenzen aus den Fortschritten der Neurowissenschaften für das Strafrecht würde dies bedeuten, dass der Hirnzustand, der unmittelbar vor einer Straftat bestand, rekonstruierbar sein müsste und die Entscheidung zur Tat als durch diesen Hirnzustand eindeutig determiniert erkannt werden könnte. Da die Forschung hiervon noch weit entfernt zu sein scheint, ist vorläufig kein Anlass für eine grundsätzliche Revision unserer Alltagsauffassung von Schuld und Verantwortung, freiem Willen sowie des strafrechtlichen Schuldbegriffs gegeben. WISSEN UND LERNEN Das Interesse sowohl der allgemeinen Öffentlichkeit als auch der Bildungsforschung an den Methoden und Erkenntnissen der Hirnforschung begründet sich in der Hoffnung, dass diese zu einem besseren Lernen beitragen können. Doch offensichtlich sind die bisherigen Ergebnisse der neurophysiologischen Forschung im Kontext von Lernen äußerst selten eindeutig interpretierbar. Zwar 3
6 wird heute besser verstanden, welche Mechanismen der Informationsverarbeitung man annehmen muss, um das Zustandekommen von (unterschiedlichen) Lernerfolgen zu erklären, warum Menschen in bestimmten Abschnitten ihres Lebens verschiedene Dinge unterschiedlich gut lernen, wie beispielsweise bestimmte Lernvorgänge physikalisch bzw. chemisch im Gehirn realisiert werden und wie sich Lernvorgänge in der Gehirnarchitektur niederschlagen. Doch welche Aktivitäten genau im Gehirn ablaufen, bevor es zu einem entsprechenden Lernerfolg kommt, gehört zu den nach wie vor ungeklärten Fragen. Wenn neuronale Voraussetzungen fehlen, bleiben bewährte Lernumgebungen wirkungslos. Wenn keine Lerngelegenheiten zur Verfügung stehen, bleiben Menschen mit einem effizienten Gehirn inkompetent. Die meisten Ursachen für Lernschwierigkeiten liegen zwischen diesen beiden Extremen und lassen sich mit der Lerngeschichte erklären. Hier hilft der Blick in die Neurophysiologie des Gehirns allein nicht weiter. Um Menschen mit einer gescheiterten Lernkarriere eine neue Chance zu geben, müsste das ihnen fehlende Wissen möglichst genau beschrieben werden, und es müssten Lernumgebungen geschaffen werden, welche den Erwerb des fehlenden Wissens ermöglichen. Vor diesem Hintergrund wird im vorliegenden Bericht diskutiert, was Hirnforschung und Bildungsforschung voneinander erwarten können, welche Implikationen sich aus neurophysiologischen Untersuchungen des menschlichen Gehirns für kognitionswissenschaftliche und lernpsychologische sowie pädagogische Theorien im Kontext des Lernens bzw. der Lehr-/Lernforschung ergeben. Auch wird gezeigt, dass Erkenntnisse aus der Hirnforschung zwar die Rahmenbedingungen beschreiben können, unter denen erfolgreiches Lernen stattfinden kann, dass aber die Beiträge der Neurowissenschaften bisher zu unbestimmt sind, um konkrete Anleitungen für die Gestaltung schulischer und außerschulischer Lerngelegenheiten geben zu können. Gleichwohl konnte die Hirnforschung viele Ergebnisse der langjährigen Lehr- und Lernforschung bestätigen: Bei einer Reihe kognitionswissenschaftlicher Ergebnisse, psychologischer Einsichten und pädagogischer Praktiken weiß man heute besser, warum sie funktionieren oder auch warum nicht. NEUROELEKTRISCHE SCHNITTSTELLEN UND NEUROPROTHETIK Alle kognitiven und emotionalen Prozesse im Gehirn werden von elektrischer Aktivität begleitet, die eine Basis der Signalübertragung zwischen den einzelnen neuronalen Elementen im zentralen Nervensystem darstellt. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, technische Systeme über neuroelektrische Schnittstellen an Nerven anzukoppeln. Derzeit kann man drei Erkrankungscluster unterscheiden, bei deren Behandlung bereits neuroelektrische Schnittstellen eingesetzt wurden. Der erste Cluster um- 4
7 fasst Erkrankungen und Verletzungen im Bereich der Sinnessysteme. Die dabei eingesetzten neuroelektrischen Schnittstellen sind auditorische und visuelle Implantate sowie Implantate zur Wiederherstellung des Gleichgewichtssinnes. Der zweite Cluster bezieht sich auf Erkrankungen und Verletzungen des motorischen Systems. Dazu gehören u. a. Bewegungsstörungen, deren Ursache im Bereich der unwillkürlichen Motorik liegt, wie z. B. Morbus Parkinson oder Dystonie, aber auch Störungen der Willkürmotorik mit Querschnittslähmung und Schlaganfall als Hauptursachen. Die zum Einsatz kommenden Systeme ermöglichen eine Bewegungsäußerung des Patienten in seiner Umwelt. Die bisher eingesetzten Systeme sind u. a. sogenannte Gehirn-Maschine-Schnittstellen sowie die Tiefenhirnstimulation. Ein dritter Cluster von Störungen bezieht sich auf das»milieu intérieur«des menschlichen Körpers. Hierin eingeschlossen sind chronische Schmerzzustände, Zwangsneurosen, Depressionen und Epilepsie. Die verwendeten Schnittstellen (u. a. Vagusnerv-, Tiefenhirn-, Motorkortex- und Rückenmarksstimulation) besitzen keine direkten Wechselwirkungen mit der Umwelt. Der Entwicklungsstand ist bei den verschiedenen Systemen sehr unterschiedlich und reicht vom breiten klinischen Einsatz z. B. beim Cochlea-Implantat zur Wiederherstellung des Gehörs in über Fällen weltweit oder bei der Rückenmarksstimulation zur Behandlung von Schmerzzuständen bei mehr als Patienten bis hin zur Erforschung von Grundlagen im Labor bzw. an einzelnen Probanden (z. B. bei Retina-Implantaten). In letzter Zeit hat sich die Entwicklung neuroelektrischer Schnittstellen stark beschleunigt, und die Palette neuer Einsatzbereiche vergrößert sich zusehends. Dieser Trend speist sich aus den Fortschritten in der IuK-Technologie, bei der Miniaturisierung mechanischer und elektronischer Systeme sowie aus den jüngsten Erkenntnissen zur Funktionsweise des Gehirns. Neuroprothetik ist ein Feld, auf dem Visionen zukünftig möglicher technologischer Entwicklungen eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen, die auch in der Öffentlichkeit immer wieder große Aufmerksamkeit finden. Obwohl es teilweise schwer fällt, den Realitätsgehalt solcher Visionen verlässlich abzuschätzen, sind sie dennoch von hoher Bedeutung vor allem für die öffentliche Wahrnehmung des Forschungsfeldes. Für die Entwicklung neuer neuroprothetischer Anwendungen ist international insbesondere die militärische Forschung von Bedeutung, für die beträchtliche Fördersummen zur Verfügung stehen. Eine Besonderheit von neuroelektrischen Schnittstellen im Gegensatz zu anderen Implantaten (z. B. einem künstlichen Herzen) ist die, dass sie direkt das zentrale Nervensystem und damit zumindest potenziell das menschliche Verhalten, die menschliche Psyche und die Persönlichkeit beeinflussen können, womit grundlegende ethische Fragen aufgeworfen werden. Auch die hypothetischen Möglichkeiten, die menschlichen mentalen Fähigkeiten durch neuroelektrische Schnittstellen zu verbessern (das sogenannte»neuroenhancement«), spielen in diesem Zusammenhang eine nicht unbedeutende Rolle. 5
8 PSYCHISCHE UND NEUROLOGISCHE ERKRANKUNGEN Die medizinisch orientierte, d. h. auf Krankheitsgeschehen fokussierte Forschung repräsentiert im Gesamtgebiet der Hirnforschung bzw. der Neurowissenschaften fraglos den wichtigsten Bereich, sowohl in Bezug auf die öffentlichen und privaten Investitionen bzw. Ressourcen als auch bezüglich der erzielten Erkenntnisse und Ergebnisse zur Funktion und Dysfunktion des Gehirns bzw. Nervensystems. Hirnspezifische Krankheiten werden üblicherweise in psychische (wie Angsterkrankungen, Depression, Psychosen) und neurologische (wie Alzheimer, Epilepsie, Migräne, Parkinson) Erkrankungen unterteilt, wobei eine klare Grenzziehung zwischen beiden Kategorien kaum möglich ist. Als psychische Erkrankungen werden solche bezeichnet, deren Ursprünge überwiegend mit dem Gehirn assoziiert werden, bei denen Veränderungen der Persönlichkeit im Vordergrund stehen und die zumindest bislang vorwiegend auf der Ebene der Symptome beschrieben werden und nicht anhand der (physiologischen) Mechanismen, die zur Erkrankung führen. Unterscheidung und Zuschreibung von psychischen gegenüber neurologischen Erkrankungen die auch das periphere Nervensystem betreffen können sind deutlich von gesellschaftlichen Bewertungen geprägt: Während Krankheiten des Nervensystems im Allgemeinen als»normale«krankheiten wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen gelten, treffen psychisch Erkrankte oft auf spezifische Vorbehalte. Neurologische, vor allem neurodegenerative Erkrankungen spielen in der alternden Gesellschaft eine wachsende Rolle, gleichzeitig scheinen psychische Krankheiten weltweit auf dem Vormarsch. Die (nur schwer bestimmbaren) Gesamtzahlen werden auf 25 bis 30 % Erkrankter in der Bevölkerung Deutschlands wie Europas geschätzt, darunter zwei Drittel psychisch Kranke. Die Europäische Kommission sieht eine zunehmende gesundheitliche und volkswirtschaftliche Bedrohung und arbeitet an der»entwicklung einer Strategie für die Förderung der psychischen Gesundheit in der Europäischen Union«. Der vorliegende Bericht stellt anhand der Krankheitsbilder Angsterkrankungen, ADHS, Depression, Parkinson, Schizophrenie und ihrer Behandlungsansätze exemplarisch die medizinische und gesellschaftliche Bedeutung psychischer und neurologischer Krankheiten dar. Das äußerst weite Spektrum analytischer, diagnostischer und therapeutischer Verfahren zur Erforschung und Behandlung neurologischer und psychischer Krankheiten kann nur angerissen werden. Den Schwerpunkt bilden die wirkstofforientierten, pharmazeutischen Verfahren, darunter besonders die Psychopharmaka mit potenzieller nichtmedizinischer Alltagsnutzung (einschließlich Suchtmittel und Stimulanzien). Verfahren der Psychotherapie werden lediglich mit Blick auf das häufig sich ergänzende, teils aber auch konkurrierende Verhältnis zu biologisch-medizinisch basierten neurowissenschaftlichen Ansätzen angesprochen. Auch die naturwissenschaftlich bedeutsamen 6
9 Forschungsgebiete der Genom- und Proteomanalyse sowie der Gen- und Zelltherapie werden nur komprimiert bezüglich ihres wissenschaftlichen und medizinischen Stellenwertes behandelt, weil sie im Vergleich zu den pharmazeutischen Verfahren noch wenig anwendungsnah und vorrangig grundlagenorientiert ausgerichtet sind. Ein (stark) zunehmender Einsatz von Psychopharmaka im Alltagsleben ist in den USA für größere Teile der Bevölkerung, gerade für die leistungsorientierten, belegt und wird in Europa zunehmend beobachtet. Die individuellen und gesamtgesellschaftlichen Folgen sind in vieler Hinsicht wohl nur schwer absehbar, erscheinen aber grundsätzlich weitreichend. Die Diskussion gesellschaftlicher Tendenzen und Implikationen neuer medizinisch nutzbarer Ergebnisse der Neurowissenschaften konzentriert sich daher auf den zunehmenden Einsatz von Psychopharmaka, insbesondere zur Leistungssteigerung, zur Selbst- und zur Fremdmanipulation. Das Problem weist einen engen Bezug zu der vielleicht größten gesundheits- und sozialpolitischen Herausforderung der kommenden Jahrzehnte auf, der demografisch geprägten Zunahme neurodegenerativer Erkrankungen. Viele Medikamente zu deren Behandlung eignen sich potenziell auch zur Leistungssteigerung Gesunder. Skizziert werden im vorliegenden Bericht zentrale Motive und Ziele der psychopharmakologischen Interventionen, wie Förderung der Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit, Verbesserung von Lernen und Gedächtnis, Stimmungshebung und -stabilisierung, Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit sowie auch die Kompensation altersbedingter mentaler, psychischer und neurologischer Einschränkungen. Insgesamt zeigen sich drängende Fragestellungen für Politik, Gesellschaft und Technikfolgenabschätzung. Ganz grundsätzlich geht es dabei um den Umgang mit Leistungsanforderungen unter den Bedingungen einer Wettbewerbsgesellschaft und die resultierenden Auswirkungen auf gesellschaftliche Normen und das vorherrschende Menschenbild. WEITERER TA-BEDARF Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick über den Stand der neurowissenschaftlichen Forschung in verschiedenen Anwendungsfeldern und skizziert aktuelle und potenzielle zukünftige wissenschaftlich-technische Entwicklungen sowie damit möglicherweise verbundene Folgen und Probleme. Dabei wurde deutlich, dass bei einer Reihe von Entwicklungen in der medizinischen Anwendung der Neurowissenschaften vertiefende TA-Untersuchungen sinnvoll und wichtig erscheinen, z. B. zur Entwicklung neurodegenerativer Erkrankungen in einer alternden Gesellschaft und den sich hieraus ergebenden Herausforderungen für das Gesundheitssystem. Das Aufgreifen dieser Problematik würde allerdings einen Ansatz implizieren, der über das Thema»Neurowissenschaften«hinausgreift und gesellschafts- wie gesundheitspolitische Fragestellungen einbezieht. 7
10 Daneben stehen Aspekte bzw. Themen, wie z. B. die Debatte um den Zusammenhang von Geist und Gehirn oder auch die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse zu Wissen und Lernen, die im vorliegenden Bericht zwar nicht erschöpfend diskutiert werden konnten, deren vertiefte Erörterung aber politisch relevante Einsichten zurzeit nicht erwarten lässt. Als im engeren Sinn hirnforschungsspezifisch bietet sich insbesondere ein TA- Projekt zum Thema»Pharmakologische und technische Neurointerventionen: Nutzen und Risiken in Medizin und Alltag«an. Damit würde das aktuell besonders in der politischen Diskussion stehende Problem der möglichen Verbesserung und Steigerung menschlicher Leistungen durch den Einsatz neurowissenschaftlicher Erkenntnisse (»cognitive enhancement«) thematisiert, und es würden die nach den Ergebnissen des vorliegenden Berichts gesellschaftlich und politisch bedeutendsten wissenschaftlich-technischen Entwicklungen (Psychopharmaka und neuroelektrische Schnittstellen) in den Blick genommen. Mit dem Thema Enhancement ergäbe sich zudem ein Bezug zur aktuellen, forschungspolitisch relevanten Debatte um die Konvergenz von Nanotechnologie, Informatik, Bio- und Neurowissenschaften (»Converging Technologies«). 8
11 Das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) berät das Parlament und seine Ausschüsse seit 1990 in Fragen des technischen und gesellschaftlichen Wandels. Das TAB ist eine organisatorische Einheit des Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) im Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Das TAB kooperierte zur Erfüllung seiner Aufgaben von 2003 bis 2013 mit dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI), Karlsruhe.
12 BÜRO FÜR TECHNIKFOLGEN-ABSCHÄTZUNG BEIM DEUTSCHEN BUNDESTAG Neue Schönhauser Str Berlin Fon +49(0)30/ Fax +49(0)30/
des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung (18. Ausschuss) gemäß 56a der Geschäftsordnung
 Deutscher Bundestag Drucksache 16/7821 16. Wahlperiode 22. 01. 2008 Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung (18. Ausschuss) gemäß 56a der Geschäftsordnung Technikfolgenabschätzung
Deutscher Bundestag Drucksache 16/7821 16. Wahlperiode 22. 01. 2008 Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung (18. Ausschuss) gemäß 56a der Geschäftsordnung Technikfolgenabschätzung
Methoden der kognitiven Neurowissenschaften
 Methoden der kognitiven Neurowissenschaften SS 2014 Freitag 9 Uhr (ct) Björn Herrmann - Jöran Lepsien - Jonas Obleser Zeitplan Datum Thema 11.4. Einführung und Organisation 18.4. -- Karfreitag -- 25.4.
Methoden der kognitiven Neurowissenschaften SS 2014 Freitag 9 Uhr (ct) Björn Herrmann - Jöran Lepsien - Jonas Obleser Zeitplan Datum Thema 11.4. Einführung und Organisation 18.4. -- Karfreitag -- 25.4.
Über den Zusammenhang von Gehirn, Gesellschaft und Geschlecht
 Geisteswissenschaft Anonym Über den Zusammenhang von Gehirn, Gesellschaft und Geschlecht Studienarbeit Humboldt Universität - Berlin Kulturwissenschaftliches Seminar Hauptseminar: Das Unbewusste Sommersemester
Geisteswissenschaft Anonym Über den Zusammenhang von Gehirn, Gesellschaft und Geschlecht Studienarbeit Humboldt Universität - Berlin Kulturwissenschaftliches Seminar Hauptseminar: Das Unbewusste Sommersemester
Über die Möglichkeit, gegen das Gehirn ein Veto einzulegen
 Medien Marius Donadello Über die Möglichkeit, gegen das Gehirn ein Veto einzulegen Können bewusste mentale Prozesse kausal wirksam sein? Magisterarbeit Schriftliche Hausarbeit für die Prüfung zur Erlangung
Medien Marius Donadello Über die Möglichkeit, gegen das Gehirn ein Veto einzulegen Können bewusste mentale Prozesse kausal wirksam sein? Magisterarbeit Schriftliche Hausarbeit für die Prüfung zur Erlangung
Bachelorarbeit Sport mit Schlaganfallpatienten: Ein neuer Ansatz - Der Gehweg von SpoMobil
 Universität Paderborn Fakultät der Naturwissenschaften Department Sport und Gesundheit Angewandte Sportwissenschaften Betreuer: Prof. Dr. med. Weiß Zweitprüfer: PD Dr. med. Baum Bachelorarbeit Sport mit
Universität Paderborn Fakultät der Naturwissenschaften Department Sport und Gesundheit Angewandte Sportwissenschaften Betreuer: Prof. Dr. med. Weiß Zweitprüfer: PD Dr. med. Baum Bachelorarbeit Sport mit
Die tun nix! Die wollen nur spielen Entwicklungspsychologie, Hirnforschung und jugendliches Verhalten
 !"#$%"&&&'(%!()#*$*+" #",%(*-.)*#) Die tun nix! Die wollen nur spielen Entwicklungspsychologie, Hirnforschung und jugendliches Verhalten Peter J. Uhlhaas Jahrestagung Offene Kinder- und Jugendarbeit Arbeitsgemeinschaft
!"#$%"&&&'(%!()#*$*+" #",%(*-.)*#) Die tun nix! Die wollen nur spielen Entwicklungspsychologie, Hirnforschung und jugendliches Verhalten Peter J. Uhlhaas Jahrestagung Offene Kinder- und Jugendarbeit Arbeitsgemeinschaft
Mastervertiefung Psychologische Grundlagen Geist & Gehirn (GG) Forschungsansätze in der Kognitionspsychologie und in den Neurowissenschaften
 Mastervertiefung Psychologische Grundlagen Geist & Gehirn (GG) Forschungsansätze in der Kognitionspsychologie und in den Neurowissenschaften 1 What Why How Who 2 What 3 Hirn Scientific Research 4 ..und
Mastervertiefung Psychologische Grundlagen Geist & Gehirn (GG) Forschungsansätze in der Kognitionspsychologie und in den Neurowissenschaften 1 What Why How Who 2 What 3 Hirn Scientific Research 4 ..und
Das Gehirn ein Beziehungsorgan
 Das Gehirn ein Beziehungsorgan Eine systemisch-ökologische Sicht von Gehirn und psychischer Krankheit Thomas Fuchs Die Welt im Kopf? Phrenologie (Franz Joseph Gall, 1758-1828) Die Welt im Kopf? Psychische
Das Gehirn ein Beziehungsorgan Eine systemisch-ökologische Sicht von Gehirn und psychischer Krankheit Thomas Fuchs Die Welt im Kopf? Phrenologie (Franz Joseph Gall, 1758-1828) Die Welt im Kopf? Psychische
LG Allgemeine und Pädagogische Psychologie
 LG Allgemeine und Pädagogische Psychologie Prof. Dr. Wolfgang Mack Lehrgebiet Team des Lehrgebietes: Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften Prof. Dr. Wolfgang Mack (modulverantwortlich für M3 und
LG Allgemeine und Pädagogische Psychologie Prof. Dr. Wolfgang Mack Lehrgebiet Team des Lehrgebietes: Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften Prof. Dr. Wolfgang Mack (modulverantwortlich für M3 und
NRW-Forum Rehabilitation sensomotorischer Störungen. Bedeutung der Rehabilitation für Parkinson-Patienten
 NRW-Forum Rehabilitation sensomotorischer Störungen Bedeutung der Rehabilitation für Parkinson-Patienten Die Krankheit Parkinson ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, die progredient verläuft
NRW-Forum Rehabilitation sensomotorischer Störungen Bedeutung der Rehabilitation für Parkinson-Patienten Die Krankheit Parkinson ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, die progredient verläuft
Kein Hinweis für eine andere Ursache der Demenz
 die später nach ihm benannte Krankheit. Inzwischen weiß man, dass die Alzheimer-Krankheit eine sogenannte primär-neurodegenerative Hirnerkrankung ist. Das bedeutet, dass die Erkrankung direkt im Gehirn
die später nach ihm benannte Krankheit. Inzwischen weiß man, dass die Alzheimer-Krankheit eine sogenannte primär-neurodegenerative Hirnerkrankung ist. Das bedeutet, dass die Erkrankung direkt im Gehirn
1. Methoden der Hirnforschung 2. Mechanistische Erklärung 3. Neuronale Mechanismen 4. Erklärung des Bewusstseins?
 1. Methoden der Hirnforschung 2. Mechanistische Erklärung 3. Neuronale Mechanismen 4. Erklärung des Bewusstseins? Brigitte Falkenburg 1 1. Methoden der Hirnforschung 2 top-down down/analytisch: Atomistisch
1. Methoden der Hirnforschung 2. Mechanistische Erklärung 3. Neuronale Mechanismen 4. Erklärung des Bewusstseins? Brigitte Falkenburg 1 1. Methoden der Hirnforschung 2 top-down down/analytisch: Atomistisch
4 Das Fachgebiet Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in der Versorgung... 55
 Inhalt XIX 3.1.4 Essstörungen............................................ 38 Binge-Eating-Störung und Adipositas........................ 41 3.1.5 Persönlichkeitsstörungen...................................
Inhalt XIX 3.1.4 Essstörungen............................................ 38 Binge-Eating-Störung und Adipositas........................ 41 3.1.5 Persönlichkeitsstörungen...................................
Ein Modell zur Gesundheits- und Krankheitsentwicklung Das Konzept der Salutogenese. Florian Schmidt, Marius Runkel, Alexander Hülsmann
 Ein Modell zur Gesundheits- und Krankheitsentwicklung Das Konzept der Salutogenese Florian Schmidt, Marius Runkel, Alexander Hülsmann Inhaltsverzeichnis 1. Entstehungshintergrund 2. Konzept der Salutogenese
Ein Modell zur Gesundheits- und Krankheitsentwicklung Das Konzept der Salutogenese Florian Schmidt, Marius Runkel, Alexander Hülsmann Inhaltsverzeichnis 1. Entstehungshintergrund 2. Konzept der Salutogenese
Morbus Parkinson Ratgeber
 Morbus Parkinson Ratgeber Impressum Zarenga GmbH, Bonn 2015 Zarenga GmbH, Pfaffenweg 15, 53227 Bonn Alle Rechte sind vorbehalten. Dieses Buch, einschließlich seiner einzelnen Teile ist urheberrechtlich
Morbus Parkinson Ratgeber Impressum Zarenga GmbH, Bonn 2015 Zarenga GmbH, Pfaffenweg 15, 53227 Bonn Alle Rechte sind vorbehalten. Dieses Buch, einschließlich seiner einzelnen Teile ist urheberrechtlich
Einsichten und Eingriffe in das Gehirnffs
 Studien des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag 24 Leonhard Hennen Reinhard Grünwald Christoph Revermann Arnold Sauter Einsichten und Eingriffe in das Gehirnffs Die Herausforderung
Studien des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag 24 Leonhard Hennen Reinhard Grünwald Christoph Revermann Arnold Sauter Einsichten und Eingriffe in das Gehirnffs Die Herausforderung
Was ist Osteopathie?
 Was ist Osteopathie? Die Osteopathie ist ein ganzheitliches manuelles Diagnose- und Therapieverfahren, mit dessen unterschiedlichen Methoden sich der Bewegungsapparat, die inneren Organe sowie die inneren
Was ist Osteopathie? Die Osteopathie ist ein ganzheitliches manuelles Diagnose- und Therapieverfahren, mit dessen unterschiedlichen Methoden sich der Bewegungsapparat, die inneren Organe sowie die inneren
Thesen zur Nanotechnologie. Herausforderungen einer interdisziplinären Nanotechnologie und eines proaktiven Dialogs.
 Thesen zur Nanotechnologie Herausforderungen einer interdisziplinären Nanotechnologie und eines proaktiven Dialogs. Folgendes Expertengremium hat das Thesenpapier ausgearbeitet: Prof. Dr. Ueli Aebi, Universität
Thesen zur Nanotechnologie Herausforderungen einer interdisziplinären Nanotechnologie und eines proaktiven Dialogs. Folgendes Expertengremium hat das Thesenpapier ausgearbeitet: Prof. Dr. Ueli Aebi, Universität
Umgang mit schwierigen Kindern und Jugendlichen Stefan Schaaf
 Umgang mit schwierigen Kindern und Jugendlichen Geplanter Ablauf: Personenkreis und Entwicklungstendenzen Begriffsklärungen Handlungsmöglichkeiten Personenkreis und Entwicklungstendenzen - Knapp 80.000
Umgang mit schwierigen Kindern und Jugendlichen Geplanter Ablauf: Personenkreis und Entwicklungstendenzen Begriffsklärungen Handlungsmöglichkeiten Personenkreis und Entwicklungstendenzen - Knapp 80.000
1a. Begriffsbestimmung. Überblick über die Bereiche der Psychologie. 1a. Begriffsbestimmung. 1a. Begriffsbestimmung
 Überblick über die Bereiche der Psychologie 1. a) Begriffsbestimmung und b) Entwicklung Dr. Markus Pospeschill Fachrichtung Psychologie Universität des Saarlandes 1 2 Psychologie ist die Wissenschaft vom
Überblick über die Bereiche der Psychologie 1. a) Begriffsbestimmung und b) Entwicklung Dr. Markus Pospeschill Fachrichtung Psychologie Universität des Saarlandes 1 2 Psychologie ist die Wissenschaft vom
Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik
 Geisteswissenschaft Sandra Mette Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik Rolle und Aufgabe der Sozialen Arbeit Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Geisteswissenschaft Sandra Mette Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik Rolle und Aufgabe der Sozialen Arbeit Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
EUPEHS-Hochschule für Gesundheit und Beruf Hochschule für Angewandte Wissenschaften 2. Studiengänge
 EUPEHS-Hochschule für Gesundheit und Beruf Hochschule für Angewandte Wissenschaften 2. Studiengänge Sekretariat: Nymphenburger Str. 155 Sekretariat: Nymphenburger Str. 155 80634 München Tel. +49-89-120
EUPEHS-Hochschule für Gesundheit und Beruf Hochschule für Angewandte Wissenschaften 2. Studiengänge Sekretariat: Nymphenburger Str. 155 Sekretariat: Nymphenburger Str. 155 80634 München Tel. +49-89-120
Klinische Psychologie: Körperliche Erkrankungen kompakt
 Klinische Psychologie: Körperliche Erkrankungen kompakt Mit Online-Materialien Bearbeitet von Claus Vögele 1. Auflage 2012. Taschenbuch. 170 S. Paperback ISBN 978 3 621 27754 9 Format (B x L): 19,4 x 25
Klinische Psychologie: Körperliche Erkrankungen kompakt Mit Online-Materialien Bearbeitet von Claus Vögele 1. Auflage 2012. Taschenbuch. 170 S. Paperback ISBN 978 3 621 27754 9 Format (B x L): 19,4 x 25
Studienmaterial für das Modul: Spezifische Bedarfe 2: psychische Erkrankungen
 Studienmaterial für das Modul: Spezifische Bedarfe 2: psychische Erkrankungen Gesundheitliche und pflegerische Versorgung von Menschen mit Beeinträchtigungen aus multidisziplinärer Perspektive Inhaltsverzeichnis
Studienmaterial für das Modul: Spezifische Bedarfe 2: psychische Erkrankungen Gesundheitliche und pflegerische Versorgung von Menschen mit Beeinträchtigungen aus multidisziplinärer Perspektive Inhaltsverzeichnis
Soziale Arbeit im Gesundheitswesen
 Qualifizierungsbereich im Gesundheitswesen Intention der ist es, (1) die Potentiale der Sozialen Arbeit wie auch das damit verbundene soziale Mandat für das Gesundheitssystem nutzbar zu machen; (2) für
Qualifizierungsbereich im Gesundheitswesen Intention der ist es, (1) die Potentiale der Sozialen Arbeit wie auch das damit verbundene soziale Mandat für das Gesundheitssystem nutzbar zu machen; (2) für
Bernhard J. Schmidt Klartext kompakt. Das Asperger Syndrom für Eltern Bernhard J. Schmidt Klartext kompakt. Das Asperger Syndrom für Lehrer
 Bücher Autist und Gesellschaft ein zorniger Perspektivenwechsel. Band 1: Autismus verstehen Mit uns reden nicht über uns! Mit uns forschen nicht über uns! Mit uns planen nicht über uns hinweg! Auch nach
Bücher Autist und Gesellschaft ein zorniger Perspektivenwechsel. Band 1: Autismus verstehen Mit uns reden nicht über uns! Mit uns forschen nicht über uns! Mit uns planen nicht über uns hinweg! Auch nach
Kein freier Wille nicht schuldfähig?
 Kein freier Wille nicht schuldfähig? Menschliche Verantwortung im Spannungsfeld von Gehirnforschung und Ethik Judith Hardegger Keiner kann anders, als er ist. Verschaltungen legen uns fest. Wir sollten
Kein freier Wille nicht schuldfähig? Menschliche Verantwortung im Spannungsfeld von Gehirnforschung und Ethik Judith Hardegger Keiner kann anders, als er ist. Verschaltungen legen uns fest. Wir sollten
Psychomotorik und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter, Ähnlichkeiten und Unterschiede Hö 05
 Prof. Dr. Gerd Hölter Fakultät Rehabilitationswissenschaften Bewegungserziehung und Bewegungstherapie gerd.hoelter@uni-dortmund.de November 2005 30 Jahre Clemens-August-Jugendklinik Neuenkirchen Fachkongress
Prof. Dr. Gerd Hölter Fakultät Rehabilitationswissenschaften Bewegungserziehung und Bewegungstherapie gerd.hoelter@uni-dortmund.de November 2005 30 Jahre Clemens-August-Jugendklinik Neuenkirchen Fachkongress
Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand
 Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand Stand: August 2014 Unterrichtsvorhaben I Eigenart philosophischen Fragens und Denkens - Was heißt es
Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand Stand: August 2014 Unterrichtsvorhaben I Eigenart philosophischen Fragens und Denkens - Was heißt es
Inhaltsverzeichnis. Vorwort
 Vorwort V 1 Verhältnis der Sonderpädagogik zur Allgemeinen Pädagogik 1 Martin Sassenroth 1.1 Vorbemerkungen 1 1.2 Entstehungsgeschichte und Definitionen von Heil- und Sonderpädagogik 2 1.2.1 Sonderpädagogik
Vorwort V 1 Verhältnis der Sonderpädagogik zur Allgemeinen Pädagogik 1 Martin Sassenroth 1.1 Vorbemerkungen 1 1.2 Entstehungsgeschichte und Definitionen von Heil- und Sonderpädagogik 2 1.2.1 Sonderpädagogik
Dr. Mstyslaw Suchowerskyi
 Dr. Mstyslaw Suchowerskyi Schmerzmediziner 92 Diese Mental-Suggestiv-Programme sollten so schnell wie möglich für jeden zugänglich sein! Wir leben in einer Zeit, in der Stress und Hektik die Hauptfaktoren
Dr. Mstyslaw Suchowerskyi Schmerzmediziner 92 Diese Mental-Suggestiv-Programme sollten so schnell wie möglich für jeden zugänglich sein! Wir leben in einer Zeit, in der Stress und Hektik die Hauptfaktoren
Das hochbegabte ehirn Gehirn Dr. Dominik Gyseler 21.. Mai Mai
 Das hochbegabte Gehirn PHSG Dr. Dominik Gyseler 21. Mai 2011 Ablauf 1. Neuropädagogik 2. Neurowissenschaftliche Erkenntnisse zur Hochbegabung 3. Was ist der Erkenntnisgewinn? 4. Schulische en Hochbegabter
Das hochbegabte Gehirn PHSG Dr. Dominik Gyseler 21. Mai 2011 Ablauf 1. Neuropädagogik 2. Neurowissenschaftliche Erkenntnisse zur Hochbegabung 3. Was ist der Erkenntnisgewinn? 4. Schulische en Hochbegabter
1 Einleitung Erster Teil: Theoretischer Hintergrund Warum Mathematik? - Bedeutung des Faches Mathematik... 14
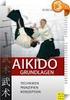 Inhaltsverzeichnis 3 INHALTSVERZEICHNIS 1 Einleitung... 11 Erster Teil: Theoretischer Hintergrund... 14 2 Warum Mathematik? - Bedeutung des Faches Mathematik... 14 2.1 Sieben Gründe für den Mathematikunterricht
Inhaltsverzeichnis 3 INHALTSVERZEICHNIS 1 Einleitung... 11 Erster Teil: Theoretischer Hintergrund... 14 2 Warum Mathematik? - Bedeutung des Faches Mathematik... 14 2.1 Sieben Gründe für den Mathematikunterricht
Szenario Gruppe III. Hypothesen zur Qualifizierung und Akademisierung der Pflege in der psychiatrischen Versorgung.
 Szenario Gruppe III Hypothesen zur Qualifizierung und Akademisierung der Pflege in der psychiatrischen Versorgung. Hypothese 1 Gesellschaftliche und epidemiologische Veränderungen und der daraus resultierende
Szenario Gruppe III Hypothesen zur Qualifizierung und Akademisierung der Pflege in der psychiatrischen Versorgung. Hypothese 1 Gesellschaftliche und epidemiologische Veränderungen und der daraus resultierende
Inhaltsverzeichnis. I. Teil: Ein Überblick über die gegenwärtige klient-bezogene Gesprächstherapie
 Inhaltsverzeichnis Vorwort des Herausgebers 13 Einleitung 15 I. Teil: Ein Überblick über die gegenwärtige klient-bezogene Gesprächstherapie I. KAPITEL. Der Entwkklungsdiarakter der klient-bezogenen Gesprädistherapie
Inhaltsverzeichnis Vorwort des Herausgebers 13 Einleitung 15 I. Teil: Ein Überblick über die gegenwärtige klient-bezogene Gesprächstherapie I. KAPITEL. Der Entwkklungsdiarakter der klient-bezogenen Gesprädistherapie
Wie wird man PsychotherapeutIn? Gesetzliche Grundlagen. Dipl.-Psych. vor dem PsychThG
 Wie wird man PsychotherapeutIn? Gesetzliche Grundlagen Psychotherapeutengesetz (PTG) vom 16.06.1998 zum Änderung des SGBV Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (PsychTh-AprV) vom 18.12.1998 Ausbildungs-
Wie wird man PsychotherapeutIn? Gesetzliche Grundlagen Psychotherapeutengesetz (PTG) vom 16.06.1998 zum Änderung des SGBV Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (PsychTh-AprV) vom 18.12.1998 Ausbildungs-
Neuro-Enhancement oder Neurodoping? Prof. Dr. M. Soyka, Meiringen
 Neuro-Enhancement oder Neurodoping? Prof. Dr. M. Soyka, Meiringen Planet der Affen prevolution Neuro-Enhancement dazugehörende Begriffe Definition Neuro-Enhancement: Massnahme zur gezielten Verbesserung
Neuro-Enhancement oder Neurodoping? Prof. Dr. M. Soyka, Meiringen Planet der Affen prevolution Neuro-Enhancement dazugehörende Begriffe Definition Neuro-Enhancement: Massnahme zur gezielten Verbesserung
München, Dipl. Soz.-Päd. Ngan Nguyen-Meyer.
 München, 1.3.2016 Dipl. Soz.-Päd. Ngan Nguyen-Meyer ngan.nguyenmeyer@gmail.com Vorstellungen von Behinderung Behinderte sind diejenigen, um die es einem Leid tut. warten auf die Hilfe der anderen, nach
München, 1.3.2016 Dipl. Soz.-Päd. Ngan Nguyen-Meyer ngan.nguyenmeyer@gmail.com Vorstellungen von Behinderung Behinderte sind diejenigen, um die es einem Leid tut. warten auf die Hilfe der anderen, nach
Schlafstörungen können Hinweise auf neurologische Leiden sein
 ENS 2013 Schlafstörungen können Hinweise auf neurologische Leiden sein Barcelona, Spanien (10. Juni 2013) Schlafstörungen können das erste Anzeichen schwerer neurologischer Erkrankungen sein, betonten
ENS 2013 Schlafstörungen können Hinweise auf neurologische Leiden sein Barcelona, Spanien (10. Juni 2013) Schlafstörungen können das erste Anzeichen schwerer neurologischer Erkrankungen sein, betonten
Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen Eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit Prof. Dr. Dr. Helmut Schneider (Steinbeis-Hochschule Berlin) Seite 2 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen Eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit Prof. Dr. Dr. Helmut Schneider (Steinbeis-Hochschule Berlin) Seite 2 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
Biologische Psychologie I
 Biologische Psychologie I Kapitel 7 Mechanismen der Wahrnehmung, des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit Organisationsprinzipien eines sensorischen Systems: Primärer und sekundärer sensorischer Kortex
Biologische Psychologie I Kapitel 7 Mechanismen der Wahrnehmung, des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit Organisationsprinzipien eines sensorischen Systems: Primärer und sekundärer sensorischer Kortex
PATIENTENINFORMATION. Caregiver Burden bei betreuenden Angehörigen schwer betroffener Parkinsonpatienten
 Version 1.2 Neurologische Klinik mit Klinischer Neurophysiologie Kommissarischer Direktor: Prof. Dr. med. M. Stangel PD Dr. med. F. Wegner Telefon: (0511) 532-3110 Fax: (0511) 532-3115 Carl-Neuberg-Straße
Version 1.2 Neurologische Klinik mit Klinischer Neurophysiologie Kommissarischer Direktor: Prof. Dr. med. M. Stangel PD Dr. med. F. Wegner Telefon: (0511) 532-3110 Fax: (0511) 532-3115 Carl-Neuberg-Straße
Technikfolgenabschätzung
 Technikfolgenabschätzung 1. Begriff 2. Entstehung und Entwicklung 3. Klassisches Konzept der Technikfolgenabschätzung 4. Spannungsfelder im technischen Fortschritt als gesellschaftlichgemeinwohlorientierter
Technikfolgenabschätzung 1. Begriff 2. Entstehung und Entwicklung 3. Klassisches Konzept der Technikfolgenabschätzung 4. Spannungsfelder im technischen Fortschritt als gesellschaftlichgemeinwohlorientierter
Methoden der Versorgungsforschung: Ein Überblick
 Methoden der : Ein Überblick Holger Pfaff Universität zu Köln, Köln & Abteilung Medizinische Soziologie des Instituts für Arbeits- und Sozialmedizin Vortrag auf der Tagung der Paul-Martini-Stiftung Methoden
Methoden der : Ein Überblick Holger Pfaff Universität zu Köln, Köln & Abteilung Medizinische Soziologie des Instituts für Arbeits- und Sozialmedizin Vortrag auf der Tagung der Paul-Martini-Stiftung Methoden
Gängige Definition des Gegenstandes der Psychologie: Menschliches Erleben und Verhalten (Handeln)
 Zum Gegenstand der Psychologie Psychologie ist die Wissenschaft von den Inhalten und den Vorgängen des geistigen Lebens, oder, wie man auch sagt, die Wissenschaft von den Bewußtseinszuständen und Bewußtheitsvorgängen.
Zum Gegenstand der Psychologie Psychologie ist die Wissenschaft von den Inhalten und den Vorgängen des geistigen Lebens, oder, wie man auch sagt, die Wissenschaft von den Bewußtseinszuständen und Bewußtheitsvorgängen.
Volkskrankheit Depression
 Natalia Schütz Volkskrankheit Depression Selbsthilfegruppen als Unterstützung in der Krankheitsbewältigung Diplomica Verlag Natalia Schütz Volkskrankheit Depression: Selbsthilfegruppen als Unterstützung
Natalia Schütz Volkskrankheit Depression Selbsthilfegruppen als Unterstützung in der Krankheitsbewältigung Diplomica Verlag Natalia Schütz Volkskrankheit Depression: Selbsthilfegruppen als Unterstützung
UNSER GEHIRN VERSTEHEN
 UNSER GEHIRN VERSTEHEN te ihnen gesagt werden, dass in vielen Fällen die richtigen Techniken bereits im Zeitraum weniger Wochen zu einer erheblichen Verbesserung der Angstsituation führen etwa in dem gleichen
UNSER GEHIRN VERSTEHEN te ihnen gesagt werden, dass in vielen Fällen die richtigen Techniken bereits im Zeitraum weniger Wochen zu einer erheblichen Verbesserung der Angstsituation führen etwa in dem gleichen
Kernlehrplan Philosophie - Einführungsphase
 Kernlehrplan Philosophie - Einführungsphase Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie unterscheiden philosophische
Kernlehrplan Philosophie - Einführungsphase Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie unterscheiden philosophische
Allgemeine Psychologie
 Vorlesung DI 16-18 Uhr, HS A1 Allgemeine Psychologie SS 2008 PD Dr. Thomas Schmidt http://www.allpsych.uni-giessen.de/thomas Website zur Vorlesung http://www.allpsych.uni-giessen.de/thomas/teaching Folien
Vorlesung DI 16-18 Uhr, HS A1 Allgemeine Psychologie SS 2008 PD Dr. Thomas Schmidt http://www.allpsych.uni-giessen.de/thomas Website zur Vorlesung http://www.allpsych.uni-giessen.de/thomas/teaching Folien
Frühe Nutzenbewertungen nach AMNOG: Einblicke in die aktuellen Verfahren und mögliche Auswirkungen für Ärzte und Patienten
 Frühe Nutzenbewertungen nach AMNOG: Einblicke in die aktuellen Verfahren und mögliche Auswirkungen für Ärzte und Patienten Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) 35a Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln
Frühe Nutzenbewertungen nach AMNOG: Einblicke in die aktuellen Verfahren und mögliche Auswirkungen für Ärzte und Patienten Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) 35a Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln
Bewusstsein und Willensfreiheit im menschlichen Entscheiden und Tun
 Bewusstsein und Willensfreiheit im menschlichen Entscheiden und Tun (3. Kernthema, Nachbardisziplinen ) Dr. Bettina Walde Philosophisches Seminar Johannes Gutenberg-Universität 55099 Mainz walde@uni-mainz.de
Bewusstsein und Willensfreiheit im menschlichen Entscheiden und Tun (3. Kernthema, Nachbardisziplinen ) Dr. Bettina Walde Philosophisches Seminar Johannes Gutenberg-Universität 55099 Mainz walde@uni-mainz.de
Pflege und DRG. Ethische Herausforderungen für die Pflege bei Einführung der DRG
 Pflege und DRG Ethische Herausforderungen für die Pflege bei Einführung der DRG Ethische Grundlagen der Pflege (I) «Wir Pflegefachfrauen und -männer setzen uns am Arbeitsort und in der Öffentlichkeit dafür
Pflege und DRG Ethische Herausforderungen für die Pflege bei Einführung der DRG Ethische Grundlagen der Pflege (I) «Wir Pflegefachfrauen und -männer setzen uns am Arbeitsort und in der Öffentlichkeit dafür
SEITE AN SEITE FÜR IHRE GESUNDHEIT
 SEITE AN SEITE FÜR IHRE GESUNDHEIT WERTVOLLE VORTEILE FÜR PATIENTEN DURCH VERSCHIEDENE FACHÄRZTE IN DERSELBEN PRAXIS Im Medizinischen Versorgungszentrum Kaiserslautern (MVZ) arbeiten Fachärzte unterschiedlicher
SEITE AN SEITE FÜR IHRE GESUNDHEIT WERTVOLLE VORTEILE FÜR PATIENTEN DURCH VERSCHIEDENE FACHÄRZTE IN DERSELBEN PRAXIS Im Medizinischen Versorgungszentrum Kaiserslautern (MVZ) arbeiten Fachärzte unterschiedlicher
GERHARD ROTH INSTITUT FÜR HIRNFORSCHUNG UNIVERSITÄT BREMEN HABEN WIR EINE WAHL?
 GERHARD ROTH INSTITUT FÜR HIRNFORSCHUNG UNIVERSITÄT BREMEN HABEN WIR EINE WAHL? G. Roth, 2007 AUSGANGSFRAGE Wir haben das unabweisbare Gefühl, dass wir innerhalb weiter Grenzen in unserem täglichen Leben
GERHARD ROTH INSTITUT FÜR HIRNFORSCHUNG UNIVERSITÄT BREMEN HABEN WIR EINE WAHL? G. Roth, 2007 AUSGANGSFRAGE Wir haben das unabweisbare Gefühl, dass wir innerhalb weiter Grenzen in unserem täglichen Leben
Veränderungen und Auswirkungen im Rahmen einer Demenzerkrankung. bei Menschen mit geistiger Behinderung. Dr. Sinikka Gusset-Bährer
 Veränderungen und Auswirkungen im Rahmen einer Demenzerkrankung bei Menschen mit geistiger Behinderung Dr. Sinikka Gusset-Bährer Überblick Symptome im frühen Stadium der Demenzerkrankung mittleren und
Veränderungen und Auswirkungen im Rahmen einer Demenzerkrankung bei Menschen mit geistiger Behinderung Dr. Sinikka Gusset-Bährer Überblick Symptome im frühen Stadium der Demenzerkrankung mittleren und
Burnout versus Depression: Volkskrankheit oder Modediagnose?
 Presse-Information Berlin/Ladenburg, den 11.5.2015 19. Berliner Kolloquium der Daimler und Benz Stiftung 13. Mai 2015 Langenbeck-Virchow-Haus Luisenstraße 58/59, 10117 Berlin Burnout versus Depression:
Presse-Information Berlin/Ladenburg, den 11.5.2015 19. Berliner Kolloquium der Daimler und Benz Stiftung 13. Mai 2015 Langenbeck-Virchow-Haus Luisenstraße 58/59, 10117 Berlin Burnout versus Depression:
Ist 60 heute die neue 40? Gesundheit im Kohortenvergleich
 Ist 60 heute die neue 40? Gesundheit im Kohortenvergleich Dr. Julia K. Wolff Altern im Wandel: Zwei Jahrzehnte Deutscher Alterssurvey (DEAS) Veranstaltung zum DEAS 2014 in Kooperation mit der BAGSO 5.
Ist 60 heute die neue 40? Gesundheit im Kohortenvergleich Dr. Julia K. Wolff Altern im Wandel: Zwei Jahrzehnte Deutscher Alterssurvey (DEAS) Veranstaltung zum DEAS 2014 in Kooperation mit der BAGSO 5.
Statement von Edelgard Bulmahn, Bundesministerin für Bildung und Forschung
 Statement von Edelgard Bulmahn, Bundesministerin für Bildung und Forschung Meine Herren und Damen, kann man mit Vitaminen der Krebsentstehung vorbeugen? Welche Kombination von Medikamenten bei AIDS ist
Statement von Edelgard Bulmahn, Bundesministerin für Bildung und Forschung Meine Herren und Damen, kann man mit Vitaminen der Krebsentstehung vorbeugen? Welche Kombination von Medikamenten bei AIDS ist
11. Sozial-kognitive Persönlichkeitstheorien. Rotter und Bandura. Teil 11.b: Bandura
 10. Theorien der Persönlichkeit GHF im WiSe 2008 / 2009 an der HS MD- SDL(FH) im Studiengang Rehabilitationspsychologie, B.Sc., 1. Semester Persönlichkeitstheorien Rotter und Bandura Teil 11.b: Bandura
10. Theorien der Persönlichkeit GHF im WiSe 2008 / 2009 an der HS MD- SDL(FH) im Studiengang Rehabilitationspsychologie, B.Sc., 1. Semester Persönlichkeitstheorien Rotter und Bandura Teil 11.b: Bandura
Informationen für Patienten
 Informationen für Patienten Viele Wege führen nach Rom. Dieser Spruch wird vielfach genutzt wenn es darum geht, welche Therapie in einer bestimmten Situation am geeignetsten ist. Unser Weg ist das Nervensystem.
Informationen für Patienten Viele Wege führen nach Rom. Dieser Spruch wird vielfach genutzt wenn es darum geht, welche Therapie in einer bestimmten Situation am geeignetsten ist. Unser Weg ist das Nervensystem.
Praxis für psychische Gesundheit. Psychiatrie Psychologische Psychotherapie. Krisen bewältigen.
 Praxis für psychische Gesundheit Psychiatrie Psychologische Psychotherapie Krisen bewältigen. Hilfe finden. @ Algesiologikum, Stand 05/2015; Text: Algesiologikum; Konzeption & Gestaltung: Planeta Gestaltungsbüro
Praxis für psychische Gesundheit Psychiatrie Psychologische Psychotherapie Krisen bewältigen. Hilfe finden. @ Algesiologikum, Stand 05/2015; Text: Algesiologikum; Konzeption & Gestaltung: Planeta Gestaltungsbüro
Frühförderung mit Kindern psychisch kranker Eltern
 Manfred Pretis Aleksandra Dimova Frühförderung mit Kindern psychisch kranker Eltern Mit 17 Abbildungen und 10 Tabellen 3., überarbeitete Auflage Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. phil. Manfred
Manfred Pretis Aleksandra Dimova Frühförderung mit Kindern psychisch kranker Eltern Mit 17 Abbildungen und 10 Tabellen 3., überarbeitete Auflage Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. phil. Manfred
Grundlagen der medizinischen Psychologie und Soziologie
 Grundlagen der medizinischen Psychologie und Soziologie Einbeziehung der psychologischen und soziologischen Aspekte von Krankheit und Gesundheit in ärztliches Denken und Handeln Psychologie Beschäftigt
Grundlagen der medizinischen Psychologie und Soziologie Einbeziehung der psychologischen und soziologischen Aspekte von Krankheit und Gesundheit in ärztliches Denken und Handeln Psychologie Beschäftigt
Verantwortung übernehmen für die Schwierigsten!
 Verantwortung übernehmen für die Schwierigsten! Fachtagung am 23./24. März 2012 in Köln Geschlossene Heimunterbringung unter ethischen Gesichtspunkten Friedrich Schiller Die Künstler Der Menschheit Würde
Verantwortung übernehmen für die Schwierigsten! Fachtagung am 23./24. März 2012 in Köln Geschlossene Heimunterbringung unter ethischen Gesichtspunkten Friedrich Schiller Die Künstler Der Menschheit Würde
Hans-Werner Wahl Vera Heyl. Gerontologie - Einführung und Geschichte. Verlag W. Kohlhammer
 Hans-Werner Wahl Vera Heyl Gerontologie - Einführung und Geschichte Verlag W. Kohlhammer Vorwort 9 1 Alter und Alternsforschung: Das junge gesellschaftliche und wissenschaftliche Interesse am Alter 12
Hans-Werner Wahl Vera Heyl Gerontologie - Einführung und Geschichte Verlag W. Kohlhammer Vorwort 9 1 Alter und Alternsforschung: Das junge gesellschaftliche und wissenschaftliche Interesse am Alter 12
Schöpfungslehre, Anthropologie, Eschatologie (systemat.-theol.) Prof. Dr. Lucia Scherzberg WS 2009/10
 Schöpfungslehre, Anthropologie, Eschatologie (systemat.-theol.) Prof. Dr. Lucia Scherzberg WS 2009/10 Christus erfreut die Seele mit Geigenspiel (Buchmalerei um 1497 von Rudolf Stahel, Martinus-Bibliothek
Schöpfungslehre, Anthropologie, Eschatologie (systemat.-theol.) Prof. Dr. Lucia Scherzberg WS 2009/10 Christus erfreut die Seele mit Geigenspiel (Buchmalerei um 1497 von Rudolf Stahel, Martinus-Bibliothek
Wissensplattform Nanomaterialien
 Daten und Wissen zu Nanomaterialien - Aufbereitung gesellschaftlich relevanter naturwissenschaftlicher Fakten Wissensplattform Nanomaterialien Neueste Forschungsergebnisse zu Auswirkungen von Nanomaterialien
Daten und Wissen zu Nanomaterialien - Aufbereitung gesellschaftlich relevanter naturwissenschaftlicher Fakten Wissensplattform Nanomaterialien Neueste Forschungsergebnisse zu Auswirkungen von Nanomaterialien
Epidemiologische Beobachtungsstelle. Geistige Gesundheit PASSI
 Epidemiologische Beobachtungsstelle Geistige Gesundheit PASSI 2010-13 Herausgegeben von Antonio Fanolla, Sabine Weiss Epidemiologische Beobachtungsstelle der Autonomen Provinz Bozen An der Durchführung
Epidemiologische Beobachtungsstelle Geistige Gesundheit PASSI 2010-13 Herausgegeben von Antonio Fanolla, Sabine Weiss Epidemiologische Beobachtungsstelle der Autonomen Provinz Bozen An der Durchführung
Schulinternes Curriculum Philosophie Gymnasium Schloss Holte-Stukenbrock
 Schulinternes Curriculum Philosophie Gymnasium Schloss Holte-Stukenbrock EF Unterrichtsvorhaben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und
Schulinternes Curriculum Philosophie Gymnasium Schloss Holte-Stukenbrock EF Unterrichtsvorhaben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und
Von einem der ersten Elektrokardiographen. und dessen Einsatz bei einer Marsmission. zum mobilen kardialen Komplexanalyzer clue medical
 clue medical - der mobile kardiale Komplexanalyzer Von einem der ersten Elektrokardiographen zum mobilen kardialen Komplexanalyzer clue medical und dessen Einsatz bei einer Marsmission clue medical - der
clue medical - der mobile kardiale Komplexanalyzer Von einem der ersten Elektrokardiographen zum mobilen kardialen Komplexanalyzer clue medical und dessen Einsatz bei einer Marsmission clue medical - der
Gemeinsame genetische Risikofaktoren bei häufigen Epilepsiesyndromen entdeckt
 Epilepsie-Varianten Gemeinsame genetische Risikofaktoren bei häufigen Epilepsiesyndromen entdeckt Berlin (19. September 2014) - Epilepsien sind eine klinisch heterogene Gruppe neurologischer Erkrankungen.
Epilepsie-Varianten Gemeinsame genetische Risikofaktoren bei häufigen Epilepsiesyndromen entdeckt Berlin (19. September 2014) - Epilepsien sind eine klinisch heterogene Gruppe neurologischer Erkrankungen.
Evolutionäre Grundlagen des Sozialverhaltens
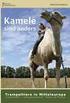 Evolutionäre Grundlagen des Sozialverhaltens Intelligenz, Bewusstsein, Selbstbewusstsein ZÜR-07 Wichtige Stichwörter Social Brain Hypothesis Theory of Mind Machiavellian Intelligence False belief tests
Evolutionäre Grundlagen des Sozialverhaltens Intelligenz, Bewusstsein, Selbstbewusstsein ZÜR-07 Wichtige Stichwörter Social Brain Hypothesis Theory of Mind Machiavellian Intelligence False belief tests
Das Krankheitsspektrum der Zukunft
 Das Krankheitsspektrum der Zukunft Expertenumfrage unter 100 führenden deutschen Forschern Zielsetzung Der Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.v. (VFA) hat das der Charité mit der Experten-Umfrage
Das Krankheitsspektrum der Zukunft Expertenumfrage unter 100 führenden deutschen Forschern Zielsetzung Der Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.v. (VFA) hat das der Charité mit der Experten-Umfrage
Meine Gene, meine Gesundheit
 AIW-Hauptversammlung, SportSchloss Velen, 4. Mai 2006 Prof. Dr. Dr. Christian De Bruijn IPMG Institut für präventiv-medizinisches Gesundheitsmanagement, Velen Die Molekularmedizin ist die Medizin von Morgen
AIW-Hauptversammlung, SportSchloss Velen, 4. Mai 2006 Prof. Dr. Dr. Christian De Bruijn IPMG Institut für präventiv-medizinisches Gesundheitsmanagement, Velen Die Molekularmedizin ist die Medizin von Morgen
Demenz Hintergrund und praktische Hilfen Dr. med. Christine Wichmann
 Demenz Hintergrund und praktische Hilfen Dr. med. Christine Wichmann Lebenserwartung in Deutschland 100 80 Männer Frauen 60 40 20 0 1871 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Demenz Hintergrund und praktische Hilfen Dr. med. Christine Wichmann Lebenserwartung in Deutschland 100 80 Männer Frauen 60 40 20 0 1871 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Förderrichtlinie. der Lörcher-Stiftung für medizinische Forschung. Präambel
 Förderrichtlinie der Lörcher-Stiftung für medizinische Forschung Präambel Die Lörcher-Stiftung für medizinische Forschung ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts, die gemäß ihrer Satzung wissenschaftliche
Förderrichtlinie der Lörcher-Stiftung für medizinische Forschung Präambel Die Lörcher-Stiftung für medizinische Forschung ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts, die gemäß ihrer Satzung wissenschaftliche
Bearbeitung des Lesetextes: Auswirkungen des Fluglärms auf die Gesundheit der Menschen. Aufgaben zum Leseverstehen
 1 DSH-Musterprüfung Name: Vorname: Bearbeitung des Lesetextes: Auswirkungen des Fluglärms auf die Gesundheit der Menschen I Textgliederung Aufgaben zum Leseverstehen Ordnen Sie die folgenden Zwischenüberschriften
1 DSH-Musterprüfung Name: Vorname: Bearbeitung des Lesetextes: Auswirkungen des Fluglärms auf die Gesundheit der Menschen I Textgliederung Aufgaben zum Leseverstehen Ordnen Sie die folgenden Zwischenüberschriften
Statement Prof. Dr. Rainer Richter
 Statement Prof. Dr. Rainer Richter Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer Sehr geehrte Damen und Herren, ein gemeinsames Kennzeichen aller seelischen und auch einiger körperlicher Erkrankungen ist
Statement Prof. Dr. Rainer Richter Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer Sehr geehrte Damen und Herren, ein gemeinsames Kennzeichen aller seelischen und auch einiger körperlicher Erkrankungen ist
A. Autismus ist eine Form der Autismus-Spektrum-Störung
 Es ist sehr wichtig, dass autistische Kinder als auch die Eltern die Autismus-Spektrum-Störun g thematisch verstehen und die neuesten Trends der Behandlungsansätze kennen. Auf so wenig wie möglichen aber
Es ist sehr wichtig, dass autistische Kinder als auch die Eltern die Autismus-Spektrum-Störun g thematisch verstehen und die neuesten Trends der Behandlungsansätze kennen. Auf so wenig wie möglichen aber
4 Kompetenzen und Inhalte (Leistungskurs)
 4 (Leistungskurs) 4.1 Physiologische Grundlagen ausgewählter Lebensprozesse am Beispiel der Nervenzelle - Aufbau lebender Organismen aus Zellen - Vorgänge an Biomembranen - Enzyme und ihre Bedeutung -
4 (Leistungskurs) 4.1 Physiologische Grundlagen ausgewählter Lebensprozesse am Beispiel der Nervenzelle - Aufbau lebender Organismen aus Zellen - Vorgänge an Biomembranen - Enzyme und ihre Bedeutung -
Firmenserviceprojekt der DRV Berlin-Brandenburg
 Firmenserviceprojekt der DRV Berlin-Brandenburg Gute Arbeit Gesund arbeiten in Brandenburg Arbeit altersgerecht gestalten ein Arbeitsleben lang Klaus Petsch, Abteilungsleiter der Abteilung Rehabilitation
Firmenserviceprojekt der DRV Berlin-Brandenburg Gute Arbeit Gesund arbeiten in Brandenburg Arbeit altersgerecht gestalten ein Arbeitsleben lang Klaus Petsch, Abteilungsleiter der Abteilung Rehabilitation
Die franz. Materialisten
 Die franz. Materialisten Julien-Offray de la Mettrie *1709 St. Malo, 1751 Berlin Claude Adrien Helvetius *1715 Paris, 1771 Versailles 1 La Mettrie Hauptwerke: Naturgeschichte der Seele, 1745 Der Mensch
Die franz. Materialisten Julien-Offray de la Mettrie *1709 St. Malo, 1751 Berlin Claude Adrien Helvetius *1715 Paris, 1771 Versailles 1 La Mettrie Hauptwerke: Naturgeschichte der Seele, 1745 Der Mensch
Gesundheit und Fitness im Alter eine gesamtpolitische Aufgabe
 Gesundheit und Fitness im Alter eine gesamtpolitische Aufgabe Dr. phil. Christoph Rott Drei Fragen zu Beginn (1) Wie möchten Sie persönlich älter werden? Was wird Ihnen im Alter besonders wichtig sein?
Gesundheit und Fitness im Alter eine gesamtpolitische Aufgabe Dr. phil. Christoph Rott Drei Fragen zu Beginn (1) Wie möchten Sie persönlich älter werden? Was wird Ihnen im Alter besonders wichtig sein?
Gesund älter werden in Deutschland
 Gesund älter werden in Deutschland - Handlungsfelder und Herausforderungen - Dr. Rainer Hess Vorsitzender des Ausschusses von gesundheitsziele.de Gemeinsame Ziele für mehr Gesundheit Was ist gesundheitsziele.de?
Gesund älter werden in Deutschland - Handlungsfelder und Herausforderungen - Dr. Rainer Hess Vorsitzender des Ausschusses von gesundheitsziele.de Gemeinsame Ziele für mehr Gesundheit Was ist gesundheitsziele.de?
Haltungen in der Bevölkerung zur Palliativversorgung und zur ärztlich assistierten Selbsttötung eine repräsentative Umfrage
 Haltungen in der Bevölkerung zur Palliativversorgung und zur ärztlich assistierten Selbsttötung eine repräsentative Umfrage Saskia Jünger¹, Nils Schneider¹, Birgitt Wiese¹, Jochen Vollmann², Jan Schildmann²
Haltungen in der Bevölkerung zur Palliativversorgung und zur ärztlich assistierten Selbsttötung eine repräsentative Umfrage Saskia Jünger¹, Nils Schneider¹, Birgitt Wiese¹, Jochen Vollmann², Jan Schildmann²
VORWORT 7 1. EINLEITUNG 9 2. DIAGNOSTIK KULTURHISTORISCHE BETRACHTUNG ERKLÄRUNGSMODELLE DER ANOREXIA NERVOSA 28
 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT 7 1. EINLEITUNG 9 2. DIAGNOSTIK 11 2.1. KRITERIEN NACH DSM-IV (307.1) 11 2.2. KRITERIEN NACH ICD-10 (F50.0) 11 2.3. DIFFERENTIALDIAGNOSE 13 2.4. ABGRENZUNG VON ANDEREN ESSSTÖRUNGEN
INHALTSVERZEICHNIS VORWORT 7 1. EINLEITUNG 9 2. DIAGNOSTIK 11 2.1. KRITERIEN NACH DSM-IV (307.1) 11 2.2. KRITERIEN NACH ICD-10 (F50.0) 11 2.3. DIFFERENTIALDIAGNOSE 13 2.4. ABGRENZUNG VON ANDEREN ESSSTÖRUNGEN
ARF - Erfahrungsaustausch
 Modernisierung des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens Schuldenkrise - Konsolidierung. Warum liefert die bisherige Modernisierung bisher noch keinen entscheidenden Beitrag? - 10 Thesen - Prof.
Modernisierung des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens Schuldenkrise - Konsolidierung. Warum liefert die bisherige Modernisierung bisher noch keinen entscheidenden Beitrag? - 10 Thesen - Prof.
Gesundheit von Menschen mit Behinderung Die Menschenrechtsperspektive. Vergessene Patienten, Düsseldorf, 17. April 2013 Susanne Schwalen 1
 Vergessene Patienten, Düsseldorf, 17. April 2013 Susanne Schwalen 1 Vergessene Patienten, Düsseldorf, 17. April 2013 Susanne Schwalen 2 Prof. Dr. med. Susanne Schwalen Geschäftsführende Ärztin der Ärztekammer
Vergessene Patienten, Düsseldorf, 17. April 2013 Susanne Schwalen 1 Vergessene Patienten, Düsseldorf, 17. April 2013 Susanne Schwalen 2 Prof. Dr. med. Susanne Schwalen Geschäftsführende Ärztin der Ärztekammer
Stabilität und Veränderung psychologischer Aspekte im höheren Erwachsenenalter. Dr. Stefanie Becker
 Stabilität und Veränderung psychologischer Aspekte im höheren Erwachsenenalter Dr. Stefanie Becker Stiftungsgastdozentur der Universität des 3. Lebensalters, Frankfurt, im Sommersemester 2007 Themen der
Stabilität und Veränderung psychologischer Aspekte im höheren Erwachsenenalter Dr. Stefanie Becker Stiftungsgastdozentur der Universität des 3. Lebensalters, Frankfurt, im Sommersemester 2007 Themen der
Depression, Burnout. und stationäre ärztliche Versorgung von Erkrankten. Burnout I Depression Volkskrankheit Nr. 1? 1. Oktober 2014, Braunschweig
 Burnout I Depression Volkskrankheit Nr. 1? 1. Oktober 2014, Braunschweig Depression, Burnout und stationäre ärztliche Versorgung von Erkrankten Privatdozent Dr. med. Alexander Diehl M.A. Arzt für Psychiatrie
Burnout I Depression Volkskrankheit Nr. 1? 1. Oktober 2014, Braunschweig Depression, Burnout und stationäre ärztliche Versorgung von Erkrankten Privatdozent Dr. med. Alexander Diehl M.A. Arzt für Psychiatrie
Schülerlabor Neurowissenschaft. Vernetzung von Ausbildung und Wissenschaft
 Schülerlabor Neurowissenschaft Vernetzung von Ausbildung und Wissenschaft Uwe J. Ilg Seite 1 Motivation für die Einrichtung eines Schülerlabors: i) Schüler für ein naturwissenschaftliches Studium begeistern
Schülerlabor Neurowissenschaft Vernetzung von Ausbildung und Wissenschaft Uwe J. Ilg Seite 1 Motivation für die Einrichtung eines Schülerlabors: i) Schüler für ein naturwissenschaftliches Studium begeistern
2 Geschäftsprozesse realisieren
 2 Geschäftsprozesse realisieren auf fünf Ebenen Modelle sind vereinfachte Abbilder der Realität und helfen, Zusammenhänge einfach und verständlich darzustellen. Das bekannteste Prozess-Modell ist das Drei-Ebenen-Modell.
2 Geschäftsprozesse realisieren auf fünf Ebenen Modelle sind vereinfachte Abbilder der Realität und helfen, Zusammenhänge einfach und verständlich darzustellen. Das bekannteste Prozess-Modell ist das Drei-Ebenen-Modell.
NEUE BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN MONOKLONALE ANTIKÖRPER
 NEUE BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN MONOKLONALE ANTIKÖRPER Was sind Antikörper? Antikörper patrouillieren wie Wächter im Blutkreislauf des Körpers und achten auf Krankheitserreger wie Bakterien, Viren und Parasiten
NEUE BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN MONOKLONALE ANTIKÖRPER Was sind Antikörper? Antikörper patrouillieren wie Wächter im Blutkreislauf des Körpers und achten auf Krankheitserreger wie Bakterien, Viren und Parasiten
experto Der Beraterverlag, ein Unternehmensbereich der VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG Theodor-Heuss Straße Bonn
 Impressum Besser mit Demenz umgehen experto Der Beraterverlag, ein Unternehmensbereich der VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG Theodor-Heuss Straße 2 4 53177 Bonn Telefon 0228 9550 100 Telefax 0228
Impressum Besser mit Demenz umgehen experto Der Beraterverlag, ein Unternehmensbereich der VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG Theodor-Heuss Straße 2 4 53177 Bonn Telefon 0228 9550 100 Telefax 0228
Mittwoch, Uhr. Depression Grundlagen, Diagnostik und Therapie: eine Zwischenbilanz. Fortbildungsreihe 2016
 Depression 2016 Grundlagen, Diagnostik und Therapie: eine Zwischenbilanz Dr. med. Hans Werner Schied Mittwoch, 07.12.2016 17.00 18.30 Uhr MediClin Zentrum für Psychische Gesundheit Donaueschingen Fortbildungsreihe
Depression 2016 Grundlagen, Diagnostik und Therapie: eine Zwischenbilanz Dr. med. Hans Werner Schied Mittwoch, 07.12.2016 17.00 18.30 Uhr MediClin Zentrum für Psychische Gesundheit Donaueschingen Fortbildungsreihe
Schulinterner Lehrplan für das Fach Ethik, Klasse 1-4
 Schulinterner Lehrplan für das Fach Ethik, Klasse 1-4 Lernziele/Inhalte Klasse 1 und 2 Hinweise Soziale Beziehungen Freundschaft - was gehört dazu und worauf kommt es an? o Formen von Freundschaft o Merkmale
Schulinterner Lehrplan für das Fach Ethik, Klasse 1-4 Lernziele/Inhalte Klasse 1 und 2 Hinweise Soziale Beziehungen Freundschaft - was gehört dazu und worauf kommt es an? o Formen von Freundschaft o Merkmale
Die Fachstelle für die öffentlichen Bibliotheken in NRW berät und unterstützt die kommunalen öffentlichen Bibliotheken. Außerdem ist die Fachstelle
 Die Fachstelle für die öffentlichen Bibliotheken in NRW berät und unterstützt die kommunalen öffentlichen Bibliotheken. Außerdem ist die Fachstelle zuständig für die Umsetzung der Landesförderung des Landes
Die Fachstelle für die öffentlichen Bibliotheken in NRW berät und unterstützt die kommunalen öffentlichen Bibliotheken. Außerdem ist die Fachstelle zuständig für die Umsetzung der Landesförderung des Landes
KAN-Positionspapier zum Thema künstliche, biologisch wirksame Beleuchtung in der Normung. August 2015
 KAN-Positionspapier zum Thema künstliche, biologisch wirksame Beleuchtung in der Normung August 2015 Das Projekt Kommission Arbeitsschutz und Normung wird finanziell durch das Bundesministerium für Arbeit
KAN-Positionspapier zum Thema künstliche, biologisch wirksame Beleuchtung in der Normung August 2015 Das Projekt Kommission Arbeitsschutz und Normung wird finanziell durch das Bundesministerium für Arbeit
EF Q1 Q2 Seite 1
 Folgende Kontexte und Inhalte sind für den Physikunterricht der Jahrgangsstufe 8 verbindlich. Fakultative Inhalte sind kursiv dargestellt. Die Versuche und Methoden sind in Ergänzung zum Kernlehrplan als
Folgende Kontexte und Inhalte sind für den Physikunterricht der Jahrgangsstufe 8 verbindlich. Fakultative Inhalte sind kursiv dargestellt. Die Versuche und Methoden sind in Ergänzung zum Kernlehrplan als
