Biologische Zeitmessung bei Pflanzen
|
|
|
- Sylvia Bayer
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 76 BOTANIK Biologische Zeitmessung bei Pflanzen Dorothee Staiger Pflanzen sind mit einer inneren Uhr ausgestattet, die ihnen eine präzise zeitliche Organisation von Stoffwechsel und Entwicklung erlaubt. In den letzten Jahren wurden wesentliche Fortschritte bei der Aufklärung des molekularen Uhrenmechanismus bei Arabidopsis thaliana (Ackerschmalwand) erzielt. Viele Lebewesen besitzen eine innere Uhr Alle Lebewesen erfahren periodische Veränderungen der Umweltbedingungen, die ihren Ursprung in der Erdumdrehung haben. Der regelmäßige Wechsel von Tageslicht zu nächtlicher Dunkelheit spiegelt sich in biologischen Rhythmen wie dem Wechsel zwischen Schlaf und Wachsein oder tagesperiodischen Schwankungen der Körpertemperatur und des Hormonhaushalts wider. Diese rhythmischen Vorgänge werden durch einen inneren Schrittmacher erzeugt, der im 24-Stunden-Takt schlägt. Man bezeichnet ihn als innere Uhr [1]. Ihre Wirkung macht sich vor allem dann bemerkbar, wenn man sie durcheinanderbringt. Jeder hat schon einmal erfahren, dass die innere Uhr uns nach einem Flug über mehrere Zeitzonen nachts hellwach halten kann, dagegen sind wir während des Tages zerschlagen und müde und haben Schwierigkeiten, uns zu konzentrieren. Dieses als Jetlag bezeichnete Phänomen zeigt, dass die innere Uhr einige Tage lang nachgeht. Eine wichtige Eigenschaft ist, dass sie durch äußere Bedingungen eingestellt werden kann: Lichtempfindliche Stoffe registrieren den täglichen Licht-Dunkel-Wechsel und senden Signale an den Schrittmacher. Dadurch wird er nach und nach so eingestellt, dass er im Takt mit dem neuen Tag-Nacht-Rhythmus schlägt und alle von ihm abhängigen Prozesse wieder zur günstigsten Tageszeit ablaufen. Auch Pflanzen verfügen über eine innere Uhr. Tatsächlich war die Chronobiologie, die Disziplin, die sich mit dem Phänomen der zeitlichen Organisation von Lebewesen beschäftigt, lange eine Domäne der Botanik. Wie endogene Rhythmen entdeckt wurden Abb. 1. Die Blumenuhr zeigt zwischen 6 Uhr morgens und 12 Uhr mittags, wann sich die Blüten verschiedener Pflanzen öffnen, und zwischen 12 Uhr und 6 Uhr nachmittags, wann sich die Blüten schließen. Carl von Linné legte um 1750 einen Garten mit einer Blumenuhr an, auf der man die Uhrzeit ablesen konnte. Quelle: Endogene Rhythmen bei höheren Pflanzen sind seit dem Altertum bekannt. Der Feldherr Androsthenes berichtete auf dem Zug Alexanders des Großen von tagesrhythmischen Blattbewegungen bei der Tamarinde: Tagsüber verharren ihre Blätter maximal gespreitet in einer horizontalen Stellung, in der Nacht sind sie hingegen abgesenkt, was als Schlaf der Pflanzen bezeichnet wurde. Es lag nahe zu vermuten, dass die Pflanzen damit auf den Übergang vom Tageslicht zur Nacht reagieren. Dass dies nicht ganz zutreffend ist, wurde 1729 von De Mairan gezeigt: Er studierte tagesperiodische Blattbewegungen der Mimose und stellte fest, dass sie die Stellung ihrer Blätter auch dann veränderte, wenn er sie in einen Schrank stellte, wo sie andauernder Dunkelheit ausgesetzt war. Das bedeutet, dass die rhythmischen Blattbewegungen endogen gesteuert werden müssen [9, 10]. Ein Jahrhundert später beobachtete De Candolle, dass die Periode das Zeitintervall zwischen maximaler Spreitung der Blätter und dem nächsten Extrempunkt in ununterbrochener Dunkelheit nicht mehr 24 Stunden wie im natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus betrug, sondern nur 22 bis 23 Stunden. Wird der endogene Schrittmacher, der die rhythmischen Blattbewegungen steuert, also nicht täglich durch Sonnenauf- und Untergang oder An- und Ausschalten des Lichts im Labor eingestellt, schwingt das System frei mit einer charakteristischen, angeborenen Periodenlänge. Weil sie nur ungefähr einer Tageslänge entspricht, spricht man von circadianen Rhythmen (lateinisch: circa ungefähr, und dies der Tag). WILEY-VCH Verlag GmbH, Weinheim, X/00/ $ /0
2 Innere Uhr bei Pflanzen 77 Blattbewegungen sind gleichsam Zeiger, welche die Uhrzeit der inneren Uhr angeben. Außerdem öffnen sich bei vielen Pflanzen die Blüten zu einer bestimmten Tageszeit, im Allgemeinen dann, wenn die bestäubenden Insekten ihre höchste Aktivität zeigen. Carl von Linné ordnete Pflanzen nach dem Zeitpunkt der Blütenöffnung in einer Blumenuhr an (Abbildung 1). Die innere Uhr steuert den Blühbeginn Licht ist ein wesentlicher Faktor, der den Übergang von vegetativem Wachstum zur Blüte und Samenbildung auslösen kann. Dabei ist weniger die Lichtintensität als die relative Länge der täglichen Lichtperiode (Photoperiode) und Dunkelphase entscheidend. Langtagpflanzen beginnen zu blühen, wenn der Tag eine bestimmte Länge überschreitet. Pflanzen in höheren Breitengraden gehören häufig zu den Langtagpflanzen. Sie beginnen im Sommer zu blühen, wenn die Tage lang sind, und haben bis zum Beginn der kalten Jahreszeit Samen gebildet. Pflanzen nutzen also zur Anpassung an den regelmäßigen Ablauf der Jahreszeiten die Tatsache, dass die Tageslänge sich mit der Jahreszeit verändert. Wie können Pflanzen messen, wie lange es am Tag hell ist? Wir haben zu Anfang gesehen, dass unsere innere Uhr durch den Licht- Dunkel-Wechsel an den Tag-Nacht-Rhythmus angepasst wird. Das gilt auch für die innere Uhr der Pflanzen. Die Feststellung, wann die Sonne auf- und untergeht, bedeutet aber, dass Pflanzen die Länge des Tages messen. Die innere Uhr wird also wie eine Stoppuhr zur Zeitmessung eingesetzt. Der Mechanismus der inneren Uhr ist im Erbgut verankert Der Pflanzenphysiologe Bünning beobachtete bereits in den dreißiger Jahren, dass einzelne Individuen der Bohne Phaseolus multiflorus unterschiedliche Periodenlängen der Blattbewegung zeigen, beispielsweise 23 Stunden und 26 Stunden. Als er diese Pflanzen miteinander kreuzte, lag die Periodenlänge der Nachkommen zwischen diesen Werten. Nachfolgende Generationen besaßen wieder die Periode der Eltern. Der Mechanismus der inneren Uhr ist also im Erbgut verankert, das bedeutet: Es gibt Gene, die für Bestandteile der inneren Uhr kodieren. Sie sind ihrerseits an der phänotypischen Ausprägung von circadianen Rhythmen ursächlich beteiligt. Abb. 2. Circadiane Oszillation der LHC-Transkripte. Arabidopsis-Pflanzen wachsen zunächst im normalen Tag-Nacht-Rhythmus und werden anschließend in konstantes Licht gebracht und rund um die Uhr geerntet. RNA, die alle Transkripte enthält, wird isoliert, auf einem Gel nach der Größe aufgetrennt und auf eine Membran übertragen. Mit einer spezifischen, radioaktiv markierten Sonde wird das Transkript des LHC-Gens nachgewiesen (oben). Schematische Darstellung der Transkriptoszillation (unten). Der schwarze Balken bedeutet Licht aus, der offene Balken Licht an. Rhythmik auch bei der Genexpression Ein wesentlicher Schritt zum Verständnis der molekularen Grundlagen circadianer Rhythmen gelang Kloppstech 1985 mit der Beobachtung, dass die innere Uhr neben makroskopisch sichtbaren Prozessen auch die Aktivität bestimmter Gene steuert [5]. Das kommt darin zum Ausdruck, dass die Menge an Transkripten, die von diesen Genen abgelesen werden, im Tagesverlauf Schwankungen unterliegen. Am besten untersucht sind die LHC-Gene, die für die Chlorophyll-bindenden Proteine des Photosyntheseapparats, die light harvesting chlorophyll binding proteins, kodieren. Sie dienen der Lichtabsorption für die Photosynthese. Nachts sind die Transkripte kaum nachzuweisen. Ihre Konzentration steigt kurz vor Sonnenaufgang an und erreicht ihr Maximum gegen Mittag. Diese Schwankungen bleiben im Dauerlicht bestehen (Abbildung 2). Was könnte der Sinn dieser Oszillationen sein? Das LHC-Protein wird zum Zeitpunkt höchster Sonneneinstrahlung gebraucht. Die Pflanze bereitet sich auf eine optimale Photosynthese vor, indem sie das Transkript für die LHC-Proteinsynthese bereits vor Sonnenaufgang anhäuft. Die zeitliche Organisation durch die innere Uhr ermöglicht es Organismen also, nicht nur auf Veränderungen zu reagieren, wenn sie eintreten, sondern für die zu einer bestimmten Tageszeit mit der höchsten Wahrscheinlichkeit vorherrschenden Bedingungen gerüstet zu sein. Der Uhrenmechanismus von Arabidopsis Pflanzen mit veränderten Rhythmen helfen bei der Aufklärung Anfang der neunziger Jahre wurde systematisch nach Mutanten mit Defekten im Uhrenmechanismus gesucht. Als Modellpflanze diente Arabidopsis thaliana (Ackerschmalwand) aus der Familie der Kreuzblütler, die sich aufgrund ihrer kurzen Generationszeit und ihres kleinen Genoms für die genetische und molekulare Charakterisierung von Mutanten sehr gut eignet. Solche Mutanten sollten sich durch veränderte Zeigerrhythmen ausweisen. Dazu erzeugten Millar und Kay einen künstlichen Zeigerrhythmus, der auf der morgenspezifischen Expression des LHC-Gens beruht (Abbildung 2). Sie kombinierten seine Kontrollregion, in der die Information für die rhythmische Transkription verschlüsselt ist, mit dem Gen für Luciferase [7]. Die Luciferase ist ein Protein aus Leuchtkäfern, das die Substanz Luciferin unter Freisetzung von Licht umsetzt. Arabidopsis- Pflanzen, in die dieses Gen eingebaut worden ist, leuchten, und zwar vor allem morgens (Abbildung 3, oben). Das lässt sich mit einer Videokamera aufzeichnen, so dass man den Lauf der inneren Uhr zu jeder Tageszeit verfolgen kann. Für den Versuch wurden Samen der transgenen Pflanzen mit einer mutagenisierenden Chemikalie behandelt, die Veränderungen am Erbgut erzeugen kann. Unter den Nachkommen können anschließend Pflanzen herausgesucht werden, die zur falschen Tageszeit
3 78 Botanik leuchten, weil ihr Luciferasegen nicht korrekt abgelesen wird (Abbildung 3, unten). Tatsächlich wurde auf diese Weise eine Mutante gefunden, bei der die maximale Lichtproduktion alle 21 Stunden stattfindet, die Luciferaseaktivität also mit einer verkürzten Periode schwingt. Sie wurde als toc1-mutante für timing of chlorophyll binding protein expression bezeichnet [7]. Interessanterweise ist auch die Periode des Blattbewegungsrhythmus verkürzt. Das Gen, das durch die Mutation betroffen ist, scheint somit eine Schlüsselrolle bei der Erzeugung circadianer Rhythmen zu spielen. Forscher sind nun dabei, dieses Gen zu identifizieren [9]. Abb. 3. Identifizierung von Arabidopsis- Mutanten mit veränderter circadianer Rhythmik. Ein Luciferase-Gen, das durch die circadiane Kontrollregion des LHC- Gens gesteuert wird, wurde in Arabidopsis eingeführt. Die Pflanzen leuchten, wenn das Luciferase-Gen abgelesen wird, also normalerweise morgens (oben). In Pflanzen, die von diesem Verhalten abweichen, ist die circadiane Kontrollregion nicht mehr korrekt an die innere Uhr angebunden; sie weisen also einen Defekt im Uhrenmechanismus auf (unten). Ein Protein reguliert über Rückkopplung Die Langtagpflanze Arabidopsis kommt bei Anzucht unter Langtagbedingungen schneller zum Blühen als unter Kurztagbedingungen (Abbildung 4). Beim Durchmustern von mutagenisierten Pflanzen fiel eine dadurch auf, dass sie im Langtag genauso lange braucht um zur Blüte zu kommen wie im Kurztag, also nicht mehr zwischen verschiedenen Tageslängen unterscheiden kann [8]. Das Gen, das in dieser lhy-mutante (late elongated hypocotyl) betroffen ist, codiert für einen Transkriptionsfaktor. Interessanterweise zeigt das LHY-Transkript eine circadiane Schwingung. Um festzustellen, ob diese Schwingung für seine Funktion notwendig ist, wurden transgene Pflanzen hergestellt, in denen LHY nicht mehr rhythmisch, sondern den gesamten Tag mit gleichbleibend hoher Konzentration gemacht wird. Das erreicht man dadurch, dass man das Gen mit einer fremden Kontrollregion ausstattet, die unabhängig von der Tageszeit abgelesen wird. In diesen transgenen Pflanzen ist die Oszillation des endogenen LHY-Transkripts stark gedämpft. Das LHY-Protein beeinflusst also seine eigene Rhythmik durch eine negative Selbstregulation. Abb. 4. Vier Wochen alte Arabidopsis blühen, wenn sie im Langtag (täglich 16 Stunden Licht) angezogen worden sind (rechts), während gleich alte Pflanzen im Kurztag (8 Stunden Licht) noch wachsen und Blätter bilden (links). Diese Beobachtung stieß auf großes Interesse, weil von Drosophila oder Säugetieren bekannt ist, dass das Uhrwerk aus einer solchen negativen Rückkopplungsschleife besteht. Der Schrittmacher der circadianen Rhythmik ist aus circadian schwingenden Proteinen aufgebaut, welche die Transkription ihrer Gene und damit ihre eigene Produktion im 24- Stunden-Takt an- und abschalten (Abbildung 5). Transkriptionsfaktoren setzen zu einer definierten Tageszeit die Transkription der Uhrengene in Gang. Dadurch steigt die Konzentration an Transkript und mit einer gewissen Verzögerung auch die der Uhrenproteine an. Ab einem bestimmten Schwellenwert erfolgt eine negative Rückkopplung: Die Uhrenproteine hemmen ihre eigene Synthese. Dadurch sinkt ihre Konzentration wieder ab, die Selbstregulation wird aufgehoben und der 24- Stunden-Zyklus kann von neuem beginnen. Man geht heute davon aus, dass Uhrenproteine nicht nur ihre eigene Synthese, sondern auch die von anderen Proteinen regulieren. Über solche rhythmisch produzierten Proteine kann die durch den Schrittmacher erzeugte Rhythmik weitergeleitet werden, was schließlich zu den messbaren circadianen Vorgängen führt. Eine weitergehende Charakterisierung der lhy-mutante zeigte, dass einige circadian regulierte Prozesse nicht mehr rhythmisch verlaufen. Beispielsweise zeigt das LHC-Transkript keine normale Oszillation mehr, und die Blattbewegungsrhythmen sind gedämpft. Die Störung des inneren Uhrenmechanismus beeinträchtigt also gleichermaßen photoperiodische Blühinduktion wie circadiane Rhythmen.
4 Innere Uhr bei Pflanzen 79 Auch CCA1 spielt eine Schlüsselrolle Auf einen Transkriptionsfaktor, der große Ähnlichkeit mit LHY aufweist, ist man bei der Suche nach Proteinen gestoßen, die an die für das morgenspezifische Ablesen verantwortliche Kontrollregion des LHC-Gens binden [11]. Ein solcher Transkriptionsfaktor könnte für die Umsetzung der von der inneren Uhr erzeugten Rhythmik in die Oszillationen des LHC-Transkripts verantwortlich sein. Er wurde deshalb CCA1, circadian clock associated, genannt. Interessanterweise zeigt CCA1 selbst eine circadiane Schwingung sowohl das Transkript als auch das Protein werden morgens produziert, kurz bevor die Transkription des LHC-Gens beginnt. In transgenen Pflanzen, die CCA1 ständig in großen Mengen produzieren, ist die Oszillation des endogenen CCA1-Transkripts stark gedämpft. CCA1 beeinflusst also ebenfalls seine eigene Rhythmik durch eine negative Selbstregulation, ist somit wie LHY Teil einer circadian regulierten Rückkopplungsschleife. Die gleichbleibend hohe CCA1-Konzentration wirkt sich auch auf die LHC-Rhythmik aus: Das LHC-Transkript schwingt im Dauerlicht nicht mehr, und die Blattbewegungsrhythmen sind gestört. CCA1 scheint also eine Schlüsselfunktion im Uhrenmechanismus einzunehmen. Das zeigt sich auch bei Pflanzen, die ein Stück fremde DNA in das CCA1-Gen eingebaut haben und es deswegen nicht mehr exprimieren können [2]. LHC zeigt trotz Verlust des CCA1-Proteins noch eine circadiane Schwingung, die Periode ist aber um 3 Stunden kürzer. CCA1 ist also wichtig für die normale Rhythmik. Es gibt aber offensichtlich noch andere Faktoren, die Einfluss auf die LHC-Oszillationen haben. Weder LHY noch CCA1 zeigen eine Sequenzähnlichkeit zu den Uhrenproteinen aus Drosophila oder Säugetieren. Doch scheinen Pflanzen das gleiche Prinzip von Rückkopplungsschleifen, über die Proteine ihre eigenen Gene regulieren, zur Erzeugung von Rhythmik zu nützen [6]. Ein RNA-Bindungsprotein wird circadian reguliert Bei einer gezielten Suche nach circadian regulierten Genen in Senf und Arabidopsis wurde ein RNA-Bindungsprotein, GRP, gefunden, Abb. 5. Modell des circadianen Schrittmachers, basierend auf experimentellen Daten von Drosophila und Säugetieren. Die Expression der Uhrengene wird durch Transkriptionsfaktoren (TF) zu einer bestimmten Tageszeit in Gang gebracht. Ist eine bestimmte Menge an Uhrenproteinen gebildet, schalten sie ihre eigene Synthese wieder ab. Die Bestandteile des Schrittmachers regulieren auch die Expression anderer Proteine, die letztendlich am Zustandekommen circadianer Rhythmen beteiligt sind. das eine Oszillation zeigt [3]. Im Gegensatz zu den LHC-Transkripten erreicht das GRP- Transkript seine höchste Konzentration erst am Abend. Auf Gewebeschnitten durch den Mutation: molekulare Veränderung im Erbgut. Bei einer Genmutation ist die Sequenz einzelner Gene betroffen, was zu Veränderung oder Verlust des Proteins führen kann. Das hat phänotypische Auswirkungen auf Stoffwechsel oder Entwicklung eines Organismus. Circadiane Rhythmen: biologische Prozesse, die im Tag-Nacht-Wechsel rhythmisch ablaufen, und auch unter konstanten Umweltbedingungen eine ungefähr 24- stündige Rhythmik beibehalten. Innere Uhr: endogener Oszillator, der mit einer Periodenlänge von ungefähr 24 Stunden schwingt und rhythmische biologische Prozesse kontrolliert. Er wird durch äußere Faktoren wie Licht und Temperatur eingestellt. Dadurch werden die inneren Rhythmen mit dem periodischen Wechsel von Tag und Nacht synchronisiert. Der circadiane Glossar Stängel von Senfpflanzen findet man das Transkript in einer ringförmigen, teilungsaktiven Zellschicht, dem Kambium, und zwar ausschließlich abends (Abbildung 6). Schrittmacher ist ein Regulationskreis aus Uhrenproteinen, die ihre eigene Genaktivität negativ regulieren. Periode: Zeitintervall zwischen zwei vergleichbaren Punkten einer Schwingung, etwa zwei aufeinander folgenden Maxima. Photoperiode: Dauer der täglichen Lichtphase. Transkription: Die genetische Information, die in der DNA-Sequenz verschlüsselt ist, wird durch den Prozess der Transkription abgelesen. Sie wird in eine RNA umgeschrieben, das Transkript des Gens. Dieses Transkript dient als Matrize für die Übersetzung in Protein. Transkriptionsfaktoren sind Proteine, die an die Kontrollregion der Gene binden. Dadurch steuern sie deren Aktivität, d. h. wann, wo und wie häufig das Gen transkribiert wird.
5 80 Botanik Nicht nur die Konzentration des Transkripts, sondern auch die des GRP-Proteins selbst unterliegt einer circadianen Schwankung. Seine Oszillation ist etwas verschoben gegenüber der des Transkripts: Steigt die Konzentration des Proteins an, sinkt die Konzentration seines Transkripts [4]. Das legt die Vermutung nahe, dass das RNA-Bindungprotein sein eigenes Transkript negativ regulieren könnte. In transgenen Pflanzen, in denen die circadian regulierte Kontrollregion des Gens durch eine konstant abgelesene ersetzt wurde und die deswegen ständig große Mengen des Proteins herstellen, ist die Oszillation des endogenen GRP-Transkripts nur noch ganz schwach ausgeprägt. Transkript und Protein bilden also tatsächlich eine negative Rückkopplungsschleife [4]. Lässt sich dieser circadian regulierte Rückkopplungskreis mit denen vergleichen, über die Uhrenproteine in Drosophila oder CCA1 und LHY bei Arabidopsis im 24-Stunden- Takt die Transkription ihrer eigenen Gene regulieren? In Pflanzen, die das RNA-Bindungsprotein überproduzieren, wird sein Transkript immer noch rhythmisch produziert. Da das Protein an RNA bindet, könnte es die Konzentration seiner eigenen RNA aber dadurch verringern, dass es in regelmäßigen Abständen an diese bindet und dadurch ihren Abbau bewirkt [10]. Das RNA-Bindungsprotein ist damit wahrscheinlich Teil eines untergeordneten Schwingkreises, der von einem Schrittmacher im 24-Stunden-Rhythmus aktiviert wird und sich anschließend selbst wieder abschaltet. Unterstützt wird dies durch die Beobachtung, dass in Pflanzen, die CCA1 oder LHY konstant überproduzieren, die Oszillation des RNA-Bindungsproteins gedämpft ist. Außerdem hat die GRP-Oszillation in der toc1-mutante eine verkürzte Periode. CCA1, LHY und TOC1 regulieren also GRP. Weitere Experimente müssen zeigen, ob GRP seinerseits andere rhythmische Prozesse reguliert. Abbildung 7 zeigt ein Modell, wie diese Komponenten zusammenwirken könnten [6, 9, 10]. Die Transkriptionsfaktoren CCA1 und LHY sind Bestandteile von miteinander verknüpften negativen Rückkopplungskreisen, die eine Reihe von Zeigerrhythmen regulieren: die Oszillation der LHC-Transkripte, die Blattbewegungsrhythmen und die Blühinduktion in Abhängigkeit von der Tageslänge. TOC1, dessen molekulare Eigenschaften Abb. 6. Nachweis eines circadian regulierten Transkripts für ein RNA-Bindungsprotein im Stängel von Senfpflanzen [3]. Auf Gewebeschnitte wird eine radioaktive Sonde für das RNA-Bindungsprotein aufgetragen. Nach einer photographischen Entwicklung zeigen die weißen Silberkörner auf einem Schnitt, der abends angefertigt wurde, eine starke Anhäufung des Transkripts im Kambium an (links). Auf einem morgens angefertigten Schnitt ist das Transkript nicht nachzuweisen (rechts). Die ringförmigen Strukturen sind die Leitbündel, deren Zellwände im Mikroskop aufleuchten (vgl. Schema des Stängelquerschnitts: K, Kambium; LB, Leitbündel). (Die Aufnahmen wurden freundlicherweise von Dr. Christian Heintzen zur Verfügung gestellt.) noch nicht bekannt sind, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle beim Zustandekommen dieser Rhythmen. Die Lichtsignale, welche die innere Uhr täglich aufs Neue mit dem Tag-Nacht-Rhythmus synchronisieren, werden über die Phytochrom-Photorezeptoren, die rotes Licht absorbieren, und den Blaulichtrezeptor Cryptochrom wahrgenommen. Weitere Untersuchungen werden Aufschluss darüber geben, ob TOC1, CCA1 und LHY die Bestandteile des Uhrwerks sind. Der Verlust eines Uhrenproteins sollte beispielsweise die Rhythmik zum Erliegen bringen; ein Verlust von CCA1 führt aber lediglich zu einer verkürzten Periode der von ihm regulierten LHC-Transkriptschwingungen. Möglicherweise ist die innere Uhr bei Pflanzen noch aus anderen Molekülen aufgebaut, die es zu identifizieren gilt. Zusammenfassung In den letzten Jahren sind verschiedene Bestandteile des Uhrenmechanismus bei Arabidopsis thaliana identifiziert worden. In der toc1-mutante sind die circadiane Oszillation der LHC-Expression und die Blattbewegungsrhythmen gestört. CCA1 und LHY sind zwei Transkriptionsfaktoren, die andere circadian regulierte Transkripte, Blattbewegungsrhythmen und die Messung der Tageslänge zur Blühinduktion kontrollieren. Sie sind Bestandteil von negativen Rückkopplungskreisen, durch die sie ihre eigene Rhythmik regulieren. Damit zeigen sie eine funktionelle Analogie zu Bestandteilen der inneren Uhr bei Drosophila, Maus oder Mensch, obwohl die Proteine keine Sequenzähnlichkeit aufweisen. The endogeneous clock in plants Numerous physiological processes in higher plants show circadian rhythms, i.e. they occur regularly at 24-hour-intervals. Several proteins involved in the generation of circadian rhythms have been identified in Arabidopsis thaliana and provide some clue as to the molecular basis of the endogeneous clock in this model plant: The toc1 mutation shortens promoter activity of the LHC genes encoding the light harvesting proteins of the photosystems as well as other rhythmic processes. The transcription factors CCA1 and LHY are part of circadianly regulated negative feedback loops through which they con-
6 Innere Uhr bei Pflanzen 81 Abb. 7. Modell des circadianen Systems in Arabidopsis. Die Transkriptionsfaktoren CCA1 und LHY sind Bestandteile von miteinander verwandten negativen Rückkopplungskreisen, welche die Oszillation der LHC-Transkripte, Blattbewegungsrhythmen und Blühinduktion in Abhängigkeit von der Tageslänge regulieren. TOC1, dessen molekulare Eigenschaften noch nicht bekannt sind, beeinflusst diese Rhythmen ebenfalls. Das RNA-Bindungsprotein GRP ist Bestandteil eines Rückkopplungskreislaufs, der von allen dreien kontrolliert wird. Die Photorezeptoren Phytochrom und Cryptochrom registrieren und verarbeiten die Lichtsignale, welche die innere Uhr täglich aufs Neue mit dem Tag-Nacht-Rhythmus synchronisieren [6, 10]. trol oscillations of their own as well as those of other genes and ultimately rhythms of leaf movement and photoperiodic flower induction. Literatur [1] J. Dunlap (1998) Circadian rhythms. An end in the beginning. Science 280, [2] R. Green, E. Tobin (1999) Loss of the circadian clock-associated protein 1 in Arabidopsis results in altered clock-regulated gene expression. Proc Natl Acad Sci USA 96, [3] C. Heintzen, S. Melzer, R. Fischer, S. Kappeler, K. Apel, D. Staiger (1994) A light- and temperature-entrained circadian clock controls expression of transcripts encoding nuclear proteins with homology to RNAbinding proteins in meristematic tissue. The Plant J 5, [4] C. Heintzen, M. Nater, K. Apel, D. Staiger (1997) AtGRP7, a nuclear RNA-binding protein as a component of a circadian-regulated negative feedback loop in Arabidopsis thaliana. Proc Natl Acad Sci USA 94, [5] K. Kloppstech (1985) Diurnal and circadian rhythmicity in the expression of light-induced plant nuclear messenger RNAs. Planta 165, [6] C. R. McClung (1999) It s about time. Putative components of an Arabidopsis circadian clock. Trends in Plant Sciences 3, [7] A. J. Millar, I. A. Carré, C. A. Strayer, N. H. Chua, S. A. Kay (1995) Circadian clock mutants in Arabidopsis identified by luciferase imaging. Science 267, [8] R. Schaffer, N. Ramsay, A. Samach, S. Corden, J. Putterill, I. A. Carré, G. Coupland (1998) The late elongated hypocotyl mutation of Arabidopsis disrupts circadian rhythms and the photoperiodic control of flowering. Cell 93, [9] D. E. Somers (1999) The physiology and molecular bases of the plant circadian clock. Plant Physiology 121, [10] D. Staiger, C. Heintzen (1999) The circadian system of Arabidopsis thaliana. Chronobiology International 16, [11] Z. Y. Wang, E. M. Tobin (1998) Constitutive expression of the Circadian clock associated 1 (CCA1) gene disrupts circadian rhythms and suppresses its own expression. Cell 93, Zur Autorin Dorothee Staiger, geboren 1960 in Stuttgart Studium der Biochemie in Tübingen und München. Diplomarbeit am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried. Dissertation am Max-Planck- Institut für Züchtungsforschung in Köln über lichtregulierte Genexpression bei höheren Pflanzen; anschließend Tätigkeit als Postdoc. Seit 1990 am Institut für Pflanzenwissenschaften der ETH Zürich beschäftigt. Thema: Molekulare Grundlagen des circadianen Systems von Arabidopsis. Anschrift Dr. Dorothee Staiger, Institut für Pflanzenwissenschaften, ETH-Zentrum, Universitätstr. 2, CH-8092 Zürich.
Exkurs: Circadiane Rhythmik. Physiologie der Zeitumstellung
 Exkurs: Circadiane Rhythmik Physiologie der Zeitumstellung Chronobiologie Die biologische Uhr circadiane Rhythmik Biologische Uhren sind Anpassungen des Organismus an zyklische Veränderungen der Umwelt
Exkurs: Circadiane Rhythmik Physiologie der Zeitumstellung Chronobiologie Die biologische Uhr circadiane Rhythmik Biologische Uhren sind Anpassungen des Organismus an zyklische Veränderungen der Umwelt
Vom pubertären Nachtschwärmer zum senilen Bettflüchter
 Biologische Uhr ändert sich Vom pubertären Nachtschwärmer zum senilen Bettflüchter Basel, Schweiz (17. Mai 2011) - Die meisten Menschen kommen aufgrund ihrer Biochronologie entweder als Lerche (Frühaufsteher)
Biologische Uhr ändert sich Vom pubertären Nachtschwärmer zum senilen Bettflüchter Basel, Schweiz (17. Mai 2011) - Die meisten Menschen kommen aufgrund ihrer Biochronologie entweder als Lerche (Frühaufsteher)
Eine zentrale Frage der molekularen Biologie beschäftigt. Jenseits des Genoms Alternatives Spleißen erhöht die Vielfalt des Transkriptoms
 ÜBERSICHT Tino Köster, Bielefeld, John WS Brown, Invergowrie (Schottland), Dorothee Staiger, Bielefeld Jenseits des Genoms Alternatives Spleißen erhöht die Vielfalt des Transkriptoms Alternatives Spleißen
ÜBERSICHT Tino Köster, Bielefeld, John WS Brown, Invergowrie (Schottland), Dorothee Staiger, Bielefeld Jenseits des Genoms Alternatives Spleißen erhöht die Vielfalt des Transkriptoms Alternatives Spleißen
1 Photomorphogenese KS 2 Skotomorphogenese KS 3 Blühinduktion KS 4 Meristemidentität
 Mol. Entwicklungsgenetik der Pflanzen II - Inhalte 1 Photomorphogenese 18. 04. 13 KS 2 Skotomorphogenese 25. 04. 13 KS 3 Blühinduktion 02. 05. 13 KS 4 Meristemidentität 16. 05. 13 KS 5 Blütenorganidentität
Mol. Entwicklungsgenetik der Pflanzen II - Inhalte 1 Photomorphogenese 18. 04. 13 KS 2 Skotomorphogenese 25. 04. 13 KS 3 Blühinduktion 02. 05. 13 KS 4 Meristemidentität 16. 05. 13 KS 5 Blütenorganidentität
1 Photomorphogenese KS 2 Skotomorphogenese KS 3 Blühinduktion KS 4 Meristemidentität
 Mol. Entwicklungsgenetik der Pflanzen II - Inhalte 1 Photomorphogenese 19. 04. 12 KS 2 Skotomorphogenese 26. 04. 12 KS 3 Blühinduktion 03. 05. 12 KS 4 Meristemidentität 10. 05. 12 KS 5 Blütenorganidentität
Mol. Entwicklungsgenetik der Pflanzen II - Inhalte 1 Photomorphogenese 19. 04. 12 KS 2 Skotomorphogenese 26. 04. 12 KS 3 Blühinduktion 03. 05. 12 KS 4 Meristemidentität 10. 05. 12 KS 5 Blütenorganidentität
Melanopsin und die innere Uhr
 Hintergrund Melanopsin und die innere Uhr Benjamin Schuster-Böcker, Betreuer: Dr. Rita Rosenthal Zirkadianer Rhythmus Praktisch alle höheren Lebewesen folgen einem Aktivitätsrhythmus, der dem Wechsel von
Hintergrund Melanopsin und die innere Uhr Benjamin Schuster-Böcker, Betreuer: Dr. Rita Rosenthal Zirkadianer Rhythmus Praktisch alle höheren Lebewesen folgen einem Aktivitätsrhythmus, der dem Wechsel von
Tageslängen im Jahresverlauf
 Tageslängen im Jahresverlauf Modellieren mit der Sinusfunktion Julian Eichbichler Thema Stoffzusammenhang Klassenstufe Modellieren mithilfe der allgemeinen Sinusfunktion Trigonometrische Funktionen 2.
Tageslängen im Jahresverlauf Modellieren mit der Sinusfunktion Julian Eichbichler Thema Stoffzusammenhang Klassenstufe Modellieren mithilfe der allgemeinen Sinusfunktion Trigonometrische Funktionen 2.
C SB. Genomics Herausforderungen und Chancen. Genomics. Genomic data. Prinzipien dominieren über Detail-Fluten. in 10 Minuten!
 Genomics Herausforderungen und Chancen Prinzipien dominieren über Detail-Fluten Genomics in 10 Minuten! biol. Prin cip les Genomic data Dr.Thomas WERNER Scientific & Business Consulting +49 89 81889252
Genomics Herausforderungen und Chancen Prinzipien dominieren über Detail-Fluten Genomics in 10 Minuten! biol. Prin cip les Genomic data Dr.Thomas WERNER Scientific & Business Consulting +49 89 81889252
Autosomal-dominanter Erbgang
 12 Autosomal-dominanter Erbgang Bearbeitetes Informationsblatt herausgegeben vom Guy s and St. Thomas Hospital, London und dem London IDEAS Genetic Knowledge Park, entsprechend deren Qualitätsstandards.
12 Autosomal-dominanter Erbgang Bearbeitetes Informationsblatt herausgegeben vom Guy s and St. Thomas Hospital, London und dem London IDEAS Genetic Knowledge Park, entsprechend deren Qualitätsstandards.
Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS. Gymnasium, Natur und Technik (Schwerpunkt Biologie), Jahrgangsstufe 6. Keimung
 Keimung Jahrgangsstufen 6 Fach/Fächer Übergreifende Bildungsund Erziehungsziele Zeitrahmen Natur und Technik (Schwerpunkt Biologie) --- Aus den nachfolgenden Aufgaben kann je nach Zeitrahmen, Unterrichtszielen
Keimung Jahrgangsstufen 6 Fach/Fächer Übergreifende Bildungsund Erziehungsziele Zeitrahmen Natur und Technik (Schwerpunkt Biologie) --- Aus den nachfolgenden Aufgaben kann je nach Zeitrahmen, Unterrichtszielen
Gesunder Schlaf. Wann Schlafmangel gefährlich wird. Leseempfehlung:
 Gesunder Schlaf Wann Schlafmangel gefährlich wird Da sich die folgenden Kapitel mit den gravierenden Auswirkungen von Schlafmangel und Schlafstörungen auf die Gesundheit beschäftigen, sei noch einmal ausdrücklich
Gesunder Schlaf Wann Schlafmangel gefährlich wird Da sich die folgenden Kapitel mit den gravierenden Auswirkungen von Schlafmangel und Schlafstörungen auf die Gesundheit beschäftigen, sei noch einmal ausdrücklich
VO Struktur und Funktion der Pflanze Univ.-Prof. Dr. Marianne Popp
 Czihak, G., Langer, H., Ziegler, H. (1976) Biologie. Ein Lehrbuch für Studenten der Biologie. Springer Verlag Berlin, pp. 837 Munk K.. (2009) Botanik. Thieme Verlag Stuttgart, pp. 573 Kutschera, U. (2002),
Czihak, G., Langer, H., Ziegler, H. (1976) Biologie. Ein Lehrbuch für Studenten der Biologie. Springer Verlag Berlin, pp. 837 Munk K.. (2009) Botanik. Thieme Verlag Stuttgart, pp. 573 Kutschera, U. (2002),
ERBKRANKHEITEN (mit den Beispielen Albinismus, Chorea Huntington, Bluterkrankheit u. Mitochondriopathie)
 ERBKRANKHEITEN (mit den Beispielen Albinismus, Chorea Huntington, Bluterkrankheit u. Mitochondriopathie) Als Erbkrankheit werden Erkrankungen und Besonderheiten bezeichnet, die entweder durch ein Gen (monogen)
ERBKRANKHEITEN (mit den Beispielen Albinismus, Chorea Huntington, Bluterkrankheit u. Mitochondriopathie) Als Erbkrankheit werden Erkrankungen und Besonderheiten bezeichnet, die entweder durch ein Gen (monogen)
Circadiane Rhythmen und molekulare Uhren
 Powered by Seiten-Adresse: Neurospora crassa wurde unter Biologen über die kleine Zunft der Mykologen (Pilzforscher) hinaus bekannt, als die US-amerikanischen Wissenschaftler George W. Beadle und Edward
Powered by Seiten-Adresse: Neurospora crassa wurde unter Biologen über die kleine Zunft der Mykologen (Pilzforscher) hinaus bekannt, als die US-amerikanischen Wissenschaftler George W. Beadle und Edward
Die Spektralfarben des Lichtes
 Die Spektralfarben des Lichtes 1 Farben sind meistens bunt. Es gibt rot, grün, gelb, blau, helldunkles rosarot,... und noch viele mehr. Es gibt vier Grundfarben, die anderen werden zusammengemischt. Wenn
Die Spektralfarben des Lichtes 1 Farben sind meistens bunt. Es gibt rot, grün, gelb, blau, helldunkles rosarot,... und noch viele mehr. Es gibt vier Grundfarben, die anderen werden zusammengemischt. Wenn
Hämoglobin: Proteinfunktion und Mikrokosmos (Voet Kapitel 9)
 Hämoglobin: Proteinfunktion und Mikrokosmos (Voet Kapitel 9) 1. Funktion des Hämoglobins 2. Struktur und Mechanismus 3. Anormale Hämoglobine 4. Allosterische Regulation 4. Allosterische Regulation Organismen
Hämoglobin: Proteinfunktion und Mikrokosmos (Voet Kapitel 9) 1. Funktion des Hämoglobins 2. Struktur und Mechanismus 3. Anormale Hämoglobine 4. Allosterische Regulation 4. Allosterische Regulation Organismen
Wie molekulare Karabiner die Zellteilung beim Menschen regulieren
 Wie molekulare Karabiner die Zellteilung beim Menschen regulieren Bayreuther Genetiker veröffentlichen neue Forschungsergebnisse im renommierten Journal der European Molecular Biology Organisation (EMBO)
Wie molekulare Karabiner die Zellteilung beim Menschen regulieren Bayreuther Genetiker veröffentlichen neue Forschungsergebnisse im renommierten Journal der European Molecular Biology Organisation (EMBO)
Zirkadiane Periode bei Pflanzen
 Zirkadiane Periodik Innere Zeitgeber Verschiedene Schlafstadien Entwicklung von Schlafmustern im Laufe der Lebensspanne Neuronales Substrat Schlafstörungen Zirkadiane Periode bei Pflanzen Versuchsaufbau
Zirkadiane Periodik Innere Zeitgeber Verschiedene Schlafstadien Entwicklung von Schlafmustern im Laufe der Lebensspanne Neuronales Substrat Schlafstörungen Zirkadiane Periode bei Pflanzen Versuchsaufbau
Zur Geschichte des Polleninformationsdienstes. Warum ist die Pollenvorhersage unerlässlich? Was ist eine Allergie? Institut für Meteorologie
 Zur Geschichte des Polleninformationsdienstes Der Polleninformationsdienst der Freien Universität Berlin wurde bereits im Jahr 1984 von Dr. med. Silbermann (Kinderarzt und Allergologe), Herrn Dipl.-Met.
Zur Geschichte des Polleninformationsdienstes Der Polleninformationsdienst der Freien Universität Berlin wurde bereits im Jahr 1984 von Dr. med. Silbermann (Kinderarzt und Allergologe), Herrn Dipl.-Met.
Entwicklungs /gewebespezifische Genexpression. Coexpression funktional überlappender Gene
 Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten Konzepte: Entwicklungs /gewebespezifische Genexpression Coexpression funktional überlappender Gene Positive Genregulation Negative Genregulation cis /trans Regulation
Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten Konzepte: Entwicklungs /gewebespezifische Genexpression Coexpression funktional überlappender Gene Positive Genregulation Negative Genregulation cis /trans Regulation
Gentherapie bei Pflanzen oder Analyse von Mutanten in biochemischen Reaktionsketten.
 Gentherapie bei Pflanzen oder Analyse von Mutanten in biochemischen Reaktionsketten. Abb. 1: Levkoje (Matthiola) http://www.blumeninschwaben.de Hintergrundinformationen In vielen Fällen resultiert ein
Gentherapie bei Pflanzen oder Analyse von Mutanten in biochemischen Reaktionsketten. Abb. 1: Levkoje (Matthiola) http://www.blumeninschwaben.de Hintergrundinformationen In vielen Fällen resultiert ein
MOLEKULARGENETISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUM EINFLUSS DER FPFI-GEN-FAMILIE AUF DIE BLÜHINDUKTION
 Diss. ETH No. 14226 MOLEKULARGENETISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUM EINFLUSS DER FPFI-GEN-FAMILIE AUF DIE BLÜHINDUKTION ABHANDLUNG zur Erlangung des Titels DOKTOR DER NATURWISSENSCHAFfEN der EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN
Diss. ETH No. 14226 MOLEKULARGENETISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUM EINFLUSS DER FPFI-GEN-FAMILIE AUF DIE BLÜHINDUKTION ABHANDLUNG zur Erlangung des Titels DOKTOR DER NATURWISSENSCHAFfEN der EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN
Warum habe ich Diabetes? Sind die Gene schuld?
 Warum habe ich Diabetes? Sind die Gene schuld? Lenka Bosanska medicalxpress.com 17. Welt Diabetes Tag Was sind Gene? Gene bei Diabetes Polygene vs. Monogene Formen Ich und meine Gene - was kann ich tun?
Warum habe ich Diabetes? Sind die Gene schuld? Lenka Bosanska medicalxpress.com 17. Welt Diabetes Tag Was sind Gene? Gene bei Diabetes Polygene vs. Monogene Formen Ich und meine Gene - was kann ich tun?
6.2 Elektromagnetische Wellen
 6.2 Elektromagnetische Wellen Im vorigen Kapitel wurde die Erzeugung von elektromagnetischen Schwingungen und deren Eigenschaften untersucht. Mit diesem Wissen ist es nun möglich die Entstehung von elektromagnetischen
6.2 Elektromagnetische Wellen Im vorigen Kapitel wurde die Erzeugung von elektromagnetischen Schwingungen und deren Eigenschaften untersucht. Mit diesem Wissen ist es nun möglich die Entstehung von elektromagnetischen
Genetische Kontrolle der Entwicklung mehrzelliger Eukaryonten
 1. Was sind maternale Effektgene, wann entstehen aus diesen Genen Genprodukte und wo sind diese lokalisiert? Welche Aspekte der Entwicklung steuern maternale Effektgene? Übung 12 Entwicklungsgenetik Genetische
1. Was sind maternale Effektgene, wann entstehen aus diesen Genen Genprodukte und wo sind diese lokalisiert? Welche Aspekte der Entwicklung steuern maternale Effektgene? Übung 12 Entwicklungsgenetik Genetische
Entwicklungs /gewebespezifische Genexpression
 Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten Konzepte: Entwicklungs /gewebespezifische Genexpression Positive Genregulation Negative Genregulation cis /trans Regulation 1. Auf welchen Ebenen kann Genregulation
Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten Konzepte: Entwicklungs /gewebespezifische Genexpression Positive Genregulation Negative Genregulation cis /trans Regulation 1. Auf welchen Ebenen kann Genregulation
Molecular genetic analysis of GIGANTEA
 Molecular genetic analysis of the role of GIGANTEA in flower initiation Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln vorgelegt
Molecular genetic analysis of the role of GIGANTEA in flower initiation Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln vorgelegt
1. Leseverstehen Text
 1. Leseverstehen Text Was ist schön? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass Frauen dann besonders attraktiv sind, wenn ihr Gesicht kindchenhafte Merkmale aufweist, d.h. Merkmale,
1. Leseverstehen Text Was ist schön? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass Frauen dann besonders attraktiv sind, wenn ihr Gesicht kindchenhafte Merkmale aufweist, d.h. Merkmale,
Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten
 Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten Konzepte: Differentielle Genexpression Positive Genregulation Negative Genregulation cis-/trans-regulation 1. Auf welchen Ebenen kann Genregulation stattfinden? Definition
Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten Konzepte: Differentielle Genexpression Positive Genregulation Negative Genregulation cis-/trans-regulation 1. Auf welchen Ebenen kann Genregulation stattfinden? Definition
27 Funktionelle Genomanalysen Sachverzeichnis
 Inhaltsverzeichnis 27 Funktionelle Genomanalysen... 543 27.1 Einleitung... 543 27.2 RNA-Interferenz: sirna/shrna-screens 543 Gunter Meister 27.3 Knock-out-Technologie: homologe Rekombination im Genom der
Inhaltsverzeichnis 27 Funktionelle Genomanalysen... 543 27.1 Einleitung... 543 27.2 RNA-Interferenz: sirna/shrna-screens 543 Gunter Meister 27.3 Knock-out-Technologie: homologe Rekombination im Genom der
Gene-Silencing in transgenen Pflanzen Gene silencing in transgenic plants
 Gene-Silencing in transgenen Pflanzen Gene silencing in transgenic plants Schmidt, Renate; Arlt, Matthias Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie, Potsdam-Golm Korrespondierender Autor E-Mail:
Gene-Silencing in transgenen Pflanzen Gene silencing in transgenic plants Schmidt, Renate; Arlt, Matthias Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie, Potsdam-Golm Korrespondierender Autor E-Mail:
Posttranskriptionale Veränderungen der Genexpression bei hereditären Erkrankungen
 Posttranskriptionale Veränderungen der Genexpression bei hereditären Erkrankungen Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades Dr. rer. nat. des Fachbereichs Biologie, Chemie, Pharmazie der Freien Universität
Posttranskriptionale Veränderungen der Genexpression bei hereditären Erkrankungen Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades Dr. rer. nat. des Fachbereichs Biologie, Chemie, Pharmazie der Freien Universität
Stressmoleküle nachweisen im lebenden Fisch
 Powered by Seiten-Adresse: https://www.biooekonomiebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/stressmolekuelenachweisen-im-lebenden-fisch/ Stressmoleküle nachweisen im lebenden Fisch Glühwürmchen tun es, um zu verführen
Powered by Seiten-Adresse: https://www.biooekonomiebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/stressmolekuelenachweisen-im-lebenden-fisch/ Stressmoleküle nachweisen im lebenden Fisch Glühwürmchen tun es, um zu verführen
Allgemeine Psychologie: Schlaf und zirkadiane Periodik. Sommersemester Thomas Schmidt
 Allgemeine Psychologie: Schlaf und zirkadiane Periodik Sommersemester 2008 Thomas Schmidt Folien: http://www.allpsych.uni-giessen.de/thomas Literatur: Rosenzweig, Ch. 14 Zirkadiane Periodik Zirkadiane
Allgemeine Psychologie: Schlaf und zirkadiane Periodik Sommersemester 2008 Thomas Schmidt Folien: http://www.allpsych.uni-giessen.de/thomas Literatur: Rosenzweig, Ch. 14 Zirkadiane Periodik Zirkadiane
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Genbezeichnung. 1. Einleitung 1
 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Genbezeichnung VI VIII X 1. Einleitung 1 1.1 Das Plastom 1 1.2 Transkription in Chloroplasten 4 1.2.1 Die plastidäre Transkriptionsmaschinerie
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Genbezeichnung VI VIII X 1. Einleitung 1 1.1 Das Plastom 1 1.2 Transkription in Chloroplasten 4 1.2.1 Die plastidäre Transkriptionsmaschinerie
Inhalt 1 Modellorganismen
 Inhalt 1 Modellorganismen....................................... 1 1.1 Escherichia coli....................................... 1 1.1.1 Historisches...................................... 3 1.1.2 Lebenszyklus.....................................
Inhalt 1 Modellorganismen....................................... 1 1.1 Escherichia coli....................................... 1 1.1.1 Historisches...................................... 3 1.1.2 Lebenszyklus.....................................
Der Entwicklungszyklus einer höheren Pflanze
 Der Entwicklungszyklus einer höheren Pflanze reproduction mature plant seedling photoautotrophy photomorphogenesis germination Pflanzliche Entwicklung äußere Reize: Licht Schwerkraft Ernährung Stress:
Der Entwicklungszyklus einer höheren Pflanze reproduction mature plant seedling photoautotrophy photomorphogenesis germination Pflanzliche Entwicklung äußere Reize: Licht Schwerkraft Ernährung Stress:
Transgene Organismen
 Transgene Organismen Themenübersicht 1) Einführung 2) Komplementäre DNA (cdna) 3) Vektoren 4) Einschleusung von Genen in Eukaryontenzellen 5) Ausmaß der Genexpression 6) Genausschaltung (Gen-Knockout)
Transgene Organismen Themenübersicht 1) Einführung 2) Komplementäre DNA (cdna) 3) Vektoren 4) Einschleusung von Genen in Eukaryontenzellen 5) Ausmaß der Genexpression 6) Genausschaltung (Gen-Knockout)
Protokoll zum diurnalen Säurerythmus einer CAM-Pflanze
 Protokoll zum diurnalen Säurerythmus einer CAM-Pflanze Datum: 30.6.10 Einleitung: In sehr trockenen und heißen Gebieten ist die Öffnung der Stomata tagsüber sehr riskant. Der Wasserverlust durch Transpiration
Protokoll zum diurnalen Säurerythmus einer CAM-Pflanze Datum: 30.6.10 Einleitung: In sehr trockenen und heißen Gebieten ist die Öffnung der Stomata tagsüber sehr riskant. Der Wasserverlust durch Transpiration
Institut für Biochemie und Molekulare Medizin. Lecture 1 Translational components. Michael Altmann FS 2011
 Institut für Biochemie und Molekulare Medizin Lecture 1 Translational components Michael Altmann FS 2011 Gene Expression Fliessdiagramm der eukaryotischen Genexpression Die Expression eines Gens kann auf
Institut für Biochemie und Molekulare Medizin Lecture 1 Translational components Michael Altmann FS 2011 Gene Expression Fliessdiagramm der eukaryotischen Genexpression Die Expression eines Gens kann auf
In 7 Schritten zum Für immer aufgeräumten Schreibtisch Dauerhaft mehr Zeit für Beruf und Familie
 In 7 Schritten zum Für immer aufgeräumten Schreibtisch Dauerhaft mehr Zeit für Beruf und Familie Der Effizienzprofi. Mehr Informationen zum 7 Schritte Programm finden Sie unter: www-für-immer-aufgeräumt.de/7schritteprogramm
In 7 Schritten zum Für immer aufgeräumten Schreibtisch Dauerhaft mehr Zeit für Beruf und Familie Der Effizienzprofi. Mehr Informationen zum 7 Schritte Programm finden Sie unter: www-für-immer-aufgeräumt.de/7schritteprogramm
Natürliche Rhythmen nutzen und der Non-Stop-Belastung entgehen. Einleitung 11. Kapitel 1 Chronobiologie - das Leben in der Zeit...
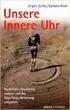 Jürgen Zulley Barbara Knab Natürliche Rhythmen nutzen und der Non-Stop-Belastung entgehen Herder Verlag Freiburg, 2003 (TB-Ausgabe). Einleitung 11 Kapitel 1 Chronobiologie - das Leben in der Zeit...13
Jürgen Zulley Barbara Knab Natürliche Rhythmen nutzen und der Non-Stop-Belastung entgehen Herder Verlag Freiburg, 2003 (TB-Ausgabe). Einleitung 11 Kapitel 1 Chronobiologie - das Leben in der Zeit...13
Stochastische Genexpression
 Stochastische Genexpression Genetische Schalter und Multistabilität Vorlesung System-Biophysik 12. Dez. 2008 Literatur Kaern et al. Nature Reviews Genetics Vol.6 p.451 (2005) Ozbudak, Oudenaarden et al
Stochastische Genexpression Genetische Schalter und Multistabilität Vorlesung System-Biophysik 12. Dez. 2008 Literatur Kaern et al. Nature Reviews Genetics Vol.6 p.451 (2005) Ozbudak, Oudenaarden et al
Hier werden bisher vorliegende ausgewählte Ergebnisse dieses Versuches vorgestellt. Erntedauer und Wirtschaftlichkeit bei Spargel 1
 1 Erntedauer und Wirtschaftlichkeit bei Spargel 1 Carmen Feller, Jan Gräfe und Matthias Fink, Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau Großbeeren und Erfurt (IGZ), Kontakt: feller@igzev.de Die
1 Erntedauer und Wirtschaftlichkeit bei Spargel 1 Carmen Feller, Jan Gräfe und Matthias Fink, Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau Großbeeren und Erfurt (IGZ), Kontakt: feller@igzev.de Die
Grundideen der Gentechnik
 Grundideen der Gentechnik Die Gentechnik kombiniert Biotechnik und Züchtung. Wie in der Züchtung wird die Erbinformation eines Lebewesen verändert. Dabei nutzte man in den Anfängen der Gentechnik vor allem
Grundideen der Gentechnik Die Gentechnik kombiniert Biotechnik und Züchtung. Wie in der Züchtung wird die Erbinformation eines Lebewesen verändert. Dabei nutzte man in den Anfängen der Gentechnik vor allem
Beschreiben Sie in Stichworten zwei der drei Suppressormutationen, die man in Hefe charakterisiert hat. Starzinski-Powitz, 6 Fragen, 53 Punkte Name
 Starzinski-Powitz, 6 Fragen, 53 Punkte Name Frage 1 8 Punkte Nennen Sie 2 Möglichkeiten, wie der Verlust von Heterozygotie bei Tumorsuppressorgenen (Z.B. dem Retinoblastomgen) zum klompletten Funktionsverlust
Starzinski-Powitz, 6 Fragen, 53 Punkte Name Frage 1 8 Punkte Nennen Sie 2 Möglichkeiten, wie der Verlust von Heterozygotie bei Tumorsuppressorgenen (Z.B. dem Retinoblastomgen) zum klompletten Funktionsverlust
Jahrbuch 2003/2004 Weigel, Detlef Das Genom als Schlüssel zum Verständnis der Anpassung von Pflanzen an ihre Umwelt
 Das Genom als Schlüssel zum Verständnis der Anpassung von Pflanzen The genome as key to understanding how plants adapt to their environment Weigel, Detlef Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie,
Das Genom als Schlüssel zum Verständnis der Anpassung von Pflanzen The genome as key to understanding how plants adapt to their environment Weigel, Detlef Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie,
Taschengeld. 15.1 Taschengeld pro Monat
 15 Taschengeld Das folgende Kapitel gibt darüber Aufschluss, wie viel Taschengeld die Kinder in Deutschland im Monat bekommen und ob sie sich Geld zum Taschengeld dazu verdienen. Wenn die Kinder zusätzliches
15 Taschengeld Das folgende Kapitel gibt darüber Aufschluss, wie viel Taschengeld die Kinder in Deutschland im Monat bekommen und ob sie sich Geld zum Taschengeld dazu verdienen. Wenn die Kinder zusätzliches
Mathias Arbeiter 02. Mai 2006 Betreuer: Herr Bojarski. Operationsverstärker. OPV-Kenndaten und Grundschaltungen
 Mathias Arbeiter 02. Mai 2006 Betreuer: Herr Bojarski Operationsverstärker OPV-Kenndaten und Grundschaltungen Inhaltsverzeichnis 1 Eigenschaften von Operationsverstärkern 3 1.1 Offsetspannung..........................................
Mathias Arbeiter 02. Mai 2006 Betreuer: Herr Bojarski Operationsverstärker OPV-Kenndaten und Grundschaltungen Inhaltsverzeichnis 1 Eigenschaften von Operationsverstärkern 3 1.1 Offsetspannung..........................................
Christian Thoma: Schnelle Regulation durch Translationskontrolle
 Powered by Seiten-Adresse: https://www.gesundheitsindustriebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/christian-thoma-schnelleregulation-durch-translationskontrolle/ Christian Thoma: Schnelle Regulation durch Translationskontrolle
Powered by Seiten-Adresse: https://www.gesundheitsindustriebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/christian-thoma-schnelleregulation-durch-translationskontrolle/ Christian Thoma: Schnelle Regulation durch Translationskontrolle
Kulturen von humanen Nabelschnur-Endothelzellen (HUVEC) produzieren konstant Endothelin-1 (ET-1) und geben dieses in das Kulturmedium ab.
 4 ERGEBNISSE 4.1 Endothelin Kulturen von humanen Nabelschnur-Endothelzellen (HUVEC) produzieren konstant Endothelin-1 (ET-1) und geben dieses in das Kulturmedium ab. 4.1.1 Dosisabhängige Herabregulation
4 ERGEBNISSE 4.1 Endothelin Kulturen von humanen Nabelschnur-Endothelzellen (HUVEC) produzieren konstant Endothelin-1 (ET-1) und geben dieses in das Kulturmedium ab. 4.1.1 Dosisabhängige Herabregulation
SCHRIFTLICHE ABITURPRÜFUNG 2007 Biologie (Grundkursniveau)
 Biologie (Grundkursniveau) Einlesezeit: Bearbeitungszeit: 30 Minuten 210 Minuten Der Prüfling wählt je ein Thema aus den Gebieten G (Grundlagen) und V (Vertiefung) zur Bearbeitung aus. Die zwei zur Bewertung
Biologie (Grundkursniveau) Einlesezeit: Bearbeitungszeit: 30 Minuten 210 Minuten Der Prüfling wählt je ein Thema aus den Gebieten G (Grundlagen) und V (Vertiefung) zur Bearbeitung aus. Die zwei zur Bewertung
Beeinflussung des Immunsystems
 Exkurs: Beeinflussung des Immunsystems http://www.quarks.de/dyn/21751.phtml **neu** Lange Zeit wurde angenommen, dass das Immunsystem völlig unabhängig vom Nervensystem ist, wo KK stattfindet. Es lässt
Exkurs: Beeinflussung des Immunsystems http://www.quarks.de/dyn/21751.phtml **neu** Lange Zeit wurde angenommen, dass das Immunsystem völlig unabhängig vom Nervensystem ist, wo KK stattfindet. Es lässt
KV: Genexpression und Transkription Michael Altmann
 Institut für Biochemie und Molekulare Medizin KV: Genexpression und Transkription Michael Altmann Herbstsemester 2008/2009 Übersicht VL Genexpression / Transkription 1.) Was ist ein Gen? 2.) Welche Arten
Institut für Biochemie und Molekulare Medizin KV: Genexpression und Transkription Michael Altmann Herbstsemester 2008/2009 Übersicht VL Genexpression / Transkription 1.) Was ist ein Gen? 2.) Welche Arten
Skript zum Thema Epigenetik
 Skript zum Thema Epigenetik Name: Seite! 2 von! 14 Worum geht s hier eigentlich? Zelle Erbgut im Zellkern Organismus 1 Die genetische Information, die jeder Mensch in seinen Zellkernen trägt, ist in jeder
Skript zum Thema Epigenetik Name: Seite! 2 von! 14 Worum geht s hier eigentlich? Zelle Erbgut im Zellkern Organismus 1 Die genetische Information, die jeder Mensch in seinen Zellkernen trägt, ist in jeder
Bundesrealgymnasium Imst. Chemie 2010-11. Klasse 4. Einführung Stoffe
 Bundesrealgymnasium Imst Chemie 2010-11 Einführung Stoffe Dieses Skriptum dient der Unterstützung des Unterrichtes - es kann den Unterricht aber nicht ersetzen, da im Unterricht der Lehrstoff detaillierter
Bundesrealgymnasium Imst Chemie 2010-11 Einführung Stoffe Dieses Skriptum dient der Unterstützung des Unterrichtes - es kann den Unterricht aber nicht ersetzen, da im Unterricht der Lehrstoff detaillierter
In den Proteinen der Lebewesen treten in der Regel 20 verschiedene Aminosäuren auf. Deren Reihenfolge muss in der Nucleotidsequenz der mrna und damit
 In den Proteinen der Lebewesen treten in der Regel 20 verschiedene Aminosäuren auf. Deren Reihenfolge muss in der Nucleotidsequenz der mrna und damit in der Nucleotidsequenz der DNA verschlüsselt (codiert)
In den Proteinen der Lebewesen treten in der Regel 20 verschiedene Aminosäuren auf. Deren Reihenfolge muss in der Nucleotidsequenz der mrna und damit in der Nucleotidsequenz der DNA verschlüsselt (codiert)
Vererbung. Die durch Fortpflanzung entstandene Nachkommenschaft gleicht den Elternorganismen weitgehend
 Vererbung Die durch Fortpflanzung entstandene Nachkommenschaft gleicht den Elternorganismen weitgehend Klassische Genetik Äußeres Erscheinungsbild: Phänotypus setzt sich aus einer Reihe von Merkmalen (Phänen))
Vererbung Die durch Fortpflanzung entstandene Nachkommenschaft gleicht den Elternorganismen weitgehend Klassische Genetik Äußeres Erscheinungsbild: Phänotypus setzt sich aus einer Reihe von Merkmalen (Phänen))
38. Lektion Wie alt ist Ötzi wirklich, oder wie wird eine Altersbestimmung durchgeführt?
 38. Lektion Wie alt ist Ötzi wirklich, oder wie wird eine Altersbestimmung durchgeführt? Lernziel: Radioaktive Isotope geben Auskunft über das Alter von organischen Materialien, von Gesteinen und von der
38. Lektion Wie alt ist Ötzi wirklich, oder wie wird eine Altersbestimmung durchgeführt? Lernziel: Radioaktive Isotope geben Auskunft über das Alter von organischen Materialien, von Gesteinen und von der
Unterschiedliche Zielarten erfordern. unterschiedliche Coaching-Tools
 Unterschiedliche Zielarten erfordern 2 unterschiedliche Coaching-Tools Aus theoretischer Perspektive lassen sich unterschiedliche Arten von Zielen unterscheiden. Die Art des Ziels und die dahinterliegende
Unterschiedliche Zielarten erfordern 2 unterschiedliche Coaching-Tools Aus theoretischer Perspektive lassen sich unterschiedliche Arten von Zielen unterscheiden. Die Art des Ziels und die dahinterliegende
Protokoll: Gefärbte Rose
 Protokoll: Gefärbte Rose 1)Fragestellung: Wie wird in einer Pflanze bzw. Blume Wasser befördert und wohin? 2.) Hypothese: Die Blume nimmt die Farbe der Tinte auf und transportiert sie weiter. 3.) Material:
Protokoll: Gefärbte Rose 1)Fragestellung: Wie wird in einer Pflanze bzw. Blume Wasser befördert und wohin? 2.) Hypothese: Die Blume nimmt die Farbe der Tinte auf und transportiert sie weiter. 3.) Material:
11.2.4 Der Burgers Vektor
 174 11. KRISTALLBAUFEHLER Abbildung 11.7: Detailansicht auf atomarer Ebene einer Stufenversetzung. 11.2.4 Der Burgers Vektor Der Burgers Vektor charakterisiert eine Versetzungslinie. Hierzu wird das gestörte
174 11. KRISTALLBAUFEHLER Abbildung 11.7: Detailansicht auf atomarer Ebene einer Stufenversetzung. 11.2.4 Der Burgers Vektor Der Burgers Vektor charakterisiert eine Versetzungslinie. Hierzu wird das gestörte
Bestimmung des Schlüsselenzyms für den biologischen Abbau mittels der Planreal DNA-Methodik PRA-DNA
 Bestimmung des Schlüsselenzyms für den biologischen Abbau mittels der Planreal DNA-Methodik PRA-DNA Dr. Christoph Henkler, Planreal AG Der biologische Abbau von Schadstoffen erfolgt in den Zellen durch
Bestimmung des Schlüsselenzyms für den biologischen Abbau mittels der Planreal DNA-Methodik PRA-DNA Dr. Christoph Henkler, Planreal AG Der biologische Abbau von Schadstoffen erfolgt in den Zellen durch
Der molekulare Bauplan des Lebens; biologische Nano- und Mikrobausteine von Lebewesen. RNA und DNA als sich selbst replizierende Informationsspeicher
 Der molekulare Bauplan des Lebens; biologische Nano- und Mikrobausteine von Lebewesen RNA und DNA als sich selbst replizierende Informationsspeicher Quelle: Biochemie, J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer,
Der molekulare Bauplan des Lebens; biologische Nano- und Mikrobausteine von Lebewesen RNA und DNA als sich selbst replizierende Informationsspeicher Quelle: Biochemie, J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer,
Seminar zur Grundvorlesung Genetik
 Seminar zur Grundvorlesung Genetik Wann? Gruppe B1: Montags, 1600-1700 Wo? Kurt-Mothes-Saal, Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie Teilnahme obligatorisch, max. 1x abwesend Kontaktdaten Marcel Quint Leibniz-Institut
Seminar zur Grundvorlesung Genetik Wann? Gruppe B1: Montags, 1600-1700 Wo? Kurt-Mothes-Saal, Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie Teilnahme obligatorisch, max. 1x abwesend Kontaktdaten Marcel Quint Leibniz-Institut
Musterlösung- Übung 9
 Teil Molekularbiologie 1. Über Mutationen a) In welchem Teil eines Operons befinden sich Mutationen, welche die Menge eines Enzyms in einem Organismus beeinflussen? Solche Mutationen befinden sich im Operator.
Teil Molekularbiologie 1. Über Mutationen a) In welchem Teil eines Operons befinden sich Mutationen, welche die Menge eines Enzyms in einem Organismus beeinflussen? Solche Mutationen befinden sich im Operator.
Versuchsprotokoll. Spezifische Wärmekapazität des Wassers. Dennis S. Weiß & Christian Niederhöfer. zu Versuch 7
 Montag, 10.11.1997 Dennis S. Weiß & Christian Niederhöfer Versuchsprotokoll (Physikalisches Anfängerpraktikum Teil II) zu Versuch 7 Spezifische Wärmekapazität des Wassers 1 Inhaltsverzeichnis 1 Problemstellung
Montag, 10.11.1997 Dennis S. Weiß & Christian Niederhöfer Versuchsprotokoll (Physikalisches Anfängerpraktikum Teil II) zu Versuch 7 Spezifische Wärmekapazität des Wassers 1 Inhaltsverzeichnis 1 Problemstellung
AlgoBio WS 16/17 Protein-DNA Interaktionen ChiP-Seq Datenanalyse. Annalisa Marsico
 AlgoBio WS 16/17 Protein-DNA Interaktionen ChiP-Seq Datenanalyse Annalisa Marsico 6.02.2017 Protein-DNA Interaktionen Häufig binden sich Proteine an DNA, um ihre biologische Funktion zu regulieren. Transkriptionsfaktoren
AlgoBio WS 16/17 Protein-DNA Interaktionen ChiP-Seq Datenanalyse Annalisa Marsico 6.02.2017 Protein-DNA Interaktionen Häufig binden sich Proteine an DNA, um ihre biologische Funktion zu regulieren. Transkriptionsfaktoren
HUMAN CENTRIC LIGHTING. Der Einfluss des Lichts auf den Menschen
 HUMAN CENTRIC LIGHTING Der Einfluss des Lichts auf den Menschen LICHT UND GESUNDHEIT Licht ist so wichtig für die Gesundheit wie ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung und ausreichend Schlaf. Gutes
HUMAN CENTRIC LIGHTING Der Einfluss des Lichts auf den Menschen LICHT UND GESUNDHEIT Licht ist so wichtig für die Gesundheit wie ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung und ausreichend Schlaf. Gutes
Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten
 Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten Konzepte: Differentielle Genexpression Positive Genregulation Negative Genregulation cis-/trans-regulation 1. Auf welchen Ebenen kann Genregulation stattfinden? Definition
Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten Konzepte: Differentielle Genexpression Positive Genregulation Negative Genregulation cis-/trans-regulation 1. Auf welchen Ebenen kann Genregulation stattfinden? Definition
3.2 Posttranslationelle Modifikation von Wt1 durch Phosphorylierung
 3.2 Posttranslationelle Modifikation von Wt1 durch Phosphorylierung Transkriptionsfaktoren erfahren oft eine posttranslationelle Modifikation in Form von Phosphorylierung und werden dadurch in ihrer Aktivität
3.2 Posttranslationelle Modifikation von Wt1 durch Phosphorylierung Transkriptionsfaktoren erfahren oft eine posttranslationelle Modifikation in Form von Phosphorylierung und werden dadurch in ihrer Aktivität
Transkription Teil 2. - Transkription bei Eukaryoten -
 Transkription Teil 2 - Transkription bei Eukaryoten - Inhalte: Unterschiede in der Transkription von Pro- und Eukaryoten Die RNA-Polymerasen der Eukaryoten Cis- und trans-aktive Elemente Promotoren Transkriptionsfaktoren
Transkription Teil 2 - Transkription bei Eukaryoten - Inhalte: Unterschiede in der Transkription von Pro- und Eukaryoten Die RNA-Polymerasen der Eukaryoten Cis- und trans-aktive Elemente Promotoren Transkriptionsfaktoren
Traditionelle Pflanzenzucht 5
 Abb. 1.1. Zeitskala der Entstehung einiger Kulturpflanzen. (Verändert nach: Programm Biotechnologie 2000, BEO, 1994; Zeichnung H.-J. Rathke) Traditionelle Pflanzenzucht 5 Regeneration intakter Pflanzen
Abb. 1.1. Zeitskala der Entstehung einiger Kulturpflanzen. (Verändert nach: Programm Biotechnologie 2000, BEO, 1994; Zeichnung H.-J. Rathke) Traditionelle Pflanzenzucht 5 Regeneration intakter Pflanzen
12 Einstellungen zur Rolle der Frau
 12 Einstellungen zur Rolle der Frau Die Rolle der Frau in Familie und Beruf hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert: Die Zahl der Ehescheidungen nimmt zu, die Geburtenrate sinkt und es sind
12 Einstellungen zur Rolle der Frau Die Rolle der Frau in Familie und Beruf hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert: Die Zahl der Ehescheidungen nimmt zu, die Geburtenrate sinkt und es sind
Berechnungsmethoden der Wertentwicklung nach IRR und BVI
 Berechnungsmethoden der Wertentwicklung nach IRR und BVI In den Depotberichten verwenden wir zwei unterschiedliche Methoden zur Berechnung der Wertentwicklung (Performance). Jede dieser Berechnungsmethoden
Berechnungsmethoden der Wertentwicklung nach IRR und BVI In den Depotberichten verwenden wir zwei unterschiedliche Methoden zur Berechnung der Wertentwicklung (Performance). Jede dieser Berechnungsmethoden
Es sollen alle die Möglichkeit bekommen, ihre persönliche Meinung zu äußern, ohne dafür kritisiert oder belehrt zu werden.
 Arbeitsblatt: Was weißt du über Drogen? Fülle den Fragebogen aus, ohne jemandem deine Antworten zu zeigen. Alle Fragebögen werden gesammelt und die Antworten anonym auf einem Plakat festgehalten. Das Arbeitsblatt
Arbeitsblatt: Was weißt du über Drogen? Fülle den Fragebogen aus, ohne jemandem deine Antworten zu zeigen. Alle Fragebögen werden gesammelt und die Antworten anonym auf einem Plakat festgehalten. Das Arbeitsblatt
Dr. Hans-Günther Heiland Dr. Werner Schulte Universität Bremen. Workshop 21. und 22. Mai 2003 in Weimar
 Dr. Hans-Günther Heiland Dr. Werner Schulte Universität Bremen Zeit, Lebenswelt und Studierende Jeder glaubt zu wissen, was Zeit ist, aber - können wir sie auch beschreiben, definieren, erklären? Ist Lebenswelt
Dr. Hans-Günther Heiland Dr. Werner Schulte Universität Bremen Zeit, Lebenswelt und Studierende Jeder glaubt zu wissen, was Zeit ist, aber - können wir sie auch beschreiben, definieren, erklären? Ist Lebenswelt
Pinschertage der OG Bonn Grundlagen der Zucht
 Pinschertage der OG Bonn 31.05. - 01.06.2008 Grundlagen der Zucht von Ralf Wiechmann Der Phänotyp Ist die Gesamtheit der wahrnehmbaren Merkmale eines Organismus. das äußere Erscheinungsbild das Aussehen,
Pinschertage der OG Bonn 31.05. - 01.06.2008 Grundlagen der Zucht von Ralf Wiechmann Der Phänotyp Ist die Gesamtheit der wahrnehmbaren Merkmale eines Organismus. das äußere Erscheinungsbild das Aussehen,
Kapitel 30 Fehlerhafte DNA-Reparatur bei Fanconi-Anämie
 281 Kapitel 30 Fehlerhafte DNA-Reparatur bei Fanconi-Anämie Ilja Demuth und Martin Digweed Institut für Humangenetik, Charité - Universitätsmedizin Berlin Man geht heute davon aus, dass die Erbanlage des
281 Kapitel 30 Fehlerhafte DNA-Reparatur bei Fanconi-Anämie Ilja Demuth und Martin Digweed Institut für Humangenetik, Charité - Universitätsmedizin Berlin Man geht heute davon aus, dass die Erbanlage des
Seminar. Leibniz Institut für Pflanzenbiochemie
 Seminar Molekulare l Mechanismen der Signaltransduktion Marcel lquint Leibniz Institut für Pflanzenbiochemie Abiotic stimuli Light Temperature Wind Drought Rain etc., rapid response essential Biotic stimuli
Seminar Molekulare l Mechanismen der Signaltransduktion Marcel lquint Leibniz Institut für Pflanzenbiochemie Abiotic stimuli Light Temperature Wind Drought Rain etc., rapid response essential Biotic stimuli
Wir sollen erarbeiten, wie man mit Hilfe der Mondentfernung die Entfernung zur Sonne bestimmen kann.
 Expertengruppenarbeit Sonnenentfernung Das ist unsere Aufgabe: Wir sollen erarbeiten, wie man mit Hilfe der Mondentfernung die Entfernung zur Sonne bestimmen kann. Konkret ist Folgendes zu tun: Lesen Sie
Expertengruppenarbeit Sonnenentfernung Das ist unsere Aufgabe: Wir sollen erarbeiten, wie man mit Hilfe der Mondentfernung die Entfernung zur Sonne bestimmen kann. Konkret ist Folgendes zu tun: Lesen Sie
Die Connexine Cx33 und Cx43 werden in der Retina der Ratte tageszeitlich reguliert
 Aus dem Institut für Funktionelle und Klinische Anatomie der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Die Connexine Cx33 und Cx43 werden in der Retina der Ratte tageszeitlich reguliert
Aus dem Institut für Funktionelle und Klinische Anatomie der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Die Connexine Cx33 und Cx43 werden in der Retina der Ratte tageszeitlich reguliert
Genaktivierung und Genexpression
 Genaktivierung und Genexpression Unter Genexpression versteht man ganz allgemein die Ausprägung des Genotyps zum Phänotyp einer Zelle oder eines ganzen Organismus. Genotyp: Gesamtheit der Informationen
Genaktivierung und Genexpression Unter Genexpression versteht man ganz allgemein die Ausprägung des Genotyps zum Phänotyp einer Zelle oder eines ganzen Organismus. Genotyp: Gesamtheit der Informationen
Identifikation einer neuen WRKY-Transkriptionsfaktorbindungsstelle. in bioinformatisch identifizierten,
 Identifikation einer neuen WRKY-Transkriptionsfaktorbindungsstelle in bioinformatisch identifizierten, Pathogen-responsiven c/s-elementen aus Arabidopsis thaliana Von der Fakultät für Lebenswissenschaften
Identifikation einer neuen WRKY-Transkriptionsfaktorbindungsstelle in bioinformatisch identifizierten, Pathogen-responsiven c/s-elementen aus Arabidopsis thaliana Von der Fakultät für Lebenswissenschaften
Ubiquitin-vermittelte Cadmium-Resistenz und MAC 1-abhängige Regulation des Kupferund Eisenstoffwechsels
 0 Molekulargenetische Analyse Metall-abhängiger Prozesse in S. cerevisiae: Ubiquitin-vermittelte Cadmium-Resistenz und MAC 1-abhängige Regulation des Kupferund Eisenstoffwechsels DISSERTATION der Fakultät
0 Molekulargenetische Analyse Metall-abhängiger Prozesse in S. cerevisiae: Ubiquitin-vermittelte Cadmium-Resistenz und MAC 1-abhängige Regulation des Kupferund Eisenstoffwechsels DISSERTATION der Fakultät
Praktikum Biochemie B.Sc. Water Science WS Enzymregulation. Marinja Niggemann, Denise Schäfer
 Praktikum Biochemie B.Sc. Water Science WS 2011 Enzymregulation Marinja Niggemann, Denise Schäfer Regulatorische Strategien 1. Allosterische Wechselwirkung 2. Proteolytische Aktivierung 3. Kovalente Modifikation
Praktikum Biochemie B.Sc. Water Science WS 2011 Enzymregulation Marinja Niggemann, Denise Schäfer Regulatorische Strategien 1. Allosterische Wechselwirkung 2. Proteolytische Aktivierung 3. Kovalente Modifikation
Human Centric Lighting. Beleuchtung mit dem Ziel, Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern.
 Human Centric Lighting Beleuchtung mit dem Ziel, Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern. 1 Natürliches Licht Sonnenaufgang Vormittag Mittagszeit Nachmittag Sonnenuntergang Nacht Nacht Natürliches Licht
Human Centric Lighting Beleuchtung mit dem Ziel, Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern. 1 Natürliches Licht Sonnenaufgang Vormittag Mittagszeit Nachmittag Sonnenuntergang Nacht Nacht Natürliches Licht
Magnesium-ProtoporphyrinIX-Chelatase: Ein Schlüsselenzym in der Tetrapyrrolbiosynthese
 Magnesium-ProtoporphyrinIX-Chelatase: Ein Schlüsselenzym in der Tetrapyrrolbiosynthese Vom Fachbereich Biologie der Universität Hannover zur Erlangung des Grades Doktor der Naturwissenschaften Dr. rer.
Magnesium-ProtoporphyrinIX-Chelatase: Ein Schlüsselenzym in der Tetrapyrrolbiosynthese Vom Fachbereich Biologie der Universität Hannover zur Erlangung des Grades Doktor der Naturwissenschaften Dr. rer.
Was verändert das Wetter? Arbeitsblatt
 Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag Die SuS erfahren, was die Wettersituation verändern kann, und lernen den Klimabegriff kennen. Sie lösen einen Lückentext, lesen einen Text zum Thema Klima und lernen
Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag Die SuS erfahren, was die Wettersituation verändern kann, und lernen den Klimabegriff kennen. Sie lösen einen Lückentext, lesen einen Text zum Thema Klima und lernen
Morphologie der Tanycyten und die Expression zellulärer Adhäsionsmoleküle wird durch die Photoperiode reguliert
 0646_Band114,Nr.389_Chronobiologie_Layout 1 25.07.11 12:50 Seite 217 Morphologie der Tanycyten und die Expression zellulärer Adhäsionsmoleküle wird durch die Photoperiode reguliert Matei BOLBOREA (Aberdeen),
0646_Band114,Nr.389_Chronobiologie_Layout 1 25.07.11 12:50 Seite 217 Morphologie der Tanycyten und die Expression zellulärer Adhäsionsmoleküle wird durch die Photoperiode reguliert Matei BOLBOREA (Aberdeen),
Weise die Wärmeabgabe - die Wärmestrahlung - unseres Körpers nach. Beobachte die Schwankungen unserer Körperwärme im Verlauf eines Tages.
 Naturwissenschaften - Biologie - Allgemeine Biologie - 1 Untersuchung von Pflanzen und Tieren (P8010400) 1.5 Die Körperwärme Experiment von: Phywe Gedruckt: 07.10.2013 15:07:20 intertess (Version 13.06
Naturwissenschaften - Biologie - Allgemeine Biologie - 1 Untersuchung von Pflanzen und Tieren (P8010400) 1.5 Die Körperwärme Experiment von: Phywe Gedruckt: 07.10.2013 15:07:20 intertess (Version 13.06
Gene-Silencing in transgenen Pflanzen
 Schmidt, Renate et al. Gen-Silencing in transgenen Pflanzen Tätigkeitsbericht 2006 Pflanzenforschung Gene-Silencing in transgenen Pflanzen Schmidt, Renate; Arlt, Matthias Max-Planck-Institut für molekulare
Schmidt, Renate et al. Gen-Silencing in transgenen Pflanzen Tätigkeitsbericht 2006 Pflanzenforschung Gene-Silencing in transgenen Pflanzen Schmidt, Renate; Arlt, Matthias Max-Planck-Institut für molekulare
Natürliche Variation bei höheren Pflanzen Gene, Mechanismen, Natural variation in higher plants genes, mechanisms, evolution, plant breeding
 Natürliche Variation bei höheren Pflanzen Gene, Mechanismen, Natural variation in higher plants genes, mechanisms, evolution, plant breeding Koornneef, Maarten Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung,
Natürliche Variation bei höheren Pflanzen Gene, Mechanismen, Natural variation in higher plants genes, mechanisms, evolution, plant breeding Koornneef, Maarten Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung,
Spannung und Stromstärke bei Reihen- und Parallelschaltung von Solarzellen
 Spannung und Stromstärke bei Reihen- und ENT Schlüsselworte Sonnenenergie, Fotovoltaik, Solarzelle, Reihenschaltung, Parallelschaltung Prinzip Eine einzelne Solarzelle liefert nur eine Spannung von 0,5
Spannung und Stromstärke bei Reihen- und ENT Schlüsselworte Sonnenenergie, Fotovoltaik, Solarzelle, Reihenschaltung, Parallelschaltung Prinzip Eine einzelne Solarzelle liefert nur eine Spannung von 0,5
Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften
 Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften VORTRÄGE N324 FRANZ PISCHINGER Möglichkeiten zur Energieeinsparung beim Teillastbetrieb von Kraftfahrzeugmotoren DIETRICH NEUMANN Die zeitliche Programmierung
Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften VORTRÄGE N324 FRANZ PISCHINGER Möglichkeiten zur Energieeinsparung beim Teillastbetrieb von Kraftfahrzeugmotoren DIETRICH NEUMANN Die zeitliche Programmierung
Vektorgeometrie Ebenen 1
 Vektorgeometrie Ebenen 1 Parametergleichung von Ebenen Punkte und Geraden in Ebenen. Spezielle Lagen von Punkten in Bezug auf ein Parallelogramm oder Dreieck. Datei Nr. 63021 Stand 1. Juli 2009 INTERNETBIBLIOTHEK
Vektorgeometrie Ebenen 1 Parametergleichung von Ebenen Punkte und Geraden in Ebenen. Spezielle Lagen von Punkten in Bezug auf ein Parallelogramm oder Dreieck. Datei Nr. 63021 Stand 1. Juli 2009 INTERNETBIBLIOTHEK
Chromosomale Translokationen
 12 Unique - The Rare Chromosome Disorder Support Group in the UK Service-Telefon: + 44 (0) 1883 330766 Email:info@rarechromo.org Web:www.rarechromo.org Chromosomale Translokationen Orphanet Frei zugängliche
12 Unique - The Rare Chromosome Disorder Support Group in the UK Service-Telefon: + 44 (0) 1883 330766 Email:info@rarechromo.org Web:www.rarechromo.org Chromosomale Translokationen Orphanet Frei zugängliche
Verteilungsfunktionen (in Excel) (1)
 Verteilungsfunktionen (in Excel) () F(x) Veranschaulichung der Sprungstellen: Erst ab x=4 ist F(x) = 0,75! Eine Minimal kleinere Zahl als 4, bspw. 3,9999999999 gehört noch zu F(x)=0,5! 0,75 0,5 0,25 0
Verteilungsfunktionen (in Excel) () F(x) Veranschaulichung der Sprungstellen: Erst ab x=4 ist F(x) = 0,75! Eine Minimal kleinere Zahl als 4, bspw. 3,9999999999 gehört noch zu F(x)=0,5! 0,75 0,5 0,25 0
