Ökologisches Grundeinkommen: Ein Einstieg ist möglich
|
|
|
- Oskar Lenz
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Ökologisches Grundeinkommen: Ein Einstieg ist möglich In dem Beitrag wird zunächst das Prinzip eines ökologischen Grundeinkommens erklärt (1), um dann herauszuarbeiten, in welcher Weise es aus verschiedenen Sackgassen bisheriger Umweltpolitik herausführen kann (2). Doch es handelt sich längst nicht nur um eine geschickte Methode zur Vermeidung von Unzulänglichkeiten der Umweltpolitik, sondern könnte dem Green New Deal, der sich als hegemoniales Projekt zur gleichzeitigen Bearbeitung der ökologischen und ökonomischen Krise etabliert, zu einem libertären und deproduktivistischen Charakter verhelfen (3). Ein ökologisches Grundeinkommen hat zudem realutopischen Charakter. Es kann identitäre und materielle Interessen größerer Bevölkerungsteile verkörpern, so dass von einer potenziellen Hegemonie dieses Projekts gesprochen werden kann (4). Abschließend wird gezeigt, dass ein ökologisch finanziertes Grundeinkommen nicht nur der Schlüssel zum Schulterschluss von Ökologie- und Grundeinkommensbewegung ist, sondern sich besonders gut zu einer schrittweisen Einführung des Prinzips eines bedingungslosen Einkommens überhaupt eignet (5). 1 Ökologisches Grundeinkommen Ein ökologisches Grundeinkommen (ÖGE) ist ein Grundeinkommen, welches durch Abgaben auf unerwünschten Umweltverbrauch finanziert wird. Das Aufkommen dieser Nutzungsentgelte (etwa einer Öko-Steuer auf Rohstoffe, CO 2 -Emissionen, Flächenverbrauch etc.) wird gleichmäßig auf die Bevölkerung zurückverteilt. Jedem Bürger, vom Säugling bis zum Greis, von Reich bis Arm, wird damit ein Öko-Bonus bzw. ein ökologisches Grundeinkommen ausgezahlt. Es handelt sich also um die Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens über die Besteuerung einer bestimmten Form des Konsums desjenigen Konsums, der die Umwelt nach unseren gesellschaftlichen Vorstellungen in falscher Weise belastet, der dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung zuwiderläuft. Halt ist eine Finanzierung über die Verteuerung von Konsum nicht ungerecht gegenüber den Armen? Haben sie nicht am meisten zu leiden unter einer Erhöhung von Preisen für ihr tägliches Leben, denn die Nutzungsentgelte für Rohstoffe oder Emissionen werden über die Wertschöpfungsketten in die Endprodukte im Laden einfließen? Genau umgekehrt ist es: Wohlhabende haben einen höheren Konsum und damit in der Regel einen höheren Umweltverbrauch. Sie zahlen daher überdurchschnittlich, während sie durch die Pro-Kopf-Ausschüttung nur durchschnittlich von der Auszahlung profitieren, sind also Netto-Zahler. Ärmere und Kinderreiche hingegen gewinnen. Eine Reihe von Forschungsergebnissen sprechen für diesen Zusammenhang: Ein Vergleich deutscher Städte zeigt eine klare Abhängigkeit der CO 2 - Emission vom Pro-Kopf-Einkommen: Frankfurt etwa mit einem BIP von /Person emittiert 11,8 t pro Kopf und Jahr, Berlin mit einem BIP von /Person nur 5,6 t pro Kopf. 1 Die CO 2 -Emission ist ein relativ guter Indikator für den Gesamt-Ressourcenverbrauch, da hoher Materialeinsatz in der Regel auch energieintensiv ist. 1 Economist Intelligence Unit (2011): German Green City Index, P. 13
2 Das Infras-Institut Zürich verglich mit Hilfe ökonometrischer Simulationen die Wirkungen von verschiedenen Formen der Öko-Steuer und kam zu dem Ergebnis, dass eine Öko-Bonus-Lösung (also die paritätische Rückverteilung der Einnahmen) diejenige ist, die eine Umverteilung nach unten bedeuten würde. 2 Die Verbraucherzentrale NRW schlug 2008 die Einführung eines kostenlosen Strom-Grundfreibetrags von 250 kwh/person und Jahr vor, der durch einen höheren Strompreis finanziert werden sollte ( Stromspartarif ). Dieser Vorschlag stellt nichts anderes als eine Konkretion des Prinzips Öko-Bonus beim Stromkonsum dar. Eine Studie des Wuppertal-Instituts untersuchte die Wirkung dieser Tarifstruktur auf Haushalte, die von Sozialtransfers leben: 80% würden sich besser stellen als vorher. 3 Der Grund: Auch der Stromverbrauch steigt in der Regel mit dem Einkommen. Natürlich gibt es immer wieder auch Gegenbeispiele. Es gibt Ärmere, die besonders verschwenderische Konsumpraktiken haben und höher belastet wären. Und es gibt Reichere, die besonders Wert auf sparsamsten Umgang legen. Genau das ist aber auch Teil des dem ökologischen Grundeinkommens zugrunde liegenden Prinzips des Tax and Share : Für alle bleibt der preisliche Anreiz bestehen, mit weniger Umweltverbrauch hergestellte und daher billigere Güter vorzuziehen. Und für alle bleibt auch der preisliche Anreiz bestehen, einmal die Null-Option in Erwägung zu ziehen also bestimmte schädliche Konsumtionen gänzlich sein zu lassen. 2 2 Aus den Sackgassen der Umweltpolitik Das ökologische Grundeinkommen (ÖGE) ist eine Antwort auf eine Reihe von grundlegenden Problemen, wenn nicht gar Aporien bisheriger Umweltpolitik. Erstens: Das ÖGE führt aus dem Dilemma ökonomischer Instrumente der Umweltpolitik ohne Sozialausgleich: Ist der Ökosteuer-Satz zu niedrig, bewirkt er nichts. Ist er zu hoch, wird er unsozial. Hier ist es umgekehrt: Je höher die Sätze werden, desto größer wird der Umverteilungseffekt, und zwar international genauso wie intranational. Das Verfahren kann auf jeder räumlichen Ebene angewendet werden. Solange es etwa keine global verbindlichen Übereinkünfte gibt, kann auch eine Nation alleine damit beginnen, ihre zulässige Umweltnutzung durch Steuern bzw. Zertifikateverkauf zu begrenzen und durch die Rückverteilung der Einnahmen einen Umverteilungseffekt bei sich erreichen. Zweitens: Ein ÖGE fördert ökologische Genügsamkeit, ohne bestimmte Lebensstile zur Norm zu erheben. Als soziale gerechtere Alternative zu ökonomischen Instrumenten der Umweltpolitik wird häufig von linker Seite verstärkte Ordnungspolitik eingefordert, die über das Setzen von Grenzwerten für die Produktion hinausgeht. Die Politik soll umweltschädliche, unnötige Konsumtionen schlicht und einfach verbieten. Ins Visier genommen werden dabei zuallererst die mit einem hohem symbolischen Luxus-, Schwachsinns- und Schädlichkeitsfaktor belegten Produkte wie Geländewagen, Südfrüchte, Fernreisen etc. Aber tendenziell alle ökologisch fraglichen Konsumtionen von unnötigen Autofahrten bis hin zu 2 3 Infras (o.j.): Soziale und räumliche Wirkung von Energieabgaben. Studie im Auftrag des Bundesamtes für Energie, Z-1 Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie; Ö-Quadrat (2008): Ökologische und ökonomische Konzepte: Kurzgutachten Stromspartarif
3 farbigem Toilettenpapier sollen für alle untersagt werden. Dies ist sozial, weil es jeden gleich trifft und möglicherweise auch ökologisch zielführend, schränkt aber die individuelle Freiheit unzulässig ein. Wir können nicht im Detail vorschreiben, welche Fahrzeuge zu welchen Anlassen wann benutzt werden dürfen, welche Möbel in welchen Wohnungen aufgestellt werden dürfen bei wie viel Kindern, welche Speisen aus welchen Ländern ich zu welchen Anlässen in welcher Menge zu mir nehmen darf etc. Das alles und noch viel mehr müsste nämlich festgelegt werden. Von welchem Standpunkt aus aber kann welcher Lebensstil untersagt bzw. gestattet werden? In welchen auch nur halbwegs demokratischen Verfahren sollte dies geschehen? Aus der Akzeptanz der Pluralität der Lebensstile in der Moderne folgt vielmehr, dass Regeln abstrakter werden müssen. Wenn wir nicht alles im Detail regeln können und wollen, kann dies nur über den Preis von Umweltnutzungen gehen. Nur er ermöglicht den Individuen eine der Modernen angemessene Handlungsfreiheit bei gleichzeitiger Setzung einer Grenze seines Gesamt- Umweltverbrauchs. Durch ein ÖGE wird die Akzeptanz verschiedenster Lebensstile gewahrt, die im Rahmen der ökologisch-monetären Beschränkung gelebt werden können. Bestimmte Konsumtionen werden zwar unattraktiver, können aber einzeln bzw. in Maßen weiter vollzogen werden. Die umverteilende Wirkung des ökologischen Grundeinkommens sorgt dafür, dass diese individuelle Freiheit nicht auf Wohlhabende beschränkt bleibt, sondern sich im Gegenteil für alle Bevölkerungsteile eröffnet. Drittens: Ein ÖGE ermöglicht ökonomische Sicherheit im ökologischen Umbau der Wirtschaft. Wie viele eigentlich als ökologisch schädlich oder als sozial zweifelhaft längst erkannte Produktionen werden heute nolens volens akzeptiert, wenn nicht sogar gefördert, weil daran in der arbeitsplatzfokussierten Regulation der kapitalistischen Ökonomie elementar die persönliche Existenz gekoppelt ist? Die für eine Akzeptanz der mit dem ökologischen Umbau der Wirtschaft verbundenen tiefgreifenden Wandel von Arbeitsplätzen, - strukturen und -qualifikationen nötige sozialpsychologische Situation ist Angstfreiheit im Wandel. Während in den hegemonialen Konzeptionen zur besseren Bearbeitung der ökologischen und ökonomischen Krise wie dem Green New Deal die Sorgen der Menschen mit der Aussicht auf neue Arbeitsplätze beruhigt werden sollen, besteht das Konzept des ÖGE in der Garantie sozialer Sicherheit einer sozialen Sicherheit unabhängig von Wirtschaftswachstum! Die durch das Grundeinkommen bewirkte größere Wahlfreiheit des Einzelnen auf dem Arbeitsmarkt ist nicht nur emanzipatorischer Fortschritt, sondern auch ein ökologisches Plus: Der Zwang zu ökologisch problematischen ökonomischen Aktivitäten wird dann geringer. Viertens: Ein ÖGE kann einen ökologisch-kulturellen Wandel auch für breitere Schichten attraktiv machen. In der ökologischen Debatte wird seit langem ein ressourcenleichter Lebensstil propagiert. Offensichtlich kommt dieser seit 20 Jahren von vielen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Institutionen mit viel medialem Aufwand betriebene Appell aber jenseits kleiner avantgardistischer Gruppen nicht an. Ein ressourcenleichter Lebensstil besteht aus zwei Komponenten, dem anders und dem weniger Konsumieren. Soll dieses Weniger nicht nur für Randgruppen attraktiv sein, so muss die Gesellschaft insgesamt weniger herrschaftsförmig werden. Ein genügsamerer Lebensstil, eine Eleganz der Einfachheit kann sich nur entwickeln auf der Basis eines freiheitlichen Lebensalltags. Wer unten ist oder sich in welcher Weise auch immer unterdrückt fühlt, wer ständig ein Gefühl der Knappheit empfindet, wer seine Arbeit als entfremdet wahrnimmt, wird sich nicht zu neuer Bescheidenheit überzeugen lassen. Er braucht vielmehr zur Kompensation 3
4 demonstrativen Status-Konsum, entschädigende Erlebniswelten, führt Aufholjagden etc. Eine massenweise Hinwendung zum Weniger hat dann eine Chance, wenn sie nicht als mühsame, aber unvermeidbare Änderung daherkommt, sondern als Befreiung aus beengenden, stressigen, sozial isolierenden Verhältnissen ihre Attraktivität entfaltet. Bestandteil einer solchen Vision wäre etwa Zeitwohlstand, wäre etwa ein Leben in mehr frei gewählten Gemeinschaften, wäre ein Leben mit mehr individuellen Freiräumen, aber weniger Konsum- und Erwerbsdruck. Das ÖGE erleichtert es allen, aus der Tretmühle Erwerbsarbeit - Konsum Erwerbsarbeit, zunächst einmal auf Probe auszusteigen. Neue Lebensstile des Weniger, des Zeitwohlstands, der stärkeren Orientierung auf nicht-monetäre Eigen- und Gemeinschaftsarbeit anstatt Erwerbsarbeit hätten eine Chance, auch jenseits von Randgruppen ausprobiert und geschätzt zu werden. Die zweite Komponente eines ressourcenleichten Lebensstils ist das Anders, also der Konsum weniger umweltbelastender Alternativprodukte. Hierzu ist die ökologische Finanzierung des Grundeinkommens nicht nur passend, sondern eine notwendige Voraussetzung. Eine Kritik aus ökologischer Sicht gegen das Grundeinkommen lautet bekannterweise, dass dann mit der größeren Massenkaufkraft mehr umweltschädliche Dinge gekauft werden. Genau dies wird durch die Änderung der relativen Preise durch die ökologischen Steuern vermieden: Produkte mit großen ökologischen Rucksack werden teurer als ihre umweltfreundlichen Alternativen. Während die Argumente, die auf Sicherheit im sozial-ökologischen Wandel zielen, für das bedingungslose Grundeinkommen generell gelten, sind die anderen Gesichtspunkte nur mit dem ökologischen Grundeinkommen zu erreichen. Das ÖGE hat also das Potenzial, gleich aus mehreren Aporien der Umweltpolitik herauszuführen. Es kann die Ökosteuer sozial machen, es erhält die Freiheit des Lebensstils trotz ökologischer Einschränkungen, es verschafft massenweise Akzeptanz für den bedrohlich erscheinenden ökologischen Strukturwandel der Wirtschaft, es eröffnet Räume für genügsame Lebensstilorientierungen jenseits kleiner Randgruppen. Dies alles sind Argumente, die das ÖGE instrumentell, als geschickte und richtige Methode zur Vermeidung von Sackgassen der Umweltpolitik begründen. Die dem ÖGE zugrundeliegende Idee des Tax and Share kann aber auch eigentumsphilosophisch, über das Besitztum aller Menschen an der Erde und ihren natürlichen Ressourcen legitimiert werden. Eine erste Idee dazu findet sich schon bei Thomas Spence im Jahre Für landwirtschaftliche Nutzung sollte eine Bodenrente bezahlt werden, von der zwei Drittel regelmäßig an alle Bewohner, die Jungen wie die Alten gleichermaßen regelmäßig auszuzahlen sei. Seine Ausgangsdiagnose war, dass nicht alle die Möglichkeit hätten, auf der Basis von Landbesitz von den Bodenerträgen durch Landwirtschaft zu leben, die Erde aber allen gehöre. Folglich habe jeder einen Anspruch auf einen Anteil dieser Erträge, die erst durch die Nutzung der Natur entstehen würden. Eine aktualisierte, sozusagen auf sämtliche knappe Ressourcen der Erde übertragene Form dieses Grundgedankens findet sich bei Peter Barnes ( Kapitalismus 3.0 ) mit seiner Idee eines Sky Trust. 4 Auch sein Ausgangspunkt ist die Annahme, dass die natürliche Umwelt mit ihrer Atmosphäre, ihren Ressourcen und ihren Senken ein Gemeingut aller Erdenbürger darstellt. Wer dieses Gemeingut 4 4 Barnes, Peter (2008): Kapitalismus 3.0. Ein Leitfaden zur Wiederaneignung der Gemeinschaftsgüter, Hamburg
5 nutzen will, hat die Eigentümer um Erlaubnis zu fragen. Bei ökologisch problematischen Nutzungen wie etwa CO 2, Flächen, Metalle etc werden über den Sky Trust Gebühren erhoben, die allen Erdenbürgern zustehen. 5 3 Ein libertärer und antiproduktivistischer Green New Deal Bisher ist das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) im Wesentlichen als Antwort auf die Krise des Wohlfahrtsstaates und die Krise der Erwerbsarbeit diskutiert worden. Claus Offe etwa sieht im BGE das Potenzial, Strukturprobleme und Gerechtigkeitslücken fortgeschrittener Industriegesellschaften in einer prononciert freiheitlichen (,links libertären, der Grundnorm gleicher realer Freiheit verpflichteten) Weise zu bewältigen. Die zentralen Strukturprobleme sind für ihn zum einen das Produktionsproblem, das durch die institutionell geregelte Beantwortung der Frage gelöst wird, welche Personen welche Arbeitsaufgaben übernehmen sollen und zum anderen das Verteilungsproblem: Wer hat, gleichsam nach getaner Arbeit, einen Anspruch auf welchen Teil des Produkts. 5 Jürgen Habermas sieht das BGE als revolutionären Schritt zur Bändigung der Systeme Ökonomie und Staat, um den Bann zu brechen, den der Arbeitsmarkt über die Lebensgeschichte aller Arbeitsfähigen verhänge. 6 Diese beiden prominenten Autoren seien hier nur beispielhaft genannt in der gesamten das BGE protegierenden Literatur fokussiert sich die Argumentation auf Probleme des Sozialstaats und der Arbeitsgesellschaft. Seltsam unterbelichtet bei all diesen Betrachtungen bleibt die ökologische Frage. Dabei ist die Krise fortgeschrittener Industriegesellschaften auch eine Krise des gesellschaftlichen Naturverhältnisses. Der fordistische Wohlfahrtsstaat konnte seine den Sozialstaat stabilisierenden Wachstumsraten nur auf der Basis einer fast rücksichtlosen Ausbeutung natürlicher Ressourcen und Senken realisieren. Die fordistische Regulationsweise mit seiner ständig steigenden industriellen Massenproduktion ist in den 1970er Jahren nicht nur durch Probleme der Sozialstaatsfinanzierung ins Wanken geraten, sondern auch durch steigende Kosten für die Nutzung natürlicher Ressourcen, die Vermeidung von Schädigungen der Umwelt oder deren Restaurierung. Man denke z.b. an die Ölkrise In der den Fordismus beerbenden Phase der neoliberalen Regulation konnten freilich die Strukturprobleme der Arbeitsgesellschaft ebenso wenig dauerhaft gelöst werden wie die Strukturprobleme des gesellschaftlichen Naturverhältnisses. Zwar sind seit den 1980er Jahren Fragen des Umweltschutzes erstmals breiter in Politik und Gesellschaft bearbeitet worden und Bestandteil der Regulationsweise dieser Phase des Kapitalismus geworden. Umweltpolitik ist allerdings nur insoweit in die politische Ökonomie eingeflochten worden, wie sie kompatibel war mit den neoliberalen Dogmen der Privatisierung, der Deregulierung, mit dem liberalen Produktivismus: Umweltschutz darf das Wachstum und den Wettbewerb nicht gefährden die Betriebe dürfen also keine allzu starken Auflagen oder Besteuerungen bekommen, die Konsumprodukte dürfen nicht zu teuer werden. 5 6 Offe, Claus (2009): Das bedingungslose Grundeinkommen als Antwort auf die Krise von Arbeitsmarkt und Sozialstaat, S. 21. In: Neuendorf/Peter/Wolf (Hg.): Arbeit und Freiheit im Widerspruch?. Bedingungsloses Grundeinkommen ein Modell im Meinungsstreit. Hamburg. Habermas, Jürgen (1985): Die Krise des Wohlfahrtsstaates und die Erschöpfung utopischer Energien, S In: Die neue Unübersichtlichkeit. Frankfurt,
6 Heute wird einer kritischen Öffentlichkeit klar, dass der Neoliberalismus nicht nur die Finanzkrise ermöglicht hat, sondern auch einer besseren Bearbeitung der ökologischen Frage im Wege steht: Eine durch Deregulierung forcierte Globalisierung der Produktion erhöht den Energieverbrauch durch Transportprozesse und verunmöglicht die Durchsetzung ambitionierter Umweltstandards; die Herrschaft der Finanzmärkte lenkt die Kapitalströme auf kurzfristige Gewinne statt auf die Entwicklung nachhaltiger Produktionsverfahren; die soziale Polarisierung unterläuft die Bereitschaft zur solidarischen Teilung ökologischer Lasten etc. Die oben diskutierten Probleme der Umweltpolitik sind zwar schon im Fordismus wirksam, werden aber durch diese neoliberale Regulation noch mal verschärft: Bei verstärkter sozialer Polarisierung ist eine Besteuerung von problematischem Umweltverbrauch noch schwieriger zu legitimieren und gilt die Propagierung genügsamer Lebensstile als Trick 17 der Oberen; bei der Herrschaft der Finanzmärkte mit jederzeit unberechenbaren Folgen für den eigenen Arbeitsplatz kann sich ein Gefühl der Sicherheit im Wandel schwerlich einstellen etc. Als hegemoniale Antwort zur gleichzeitigen Bearbeitung von Wirtschafts- und Ökokrise schält sich die Idee eines Green New Deal heraus. Die Kernidee besteht darin, einen staatlich gestützten Innovations- und Investitionsschub bei grünen Technologien auf einem grünen Markt zu erreichen. Das dadurch induzierte wirtschaftliche Wachstum soll gleichzeitig ökologischen Fortschritt bringen, da mit den neuen Technologien weniger Umwelt verbraucht und geschädigt werde. Diese Idee wurde zunächst von der Partei DIE GRÜNEN, grünen Think Tanks und NGOs in die Debatte gebracht. Sie wird jedoch zunehmend mehrheitsfähig in der gesamten politischen Klasse, wenn auch andere Bezeichnungen verwendet werden. Green New Deal ist jedoch nicht gleich Green New Deal. Ganz unterschiedlich wird die soziale Seite des Deals sowie die Wachstumsfrage konzipiert. Hier lassen sich drei Ansätze unterscheiden. Im Green New Deal der Grünen, der Heinrich-Böll-Stiftung 7 u.a. besteht der Deal in der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen und dem dazugehörigen Empowerment der Arbeitnehmer, die aus den Alt-Industrien herausgedrängt sind oder es noch werden. Durch Erhöhung der Bildungsausgaben und -chancen sollen die von Ausschließung Bedrohten wieder in die (Arbeits-)Gesellschaft hereingenommen werden. Dies ist gleichzeitig funktional notwendig, denn die neuen grünen Arbeitsplätze erfordern ungemein höhere Qualifikationen als die alten massenindustriellen Fertigungslinien. Die soziale Frage als Verteilungsfrage hingegen gilt als weitgehend gelöst, eben durch den historisch längst vollzogenen New Deal. Die Induktion eines grünen Marktes durch Bepreisung von als schädlich angesehenen Umweltnutzungen wie etwa CO 2 -Emissionen, Verschmutzungen verschiedener Umweltmedien, Rohstoffverbräuchen etc erfordert daher allenfalls ein paar Maßnahmen zur Linderung besonderer Härten. Der sozial-ökologische New Deal oder Pakt für nachhaltige Entwicklung, Vollbeschäftigung, soziale Sicherheit und Umweltschutz 8, wie ihn etwa linke Parteien oder Gewerkschafter fordern, basiert ebenso auf dem Mix von staatlichen Investitionen einerseits und der staatlichen Anregung von privaten grünen Investitionen andererseits. Diese Investitionen sollen jedoch primär durch ordnungsrechtliche Gebote und Verbote über zulässige Techniken und Grenzwerte Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.) (2009): Auf dem Weg zu einem Green New Deal. Die Klima- und die Wirtschaftskrise als transatlantische Herausforderungen. Berlin. Europawahlprogramm der Partei DIE LINKE 2009
7 angestoßen werden. Der zweite Unterschied besteht in der Rolle von Umverteilung von Arbeit und Einkommen, etwa der 30-Stunden-Woche als Normalvollarbeitszeit bei Lohnausgleich, einer hohen sozialen Sicherung, Mindestlöhnen etc. Die Umverteilung löst gleichzeitig den Knoten im Investitionsstau, da die bisher schwache Binnennachfrage angeregt wird. Finanziert werden soll dies durch höhere Steuern für Wohlhabende und Unternehmen. Gemeinsam ist diesem Sozialen Green New Deal der Linken und dem Green New Deal der Grünen allerdings die Hoffnung auf Wirtschaftswachstum als Löser von Wirtschaftskrise und ökologischer Krise. Eine dritte Variante wird in der Studie des Wuppertal-Instituts Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt dargelegt. Im Rahmen eines neuen Gesellschaftsvertrags sind die Bürger als Unternehmer und Konsumenten aufgerufen, einen Teil ihrer Kapital- und Komfortmacht an die Natur und die Schlechtergestellten auf dem Globus abzutreten. 9 Die Menschen im Norden bzw. die globale Konsumentenklasse sollen ihren Lebensstil in Richtung Genügsamkeit ändern, anstatt das bisherige Wohlstandsmodell mit neuer Umwelttechnologie zu verlängern. Im Unterschied zu den Varianten des Green New Deal mit Wachstum wird die Verteilungsfrage deshalb gestellt, weil die Autoren offensichtlich eine andere Einschätzung der Vereinbarkeit von Wirtschaftswachstum mit einem nachhaltigen gesellschaftlichen Naturverhältnis haben: Die Wachstumsorientierung steht in starker Spannung zur Nachhaltigkeit. Zukunftsfähigkeit erfordert deshalb, schon heute vorsorgend Wege zu einer Wirtschaftsweise einzuschlagen, die allen Bürgern ein gedeihliches Leben sichert, ohne auf ständiges Wachstum angewiesen zu sein. 10 Dieses Konzept kann als Sozialer Green New Deal ohne Wachstum bezeichnet werden. Ein ÖGE könnte ein zentrales Element des dafür vorgeschlagenen Gesellschaftsvertrages sein. Durch die Besteuerung von Umweltverbrauch würden die Bürger einen Teil ihrer Komfortmacht an die Natur (durch das Weglassen bestimmter Konsumtionen) und an die Schlechtergestellten (durch die Auszahlung an jeden) abgeben. Aber ein ÖGE ist mehr als ein Umverteilungsmodell. Mit einem ÖGE kann der Green New Deal einen libertären Charakter erlangen, da die Spielräume zur Gestaltung eines eigenen Lebensplans für alle, nicht nur die Begüterten, größer werden. Mit dem ÖGE wird der Green New Deal zudem antiproduktivistisch, denn es bewirkt neben der Förderung technologischer Alternativen mit geringerem Ressourceneinsatz einen Rückgang ökonomischer Aktivitäten. Zum einen verteuert es Konsum, zum anderen wird aufgrund eines steigenden Anteils sozialer Sicherung eine Arbeitsaufnahme unattraktiver ob als Arbeitnehmer oder Selbständiger. Neben den technischen Wegen der Effizienz und der Konsistenz (Verträglichkeit anthropogener und natürlicher Stoffkreisläufe, z.b. Kreislaufwirtschaften) wird auch der nicht-technische Weg der Suffizienz, d.h. der Genügsamkeit gefördert. Das Verhältnis von technischem und nicht-technischem Weg kann nicht vorausgesagt werden. In jedem Fall aber hat das ökologische Grundeinkommen eine deproduktivistische Komponente und ist damit Bestandteil einer Postwachstumsökonomie. Die deproduktivistische Wirkung läuft der Finanzierungsfunktion für das Grundeinkommen nicht entgegen. Werden weniger BUND, EED (Hg.) (2008): Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt, Frankfurt a.m., S. 607 BUND, EED (Hg.) (2008): Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt. Einblicke. S. 25
8 Güter konsumiert und produziert, was aus ökologischen Gründen erwünscht ist, kann das Aufkommen dennoch gleich bleiben oder sogar steigen: Durch die sukzessive Erhöhung der Steuersätze. Die Aufrechterhaltung des Ausschüttungsvolumens erfordert also nicht die Aufrechterhaltung einer bestimmten Menge einer unerwünschten, umweltbelastenden Produktion, wie einige Kritiker einwenden. Zusammengefasst kann gesagt werden: Ein ÖGE als Kern eines libertären und antiproduktivistischen Green New Deal würde nicht nur eine höhere Stufe des Sozialstaats konstituieren, sondern auch eine höhere Stufe des Umweltstaates. Eine höhere Stufe deswegen, weil ganz im Sinne von Offe die Strukturprobleme der Arbeit und die Strukturprobleme der Umwelt im Sinne der Grundnorm gleicher realer Freiheit gelöst würden. Eine höhere Stufe deswegen, weil ganz im Sinne von Habermas die Dominanz der Systeme Markt und Staat über die Lebenswelt zurückgedrängt wäre. Fraglich ist natürlich, ob durch ein ÖGE die drei gesellschaftlichen Bereiche Lebenswelt, Markt und Staat tatsächlich in eine neue Balance, wie Habermas hofft, gebracht werden könnten. Oder aber ob nicht ständig mit einer Kolonialisierung der Lebenswelt, also zerstörenden Grenzüberschreitungen der geld- und machtgesteuerten Systeme Markt und Staat gegenüber der von ihnen befreiten Sphäre des Grundeinkommens zu rechnen ist. Könnte sich so wäre zu fragen - das Regulierungsprinzip Ökologisches Grundeinkommen gegen die damit eingeschränkten Profitansprüche dauerhaft im Rahmen einer stabilen neuen Entwicklungsphase des Kapitalismus behaupten? Vielleicht hat aber auch ein ökologisches Grundeinkommen eine derart wachstumshemmende Wirkung, die eine Integration in eine stabile Entwicklungsweise des Kapitalismus nicht zulässt Um diesen Fragen näher zu kommen, könnte etwa der Regulationsansatz als eine Theorie des Wandels der gesellschaftlichen Konstitution der Ökonomie des Kapitalismus neu angewendet werden. In diesem Zusammenhang wäre Kapitalismus sicher auch erst einmal genauer zu definieren. Kann man noch von Kapitalismus sprechen, wenn die Kapitaldominanz durch entsprechende gravierende Regulierungen wie ein ÖGE zurückgedrängt ist? 8 4 Ein hegemonialer Block ist möglich Doch jenseits solcher akademischer Fragestellungen gilt es, die Durchsetzungschancen eines ÖGE in den Blick zu nehmen. Zunächst kann die Idee des ÖGE die Grundeinkommensbewegung mit größeren Teilen der Umweltbewegung zusammenführen, die die oben beschriebenen Aporien der Umweltpolitik vergegenwärtigen und an ihrer Überwindung ein starkes Interesse haben. Dieses Bündnis allein würde einen großen Schritt nach vorn bedeuten. in ÖGE hat aber auch darüber hinaus ein hegemoniales Potenzial. Die gleichzeitige soziale, ökologische und emanzipative Qualität eines ÖGE lässt zumindest auf die Möglichkeit einer breiten Zustimmung durch einen hegemonialen Block schließen. Als hegemonialen Block definiert der Regulationstheoretiker Alain Lipietz (in Anlehnung an Gramsci) eine Koalition sozio-ökonomisch konstituierter Gruppen, die ihr»projekt«als dasjenige der Gesamtgesellschaft legitimieren und es urch realisieren können. Ein hegemonialer Block stellt einen weitreichenden Konsens dar. Er muss eine so große Ausdehnung haben, dass diejenigen, deren Interessen unberücksichtigt werden, sehr minoritär sind. Der Konsens fußt auf der Berücksichtigung sozial-psychologischer, materieller und ideologischer Bedürfnisse:
9 Innerhalb eines hegemonialen Blocks müssen die Individuen ihre Identität, ihre Interessen und Meinungsverschiedenheiten ausdrücken können. 11 Im Sinne einer ersten vorsichtigen Annäherung soll hier nur angedeutet werden, in welcher Weise ein ÖGE mit bestehenden Konsumstilen, Identitäten und Wertorientierungen wesentlicher gesellschaftlicher Schichten, wie sie etwa in den Sinus-Milieus 12 für Deutschland herausgearbeitet worden sind, aufweisen könnte. Ein ÖGE erhöht kurz gesprochen die Realisationschancen für ressourcenschonende, postmaterielle Aktivitäten jenseits der Erwerbsarbeit. Die Sinus-Studie kennt mindest vier Milieus mit einem Bevölkerungsanteil von insgesamt ca. 35%, deren Identität und deren Wertorientierungen deutlich in diese Richtung gehen. Da sind zunächst die modernen Performer (10%), die junge, unkonventionelle Leistungselite. Ihr Ehrgeiz bezieht sich auf das eigene Ding, jenseits des materiellen Erfolges. Ihr Konsumstil ist durch die Lust am Besonderen, an Kultur und Multimedia geprägt, außerdem gibt es großes Interesse an sportlicher Betätigung. Die Experimentalisten (9%), die individualistische neue Boheme aus der Mittelschicht, haben große Lust am Leben und Experimentieren, gehen kreativen Tätigkeiten nach. Ihnen ist materieller Erfolg weniger wichtig und ihr Hauptinteresse richtet sich auf Musik, Kunst, Kultur und Bücher. Die Postmateriellen (10%), das aufgeklärte Nach 68er-Milieu mit liberaler Grundhaltung, postmateriellen Werten und intellektuellen Interessen, richtet seine Ansprüche auf die Entfaltung von individuellen Bedürfnissen und Neigungen, auf das Schaffen von Freiräumen für sich und auf mehr Zeitsouveränität. Überflüssigen Konsum lehnen sie ab, sie schätzen subtile Genüsse, die ihren Preis haben dürfen, kaufen selektiv nach dem Motto Weniger ist mehr. Etwas schwieriger wird es mit den Hedonisten (11%), den Spaßorientierten aus der modernen Unterschicht. Sie verweigern zwar Konventionen und Verhaltenserwartungen der Leistungsgesellschaft, sind aber stark konsumorientiert, vorzugsweise an Unterhaltungselektronik, Klamotten und Autos. Ein ÖGE kommt ihrer hedonistischen Leistungsskepsis entgegen, kollidiert jedoch mit ihren Konsumbedürfnissen, da diese sich verteuern könnten. Ebenso indifferent derartigen Transformationsprojekten gegenüber verhalten könnte sich die bürgerliche Mitte (15%), der statusorientierte moderne Mainstream mit Streben nach beruflicher und sozialer Etablierung, nach gesicherten und harmonischen Verhältnissen. Ein ÖGE wird möglicherweise als Bedrohung der eigenen Leistungsbereitschaft und des verdienten Lohnes gesehen, kann aber genauso gut auch als Schritt zu mehr Lebenssicherheit, als Sicherung gegen sozialen Abstieg gewertet werden. Auch die Konservativen (5%), das alte Bildungsbürgertum mit humanistisch geprägter Pflichtethik und erhöhtem Abgrenzungsbedürfnis, hätte einerseits Gründe für Vorbehalte, etwa gegen leistungslose Einkommen, andererseits beinhaltet ihre konservative Kulturkritik die Ablehnung von Konsumorientierung bzw. die Betonung von immateriellen Werten und sozialem Engagement, welches etwa durch das ÖGE befördert wird. Widerstände hingegen sind eher zu erwarten von den Traditionsverwurzelten (14%) in der kleinbürgerlichen und traditionellen Arbeiterkultur, den Konsum-Materialisten (12%), der materialistisch geprägten Unterschicht, die über Konsum soziale Benachteiligungen zu kompensieren versuchen sowie den Etablierten (10%) mit einer Erfolgs-Ethik und Exklusivitätsansprüchen Lipietz, Alain 1998 (1985): Das Nationale und das Regionale. In: Lipietz, Alain 1998: Nach dem Ende des goldenen Zeitalters: Regulation und Transformation kapitalistischer Gesellschaften. Hamburg Sinus-Institut 2009;
10 Die hier im Schnelldurchgang durch gesellschaftliche Milieus nur angedeutete und abgeleitete (und keineswegs empirisch verifizierte) Stellung derselben zum Projekt ÖGE, zeigt, dass zumindest in erster Näherung eine gute Chance für die Anschlussfähigkeit an vorhandene identitäre Bedürfnisse und Wertorientierungen vorhanden ist. Um einen neuen hegemonialen, einen historischen sozialen Block zu konstituieren, müssen auch materielle Interessen (nicht gleichzusetzen mit Interessen an materiellem Konsum) der tragenden Gruppen hinreichend berücksichtigt sein. Auch hier hat das Projekt eines ÖGE keine schlechten Karten: Es bedeutet erstens direkte Umverteilung nach unten (s.o.). Zweitens bewirkt ein Grundeinkommen aus ökologischer Besteuerung eine enorme Verbesserung der Position auf dem Erwerbsarbeitsmarkt. Auch dies hat einen umverteilenden Aspekt. Sind elementare Dinge des Lebens bereits gesichert, wird Erwerbsarbeit besser vergütet werden müssen. Dies gilt vor allem für schwere Arbeit verschiedenster Natur sowie für solche, deren Produkt vom Erbringer als weniger sinnvoll angesehen wird. Andersherum wird es auch mehr Tätigkeiten für wenig Geld bis hin zum Nulltarif geben. Etwa, wenn sich jemand selbst verwirklichen möchte, oder aber für Andere oder seine Gemeinschaft etwas Gutes tun möchte. Die Übergänge werden fließend sein und das ist auch richtig so angesichts vielfältiger Arbeitsmotivationen, die irgendwo auf dem Kontinuum zwischen reinem Geldinteresse und reiner Selbstverwirklichung oder reiner Nächstenliebe angesiedelt sind. Es kommt also gleichzeitig zu einer höheren Bewertung sowie einer Dekommerzialisierung von Arbeit. Drittens ist das Ganze mit einer Reduzierung von Umweltverbrauch verbunden, verbessert also eine nicht minder wichtige materielle Lebensbedingung den Erhalt der natürlichen Umwelt. Im Prinzip alle gesellschaftlichen Gruppen und Milieus haben also einen materiellen Nutzen. Die Besserverdienenden büßen zwar Konsumtionsrechte ein, erhalten aber im Gegenzug eine Verbesserung ihrer natürlichen und sozialen Umwelt ein neuer Gesellschaftsvertrag (s.o.) könnte hier auf den Plan treten. Nur wenige wären in diesen hegemonialen Block nicht integriert. Etwa diejenigen, die weiter auf ein Arbeitseinkommen oder auf Profit aus ökologisch und sozial zweifelhaften, aber zurückgedrängten Branchen wie etwa Kohle, Auto, bestimmte Teile des Finanzwesens etc. setzen und einen Wechsel in andere Branchen, etwa der Kultur etc ablehnen. Nicht integriert wären auch diejenigen, die den auf Grundeinkommensbasis leichter möglichen Lebensstilen mit mehr Gemeinschaft, mehr Zeit, aber weniger Geld nichts abgewinnen können. Der großen Mehrheit aber kann eine solche Transformation Antworten geben auf konkret erfahrene soziale, emanzipatorische und ökologische Unzulänglichkeiten liberalisierter Marktökonomien, unter denen viele Menschen aus unterschiedlichsten Schichten und Milieus in unterschiedlichen Formen leiden: Nicht nur Arme empfinden die zunehmende materielle Spaltung als drückend. Nicht nur Mütter und Väter können angesichts zunehmender Ungleichverteilung von Arbeit ihre Lebensansprüche nicht mit den Anforderungen ihrer Erwerbstätigkeit vereinbaren. Nicht nur die neuen Selbständigen leiden unter dem Zwang, ihre kreativen Fähigkeiten für zweifelhafte Nachfragen verkaufen zu müssen. Nicht nur ökologisch Engagierte sehen zunehmend die Wachstumslogik als Ursache für das Unterlaufen partieller ökologischer Fortschritte. Das Transformationsprojekt eines ökologischen Grundeinkommens ist aber auch deswegen hegemoniefähig, weil es die zu Recht positiv gewerteten Freiheiten und Potenziale des Marktes nicht aufhebt. Das Wirtschaften und Leben wird nicht unter den problematischen Primat einer direkten 10
11 Vergesellschaftung durch Planung im Rahmen von Gemeinschaften oder aber gar Gesamtgesellschaften gestellt. Vielmehr können sich die emanzipatorischen Gehalte der Wahlfreiheit, der Flexibilität, der nicht-hierarchischen Koordination im Rahmen sozial-ökologischer Regulierung erst richtig entfalten Mit dem ÖGE einsteigen Eine potenzielle Hegemonie für ein ÖGE heißt noch nicht, dass ein Vorschlag zu seiner Einführung jetzt mehrheitsfähig wäre. Wir können nicht auf ein System- Hopping des Sozialstaates setzen, bei dem irgendwann auf einmal ab Montag früh das existenzsichernde bedingungslose Grundeinkommen gilt und alle anderen sozialen Sicherungssysteme abgeschaltet werden. Die Wirkung eines derartig abrupt wirkenden sozio-ökonomischen Groß-Experiments am lebendigen Körper der Gesellschaft ist zu unberechenbar sind doch das gesamte ökonomische Gefüge, die Preise, der Arbeitsmarkt, die Nachfrage und die Produktion plötzlich völlig neuen Bedingungen ausgesetzt. Die Angst von Politik und Bürgern vor einem solchem Crash wäre unüberwindbar. Allenfalls in einer existenziell bedrohlichen Krisenlage oder einer Post-Katastrophensituation (z.b. nach einem Krieg) ist ein derartig abrupter Neuanfang denkbar. Darauf sollten wir nicht hoffen. Neue Paradigmen lassen sich in der Regel nur über Prototypen und kleine Einstiegsprojekte etablieren. Ein ÖGE eignet sich hervorragend zu einer solchen schrittweisen Einführung. Es kann klein begonnen werden, um das Prinzip zunächst als solches zu verankern. Ein ÖGE kann langsam parallel zur bisherigen sozialen Sicherung aufgebaut werden. So kann Sicherheit im Wandel entstehen, so bleibt ausreichend Zeit für Anpassungsprozesse. Mit dem Prinzip des Tax and Share könnte auf verschiedenen Ebenen und bei verschiedenen Umweltmedien begonnen werden: Die Einnahmen aus den ab 2013 verstärkt zu versteigernden (und nicht mehr zu verschenkenden) Zertifikaten im Rahmen des EU-Emissionshandels werden auf ca. 10 Mrd. /Jahr geschätzt. Werden sie pro Kopf ausgeschüttet, bekommt eine 4-köpfige Familie 500 /Jahr Öko-Bonus bzw. ökologisches Grundeinkommen. Es ist zu erwarten, dass sich die Einnahmen durch Verringerung der ausgegebenen Mengen (Cap) erhöhen. Bei einer Verdopplung der Einnahmen bekommt jeder 250 im Jahr. Würde die Ökosteuer in Deutschland so erhöht, dass die Endpreise für Strom und Brennstoffe um 10% steigen, könnte dieser Familie zusätzlich im Jahr ausgezahlt werden, bei einem Anstieg bis zu 50% wären es bzw /Person Es könnte eine Steuer auf Baustoffe, Metalle, seltene Erden (Metalle) etc eingeführt werden. Dies wäre nicht nur eine weitere Quelle für das Grundeinkommen, sondern würde einen Schub in Richtung Kreislaufwirtschaft bringen Die Neu-Versiegelung von Flächen (in Deutschland täglich ca. 100 ha) könnte mit einer Abgabe versehen werden, um diesen Prozess endlich wirksam zu verlangsamen Das ÖGE kann auch in materialer Form eingeführt werden, zum Beispiel als Basisfreimenge Strom oder Gas, finanziert über einen höheren Preis für den
12 darüber hinausgehenden Verbrauch. Ein solcher Spar-Tarif wurde von der Verbraucherzentrale NRW 2008 vorgeschlagen. Über das Energiewirtschaftsgesetz könnte das Anbieten einer solchen Tarifstruktur bundesweit für jeden Versorger vorgeschrieben werden. 12 Das alles ergibt noch kein existenzsicherndes Grundeinkommen. Aber es sind Schritte in die richtige Richtung. Es ist die Basis für mehr. In welcher Weise dieses Mehr, der Rest zum existenzsichernden Grundeinkommen, dann später dazukommt, ist nicht vorgegeben. Eine Möglichkeit ist, die ökologische Besteuerung sukzessive zu erhöhen und auf weitere Umweltmedien auszuweiten, so dass irgendwann einmal eine existenzsichernde Höhe von ca /Monat erreicht ist. Eine andere Möglichkeit ist es, all die anderen vorgeschlagenen Finanzierungsarten zu addieren und so zu einem mischfinanzierten Grundeinkommen zu kommen. In jedem Fall eignet sich das ökologische Grundeinkommen besonders gut zur Einführung des Prinzips: Jeder Mensch erhält ohne Bedingung einen Anteil am gemeinsamen Erbe der Gesellschaft, dem Reichtum an Ressourcen, Wissen und Produziertem, dem Reichtum an erster und zweiter Natur. Ulrich Schachtschneider, Oldenburg (D) Dipl.-Ing. Dr. rer.pol. Energieberater, freier Autor, Bildungsarbeiter u.v.m. Referent im Attac-Netzwerk Gesprächskreis Nachhaltigkeit der Rosa-Luxemburg-Stiftung
Ökologisches Grundeinkommen: Umverteilung auf ökologisch-emanzipatorisch
 Beitrag in: LUXEMBURG 02/2013 Ulrich Schachtschneider Ökologisches Grundeinkommen: Umverteilung auf ökologisch-emanzipatorisch 1 Ein ökologisches Grundeinkommen ist Umverteilung Die Besteuerung von Konsum
Beitrag in: LUXEMBURG 02/2013 Ulrich Schachtschneider Ökologisches Grundeinkommen: Umverteilung auf ökologisch-emanzipatorisch 1 Ein ökologisches Grundeinkommen ist Umverteilung Die Besteuerung von Konsum
Ökologisches Grundeinkommen: Freiheitliche Umwelt- und Sozialpolitik. 1 Grundeinkommen braucht Ökosteuer
 Dr. Ulrich Schachtschneider Energieberater/ freier Sozialwissenschaftler/ konkreter Utopist Ökologisches Grundeinkommen: Freiheitliche Umwelt- und Sozialpolitik 1 Grundeinkommen braucht Ökosteuer 2 Tax
Dr. Ulrich Schachtschneider Energieberater/ freier Sozialwissenschaftler/ konkreter Utopist Ökologisches Grundeinkommen: Freiheitliche Umwelt- und Sozialpolitik 1 Grundeinkommen braucht Ökosteuer 2 Tax
Ökologisches Grundeinkommen: Freiheitliche Umwelt- und Sozialpolitik. 2 Grundeinkommen braucht Ökosteuer
 Dr. Ulrich Schachtschneider Energieberater/ freier Sozialwissenschaftler/ konkreter Utopist Ökologisches Grundeinkommen: Freiheitliche Umwelt- und Sozialpolitik 1 Tax and Share: Öko-Steuer braucht Öko-Bonus/Öko-Grundeinkommen
Dr. Ulrich Schachtschneider Energieberater/ freier Sozialwissenschaftler/ konkreter Utopist Ökologisches Grundeinkommen: Freiheitliche Umwelt- und Sozialpolitik 1 Tax and Share: Öko-Steuer braucht Öko-Bonus/Öko-Grundeinkommen
Ulrich Schachtschneider Freiheit, Gleichheit, Gelassenheit Mit dem Ökologischen Grundeinkommen aus der Wachstumsfalle ISBN
 Ulrich Schachtschneider Freiheit, Gleichheit, Gelassenheit Mit dem Ökologischen Grundeinkommen aus der Wachstumsfalle ISBN 978-3-86581-693-1 152 Seiten, 14,8 x 21cm, 16,95 Euro oekom verlag, München 2014
Ulrich Schachtschneider Freiheit, Gleichheit, Gelassenheit Mit dem Ökologischen Grundeinkommen aus der Wachstumsfalle ISBN 978-3-86581-693-1 152 Seiten, 14,8 x 21cm, 16,95 Euro oekom verlag, München 2014
Postwachstum braucht ökologisches Grundeinkommen. 2 Ökologisches Grundeinkommen stützt anti-produktivistische Ökonomie
 Dr. Ulrich Schachtschneider Energieberater/ freier Sozialwissenschaftler Oldenburg Postwachstum braucht ökologisches Grundeinkommen 1 Ökologisches Grundeinkommen als umverteilende und libertäre Umweltpolitik
Dr. Ulrich Schachtschneider Energieberater/ freier Sozialwissenschaftler Oldenburg Postwachstum braucht ökologisches Grundeinkommen 1 Ökologisches Grundeinkommen als umverteilende und libertäre Umweltpolitik
Soziale Milieus als Zielgruppen für die Nachhaltigkeitskommunikation
 Soziale Milieus als Zielgruppen für die Nachhaltigkeitskommunikation Dr. Silke Kleinhückelkotten Expertenwerkstatt, Hannover, 30.11. Soziale Milieus (nach Sociovision) Wertorientierungen Lebensziele Lebensauffassung
Soziale Milieus als Zielgruppen für die Nachhaltigkeitskommunikation Dr. Silke Kleinhückelkotten Expertenwerkstatt, Hannover, 30.11. Soziale Milieus (nach Sociovision) Wertorientierungen Lebensziele Lebensauffassung
2 Ökologisches Grundeinkommen: Idee, Prinzipien. 3 Ökologisches Grundeinkommen: Mehr Ökologie durch mehr Freiheit und mehr Gleichheit
 Dr. Ulrich Schachtschneider Ulrich Energieberater/freier Schachtschneider Sozialwissenschaftler Ökologisches Grundeinkommen Freiheit, Gleichheit, Ökologie 1 Markt, Planung, Aufklärung? Aporien der Umweltpolitik
Dr. Ulrich Schachtschneider Ulrich Energieberater/freier Schachtschneider Sozialwissenschaftler Ökologisches Grundeinkommen Freiheit, Gleichheit, Ökologie 1 Markt, Planung, Aufklärung? Aporien der Umweltpolitik
Übung Betriebswirtschaftslehre I Grundlagen des Marketing. Sinus Milieus
 Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Professur für Marketing und Handelsbetriebslehre Übung Übung Betriebswirtschaftslehre I Sinus Milieus Technische Universität Chemnitz Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Professur für Marketing und Handelsbetriebslehre Übung Übung Betriebswirtschaftslehre I Sinus Milieus Technische Universität Chemnitz Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Ringvorlesung Postwachstumsökonomie Oldenburg, Mit Freiheit, Gleichheit und Genügsamkeit zu einer Postwachstumsgesellschaft
 Ringvorlesung Postwachstumsökonomie Oldenburg, 08.06.2011 Ulrich Schachtschneider Mit Freiheit, Gleichheit und Genügsamkeit zu einer Postwachstumsgesellschaft 1 Warum haben wir eine Wachstumsgesellschaft?
Ringvorlesung Postwachstumsökonomie Oldenburg, 08.06.2011 Ulrich Schachtschneider Mit Freiheit, Gleichheit und Genügsamkeit zu einer Postwachstumsgesellschaft 1 Warum haben wir eine Wachstumsgesellschaft?
KURZBESCHREIBUNG MILIEUS UND LEGENDE MILIEUABKÜRZUNGEN. vhw 2012
 KURZBESCHREIBUNG MILIEUS UND LEGENDE MILIEUABKÜRZUNGEN vhw 2012 2/6 SINUS-MILIEUS Gesellschaftliche Leitmilieus KET Konservativ-Etablierte 10% der Gesamtbevölkerung Das klassische Establishment: Verantwortungs-
KURZBESCHREIBUNG MILIEUS UND LEGENDE MILIEUABKÜRZUNGEN vhw 2012 2/6 SINUS-MILIEUS Gesellschaftliche Leitmilieus KET Konservativ-Etablierte 10% der Gesamtbevölkerung Das klassische Establishment: Verantwortungs-
Ökologisches Grundeinkommen eine Beschleunigungsbremse
 Beitrag zur Degrowth 2014, Leipzig Ulrich Schachtschneider Ökologisches Grundeinkommen eine Beschleunigungsbremse In diesem Beitrag geht es um die Idee eines ökologisch finanzierten Grundeinkommens und
Beitrag zur Degrowth 2014, Leipzig Ulrich Schachtschneider Ökologisches Grundeinkommen eine Beschleunigungsbremse In diesem Beitrag geht es um die Idee eines ökologisch finanzierten Grundeinkommens und
1 Ökologisches Tax and Share ist Umverteilung von Einkommen. 2 Ökologisches Grundeinkommen bringt Umwelt- und Grundeinkommensbewegung zusammen
 Dr. Ulrich Schachtschneider Energieberater/ freier Sozialwissenschaftler Oldenburg Ökologisches Grundeinkommen Ein Einstieg ist möglich 1 Ökologisches Tax and Share ist Umverteilung von Einkommen 2 Ökologisches
Dr. Ulrich Schachtschneider Energieberater/ freier Sozialwissenschaftler Oldenburg Ökologisches Grundeinkommen Ein Einstieg ist möglich 1 Ökologisches Tax and Share ist Umverteilung von Einkommen 2 Ökologisches
Freiheit, Gleichheit, Genügsamkeit
 1 Diskursprojekt Linksreformismus Tagung 04-06.02.2011, Berlin Ulrich Schachtschneider Freiheit, Gleichheit, Genügsamkeit Ein ökologisches Grundeinkommen als anschlussfähiges sozialökologisches Reformprojekt
1 Diskursprojekt Linksreformismus Tagung 04-06.02.2011, Berlin Ulrich Schachtschneider Freiheit, Gleichheit, Genügsamkeit Ein ökologisches Grundeinkommen als anschlussfähiges sozialökologisches Reformprojekt
Haben Sie von der aktuellen Debatte über Sexismus in Deutschland bereits gehört?
 Haben Sie von der aktuellen Debatte über Sexismus in Deutschland bereits gehört? 15% 14% Online-Umfrage Repräsentative Stichprobe: Deutsche Bevölkerung zwischen 18-69 n Basis: 1.056 Fälle 71% Durchführungszeitraum:
Haben Sie von der aktuellen Debatte über Sexismus in Deutschland bereits gehört? 15% 14% Online-Umfrage Repräsentative Stichprobe: Deutsche Bevölkerung zwischen 18-69 n Basis: 1.056 Fälle 71% Durchführungszeitraum:
Einstellung zu Institutionen in den Sinus-Milieus
 Einstellung zu Institutionen in den -Milieus Austrian Online Pool ermöglicht Zielgruppen-Segmentierung Gerade in wirtschaftlich turbulenten Zeiten steht das Vertrauen der Bevölkerung gegenüber öffentlichen
Einstellung zu Institutionen in den -Milieus Austrian Online Pool ermöglicht Zielgruppen-Segmentierung Gerade in wirtschaftlich turbulenten Zeiten steht das Vertrauen der Bevölkerung gegenüber öffentlichen
Ökologisches Grundeinkommen: Gastliches Umfeld für ein (Arbeits-)leben jenseits des Produktivismus
 Ev. Akademie Tutzing 16-11-2017 Dr. Ulrich Schachtschneider Energieberater/ freier Sozialwissenschaftler/ konkreter Utopist Ökologisches Grundeinkommen: Gastliches Umfeld für ein (Arbeits-)leben jenseits
Ev. Akademie Tutzing 16-11-2017 Dr. Ulrich Schachtschneider Energieberater/ freier Sozialwissenschaftler/ konkreter Utopist Ökologisches Grundeinkommen: Gastliches Umfeld für ein (Arbeits-)leben jenseits
2 Mit Tax and Share steuern und umverteilen. 3 Eine Postwachstumsökonomie wird möglich. 4 Wir können beginnen: Das Prinzip in die Welt setzen
 Dr. Ulrich Schachtschneider Energieberater/ freier Sozialwissenschaftler Oldenburg Freiheit. Gleichheit. Ökologie. Ökologisches Grundeinkommen 1 Aporien der Umweltpolitik 2 Mit Tax and Share steuern und
Dr. Ulrich Schachtschneider Energieberater/ freier Sozialwissenschaftler Oldenburg Freiheit. Gleichheit. Ökologie. Ökologisches Grundeinkommen 1 Aporien der Umweltpolitik 2 Mit Tax and Share steuern und
4.1.1 Das Verhältnis von Natur und Gesellschaft und ihre gegenseitige Vermittlung Die relative Eigenständigkeit der Natur und die
 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung...15 1.1 Gegenstände und Fragestellungen...17 1.2 Modelle...19 1.3 Zweck und Ziel der Arbeit...22 1.4 Erkenntnistheoretische Vorbemerkungen...24 1.5 Thesen...26 1.6 Stand
Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung...15 1.1 Gegenstände und Fragestellungen...17 1.2 Modelle...19 1.3 Zweck und Ziel der Arbeit...22 1.4 Erkenntnistheoretische Vorbemerkungen...24 1.5 Thesen...26 1.6 Stand
IG Metall Deine Stimme für ein Gutes Leben
 IG Metall Deine Stimme für ein Gutes Leben Auswertung für die IG Metall Erlangen Schaeffler KG Anzahl Befragte Betrieb: 747 Anzahl Befragte Deutschland: 451899 Durchgeführt von der sociotrend GmbH Leimen
IG Metall Deine Stimme für ein Gutes Leben Auswertung für die IG Metall Erlangen Schaeffler KG Anzahl Befragte Betrieb: 747 Anzahl Befragte Deutschland: 451899 Durchgeführt von der sociotrend GmbH Leimen
Was ist Mikroökonomie? Kapitel 1. Was ist Mikroökonomie? Was ist Mikroökonomie? Themen der Mikroökonomie
 Was ist Mikroökonomie? Mikroökonomie handelt von begrenzten Ressourcen. Kapitel 1 Themen der Mikroökonomie Beschränkte Budgets, beschränkte Zeit, beschränkte Produktionsmöglichkeiten. Welches ist die optimale
Was ist Mikroökonomie? Mikroökonomie handelt von begrenzten Ressourcen. Kapitel 1 Themen der Mikroökonomie Beschränkte Budgets, beschränkte Zeit, beschränkte Produktionsmöglichkeiten. Welches ist die optimale
Was verträgt unsere Erde noch?
 Was verträgt unsere Erde noch? Jill Jäger Was bedeutet globaler Wandel? Die tief greifenden Veränderungen der Umwelt, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten beobachtet wurden: Klimawandel, Wüstenbildung,
Was verträgt unsere Erde noch? Jill Jäger Was bedeutet globaler Wandel? Die tief greifenden Veränderungen der Umwelt, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten beobachtet wurden: Klimawandel, Wüstenbildung,
Grundeinkommen und solidarische Ökonomie Für eine neue politische Ökonomie
 Grundeinkommen und solidarische Ökonomie Für eine neue politische Ökonomie Ronald Blaschke blaschke@grundeinkommen.de, www.grundeinkommen.de Solidarische Ökonomie und Transformation Berlin, 12. September
Grundeinkommen und solidarische Ökonomie Für eine neue politische Ökonomie Ronald Blaschke blaschke@grundeinkommen.de, www.grundeinkommen.de Solidarische Ökonomie und Transformation Berlin, 12. September
Shareholder Value und gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen
 Shareholder Value und gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen Vortrag am Interfakultativen Institut für Entrepreneurship der Universität Karlsruhe 4. Februar 2002 Dr. iur. Dr. h.c. rer. oec. Manfred
Shareholder Value und gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen Vortrag am Interfakultativen Institut für Entrepreneurship der Universität Karlsruhe 4. Februar 2002 Dr. iur. Dr. h.c. rer. oec. Manfred
Auf dem Weg zu einem Green New Deal
 Auf dem Weg zu einem Green New Deal Das Papier beschreibt, wie ein Green New Deal gestaltet sein muss, damit zweierlei gelingt: eine nachhaltige Belebung der Wirtschaft und der Übergang zu einer umweltverträglichen,
Auf dem Weg zu einem Green New Deal Das Papier beschreibt, wie ein Green New Deal gestaltet sein muss, damit zweierlei gelingt: eine nachhaltige Belebung der Wirtschaft und der Übergang zu einer umweltverträglichen,
Gesellschaftliche Wege aus der Ökokrise Konzepte im Überblick. 1 Der technische Weg und seine Grenzen
 Ulrich Schachtschneider Gesellschaftliche Wege aus der Ökokrise Konzepte im Überblick 1 Der technische Weg und seine Grenzen 2 Gesellschaftliche Wege Systemwechsel? Modernisierung im System? Phasenwechsel?
Ulrich Schachtschneider Gesellschaftliche Wege aus der Ökokrise Konzepte im Überblick 1 Der technische Weg und seine Grenzen 2 Gesellschaftliche Wege Systemwechsel? Modernisierung im System? Phasenwechsel?
Fernseher oder Wohnung ALLES EINE FRAGE DER PRIORITÄT?
 Fernseher oder Wohnung ALLES EINE FRAGE DER PRIORITÄT? Menschen handeln Dingen gegenüber auf der Grundlage der Bedeutung, die diese Dinge für sie haben. Herbert Blumer 1978 Wie entstehen Werte? Welcher
Fernseher oder Wohnung ALLES EINE FRAGE DER PRIORITÄT? Menschen handeln Dingen gegenüber auf der Grundlage der Bedeutung, die diese Dinge für sie haben. Herbert Blumer 1978 Wie entstehen Werte? Welcher
Möglichkeiten und Grenzen von Ökosteuern Vorschläge der Allianz Wege aus der Krise
 Möglichkeiten und Grenzen von Ökosteuern Vorschläge der Allianz Wege aus der Krise Dr. Heinz Högelsberger Referat Wirtschaft September 2013 www.vida.at Was eine gute Ökosteuer können soll Steuerungseffekt»
Möglichkeiten und Grenzen von Ökosteuern Vorschläge der Allianz Wege aus der Krise Dr. Heinz Högelsberger Referat Wirtschaft September 2013 www.vida.at Was eine gute Ökosteuer können soll Steuerungseffekt»
Freiheit. Gleichheit. Genügsamkeit. Ökologisches Grundeinkommen. 1 Mit Tax and Share steuern und umverteilen. 2 Aus den Aporien der Umweltpolitik
 Dr. Ulrich Schachtschneider Energieberater/ freier Sozialwissenschaftler Oldenburg Freiheit. Gleichheit. Genügsamkeit. Ökologisches Grundeinkommen 1 Mit Tax and Share steuern und umverteilen 2 Aus den
Dr. Ulrich Schachtschneider Energieberater/ freier Sozialwissenschaftler Oldenburg Freiheit. Gleichheit. Genügsamkeit. Ökologisches Grundeinkommen 1 Mit Tax and Share steuern und umverteilen 2 Aus den
Ökologisch-soziale Ressourcenbesteuerung. Damian Ludewig Jugendvertreter im DNR-Präsidium
 Ökologisch-soziale Ressourcenbesteuerung Damian Ludewig Jugendvertreter im DNR-Präsidium Bemerkung: Die hier vorgestellten Ideen geben die Meinung des Referenten wieder und entsprechen nicht notwendiger
Ökologisch-soziale Ressourcenbesteuerung Damian Ludewig Jugendvertreter im DNR-Präsidium Bemerkung: Die hier vorgestellten Ideen geben die Meinung des Referenten wieder und entsprechen nicht notwendiger
Die Ökosteuer. Wie entwickelt sich die Ökosteuer in Deutschland und welche Wirkung hat sie?
 Die Ökosteuer Wie entwickelt sich die Ökosteuer in Deutschland und welche Wirkung hat sie? Gliederung Einführung der Ökosteuer Grundgedanken und Ziele Diskussionen vor 1999 Wirkung der Ökosteuer Theoretischer
Die Ökosteuer Wie entwickelt sich die Ökosteuer in Deutschland und welche Wirkung hat sie? Gliederung Einführung der Ökosteuer Grundgedanken und Ziele Diskussionen vor 1999 Wirkung der Ökosteuer Theoretischer
Agrobiodiversität im gesellschaftlichen Bewusstsein
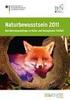 Agrobiodiversität im gesellschaftlichen Bewusstsein Silke Kleinhückelkotten, ECOLOG-Institut Tagung: Agrobiodiversität als Schlüssel für eine nachhaltige Landwirtschaft im 21. Jahrhundert? 20. / 21. Oktober,
Agrobiodiversität im gesellschaftlichen Bewusstsein Silke Kleinhückelkotten, ECOLOG-Institut Tagung: Agrobiodiversität als Schlüssel für eine nachhaltige Landwirtschaft im 21. Jahrhundert? 20. / 21. Oktober,
95 % 50 % Drei Ziele eine Position für unsere Zukunft. Treibhausgasemissionen. Energieverbrauch. senken (bis 2050)
 Treibhausgasemissionen senken (bis 2050) Drei Ziele eine Position für unsere Zukunft Energiewende konsequent gestalten! Für zukunftsfähige Lebens- und Arbeitsbedingungen Energieverbrauch senken (bis 2050)
Treibhausgasemissionen senken (bis 2050) Drei Ziele eine Position für unsere Zukunft Energiewende konsequent gestalten! Für zukunftsfähige Lebens- und Arbeitsbedingungen Energieverbrauch senken (bis 2050)
Brauchen wir Utopien?
 Dr. Ulrich Schachtschneider Energieberater/ freier Sozialwissenschaftler/konkreter Utopist Brauchen wir Utopien? http://ulrich-schachtschneider.de Dr. Ulrich Schachtschneider Energieberater/ freier Sozialwissenschaftler/konkreter
Dr. Ulrich Schachtschneider Energieberater/ freier Sozialwissenschaftler/konkreter Utopist Brauchen wir Utopien? http://ulrich-schachtschneider.de Dr. Ulrich Schachtschneider Energieberater/ freier Sozialwissenschaftler/konkreter
7. Einheit Nachhaltigkeit
 7. Einheit Nachhaltigkeit Wachstum Wachstum (umgefähre Werte) 7 6 5 4 3 2 1 400 350 300 250 200 150 100 50 Bevölkerung (Mrd.) BIP (Int. $, 100 Mrd.) 0 1750 1800 1850 1900 1950 2000 0 Grenzen des Wachstums
7. Einheit Nachhaltigkeit Wachstum Wachstum (umgefähre Werte) 7 6 5 4 3 2 1 400 350 300 250 200 150 100 50 Bevölkerung (Mrd.) BIP (Int. $, 100 Mrd.) 0 1750 1800 1850 1900 1950 2000 0 Grenzen des Wachstums
Leipziger Chef-Depesche / II. Rohstoff- und Energieabgaben anstelle von von Ertrags- und Erfolgssteuer
 Leipziger Chef-Depesche 4-1994 / II Rohstoff- und Energieabgaben anstelle von von Ertrags- und Erfolgssteuer Leipziger Chef-Depesche Impressum: Redaktion: Horst Bargmann Edition Leu GmbH & Cie. Wettiner
Leipziger Chef-Depesche 4-1994 / II Rohstoff- und Energieabgaben anstelle von von Ertrags- und Erfolgssteuer Leipziger Chef-Depesche Impressum: Redaktion: Horst Bargmann Edition Leu GmbH & Cie. Wettiner
Arbeitsmärkte und die Zukunft der Anerkennung
 Arbeitsmärkte und die Zukunft der Anerkennung Christian.neuhäuser@udo.edu Agenda 1. Die klassische Idee des Arbeitsmarktes 2. Wirtschaftswachstum und Arbeitsbeschaffung 3. Herausforderung 1: Anerkennung
Arbeitsmärkte und die Zukunft der Anerkennung Christian.neuhäuser@udo.edu Agenda 1. Die klassische Idee des Arbeitsmarktes 2. Wirtschaftswachstum und Arbeitsbeschaffung 3. Herausforderung 1: Anerkennung
WEGE AUS DER ARMUT. "Dein Hunger wird nie gestillt, dein Durst nie gelöscht, du kannst nie schlafen, bis du irgendwann nicht mehr müde bist"
 WEGE AUS DER ARMUT "Dein Hunger wird nie gestillt, dein Durst nie gelöscht, du kannst nie schlafen, bis du irgendwann nicht mehr müde bist" Wer hungern muss, wer kein Geld für die nötigsten Dinge hat,
WEGE AUS DER ARMUT "Dein Hunger wird nie gestillt, dein Durst nie gelöscht, du kannst nie schlafen, bis du irgendwann nicht mehr müde bist" Wer hungern muss, wer kein Geld für die nötigsten Dinge hat,
Bei Marx spielt die individuelle Freiheit keine Rolle
 Bei Marx spielt die individuelle Freiheit keine Rolle Bei Marx spielt die individuelle Freiheit keine Rolle Das wird gesagt: In einer Gesellschaft nach Marx Vorstellungen können die Individuen nicht das
Bei Marx spielt die individuelle Freiheit keine Rolle Bei Marx spielt die individuelle Freiheit keine Rolle Das wird gesagt: In einer Gesellschaft nach Marx Vorstellungen können die Individuen nicht das
Haltung zu Gesundheit und Rauchen in den Sinus-Milieus
 Haltung zu Gesundheit und Rauchen in den -Milieus Austrian Online Pool ermöglicht Zielgruppen-Segmentierung Das Thema Gesundheit interessiert jeden von uns. Aber die damit verbundenen, konkreten Meinungen
Haltung zu Gesundheit und Rauchen in den -Milieus Austrian Online Pool ermöglicht Zielgruppen-Segmentierung Das Thema Gesundheit interessiert jeden von uns. Aber die damit verbundenen, konkreten Meinungen
Öffentlich ist wesentlich. Die Zukunft kommunaler Dienstleistungen
 Öffentlich ist wesentlich Die Zukunft kommunaler Dienstleistungen Pakt für den Euro Schuldenbremse in nationales Recht Kontrolle der nationalen Budgets Anpassung Renteneintrittsalter Abschaffung Vorruhestandsregelungen
Öffentlich ist wesentlich Die Zukunft kommunaler Dienstleistungen Pakt für den Euro Schuldenbremse in nationales Recht Kontrolle der nationalen Budgets Anpassung Renteneintrittsalter Abschaffung Vorruhestandsregelungen
Was besprechen wir heute?
 Global Governance Annahme / Problem: Sozialwissenschaften analysieren Realität, die kann aber unterschiedlich interpretiert werden Weltsichten, Erkenntnisinteresse These: es gibt verschiedene Verständnisse
Global Governance Annahme / Problem: Sozialwissenschaften analysieren Realität, die kann aber unterschiedlich interpretiert werden Weltsichten, Erkenntnisinteresse These: es gibt verschiedene Verständnisse
Sozial-ökologische Umbauperspektiven in Industrie und Gesellschaft
 Sozial-ökologische Umbauperspektiven in Industrie und Gesellschaft Arbeiterkammer Linz 12. Juni 2012 Ulla Lötzer MdB Im Jahr 2052 wird die Welt mit Schrecken auf weitere Änderungen in der zweiten Hälfte
Sozial-ökologische Umbauperspektiven in Industrie und Gesellschaft Arbeiterkammer Linz 12. Juni 2012 Ulla Lötzer MdB Im Jahr 2052 wird die Welt mit Schrecken auf weitere Änderungen in der zweiten Hälfte
Master-Titelformat bearbeiten Untertitel
 Strategien für gute Arbeit in der Postwachstumsgesellschaft Master-Titelformat bearbeiten Untertitel Ehemaliger Bereichsleiter Arbeitsgestaltung und Qualifizierungspolitik beim Vorstand der IG Metall Evangelische
Strategien für gute Arbeit in der Postwachstumsgesellschaft Master-Titelformat bearbeiten Untertitel Ehemaliger Bereichsleiter Arbeitsgestaltung und Qualifizierungspolitik beim Vorstand der IG Metall Evangelische
1 Grundeinkommen als libertärer Sozialstaat. 2 Gutes Leben statt ewiges Wachstum: Ein gastliches Umfeld. 4 [Theoretische und normative Quellen]
![1 Grundeinkommen als libertärer Sozialstaat. 2 Gutes Leben statt ewiges Wachstum: Ein gastliches Umfeld. 4 [Theoretische und normative Quellen] 1 Grundeinkommen als libertärer Sozialstaat. 2 Gutes Leben statt ewiges Wachstum: Ein gastliches Umfeld. 4 [Theoretische und normative Quellen]](/thumbs/95/123646369.jpg) Dr. Ulrich Schachtschneider Energieberater/ freier Sozialwissenschaftler/ konkreter Utopist 8. internationale Woche des Grundeinkommens Grünes Grundeinkommen eine konkrete Utopie jenseits des Wachstumszwangs
Dr. Ulrich Schachtschneider Energieberater/ freier Sozialwissenschaftler/ konkreter Utopist 8. internationale Woche des Grundeinkommens Grünes Grundeinkommen eine konkrete Utopie jenseits des Wachstumszwangs
Degrowth Ziele, Visionen und Herausforderungen
 Degrowth Ziele, Visionen und Herausforderungen Judith Kleibs Oikos Germany Meeting 30. Mai 2015 Inhalt 1. Definition Degrowth 2. Geschichte der Degrowth-Bewegung 3. Visionen und Ziele 4. Herausforderungen
Degrowth Ziele, Visionen und Herausforderungen Judith Kleibs Oikos Germany Meeting 30. Mai 2015 Inhalt 1. Definition Degrowth 2. Geschichte der Degrowth-Bewegung 3. Visionen und Ziele 4. Herausforderungen
Sozialog-Reihe des PARITÄTISCHEN, LV Schleswig-Holstein, Kiel 03. Juni Die Erosion des Sozialen: Quo vadis Sozialstaat?
 Sozialog-Reihe des PARITÄTISCHEN, LV Schleswig-Holstein, Kiel 03. Juni 2013 Die Erosion des Sozialen: Quo vadis Sozialstaat? PD Dr. Ralf Ptak, Volkswirt des KDA der Nordkirche und Privatdozent an der Universität
Sozialog-Reihe des PARITÄTISCHEN, LV Schleswig-Holstein, Kiel 03. Juni 2013 Die Erosion des Sozialen: Quo vadis Sozialstaat? PD Dr. Ralf Ptak, Volkswirt des KDA der Nordkirche und Privatdozent an der Universität
Naturbewusstsein in Deutschland
 Eine Zukunftsaufgabe in guten Händen Naturbewusstsein in Deutschland Naturbewusstsein 2011: Einführung, grundlegende Befunde und Ergebnisse zum nachhaltigen Konsum Andreas Wilhelm Mues Bundesamt für Naturschutz
Eine Zukunftsaufgabe in guten Händen Naturbewusstsein in Deutschland Naturbewusstsein 2011: Einführung, grundlegende Befunde und Ergebnisse zum nachhaltigen Konsum Andreas Wilhelm Mues Bundesamt für Naturschutz
FUGO (Forschungskolloquium Unternehmen und Gesellschaft) Oldenburg Ulrich Schachtschneider:
 FUGO (Forschungskolloquium Unternehmen und Gesellschaft) Oldenburg 19.01.2011 Ulrich Schachtschneider: Der Regulationsansatz als integrale sozial-ökonomische Theorie und sein Beitrag zu einer Theorie sozial-ökologischer
FUGO (Forschungskolloquium Unternehmen und Gesellschaft) Oldenburg 19.01.2011 Ulrich Schachtschneider: Der Regulationsansatz als integrale sozial-ökonomische Theorie und sein Beitrag zu einer Theorie sozial-ökologischer
Arbeitskräftemangel bremst Wachstum aus
 Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Perspektive 2035 07.07.2017 Lesezeit 3 Min. Arbeitskräftemangel bremst Wachstum aus Wie wird sich die deutsche Wirtschaftsleistung im demografischen
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Perspektive 2035 07.07.2017 Lesezeit 3 Min. Arbeitskräftemangel bremst Wachstum aus Wie wird sich die deutsche Wirtschaftsleistung im demografischen
Fach Wirtschaft. Kursstufe (vierstündig) Schuleigenes Curriculum. Außerschulische Lernorte (Beispiele) und Methoden
 1. WIRTSCHAFTLICHES HANDELN IM SEKTOR HAUSHALT Knappheit als Grundlage wirtschaftlichen Handelns erkennen; das ökonomische Verhaltensmodell darlegen und die Begriffe Präferenzen und Restriktionen sachgerecht
1. WIRTSCHAFTLICHES HANDELN IM SEKTOR HAUSHALT Knappheit als Grundlage wirtschaftlichen Handelns erkennen; das ökonomische Verhaltensmodell darlegen und die Begriffe Präferenzen und Restriktionen sachgerecht
Bäuerliche Prinzipien der Zukunft Im Einklang mit Ökologie, Ökonomie und Unternehmertum. Bauernstammtisch Derndorf, 08. April 2010
 Bäuerliche Prinzipien der Zukunft Im Einklang mit Ökologie, Ökonomie und Unternehmertum Bauernstammtisch Derndorf, 08. April 2010 Strukturwandel in der Landwirtschaft seit Jahrzehnten enormer Wandel: Auf
Bäuerliche Prinzipien der Zukunft Im Einklang mit Ökologie, Ökonomie und Unternehmertum Bauernstammtisch Derndorf, 08. April 2010 Strukturwandel in der Landwirtschaft seit Jahrzehnten enormer Wandel: Auf
Bedeutung und Perspektiven von Indikatoren als Instrument der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie
 Bedeutung und Perspektiven von Indikatoren als Instrument der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie Dr. Jörg Mayer-Ries Bundesministerium für Umwelt Referat Allgemeine und grundsätzliche Fragen der Umweltpolitik
Bedeutung und Perspektiven von Indikatoren als Instrument der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie Dr. Jörg Mayer-Ries Bundesministerium für Umwelt Referat Allgemeine und grundsätzliche Fragen der Umweltpolitik
Kompetenzen Workshop Fairer Handel
 Kompetenzen Workshop Fairer Handel Erkennen 1. Informationsbeschaffung und -verarbeitung Informationen zu Fragen der Globalisierung und Entwicklung beschaffen und themenbezogen verarbeiten. Informationen
Kompetenzen Workshop Fairer Handel Erkennen 1. Informationsbeschaffung und -verarbeitung Informationen zu Fragen der Globalisierung und Entwicklung beschaffen und themenbezogen verarbeiten. Informationen
Kapitalismus vs. Klima. Denknetz U Juli 2017
 Kapitalismus vs. Klima Denknetz U-35 8. Juli 2017 Klimawandel: Ursachen Treibhauseffekt verursacht durch Emissionen aus verschiedenen Quellen (in CO 2 -Äquivalenten): Quelle: 4. UN Klimareport 2007 Klimawandel:
Kapitalismus vs. Klima Denknetz U-35 8. Juli 2017 Klimawandel: Ursachen Treibhauseffekt verursacht durch Emissionen aus verschiedenen Quellen (in CO 2 -Äquivalenten): Quelle: 4. UN Klimareport 2007 Klimawandel:
Ganzheitliches Greening of the economy unterstützen statt Verengung auf Green Jobs Rede von Alexander Wilhelm
 Es gilt das gesprochene Wort! Ganzheitliches Greening of the economy unterstützen statt Verengung auf Green Jobs Rede von Alexander Wilhelm Stellvertretender Leiter, Abteilung Arbeitsmarkt Konferenz Green
Es gilt das gesprochene Wort! Ganzheitliches Greening of the economy unterstützen statt Verengung auf Green Jobs Rede von Alexander Wilhelm Stellvertretender Leiter, Abteilung Arbeitsmarkt Konferenz Green
Nachhaltiges Wirtschaftswachstum: Kann dies in der Praxis funktionieren?
 Nachhaltiges Wirtschaftswachstum: Kann dies in der Praxis funktionieren? Beitrag zum Symposium Ressourcenschonendes Wirtschaften Technische Universität Wien, 25. März 204 Univ.-Prof. Dr. Michael Getzner
Nachhaltiges Wirtschaftswachstum: Kann dies in der Praxis funktionieren? Beitrag zum Symposium Ressourcenschonendes Wirtschaften Technische Universität Wien, 25. März 204 Univ.-Prof. Dr. Michael Getzner
Naturschutzengagement in Deutschland
 Eine Zukunftsaufgabe in guten Händen Naturschutzengagement in Deutschland Befunde der Naturbewusstseinsstudie und Entwicklungspotenziale Andreas Wilhelm Mues Bundesamt für Naturschutz Gliederung I. Einführung
Eine Zukunftsaufgabe in guten Händen Naturschutzengagement in Deutschland Befunde der Naturbewusstseinsstudie und Entwicklungspotenziale Andreas Wilhelm Mues Bundesamt für Naturschutz Gliederung I. Einführung
Wohlstand & Lebensqualität Zusammenfassung
 Einfacher Wirtschaftskreislauf Bruttoinlandsprodukt (BIP) Das BIP als Wohlstandsindikator misst die Wirtschaftsleistung (d. h. die erstellten Güter, abzüglich der Vorleistungen), die eine Volkswirtschaft
Einfacher Wirtschaftskreislauf Bruttoinlandsprodukt (BIP) Das BIP als Wohlstandsindikator misst die Wirtschaftsleistung (d. h. die erstellten Güter, abzüglich der Vorleistungen), die eine Volkswirtschaft
Ulrich Schachtschneider Gesellschaftliche Wege aus der Ökokrise
 Ulrich Schachtschneider Gesellschaftliche Wege aus der Ökokrise Herr Schachtschneider, Sie beschäftigen sich mit verschiedenen Konzepten für gesellschaftliche Wege aus der Ökokrise. Wie sind Sie dazu gekommen?
Ulrich Schachtschneider Gesellschaftliche Wege aus der Ökokrise Herr Schachtschneider, Sie beschäftigen sich mit verschiedenen Konzepten für gesellschaftliche Wege aus der Ökokrise. Wie sind Sie dazu gekommen?
Nachhaltigkeitskommunikation Defizite, Neuentwicklungen und soziokulturelle Perspektiven
 Nachhaltigkeitskommunikation Defizite, Neuentwicklungen und soziokulturelle Perspektiven Beitrag zur Tagung: Kulturelle Nachhaltigkeit und Naturschutz (Insel Vilm, 11.12.2008) 1von 8 Als Ausgangspunkt
Nachhaltigkeitskommunikation Defizite, Neuentwicklungen und soziokulturelle Perspektiven Beitrag zur Tagung: Kulturelle Nachhaltigkeit und Naturschutz (Insel Vilm, 11.12.2008) 1von 8 Als Ausgangspunkt
Ausgewachsen. Wie die Wirtschaft mit viel weniger Ressourcen auskommen kann. Christine Ax Friedrich Hinterberger
 Ausgewachsen Wie die Wirtschaft mit viel weniger Ressourcen auskommen kann Christine Ax Friedrich Hinterberger forum zukunft, Baden-Baden, 2.März 2013 Überblick das WAS, das WARUM, das ABER, das WIE, das
Ausgewachsen Wie die Wirtschaft mit viel weniger Ressourcen auskommen kann Christine Ax Friedrich Hinterberger forum zukunft, Baden-Baden, 2.März 2013 Überblick das WAS, das WARUM, das ABER, das WIE, das
Wie man das wirtschaftliche Dilemma versteht
 4. Innovation, Wettbewerb und Ressourcennutzung Oliver Richters, Andreas Siemoneit Wettbewerb und Gewinnerwartungen Steigerungslogik des Kapitalismus Ausbeutung der Arbeiter Steigerungslogik Akkumulationszwang
4. Innovation, Wettbewerb und Ressourcennutzung Oliver Richters, Andreas Siemoneit Wettbewerb und Gewinnerwartungen Steigerungslogik des Kapitalismus Ausbeutung der Arbeiter Steigerungslogik Akkumulationszwang
Krise des Neoliberalismus? Thesen zur Dynamik und Wirkung eines Jahrhundertprojekts
 Krise des Neoliberalismus? Thesen zur Dynamik und Wirkung eines Jahrhundertprojekts Symposium des Renner-Instituts am in Wien Vortrag von Institut II Wirtschaftswissenschaft, Bildungsökonomie und Ökonomische
Krise des Neoliberalismus? Thesen zur Dynamik und Wirkung eines Jahrhundertprojekts Symposium des Renner-Instituts am in Wien Vortrag von Institut II Wirtschaftswissenschaft, Bildungsökonomie und Ökonomische
Betriebstechnikausarbeitung Wirtschaft. Thomas Braunsdorfer
 Betriebstechnikausarbeitung Wirtschaft Thomas Braunsdorfer Inhaltsverzeichnis 1 Wirtschaft... 3 1.1 Allgemeines... 3 1.2 Kreisläufe der Wirtschaft... 3 1.2.1 Geldkreislauf...3 1.2.2 Waren- (Güter-) und
Betriebstechnikausarbeitung Wirtschaft Thomas Braunsdorfer Inhaltsverzeichnis 1 Wirtschaft... 3 1.1 Allgemeines... 3 1.2 Kreisläufe der Wirtschaft... 3 1.2.1 Geldkreislauf...3 1.2.2 Waren- (Güter-) und
Die Sinus-Milieus in der Schweiz
 Die Sinus-Milieus in der Schweiz Wolfgang Plöger Sinus Sociovision Die Sinus-Milieus Ergebnis von mehr als zwei Jahrzehnten sozialwissenschaftlicher Forschung Abbild der gesellschaftlichen Strukturen und
Die Sinus-Milieus in der Schweiz Wolfgang Plöger Sinus Sociovision Die Sinus-Milieus Ergebnis von mehr als zwei Jahrzehnten sozialwissenschaftlicher Forschung Abbild der gesellschaftlichen Strukturen und
Eltern unter Druck Die wichtigsten Ergebnisse der Studie... 1 Christine Henry-Huthmacher
 Inhalt Eltern unter Druck Die wichtigsten Ergebnisse der Studie... 1 Christine Henry-Huthmacher Eltern unter Druck Die Studie... 25 Tanja Merkle/Carsten Wippermann 1. Hintergrund.... 27 2. Zentrale Befunde...
Inhalt Eltern unter Druck Die wichtigsten Ergebnisse der Studie... 1 Christine Henry-Huthmacher Eltern unter Druck Die Studie... 25 Tanja Merkle/Carsten Wippermann 1. Hintergrund.... 27 2. Zentrale Befunde...
Vorstand. Berlin, 3. Juli So wollen wir leben! Ergebnisse und Analysen der Befragung der IG Metall. Pressekonferenz Detlef Wetzel
 Berlin, 3. Juli 2009 So wollen wir leben! Ergebnisse und Analysen der Befragung der IG Metall Pressekonferenz Detlef Wetzel Übersicht Die Befragung: Deine Stimme für ein gutes Leben! Quantitative Ergebnisse
Berlin, 3. Juli 2009 So wollen wir leben! Ergebnisse und Analysen der Befragung der IG Metall Pressekonferenz Detlef Wetzel Übersicht Die Befragung: Deine Stimme für ein gutes Leben! Quantitative Ergebnisse
Milieus als Erklärungsmodelle für Wahlverhalten
 Milieus als Erklärungsmodelle für Wahlverhalten Das Beispiel Bonn Vortrag von Dipl.- Geogr. Klaus Kosack Statistikstelle Stadt Bonn Kosack 1 MOSAIC-Milieus Inhalte des Vortrages Was sind MOSAIC Milieus?
Milieus als Erklärungsmodelle für Wahlverhalten Das Beispiel Bonn Vortrag von Dipl.- Geogr. Klaus Kosack Statistikstelle Stadt Bonn Kosack 1 MOSAIC-Milieus Inhalte des Vortrages Was sind MOSAIC Milieus?
Frühjahrstagung 2010
 Weiterbildung für Träger und Multiplikatoren politischer Bildung Frühjahrstagung 2010 "Wege zur Erhöhung der Breiten- und Tiefenwirkung politischer Bildung in Mecklenburg- Vorpommern" 11. März 2010, Waren
Weiterbildung für Träger und Multiplikatoren politischer Bildung Frühjahrstagung 2010 "Wege zur Erhöhung der Breiten- und Tiefenwirkung politischer Bildung in Mecklenburg- Vorpommern" 11. März 2010, Waren
Konzepte für eine moderne Wirtschaftspolitik
 Konzepte für eine moderne Wirtschaftspolitik Makroskop-Kongress 13. Oktober 2018 Neue wirtschaftliche Dynamik durch ökologischen Umbau und sozialen Fortschritt Dr. Rainer Land Thünen-Institut ev. Bollewick
Konzepte für eine moderne Wirtschaftspolitik Makroskop-Kongress 13. Oktober 2018 Neue wirtschaftliche Dynamik durch ökologischen Umbau und sozialen Fortschritt Dr. Rainer Land Thünen-Institut ev. Bollewick
Brauchen wir mehr Umweltsteuern in einer von Wachstumszwängen befreiten Ökonomie?
 Brauchen wir mehr Umweltsteuern in einer von Wachstumszwängen befreiten Ökonomie? Prof. Dr. Holger Professor für Nachhaltige Ökonomie und Direktor des Instituts für Nachhaltigkeit I. Hintergrund II. Aufkommen
Brauchen wir mehr Umweltsteuern in einer von Wachstumszwängen befreiten Ökonomie? Prof. Dr. Holger Professor für Nachhaltige Ökonomie und Direktor des Instituts für Nachhaltigkeit I. Hintergrund II. Aufkommen
Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Wachstum Möglichkeiten wirtschaftspolitischer Steuerung
 Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Wachstum Möglichkeiten wirtschaftspolitischer Steuerung Prof. Dr. Michael von Hauff TU Kaiserslautern Staatsschauspiel Dresden, Kleines Haus 20. Januar 2016 22.01.2016
Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Wachstum Möglichkeiten wirtschaftspolitischer Steuerung Prof. Dr. Michael von Hauff TU Kaiserslautern Staatsschauspiel Dresden, Kleines Haus 20. Januar 2016 22.01.2016
GRUNDWISSEN WIRTSCHAFT UND RECHT Jgst. Peutinger-Gymnasium Augsburg
 Operatoren in schriftlichen und mündlichen Leistungserhebungen siehe Grundwissen Wirtschaft und Recht 9. Jgst. 10.1 Denken in gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen Wie verhalten sich Haushalte und Unternehmen
Operatoren in schriftlichen und mündlichen Leistungserhebungen siehe Grundwissen Wirtschaft und Recht 9. Jgst. 10.1 Denken in gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen Wie verhalten sich Haushalte und Unternehmen
Lebensqualität, Bedürfnisse und Capabilities
 Lebensqualität, Bedürfnisse und Capabilities Politische Leitidee für eine Transformation Dr. Ines Omann Einige Botschaften vorweg Wir haben derzeit keine nachhaltige Entwicklung, weder global noch national
Lebensqualität, Bedürfnisse und Capabilities Politische Leitidee für eine Transformation Dr. Ines Omann Einige Botschaften vorweg Wir haben derzeit keine nachhaltige Entwicklung, weder global noch national
August-Dicke-Schule, Schützenstraße 44, Solingen Kernlehrplan Politk/ Wirtschaft
 August-Dicke-Schule, Schützenstraße 44, 42659 Solingen Kernlehrplan Politk/ Wirtschaft Im Fach Politik/Wirtschaft arbeiten wir in der Klasse 5 mit dem Lehrbuch Team 5/6 aus dem Verlag Schöningh. Die Reihenfolge
August-Dicke-Schule, Schützenstraße 44, 42659 Solingen Kernlehrplan Politk/ Wirtschaft Im Fach Politik/Wirtschaft arbeiten wir in der Klasse 5 mit dem Lehrbuch Team 5/6 aus dem Verlag Schöningh. Die Reihenfolge
Das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE)
 Das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) Die wichtigsten Ziele: 1. Freiheit - durch Beseitigung existenzieller Abhängigkeit 2. Befreiung von Existenz-Angst 3. Beseitigung von Armut - durch Mindesteinkommen
Das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) Die wichtigsten Ziele: 1. Freiheit - durch Beseitigung existenzieller Abhängigkeit 2. Befreiung von Existenz-Angst 3. Beseitigung von Armut - durch Mindesteinkommen
6. Einheit Wachstum und Verteilung
 6. Einheit Wachstum und Verteilung Wirtschaftswachstum und Wohlstand (1) Wachstum: Wirtschaftswachstum = Zunahme des realen Bruttoinlandsprodukts real = zu konstanten Preisen Beispiele (2006): Österreich:
6. Einheit Wachstum und Verteilung Wirtschaftswachstum und Wohlstand (1) Wachstum: Wirtschaftswachstum = Zunahme des realen Bruttoinlandsprodukts real = zu konstanten Preisen Beispiele (2006): Österreich:
Grundeinkommen. Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderung(en)
 Ein Leben in Würde ist nur mit der bedingungslosen Absicherung der grundlegenden materiellen Existenz und gesellschaftlichen Teilhabe möglich. Grundeinkommen. Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderung(en)
Ein Leben in Würde ist nur mit der bedingungslosen Absicherung der grundlegenden materiellen Existenz und gesellschaftlichen Teilhabe möglich. Grundeinkommen. Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderung(en)
Sinus Milieus Der aktuelle gesellschaftliche Wandel
 Sinus s Der aktuelle gesellschaftliche Wandel Strukturelle Veränderungen: Demografische Verschiebungen, Veränderungen in Sozialstruktur und Arbeitswelt, Auseinanderdriften von oben und unten, von Mitte
Sinus s Der aktuelle gesellschaftliche Wandel Strukturelle Veränderungen: Demografische Verschiebungen, Veränderungen in Sozialstruktur und Arbeitswelt, Auseinanderdriften von oben und unten, von Mitte
Sinus-Milieus. Erstelldatum: / Version: 1. Methoden der Marktsegmentierung
 Erstelldatum: 07.02.13 / Version: 1 Sinus-Milieus Methoden der Marktsegmentierung Oberösterreich Tourismus Mag. Rainer Jelinek Tourismusentwicklung und Marktforschung Freistädter Straße 119, 4041 Linz,
Erstelldatum: 07.02.13 / Version: 1 Sinus-Milieus Methoden der Marktsegmentierung Oberösterreich Tourismus Mag. Rainer Jelinek Tourismusentwicklung und Marktforschung Freistädter Straße 119, 4041 Linz,
Die Sinus-Milieus für ein verändertes Österreich. Statistiktage 2016 der Österreichischen Statistischen Gesellschaft
 Die Sinus-Milieus für ein verändertes Österreich Statistiktage 2016 der Österreichischen Statistischen Gesellschaft 14. September 2016 Soziale Milieus und Wertewandel in Österreich Sinus-Milieus in Österreich
Die Sinus-Milieus für ein verändertes Österreich Statistiktage 2016 der Österreichischen Statistischen Gesellschaft 14. September 2016 Soziale Milieus und Wertewandel in Österreich Sinus-Milieus in Österreich
Für ein nachhaltiges Europa. Dr. Anja Weisgerber MdEP
 Für ein nachhaltiges Europa Dr. Anja Weisgerber MdEP Dr. Anja Weisgerber MdEP Für ein nachhaltiges Europa Was bedeutet Nachhaltigkeit? Was tut die EU in diesem Bereich? Konkretes Beispiel: Klimapaket Erneuerbare
Für ein nachhaltiges Europa Dr. Anja Weisgerber MdEP Dr. Anja Weisgerber MdEP Für ein nachhaltiges Europa Was bedeutet Nachhaltigkeit? Was tut die EU in diesem Bereich? Konkretes Beispiel: Klimapaket Erneuerbare
Existenzsicherung durch Grundeinkommen
 Existenzsicherung durch Grundeinkommen Recht auf oder Pflicht zur Arbeit? Roman Niedermann 8.11.2012 Was würden Sie arbeiten, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre? 1& Bedingungsloses Grundeinkommen! Armutsbekämpfend,
Existenzsicherung durch Grundeinkommen Recht auf oder Pflicht zur Arbeit? Roman Niedermann 8.11.2012 Was würden Sie arbeiten, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre? 1& Bedingungsloses Grundeinkommen! Armutsbekämpfend,
Einleitung Die Asymmetrie in den klassischen Theorien zur Europäischen Integration 10
 Inhalt Einleitung 7 1. Die Asymmetrie in den klassischen Theorien zur Europäischen Integration 10 2. Der Neogramscianismus 14 2.1. Das Hegemoniekonzept von Antonio Gramsci 17 2.2. Die Strukturelle Überakkumulation
Inhalt Einleitung 7 1. Die Asymmetrie in den klassischen Theorien zur Europäischen Integration 10 2. Der Neogramscianismus 14 2.1. Das Hegemoniekonzept von Antonio Gramsci 17 2.2. Die Strukturelle Überakkumulation
Möglichkeiten und Grenzen von Suffizienzpolitik mit dem Ziel Ressourcenschutz
 Möglichkeiten und Grenzen von Suffizienzpolitik mit dem Ziel Ressourcenschutz Dr. Corinna Fischer Tagung Damit gutes Leben mit der Natur einfacher wird - Suffizienzpolitik für Naturbewahrung und Ressourcenschutz
Möglichkeiten und Grenzen von Suffizienzpolitik mit dem Ziel Ressourcenschutz Dr. Corinna Fischer Tagung Damit gutes Leben mit der Natur einfacher wird - Suffizienzpolitik für Naturbewahrung und Ressourcenschutz
Karl Marx ( )
 Grundkurs Soziologie (GK I) BA Sozialwissenschaften Karl Marx (1818-1883) Kolossalfigur des 19. Jahrhunderts 1. Historischer Materialismus 2. Arbeit als Basis der Gesellschaft 3. Klassen und Klassenkämpfe
Grundkurs Soziologie (GK I) BA Sozialwissenschaften Karl Marx (1818-1883) Kolossalfigur des 19. Jahrhunderts 1. Historischer Materialismus 2. Arbeit als Basis der Gesellschaft 3. Klassen und Klassenkämpfe
Freiheit ermöglichen Gerechtigkeit schaffen Solidarität stärken die Idee des bedingungslosen Grundeinkommen
 Freiheit ermöglichen Gerechtigkeit schaffen Solidarität stärken die Idee des bedingungslosen Grundeinkommen Dr. Thomas Loer Initiative Freiheit statt Vollbeschäftigung In der Arbeitsgesellschaft: Arbeitsleistung
Freiheit ermöglichen Gerechtigkeit schaffen Solidarität stärken die Idee des bedingungslosen Grundeinkommen Dr. Thomas Loer Initiative Freiheit statt Vollbeschäftigung In der Arbeitsgesellschaft: Arbeitsleistung
Er soll für Dumpinglöhne arbeiten, sagen die Konservativen. Mehr SPD für Europa.
 Er soll für Dumpinglöhne arbeiten, sagen die Konservativen. Mehr SPD für Europa. 7. Juni Europawahl Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Europawahl am 7. Juni ist eine Richtungsentscheidung. Es geht
Er soll für Dumpinglöhne arbeiten, sagen die Konservativen. Mehr SPD für Europa. 7. Juni Europawahl Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Europawahl am 7. Juni ist eine Richtungsentscheidung. Es geht
SUFFIZIENZ PERSÖNLICH
 SUFFIZIENZ PERSÖNLICH Wo hast du Befreiung von Konsum erlebt? Reisen mit ganz wenig Gepäck Mobilität mit dem Rad neu erleben und genießen Verzicht auf Fernseher, dadurch weniger Werbung ausgesetzt und
SUFFIZIENZ PERSÖNLICH Wo hast du Befreiung von Konsum erlebt? Reisen mit ganz wenig Gepäck Mobilität mit dem Rad neu erleben und genießen Verzicht auf Fernseher, dadurch weniger Werbung ausgesetzt und
Leitartikel Weltnachrichten 4 / 2016
 Leitartikel Weltnachrichten 4 / 2016 Mit Eigenverantwortung zu einer wirksamen Entwicklung? Die Staaten der Welt haben im September 2015 neue Globale Ziele für Nachhaltige Entwicklung bis 2030 beschlossen.
Leitartikel Weltnachrichten 4 / 2016 Mit Eigenverantwortung zu einer wirksamen Entwicklung? Die Staaten der Welt haben im September 2015 neue Globale Ziele für Nachhaltige Entwicklung bis 2030 beschlossen.
Jahr für die Gemeinschaft
 Jahr für die Gemeinschaft Beschluss des Parteitags der Christlich-Sozialen Union am 29./30. Oktober 2010 in München Leitantrag des Parteivorstands Jahr für die Gemeinschaft Der Parteitag möge beschließen:
Jahr für die Gemeinschaft Beschluss des Parteitags der Christlich-Sozialen Union am 29./30. Oktober 2010 in München Leitantrag des Parteivorstands Jahr für die Gemeinschaft Der Parteitag möge beschließen:
Prävention und Gesundheitsförderung: Kompetenzentwicklung in Gesundheitsberufen
 Prof. Dr. Eberhard Göpel Prävention und Gesundheitsförderung: Kompetenzentwicklung in Gesundheitsberufen Osnabrück, 19.4.2012 Übersicht 1. Zum Gesundheitsbegriff 2. Zum historisch kulturellen Wandel der
Prof. Dr. Eberhard Göpel Prävention und Gesundheitsförderung: Kompetenzentwicklung in Gesundheitsberufen Osnabrück, 19.4.2012 Übersicht 1. Zum Gesundheitsbegriff 2. Zum historisch kulturellen Wandel der
Die Arbeitszeit in der Metall- und Elektro-Industrie
 Arbeitszeitumfragen 2017 Die Arbeitszeit in der Metall- und Elektro-Industrie Ergebnisse der Befragung unter Arbeitgebern und Arbeitnehmern Befragungszeitraum: Dezember 2016/Januar 2017 Arbeitszeitumfragen
Arbeitszeitumfragen 2017 Die Arbeitszeit in der Metall- und Elektro-Industrie Ergebnisse der Befragung unter Arbeitgebern und Arbeitnehmern Befragungszeitraum: Dezember 2016/Januar 2017 Arbeitszeitumfragen
Studiengebühren und Studienbeiträge Eine Modellanalyse
 Studiengebühren und Studienbeiträge Eine Modellanalyse Thorsten Lang Liberale Bildungsgespräche der Friedrich-Naumann- Stiftung: Hochschul- und Studienfinanzierung Mainz, 12. Mai 2005 Was ist und was macht
Studiengebühren und Studienbeiträge Eine Modellanalyse Thorsten Lang Liberale Bildungsgespräche der Friedrich-Naumann- Stiftung: Hochschul- und Studienfinanzierung Mainz, 12. Mai 2005 Was ist und was macht
Arbeit, Umwelt, Gerechtigkeit
 Arbeit, Umwelt, Gerechtigkeit Konzepte und Strategien zukunftsfähiger Entwicklung Wie»grün«muss DIE LINKE. sein? Konferenz Berlin, 12.Mai 2007 Dr. Joachim H. Spangenberg Dr. Joachim H. Spangenberg, Arbeit,
Arbeit, Umwelt, Gerechtigkeit Konzepte und Strategien zukunftsfähiger Entwicklung Wie»grün«muss DIE LINKE. sein? Konferenz Berlin, 12.Mai 2007 Dr. Joachim H. Spangenberg Dr. Joachim H. Spangenberg, Arbeit,
Ausgewachsen: Arbeit und Ressourcen. Friedrich Hinterberger und Christine Ax
 Ausgewachsen: Arbeit und Ressourcen Friedrich Hinterberger und Christine Ax Postwachstumsgesellschaft konkret FÖS-Jahreskongress, Berlin, 15.März 2013 wunder-bar Das gute Wachstum der 50er bis in die 70er
Ausgewachsen: Arbeit und Ressourcen Friedrich Hinterberger und Christine Ax Postwachstumsgesellschaft konkret FÖS-Jahreskongress, Berlin, 15.März 2013 wunder-bar Das gute Wachstum der 50er bis in die 70er
Green Economy. Neue Impulse durch Rio plus 20?
 Green Economy. Neue Impulse durch Rio plus 20? Prof. Dr. Werner Wild Fakultät Betriebswirtschaft an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg 5. Neumarkter Nachhaltigkeitskonferenz 29. Juni 2012. Neue Hoffnung
Green Economy. Neue Impulse durch Rio plus 20? Prof. Dr. Werner Wild Fakultät Betriebswirtschaft an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg 5. Neumarkter Nachhaltigkeitskonferenz 29. Juni 2012. Neue Hoffnung
Für eine europäische Investitionsoffensive
 Für eine europäische Investitionsoffensive Gewerkschaftliche Vorschläge für mehr Investitionen und deren Finanzierung FES-DGB-Konferenz Zukunft braucht Investitionen: Wie schließen wir die Investitionslücke
Für eine europäische Investitionsoffensive Gewerkschaftliche Vorschläge für mehr Investitionen und deren Finanzierung FES-DGB-Konferenz Zukunft braucht Investitionen: Wie schließen wir die Investitionslücke
Wachstum in der Marktwirtschaft - notwendige Bedingung und Sackgasse zugleich?
 Wachstum in der Marktwirtschaft - notwendige Bedingung und Sackgasse zugleich? Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe Wachstum wohin? der VHS Linz Montag, 24. März 2014 von Friederike Spiecker Friederike
Wachstum in der Marktwirtschaft - notwendige Bedingung und Sackgasse zugleich? Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe Wachstum wohin? der VHS Linz Montag, 24. März 2014 von Friederike Spiecker Friederike
