integrativ.es Esslinger Integrationsplan
|
|
|
- Frank Bauer
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 STADT ESSLINGEN AM NECKAR Fachrat für Migration und Integration FMI integrativ.es Esslinger Integrationsplan Anhang: Ergebnisse der empirischen Untersuchungen
2 Impressum Herausgeber Fachrat für Migration und Integration FMI Sprecher des FMI: Erdal Senbay Inhaltliche Koordination: Prof. Dr. Sylvia Greiffenhagen wissenschaftliche Recherchen und Begleitung COMPARE Consulting Dr. Marlen Niederberger im Auftrag des Gemeinderats der STADT ESSLINGEN AM NECKAR in Partnerschaft mit dem Beauftragten für Migration und Integration Stephan Stötzler-Nottrodt Mitglieder im Fachrat für Migration und Integration Fach- und sachkundig Karl-Heinz Aschenbrenner Selda Aydogan Stellv. Sprecherin Arife Bagci Demirkol Prof. Dr. Sylvia Greiffenhagen Hans Norbert Janowski Lisa Kappes-Sassano Stellv. Sprecherin Deniz Kiral Dr. Regina Kuppinger-Said Kornelija Ljubek-Pleš Josef Minarsch-Engisch Peter Schaal-Ahlers Erdal Senbay Sprecher Für die Gemeinderatsfraktionen Adolf Bayer Freie Wähler Gerhard Deffner CDU Brigitte Krömer-Schmeisser SPD Claudia Wild B90/Grüne Geschäftsstelle STADT ESSLINGEN AM NECKAR Referat für Migration und Integration Rathausplatz 2/ Esslingen Tel.: +49(0)711 / Fax: +49(0)711 / Referat-Migration-Integration@esslingen.de Oktober 2012
3 Esslinger Integrationsplan integrativ.es Liebe Esslingerinnen, liebe Esslinger! Integration muss Chefsache werden. Diese Forderung erhebt der Nationale Integrationsplan der Bundesregierung gegenüber den Städten. Dieser Aufgabe stelle ich mich als Oberbürgermeister, möchte jedoch in Esslingen die ganze Stadt mit einbeziehen. Dabei dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass Integration keine Angelegenheit allein der Menschen mit so genanntem Migrationshintergrund ist. Integrativ.ES: Das Zusammenleben von Esslingerinnen und Esslingern mit oder ohne jenen Migrationshintergrund geht uns alle an Integration ist die aktive Gestaltung von Vielfalt auf allen Ebenen! Eine Lebensgrundlage unserer Stadt war und ist ihre offene Ausstrahlung. Esslingen ist, Dank ihrer Menschen, eine vielfältige und internationale Stadt. Reich an über Jahren Tradition, ist Esslingen eine moderne, fortschrittliche und abwechslungsreiche Stadt. Eine Stadt, in der es sich egal welcher Herkunft für alle gut wohnen, arbeiten und leben lässt. Über Jahrhunderte hinweg ist Esslingen geprägt durch die Zuwanderung von Menschen. Vor allem in den letzten 60 Jahren ist die Zusammensetzung unserer Bevölkerung sehr viel bunter geworden. In Esslingen leben Menschen aus aller Welt. Die Grenze dessen, was als 'fremd' empfunden wird, ist dabei immer weiter in die Ferne gerückt. Parallel dazu haben jüngere Generationen seltener eine eigene, persönliche Migrationsgeschichte und verstehen sich zurecht als selbstverständlichen Teil Ihrer Stadt. Diese Vielfalt unserer Bevölkerung beschränkt sich nicht auf Herkunftsgeschichten, sondern umfasst zugleich die Lebenserfahrungen mehrerer Generationen. Sie beinhalten die große Spannbreite beruflicher Werdegänge und sozialer Lagen, sehr unterschiedliche Interessen und Wünsche für ein selbstbestimmtes Leben, vielfache Erwartungen an Familie, an einen Beruf und an unser Zusammenleben. Menschen unterscheiden sich nicht nur, sie ändern sich auch im Laufe ihres Lebens und von Generation zu Generation. Und nicht nur das wir beeinflussen einander mit allen unseren Unterschieden. Wir haben das Glück, in einem freien Land zu leben. Andere Lebensentwürfe und abweichende Erwartungen werden heute offener ausgelebt als noch vor einigen Jahrzehnten.
4 Auch in Esslingen haben wir es in Einzelfällen mit abweichenden Meinungsprofilen zu tun, die stärker sind als das Gefühl der Zugehörigkeit. Dies ist ebenfalls eine Facette von Integration. Die aktive Gestaltung von Vielfalt auf allen Ebenen wird dadurch nicht geringer. In einer Demokratie haben wir immer wieder die Fragen zu beantworten: Was hält unsere Gesellschaft zusammen und was macht sie zukunftsfähig? Eine (Integrations-)Politik, die Menschen wirklich erreichen will und verbindliche Grundlagen des Zusammenlebens vermitteln und fördern soll, hat all dies zu berücksichtigen: unseren vielschichtigen, abwechslungsreichen Alltag. Daher beschäftigt sich der Esslinger Integrationsplan mit dieser Vielfalt, den daraus resultierenden Fragen und Themen und natürlich mit den vorhandenen Potentialen und Chancen, von denen unsere Stadt lebt. Der Esslinger Integrationsplan, der Gemeinderat, der Fachrat für Migration und Integration, die Stadtverwaltung und ich nehmen die urbane Realität ernst. Vielfalt war und ist ein Motor des gesellschaftlichen Wandels und verleiht städtischen Zentren eine neue Dynamik, enorme Pluralität und internationale Atmosphäre. Seinen Lebensmittelpunkt in Esslingen zu haben, bedeutet mehr als nur die Wahl des Wohnortes. Es bedeutet einen Raum zu finden und willkommen zu sein. Im Vordergrund steht dabei die Idee, dass alle gemeinsam die Einzigartigkeit und den Reichtum unserer Stadt ausmachen. Für alle ist hier ein Platz vorhanden. Ein Platz, um persönliche und gemeinsame Freiräume zu verwirklichen. Dabei braucht unsere Stadtgesellschaft eine von allen geteilte Sicht von Wirklichkeit, Vorstellungen von einer gemeinsamen Zukunft, Formen und Symbole der Zugehörigkeit, eine Verständigung über Pflichten, Rechte und Möglichkeiten der Teilhabe. Bei allen Unterschieden stellt sich uns immer neu die Frage: Wie wollen wir zusammenleben? Ich lade Sie ein, darauf Antworten bei der gemeinschaftlichen Weiterentwicklung des Esslinger Integrationsplanes zu finden! Gestalten Sie aktiv mit! Ihr Dr. Jürgen Zieger Oberbürgermeister
5 integrativ.es Liebe Esslingerinnen, liebe Esslinger, wir Sozialbürgermeister und Beauftragter für Migration und Integration nutzen die Chance eines gemeinsamen Vorwortes zu den im Esslinger Integrationsplan aufgegriffenen komplexen Themen: Unsere Stadt das Gemeinwesen Esslingen steht für Offenheit und Vielfalt. Ihre Einwohnerinnen und Einwohner sind Multiplikatoren für Informationen und Wissen. Gleichzeitig sind sie Ansprechpartner für gegenseitige Kontakte und das sich Kennen (-lernen) untereinander. So gesehen ist Esslingen ein Dachverband, der Interessen bündelt, der gemeinsam Projekte und Aktivitäten plant, organisiert und durchführt. Alle Einwohnerinnen und Einwohner bringen aufgrund ihrer verschiedenen Lebens- und Berufserfahrungen sowie ihres jeweiligen ethnischen Hintergrunds ein breites Spektrum persönlicher Fähigkeiten mit ein. In einer win-win-situation profitieren die einzelnen Mitglieder, der Gemeinderat, die Stadtverwaltung und vor allem die Kommune als Ganzes von den mitgebrachten Erfahrungen, dem vorhandenen Wissen und den unterschiedlichsten Kompetenzen. Der vorliegende Esslinger Integrationsplan (ESIP) wurde maßgeblich durch die freiwillig ehrenamtlich agierenden Mitglieder des Fachrates für Migration und Integration erarbeitet. Er zeigt Chancen auf, die ein besseres gegenseitiges Verständnis zwischen Esslingerinnen und Esslingern mit und ohne Migrationshintergrund (MHG) ermöglichen. Für das Aufzeigen dieser Chancen, vor allem aber für das kompetente, zeitintensive, beharrliche sowie leidenschaftliche Engagement gilt jedem einzelnen Mitglied des Fachrats für Migration und Integration unsere besondere Annerkennung und unser Dank auch und gerade im Namen aller Esslingerinnen und Esslinger! Der ESIP bietet eine Plattform für Toleranz und Respekt, für Transfer und für wechselseitige Unterstützung. Seine politische Wirkung und der Wunsch des Sichtbarwerdens in der Öffentlichkeit als ein sich stetig fortschreibendes Manuskript für die gelebte Interessengemeinschaft, in der die Chancengerechtigkeit und das Miteinander Maxime sind, bilden den Garant, kommunale Integrationsarbeit erfolgreich und aktiv zu gestalten: Beteiligend auf Augenhöhe von Anfang an und nicht den Fehler begehend, ein fertiges Konzept quasi überstülpen zu wollen.
6 Er bildet die Grundlage für die künftig zu führenden Diskussionen über Integrationspolitik in unserer Stadt. Wir laden alle ein, uns ihre Gedanken, Ergänzungen und Änderungsvorschläge mitzuteilen, um sie in den sich weiter entwickelnden ESIP einzuarbeiten. Gleichberechtigte Teilhabe ohne einseitige Bedingungen ermöglichen erst Konzepte bzw. deren Umsetzung und Weiterentwicklung wie den ESIP. Vielfalt war und ist gewünscht, wird nicht gebremst und wird als positive Ressource gesehen. Durch den ESIP fällt es leichter, das teils heftig diskutierte Thema Migration und Integration aus betroffener Perspektive wahrzunehmen bzw. die Perspektive zu wechseln. Er ist eine ideale Basis niederschwellig und unkompliziert ins Gespräch zu kommen, um konkret daran mitzuwirken, Entscheidungen zu treffen. Keine kleine Schwierigkeit in vielen Diskussionen ist, dass der Fokus zu sehr auf Separation liegt: Es wird immer wieder betont, dass allgemein Migranten angeblich zu wenig tun, um sich zu integrieren und Integration letztendlich nicht wollen. Dies pauschaliert den Ausnahme-, nicht den Regelfall, entspricht also nicht der Realität und unterschlägt dazu, dass Menschen mit MHG nach wie vor mit schwierigen Rahmenbedingungen zu kämpfen haben. Nur wenigen ist bewusst, wie kompliziert unser System auf die Mehrzahl von Migranten wirken kann, ja wirken muss. Wie sich viele in den oft unübersichtlichen Strukturen verirren und was am bedauerlichsten ist: es wird über Menschen geredet, als wären sie Objekte. Zu selten wird erkannt, welche Wirkung eine einseitige Negativdarstellung auf die Lebens- und Gefühlswelt von Betroffenen hat: So fühlen sich nicht wenige subjektiv verloren auf ihrem Weg hinein in die Aufnahmegesellschaft, da trotz oder wegen zahlreicher Angebote und Projekten der Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen wird, nicht gesehen werden kann. Viele empfinden Ohnmacht, bedingt durch ein Nichtanerkennen ihrer persönlichen Kompetenzen oder ihrer ausländischen Qualifikation bzw. ihrer mitgebrachten Berufserfahrung. Fast alle spüren die Zerrissenheit, zwischen den Kulturen zu stehen; oftmals weder von der Herkunftskultur noch der hiesigen Kultur anerkannt zu werden; als Außenseiter zu gelten egal wo man gerade ist. Der Einfluss der Familie und traditionelle Zwänge beeinflussen die individuelle Entwicklung bisweilen noch zu stark. Distanz und Kühle werden sensibel wahrgenommenen; man sieht sich auf seine Herkunft reduziert und wird mit schubladenhaften Vorurteilen konfrontiert. Vorurteile, die der eigenen Geschichte und Persönlichkeit nicht im Geringsten gerecht werden und so massiv fälschlich vereinfachen, dass es nur verletzend und diskriminierend sein kann. Verletzend auch durch eine fehlende bzw. unzureichende Willkommenskultur und eine zunehmende Abwehrhaltung gegenüber Anderem und Fremdem. Wie würden wir uns, wie würde ich mich unter diesen Rahmenbedingungen fühlen? Kann unter diesen Umständen die empfundene Fremde, kann Esslingen überhaupt zu einer zweiten, zu der eigentlichen Heimat werden? Als mögliche Antwort reduzieren viele das Thema auf: Hauptsache die Sprache wird beherrscht, dann regelt sich alles von alleine
7 Nein. Diesem Trugschluss sitzen wir in Esslingen nicht auf. An der Vergangenheit und an dem unzureichenden Umgang mit den Themen Migration, Integration und Spracherwerb können wir nichts ändern. Wir können jedoch der Ist-Situation ins Auge schauen und Verantwortung für einen Prozess der gesellschaftlichen Veränderung übernehmen. Wir haben es jederzeit in der Hand, andere anzusprechen, ihnen Hilfe anzubieten, ihnen Mentor und Wegweiser zu sein, ohne erhobenen Zeigefinger, ohne zu belehren. Belohnt werden sie und wir sprechen hier aus großer Erfahrung mit Dankbarkeit, Herzlichkeit und Wärme. Umstände, die im Alltagsleben einfach nur gut tun. Integration vollzieht sich nun mal am deutlichsten im Umgang miteinander. Vollzieht sich im Alltag in unserer in Ihrer Stadt. Ob im täglichen Begegnen, wie in der Nachbarschaft, beim Einkauf, in den Kindergärten, in den Schulen, bei der Arbeit oder beim aufmerksamen Lesen des ESIP. Der ESIP erfüllt eine gute und wichtige Funktion. Er ist ein Richtungszeiger mit dem wir, trotz oder gerade wegen aller Gemeinsamkeit, unsere Unterschiedlichkeit anerkennen. Wenn er dazu beiträgt, dass ein echtes Interesse und eine wohlwollende Neugierde für Esslingerinnen und Esslinger anderer Herkunft geweckt bzw. befriedigt wird, wenn die in ihm beschriebenen Erkenntnisse in den Alltag, in die Politik und die Verwaltung hinein genommen und im Miteinander gelebt werden, ist das Ziel des ESIP erreicht. Nicht allein deshalb ist es angebracht, dass unsere kommunale Migrations- und Integrationspolitik mit den Erkenntnissen des vorliegenden Integrationsplanes noch mehr Gewicht auf das Anerkennen, das Fördern aber auch Fordern und die Zusammenarbeit aller legt. Dies ist der Vernunft entsprechende beste Weg. Dass wir auf diesem besten Wege sind, davon sind wir überzeugt. Aus dieser Überzeugung heraus sind wir sicher, dass wir unsere Stadt nur gemeinsam weiter entwickeln können. Auch und gerade im Sinne des ESIP: Im Sinne des Bewahrens der eigenen Wurzeln und der dafür notwendigen Entscheidungen, eine unteilbare Zukunft in Esslingen über alle Herkünfte und Generationen hinweg zu gestalten. Für uns gilt: Wir, Sozialbürgermeister und Beauftragter für Migration und Integration, sind stolz darauf Teil einer lebendigen, agilen, eben einer bunten Stadt zu sein. Die daraus entstehenden Chancen gilt es zu sehen und zu nutzen. Es gilt, sie als Bereicherung zu verstehen. Bisweilen mit gelegentlichen Ecken und Kanten versehen, die wir ausnahmslos in der Lage sind, auszuhalten bzw. auch bereit sind, sie für alle dienlich über die Zeit abzuschleifen. Vielfalt bedeutet Fortschritt Einfalt bedeutet Stagnation. Ihr Ihr Dr. Markus Raab Bürgermeister für Ordnungs-, Sozial-, Kultur-, Schul- und Sportwesen Stephan Stötzler-Nottrodt Beauftragter für Migration und Integration
8 Inhalt 1. Einleitung Entstehungsgeschichte des Esslinger Integrationsplans Konkretisierung nationaler Integrationserfordernisse für die Stadt Esslingen Leitlinien für die Integrationspolitik Integration und Migration in Esslingen Stärken und Schwächen der Esslinger Integrationspolitik Vorgehensweise bei der Erstellung des ESIP Zu Hause in Esslingen: Lebensbedingungen von Menschen mit Migrationshintergrund Wesentliche Daten Die jeweilige Lage in den verschiedenen Lebensfeldern Ökonomische Situation Wohnen Arbeit und Ausbildung Freizeit Gesundheit Soziale Einbindung Medien und Integration Politische Teilhabe und Teilhabe an der öffentlichen Verwaltung Rechtsstatus Fazit Integrationspolitik in Bund, Land und Stadt. Handlungsfelder und Zielrichtungen Sprache Bildung Ausbildung Arbeitsmarktchancen Integration vor Ort Wohnen Interkulturelle Öffnung der Verwaltung Integration als Querschnittsaufgabe Bürgerschaftliches Engagement, gleichberechtigte Teilhabe/gesellschaftliche und politische Partizipation Kultur, Sport und Gesundheit Kultur... 34
9 Sport Gesundheit und Pflege Rechtliche Integration Integrationspolitik in Esslingen. Strukturelle Rahmenbedingungen und Angebote Kommunale Rahmenbedingungen Angebote im Themenfeld Migration und Integration Integrationspolitik aus Sicht der InterviewpartnerInnen Die Online-Befragung Abgeschlossene Projekte Laufende Projekte Fazit Wie und wo kann Integration besser gelingen? Einleitung Was heißt Integration? Integration und Inklusion Kritik am Integrationsmodell Vorschläge und Erfordernisse Zur Organisation von Integration in der Verwaltung Wohnen Arbeit Erziehung und Bildung Kultur Gesundheit und Pflege Sport Jugendliche Diskriminierung, Rassismus und rechtsradikale Aktivitäten Religion in der Gesellschaft Medien und Integration Bürgerschaftliches Engagement und politische Partizipation Fazit Relevante Literatur und Links Verzeichnis der ESIP-AutorInnen und InterviewerInnen... 70
10 Abkürzungsverzeichnis AWO: BIBB: BAMF: ES: ESIP: EWB: FMI: GR: GWA: LIP: MHG: NIP: RMI: RSKN: SGB: SOEP: SWR: VHS: Arbeiterwohlfahrt Bundesinstitut für Berufsbildung Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Esslingen Esslinger Integrationsplan Esslinger Wohnungsbau GmbH Fachrat für Integration und Migration Gemeinderat Gemeinwesenarbeit Brühl Integrationsplan Baden-Württemberg Migrationshintergrund Nationale Integrationsplan Referat für Migration und Integration Rüdern, Sulzgries, Krummenacker und Neckarhalde Sozialgesetzbuch Sozioökonomisches Panel Südwestrundfunk Volkshochschule
11 1. Einleitung 1.1. Entstehungsgeschichte des Esslinger Integrationsplans Im Januar 2008 hatte der vom Gemeinderat (GR) der Stadt Esslingen berufene Fachrat für Migration und Integration (FMI) seine konstituierende Sitzung. Noch im selben Monat in der ersten Klausurtagung des FMI wurde über einen Esslinger Integrationsplan (ESIP) als ein zentrales Grundlageninstrument für die künftige städtische Integrationspolitik diskutiert. Nach Beratungen mit der Stadtverwaltung, den Fraktionen und im FMI selbst legte der FMI Ende 2009 ein Konzept für die Erarbeitung eines ESIP im GR vor und sagte zugleich seine federführende Mitwirkung zu. Mit Beschluss vom erteilte der GR dem FMI den Auftrag, den geforderten Integrationsplan in eigener Regie und Verantwortung zu erstellen. Für die dafür notwendigen Planungsschritte bzw. die Entwicklung des Integrationsplans wurden ,- Euro für Sachkosten und das Hinzuziehen einer externen wissenschaftlichen Fachkraft bewilligt. Der nun vorliegende ESIP gründet auf einem gemeinsamen Verständnis von Integration und Integrationszielen. Er benennt Rahmenbedingungen zur Teilhabe aller und dient als Basis für eine respektvolle Begegnung und den Abbau gegenseitiger Vorurteile. Der ESIP fordert und fördert den kommunalen Diskurs sowie die selbst verpflichtende Mitwirkung aller in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich. Unter Integration von Menschen mit Migrationshintergrund (MHG) und mit Behinderungen oder anderen Benachteiligungen wird hier der Prozess einer kulturellen und sozialen Annäherung verstanden, der gegenseitige Auseinandersetzung einschließt, das Auffinden von Gemeinsamkeiten und Unterschieden erlaubt und gleichzeitig die Übernahme von gemeinschaftlicher und partnerschaftlicher Verantwortung durch die Mehrheitsbevölkerung und die Zugewanderten, d. h. die aktive gesellschaftliche und politische Teilnahme ermöglicht. Ausschluss und Separation von Personen und Gruppen soll verhindert bzw. überwunden werden; zugleich verlangt Integration im Unterschied zur Anpassung (Assimilation) nicht die Aufgabe der eigenen kulturellen Identität. Ziel ist die vom Grundgesetz formulierte und gesicherte Wertegemeinschaft, die auch Gruppen und Personen einbezieht, die zunächst andere Werthaltungen vertreten (vgl. ausführlicher im Kapitel 5) Konkretisierung nationaler Integrationserfordernisse für die Stadt Esslingen Auf Bundes- und Länderebene sind zu den Bereichen Migration und Integration im Laufe der vergangenen Jahrzehnte wichtige Handlungsfelder benannt und Handlungsansätze erarbeitet worden. ExpertInnen aus Theorie und Praxis lieferten Grundlagenmaterial für die Integrationspolitik in unterschiedlichsten Aspekten und Anwendungsfeldern. Kommunen machten sich auf den Weg einer Differenzierung und Konkretisierung solcher Arbeitsansätze für die jeweiligen lokalen Gegebenheiten und Anforderungen. Dabei muss keine Kommune das Rad neu erfinden. Die Chancen und Defizite der deutschen Integrationspolitik sind mittlerweile bekannt, Handlungsfelder und Zielgruppen definiert, entsprechende Maßnahmen praxisbezogen entwickelt und zumindest in Teilen bereits umgesetzt. Seite 1
12 Speziell in Esslingen konnten alle an der Erarbeitung des ESIP Beteiligten auf zahlreich vorhandene Grundlagen zurückgreifen. Die (Haupt-)Aufgabe besteht in der Konkretisierung für die spezifischen Esslinger Belange Leitlinien für die Integrationspolitik Leitlinien für die Integrationspolitik wurden bisher vorwiegend durch Bund und Länder sowie durch wissenschaftliche Gremien definiert. Aber auch für Esslingen liegen Leitlinien vor, die dem Sinn nach unter anderem im Prozess der Stadtstrategie 2027 entwickelt und bestätigt wurden: Integration mit all ihren Facetten ist für unsere moderne Gesellschaft eine zentrale Herausforderung diese Herausforderung muss angenommen werden. Dabei gilt es, die kulturelle, ethnische und religiöse Verschiedenheit mit Blick auf Zuwanderungsrealität anzuerkennen Grundlagen für gelingende Integration sind Toleranz und Offenheit sowie die Sicherung von Chancengerechtigkeit, interkultureller Öffnung und Partizipationsmöglichkeiten die Menschen wollen dabei nicht als Objekte oder Zielgruppen von Integrationspolitik verstanden werden, sondern als deren wesentliche AkteurInnen und PartnerInnen Integration und Migration in Esslingen Ein Integrationsplan für Esslingen muss sich grundsätzlich mit allen Gruppen und Themen befassen, die das soziale Miteinander des städtischen Lebens durch Spaltungstendenzen gefährden. Thematisiert werden müsste eigentlich das Zusammenleben von Jungen und Alten, Armen und Reichen, Menschen mit und ohne Behinderung, sowie Menschen mit oder ohne MHG. Ein solch umfassendes Werk hätte die Möglichkeiten der freiwillig ehrenamtlich am ESIP arbeitenden Mitglieder des FMI überfordert. Deshalb rückt der vorliegende Integrationsplan zunächst einen Schwerpunkt von Integrationspolitik in den Fokus: die Integration von Menschen mit MHG. Insofern ist der ESIP kein abgeschlossenes Werk, sondern der Beitrag eines regelmäßig fortzuschreibenden Arbeitspapiers. Esslingen ist eine heterogene und internationale Stadt. Hier leben Menschen mit Herkünften aus 132 Ländern. Wie andere Kommunen mit hohem Migrantenanteil von EinwohnerInnen haben 36,6 % einen MHG und 19,7 % EinwohnerInnen eine ausländische Staatsbürgerschaft (Stand: Dezember 2011) steht auch Esslingen vor beachtlichen Herausforderungen. Zugleich bietet diese Internationalität als Standort- und als Qualifizierungsfaktor vielfältige Chancen. Zu fordern und zu fördern ist dabei einerseits die Integrationsbereitschaft von MigrantInnen, andererseits auch die Bereitschaft der Aufnahmegesellschaft, sich weiter zu öffnen. Beides ist nur möglich in einem Prozess der Verständigung und der Kompromissfähigkeit. Dieser Prozess stärkt das solidarische und demokratische Zusammenleben in unserer Stadt und ist Voraussetzung für die Schaffung von Chancengerechtigkeit für alle EsslingerInnen. Integration als Querschnittsaufgabe ist somit ein wesentlicher Bestandteil einer allgemeinen und ganzheitlichen Stadtpolitik. Seite 2
13 1.5. Stärken und Schwächen der Esslinger Integrationspolitik Die Esslinger Integrationspolitik hat ein beachtliches Niveau erreicht. Ihre Projekte und Maßnahmen finden über die Stadtgrenzen hinaus Interesse, Anerkennung und Nachahmung. Dennoch ist eine Weiterentwicklung der Arbeit nötig und möglich, sowohl inhaltlich als auch organisatorisch. Der Integrationsplan ergänzt die Erkenntnisse aus ESsense und dem Strategieprozess 2027 um konkretere und differenziertere Handlungsempfehlungen. Auf diese Weise entsteht ein Handlungsrahmen, der die örtlichen Gegebenheiten und Bedarfslagen erfasst, analysiert und (weiter-)entwickelt. Eine Bewertung der bisher verfolgten und künftigen Arbeit schafft Sicherheit bei der Priorisierung einzelner Maßnahmen. Die Orientierung an vorhandenen städtischen Plänen (Sozialdatenatlas, Schulentwicklungsplanung, Jugendförderplan, Spielraumleitplanung, etc.) soll Parallelstrukturen vermeiden, Potenziale nutzen, Ressourcen bündeln und auf diese Weise Effektivität steigern. Die vorhandene, in vielen Bereichen selbstverständliche und stetig zunehmende fach-, amt- und dezernatübergreifende Zusammenarbeit soll hierfür weiter ausgebaut werden, genauso wie die Kooperation und die beständig wachsende Vernetzung mit allen relevanten AkteurInnen vor Ort Vorgehensweise bei der Erstellung des ESIP Den ersten Schritt bildete eine Bestandsanalyse der Institutionen, Leistungen und Angebote vor Ort: Was bieten die Kommune, die Schulen, die Kirchen und andere Einrichtungen, die freien Träger und Vereine für EsslingerInnen mit MHG? Werden die Zielgruppen erreicht? Was fehlt? In einem im FMI abgestimmten Fragebogen wurden 821 Esslinger Institutionen und Initiativen, die mehrheitlich auf dem Feld der Integrations-/Migrationspolitik tätig sind, nach ihren Projekten und Aktivitäten zum Teil mündlich vertiefend befragt. Gleichzeitig wurden sie um ihre Einschätzung der Lebenssituationen von EsslingerInnen mit MHG sowie um die Bewertung der derzeitigen Esslinger Integrations-/Migrationspolitik und möglicher künftiger Bedarfe gebeten. Eine repräsentative Befragung der Zielgruppe war aus Kostengründen nicht möglich. Deshalb wurde das objektive und subjektive Wissen aktiver Multiplikatoren über die Lebenslagen Betroffener im Blick auf unterschiedlichste Lebensfelder genutzt (Wohnen, Arbeit und Freizeit, Gesundheit, Bildung etc.). Für illustrative Fallstudien wurden außerdem Interviews mit einzelnen EsslingerInnen mit MHG geführt. Der hohe Rücklauf an Fragebögen (36,42 %) bestätigt, dass ein großer Teil der Einrichtungen erreicht wurde, und unterstreicht zudem die Wichtigkeit des abgefragten Themas. Die Analyse der empirischen Untersuchungen liefert somit eine gute und aussagekräftige Datengrundlage für die Entwicklung von Maßnahmen. Ausgehend von den gewonnenen Informationen mussten im nächsten Schritt, zugeschnitten auf die örtlichen Rahmenbedingungen, Ziele und Handlungsempfehlungen für die städtische Integrationspolitik erarbeitet werden, bis hin zu konkreten Vorschlägen. Sowohl bei der Situations- und Bestandsanalyse als auch beim Erarbeiten von Handlungsvorschlägen wurden unterschiedlichste AkteurInnen beteiligt, ExpertInnen in Einrichtungen, Politik und Verwaltung ebenso wie Betroffene in Vereinen und sonstigen Gruppen. Auf diese Seite 3
14 Weise konnte das gegenseitige Vertrauen gestärkt und weit möglichst sichergestellt werden, dass die daraus abzuleitenden Maßnahmen die potenziellen Adressaten tatsächlich erreichen. Wenn die ersten Maßnahmen umgesetzt sind, sollen in regelmäßigen Abständen und mit verschiedenen Methoden Erfolgskontrollen durchgeführt werden, um die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit des Entwicklungsprozesses zu erhöhen. 2. Zu Hause in Esslingen: Lebensbedingungen von Menschen mit Migrationshintergrund 2.1. Wesentliche Daten Ca. ein Drittel (36 %) aller EsslingerInnen haben einen MHG, bei steigender Tendenz. Unter Menschen mit Migrationshintergrund versteht der vorliegende Integrationsplan, der Definition des Nationalen Integrationsplans/Mikrozensus folgend, AusländerInnen, ehemalige Gastarbeiterfamilien, MigrantInnen, Kinder und Kindeskinder, Flüchtlinge, jüdische Kontingentflüchtlinge, AsylbewerberInnen, SpätaussiedlerInnen und Eingebürgerte. 19,4 % dieser Menschen haben eine ausländische Staatsangehörigkeit, Tendenz fallend. Davon leben drei Viertel seit mindestens acht Jahren, 41 % seit mindestens 20 Jahren und 27 % seit mehr als 30 Jahren in Deutschland, in Esslingen und/oder wurden hier geboren. 132 unterschiedliche Nationalitäten sind in Esslingen vertreten Die jeweilige Lage in den verschiedenen Lebensfeldern Nicht zu allen der nachfolgend beschriebenen Themen liegen den AutorInnen des ESIP statistische Angaben vor. Die Darstellung beruht deshalb vorwiegend auf den Erkenntnissen aus der schriftlichen Befragung aller wichtigen Institutionen und Vereine sowie auf den mündlichen Interviews mit ExpertInnen und MultiplikatorInnen. Eine wichtige Quelle bieten außerdem die Kenntnisse und Erfahrungen von Mitgliedern des Referates für Migration und Integration (RMI) und des FMI. Die Berichte über Esslinger Lebensbedingungen und Lebenslagen von Menschen mit MHG wurden mit umfangreichem Datenmaterial auf Bundes- und Länder- (bzw. Landes-) Ebene und aus wissenschaftlichen Studien abgeglichen. 1 Dabei zeigen sich für Esslingen ähnliche Verhältnisse wie auf anderen politischen Ebenen und in anderen deutschen Regionen. Vieles spricht dafür, dass Menschen mit MHG in Esslingen rein quantitativ betrachtet im Ganzen unter etwas besseren Bedingungen leben als anderswo. Trotzdem kennen MigrantInnen in Esslingen die grundsätzlich gleichen Probleme wie in anderen Regionen und Städten. 1 Vgl. u. a. die Daten im Nationalen Integrationsplan und im Integrationsplan für Baden-Württemberg, die Publikationen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, die Veröffentlichungen des Sozioökonomischen Panels (SOEP), die Studie des Zentrums für Türkei-Studien 2009 ( Schäuble-Bericht ), die verschiedenen BIBB- Studien, mehrere Berichte des Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden- Württemberg, mehrere Themenhefte der Zeitschrift Wiso Diskurs der Friedrich-Ebert-Stiftung (Expertisen und Dokumentationen zur Wirtschafts- und Sozialpolitik), mehrere Themenhefte zum Themenkreis Migration in der Zeitschrift Aus Politik und Zeitgeschichte (Beilage der Wochenzeitung Das Parlament) und zahlreiche einzelne wissenschaftliche Studien. Seite 4
15 Die AutorInnen des ESIP sind sich bewusst, dass von den Menschen mit MHG nicht die Rede sein kann: Wie groß die Heterogenität innerhalb dieser Bevölkerungsgruppe ist, zeigen neben dem eigenen Augenschein zahlreiche Veröffentlichungen, unter anderem die 2007/2008 bekannt gewordene Sinus-Studie. In dieser Untersuchung werden MigrantInnen wie in früheren Jahren die deutsche Bevölkerung insgesamt sozialen Milieus zugeordnet, die unterschiedlicher nicht sein können. Die Studie erlaubt einen differenzierenden Blick auf die Bevölkerungsgruppe mit MHG. (Sie wird insofern kritisiert, als sie quantitativ wenig relevant ist, denn es wurde nur eine geringe Anzahl von MigrantInnen interviewt.) Sehr unterschiedliche Urteile gaben auch die für den ESIP schriftlich und mündlich befragten Personen für die spezifische Esslinger Situation ab. Auch die folgende Darstellung versucht einen differenzierenden Blick; sie legt ihren Schwerpunkt allerdings auf solche Personen und Gruppen, deren Lebensbedingungen im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt eher ungünstig sind. Die Texte zu den einzelnen Lebensfeldern sind bewusst kurz gehalten; sie können und sollen nur die wichtigsten Grundeinsichten vermitteln. Dem Text werden Interviews und Fallgeschichten eingefügt, die im Einzelfall gelingende oder schwierige Integrationsprozesse anschaulich wiedergeben. Die Interviews folgen in der Regel einem Leitfaden: Vorname/Geschlecht, Alter, Herkunftsland, Jahr der Ankunft in Deutschland/Esslingen, Generation, Generationsprobleme mit Kindern, Eltern etc., eigener Beruf, Ausbildung auch der Eltern, kurzer Lebenslauf, persönliche Bewertung und Begründung der Integration: günstige oder hemmende Umstände? Lebenskurven; besondere Orte für Heimat oder Segregation? Aktivitäten für andere? Lebensmaxime Ökonomische Situation Die wirtschaftliche(n) Situation(en) von Menschen und Familien mit MHG unterscheiden sich stark voneinander, entsprechend deren jeweiligen Ausbildungen, Berufen und sonstigen Lebensumständen. Ein kleiner Teil der Menschen und Familien mit MHG verfügt über ein relativ hohes Einkommen und Vermögen. Zu dieser Gruppe gehören insbesondere Selbständige und höhere Angestellte, meist mit akademischer Ausbildung. Ein großer Kreis von Menschen und Familien mit MHG lebt in ausreichend bis gut zu nennenden finanziellen Verhältnissen. Hier handelt es sich häufig um (Fach-)ArbeiterInnen der größeren regionalen Unternehmen in Handwerk und Industrie. Oft beziehen auch die Ehefrauen und jüngeren Familienmitglieder noch ein zusätzliches Einkommen, das den Lebensstandard der Familie insgesamt hebt. Diese Menschen sind in ökonomischer Hinsicht ihren herkunftsdeutschen KollegInnen mit entsprechenden Ausbildungsgängen und Berufen in etwa vergleichbar; zwei Unterschiede gilt es aber zu bedenken: Zum einen versorgen Menschen und Familien mit MHG in vielen Fällen mit ihrem Einkommen Verwandte in ihren Herkunftsländern und/oder in finanzielle Schwierigkeiten geratene Familienmitglieder in der näheren Umgebung noch mit, so dass sich das für den eigenen Konsum zur Verfügung stehende Einkommen verringert. Zum anderen zeigt die Erfahrung, dass Menschen mit MHG in wirtschaftlichen Krisenzeiten eher durch den Verlust ihres Arbeitsplatzes bedroht sind als ihre herkunftsdeutschen KollegInnen. Die ökonomische Situation von Menschen und Familien mit MHG muss deshalb auch bei gutem Verdienst statistisch als etwas ungünstiger eingeschätzt werden, als das bei Personen deutscher Herkunft der Fall ist. Seite 5
16 Erkan: männlich, 55 Jahre 2 Türkei 1980 Deutschland/ 1983 Esslingen 1.Generation Nach dem frühen Tod des Vaters hat sich mein großer Bruder um die Familie gekümmert. Programmierer, Fachhochschulabschluss in Informatik für Maschinenbau beide Eltern ohne Berufsausbildung Geboren und aufgewachsen in Sivas. Diplom-Studium Maschinenbau an der Universität in Istanbul mit Abschluss. Kurz vor dem Militärputsch 1980 nach Deutschland geflohen. Das Diplom wurde in Deutschland nicht anerkannt, nur zwei Semester wurden angerechnet Heirat, ein Sohn. Zunächst Arbeit als Maschinenbediener, durch zusätzliche Lehrgänge und ab 1989 Aufbaustudium an der Fachhochschule Esslingen zum Maschinenbau-Informatiker. Seitdem arbeite ich als Programmierer. Das sind jetzt 26 Jahre in der gleichen Firma. Von mir aus kann ich sagen: die Integration ist gelungen; seit 1996 bin ich deutscher Staatsbürger. Allerdings spüre ich bei Behörden eine Kälte der Beamten mir gegenüber, hören musste ich auch schon Sätze wie: Hier ist nicht die Türkei. In Esslingen fühle ich mich heimisch: Ich habe einen sicheren Arbeitsplatz, eine Wohnung, einen großen Freundeskreis, Sportmöglichkeiten und Familie. Begünstigend waren und sind meine Grundeinstellung in Bezug auf Gleichberechtigung, egal wo und bei welchem Thema. Natürlich auch Kontakte über den Fußballverein ich war lange Jahre auch Kapitän in der Mannschaft über Migrantenvereine und auch andere Vereine und Initiativen, bei denen ich mitgemacht habe, und vor allem Freunde, über die ich wichtige Information und Tipps erhalten habe. So habe ich z. B. den Tipp zum Aufbaustudium an der Fachhochschule in Esslingen von einem Freund erhalten. Gründungsmitglied bei adg Interkulturelles Forum Esslingen e.v.. Seit 25 Jahren aktiv. Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, ist mir wichtig. Viele Folkloregruppen habe ich trainiert und angeleitet. Vielen MigrantInnen helfe ich, wenn sie einen Rat oder Infos brauchen. Der Mensch kann nicht allein leben, daher ist Teilen, egal ob im Glück oder Unglück, ganz wichtig: Leben und leben lassen. Ökonomische Unsicherheit kennzeichnet wesentlich stärker eine weitere, kleinere Gruppe von Menschen und Familien mit MHG, nämlich ArbeiterInnen ohne spezielle Ausbildung. Sie sind in Krisenzeiten hochgradig gefährdet, weil ihr Einkommen unter solchen Bedingungen ein- oder auch ganz wegbrechen kann. Erfahrungsgemäß werden solche Personen über eine gewisse Zeit, zum Teil über sehr lange Zeiträume hinweg, von anderen (auch entfernten) Verwandten aufgefangen und unterstützt was wiederum Auswirkungen auf das Haushaltsbudget der Helfenden hat. Die Auswertung des Mikrozensus 2010 auf Landesebene zeigt für die Herkunftsdeutschen in Baden-Württemberg ein Armutsrisiko von etwa 8 %, für Personen mit MHG von 19 %. Ähnlich schätzen ExpertInnen die Situation in Esslingen ein. Igor: männlich, 78 Jahre Bosnien-Herzegowina; kroatisch Esslingen, Ende der 60er Jahre/ Generation: sog. Gastarbeiter aus dem Anwerbeland Jugoslawien Keine Generationsprobleme mit Kindern oder Eltern Keine abgeschlossene Ausbildung, Hilfsarbeiter in verschiedenen Bereichen Landwirte. Vater: Grundschule, Mutter ohne Schulbildung 2 Alle Namen sind anonymisiert. Seite 6
17 Ivan wuchs auf einem kleinen Bauernhof auf. Seine Familie (Eltern und zwei Geschwister) lebte von den landwirtschaftlichen Erträgen, die sie selbst erwirtschaftete. Ivans Mutter starb, als er 10 Jahre alt war. Sein Vater heiratete ein zweites Mal, und aus dieser Ehe gingen noch fünf Kinder hervor. Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Eltern war es Ivan nicht möglich, zur Schule zu gehen. Ihm war es aber immer schon wichtig, vieles zu lernen und sich anderweitig zu bilden. So lieh er sich Bücher von Verwandten und lernte durch Unterstützung von Vater und Onkel Lesen und Schreiben. Schon als Kind half Ivan mit, die täglichen Arbeiten auf dem Bauernhof zu verrichten. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er im kleinen Radius der Dorfgemeinschaft. Mit 22 Jahren ging er zur jugoslawischen Volksarmee, wo er zum ersten Mal die Grenzen der Gemeinde überschritt. Nach dem Wehrdienst begann für ihn die Zeit des Schaufelns und Grabens. In großen Teilen des e- hemaligen Jugoslawiens mussten Kanäle für Flüsse sowie Gräben für den Schienenverkehr ausgehoben werden. Baumaschinen gab es zu dieser Zeit noch nicht. Es gab für diese schwere körperliche Arbeit nicht viel Lohn, aber es war besser als gar nichts! Ende der 50-er Jahre lernte Ivan seine Frau kennen, die er kurze Zeit später heiratete und mit der er eine Tochter hat, die heute mit Ehemann und zwei Kindern in Kroatien lebt. Ende der 60- iger Jahre beschloss Ivan im Zuge der Gastarbeiteranwerbung, nach Deutschland zu gehen. Irgendwie hatte ich schon Angst vor dem neuen fremden Land, aber ich war auch neugierig. Eigentlich wollte ich wie die meisten Gastarbeiter nur 2 Jahre bleiben, tja, und jetzt sind es mittlerweile 40 Jahre! Hannover war Ivans erste Station in Deutschland. Dort arbeitete er bei einer großen Baufirma, später wechselte er zu verschiedenen Zweigstellen des Unternehmens hörte ich davon, dass in Esslingen Friedhofsgärtner bzw. Bestattungshelfer gesucht werden. Keiner wollte auf dem Friedhof arbeiten, Gräber schaufeln und mit Toten in Berührung kommen. Aber ich hatte keine Scheu davor! Er bewarb sich, bekam die Stelle und begann ein neues gutes Leben als Friedhofsgärtner bei der Stadt Esslingen. Zehn Friedhöfe und eine Kapelle waren von nun an 18 Jahre lang sein Arbeitsreich. Ich fühlte mich in diesem Beruf richtig angekommen, und mit der Arbeit hatte ich auch das Gefühl, richtig dazuzugehören zu den Anderen hier in Deutschland. Ich war nicht mehr nur der Hilfsarbeiter, sondern ich konnte meine Zeit alleine einteilen, ich wurde sehr für meine Zuverlässigkeit geschätzt, und das ist wichtig. Ich weiß gar nicht so genau, was das Ganze mit Integration bedeutet. Ich höre das immer in den Nachrichten und denke mir: warum tun sich Menschen so schwer miteinander zu leben. Ich habe nie mit jemandem Probleme gehabt und habe auch niemandem Probleme bereitet. Ich war schon als Kind sehr neugierig, wenn Leute meine Eltern besuchten, die ich nicht kannte. Ich bin immer gleich auf sie zugegangen und habe den Kontakt gesucht. Und hier in Deutschland war das auch immer so. Ein wichtiger Bestandteil in seinem Leben ist sein großer internationaler Freundeskreis. Damals wie heute interessiere ich mich für Menschen und bin offen für alles. Ich bin geschieden und lebe alleine, und das kann auch ein Grund sein, warum ich die Gesellschaft suche, aber ich habe das Gefühl, dass andere sich in meiner Gesellschaft auch wohl fühlen. Ist das gelungene Integration, wenn ich mich hier in Esslingen daheim fühle? Dann ist das so. Begünstigend ist, dass ich offen bin und andere Menschen respektiere. Hemmend ist natürlich, dass ich nie richtig gut Deutsch gelernt habe. Da gebe ich mir selbst ein bisschen die Schuld, dass ich mich mehr hätte dahinter klemmen müssen, aber ich musste ja seit meiner Ankunft in Deutschland immer arbeiten und arbeiten, und so Angebote mit Deutsch lernen gab es meines Wissens nicht. Ich hätte es gut gefunden, wenn die Firma das angeboten hätte, aber die haben da einen Kollegen gehabt, der slowenisch gesprochen hat, und der war dann sozusagen der Vermittler zwischen mir und dem Polier oder Chef. In der Anfangszeit hab ich mich hier schon sehr allein gefühlt und habe mich auch nicht so reingefunden, weil ich ja auch nicht ewig bleiben wollte. Irgendwann ist dann aber die Schwelle überschritten, wo dann auch meine eigentliche Heimat Bosnien oder Kroatien nicht mehr so richtig meine Heimat war. Also irgendwann bist du an dem Punkt, wo du zwischen zwei Welten bist, und da hat dann Deutschland überwogen, weil ich hier Fuß gefasst habe und eine Rückkehr nicht mehr Thema für mich war. Man sagt, in der Ehe lebt man sich auseinander. Irgendwie, galt das Seite 7
18 auch für meine Heimat. Ich habe mich auseinander gelebt. Das wäre aber bestimmt ganz anders, wenn ich keine so gute Arbeit gehabt hätte und eine gute Umgebung. Für mich war es gut, in Deutschland zu bleiben. Ich sehe Kroatien bzw. Bosnien als mein Geburtsland, in welchem ich aufgewachsen bin und dem ich mich sehr verbunden fühle. Aber den Großteil meines Lebens habe ich in Deutschland gelebt, und deshalb fühle ich mich in den wenigen Wochen, die ich in meinem Geburtsort bin, zwar gut aufgenommen, aber irgendwie unsicher. Ich reise zwar gerne und besuche meine Tochter und meine Verwandten, aber wenn ich dann nach Deutschland zurückfahre, weiß ich: ich fahre nach Hause. Ich habe den einen oder anderen Treffpunkt in Esslingen, wo ich Landsleute treffe, und das ist mir auch wichtig. Der Austausch in der Muttersprache ist wichtig und dass man doch ein anderes Verhältnis zu Landsleuten hat, man lebt irgendwie doch ähnlichere Leben, weil man eine ähnliche Lebensgeschichte hat. Ich kann mit deutschen Kameraden nicht die gleiche Kindheitsgeschichte und Berufsbiografie teilen, weil sie nie Gastarbeiter waren, bzw. wenige in den sozialen und politischen Lebensverhältnissen lebten wie unsereins. Das verbindet natürlich. Aber nicht nur meine Landsleute. Das verbindet uns auch mit Italienern und Griechen und Türken und allen anderen, die dasselbe erlebt haben. Ich treffe mich auch mit den Senioren in der kroatischen Seniorengruppe 1x im Monat, da haben wir immer viel zu erzählen. Je älter man wird, umso wichtiger ist es, glaube ich, dass man sich sicher fühlt und Menschen um sich herum hat, die einem helfen würden, wenn man sie braucht. Du bist auch so ein Mensch, dem wir vertrauen, weil du unsere Muttersprache sprichst und dafür sorgst, dass wir am Ball bleiben. Also für mich war immer das Motto: Lass andere nach ihren Wünschen und Ideen leben, und lebe Du so, wie Du es für richtig hältst aber immer mit dem Gedanken, dass man Respekt und Achtung voreinander haben muss. Die am schlechtesten gestellte, zwar kleine, aber stetig wachsende Gruppe lebt in dauerhaft finanziell prekären Verhältnissen. Diese Menschen haben keine Unterstützung durch die Familie und/oder müssen mit wenig Grundsicherung auskommen. Zu ihnen gehören unter anderem Jugendliche ohne Schulabschluss, die sich aus welchen Gründen immer von ihren Eltern getrennt haben, Personen mit Flüchtlingsbiographie, die in Deutschland nicht arbeiten dürfen, deren Ausbildungs- und Berufsabschlüsse in Deutschland nicht anerkannt werden oder die traumatisiert und deshalb nur eingeschränkt arbeitsfähig sind. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass das Einkommensniveau von Menschen mit MHG niedriger liegt als das der gesamten Bevölkerung und dass diese Menschen ein höheres Armutsrisiko tragen Wohnen Auch auf diesem Lebensfeld zeigen sich wesentliche Unterschiede innerhalb der Bevölkerung mit MHG. Alles in allem ist aber nicht zu verkennen, dass sich Menschen und Familien mit MHG in bestimmten Stadtteilen und in bestimmten Wohnformen konzentrieren (vgl. Abbildung 1). Stadtteile mit hohem Anteil von Menschen mit MHG sind Oberesslingen, Innenstadt, Mettingen/Weil/Brühl und die Pliensauvorstadt. In Wohnungen in Hang- oder Höhenlage der Stadt, beispielsweise in St. Bernhard, Hegensberg oder Wäldenbronn, lebt hingegen ein vergleichsweise kleiner Prozentsatz von Menschen mit MHG. Die Stadtteile mit hohem Migrantenanteil gelten in der Sicht der Esslinger BürgerInnen im allgemeinen als weniger begehrte Wohnlagen und haben in der Regel kein gutes Image mit Ausnahme der Altstadt, in der gut situierte deutsche Stadt-Rückkehrer mit MigrantInnen um Wohnraum konkurrieren. Diese Stadtteile liegen vor allem im Tal, sind meist hoch verdichtet und weisen einen hohen Anteil Seite 8
19 von Siedlungshäusern im Bestand von Esslinger Wohnungsgesellschaften auf. Sie haben vergleichsweise wenig Grün- und Freiflächen. Die Wohnungen sind eher klein und verfügen oft weder über Balkon noch über einen kleinen Gartenanteil. Oft leben große Familien auf kleiner Fläche zusammen, insbesondere wenn Familien zusammen rücken, weil ein Familienmitglied die ökonomische Selbständigkeit aufgeben muss und für einen kurzen Zeitraum oder für immer in die Familie zurückkehrt (z. B. bei Scheidung oder Verlust des Arbeitsplatzes). In den vergangenen Jahren hat die Esslinger Wohnungswirtschaft große Anstrengungen unternommen, um durch Sanierungen, wie den Anbau von Balkonen und eine bessere Fassadengestaltung, eine Verbesserung des Wohnungsbestandes zu erzielen. Auch die öffentlichen Grün- und Freiflächen werden derzeit verbessert: ein großer Gewinn für die Wohnsituation gerade von Menschen und Familien mit MHG. Beispielhaft sind hier die Maßnahmen in der Pliensauvorstadt zu nennen. Gleichwohl bleiben, im Ganzen gesehen, noch immer klare Benachteiligungen der an solchen schwierigen Standorten lebenden Menschen festzustellen. Das sind keineswegs nur Menschen mit MHG, sondern auch gering verdienende Familien deutscher Herkunft; aber statistisch sind mehr MigrantInnen betroffen als Menschen deutscher Herkunft. Zell Berkheim Mettingen, Weil, Brühl Zollberg Pliensauvorstadt Sirnau Oberesslingen Hegensberg, Liebersbronn, Kimmichsweiler, Oberhof St. Bernhardt, Kennenburg, Wiflingshausen Wäldenbronn, Hohenkreuz, Serach, Obertal (WHSO) RSKN Innenstadt 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Migrationshintergrund (Anteil an Wohnbevölkerung ) Nicht EU-Ausländer (Anteil an Wohnbevölkerung ) Abbildung 1: Überblick Anteile MHG nach Stadtteilen Eine Veränderung, die sich im letzten Jahrzehnt herauskristallisiert, ist in der Tatsache zu sehen, dass besonders in Stadtteilen mit hohem Migrationsanteil zunehmend Wohnungen und Häuser von Familien mit MHG gekauft und saniert werden, so dass zwar der prozen- Seite 9
20 tuale Anteil von EinwohnerInnen mit MHG gleich bleibt, aber eine interne Differenzierung zwischen MieterInnen und EigentümerInnen eintritt. In einer besonderen und hochproblematischen Wohnform leben AsylbewerberInnen und Flüchtlinge. AsylbewerberInnen und Flüchtlinge in Esslingen Die Unterkunft in der Rennstraße 8-10 ist die einzige staatliche Gemeinschaftsunterkunft in der Stadt; sie wird vom Landkreis getragen. Die soziale Betreuung ist durch einen Kooperationsvertrag der Arbeiterwohlfahrt (AWO) übertragen. Weitere Flüchtlinge mit Bleiberecht wohnen auch an anderer Stelle in der Stadt. Zwischen der Sozialbetreuung der Stadt und der AWO gibt es so gut wie keine Berührungspunkte. In der Rennstraße wohnen ca. 100 Menschen, davon ca. 40 Kinder. In drei Stockwerken gibt es zwölf Appartements. Auf ca. 20 Personen kommt eine Dusche. Derzeit kommen viele aus Afghanistan und Irak. In letzter Zeit kamen auch viele Kurden. Die Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Karlsruhe weist die AsylbewerberInnen und Flüchtlinge den Landkreisen zu. Die meisten Flüchtlinge kommen auf den unterschiedlichsten Wegen (zu Fuß, mit Lkw, auf dem Seeweg). Ganz wenige kommen mit falschen Papieren mit dem Flugzeug. Fast alle kommen mit Schleppern nach Deutschland. Dadurch sind die meisten hoch verschuldet. Dabei geht es um Summen zwischen und Dies führt zu großer finanzieller Not. Manche werden Dealer; oft führt der Weg auch in die Prostitution. Viele gehörten in ihren Heimatländern zur Oberschicht und erleben nun einen steilen Abstieg in Deutschland. Manche sind Analphabeten. In der staatlichen Unterkunft gibt es 40 im Monat Unterstützung. Bei EDEKA können die Flüchtlinge bargeldlos, mit Punkten, einkaufen. Der Haushaltsvorstand bekommt , also 35% weniger als Hartz IV, die Familienangehörigen weniger. Zweimal im Jahr gibt es eine Grundausstattung an Kleidern. Das Asylbewerberleistungsgesetz umfasst Schmerzbehandlung und Behandlung bei lebensbedrohlichen Krankheitszuständen (mit Krankenversicherung). In besonderen Fällen muss der Arzt einen Antrag stellen, der vom Gesundheitsamt bearbeitet wird. Ärzte dürfen nur eingeschränkt eine Blutabnahme vornehmen; die Diagnostik ist damit nicht ausreichend möglich. Die Flüchtlinge haben eine sehr unterschiedliche Verweildauer. Das hängt damit zusammen, dass die Entscheider unterschiedlich stark beschäftigt sind. Der Ablauf sieht folgendermaßen aus: Meldung in Karlsruhe als AsylbewerberIn erkennungsdienstliche Behandlung Anhörung (Interview, Dauer: 40 Minuten bis zwei Stunden), kann oft viel später stattfinden Bescheid (kann Monate dauern; in der Frist evtl. Abschiebeandrohung) Im Fall einer Ablehnung steht der Klageweg beim Verwaltungsgericht offen. Der Ökumenische Freundeskreis Berkheim ist sehr aktiv. Er organisiert seit über 20 Jahren einen Teenachmittag, einen Treffpunkt für Frauen. Die AWO organisiert in dieser Zeit die Kinderbetreuung. Montagskaffee für Männer wird vom Freundeskreis Asyl Esslingen-Zell angeboten. Der Freundeskreis Oberesslingen verschenkt Fahrräder. Probleme: Die AsylbewerberInnen und Flüchtlinge sind zum Warten verdammt. Die Perspektivlosigkeit ist oft schwer auszuhalten. Wer ohne Bleiberecht ist, bekommt keinen Deutschkurs bezahlt. Aus dieser Zwangslage heraus werden Sprachkurse in Eigenregie auf Spendenbasis organisiert. Oft arbeiten die LehrerInnen mit homöopathischem Lohn. AsylbewerberInnen und Flüchtlinge erhalten bei der Ankunft keine umfassende medizinische Basisuntersuchung mehr. Oft gibt es Verständigungsprobleme. Diese können sehr unterschiedliche Gründe haben: z. B. können ÜbersetzerInnen überfordert sein; oft sind es Kinder und Jugendliche. Es kann auch sein, dass DolmetscherInnen aus einer anderen Ethnie stammen; dann sehen sie oft die politischen Zusammenhänge anders als die Person, für die sie dolmetschen sollen. Oft spielt auch Scham eine Rolle. Auch Traumatisierungen können Menschen verstummen lassen. Für manche Sprachen stehen keine DolmetscherInnen zur Verfügung. Bei Dauerduldung gibt es nur eine medizinische Grundversorgung, d. h. hauptsächlich Schmerzbe- Seite 10
Vielfaltstrategien in Kommunen des ländlichen Raums
 Vielfaltstrategien in Kommunen des ländlichen Raums ARL-Kongress 2015 Migration, Integration: Herausforderungen für die räumliche Planung 18.06.2015 Gudrun Kirchhoff 1 Bevölkerung mit Migrationshintergrund
Vielfaltstrategien in Kommunen des ländlichen Raums ARL-Kongress 2015 Migration, Integration: Herausforderungen für die räumliche Planung 18.06.2015 Gudrun Kirchhoff 1 Bevölkerung mit Migrationshintergrund
Lebenssituation von MigrantInnen in Oberhausen
 Lebenssituation von MigrantInnen in Oberhausen Ergebnisse einer mündlichen Befragung von Migrantinnen und Migranten im Zusammenhang mit dem Kommunalen Integrationskonzept Referentin: Ulrike Schönfeld-Nastoll,
Lebenssituation von MigrantInnen in Oberhausen Ergebnisse einer mündlichen Befragung von Migrantinnen und Migranten im Zusammenhang mit dem Kommunalen Integrationskonzept Referentin: Ulrike Schönfeld-Nastoll,
Integrationsbeirat als ein Beispiel der Integration
 Stadtteilforum Mitte Integrationsbeirat als ein Beispiel der Integration Liubov Belikova Vorsitzende des Integrationsbeirates Frankfurt (Oder) Iris Wünsch stellvertretende Vorsitzende des Integrationsbeirates
Stadtteilforum Mitte Integrationsbeirat als ein Beispiel der Integration Liubov Belikova Vorsitzende des Integrationsbeirates Frankfurt (Oder) Iris Wünsch stellvertretende Vorsitzende des Integrationsbeirates
Kommunale Flüchtlings- und Integrationspolitik. Ausgewählte Ergebnisse einer Online-Befragung von Städten, Landkreisen und Gemeinden
 Kommunale Flüchtlings- und Integrationspolitik Ausgewählte Ergebnisse einer Online-Befragung von Städten, Landkreisen und Gemeinden Dr. Frank Gesemann / Prof. Dr. Roland Roth Stand der Auswertungen: 15.
Kommunale Flüchtlings- und Integrationspolitik Ausgewählte Ergebnisse einer Online-Befragung von Städten, Landkreisen und Gemeinden Dr. Frank Gesemann / Prof. Dr. Roland Roth Stand der Auswertungen: 15.
(Vo V r o lä l uf u ig i e g ) Z i Z e i le l u n u d n d Grun u d n s d ätze d e d r M a M nn n h n e h im i e m r
 (Vorläufige) Ziele und Grundsätze der Mannheimer Integrationspolitik (Präsentation im Lenkungsausschuss am 11.5.2009) H I i Was meint Integration? Integrationspolitik bezeichnet die aktive Gestaltung des
(Vorläufige) Ziele und Grundsätze der Mannheimer Integrationspolitik (Präsentation im Lenkungsausschuss am 11.5.2009) H I i Was meint Integration? Integrationspolitik bezeichnet die aktive Gestaltung des
BEISPIELE KOMMUNALER INTEGRATIONSARBEIT IN BADEN-WÜRTTEMBERG
 Platzhalter für ein Titelbild! BEISPIELE KOMMUNALER INTEGRATIONSARBEIT IN BADEN-WÜRTTEMBERG DGB-Zukunftskongress am Freitag, den 22. Januar 2016 Referent: Marc Nogueira MANNHEIM EINE VON ZUWANDERUNG GEPRÄGTE
Platzhalter für ein Titelbild! BEISPIELE KOMMUNALER INTEGRATIONSARBEIT IN BADEN-WÜRTTEMBERG DGB-Zukunftskongress am Freitag, den 22. Januar 2016 Referent: Marc Nogueira MANNHEIM EINE VON ZUWANDERUNG GEPRÄGTE
Befragung von Migrantinnen und Migranten im Deutschen Freiwilligensurvey 2014
 Befragung von Migrantinnen und Migranten im Deutschen Freiwilligensurvey 2014 Dr. Claudia Vogel & Dr. Julia Simonson Deutsches Zentrum für Altersfragen 42. Sitzung der AG 5 Migration und Teilhabe des Bundesnetzwerks
Befragung von Migrantinnen und Migranten im Deutschen Freiwilligensurvey 2014 Dr. Claudia Vogel & Dr. Julia Simonson Deutsches Zentrum für Altersfragen 42. Sitzung der AG 5 Migration und Teilhabe des Bundesnetzwerks
Einwanderungsstadt Fulda? Ergebnisse einer empirischen Untersuchung und kommunale Integrationsstrategien im Hinblick auf Familienbildung in Fulda
 Einwanderungsstadt Fulda? Ergebnisse einer empirischen Untersuchung und kommunale Integrationsstrategien im Hinblick auf Familienbildung in Fulda Dienstag, 12. Juni 2007 Prof. Dr. Gudrun Hentges Seite
Einwanderungsstadt Fulda? Ergebnisse einer empirischen Untersuchung und kommunale Integrationsstrategien im Hinblick auf Familienbildung in Fulda Dienstag, 12. Juni 2007 Prof. Dr. Gudrun Hentges Seite
Protokoll des ersten Interkulturellen-Miteinander-Forums vom im SZ I. Thema: Gemeinsam besser leben in der neuen Heimat
 Protokoll des ersten Interkulturellen-Miteinander-Forums vom 07.11.2013 im SZ I Thema: Gemeinsam besser leben in der neuen Heimat Beginn : Ende: Ort: Teilnehmer: 18.00 Uhr 20.05 Uhr Statteilzentrum I an
Protokoll des ersten Interkulturellen-Miteinander-Forums vom 07.11.2013 im SZ I Thema: Gemeinsam besser leben in der neuen Heimat Beginn : Ende: Ort: Teilnehmer: 18.00 Uhr 20.05 Uhr Statteilzentrum I an
VIELFALT ALS NORMALITÄT
 Tag der Vereinsführungskräfte Hamm, 16. Januar 2013 VIELFALT ALS NORMALITÄT Migration, Integration & Inklusion im Sportverein Dirk Henning Referent NRW bewegt seine KINDER! 16.02.2013 Vielfalt als Normalität
Tag der Vereinsführungskräfte Hamm, 16. Januar 2013 VIELFALT ALS NORMALITÄT Migration, Integration & Inklusion im Sportverein Dirk Henning Referent NRW bewegt seine KINDER! 16.02.2013 Vielfalt als Normalität
Forderungen der Jugendarbeit in Bayern
 Forderungen der Jugendarbeit in Bayern Mehr zum Thema Wahlen unter www.bjr.de/wahlen Wählen ab 14! Junge Menschen übernehmen Verantwortung für ihr Leben: in Alltag, Schule und Beruf. Sie sollen deshalb
Forderungen der Jugendarbeit in Bayern Mehr zum Thema Wahlen unter www.bjr.de/wahlen Wählen ab 14! Junge Menschen übernehmen Verantwortung für ihr Leben: in Alltag, Schule und Beruf. Sie sollen deshalb
Interkulturelle Öffnung durch Kooperationen mit Migrantenorganisationen
 Interkulturelle Öffnung durch Kooperationen mit Migrantenorganisationen PD Dr. Uwe Hunger Westfälische Wilhelms-Universität Münster/ Universität Osnabrück Vortrag im Rahmen der Fachtagung Wie die interkulturelle
Interkulturelle Öffnung durch Kooperationen mit Migrantenorganisationen PD Dr. Uwe Hunger Westfälische Wilhelms-Universität Münster/ Universität Osnabrück Vortrag im Rahmen der Fachtagung Wie die interkulturelle
Vereinbarung über die Zusammenarbeit der Bürgerausschüsse mit Gemeinderat und Verwaltung vom in der Neufassung vom
 Vereinbarung über die Zusammenarbeit der Bürgerausschüsse mit Gemeinderat und Verwaltung vom 10.12.1990 in der Neufassung vom 28.02.2011 Aufgabenstellung, Zusammensetzung und Arbeitsweise der Bürgerausschüsse
Vereinbarung über die Zusammenarbeit der Bürgerausschüsse mit Gemeinderat und Verwaltung vom 10.12.1990 in der Neufassung vom 28.02.2011 Aufgabenstellung, Zusammensetzung und Arbeitsweise der Bürgerausschüsse
Vielfalt im Ländlichen Raum Plädoyer für eine neue Willkommenskultur
 Vielfalt im Ländlichen Raum Plädoyer für eine neue Willkommenskultur Gudrun Kirchhoff Ländliche Räume in NRW stärken Evangelische Akademie Villigst am 3. - 4. März 2016 2 Integrationspolitischer Diskurs
Vielfalt im Ländlichen Raum Plädoyer für eine neue Willkommenskultur Gudrun Kirchhoff Ländliche Räume in NRW stärken Evangelische Akademie Villigst am 3. - 4. März 2016 2 Integrationspolitischer Diskurs
Integration in Nürnberg. Anmerkungen zu Gelingen und Misslingen Reiner Prölß
 Integration in Nürnberg Anmerkungen zu Gelingen und Misslingen Reiner Prölß 29.1.2011 Zur Nürnberger Bevölkerung mit Migrationshintergrund Zum 31.12.2009 lebten in Nürnberg insgesamt 86.806Ausländer (rund
Integration in Nürnberg Anmerkungen zu Gelingen und Misslingen Reiner Prölß 29.1.2011 Zur Nürnberger Bevölkerung mit Migrationshintergrund Zum 31.12.2009 lebten in Nürnberg insgesamt 86.806Ausländer (rund
Dr. Frank Gesemann Zum Stand der kommunalen Integrations- und Diversitätspolitik in Deutschland
 Dr. Frank Gesemann Zum Stand der kommunalen Integrations- und Diversitätspolitik in Deutschland Rethinking Migration: Diversity Policies in Immigration Societies International Conference 8 9 December 2011
Dr. Frank Gesemann Zum Stand der kommunalen Integrations- und Diversitätspolitik in Deutschland Rethinking Migration: Diversity Policies in Immigration Societies International Conference 8 9 December 2011
Erfolgsfaktoren kommunaler Integrationskonzepte
 Erfolgsfaktoren kommunaler Integrationskonzepte Gudrun Kirchhoff Zukunftsforum Ländliche Entwicklung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft Begleitveranstaltung Willkommenskultur gestalten_netzwerke
Erfolgsfaktoren kommunaler Integrationskonzepte Gudrun Kirchhoff Zukunftsforum Ländliche Entwicklung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft Begleitveranstaltung Willkommenskultur gestalten_netzwerke
Interkulturelle Elternarbeit. Donnerstag, Uhr Uhr Referentin: Julia Fübbeker, HÖB Papenburg
 Interkulturelle Elternarbeit Donnerstag, 07.04.2016 13.30 Uhr 15.00 Uhr Referentin: Julia Fübbeker, HÖB Papenburg Menschen fühlen sich an den Orten wohl und zuhause, an denen sie sich wertgeschätzt fühlen.
Interkulturelle Elternarbeit Donnerstag, 07.04.2016 13.30 Uhr 15.00 Uhr Referentin: Julia Fübbeker, HÖB Papenburg Menschen fühlen sich an den Orten wohl und zuhause, an denen sie sich wertgeschätzt fühlen.
Interkulturelle Öffnung auf dem Prüfstand Neue Wege der Kooperation und Partizipation
 Interkulturelle Öffnung auf dem Prüfstand Neue Wege der Kooperation und Partizipation PD Dr. Uwe Hunger Vortrag auf der Tagung Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte Jugendgästehaus
Interkulturelle Öffnung auf dem Prüfstand Neue Wege der Kooperation und Partizipation PD Dr. Uwe Hunger Vortrag auf der Tagung Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte Jugendgästehaus
Ergebnisse der Bürgerbefragung Vielfalt in Neumünster (durchgeführt im Dezember Januar 2014)
 Ergebnisse der Bürgerbefragung Vielfalt in Neumünster (durchgeführt im Dezember 2013 - Januar 2014) Fachdienst 03 Udo Gerigk / Hanna Brier 07/02/14 Bürgerbefragung Vielfalt in Neumünster 1 Gliederung 1.
Ergebnisse der Bürgerbefragung Vielfalt in Neumünster (durchgeführt im Dezember 2013 - Januar 2014) Fachdienst 03 Udo Gerigk / Hanna Brier 07/02/14 Bürgerbefragung Vielfalt in Neumünster 1 Gliederung 1.
Interkulturelle Öffnung im Kinderschutz
 Interkulturelle Öffnung im Kinderschutz Wie viele Anforderungen / wie viel Komplexität und Differenzierung verträgt ein? - Notwendige Rahmenbedingungen und Herausforderungen für die Umsetzung im - 03.12.2014
Interkulturelle Öffnung im Kinderschutz Wie viele Anforderungen / wie viel Komplexität und Differenzierung verträgt ein? - Notwendige Rahmenbedingungen und Herausforderungen für die Umsetzung im - 03.12.2014
Für Integration und gleichberechtigtes Zusammenleben
 4 Thema Ausländische Arbeitnehmer Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie Für Integration und gleichberechtigtes Zusammenleben Mehr als 7,3 Millionen Menschen ausländischer Nationalität leben in
4 Thema Ausländische Arbeitnehmer Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie Für Integration und gleichberechtigtes Zusammenleben Mehr als 7,3 Millionen Menschen ausländischer Nationalität leben in
WDR Lokalzeiten: WIR-Studie 2015 Repräsentativbefragung TNS/Emnid
 WDR Lokalzeiten: WIR-Studie 2015 Repräsentativbefragung TNS/Emnid Feldzeit: 11. August bis 23. September 2015 Basis: 3.002 Befragte ab 14 Jahren in NRW WDR Medienforschung, 12. Oktober 2015 WIR-Gefühl
WDR Lokalzeiten: WIR-Studie 2015 Repräsentativbefragung TNS/Emnid Feldzeit: 11. August bis 23. September 2015 Basis: 3.002 Befragte ab 14 Jahren in NRW WDR Medienforschung, 12. Oktober 2015 WIR-Gefühl
Bevölkerung mit Migrationshintergrund III
 Nach Altersgruppen, in absoluten Zahlen und Anteil an der Altersgruppe in Prozent, 2011 Altersgruppen (Jahre) Bevölkerung mit Migrationshintergrund unter 5 1.148 3.288 34,9% 5 bis 10 1.130 3.453 32,7%
Nach Altersgruppen, in absoluten Zahlen und Anteil an der Altersgruppe in Prozent, 2011 Altersgruppen (Jahre) Bevölkerung mit Migrationshintergrund unter 5 1.148 3.288 34,9% 5 bis 10 1.130 3.453 32,7%
Wanderer, kommst du nach D
 Wanderer, kommst du nach D Migration und Integration in der Bundesrepublik seit den 90er Jahren Isabelle BOURGEOIS, CIRAC Studientag Migrationspolitik in Deutschland und Frankreich: eine Bestandaufnahme
Wanderer, kommst du nach D Migration und Integration in der Bundesrepublik seit den 90er Jahren Isabelle BOURGEOIS, CIRAC Studientag Migrationspolitik in Deutschland und Frankreich: eine Bestandaufnahme
Thema Integrationskonzept
 Kölner Integrationskonzept Ein Blick zurück Gute Gründe für ein Integrationskonzept für Köln Integration: ein Begriff, unterschiedliche Ebenen Kooperationspartner im Prozess wer muss mitmachen? Die Arbeitsstruktur
Kölner Integrationskonzept Ein Blick zurück Gute Gründe für ein Integrationskonzept für Köln Integration: ein Begriff, unterschiedliche Ebenen Kooperationspartner im Prozess wer muss mitmachen? Die Arbeitsstruktur
Die Stadtverwaltung Königswinter als Arbeitgeberin
 Die Stadtverwaltung Königswinter als Arbeitgeberin 1 Heimatverbunden Die Stadt Königswinter liegt wunderschön am Rhein und im Siebengebirge, es gibt ein aktives soziales und kulturelles Leben und vielfältige
Die Stadtverwaltung Königswinter als Arbeitgeberin 1 Heimatverbunden Die Stadt Königswinter liegt wunderschön am Rhein und im Siebengebirge, es gibt ein aktives soziales und kulturelles Leben und vielfältige
Referat für Integration Duisburg Internationale und weltoffene Hafenstadt an Rhein und Ruhr
 Duisburg Internationale und weltoffene Hafenstadt an Rhein und Ruhr Stellv. Leiter des Referates für Integration Marijo Terzic (Stellv. Integrationsbeauftragter) Gutenbergstraße 24 47051 Duisburg Telefon:
Duisburg Internationale und weltoffene Hafenstadt an Rhein und Ruhr Stellv. Leiter des Referates für Integration Marijo Terzic (Stellv. Integrationsbeauftragter) Gutenbergstraße 24 47051 Duisburg Telefon:
Die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements für eine gelingende Integration
 Die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements für eine gelingende Integration Engagement für alle! Kooperation zwischen Engagementförderung und Integrationsarbeit Fachtagung des Hessischen Ministeriums
Die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements für eine gelingende Integration Engagement für alle! Kooperation zwischen Engagementförderung und Integrationsarbeit Fachtagung des Hessischen Ministeriums
Inklusion und Integration. Ein Beitrag zur Begriffsklärung
 Inklusion und Integration Ein Beitrag zur Begriffsklärung Prof. Dr. Albrecht Rohrmann Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer Dienste der Universität Siegen Gliederung 1. Der Impuls der UN-Konvention
Inklusion und Integration Ein Beitrag zur Begriffsklärung Prof. Dr. Albrecht Rohrmann Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer Dienste der Universität Siegen Gliederung 1. Der Impuls der UN-Konvention
Leitziel 2 Gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist Allen im Landkreis möglich. Projekt- bzw. Handlungsschwerpunkte 2013
 Ergebnis der Erarbeitung der Zielpyramide für den Lokalen Aktionsplan 2014 im Herzogtum Lauenburg (außer Stadt Lauenburg und Amt Lütau, die gemeinsam einen eigenen Lokalen Aktionsplan umsetzen) Leitziel
Ergebnis der Erarbeitung der Zielpyramide für den Lokalen Aktionsplan 2014 im Herzogtum Lauenburg (außer Stadt Lauenburg und Amt Lütau, die gemeinsam einen eigenen Lokalen Aktionsplan umsetzen) Leitziel
Die Integration jüngerer Zugewanderter durch Bildung und die Kosten ihrer Nicht- Integration von von Dr. Hans Dietrich von Loeffelholz, Essen
 Die Integration jüngerer Zugewanderter durch Bildung und die Kosten ihrer Nicht- Integration von von Dr. Hans Dietrich von Loeffelholz, Essen ehemals Chefvolkswirt und Leiter der wirtschaftswissenschaftlichen
Die Integration jüngerer Zugewanderter durch Bildung und die Kosten ihrer Nicht- Integration von von Dr. Hans Dietrich von Loeffelholz, Essen ehemals Chefvolkswirt und Leiter der wirtschaftswissenschaftlichen
Gutes Zusammenleben klare Regeln
 Gutes Zusammenleben klare Regeln Start in die Erarbeitung eines Nationalen Integrationsplans I. Die Integration von Zuwanderern ist eine der großen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen
Gutes Zusammenleben klare Regeln Start in die Erarbeitung eines Nationalen Integrationsplans I. Die Integration von Zuwanderern ist eine der großen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen
Leitbild Schule Teufen
 Leitbild Schule Teufen 1 wegweisend Bildung und Erziehung 2 Lehren und Lernen 3 Beziehungen im Schulalltag 4 Zusammenarbeit im Schulteam 5 Kooperation Schule und Eltern 6 Gleiche Ziele für alle 7 Schule
Leitbild Schule Teufen 1 wegweisend Bildung und Erziehung 2 Lehren und Lernen 3 Beziehungen im Schulalltag 4 Zusammenarbeit im Schulteam 5 Kooperation Schule und Eltern 6 Gleiche Ziele für alle 7 Schule
Fachtagung Migrantenvereine als Akteure der Zivilgesellschaft 27. April 2013, München. Grußwort
 Fachtagung Migrantenvereine als Akteure der Zivilgesellschaft 27. April 2013, München Grußwort Dr. Andreas Kufer, Leiter des Referats Integrationspolitik im Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und
Fachtagung Migrantenvereine als Akteure der Zivilgesellschaft 27. April 2013, München Grußwort Dr. Andreas Kufer, Leiter des Referats Integrationspolitik im Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und
Es gilt das gesprochene Wort!
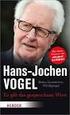 Rede von Frau Oberbürgermeisterin Henriette Reker anlässlich des gemeinsamen Treffens der StadtAGs, des Integrationsrates und des AK Kölner Frauenvereinigungen am 15. April 2016, 13:30 Uhr, Dienststelle
Rede von Frau Oberbürgermeisterin Henriette Reker anlässlich des gemeinsamen Treffens der StadtAGs, des Integrationsrates und des AK Kölner Frauenvereinigungen am 15. April 2016, 13:30 Uhr, Dienststelle
Leitfaden zur Durchführung der Interviews (Vorbilder) im Projekt BINGO Beste INteGratiOn
 Leitfaden zur Durchführung der Interviews (Vorbilder) im Projekt BINGO Beste INteGratiOn Einführende Einleitung wird nicht aufgezeichnet. Die Einleitung beinhaltet folgendes: Ich stelle mich bzw. das Team
Leitfaden zur Durchführung der Interviews (Vorbilder) im Projekt BINGO Beste INteGratiOn Einführende Einleitung wird nicht aufgezeichnet. Die Einleitung beinhaltet folgendes: Ich stelle mich bzw. das Team
Bürgerbeteiligung und Integration
 Bürgerbeteiligung und Integration Kommunaler Dialog Zusammenleben mit Flüchtlingen Stuttgart, 21. Januar 2016 www.komm.uni-hohenheim.de Fragen 1. Integration von Flüchtlingen: Warum sind Bürgerbeteiligung
Bürgerbeteiligung und Integration Kommunaler Dialog Zusammenleben mit Flüchtlingen Stuttgart, 21. Januar 2016 www.komm.uni-hohenheim.de Fragen 1. Integration von Flüchtlingen: Warum sind Bürgerbeteiligung
Willkommenskultur in der Ganztagsschule: auf dem Weg zur interkulturellen Bildung
 Willkommenskultur in der Ganztagsschule: auf dem Weg zur interkulturellen Bildung Regionalzentren für demokratische Kultur in Mecklenburg-Vorpommern Begrifflichkeiten Migration: Zu- und Auswanderung Migrationshintergrund
Willkommenskultur in der Ganztagsschule: auf dem Weg zur interkulturellen Bildung Regionalzentren für demokratische Kultur in Mecklenburg-Vorpommern Begrifflichkeiten Migration: Zu- und Auswanderung Migrationshintergrund
MigrantInnenenorganisationen fördern Integration und Beteiligung - unter Berücksichtigung der interkulturellen Öffnung des Vereinswesens
 Fachforum 4: MigrantInnenenorganisationen fördern Integration und Beteiligung - unter Berücksichtigung der interkulturellen Öffnung des Vereinswesens Dr. Cengiz Deniz, MigraMundi e.v. Gliederung 1. Teil
Fachforum 4: MigrantInnenenorganisationen fördern Integration und Beteiligung - unter Berücksichtigung der interkulturellen Öffnung des Vereinswesens Dr. Cengiz Deniz, MigraMundi e.v. Gliederung 1. Teil
VISION FÜR EINE EVANGELISCHE JUGENDARBEIT 2017
 VISION FÜR EINE EVANGELISCHE JUGENDARBEIT 2017 Neuwürschnitz 15.06.2013 Tobias Bilz Glauben auf evangelische Art In der evangelischen Jugendarbeit sind wir überzeugt davon, dass unsere Glaubenspraxis dem
VISION FÜR EINE EVANGELISCHE JUGENDARBEIT 2017 Neuwürschnitz 15.06.2013 Tobias Bilz Glauben auf evangelische Art In der evangelischen Jugendarbeit sind wir überzeugt davon, dass unsere Glaubenspraxis dem
Unterstützung von Angehörigen von Menschen mit Behinderungen
 Unterstützung von Angehörigen von Menschen mit Behinderungen Zusammenfassung In der UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen geht es um die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen.
Unterstützung von Angehörigen von Menschen mit Behinderungen Zusammenfassung In der UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen geht es um die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen.
Demografischer Wandel: Die Situation in Witten insbesondere in Bezug zur Migration Bevölkerungprognose Witten 06 Migrationshintergrund in NRW und Witt
 15. Sitzung des Wittener Internationalen Netzwerks (WIN) 07. November 07 Demografischer Wandel: Die Situation in Witten insbesondere in Bezug zur Migration Demografischer Wandel: Die Situation in Witten
15. Sitzung des Wittener Internationalen Netzwerks (WIN) 07. November 07 Demografischer Wandel: Die Situation in Witten insbesondere in Bezug zur Migration Demografischer Wandel: Die Situation in Witten
Protokoll Forum Inklusion
 Protokoll Forum Inklusion 16.09.14 Führung und Diskussion in der PLSW Afferde Unter anderem wurde über den Umstand diskutiert, dass für Menschen mit Behinderungen, die die Angebote von Werkstätten wahrnehmen,
Protokoll Forum Inklusion 16.09.14 Führung und Diskussion in der PLSW Afferde Unter anderem wurde über den Umstand diskutiert, dass für Menschen mit Behinderungen, die die Angebote von Werkstätten wahrnehmen,
Stadt Dietikon. Integrationsleitbild der Stadt Dietikon
 Stadt Dietikon Integrationsleitbild der Stadt Dietikon Vorwort Handlungsfeld «Sprache und Verständigung» Wer in Dietikon wohnt, soll sich in das Gemeinwesen einbinden und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen
Stadt Dietikon Integrationsleitbild der Stadt Dietikon Vorwort Handlungsfeld «Sprache und Verständigung» Wer in Dietikon wohnt, soll sich in das Gemeinwesen einbinden und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen
DEGRIN Begegnung und Bildung in Vielfalt e.v.
 -lich willkommen bei DEGRIN Begegnung und Bildung in Vielfalt e.v. Gostenhofer Hauptstr. 50 (RG) 90443 Nürnberg Fon: 0911 / 568363-0 Fax: 0911 / 568363-10 Email: info@degrin.de www.degrin.de DEGRIN Wer
-lich willkommen bei DEGRIN Begegnung und Bildung in Vielfalt e.v. Gostenhofer Hauptstr. 50 (RG) 90443 Nürnberg Fon: 0911 / 568363-0 Fax: 0911 / 568363-10 Email: info@degrin.de www.degrin.de DEGRIN Wer
Teilhabe Konkret Migrantenorganisationen in der Einwanderungsgesellschaft
 Teilhabe Konkret Migrantenorganisationen in der Einwanderungsgesellschaft Eröffnung der Bilanztagung am 20.10.2016 in Berlin Grußwort von Dr. Uta Dauke, Vizepräsidentin des Bundesamtes für Migration und
Teilhabe Konkret Migrantenorganisationen in der Einwanderungsgesellschaft Eröffnung der Bilanztagung am 20.10.2016 in Berlin Grußwort von Dr. Uta Dauke, Vizepräsidentin des Bundesamtes für Migration und
Leitbild. des Deutschen Kinderschutzbundes
 Leitbild des Deutschen Kinderschutzbundes Wichtig für Sie, wichtig für uns! Unser Leitbild ist die verbindliche Grundlage für die tägliche Kinderschutzarbeit. Es formuliert, wofür der Deutsche Kinderschutzbund
Leitbild des Deutschen Kinderschutzbundes Wichtig für Sie, wichtig für uns! Unser Leitbild ist die verbindliche Grundlage für die tägliche Kinderschutzarbeit. Es formuliert, wofür der Deutsche Kinderschutzbund
FAQs Erhebung Zusammenleben in der Schweiz (ZidS)
 Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Statistik BFS Abteilung Bevölkerung und Bildung 9. Januar 2017 FAQs Erhebung Zusammenleben in der Schweiz (ZidS) Inhaltsverzeichnis 1 Was ist das
Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Statistik BFS Abteilung Bevölkerung und Bildung 9. Januar 2017 FAQs Erhebung Zusammenleben in der Schweiz (ZidS) Inhaltsverzeichnis 1 Was ist das
gemeinde fil arth LebensArt{h) im Alter Altersleitbild
 gemeinde fil arth LebensArt{h) im Alter Altersleitbild "Ein Leben in Würde" Seit mehr als 20 Jahren lebe und arbeite ich in der Gemeinde Arth. Die Herausforderung, ein zeitgemässes und in die Zukunft schauendes
gemeinde fil arth LebensArt{h) im Alter Altersleitbild "Ein Leben in Würde" Seit mehr als 20 Jahren lebe und arbeite ich in der Gemeinde Arth. Die Herausforderung, ein zeitgemässes und in die Zukunft schauendes
Migranten und Ehrenamt
 Migranten und Ehrenamt Sozio-Demographische Entwicklungen Frankfurt am Main, 12. Juni 2015 Lorenz Overbeck, BDO-Geschäftsführer Gliederung des Vortrags 1) Initiative Integration durch Musik 2) Begriffsklärungen
Migranten und Ehrenamt Sozio-Demographische Entwicklungen Frankfurt am Main, 12. Juni 2015 Lorenz Overbeck, BDO-Geschäftsführer Gliederung des Vortrags 1) Initiative Integration durch Musik 2) Begriffsklärungen
Dei-Wer-City oder Treptow-Köpenick Dorf?
 Dei-Wer-City oder Treptow-Köpenick Dorf? Ein Überblick über Diversity und dessen Management Integrationsbeauftragter Integrationsbeauftragter Seite 2 Dei-Wer-City Stadt der Zukunft? 1. Diversity, Vielfalt
Dei-Wer-City oder Treptow-Köpenick Dorf? Ein Überblick über Diversity und dessen Management Integrationsbeauftragter Integrationsbeauftragter Seite 2 Dei-Wer-City Stadt der Zukunft? 1. Diversity, Vielfalt
Türkische Migranten in Deutschland
 Geisteswissenschaft Islam Fatih Kisacik Türkische Migranten in Deutschland "Wie funktioniert Integration oder nicht?" Essay Universität Kassel SS 2008 Fachbereich 05: Gesellschaftswissenschaften / Fachdidaktik
Geisteswissenschaft Islam Fatih Kisacik Türkische Migranten in Deutschland "Wie funktioniert Integration oder nicht?" Essay Universität Kassel SS 2008 Fachbereich 05: Gesellschaftswissenschaften / Fachdidaktik
Ältere Migrantinnen und Migranten in Deutschland Lebenssituationen, Unterstützungsbedarf, Alternspotenziale
 Ältere Migrantinnen und Migranten in Deutschland Lebenssituationen, Unterstützungsbedarf, Alternspotenziale Dr. Peter Zeman, Deutsches Zentrum für Altersfragen Hamburger Koordinationsstelle für Wohn-Pflege-Gemeinschaften
Ältere Migrantinnen und Migranten in Deutschland Lebenssituationen, Unterstützungsbedarf, Alternspotenziale Dr. Peter Zeman, Deutsches Zentrum für Altersfragen Hamburger Koordinationsstelle für Wohn-Pflege-Gemeinschaften
Selbstständige Lebensführung älterer Migrantinnen und Migranten in Deutschland Handlungsbedarfe und strukturelle Ansatzpunkte
 Selbstständige Lebensführung älterer Migrantinnen und Migranten in Deutschland Handlungsbedarfe und strukturelle Ansatzpunkte Empfehlungen des interdisziplinären Workshops am 10. Dezember 2015 in Berlin
Selbstständige Lebensführung älterer Migrantinnen und Migranten in Deutschland Handlungsbedarfe und strukturelle Ansatzpunkte Empfehlungen des interdisziplinären Workshops am 10. Dezember 2015 in Berlin
Geschlechterrollen von Geflüchteten in Deutschland Ergebnisse aus der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten
 Geschlechterrollen von Geflüchteten in Deutschland Ergebnisse aus der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten Okay. zusammen leben/projektstelle für Zuwanderung und Integration Götzis, Vorarlberg, 17.
Geschlechterrollen von Geflüchteten in Deutschland Ergebnisse aus der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten Okay. zusammen leben/projektstelle für Zuwanderung und Integration Götzis, Vorarlberg, 17.
GRÜNBERG Ein Handlungsrahmen für die aktive Gestaltung der Zukunft unserer Stadt. Grünberg gestaltet Zukunft
 GRÜNBERG 2025 Ein Handlungsrahmen für die aktive Gestaltung der Zukunft unserer Stadt Grünberg gestaltet Zukunft Präambel Die Stadt Grünberg hat einen Leitbildprozess angestoßen, um die zukünftige Entwicklung
GRÜNBERG 2025 Ein Handlungsrahmen für die aktive Gestaltung der Zukunft unserer Stadt Grünberg gestaltet Zukunft Präambel Die Stadt Grünberg hat einen Leitbildprozess angestoßen, um die zukünftige Entwicklung
Grußwort der Regierungsvizepräsidentin von Oberbayern Maria Els anlässlich des 26. Oberbayerischen Integrationsforums Integration vor Ort am 2.
 Grußwort der Regierungsvizepräsidentin von Oberbayern Maria Els anlässlich des 26. Oberbayerischen Integrationsforums Integration vor Ort am 2. Mai 2013 in Pfaffenhofen 2 Sehr geehrter Herr Abgeordneter
Grußwort der Regierungsvizepräsidentin von Oberbayern Maria Els anlässlich des 26. Oberbayerischen Integrationsforums Integration vor Ort am 2. Mai 2013 in Pfaffenhofen 2 Sehr geehrter Herr Abgeordneter
Partizipationsforum der Stadt Heidelberg
 Partizipationsforum der Stadt Heidelberg imap Institut für interkulturelle Management- und Politikberatung Referent: Bülent Arslan, Christopher van den Hövel Heidelberg, den 11. Juni 2013 1 Ablauf Begrüßung
Partizipationsforum der Stadt Heidelberg imap Institut für interkulturelle Management- und Politikberatung Referent: Bülent Arslan, Christopher van den Hövel Heidelberg, den 11. Juni 2013 1 Ablauf Begrüßung
Interkulturelle Kompetenz
 Interkulturelle Kompetenz für Bildungspatenschaften Christa Müller-Neumann Mainz, 01. Dezember 2011 Fragestellungen Was ist Interkulturelle Kompetenz Ein Blick auf die Zielgruppe der Aktion zusammen wachsen
Interkulturelle Kompetenz für Bildungspatenschaften Christa Müller-Neumann Mainz, 01. Dezember 2011 Fragestellungen Was ist Interkulturelle Kompetenz Ein Blick auf die Zielgruppe der Aktion zusammen wachsen
Ausbildung bei der Landeshauptstadt München: Interkulturelle Kompetenz erwünscht!
 Ausbildung bei der Landeshauptstadt : Interkulturelle Kompetenz erwünscht! Stefan Scholer Leiter der Abteilung Aus- und Fortbildung im 1 Landeshauptstadt 1,326 Millionen Einwohner Ausländeranteil: 23 %;
Ausbildung bei der Landeshauptstadt : Interkulturelle Kompetenz erwünscht! Stefan Scholer Leiter der Abteilung Aus- und Fortbildung im 1 Landeshauptstadt 1,326 Millionen Einwohner Ausländeranteil: 23 %;
Leitlinien Bürgerbeteiligung Wuppertal
 Leitlinien Bürgerbeteiligung Wuppertal V.2 / Beraten am 22.2.17 Präambel noch zu beraten Der Rat der Stadt Wuppertal hat 2.3.2016 die Stabsstelle Bürgerbeteiligung beauftragt, Leitlinien für Bürgerbeteiligung
Leitlinien Bürgerbeteiligung Wuppertal V.2 / Beraten am 22.2.17 Präambel noch zu beraten Der Rat der Stadt Wuppertal hat 2.3.2016 die Stabsstelle Bürgerbeteiligung beauftragt, Leitlinien für Bürgerbeteiligung
Integration gestalten im Kreis Bergstraße
 Integration gestalten im Kreis Bergstraße Die 261.913 (30.06.2013 HStL) Einwohner verteilen sich auf 22 Städte und Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von 2.432 bis 39.310 Menschen. Die jeweiligen örtlichen
Integration gestalten im Kreis Bergstraße Die 261.913 (30.06.2013 HStL) Einwohner verteilen sich auf 22 Städte und Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von 2.432 bis 39.310 Menschen. Die jeweiligen örtlichen
Stadtkonzeption Heilbronn 2030 Werkstatt (Zusammen-) Leben in der Stadt
 Stadtkonzeption Heilbronn 2030 Werkstatt (Zusammen-) Leben in der Stadt 21.10.15 2 ergänzt. Danach werden die Zielentwürfe für die Themenschwerpunkte "Vielfältiges Zusammenleben in der Stadt - Rahmenbedingungen
Stadtkonzeption Heilbronn 2030 Werkstatt (Zusammen-) Leben in der Stadt 21.10.15 2 ergänzt. Danach werden die Zielentwürfe für die Themenschwerpunkte "Vielfältiges Zusammenleben in der Stadt - Rahmenbedingungen
REFERAT VON FRANZISKA TEUSCHER, DIREKTORIN FÜR BILDUNG, SOZIALES UND SPORT
 Stadt Bern Direktion für Bildung Soziales und Sport Kick-off «Schwerpunkteplan Integration 2018-2021» vom Montag, 29. Januar 2018 REFERAT VON FRANZISKA TEUSCHER, DIREKTORIN FÜR BILDUNG, SOZIALES UND SPORT
Stadt Bern Direktion für Bildung Soziales und Sport Kick-off «Schwerpunkteplan Integration 2018-2021» vom Montag, 29. Januar 2018 REFERAT VON FRANZISKA TEUSCHER, DIREKTORIN FÜR BILDUNG, SOZIALES UND SPORT
50plus den demografischen Wandel im Quartier gestalten. BMBF-Forum für Nachhaltigkeit
 50plus den demografischen Wandel im Quartier gestalten BMBF-Forum für Nachhaltigkeit 23.09.2014 Chancen für Ludwigsburg partizipativer Prozess Die 11 Themenfelder des SEK Attraktives Wohnen Wirtschaft
50plus den demografischen Wandel im Quartier gestalten BMBF-Forum für Nachhaltigkeit 23.09.2014 Chancen für Ludwigsburg partizipativer Prozess Die 11 Themenfelder des SEK Attraktives Wohnen Wirtschaft
KOMMUNEN DER ZUKUNFT WÄHLEN! STARK, SOZIAL, SOLIDARISCH!
 KOMMUNEN DER ZUKUNFT WÄHLEN! STARK, SOZIAL, SOLIDARISCH! Kommunen der Zukunft wählen! Am 11. September 2016 stellen die Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen die Weichen dafür, wie Städte, Gemeinden
KOMMUNEN DER ZUKUNFT WÄHLEN! STARK, SOZIAL, SOLIDARISCH! Kommunen der Zukunft wählen! Am 11. September 2016 stellen die Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen die Weichen dafür, wie Städte, Gemeinden
Ich etabliere Werte. Kreativdirektorin. Dorottya K.
 Dorottya K. Kreativdirektorin Ich etabliere Werte. Traumjob Erzieherin. Traumjob Erzieher: Die Welt hat viele Gesichter. Kinder brauchen Orientierung. In der Kita lernen sie für ihr Leben. Migrantinnen
Dorottya K. Kreativdirektorin Ich etabliere Werte. Traumjob Erzieherin. Traumjob Erzieher: Die Welt hat viele Gesichter. Kinder brauchen Orientierung. In der Kita lernen sie für ihr Leben. Migrantinnen
Integration Zentrales Zukunftsthema. Teilresolution Flüchtlinge
 Integration Zentrales Zukunftsthema Teilresolution Flüchtlinge Klausurtagung der SPD-Fraktion des Abgeordnetenhauses von Berlin vom 23. bis 25. Januar 2015 in Leipzig #spdfraktionberlin15 Teilresolution
Integration Zentrales Zukunftsthema Teilresolution Flüchtlinge Klausurtagung der SPD-Fraktion des Abgeordnetenhauses von Berlin vom 23. bis 25. Januar 2015 in Leipzig #spdfraktionberlin15 Teilresolution
Inhalt. - Impressum. - Wer wir sind - Wie wir arbeiten. - Was wir wollen. - Inklusion. - Solidarität. - Adressen, Spendenkonto
 Leitbild 2010 Inhalt - Impressum - Wer wir sind - Wie wir arbeiten - Was wir wollen - Inklusion - Solidarität - Adressen, Spendenkonto 2 4 6 8 10 12 Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Ortsvereinigung
Leitbild 2010 Inhalt - Impressum - Wer wir sind - Wie wir arbeiten - Was wir wollen - Inklusion - Solidarität - Adressen, Spendenkonto 2 4 6 8 10 12 Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Ortsvereinigung
"Weggehen oder Hierbleiben?" Vor dieser Frage stehen viele junge Menschen an der Schwelle ins Erwachsenenleben.
 Jugend - Demografischer Wandel - Ländlicher Raum "Weggehen oder Hierbleiben?" Vor dieser Frage stehen viele junge Menschen an der Schwelle ins Erwachsenenleben. Statistiken und Prognosen zeigen übereinstimmend:
Jugend - Demografischer Wandel - Ländlicher Raum "Weggehen oder Hierbleiben?" Vor dieser Frage stehen viele junge Menschen an der Schwelle ins Erwachsenenleben. Statistiken und Prognosen zeigen übereinstimmend:
Respekt, Toleranz, Achtung. Zuwanderungs- und Integrationskonzept
 Respekt, Toleranz, Achtung Zuwanderungs- und Integrationskonzept Sehr geehrte Damen und Herren, der Freistaat Sachsen ist reich an Kultur, an wunderschöner Landschaft und an Geschichte. Der größte Reichtum
Respekt, Toleranz, Achtung Zuwanderungs- und Integrationskonzept Sehr geehrte Damen und Herren, der Freistaat Sachsen ist reich an Kultur, an wunderschöner Landschaft und an Geschichte. Der größte Reichtum
Zugehörigkeit und Zugehörigkeitskriterien zur Gesellschaft im Einwanderungsland Deutschland Ergebnisse des SVR-Integrationsbarometers 2016 Handout
 Zugehörigkeit und Zugehörigkeitskriterien zur Gesellschaft im Einwanderungsland Deutschland Ergebnisse des SVR-Integrationsbarometers 2016 Handout Für das SVR-Integrationsbarometer 2016 wurden von März
Zugehörigkeit und Zugehörigkeitskriterien zur Gesellschaft im Einwanderungsland Deutschland Ergebnisse des SVR-Integrationsbarometers 2016 Handout Für das SVR-Integrationsbarometer 2016 wurden von März
in Deutschland Ihre Bedeutung und Funktion im Integrationsprozess Hamburg, 04. November 2008
 Migrantenorganisationen in Deutschland Ihre Bedeutung und Funktion im Integrationsprozess Hamburg, 04. November 2008 Das Netzwerk IQ wird gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und
Migrantenorganisationen in Deutschland Ihre Bedeutung und Funktion im Integrationsprozess Hamburg, 04. November 2008 Das Netzwerk IQ wird gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und
Leitbild Kinder- und Jugendhilfe in der Stadt Freiburg
 Leitbild Kinder- und Jugendhilfe in der Stadt Freiburg Stand 21.11.2011 Präambel Die Stadt Freiburg schafft und erhält positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder-,
Leitbild Kinder- und Jugendhilfe in der Stadt Freiburg Stand 21.11.2011 Präambel Die Stadt Freiburg schafft und erhält positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder-,
GIP Gemeinsam in Parchim. Diakonisches Werk Mecklenburg-Vorpommern e. V.
 GIP Gemeinsam in Parchim Diakonisches Werk Mecklenburg-Vorpommern e. V. Projektbezeichnung: GIP Gemeinsam in Parchim Projektdauer: 01.10.2013-31.09.2016 Träger: Diakonisches Werk Mecklenburg-Vorpommern
GIP Gemeinsam in Parchim Diakonisches Werk Mecklenburg-Vorpommern e. V. Projektbezeichnung: GIP Gemeinsam in Parchim Projektdauer: 01.10.2013-31.09.2016 Träger: Diakonisches Werk Mecklenburg-Vorpommern
Es gilt das gesprochene Wort
 Grußwort zur vierten Integrationswoche am 12. Okt. 2014 Es gilt das gesprochene Wort Seien Sie herzlich willkommen hier in dieser wunderbaren Halle zur Eröffnung unserer vierten Integrations-Woche. Mit
Grußwort zur vierten Integrationswoche am 12. Okt. 2014 Es gilt das gesprochene Wort Seien Sie herzlich willkommen hier in dieser wunderbaren Halle zur Eröffnung unserer vierten Integrations-Woche. Mit
Integration = Arbeitsmarktintegration? Chancen und Herausforderungen des KIP2 Veranstaltung = Willkommen auf Suaheli
 Integration = Arbeitsmarktintegration? Chancen und Herausforderungen des KIP2 Veranstaltung 23.5.2018 = Willkommen auf Suaheli Gründe für die Veranstaltung Basis für Leistungsvertrag mit den Gemeinden
Integration = Arbeitsmarktintegration? Chancen und Herausforderungen des KIP2 Veranstaltung 23.5.2018 = Willkommen auf Suaheli Gründe für die Veranstaltung Basis für Leistungsvertrag mit den Gemeinden
Möglichkeiten und Grenzen der Integration von Geflüchteten im und durch Sport. Angelika Ribler
 Möglichkeiten und Grenzen der Integration von Geflüchteten im und durch Sport von Angelika Ribler Dokument aus der Internetdokumentation des Deutschen Präventionstages www.praeventionstag.de Herausgegeben
Möglichkeiten und Grenzen der Integration von Geflüchteten im und durch Sport von Angelika Ribler Dokument aus der Internetdokumentation des Deutschen Präventionstages www.praeventionstag.de Herausgegeben
der AWO Kreisverband Nürnberg e.v. 2. IKÖ als Auftrag zur aktiven Beteiligung im Gemeinwesen 3. IKÖ als Auftrag an Vorstand und Ortsvereine
 Leitbild zur Interkulturellen Öffnung (IKÖ) der AWO Kreisverband Nürnberg e.v. 1. Grundsätze 2. IKÖ als Auftrag zur aktiven Beteiligung im Gemeinwesen 3. IKÖ als Auftrag an Vorstand und Ortsvereine 4.
Leitbild zur Interkulturellen Öffnung (IKÖ) der AWO Kreisverband Nürnberg e.v. 1. Grundsätze 2. IKÖ als Auftrag zur aktiven Beteiligung im Gemeinwesen 3. IKÖ als Auftrag an Vorstand und Ortsvereine 4.
Entwickelt und erarbeitet von Trägern der Freien und Öffentlichen Jugendhilfe im Bezirk
 Entwickelt und erarbeitet von Trägern der Freien und Öffentlichen Jugendhilfe im Bezirk März 2006 1 Sozialraumorientierung heißt Lebensweltorientierung Wir als Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe im
Entwickelt und erarbeitet von Trägern der Freien und Öffentlichen Jugendhilfe im Bezirk März 2006 1 Sozialraumorientierung heißt Lebensweltorientierung Wir als Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe im
Kinder mit Fluchthintergrund in der Kindertagespflege. Ilka Ruhl, Dr. Eveline Gerszonowicz (wiss. Referentinnen)
 Kinder mit Fluchthintergrund in der Kindertagespflege Ilka Ruhl, Dr. Eveline Gerszonowicz (wiss. Referentinnen) Überblick 1. Der Bundesverband für Kindertagespflege 2. Das Projekt Kinder aus Familien mit
Kinder mit Fluchthintergrund in der Kindertagespflege Ilka Ruhl, Dr. Eveline Gerszonowicz (wiss. Referentinnen) Überblick 1. Der Bundesverband für Kindertagespflege 2. Das Projekt Kinder aus Familien mit
Rede des Landrates. anlässlich der Einbürgerungsfeier. am
 Herzlich willkommen! Rede des Landrates anlässlich der Einbürgerungsfeier am 30.11.2015 Ich freue mich sehr, so viele Menschen aus der ganzen Welt, Sie alle meine sehr geehrten Damen und Herren heute und
Herzlich willkommen! Rede des Landrates anlässlich der Einbürgerungsfeier am 30.11.2015 Ich freue mich sehr, so viele Menschen aus der ganzen Welt, Sie alle meine sehr geehrten Damen und Herren heute und
Leitbild Stand
 Leitbild Stand 28.10.17 Wir wollen... 1. als Gemeinschaft stattvilla miteinander wohnen und leben und uns dabei viel persönlichen Freiraum lassen 2. Vielfalt leben und Unterschiedlichkeit respektieren
Leitbild Stand 28.10.17 Wir wollen... 1. als Gemeinschaft stattvilla miteinander wohnen und leben und uns dabei viel persönlichen Freiraum lassen 2. Vielfalt leben und Unterschiedlichkeit respektieren
Der Wunsch nach Verbundenheit und Einssein
 Der Wunsch nach Verbundenheit und Einssein Aufgewachsen bin ich als der Ältere von zwei Kindern. Mein Vater verdiente das Geld, meine Mutter kümmerte sich um meine Schwester und mich. Vater war unter der
Der Wunsch nach Verbundenheit und Einssein Aufgewachsen bin ich als der Ältere von zwei Kindern. Mein Vater verdiente das Geld, meine Mutter kümmerte sich um meine Schwester und mich. Vater war unter der
Integration geht uns alle an! Interkulturelle Öffnung vor Ort.
 Integration geht uns alle an! Interkulturelle Öffnung vor Ort. Zukunfts-Workshop des Landkreises Landsberg Martina Lachmayr, VIA Bayern e.v. IQ Fachstelle Interkulturelle Kompetenzentwicklung und Antidiskriminierung
Integration geht uns alle an! Interkulturelle Öffnung vor Ort. Zukunfts-Workshop des Landkreises Landsberg Martina Lachmayr, VIA Bayern e.v. IQ Fachstelle Interkulturelle Kompetenzentwicklung und Antidiskriminierung
Integration von Flüchtlingen in ländlichen Räumen. Strategische Leitlinien und Best Practices
 Integration von Flüchtlingen in ländlichen Räumen Strategische Leitlinien und Best Practices Studie des Deutschen Landkreistags in Kooperation mit Viventure Konferenz in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium
Integration von Flüchtlingen in ländlichen Räumen Strategische Leitlinien und Best Practices Studie des Deutschen Landkreistags in Kooperation mit Viventure Konferenz in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium
GEMEINSAM AUF DEM WEG. Unsere Schule ist ein Haus der Begegnung und des Lernens, wo sich alle Beteiligten wohl fühlen können.
 GEMEINSAM AUF DEM WEG. Unsere Schule ist ein Haus der Begegnung und des Lernens, wo sich alle Beteiligten wohl fühlen können. INHALT SCHULKLIMA LEHREN UND LERNEN SCHULFÜHRUNGSKRAFT BEZIEHUNGEN NACH AUSSEN
GEMEINSAM AUF DEM WEG. Unsere Schule ist ein Haus der Begegnung und des Lernens, wo sich alle Beteiligten wohl fühlen können. INHALT SCHULKLIMA LEHREN UND LERNEN SCHULFÜHRUNGSKRAFT BEZIEHUNGEN NACH AUSSEN
2 Ansprechpartner: 3 Telefon:
 Kreis Warendorf Befragung im Rahmen des Projektes Aktivierende Bestandsaufnahme der Lebenswelt von Zuwanderern im Kreis Warendorf Befragung von Freien Trägern und Migrantenselbstorganisationen zur Integrationsarbeit
Kreis Warendorf Befragung im Rahmen des Projektes Aktivierende Bestandsaufnahme der Lebenswelt von Zuwanderern im Kreis Warendorf Befragung von Freien Trägern und Migrantenselbstorganisationen zur Integrationsarbeit
Referat: TRANSKULTURELLER PFLEGEDIENST
 Fachtagung Interkulturelle Öffnung Bremen 16.10,.2007 Referat: TRANSKULTURELLER PFLEGEDIENST Interkulturelle Kompetenz gewinnt in der ambulanten und stationären Pflege zunehmend an Bedeutung, weil immer
Fachtagung Interkulturelle Öffnung Bremen 16.10,.2007 Referat: TRANSKULTURELLER PFLEGEDIENST Interkulturelle Kompetenz gewinnt in der ambulanten und stationären Pflege zunehmend an Bedeutung, weil immer
Die Beziehung zur Persönlichkeit
 Die Beziehung zur Persönlichkeit selbstbewusst und selbstkritisch sein Wir gestalten unser Leben mit Freude und Optimismus. Dabei bilden wir uns eine eigene Meinung, übernehmen Verantwortung für uns selbst
Die Beziehung zur Persönlichkeit selbstbewusst und selbstkritisch sein Wir gestalten unser Leben mit Freude und Optimismus. Dabei bilden wir uns eine eigene Meinung, übernehmen Verantwortung für uns selbst
Sitzung: GR Verwaltungs- und Finanzausschuss nicht öffentlich Vorberatung Gemeinderat öffentlich Entscheidung
 TOP Drucksache Nr.: 2016-062/1 Sitzung: GR 21.03.2016 Federführender Dezernent: Federführende/r Fachbereich/Dienststelle: FB 9 Beteiligte/r Fachbereich/e/Dienststellen: Bürgermeister Pfirrmann, Dezernat
TOP Drucksache Nr.: 2016-062/1 Sitzung: GR 21.03.2016 Federführender Dezernent: Federführende/r Fachbereich/Dienststelle: FB 9 Beteiligte/r Fachbereich/e/Dienststellen: Bürgermeister Pfirrmann, Dezernat
Zur Diskriminierung im Wohnungsmarkt
 Zur Diskriminierung im Wohnungsmarkt Integrations- und Ausgrenzungsprozesse bei türkischen Migranten der zweiten Generation Dr. Norbert Gestring Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Freiwillige Selbstverpflichtungen
Zur Diskriminierung im Wohnungsmarkt Integrations- und Ausgrenzungsprozesse bei türkischen Migranten der zweiten Generation Dr. Norbert Gestring Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Freiwillige Selbstverpflichtungen
Datenreport 2016 ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland. Statement von Dr. Mareike Bünning (WZB)
 Pressekonferenz Migration und Integration Datenreport 01 ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland am 3. Mai 01 in Berlin Statement von Dr. Mareike Bünning (WZB) Es gilt das gesprochene Wort
Pressekonferenz Migration und Integration Datenreport 01 ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland am 3. Mai 01 in Berlin Statement von Dr. Mareike Bünning (WZB) Es gilt das gesprochene Wort
INTEGRIERTES KOMMUNALES ENTWICKLUNGSKONZEPT (IKEK) OBER-RAMSTADT
 INTEGRIERTES KOMMUNALES ENTWICKLUNGSKONZEPT (IKEK) OBER-RAMSTADT Leitbild-Visionen zum IKEK Ober-Ramstadt Vorwort Im Rahmen des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) wurde gemeinsam mit
INTEGRIERTES KOMMUNALES ENTWICKLUNGSKONZEPT (IKEK) OBER-RAMSTADT Leitbild-Visionen zum IKEK Ober-Ramstadt Vorwort Im Rahmen des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) wurde gemeinsam mit
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Andrea Mack-Philipp, Referentin. Grußwort zur Fachtagung jung.vielfältig.engagiert. der aej am 20.03.
 KNr. 601 005 BAMF 08-04 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Andrea Mack-Philipp, Referentin Grußwort zur Fachtagung jung.vielfältig.engagiert. der aej am 20.03.2014 Sehr geehrte Damen und Herren, Ich
KNr. 601 005 BAMF 08-04 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Andrea Mack-Philipp, Referentin Grußwort zur Fachtagung jung.vielfältig.engagiert. der aej am 20.03.2014 Sehr geehrte Damen und Herren, Ich
Heimat und Identität in der Einwanderungsgesellschaft
 Heimat und Identität in der Einwanderungsgesellschaft Vorbemerkungen Deutschland ist ein in der Welt angesehenes Land. Viele Menschen aus der ganzen Welt sind in den letzten 60 Jahren aus verschiedenen
Heimat und Identität in der Einwanderungsgesellschaft Vorbemerkungen Deutschland ist ein in der Welt angesehenes Land. Viele Menschen aus der ganzen Welt sind in den letzten 60 Jahren aus verschiedenen
Erfolgsfaktoren und Hindernisse bei der Integration von Flüchtlingen im ländlichen Raum Erfahrungen aus Forschungs-Praxis-Projekten
 Erfolgsfaktoren und Hindernisse bei der Integration von Flüchtlingen im ländlichen Raum Erfahrungen aus Forschungs-Praxis-Projekten Gudrun Kirchhoff Auftaktveranstaltung Ankommen Wohlfühlen Heimisch werden
Erfolgsfaktoren und Hindernisse bei der Integration von Flüchtlingen im ländlichen Raum Erfahrungen aus Forschungs-Praxis-Projekten Gudrun Kirchhoff Auftaktveranstaltung Ankommen Wohlfühlen Heimisch werden
sportlich. christlich. bewegt.
 DJK-Sportverband Diözesanverband Münster e. V. sportlich. christlich. bewegt. Unser Leitbild Unsere Mission. Sport als Dienst am Menschen. Unsere Mission. Sport als Dienst am Menschen. Bewegung, Spiel
DJK-Sportverband Diözesanverband Münster e. V. sportlich. christlich. bewegt. Unser Leitbild Unsere Mission. Sport als Dienst am Menschen. Unsere Mission. Sport als Dienst am Menschen. Bewegung, Spiel
Erwartungen an die Politik und die Verwaltung der Stadt Schopfheim. Arbeitskreis Integration. Wer sind wir - was tun wir.
 Arbeitskreis Integration Schopfheim Wer sind wir - was tun wir Erwartungen an die Politik und die Verwaltung der Stadt Schopfheim Wer sind wir? - Entstehung - 21.11.2006 Podiumsdiskussion Integration geht
Arbeitskreis Integration Schopfheim Wer sind wir - was tun wir Erwartungen an die Politik und die Verwaltung der Stadt Schopfheim Wer sind wir? - Entstehung - 21.11.2006 Podiumsdiskussion Integration geht
