MRT in der Differentialdiagnose von Parkinson-Syndromen
|
|
|
- Roland Abel
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Österreichische Post AG info.mail Entgelt bezahlt Retouren an Postfach 555, 1080 Wien 2/2012 a k t u e l l Informationen zu Morbus Parkinson und extrapyramidalen Bewegungsstörungen Newsletter der Österreichischen Parkinson Gesellschaft S MRT in der Differentialdiagnose von ParkinsonSyndromen C. MUELLER, K. SEPPI, M. SCHOCKE Universitätsklinik für Neurologie, Universitätsklinik für Radiologie, Medizinische Universität Innsbruck Editorial ehr geehrte Frau Kollegin, Sehr geehrter Herr Kollege! Die Diagnose des Morbus Parkinson basiert primär auf Anamnese und neurologischer Untersuchung und wird anhand etablierter klinischer Kriterien gestellt. Die Abgrenzung von milden extrapyramidalen Störungen bei ansonsten gesunden älteren Personen, anderen ParkinsonSyndromen und Tremor Syndromen kann im Frühstadium jedoch schwierig sein. In fortgeschrittenen Krankheitsstadien kann die Differenzierung unterschiedlicher ParkinsonSyndrome Probleme bereiten, insbesondere bei ungenügendem Ansprechen auf Dopamin Ersatztherapie oder bei atypischen ParkinsonSyndromen wie MSA oder PSP. Bildgebende Untersuchungen können wesentlich zur Diagnostik von ParkinsonSyndromen beitragen. Im Rahmen der Abklärung von Patienten mit ParkinsonSyndromen sollte routinemäßig zumindest einmalig eine strukturelle kraniale Bildgebung (wenn möglich MRT, ansonsten CCT) erfolgen. MRT bzw. CCT dienen primär dem Ausschluss läsioneller ParkinsonSyndrome und der Erfassung von Komorbiditäten. Wie der vorliegende Beitrag von Dr. Müller, Prof. Seppi und Prof. Schocke von der Medizinischen Universität Innsbruck zeigt, kann die MRT aber auch wesentlich zur Differenzialdiagnose degenerativer ParkinsonSyndrome beitragen. Atypische ParkinsonErkrankungen sind durch spezifische AtrophieMuster und Veränderungen der Signalintensität charakterisiert, die in fortgeschrittenen Krankheitsstadien eine relativ hohe Sensitivität und Spezifität, im Frühstadium der Erkrankung aber nur eine geringe Sensitivität haben. Neue MRTechniken wie die Diffusionsbildgebung könnten hier einen wesentlichen Fortschritt bringen, da ihre Sensitivität und Spezifität in der Differenzierung von MSA und PSP vom M. Parkinson bereits in frühen Krankheitsstadien hoch zu sein scheint. Wie praktikabel der Einsatz dieser moderneren MRTechniken im klinischen Alltag ist, muss allerdings noch dokumentiert werden. Wir danken den Autoren für den schönen Überblick zum Thema»MRT in der Diagnostik von ParkinsonSyndromen«und wünschen unseren LeserInnen viel Vergnügen bei der Lektüre! Als Herausgeber sind wir wie immer dankbar für Anregungen und Kritik. Walter PIRKER Sylvia BOESCH Abb. 1 T1gewichtete MRBilder in der medianen Sagittalebene, unauffällig bei MP (A). Bei MSAP (B) zeigt sich eine Ponsatrophie, bei PSP (C) zeigt sich eine Mittelhirnatrophie ohne Atrophie des Pons. Hieraus ergibt sich die Silhouette eines Königspinguins oder eines Kolibris, wobei das Mittelhirn die Form des Kopfes annimmt und der darunterliegende, nicht atrophe Pons den Körper darstellt (getrennt durch die weiße Linie). M. Schocke, K. Seppi, Universitätsklinik für Radiologie, Universitätsklinik für Neurologie. Innsbruck.
2 1. Einleitung Der Morbus Parkinson (MP) ist neben der Alzheimer Erkrankung die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung und die häufigste Ursache für die Entwicklung eines ParkinsonSyndroms (PS). Die Diagnose des MP fußt primär auf Anamnese und klinischer Untersuchung (Tabelle 1). Dennoch kann die Abgrenzung von milden extrapyramidalen Störungen bei ansonsten gesunden älteren Personen und bei Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen, von Medikamenteninduzierten und vaskulären ParkinsonSyndromen sowie von Tremorsyndromen schwierig sein. Eine Differenzierung zwischen MP und den neurodegenerativen atypischen ParkinsonSyndromen (aps) wie der Multisystematrophie (MSA, multiple system atrophy), der Progressiven Supranukleären Paralyse (PSP, progressive supranuclear palsy) und der Kortikobasalen Degeneration (CBD, corticobasal degeneration) ist im Frühstadium klinisch häufig nicht möglich, auch wenn die aps gegenüber dem MP eine raschere Krankheitsprogression mit einem mittleren Überleben meist unter 10 Jahren, ein vermindertes Ansprechen auf die dopaminerge Therapie und zusätzliche klinische Symptomen aufweisen. Die zugrunde liegende Pathologie beim MP besteht in einem Verlust von dopaminergen Neuronen in der Substantia nigra (SN) und dem Auftreten von LewyKörperchen, welche alphasynuklein enthalten. Die motorischen Kardinalsymptome sind Bradykinese, muskulärer Rigor, Ruhetremor und eine Beeinträchtigung der posturalen Stabilität. Daneben können sich Patienten mit nichtmotorischen Symptomen wie Störungen der SchlafWach Regulation, neuropsychiatrischen Symptomen und auch autonomen Dysfunktionen präsentieren. Die MSA ist wie der MP und die Tabelle 1: UK Brain Bank Criteria (angelehnt an Oertel, Deuschl, Poewe. ParkinsonSyndrome und andere Bewegungsstörungen. ThiemeVerlag 2012; und Gibb et al. 1988) Kriterien 1. Diagnose eines ParkinsonSyndroms Feststellung von Akinese/Bradykinese mit mindestens einem der folgenden Symptome: Muskulärer Rigor Ruhetremor Posturale Instabilität, die nicht primär durch visuelle, vestibuläre, zerebelläre oder propriozeptive Störungen erklärbar ist. 2. Vohandensein von unterstützenden Kriterien Einseitiger Beginn Persistierende Asymmetrie im Krankheitsverlauf Klassischer Ruhetremor Eindeutig positives Ansprechen (>30% UPDRS motorisch) auf LDopa Anhaltendes Ansprechen auf LDopa über mehr als 5 Jahre Auftreten von LDopa induzierten choreatischen Dyskinesien im Verlauf Langsame klinische Progression mit Krankheitsverlauf über mehr als 10 Jahre 3. Fehlen von Ausschlusskriterien für die klinische Diagnose einer ParkinsonKrankheit 3.1 Hinweise für ein symptomatisches ParkinsonSyndrom: Klinische Hinweise: Rezidivierende SchädelHirnTraumen in der Vorgeschichte Diagnostisch gesicherte Enzephalitis in der Vorgeschichte Remissionen über längere Perioden Behandlung mit Neuroleptika oder Exposition gegenüber anderen ein ParkinsonSyndrom auslösenden Medikamenten/Toxinen/Noxen in zeitlichem Zusammenhang mit Erstmanifestation der Parkinson Symptome Wiederholte zerebrale ischämische Insulte, assoziiert mit einer stufenweisen Verschlechterung der ParkinsonSymptome Zerebrale Bildgebung: Nachweis struktureller Basalganglienveränderungen, frontaler Tumoren oder Hydrocephalus communicans 3.2 Warnsymptome, die auf ein atypisches ParkinsonSyndrom hinweisen können: Nichtansprechen auf hohe Dosen LDopa (1000 mg/tag) über mehrere Monate (auch nach Ausschluss einer Malresorption) Frühzeitig im Verlauf auftretende schwere Störungen des autonomen Nervensystems (orthostatische Hypotension bis hin zu Synkopen, Impotenz oder verringerte genitale Empfindlichkeit, Blasenentleerungsstörungen, Anhidrose) Zerebelläre Zeichen Positives BabinskiZeichen, soweit nicht anderweitig erklärbar (z.b. Schlaganfall) Ausgeprägter Antecollis Supranukleäre vertikale Blickparese Frühe posturale Instabilität und Stürze Apraxie Innerhalb der ersten Jahre auftretende Demenz Innerhalb der ersten Jahre auftretende fluktuierende visuelle Halluzinationen 2 P A K T U E L L 2 /
3 Demenz mit LewyKörperchen (DLB, dementia with Lewy bodies) eine alpha Synukleinopathie, die entsprechend den Diagnosekriterien immer mit autonomen Symptomen wie Blasenfunktionsstörungen oder orthostatischer Dysregulation vergesellschaftet ist. Je nach Auftreten von Zusatzsymptomen zum Untersuchungszeitpunkt wird die MSA in zwei Unterformen unterteilt: Die MSAP zeigt überwiegend Zeichen eines LDoparefraktären PS und ist neuropathologisch durch striatonigrale Degeneration (SND) gekennzeichnet, wohingegen die MSAC mit zerebellären Zeichen einhergeht und auf einer olivopontozerebellären Atrophie (OPCA) beruht. Im Verlauf der Erkrankung bietet ein Großteil der Patienten neben den autonomen Symptomen sowohl Parkinson als auch zerebelläre Symptome, auch neuropathologisch liegt in den meisten Fällen sowohl eine SND als auch eine OPCA vor. Die PSP ist eine TauProtein assoziierte neurodegenerative Erkrankung und kann sich im Frühstadium heterogen präsentieren. Der klassische Phänotyp, das RichardsonSyndrom (RS), ist durch das Vorliegen einer supranukleären vertikalen Blickparese, posturaler Instabilität und Fallneigung mit Stürzen nach hinten gekennzeichnet. Daneben gibt es aber noch atypische Präsentationen wie die Parkinsonvariante der PSP (PSPP) mit einem initial auf L Dopa meist gering bis mäßiggradig ansprechenden PS, das erst im späteren Verlauf die Symptome des RS zeigt, sowie pure akinesia with gait freezing (PAGF) mit im Vordergrund stehenden FreezingEpisoden beim Gehen und Sprechen, posturaler Instabilität und ohne Ansprechen auf LDopa. Die meisten bildgebenden Studien wurden mit RSPatienten durchgeführt, wohingegen die eigentliche Schwierigkeit in der Diagnose der sich atypisch präsentierenden PSPP liegt. Die CBD ist wie die PSP eine Tauopathie und neuropathologisch durch eine asymmetrische kortikale Degeneration gekennzeichnet. Die klassische Manifestation der CBD ist die klinische Präsentation als kortikobasales Syndrom (CBS, corticobasal syndrome) und umfasst eine strikt asymmetrische Symptomausprägung mit Extremitätenapraxie (ggf. mit»alienlimbphänomen«der fremden Extremität) u.a. vergesellschaftet mit Myoklonus, Dystonie, Bradykinese und Rigor der betreffenden Extremität. Allerdings haben rezente klinischneuropathologische Studien gezeigt, dass sich eine CBD phänotypisch auch als PSPSyndrom oder als eine frontale Demenz (behavioural variant einer FTD) präsentieren kann, während andererseits einem CBS neuropathologisch eine CBD, eine PSP, eine Frontotemporale Demenz oder eine Alzheimer Erkrankung zugrunde liegen können. Die meisten Bildgebungsstudien wurden bei klinisch diagnostizieren Patienten mit CBS durchgeführt. Im Gegensatz zum MP präsentiert sich die DLB mit einem dementiellen Syndrom, das vor oder spätestens ein Jahr nach Auftreten von Parkinson Symptomen manifest wird. Zu den Kernsymptomen der DLB gehören außerdem fluktuierende kognitive Defizite, insbesondere der Aufmerksamkeit, und wiederholte detaillierte visuelle Halluzinationen. Patienten mit ParkinsonErkrankung und Demenz (PDD, Parkinson s disease with dementia) präsentieren sich ebenfalls mit den oben angegebenen Symptomen, wobei es erst über 12 Monate nach Beginn der ParkinsonSymptome zur Entwicklung von kognitiven Defiziten kommt. Die DLB und PDD sind wie der MP alphasynukleinopathien, wobei sich die LewyKörperchen hauptsächlich in Neokortex, limbischem Cortex, Hirnstamm und Nucleus basalis Meynert finden. Interessanterweise ergaben Nachuntersuchungen von in Allgemeinpraxen diagnostizierten MPPatienten Fehldiagnoseraten von bis zu 50%. Die Diagnose sollte daher durch einen Neurologen gestellt werden. Die zurzeit erreichbare Zuverlässigkeit der klinischen Diagnose MP liegt jedoch selbst in spezialisierten Zentren und im fortgeschrittenen Stadium bei maximal 90%. Bildgebende Untersuchungen können wesentlich zur Diagnostik von ParkinsonSyndromen beitragen und haben in den letzten Jahren daher einen wichtigen Stellenwert in der klinischen Routine erlangt. SPECT (single photon emisson computed tomography) und PET (positron emission tomography) sind nuklearmedizinische funktionelle Bildgebungsverfahren, die die Untersuchung von Hirnperfusion, stoffwechsel und Rezeptorsystemen erlauben. Die DopamintransporterSPECT (DATSPECT) kann zwischen ParkinsonSyndromen mit und ohne dopaminerger Degeneration differenzieren und hat zurzeit den höchsten praktischen Stellenwert unter den funktionellen Bildgebungsverfahren. Untersuchungen des Zuckerstoffwechsels (FDGPET) und D2RezeptorUntersuchungen (IBZMSPECT) können zur Differenzierung der verschiedenen degenerativen ParkinsonSyndrome beitragen. In der Regel sollte vor funktionellen bildgebenden Untersuchungen (SPECT, PET) eine kraniale CT oder MRT durchgeführt werden, um Fehlinterpretationen aufgrund von strukturellen Läsionen zu vermeiden. Die strukturelle Bildgebung mittels kranialer Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT) dient primär dem Ausschluss läsioneller ParkinsonSyndrome z.b. bei Raumforderungen im Frontallappen bzw. in den Basalganglien, wobei die MRT die im Vergleich zur CT wesentlich sensitivere Methode darstellt. Bei atypischen Parkinson Symptomen und selteneren heredometabolischen Störungen finden sich in der konventionellen MRT bei einem Teil der Patienten charakteristische Atrophiemuster oder Veränderungen der Signalintensität, die eine diagnostische Abgrenzung vom MP erlauben. Entscheidende Verbesserungen in der Diagnostik könnten moderne MRT P A K T U E L L 2 /
4 Techniken wie die Verwendung Suszeptibilitätsgewichteter Sequenzen, die sensitiv auf die Entdeckung von Eisenablagerungen sind, der Relaxometrie, mit deren Hilfe Eisenablagerungen quantifiziert werden, sowie der DiffusionsTensorBildgebung (DTI, diffusion tensor imaging), mit deren Hilfe die Bewegung der Wassermoleküle über den Diffusionskoeffizienten und über die fraktionale Anisotropie (FA) im hoch organisierten ZNS beschrieben werden können. Die DTI kann sogar den Verlauf einzelner Faserbündel durch das ZNS visualisieren, was auch als Traktographie bezeichnet wird. Außerdem hat sich die HochfeldMRT Untersuchung mit 3.0 Tesla (T) über die letzten Jahre in Forschung und klinischem Alltag etabliert, wobei deren Verwendung gerade in der Neurobildgebung immer mehr propagiert wird. Zudem hat die transkranielle Parenchymsonographie (TCS) für die Differentialdiagnose des MP über das letzte Jahrzehnt zunehmend an Bedeutung gewonnen, indem bei 90% der Patienten mit MP eine sogenannte Hyperechogenität im Mittelhirn im Bereich der Substantia nigra (SN+) nachweisbar ist, wobei dieses Ultraschallsignal bei ca. 10% der gesunden Menschen vorliegt. Ziel dieser Übersichtsarbeit ist es, dem Leser einen Überblick über den Stellenwert der wichtigsten strukturellen bildgebenden Verfahren in der heutigen klinischen Diagnostik in der Abklärung von neurodegenerativen Parkinson Syndromen zu geben. 2. Magnetresonanz Bildgebung Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat die Magnetresonanztomographie (MRT) immer weiter Einzug in die Abklärung neurodegenerativer Erkrankungen gehalten. Dementsprechend wird bei der Diagnostik von PS von den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie einmalig eine struktu relle Bildgebung vorzugsweise eine MRT im Rahmen der Basisdiagnostik, v.a. zum Ausschluss eines symptomatischen PS aufgrund von strukturellen Läsionen, empfohlen. Tatsächlich lassen sich auch mit Hilfe der konventionellen MRT Patienten mit MP von Patienten mit aps unterscheiden, wenn sich bestimmte, für aps pathognomonische Zeichen darstellen lassen. Durch Anwendung spezieller Sequenzen und Algorithmen lässt sich die diagnostische Information aus der konventionellen MRTBildgebung bei Patienten mit PS erheblich erweitern. Voxelbasierte Morphometrie (VBM, voxelbased morphometry), funktionelle MRT, Spektroskopie oder MR Traktographie werden aber aktuell nur im wissenschaftlichen Zusammenhang untersucht und haben keinen Stellenwert in der klinischen Routinediagnostik. Dies gilt nicht in gleichem Maß für die DWI, wo der Nachweis bzw. Ausschluss von Veränderungen der Diffusivität im Bereich von Putamen und Kleinhirnstielen bereits jetzt an spezialisierten Zentren für die Differenzierung zwischen MP und aps routinemäßig verwendet wird. Da durchwegs sämtliche Literaturstellen auf Befunden von 1.5 T Geräten beruhen, beziehen sich Befunde über Signalveränderungen in diesem Artikel auf die auch in der klinischen Routine meistverwendeten Magnetfeldstärken von 1.5 T, falls nicht anders angegeben MRT bei Morbus Parkinson Beim Morbus Parkinson zeigt die konventionelle MRT mittels Routinesequenzen mit T1, PD und T2Gewichtung in der Regel einen altersentsprechenden normalen Befund. Vor allem im Frühstadium lassen sich keine mittels MRT fassbaren spezifischen Signalpathologien im Sinne einer Neurodegeneration im Bereich des nigrostriatalen Systems detektieren. In späteren Krankheitsstadien allerdings können gelegentlich eine präfrontale kortikale Atrophie, leichte Signaländerungen im Bereich der SN wie Hyperintensitäten in T2Bildern oder Verwaschen der Grenzen zum Nucleus ruber hin und ein Aneinanderrücken dieser beiden Strukturen auftreten. Derartige Veränderungen sind jedoch schwer von altersabhängigen Normvarianten abgrenzbar; bis heute konnte noch kein spezifischer MRTMarker für MP identifiziert werden. In der Vergangenheit fokussierten sich einige Studien auf die Differenzierung zwischen MPPatienten und gesunden Kontrollen mittels DWI/DTI. Es konnte eine Verminderung der FA mit Erhöhung der mittleren Diffusivität im Bereich der SN bei MP im Vergleich zu gesunden Probanden nachgewiesen werden. In einer weiteren 1.5 TMRT Studie konnte eine Erhöhung der Diffusivität im Tractus olfactorius bei frühen MPPatienten beschrieben werden, wobei man an Hand dieses Signals mit einer diagnostischen Wertigkeit von 94% zwischen MPPatienten und Kontrollen unterscheiden konnte. Diese Ergebnisse entspringen aber einem experimentellen Setting und müssen erst reproduziert werden. Mehrere rezente HochfeldMRTStudien wurden bei Patienten mit MP durchgeführt und zeigten interessante Ergebnisse (zusammengefasst in Tabelle 2). All diese Ergebnisse müssen jedoch noch reproduziert werden und sind daher als experimentell zu werten MRT bei atypischen ParkinsonSyndromen Eine große Wertigkeit der MRT besteht in der Differentialdiagnose von neurodegenerativen atypischen Parkinson Syndromen. Bis heute konnten mehrere Strukturveränderungen bei Patienten mit MSA, PSP und CBD in der MRT beschrieben werden; einige von diesen Veränderungen besitzen eine hohe Spezifität (Abb. 1 und 2). Hingegen beträgt die GesamtSensitivität in Abhängigkeit von der Erkrankungsdauer und dem Krankheitsstadium nur etwa 6080%. Die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Veränderungen in T1 und T2Sequenzen bei 4 P A K T U E L L 2 /
5 Tabelle 2: Ergebnisse von quantitativen Bildgebungstechniken mittels Hochfeld (3.0 T) und UltraHochfeld (7.0 T) MRT bei Morbus Parkinson MRTBefunde R2* in der lateralen SN kontrolateral FA in der kaudalen SN FA in der mittleren SN FA in der rostralen SN Volumen der SN VCDR b Volumen der SN + VCDR T2* in der SN bilateral T1 in der SN kontrolateral R2* in der SN FA in der SN mittlere Diffusivität in Putamen und Ncl. Caudatus NAA/CrRatio der rostralen SN NAA/CrRatio der kaudalen SN rostralzukaudal Ratio der NAA/CrRatio Signifikante von SAD bei MP versus Kontrollen, nur geringe Überlappung von SAD bei MP und Kontrollen, signifikante Korrelation von SAD mit UPDRS Unregelmäßige laterale Oberfläche der SN, rostral > kaudal und mittig T2* an der dorsomedialen Fläche der lateralen SN MRTTechnik Gradientenechosequenz für ProtonenTransversal Relaxationsrate (R2*) bei 3.0 T (Eisensensitive Sequenzen DTI der SN (Subregionen) mit 3.0 T Kombinierte SNVolumetrie mit DTI der SN bei 3.0 T (VCDR a ) T1gewichtete 3D Gradientenechosequenz und T2* gewichtete MultiechoTechnik bei 3.0 T Multimodal MRTStudie mit 3.0 T, Kombination unterschiedlicher MRMarker wie Volumetrie, mittlere R2*, mittlere Diffusivität und FA in 6 Strukturen der grauen Substanz (SN, Ncl. ruber, Thalamus, Putamen, Ncl. caudatus, Globus pallidus) 3DMRSI der SN mit 3.0 T T2*gewichtete Gradientenechosequenz bei 7.0 T zur quantitativen Beurteilung (SAD C ) der Grenzen der SN 3dimensionale T2*gewichtete Gradientenechosequenz bei 7.0 T der SN Referenz Martin et al Vallaincourt et al Menke et al Baudrexel et al Peran et al Gröger et al Cho et al Kwon et al a VCDR ist ein spezieller DTIMarker, welcher die Konnektivität von Subregionen eines Kerngebietes quantitativ angibt b VCDRs SN links und rechts im Vergleich zu den ipsilateralen VCDRs des Thalamus c SAD (von den Autoren als sum of absolute differences bezeichnet) ist ein Maß für die Umrandung der SN (je unregelmäßiger und gezackter desto höhere Werte) mit höheren Werten bei MP im Vergleich zu gesunden Kontrollen. Für genaue Berechnung von SAD siehe Cho et al Abkürzungen: MP, Morbus Parkinson; SN, Substantia nigra; Ncl, Nucleus; DTI, diffusion tensor imaging; 3DMRSI, threedimensional magnetic resonance spectroscopic imaging; R2*, Relaxationsrate, 1/T2*; FA, fraktionale Anisotropie; MRT, Magnetresonanztomographie; T, Telsa; UPDRS, Unified Parkinson s Disease Rating Scale; H&Y, Hoehn & Yahr; AC, anterior commissure; PC, posterior commissure. Martin WR, Wieler M, Gee M. Midbrain iron content in early Parkinson disease: a potential biomarker of disease status. Neurology. Apr 2008;70(16 Pt 2): Vaillancourt DE, Spraker MB, Prodoehl J, et al. Highresolution diffusion tensor imaging in the substantia nigra of de novo Parkinson disease. Neurology 2009;72(16): Menke RA, Scholz J, Miller KL, et al. MRI characteristics of the substantia nigra in Parkinson s disease: a combined quantitative T1 and DTI study. Neuroimage 2009;47(2): Baudrexel S, Nürnberger L, Rüb U, et al. Quantitative mapping of T1 and T2* discloses nigral and brainstem pathology in early Parkinson s disease. Neuroimage. Jun 2010;51(2): Gröger A, Chadzynski G, Godau J, Berg D, Klose U. Threedimensional magnetic resonance spectroscopic imaging in the substantia nigra of healthy controls and patients with Parkinson s disease. Eur Radiol Péran P, Cherubini A, Assogna F, et al. Magnetic resonance imaging markers of Parkinson s disease nigrostriatal signature. Brain 2010;133(11): Cho ZH, Oh SH, Kim JM, et al. Direct visualization of Parkinson s disease by in vivo human brain imaging using 7.0T magnetic resonance imaging. Mov Disord 2011;26(4): Kwon DH, Kim JM, Oh SH, et al. SevenTesla magnetic resonance images of the substantia nigra in Parkinson disease. Ann Neurol. Feb 2012;71(2): P A K T U E L L 2 /
6 Abb. 2 Axiale T2gewichtete MRBilder, unauffällig bei einem Patienten mit MP (A). Bei MSAP (B) zeigt sich eine Atrophie des Putamens (Pfeil) sowie eine putaminale Hypointensität (gepunkteter Pfeil) mit einem hyperintensen Randsaum (gestrichelter Pfeil). M. Schocke, K. Seppi, Universitätsklinik für Radiologie, Universitätsklinik für Neurologie. Innsbruck. Hypointensität auftritt, sowie eine striatale Atrophie mit Betonung des dorsolateralen Putamens. Für eine MSAC sprechen hingegen Veränderungen in den infratentoriellen Hirnregionen wie Atrophie von Zerebellum, des mittleren Kleinhirnstiels (MCP, middle cerebellar peduncle) und des Pons sowie eine pontine T2Veränderung in Form eines in axialer Ausrichtung positionierten Kreuzformation (Semmelzeichen,»hot cross bun sign«, Abb. 3). Eine Studie konnte an Hand von 3.0 T MRUntersuchungen jedoch zeigen, dass der T2hyperintense putaminale Randsaum auch bei gesunden Kontrollen beobachtet werden kann und somit bei diesen Feldstärken womöglich als unspezifisches Zeichen unklarer pathologischer Relevanz zu werten ist. aps können jedoch in frühen Krankheitsstadien und bei Erstmanifestation fehlen. Hier scheint die Verwendung diffusionsgewichteter MRT, die bei MSAP und seltener bei PSP eine Gewebsschädigung im Putamen zeigen kann, sensitiver zu sein. Tabelle 3 fasst die typischen Abnormitäten in der MRT bei Patienten mit MSAP und PSP zusammen. Die meisten der bislang durchgeführten MRTStudien bei Patienten mit aps bedienten sich klinischer Diagnosekriterien ohne neuropathologische Verifizierung, somit können Fehldiagnosen nicht ausgeschlossen werden. Da klinisch die diagnostische Treffsicherheit in späten Krankheitsstadien höher als in frühen ist, wurden vorwiegend Patienten in fortgeschrittenen Krankheitsstadien untersucht. Daten zur MRTgestützten Diagnosefindung in frühen Krankheitsstadien fehlen weitgehend. Multisystematrophie (MSA). Pathognomonische MRTmorphologische Veränderungen, welche die Diagnose einer MSAP favorisieren, sind ein hyperintenser putaminaler Randsaum in T2Sequenzen, der häufig in Kombination mit einer putaminalen T2 Tabelle 3. Typische Abnormitäten in der konventionellen MRT bei MSAP und PSP, angelehnt an Mahlknecht et al MSAP Atrophie des Putamen Hypointensitäten des Putamen Hyperintenser putaminaler Randsaum (»putaminal hyperintense rim«) Atrophie und/oder Hyperintensitäten MCP, Kleinhirn und Hirnstamm Atrophie und/oder Hyperintensitäten im Pons (ggf.»hot cross bun sign«) Supratentorielle Veränderungen PSP Atrophie des Putamen Atrophie von Frontal und/oder Temporallappen Infratentorielle Veränderungen MSAP PSP Atrophie und/oder Hyperintensitäten im Mittelhirn Verkürzter APMittelhirnDurchmesser < 14 mm (ggf. Mickey Mouse Zeichen) Abnormes oberes Mittelhirnprofil in der medianen Sagittalschicht (linear bis konkav)»humming bird«zeichen oder»kingpenguin«silhouette Vergrößerung des dritten Ventrikels Atrophie und/oder Hyperintensitäten des SCP Abkürzungen: MRT, Magnetresonanztomographie; MSAP, ParkinsonVariante der Multisystematrophy; PSP, progressive supranukleäre Paralyse; MCP, mittlerer Kleinhirnstiel; AP, anteriorposterior; SCP, oberer Kleinhirnstiel. Die Angaben für diese Veränderungen gelten für 1.5TGeräte; Signaländerungen (Hyper bzw. Hypointensitäten) beziehen sich auf T2 gewichtete Aufnahmen. 6 P A K T U E L L 2 /
7 Abb. 3 Axiales T2gewichtetes MRBild eines Patienten mit MSAP. Der Pfeil weist auf die Signaländerung im Pons hin, das sogenannte»hot cross bun«oder»semmel Zeichen«. M. Schocke, K. Seppi, Universitätsklinik für Radiologie, Universitätsklinik für Neurologie. Innsbruck. Im letzten Jahrzehnt gab es wachsendes Interesse an der diffusionsgewichteten Bildgebung zur Differentialdiagnose der MSA. Insbesondere scheinen sich die putaminalen Veränderungen bei der MSAP bereits früh im Krankheitsverlauf durch eine erhöhte Diffusivität im Putamen darzustellen. So wurden in diversen Studien MSAP Patienten mit einer Krankheitsdauer von bis zu sechs Jahren mit einer hohen diagnostischen Treffsicherheit gegenüber MP Patienten und gesunden Kontrollen abgegrenzt. Vorsicht ist bei der Unterscheidung der MSAP von der PSP geboten, da auch diese Entität regelmäßig mit Erhöhung der putaminalen Diffusivität einhergehen kann (Abb. 4). Eine abnorm erhöhte Diffusivität findet sich auch in anderen Hirnstrukturen wie im MCP, Pons und Zerebellum, wobei supratentorielle Veränderungen im Bereich der Basalganglien auf eine MSAP, infratentorielle Veränderungen auf eine MSAC hinweisen. Außerdem führen chronisch vaskuläre Veränderungen (white matter changes, WMC) in Verbindung mit langer Krankheitsdauer bei Patienten mit MP ebenso zu einer Erhöhung der putaminalen Diffusivität. Progressive Supranukleäre Paralyse (PSP). Passend zu den neuropathologischen Veränderungen bei der PSP zeigen sich in der MRT eine Atrophie des Mittelhirns, besonders im Bereich von Mittelhirnhaube und Mittelhirndach (Tegmentum und Tectum), sowie Strukturpathologien der oberen Kleinhirnstiele (SCP, superior cerebellar peduncle) und der unteren Olive. Zusätzlich findet sich eine Substanzminderung in Frontal und Temporallappen. Aus der Atrophie des Mittelhirns mit Abflachung und Eindellung der rostrodorsalen Mittelhirnhaube und daraus folgender Größenzunahme des dritten Ventrikels resultiert bildmorphologisch in der medianen Sagittalschicht das sogenannte»kolibri oder KönigspinguinZeichen«(»kingpinguin sign«,»humming bird sign«, Abb. 1c). Dieses Zeichen findet sich kaum bei Patienten mit anderen neurodegenerativen ParkinsonSyndromen, weshalb ein Vorhandensein dieses»kolibrizeichens«spezifisch für die PSP zu sein scheint, obschon dieses Zeichen bei bis zur Hälfte der PSPPatienten, insbesondere in weniger fortgeschrittenen Stadien, fehlen kann. Zusätzlich kann durch eine planimetrische Ausmessung der midsagittalen Mittelhirn und Ponsfläche alleine, oder in Kombination mit dem Verhältnis zwischen Breite der oberen und mittleren Kleinhirnstiele eine Differenzierung zwi Abb. 4 ADCMaps auf Höhe des Striatums, normal beim Patient mit MP (A). Bei Patienten mit MSAP (B) und PSP (C) zeigt sich eine diffuse Hyperintensität, entsprechend erhöhten ADCWerten (erhöhte Diffusivität). M. Schocke, K. Seppi, Universitätsklinik für Radiologie, Universitätsklinik für Neurologie. Innsbruck. P A K T U E L L 2 /
8 schen PSP und nichtpsp erfolgen. Der daraus errechnete MRParkinsonism Index (MRPI, Ponsfläche/Mittelhirn x MCPDurchmesser/SCPDurchmesser), welcher bei PSPPatienten vermindert ist, sowie eine erhöhte Ratio zwischen Mittelhirn und Ponsfläche (M/PRatio) alleine können bei der Differenzierung von PSP und MSA, MP und gesunden Kontrollen diagnostische Wertigkeiten zwischen 80% und 100% erreichen, wobei der MRPI besser zwischen PSP und MSAP, die M/PRatio besser zwischen PSP und MP unterscheiden kann. Welche Ausmessungen und daraus errechneten Ratios wirklich die diagnostische Treffsicherheit, insbesondere in Frühstadien der Erkrankungen, zu erhöhen vermögen bleibt vorerst offen. Wie regelmäßig bei der MSAP, kann es in diffusionsgewichteten Sequenzen bei der PSP zu einem Anstieg der putaminalen Diffusivität kommen, so dass hohe Werte mit denen der MSA und niedrige Werte mit denen des MP überlappen können. Des Weiteren haben einige kleine Studien eine PSPspezifische Zunahme der Diffusivität in den SCP gezeigt. Es bedarf allerdings weiterer Studien, bevor dieses Zeichen für die routinemäßige Abklärung von ParkinsonSyndromen herangezogen werden kann. Die meisten MRTStudien wurden mit RSPatienten durchgeführt, wohingegen die eigentliche Schwierigkeit in der Diagnose der sich atypisch präsentierenden PSPP liegt. Inwieweit sich die oben genannten MRTMarker auch bei anderen PSP Formen nachweisen lassen, muss durch entsprechende Studien aufgedeckt werden. Kortikobasale Degeneration (CBD). Wenige Studien haben sich mit MRT Veränderungen bei der CBD befasst. In Übereinstimmung mit der Neuropathologie findet sich typischerweise eine asymmetrische, kontralateral zur klinisch stärker betroffenen Seite ausgeprägte frontoparietale kortikale Atrophie, gelegentlich kommt aber auch eine symmetrische Globalatrophie vor. Veränderungen der Basalganglien können häufig fehlen, obschon manchmal eine Atrophie des Putamens imponieren kann. Des Weiteren kann sich das Mittelhirn in der MRT atrophisch zeigen, Marklagergliosen können häufig gefunden werden und demarkieren sich als kleine T2Hyperintensitäten der angrenzenden weißen Substanz. Noch limitierter ist die Studienlage für die diffusionsgewichtete Bildgebung bei der CBD. Eine erhöhte Diffusivität wurde im Putamen beschrieben, interessanterweise aber auch in asymmetrischer Weise in den Hemisphären. In Anbetracht der klinischen Heterogenität der CBD muss hier die MRT Tabelle 4. Praktische MRTKriterien beim neurodegenerativen Parkinson Syndromen; Quelle: Mahlknecht et al Konventionelle MRT Normal Atrophie des Putamens Hyperintenser putaminaler Randsaum Hypointensitäten des Putamens Atrophie des Pons und des Vermis cerebellaris Signaländerungen im Pons (»SemmelZeichen«) oder in den mittleren Kleinhirnstielen Atrophie des Mittelhirns (bei PSP»Mickey Mouse«und»KolibriZeichen«) MRT Planimetrie Reduzierter anteriorposteriorer Mittelhirndurchmesser Reduzierte Ratio zwischen Mittelhirn und Ponsfläche Abnormer MRPI (erhöht bei PSP) Diffusionsgewichtung (DWI) Erhöhte Diffusivität im Putamen Erhöhte Diffusivität im SCP Studienlage allerdings mit kritischem Auge betrachtet werden. Tabelle 4 fasst nützliche MRTMarker bei 1.5 T als Hilfestellung zur Diagnose der neurodegenerativen PS zusammen MRT bei Demenz mit LewyKörperchen und Parkinson Krankheit mit Demenz Während sich beim MP in frühen Erkrankungsstadien in der MRT bei den Routinesequenzen in der Regel ein altersentsprechender normaler Befund findet, weisen Patienten mit DLB und PDD häufig eine Atrophie subkortikaler Strukturen bei relativem Erhalt des medialen Temporallappens auf (Abb. 5). Häufig kann es auch zu diffusen MP MSA(P) PSP Abkürzungen: cmri, konventionelle Magnetresonanztomographie; T, Tesla; MP, Morbus Parkinson; MSA, Multisystematrophie; PSP, progressive supranukleäre Paralyse; MCP, mittlerer Kleinhirnstiel; MRPI, MR parkinsonism index; DWI, Diffusionsgewichtete Bildgebung; SCP, oberer Kleinhirnstiel. <20%; %; 5070%; %; >90%. Die Angaben für diese Veränderungen gelten für 1.5 T Geräte; Signaländerungen (Hyper bzw. Hypointensitäten) beziehen sich auf T2gewichtete Aufnahmen. Die CBD ist aufgrund der limitierten Studienlage nicht enthalten. MRPI = MRParkinsonismIndex = (A Pons / A Mittelhirn )*( D Mittlerer Kleinhirnstil / D Oberer Kleinhirnstil ) P A K T U E L L 2 /
9 Volumsminderungen der grauen Substanz im Bereich von Temporal, Parietal und Okzipitallappen sowie der frontalen Gyri kommen. Dieses Muster mit Atrophie subkortikaler Strukturen bei relativem Erhalt des medialen Temporallappens unterscheidet die DLB von der AlzheimerErkrankung, bei welcher sich häufig bereits in Frühstadien eine Atrophie des medialen Temporallappens mit der Hippocampusformation findet. Während sich der Erhalt des medialen Temporallappens in der MRT womöglich als differenzierender Marker zwischen DLB und AlzheimerErkrankung etablieren könnte und bereits Einzug in die revidierten Konsensuskriterien für die klinische Diagnose der DLB gefunden hat, lassen sich die DLB und die PDD mittels MRT nicht unterscheiden MRT zum Ausschluss sekundärer ParkinsonSyndrome T1 und T2gewichtete Untersuchungen finden ihre Anwendung in erster Linie in der Differentialdiagnose bzw. im Ausschluss von sekundären oder symptomatischen PS. Diese können auf dem Boden von Raumforderungen im Bereich der Basalganglien, des Hirnstamms oder des frontalen Marklagers, durch strategische vaskuläre Läsionen (Mikro und Makroangiopathien) oder im Rahmen eines Normaldruckhydrozephalus entstehen. Des Weiteren können seltene Ursachen wie fokale Läsionen im Rahmen einer Multiplen Sklerose, die WilsonKrankheit, striatopallidodentale Kalzinose bei Morbus Fahr, das Manganassoziierte PS und die Neurodegeneration mit
10 PDD häufig eine Atrophie subkortikaler Strukturen bei relativem Erhalt des medialen Temporallappens auf (Abb. 5). Häufig kann es auch zu diffusen Volumsminderungen der grauen Substanz im Bereich von Temporal, Parietal und Abb. 5 Koronare MRBilder eines Patienten mit einer (A) Demenz mit LewyKörperchen (Erkrankungsdauer 1.5 Jahre) und eines Patienten mit einer (B) AlzheimerDemenz (Erkrankungsdauer 2 Jahre). Beim Patienten mit DLB zeigt sich ein relativer Erhalt des medialen Temporallappens (A), beim Patienten mit AlzheimerErkrankung kommt eine deutliche Atrophie der HippocampusFormation zur Darstellung (B). M. Schocke, K. Seppi, Universitätsklinik für Radiologie, Universitätsklinik für Neurologie. Innsbruck. Eisenablagerungen im Gehirn (neurodegeneration with brain iron accumulation, NBIASyndrom) oder Morbus Huntington (WestphalVariante) ursächlich für ein symptomatisches PS sein.(tabelle 5). Da für die zugrunde liegende Ursache eines sekundären PS therapeutische sowie zum Teil heilende Maßnahmen bestehen, erfordern diese ParkinsonSyndrome eine diagnostische Abklärung unter Einbeziehung von Befunden der zerebralen Bildgebung. Lakunäre Infarkte im Bereich der Basalganglien, Frontalhirninfarkte oder eine subkortikale, meistens frontal betonte Leukenzephalopathie können Ursachen eines vaskulären PS sein. Die Entwicklung der Symptome gestaltet sich je nach zugrunde liegender Erkrankung schleichend auf dem Boden einer subkortikalen arteriosklerotischen Enzephalopathie (SAE) oder (sub)akut bei lakunären Hirninfarkten, die den externen Teil des Globus pallidus, Teile des Thalamus oder selten die Substantia nigra betreffen. Für die Diagnosestellung muss hierbei ein zeitlicher Zusammenhang zwischen Auftreten der motorischen Symptome und den vaskulären Läsionen bestehen. Bildgebend können fokale Läsionen im Sinne von lakunären Infarkten in den Basalganglien, Frontalhirninfarkten oder Veränderungen wie subkortikale mi kroangiopathische Läsionen mit diffusen periventrikulären Signalalterationen zur Darstellung kommen (Abb. 6). Ein Normaldruckhydrozephalus manifestiert sich klinisch in einer frontalen Gangstörung mit begleitender subkortikaler Demenz sowie Inkontinenz; man spricht auch vom»lower body parkinsonism«, da hierbei die Gangstörung im Vordergrund steht und selten eine Tremorkomponente beobachtet wird. In der MRT zeigt sich eine Vergrößerung der Seitenventrikel, eine Ballonierung der Vorderhörner der Ventrikel sowie periventrikuläre T2 Signalsteigerungen. (Abb. 7). Die neuronale Schädigung durch erhöhte Kupferablagerungen beim Morbus Wilson spiegelt sich typischerweise in der MRT in einer Mittelhirnatrophie mit T2/FLAIRSignalanhebung in der Mittelhirnhaube (»PandabärZeichen«) und in randständig betonten T2Hyperintensitäten in Putamen, Pallidum, Nucleus caudatus bzw. entlang der Pyramidenbahn wider. Schädigungen der Basalganglien durch Eisenablagerungen bei NBIASyndromen zeigen in der MRT hingegen typischerweise herabgesetzte Signalintensitäten in Putamen, Nucleus caudatus, Thalamus Abb. 6. T2gewichtete axiale MRBilder eines Patienten mit einem vaskulären PS bei Status lacunaris mit multiplen vaskulären Läsionen im Bereich der Basalganglien sowie arteriosklerotischer Leukenzephalopathie. M. Schocke, K. Seppi, Universitätsklinik für Radiologie, Universitätsklinik für Neurologie. Innsbruck. 10 P A K T U E L L 2 /
11 Tabelle 5. MRTBefunde für die Differentialdiagnose von sekundären ParkinsonSyndromen. Entität Vaskuläres PS Normdruckhydrozephalus Toxischinduziertes PS Mangan Methcathinon (Ephedron) Kohlenmonoxid Zyanid Methanol Morbus Huntington (WestphalVariante) Morbus Wilson Neurodegeneration mit Eisenablagerungen (NBIA) Panthothenate Kinaseassoziierte Neurodegeneration (PKAN Aceruloplasminaemia und Neuroferritinopathie Zerebrale Raumforderungen Multiple Sklerose Typische MRTBefunde Lakunäre Infarkte im Bereich von Basalganlien oder Frontallappen, subkortikale mikroangiopathische Läsionen mit diffusen periventrikulären Signalsteigerungen Vergrößerung der Seitenventrikel mit Ballonierung der Vorderhörner, periventrikuläre T2Signalsteigerungen Hyperintensitäten im Globus pallidus, Signalsteigerungen in T1gewichteten Sequenzen in Striatum und SN Bilateral symmetrische T1Hyperintensitäten im Globus pallidus und Hypointensitäten in der SN, keine Signalveränderungen in T2gewichteten Sequenzen Bilateral symmetrische Hyperintensitäten in T2gewichteten Sequenzen im Globus pallidus Symmetrische hyperintense Signalveränderungen in Globus pallidus, Putamen, Ncl. caudatus und weißer Substanz in T2Bildern und FLAIRSequenzen; T1Hyperintensitäten mit Kontrastaufnahme in den Basalganglien T2Signalsteigerung und T1Signalverminderung im Bereich des Putamen Progressive bilaterale Atrophie von Striatum mit Verbreiterung des Vorderhornes des Seitenventrikels bei Atrophie des Caput nuclei caudati; im weiteren Krankheitsverlauf Atrophie des gesamten Cortex Atrophie von Mittelhirn, Hirnstamm und Kleinhirn; T2Hypointensitäten in Globus pallidus, symmetrische T2Hyperintensitäten in Striatum, lateralem Thalamus, weißer Substanz und dorsalem Hirnstamm;»face of the giant panda«: normales Signal des Ncl. ruber (Augen) und der lateralen SN (Ohren) mit Signalsteigerung im Tegmentum und Signalverminderung in den Colliculi superiors in axialen T2gewichteten MR T2Hypointensitäten in Globus pallidus, Putamen, Ncl. caudatus und Thalamus;»eye of the tiger«zeichen: Signalsteigerung im Zentrum des Globus pallidus und T2Hypointensitäten in der Umgebung T2Hypointensitäten im Globus pallidus, SN, Striatum, Thalamus und Ncl. Dentatus Je nach Entität der zerebralen Raumforderung (Tumor, Metastase, Abszess, Toxoplasmose, Granulome) charakteristische strukturelle Darstellung mit/ohne Umgebungsreaktion T1Hypointensitäten (»black holes«) sowie T2Hyperintensitäten im Bereich von Striatum, Globus pallidus, Thalamus und Hirnstam Abkürzungen: MRT, Magnetresonanztomographie; SN, Substantia nigra; NBIA, neurodegeneration with iron accumulation; PKAN, panthothenate kinaseassociated neurodegeneration; Ncl, Nucleus; FLAIR, fluid attenuated inversion recovery. und Pallidum (Abb. 8), wobei bei der PKAN (Pantothenate kinaseassociated neurodegeneration), einer Form dieser Syndrome, eine Hyperintensität im inneren Segment des Globus pallidus auftritt und als»tigeraugezeichen«(»eye of the Tiger«) beschrieben wird. Daneben begrenzen sich die verminderten Signalintensitäten bei der PKAN meist auf den Globus pallidus und der SN, während sich die Hypointensitäten bei der Neuroferritinopathie und der Acoerulinoplasminämie, anderen Formen der NBIA, auch in anderen Kerngebieten, wie im Striatum, Thalamus oder Nucleus dentatus finden. Symmetrische Kalzinosen der Basalganglien, des Nucleus dentatus und des periventrikulären Marklagers im Rahmen einer striatodentalen Kalzifikation (Morbus P A K T U E L L 2 /
12 Abb. 7. T2gewichtetes MRBild in axialer (A) und T1gewichtetes MRBild in sagittaler Schnittführung (B) eines Patienten mit einem Normaldruckhydrozephalus mit typischer Aufweitung der Seitenventrikel und periventrikulären Signalsteigerungen an deren Polen (in T2), auch Polkappen genannt. M. Schocke, K. Seppi, Universitätsklinik für Radiologie, Universitätsklinik für Neurologie. Innsbruck. Entität und zugrunde liegender Ursache charakteristische Strukturveränderungen und Signalpathologien. ZNS Infektionen können einerseits durch erregerbedingte entzündliche als auch postinfektiöse Läsionen der Basalganglien sekundäre PS verursachen. Dazu zählen unter anderem: Abszesse bei zerebraler Toxoplasmose (siehe Abb. 10), Kryptokokkose oder Tuberkulose, Enzephalitiden, PrionenErkrankungen, oder progressive multifokale Leukenzephalopathien. Symptomatische ParkinsonSyndrome auf Grund von Multiple Sklerose werden selten berichtet. Neben der üblichen Verteilung von MSPlaques können demyelinisierende Läsionen jedoch auch im Be Fahr) demarkieren sich in der MRT unter Umständen nur unzureichend, hier sollte ergänzend eine zerebrale CT durchgeführt werden. Die WestphalVariante der HuntingtonErkrankung präsentiert sich häufig mit einem juvenilen PS, in der MRT findet sich typischerweise eine Atrophie von Nucleus caudatus und Putamen, eine kortikale frontal betonte Atrophie sowie eine Vergrößerung der Vorderhörner der Seitenventrikel (Abb. 9). Schließlich können auch Toxinassoziierte PS mit MRTSignalalterationen den Basalganglien einhergehen, z.b. zeigen sich bei chronischer Manganexposition im T1gewichteten Bild häufig Hyperintensitäten im Globus pallidus. Auch raumfordernde Läsionen wie Hirntumore oder infektiöse Herde können durch Verdrängung bzw. Infiltration der Basalganglien zu ParkinsonSymptomen führen. Die strukturelle Bildgebung mittels MRT zeigt dabei je nach Abb. 8 T2gewichtete axiale MRBilder (linke Spalte) mit entsprechenden R2* maps (rechte Spalte) eines Patienten mit Acoerulinoplasminämie mit Hypointensitäten im Bereich des Striatums, der hinteren Thalamusregion, der Substantia nigra, des Nucleus ruber und des Nucleus dentatus in den T2gewichteten Sequenzen mit entsprechender Signalsteigerung in den R2* maps. M. Schocke, Universitätsklinik für Radiologie, Innsbruck. 12 P A K T U E L L 2 /
13 Abb. 9. T2gewichtete axiale MRBilder eines Patienten mit der WestphalVariante des Morbus Huntington (A und B). Die Pfeile weisen auf die für die Erkrankung typische Caudatus Atrophie hin. M. Schocke, K. Seppi, Universitätsklinik für Radiologie, Universitätsklinik für Neurologie. Innsbruck. Abb. 10. Kontrastmittelunterstützes T1gewichtetes axiales MRBild. Multiple cerebrale Kontrastmittelaufnehmende Läsionen mit Involviereung der Basalganglien bei zerebraler Toxoplasmose im Rahmen einer AIDSErkrankung. Der Patient präsentierte sich mit einem akinetischrigiden ParkinsonSyndrom. M. Schocke, K. Seppi, Universitätsklinik für Radiologie, Universitätsklinik für Neurologie. Innsbruck. reich von Striatum, Globus pallidus, Thalamus und Hirnstamm auftreten. MRTBilder zeigen hierbei T1Hypointensitäten (»black holes«) sowie T2 Hyperintensitäten in der SN und den Basalganglien. 3. Transkranielle Weichteilsonographie Die transkranielle BModeDoppler Sonographie (TCS, transcranial sonography) kann dazu verwendet werden, über das temporale akustische Knochenfenster Hirnparenchym darzustellen und das Ausmaß eines echogenen Signals im Bereich der SN oder der Basalganglien zu beurteilen. Das Mittelhirn kommt hierbei als schmetterlingsartig geformte Struktur zur Darstellung. Die TCS kann neben klinischneurologischer Untersuchung, struktureller und funktioneller Bildgebung mittels MRT und SPECT Verfahren als zusätzliche nichtinvasive und kosteneffiziente Untersuchung bei der Differenzierung von Parkinson Syndromen eingesetzt werden. Nachdem ein ausreichendes temporales Knochenfenster Voraussetzung für die TCS ist, kann diese Methode jedoch bei über 10% der Bevölkerung nicht angewendet werden. Die sonographische Darstellung der Basalganglien besitzt vor allem beim MP eine geringere Wertigkeit; bei aps kann, wie im folgenden Absatz angeführt, eine Hyperechogenität in diesem Bereich diagnostische Hinweise auf die Erkrankung geben. Durch die Darstellung einer Hyperechogenität im Bereich der Substantia nigra bei Patienten mit MP wird die TCS seit 1995 routinemäßig zur Diagnostik von Bewegungsstörungen verwendet. Dabei geht es um die Größe der hyperechogenen Fläche, die ab einer gewissen Fläche als pathologisch beurteilt werden kann, wobei in der Literatur für Grenzwerte für eine Hyperechogenität im Bereich der Substantia nigra (SN+) unterschiedliche Werte berechnet wurden. Während manche Studien als cutoff für eine SN+ die dritte Quartile der größeren Ausdehnung der Echogenitäten im Bereich beider SN einer gesunden Kontrollpopulation verwendet haben, wurde bei anderen Studien der Mittelwert plus eine Standardabweichung der größeren der beiden Echogenitäten im Bereich der SN einer gesunden Kontrollpopulation als Grenzwert verwendet. Bei ungefähr 90% der Patienten mit MP kann eine SN+ nachgewiesen werden. Die Ausdehnung des echogenen Signals ist dabei unabhängig vom Alter des Patienten, von Dauer und Schweregrad der Erkrankung, korreliert nicht mit dem Grad der striatalen Dopamintransporterverfügbarkeit und zeigt keine Progression im Laufe der Erkrankung. Trotzdem ist die Hyperechogenität auf der kontralateral zur klinisch stärker betroffenen Seite meistens größer. Allerdings haben auch bis zu 15% der gesunden Bevölkerung eine vermehrte Echogenität in der SN, Familienangehörige 1. Grades können sogar noch häufiger pathologische Befunde zeigen. Eine prospektive verblindete Studie an 60 neuerkrankten Patienten mit PS (von denen im FollowUp nach einem Jahr 43 Patienten als MP und 13 Patienten als aps klassifiziert wurden, 4 weitere hatten kein Parkinson Syndrom im FollowUp) ergab eine diagnostische Wertigkeit des Markers P A K T U E L L 2 /
14 SN+ von 88.3% für die Diagnose eines MP, wobei die Sensitivität bei 90.7% und die Spezifität bei 82.4% lag. Für die Differenzierung zwischen MP und aps ergaben sich Werte für Sensitivität und Spezifität von 94.8% bzw. 90% bei einem positiv prädiktiven Wert von 97.4%. Häufig findet sich bei Patienten mit aps eine vermehrte Hyperechogenität uni oder bilateral in den Basalganglien, insbesondere im Linsenkern. Allerdings scheint die diagnostische Wertigkeit einer Hyperechogenität im Bereich der Basalganglien unzureichend, wie oben genannte Arbeit an den 60 neuerkrankten Patienten mit PS gezeigt hat. Die diagnostische Wertigkeit einer Hyperechogenität im Bereich der Basalganglien bei Patienten mit aps wurde dabei mit 68.2% beziffert, bei einer Sensitivität von 66.7% und einer Spezifität von 68.6%. 4. Schlussfolgerung Patienten mit neurodegenerativen ParkinsonSyndromen stehen heutzutage einem großen Armamentarium von diagnostischen Untersuchungstechniken struktureller und funktioneller Natur gegenüber. Tabelle 6 fasst die Rolle von Bildgebungsverfahren bei häufigen klinischen Fragestellungen zusammen. Eine genaue Diagnose ist für den Patienten dabei von großer therapeutischer und prognostischer Relevanz. Tabelle 6 beinhaltet dabei auch die DATSPECTUntersuchung, welche ihren Stellenwert 1) in der Frühdiagnose des MP bei fraglicher und asymptomatischer Symptomausprägung, 2) in der Differenzierung neurodegenerativer ParkinsonSyndrome (MP und aps) von nichtdegenerativen Parkinson und TremorSyndromen (wobei eine Differenzierung zwischen MP und aps mittels DAT SPECTUntersuchung nicht möglich ist), sowie 3) in der Unterscheidung von AlzheimerErkrankung (Normalbefund bei der DATSPECTUntersuchung) und DLB (reduzierte Bindung bei der DATSPECTUntersuchung) Tabelle 6: Rolle von Bildgebungsverfahren bei häufigen klinischen Fragestellungen in der Differentialdiagnose von ParkinsonSyndromen. Fragestellung MRT DATSPECT TCS Ausschluss eines symptomatischen PS auf Grund struktureller Läsionen auf Grund von Medikamenten oder Toxinen Differenzierung neurodegenerativer PS vs. ET (und anderen TremorErkrankungen) Differenzierung MP vs. aps Differenzierung MP vs. psychogenes PS Differenzierung DLB, PDD und AD Mittel der Wahl 1 Bei manchen Intoxikationen finden sich Signalalterationen in der MRT, wie z.b. bei Manganintoxikation wo sich im T1gewichteten Bild häufig Hyperintensitäten im Globus pallidus finden 2 für TCS bei medikamentösinduziertem PS kaum Studiendaten vorhanden 3 wenig Studiendaten vorhanden, allerdings scheint eine erhöhte Prävalenz einer SN+ bei ET vorzuliegen (SN+ bei bis zu 25% der Patienten mit ET beschrieben) 4 ein Normalbefund schließt allerdings ein aps nicht aus; durch Addition von DWISequenzen wird die diagnostische Wertigkeit der MRT, insbesondere gegenüber MSA, gesteigert 5 das Vorliegen einer SN+ spricht sehr für einen MP 6 keine Studiendaten vorhanden Abkürzungen: PS, ParkinsonSyndrom; MRT, Magnetresonanztomographie; DATSPECT, Dopamintransporter singlephoton emission computed tomography; TCS, transkranielle Sonographie; ET, essentieller Tremor; aps, atypisches ParkinsonSyndrom; DLB, Demenz mit Lewy Körperchen; PDD, ParkinsonDemenz; AlzheimerDemenz. 1? 2? 3 4 5? 6? 6 hat, was in dieser Fragestellung erhebliche therapeutische Konsequenzen (evtl. LDopaTherapie, Wahl eines Neuroleptikums) mit sich bringen kann. Die Domäne der strukturellen Bildgebung mittels MRT in der Parkinson Diagnostik ist der Ausschluss symptomatischer Formen durch Läsionen im Bereich der Basalganglien, des Hirnstamms oder des frontalen Marklagers sowie der Ausschluss eines Normaldruckhydrozephalus. Beim MP zeigt die MRT in der Regel keine spezifischen Zeichen einer Neurodegeneration, bei den aps hingegen können sich spezifische bildgebende Zeichen demarkieren. So finden sich infraund supratentoriell bei Patienten mit MSA und PSP häufig charakteristische Atrophiemuster und Veränderungen der Signalintensität, und beim CBS lassen sich häufig eine asymmetrische, kontralateral zur klinisch stärker betroffenen Seite ausgeprägte frontoparietale kortikale Atrophie detektieren. Dienlich in der Differenzierung der DLB und PDD von der AlzheimerDemenz kann außerdem der Nachweis einer Atrophie subkortikaler Strukturen bei relativem Erhalt des medialen Temporallappens sein. Unter den neueren Verfahren ist die DWI zurzeit am meisten etabliert, Änderungen in der Diffusivität können bei der MSA und der PSP womöglich früh im Krankheitsverlauf auftreten und wurden besonders im Bereich des Putamens bereits in mehreren Studien beschrieben. Rezente Studien beim MP zur Beurteilung des Eisengehaltes und der fraktionellen Anisotropie in der SN mittels 3.0 T MRT sind als experimentell zu werten. Trotz der starken Untersucherabhängigkeit sowie der mangelnden Durchführbarkeit bei eingeschränkten Schallbedingungen kann die TCS im Kontext mit klinischen und anderen Unter 14 P A K T U E L L 2 /
15 Berg D, Godau J, Walter U. Transcranial sonography in movement disorders. Lancet Neurol. Nov 2008; 7: Berg D, Steinberger JD, Warren Olanow C, Naidich TP, Yousry TA. Milestones in magnetic resonance imaging and transcranial sonography of movement disorders. Mov Disord. May 2011;26: Brooks DJ, Pavese N. Imaging biomarkers in Parkinson s disease. Prog Neurobiol 2011;95: Brooks DJ, Seppi K, MSA NWGo. Proposed neuroimaging criteria for the diagnosis of multiple system atrophy. Mov Disord 2009;24: Folgar S, Gatto EM, Raina G, Micheli F. Parkinsonism as a manifestation of multiple sclerosis. Neurology. Dec 2004;63(12 Suppl6):S814. Gaenslen A, Unmuth B, Godau J, et al. The specificity and sensitivity of transcranial ultrasound in the differential diagnosis of Parkinson s disease: a prospective blinded study. Lancet Neurol. May 2008;7: Gibb WR, Lees AJ. The relevance of the Lewy body to the pathogenesis of idiopathic Parkinson s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry. Jun 1988;51: Hotter A, Esterhammer R, Schocke MF, Seppi K. Potential of advanced MR imaging techniques in the differential diagnosis of parkinsonism. Mov Disord. 2009;24 (Suppl 2):S711S720. Kwon DH, Kim JM, Oh SH, et al. SevenTesla magsuchungsergebnissen als eine sinnvolle Erweiterung der diagnostischen Maßnahmen in der Differenzialdiagnose von ParkinsonSyndromen angesehen werden, da das Bestehen einer SN+ für das Vorliegen eines MP spricht. Allerdings sind weiterführende Validierungsstudien gegenüber klinischen Standards erforderlich. Die mehrfach berichtete erhöhte Prävalenz einer SN+ bei Patienten mit essentiellem Tremor von bis zu 25% scheint sich bereits als limitierender Faktor der Technik herauszukristallisieren. Anmerkung: Textteile und einige Abbildungen des Manuskripts wurden aus einem kürzlich veröffentlichten Beitrag über»parkinsonsyndrome«(autoren: K. Seppi, M. Schocke, C. Müller und W. Pirker) zum Themenschwerpunkt»Neuroimaging Möglichkeiten und Grenzen«in der Zeitschrift»Neurologisch«(Hrsg.: Österreichische Gesellschaft für Neurologie; Ausgabe 1/12, S.3650) übernommen und bearbeitet. Empfohlene Literatur: Kurzfachinformation zum Inserat Seite 16 netic resonance images of the substantia nigra in Parkinson disease. Ann Neurol. Feb 2012;71: Litvan I, Bhatia KP, Burn DJ, et al. Movement Disorders Society Scientific Issues Committee report: SIC Task Force appraisal of clinical diagnostic criteria for Parkinsonian disorders. Mov Disord. May 2003; 18: Mahlknecht P, Hotter A, Hussl A, Esterhammer R, Schocke M, Seppi K. Significance of MRI in diagnosis and differential diagnosis of Parkinson s disease. Neurodegener Dis 2010;7: Mahlknecht P, Schocke M, Seppi K.3. Nervenarzt. Oct 2010;81: Oertel WH, Reichmann H. Kapitel Parkinson Syndrome: Diagnostik und Therapie. Aus: Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie. Herausgebende Autoren: Diener HC, Putzki N. Georg Thieme Verlag, 4. überarbeitete Auflage S. 82ff. Poewe W, Deuschl G. Kapitel 2 ParkinsonKrankheit, Kap. 2.2 Diagnose und Differentialdiagnose. Aus: ParkinsonSyndrome und andere Bewegungsstörungen. Herausgebende Autoren: Oertel WH, Deuschl G, Poewe W. Georg Thieme Verlag S.50ff. Scherfler C, Seppi K. Kapitel 29 Diagnostische Verfahren bei Bewegungsstörungen, Kap Magnetresonanztomografie. Aus: ParkinsonSyndrome und andere Bewegungsstörungen. Herausgebende Autoren: Oertel WH, Deuschl G, Poewe W. Georg Thieme Verlag S.577ff. Scherfler C. Kapitel 29 Diagnostische Verfahren bei Bewegungsstörungen, Kap SinglePhoton Emissionstomografie. Aus: ParkinsonSyndrome und andere Bewegungsstörungen. Herausgebende Autoren: Oertel WH, Deuschl G, Poewe W. Georg Thieme Verlag S.574ff. Schuff N. Potential role of highfield MRI for studies in Parkinson s disease. Mov Disord. 2009;24 (Suppl 2):S684S690. Seppi K, Poewe W. Brain magnetic resonance imaging techniques in the diagnosis of parkinsonian syndromes. Neuroimaging Clin N Am. Feb 2010;20:2955. Stockner H. Kapitel 29 Diagnostische Verfahren bei Bewegungsstörungen, Kap Transkranielle Sonografie. Aus: ParkinsonSyndrome und andere Bewegungsstörungen. Herausgebende Autoren: Oertel WH, Deuschl G, Poewe W. Georg Thieme Verlag S.579. Wadia PM, Lang A. The many faces of corticobasal degeneration. Parkinsonism Relat Disord 2007; 13(Suppl 3):S336 S340. Walker Z, Jaros E, Walker RWH, et al. Dementia with Lewy bodies: a comparison of clinical diagnosis, FPCIT single photon emission computed tomography imaging and autopsy.j Neurol Neurosurg Psychiatry 2007;78: Wenning GK, Colosimo C, Geser F, Poewe W. Multiple system atrophy. Lancet Neurol. Feb 2004;3 (2): Williams DR, Lees AJ. Progressive supranuclear palsy: clinicopathological concepts and diagnostic challenges. Lancet Neurol 2009;8:2709. Williams DR, Lees AJ. How do patients with parkinsonism present? A clinicopathological study. Intern Med J 2009;39:7 12. Zivadinov R, Cox JL. Neuroimaging in multiple sclerosis. Int Rev Neurobiol. 2007;79: Abkürzungen aps CBD CBS CT DAT DLB DTI DWI FDG IBZM LBP MCP MP MRPI MRT MSA NBIA OPCA PAGF PDD PET PKAN PS PSP RS SAE SCA SCP SN SND SPECT T TCS VBM ZNS atypisches ParkinsonSyndrom Kortikobalsale Degeneration Kortikobasales Syndrom Computertomographie Dopamintransporter Demenz mit Lewy Körperchen diffusion tensor imaging diffusion weighted imaging 18FFlurodesoxyglucose I123Iodobenzamid lower body Parkinsonism middle cerebellar peduncle, mittlerer Kleinhirnstiel Morbus Parkinson MR ParkinsonIndex Magnetresonanztomographie Multisystematrophie Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation olivopontozerebelläre Atrophie pure akinesia with gait freezing Parkinson s disease with dementia, ParkinsonDemenz positron emission tomography Pantothenate kinaseassociated neurodegeneration ParkinsonSyndrom progressive supranukleäre Paralyse RichardsonSyndrom subkortikale arteriosklerotische Enzephalopathie Spinocerebelläre Ataxie superior cerebellar peduncle, oberer Kleinhirnstiel Substantia nigra striatonigrale Degeneration single photon emission tomography Tesla transkranielle Sonographie Voxelbasierte Morphometrie Zentralnervensystem Impressum: Herausgeber: Österreichische Parkinson Gesellschaft, Skodagasse 1416, A1080 Wien, Tel: +43/1/ , Fax: +43/1/ Für den Inhalt verantwortlich: Univ.Prof. Dr. G. Ransmayr, Univ.Prof. Dr. W. Pirker, Priv.Doz. Dr. Sylvia Bösch Editor: Univ.Prof. Dr. W. Pirker, Univ.Klinik für Neurologie, Währinger Gürtel 1820, A1090 Wien, Tel: + 43/1/ , Fax: +43/1/ , walter.pirker@meduniwien.ac.at; CoEditor: Priv.Doz. Dr. Sylvia Bösch, Univ.Klinik für Neurologie, Anichstr. 35, A6020 Innsbruck, Tel: +43/ 512/504/0, Fax: +43/512/ , sylvia.boesch@imed.ac.at Konzeption: Helmut Haid, Bettelwurfstr. 2, A6020 Innsbruck Druck: Tiroler Druck, A6020 Innsbruck Juni 2012
16
Wie können wir in Zukunft diese Fragen beantworten?
 Parkinson Krankheit: Diagnose kommt sie zu spät? Prof. Dr. med. Claudia Trenkwalder Mannheim (23. September 2010) - Die Frage, ob derzeit die Diagnosestellung einer Parkinson-Erkrankung zu spät kommt,
Parkinson Krankheit: Diagnose kommt sie zu spät? Prof. Dr. med. Claudia Trenkwalder Mannheim (23. September 2010) - Die Frage, ob derzeit die Diagnosestellung einer Parkinson-Erkrankung zu spät kommt,
Die vielen Gesichter des Parkinson
 Die vielen Gesichter des Parkinson Prof. Rudolf Töpper Asklepios Klinik Harburg Sylt Harburg (Hamburg) Falkenstein Ini Hannover Bad Griesbach Sichtweisen der Erkrankung Klinik Hamburg-Harburg typischer
Die vielen Gesichter des Parkinson Prof. Rudolf Töpper Asklepios Klinik Harburg Sylt Harburg (Hamburg) Falkenstein Ini Hannover Bad Griesbach Sichtweisen der Erkrankung Klinik Hamburg-Harburg typischer
Differenzialdiagnose der Parkinson-Syndrome mittels MRT
 Leitthema Nervenarzt 2010 81:1168 1179 DOI 10.1007/s00115-010-3022-8 Online publiziert: 22. September 2010 Springer-Verlag 2010 P. Mahlknecht 1 M. Schocke 2 K. Seppi 1 1 Universitätsklinik für Neurologie,
Leitthema Nervenarzt 2010 81:1168 1179 DOI 10.1007/s00115-010-3022-8 Online publiziert: 22. September 2010 Springer-Verlag 2010 P. Mahlknecht 1 M. Schocke 2 K. Seppi 1 1 Universitätsklinik für Neurologie,
Stellenwert bildgebender Verfahren (CCT, MRT) zur Diagnostik und Differenzialdiagnostik der Parkinsonkrankheit
 Stellenwert bildgebender Verfahren (CCT, MRT) zur Diagnostik und Differenzialdiagnostik der Parkinsonkrankheit R. Schmitt M. Hahne Bad Neustadt an der Saale (D) 4. Parkinson-Symposium Bad Neustadt, den
Stellenwert bildgebender Verfahren (CCT, MRT) zur Diagnostik und Differenzialdiagnostik der Parkinsonkrankheit R. Schmitt M. Hahne Bad Neustadt an der Saale (D) 4. Parkinson-Symposium Bad Neustadt, den
8.4 Morbus Parkinson und. atypischen Parkinson-Syndrome Morbus Parkinson Multisystematrophie. Merke. 8.4 Parkinson-Syndrome
 8.4 Parkinson-Syndrome MRT-Befunde. Die vielen verschiedenen Formen der degenerativen Ataxien können mit einer kortikalen zerebellären Atrophie, einer olivopontozerebellären Atrophie oder auch mit einer
8.4 Parkinson-Syndrome MRT-Befunde. Die vielen verschiedenen Formen der degenerativen Ataxien können mit einer kortikalen zerebellären Atrophie, einer olivopontozerebellären Atrophie oder auch mit einer
Symptome und Diagnosestellung des Morbus Parkinson
 meine Hand zittert habe ich etwa Parkinson? Symptome und Diagnosestellung des Morbus Parkinson Dr. med. Sabine Skodda Oberärztin Neurologische Klinik Morbus Parkinson chronisch fortschreitende neurodegenerative
meine Hand zittert habe ich etwa Parkinson? Symptome und Diagnosestellung des Morbus Parkinson Dr. med. Sabine Skodda Oberärztin Neurologische Klinik Morbus Parkinson chronisch fortschreitende neurodegenerative
Rolle von PET und SPECT in der Differentialdiagnose von Parkinson- Syndromen
 Rolle von PET und SPECT in der Differentialdiagnose von Parkinson- Syndromen Rüdiger Hilker Neurowoche und DGN 2006 20.09.2006 1. Methodik nuklearmedizinischer Bildgebung 2. Biomarker-Konzept bei Parkinson-
Rolle von PET und SPECT in der Differentialdiagnose von Parkinson- Syndromen Rüdiger Hilker Neurowoche und DGN 2006 20.09.2006 1. Methodik nuklearmedizinischer Bildgebung 2. Biomarker-Konzept bei Parkinson-
Bewegungsstörungen. Demenzen. und. am Anfang war das Zittern. (movement disorders) und. Neuro-Geriatrie Fachtage in Haiger,,
 am Anfang war das Zittern Bewegungsstörungen (movement disorders) und Demenzen und Psycho-Neuro Neuro-Geriatrie Fachtage in Haiger,, 9.06.2009 Referent Alexander Simonow Neurologische Praxis, Herborn Bewegungsstörungen
am Anfang war das Zittern Bewegungsstörungen (movement disorders) und Demenzen und Psycho-Neuro Neuro-Geriatrie Fachtage in Haiger,, 9.06.2009 Referent Alexander Simonow Neurologische Praxis, Herborn Bewegungsstörungen
Neurologische/ Neurogeriatrische Erkrankungen des höheren Lebensalters
 Neurologische/ Neurogeriatrische Erkrankungen des höheren Lebensalters J. Bufler Neurologische Klinik des ISK Wasserburg Präsentation, Stand November 2008, Martin Spuckti Seite 1 Vier Giganten der Geriatrie
Neurologische/ Neurogeriatrische Erkrankungen des höheren Lebensalters J. Bufler Neurologische Klinik des ISK Wasserburg Präsentation, Stand November 2008, Martin Spuckti Seite 1 Vier Giganten der Geriatrie
PARKINSON. Die Krankheit verstehen und bewältigen. Prof. Dr. med. Claudia Trenkwalder
 Prof. Dr. med. Claudia Trenkwalder PARKINSON Die Krankheit verstehen und bewältigen Unter Mitarbeit von: Dr. med. Manfred Georg Krukemeyer Prof. Dr. med. Gunnar Möllenhoff Dipl.-Psych. Dr. Ellen Trautmann
Prof. Dr. med. Claudia Trenkwalder PARKINSON Die Krankheit verstehen und bewältigen Unter Mitarbeit von: Dr. med. Manfred Georg Krukemeyer Prof. Dr. med. Gunnar Möllenhoff Dipl.-Psych. Dr. Ellen Trautmann
Grundlagen Neurogenetik und Bewegungsstörungen Ausblick 27. Krankheitsbilder Differenzialdiagnosen
 XI Grundlagen 1 1 Grundlagen der Bewegungserkrankungen 3 W. H. Oertel 1.1 Einleitung und Geschichte der Erforschung der Bewegungserkrankungen 3 1.2 Neuroanatomie und Neurophysiologie der Basalganglien
XI Grundlagen 1 1 Grundlagen der Bewegungserkrankungen 3 W. H. Oertel 1.1 Einleitung und Geschichte der Erforschung der Bewegungserkrankungen 3 1.2 Neuroanatomie und Neurophysiologie der Basalganglien
Cindy Former & Jonas Schweikhard
 Cindy Former & Jonas Schweikhard Definition Krankheitsbild Entdeckung Ursachen Biochemische Grundlagen Diagnostik Therapie Quellen Morbus Parkinson ist eine chronisch progressive neurodegenerative Erkrankung
Cindy Former & Jonas Schweikhard Definition Krankheitsbild Entdeckung Ursachen Biochemische Grundlagen Diagnostik Therapie Quellen Morbus Parkinson ist eine chronisch progressive neurodegenerative Erkrankung
Demenzerkrankungen: Was kommt da auf uns alle zu?
 Demenzerkrankungen: Was kommt da auf uns alle zu? Prof. Dr. phil Helmut Hildebrandt Klinikum Bremen-Ost, Neurologie Universität Oldenburg, Psychologie Demenzerkrankungen: Was kommt da auf uns alle zu?
Demenzerkrankungen: Was kommt da auf uns alle zu? Prof. Dr. phil Helmut Hildebrandt Klinikum Bremen-Ost, Neurologie Universität Oldenburg, Psychologie Demenzerkrankungen: Was kommt da auf uns alle zu?
M. Parkinson Ursache und Diagnose
 M. Parkinson Ursache und Diagnose Historisches Häufigkeit Diagnose Manifestationstypen Ähnliche Krankheiten Ursache(n) Zusatzuntersuchungen Prof. Dr. med. Helmut Buchner und klinische Neurophysiologie
M. Parkinson Ursache und Diagnose Historisches Häufigkeit Diagnose Manifestationstypen Ähnliche Krankheiten Ursache(n) Zusatzuntersuchungen Prof. Dr. med. Helmut Buchner und klinische Neurophysiologie
Bildgebende Verfahren zur Erkennung von Parkinsonsyndromen
 I N F O R M A T I O N S B R O S C H Ü R E Bildgebende Verfahren zur Erkennung von Parkinsonsyndromen 4 VORWORT 5 Liebe Patientin, Lieber Patient, Verantwortlich für den Inhalt dieser Informationsbroschüre:
I N F O R M A T I O N S B R O S C H Ü R E Bildgebende Verfahren zur Erkennung von Parkinsonsyndromen 4 VORWORT 5 Liebe Patientin, Lieber Patient, Verantwortlich für den Inhalt dieser Informationsbroschüre:
Was bleibt da für die klassische MRT-Bildgebung übrig?
 11. Bremer MR-Symposium Demenzerkrankungen Was bleibt da für die klassische MRT-Bildgebung übrig? G. Schuierer Zentrum Neuroradiologie Regensburg Alzheimerdemenz ~60% Alzheimerdemenz ~60% Mischform AD-vaskulär~15%
11. Bremer MR-Symposium Demenzerkrankungen Was bleibt da für die klassische MRT-Bildgebung übrig? G. Schuierer Zentrum Neuroradiologie Regensburg Alzheimerdemenz ~60% Alzheimerdemenz ~60% Mischform AD-vaskulär~15%
. Frühe Anzeichen eines Parkinson-Syndroms... 5
 Die Parkinson-Krankheit Grundlagen... 3. Frühe Anzeichen eines Parkinson-Syndroms... 5 Riechvermögen.... 5 Schlafstörungen.... 5 Blutdruckregulationsstörungen... 6 Verdauung (Verstopfung, Obstipation)....
Die Parkinson-Krankheit Grundlagen... 3. Frühe Anzeichen eines Parkinson-Syndroms... 5 Riechvermögen.... 5 Schlafstörungen.... 5 Blutdruckregulationsstörungen... 6 Verdauung (Verstopfung, Obstipation)....
Parkinson-Syndrome und andere Bewegungsstörungen
 Parkinson-Syndrome und andere Bewegungsstörungen Bearbeitet von Wolfgang H. Oertel, Günther Deuschl, Werner Poewe 1. Auflage 2011. Buch. ca. 648 S. Hardcover ISBN 978 3 13 148781 0 Format (B x L): 19,5
Parkinson-Syndrome und andere Bewegungsstörungen Bearbeitet von Wolfgang H. Oertel, Günther Deuschl, Werner Poewe 1. Auflage 2011. Buch. ca. 648 S. Hardcover ISBN 978 3 13 148781 0 Format (B x L): 19,5
Innovative Neuro-Bildgebung unterstützt frühe Diagnose und maßgeschneiderte Therapiestrategien
 Kongress der European Neurological Society (ENS) 2009: Alzheimer, Kopfschmerzen, Multiple Sklerose Innovative Neuro-Bildgebung unterstützt frühe Diagnose und maßgeschneiderte Therapiestrategien Mailand,
Kongress der European Neurological Society (ENS) 2009: Alzheimer, Kopfschmerzen, Multiple Sklerose Innovative Neuro-Bildgebung unterstützt frühe Diagnose und maßgeschneiderte Therapiestrategien Mailand,
Hirnparenchymsonographie bei Parkinson-Syndromen. Hirnsonographie (B-Bild) Hirnblutungen Seidel et al. Stroke 1993
 Hirnparenchymsonographie bei Parkinson-Syndromen Uwe Walter Halbtageskurs Klinisch relevante Neurosonologie Neurowoche, Mannheim, 23. September 2010 Klinik für Neurologie Universität Rostock Hirnsonographie
Hirnparenchymsonographie bei Parkinson-Syndromen Uwe Walter Halbtageskurs Klinisch relevante Neurosonologie Neurowoche, Mannheim, 23. September 2010 Klinik für Neurologie Universität Rostock Hirnsonographie
Neuronale Bildgebung bei der Alzheimer Krankheit. Stefan J. Teipel
 Neuronale Bildgebung bei der Alzheimer Krankheit Stefan J. Teipel Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Rostock Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), Rostock
Neuronale Bildgebung bei der Alzheimer Krankheit Stefan J. Teipel Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Rostock Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), Rostock
Parkinson: (differentielle) Diagnosis
 Parkinson: (differentielle) Diagnosis Professor Bastiaan R. Bloem Parkinson Center Nijmegen (ParC) Medizinisches Zentrum der Universität Radboud @BasBloem Teilnehmende Organisationen: Eine faszinierende
Parkinson: (differentielle) Diagnosis Professor Bastiaan R. Bloem Parkinson Center Nijmegen (ParC) Medizinisches Zentrum der Universität Radboud @BasBloem Teilnehmende Organisationen: Eine faszinierende
Demenz. Demenz...und wenn es nicht Alzheimer ist? Häufigkeit (%) von Demenzerkrankungen in der Bevölkerung. Delir. Depression
 ...und wenn es nicht Alzheimer ist? Nutritiv-toxisch Neurodegeneration Vaskuläre Erkrankungen Neoplastisch Zukunft Alter Gerontologica - 4.6.2004 Wiesbaden Empfehlungen für die Praxis Unterstützung für
...und wenn es nicht Alzheimer ist? Nutritiv-toxisch Neurodegeneration Vaskuläre Erkrankungen Neoplastisch Zukunft Alter Gerontologica - 4.6.2004 Wiesbaden Empfehlungen für die Praxis Unterstützung für
REM-Schlafverhaltensstörung RBD
 RBD-Patiententag 20.07.2012 REM-Schlafverhaltensstörung RBD RBD Formen und diagnostische Probleme Prof. Dr. W. H. Oertel, Prof. Dr. G. Mayer, Prof. Dr. F. Rosenow, PD Dr. V. Ries, Dr. D. Vadasz Frau E.
RBD-Patiententag 20.07.2012 REM-Schlafverhaltensstörung RBD RBD Formen und diagnostische Probleme Prof. Dr. W. H. Oertel, Prof. Dr. G. Mayer, Prof. Dr. F. Rosenow, PD Dr. V. Ries, Dr. D. Vadasz Frau E.
Neurodegeneration. Quantität oder Qualität
 Neurodegeneration Quantität oder Qualität Karl Egger Leiter Freiburg Brain Imaging Center Klinik für Neuroradiologie Freiburg karl.egger@uniklinik-freiburg.de Content I. Neurodegeneration Grundlagen und
Neurodegeneration Quantität oder Qualität Karl Egger Leiter Freiburg Brain Imaging Center Klinik für Neuroradiologie Freiburg karl.egger@uniklinik-freiburg.de Content I. Neurodegeneration Grundlagen und
Neurodegenerative Demenzen: Es ist nicht immer Alzheimer
 Neurodegenerative Demenzen: Es ist nicht immer Alzheimer PD Dr. Brit Mollenhauer Prof. Dr. Claudia Trenkwalder Paracelsus-Elena Klinik, Kassel Neurologisches Krankenhaus für Bewegungsstörungen Prävalenz
Neurodegenerative Demenzen: Es ist nicht immer Alzheimer PD Dr. Brit Mollenhauer Prof. Dr. Claudia Trenkwalder Paracelsus-Elena Klinik, Kassel Neurologisches Krankenhaus für Bewegungsstörungen Prävalenz
Nuklearmedizin- Zentralnervensystem. dr. Erzsébet Schmidt Institut für Nuklearmedizin, Universität Pécs
 Nuklearmedizin- Zentralnervensystem dr. Erzsébet Schmidt Institut für Nuklearmedizin, Universität Pécs - Man sieht nur das, was funktioniert! - Strukturgebende Verfahren (CT, MR): Makrostruktur des Gehirns
Nuklearmedizin- Zentralnervensystem dr. Erzsébet Schmidt Institut für Nuklearmedizin, Universität Pécs - Man sieht nur das, was funktioniert! - Strukturgebende Verfahren (CT, MR): Makrostruktur des Gehirns
Bild: Kurzlehrbuch Neurologie, Thieme
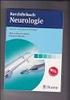 Morbus Parkinson 2 Morbus Parkinson Inhalt» Pathogenese» Symptome» Diagnostik» Therapie Bild: Kurzlehrbuch Neurologie, Thieme Eigene Bilder Morbus Parkinson 4 Morbus Parkinson 3 Was ist Parkinson?» Die
Morbus Parkinson 2 Morbus Parkinson Inhalt» Pathogenese» Symptome» Diagnostik» Therapie Bild: Kurzlehrbuch Neurologie, Thieme Eigene Bilder Morbus Parkinson 4 Morbus Parkinson 3 Was ist Parkinson?» Die
Die Blutversorgung des Gehirns. Figure 21-24a
 Die Blutversorgung des Gehirns Figure 21-24a Die Blutversorgung des Gehirns Figure 21-22 Die Blutversorgung des Gehirns A. cerebri media A. cerebri anterior A. basilaris A. cerebri posterior A. carotis
Die Blutversorgung des Gehirns Figure 21-24a Die Blutversorgung des Gehirns Figure 21-22 Die Blutversorgung des Gehirns A. cerebri media A. cerebri anterior A. basilaris A. cerebri posterior A. carotis
Tiefe Hirnstimulation bei Bewegungsstörungen. Klinik für Neurologie Klinik für Neurochirurgie
 Tiefe Hirnstimulation bei Bewegungsstörungen Klinik für Neurologie Klinik für Neurochirurgie Bewegungsstörung Die Parkinson Krankheit (Morbus Parkinson) zählt zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen
Tiefe Hirnstimulation bei Bewegungsstörungen Klinik für Neurologie Klinik für Neurochirurgie Bewegungsstörung Die Parkinson Krankheit (Morbus Parkinson) zählt zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen
Leichte kognitive Beeinträchtigung (mild cognitive impairment) und Differentialdiagnosen
 Leichte kognitive Beeinträchtigung (mild cognitive impairment) und Differentialdiagnosen Thomas Duning Andreas Johnen Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität
Leichte kognitive Beeinträchtigung (mild cognitive impairment) und Differentialdiagnosen Thomas Duning Andreas Johnen Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität
Neue Leitlinien zur Dissektion hirnversorgender Arterien: Was ändert sich im klinischen Alltag?
 Neue Leitlinien zur Dissektion hirnversorgender Arterien: Was ändert sich im klinischen Alltag? Ralf Dittrich Department für Neurologie Klinik für Allgemeine Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität
Neue Leitlinien zur Dissektion hirnversorgender Arterien: Was ändert sich im klinischen Alltag? Ralf Dittrich Department für Neurologie Klinik für Allgemeine Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität
6. Zusammenfassung Zielsetzung
 6. Zusammenfassung 6.1. Zielsetzung Die Diagnose eines idiopathischen Parkinson-Syndromes ist bis zum heutigen Zeitpunkt überwiegend von klinischen Parametern bestimmt. Im Regelfall, also außerhalb der
6. Zusammenfassung 6.1. Zielsetzung Die Diagnose eines idiopathischen Parkinson-Syndromes ist bis zum heutigen Zeitpunkt überwiegend von klinischen Parametern bestimmt. Im Regelfall, also außerhalb der
Vaskuläre Demenz G. Lueg Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität Münster
 Vaskuläre Demenz G. Lueg Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität Münster Verteilung der Demenz 3-10% LewyKörperchenDemenz 3-18% Frontotemporale Demenz
Vaskuläre Demenz G. Lueg Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität Münster Verteilung der Demenz 3-10% LewyKörperchenDemenz 3-18% Frontotemporale Demenz
Demenz (Chronische Verwirrtheit)
 Demenz (Chronische Verwirrtheit) Demenz ist ein Überbegriff für eine Erkrankung. Die Epidemiologie zeigt dass ca. 10 13% der 12 Millionen Menschen > 65 Jahre eine Demenz haben.nbdas entspricht ca. 1,2
Demenz (Chronische Verwirrtheit) Demenz ist ein Überbegriff für eine Erkrankung. Die Epidemiologie zeigt dass ca. 10 13% der 12 Millionen Menschen > 65 Jahre eine Demenz haben.nbdas entspricht ca. 1,2
Aus der Klinik für Neurologie. im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel. an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
 Aus der Klinik für Neurologie im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Direktor: Prof. Dr. med. G. Deuschl Untersuchung zur Wertigkeit klinischer
Aus der Klinik für Neurologie im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Direktor: Prof. Dr. med. G. Deuschl Untersuchung zur Wertigkeit klinischer
PET, SPECT. M. Weckesser Münster
 Neurodegenerative Erkrankungen PET, SPECT M. Weckesser Münster Perfusion H2O Rezeptor FDG GLUT FDG Hexokinase Ligand FDG-6P Metabolismus Synapse Park. 5% 5% Andere* AD/Vasc. 15% Vasc. 15% 5% DLB AD 55%
Neurodegenerative Erkrankungen PET, SPECT M. Weckesser Münster Perfusion H2O Rezeptor FDG GLUT FDG Hexokinase Ligand FDG-6P Metabolismus Synapse Park. 5% 5% Andere* AD/Vasc. 15% Vasc. 15% 5% DLB AD 55%
Multiple Systematrophie (MSA)
 1 Multiple Systematrophie (MSA) MSA vereint begrifflich folgende historisch früher beschriebene neurodegenerative Erkrankungen: - Olivopontocerebellare Atrophie - Striatonigrale Degeneration - Shy-Drager-Syndrom
1 Multiple Systematrophie (MSA) MSA vereint begrifflich folgende historisch früher beschriebene neurodegenerative Erkrankungen: - Olivopontocerebellare Atrophie - Striatonigrale Degeneration - Shy-Drager-Syndrom
Parkinson und Kreislaufprobleme
 Parkinson und Kreislaufprobleme Referent: Dr. Gabor Egervari Leiter der Kardiologie, Klinik für Innere Medizin Übersicht 1. Ursachen für Kreislaufprobleme bei M. Parkinson 2. Diagnostische Maßnahmen bei
Parkinson und Kreislaufprobleme Referent: Dr. Gabor Egervari Leiter der Kardiologie, Klinik für Innere Medizin Übersicht 1. Ursachen für Kreislaufprobleme bei M. Parkinson 2. Diagnostische Maßnahmen bei
REM Schlafverhaltensstörung
 REM Schlafverhaltensstörung Prof. Dr. W. H. Oertel, Prof. Dr. G. Mayer, Prof. Dr. F. Rosenow, PD Dr. V. Ries, Dr. D. Vadasz, Frau E. Sittig-Wiegand, Frau M. Bitterlich Klinik für Neurologie Philipps Universität
REM Schlafverhaltensstörung Prof. Dr. W. H. Oertel, Prof. Dr. G. Mayer, Prof. Dr. F. Rosenow, PD Dr. V. Ries, Dr. D. Vadasz, Frau E. Sittig-Wiegand, Frau M. Bitterlich Klinik für Neurologie Philipps Universität
Früh- und Vorbotensymptome der Parkinsonerkrankung
 Früh- und Vorbotensymptome der Parkinsonerkrankung 5. Hiltruper Parkinson-Tag 20. Mai 2015 Referent: Dr. Christoph Aufenberg, Oberarzt der Klinik für Neurologie Herz-Jesu-Krankenhaus Münster-Hiltrup Westfalenstraße
Früh- und Vorbotensymptome der Parkinsonerkrankung 5. Hiltruper Parkinson-Tag 20. Mai 2015 Referent: Dr. Christoph Aufenberg, Oberarzt der Klinik für Neurologie Herz-Jesu-Krankenhaus Münster-Hiltrup Westfalenstraße
Gliederung. 1. Biochemie 1.1. Synukleinopathien 1.2. Tauopathien 1.3. Amyloidopathien
 Gliederung 1. Biochemie 1.1. Synukleinopathien 1.2. Tauopathien 1.3. Amyloidopathien 2. Neurodengeneration 2.1. Aggregate 2.2. Klinische Einteilung 2.3. Pathologie 2.4. Ergebnisse 3. Bildgebung 3.1. M.
Gliederung 1. Biochemie 1.1. Synukleinopathien 1.2. Tauopathien 1.3. Amyloidopathien 2. Neurodengeneration 2.1. Aggregate 2.2. Klinische Einteilung 2.3. Pathologie 2.4. Ergebnisse 3. Bildgebung 3.1. M.
Vorbote von Parkinson-Krankheit und Lewy-Körper-Demenz
 Schlafstörung IRBD Vorbote von Parkinson-Krankheit und Lewy-Körper-Demenz Berlin (3. Juni 2013) - Die Langzeitbeobachtung von 44 Patienten mit der seltenen Traum-Schlafverhaltensstörung IRBD (Idiopathic
Schlafstörung IRBD Vorbote von Parkinson-Krankheit und Lewy-Körper-Demenz Berlin (3. Juni 2013) - Die Langzeitbeobachtung von 44 Patienten mit der seltenen Traum-Schlafverhaltensstörung IRBD (Idiopathic
Parkinson - Die Krankheit verstehen und bewältigen
 Parkinson - Die Krankheit verstehen und bewältigen Unter Mitarbeit von Dr. med. Manfred Georg Krukemeyer, Prof. Dr. med. Gunnar Möllenhoff und Dipl.- Psych. Dr. Ellen Trautmann Bearbeitet von Claudia Trenkwalder
Parkinson - Die Krankheit verstehen und bewältigen Unter Mitarbeit von Dr. med. Manfred Georg Krukemeyer, Prof. Dr. med. Gunnar Möllenhoff und Dipl.- Psych. Dr. Ellen Trautmann Bearbeitet von Claudia Trenkwalder
Ausbildungsinhalte zum Arzt für Allgemeinmedizin. Neurologie
 Ausbildungsinhalte zum Arzt für Allgemeinmedizin Anlage 1.B.8.5 Neurologie 1. Akut- und Notfallmedizin absolviert 1. Kenntnisse und Erfahrungen im Erkennen und Vorgehen bei akut bedrohlichen Situationen,
Ausbildungsinhalte zum Arzt für Allgemeinmedizin Anlage 1.B.8.5 Neurologie 1. Akut- und Notfallmedizin absolviert 1. Kenntnisse und Erfahrungen im Erkennen und Vorgehen bei akut bedrohlichen Situationen,
Homepage: Online-Datenbank mit Autoren- und Stichwortsuche
 Update: SPECT in der Diagnostik von Parkinson-Syndromen Pirker W Journal für Neurologie Neurochirurgie und Psychiatrie 2015; 16 (2), 60-71 Homepage: www.kup.at/ JNeurolNeurochirPsychiatr Online-Datenbank
Update: SPECT in der Diagnostik von Parkinson-Syndromen Pirker W Journal für Neurologie Neurochirurgie und Psychiatrie 2015; 16 (2), 60-71 Homepage: www.kup.at/ JNeurolNeurochirPsychiatr Online-Datenbank
Funktionelle Bildgebung in der Neurologie
 Funktionelle Bildgebung in der Neurologie Academia Neurologica Plau am See, 10.03.2010 Famulus Marco Gericke Klinische Indikationen der funktionellen Bildgebung - Abgrenzung von funktionsfähigem und infarziertem
Funktionelle Bildgebung in der Neurologie Academia Neurologica Plau am See, 10.03.2010 Famulus Marco Gericke Klinische Indikationen der funktionellen Bildgebung - Abgrenzung von funktionsfähigem und infarziertem
Die Hauptstrukturen des Gehirns
 Wir unterscheiden 4 grosse Lappen (cortical): Frontallappen, Parietallappen, Temporallappen und Occipitallappen! Markante Gyri sind: Gyrus precentralis, Gyrus postcentralis und Gyrus temporalis superior
Wir unterscheiden 4 grosse Lappen (cortical): Frontallappen, Parietallappen, Temporallappen und Occipitallappen! Markante Gyri sind: Gyrus precentralis, Gyrus postcentralis und Gyrus temporalis superior
Klinik für Neurologie und neurologische Intensivmedizin am Klinikum Lüdenscheid. Graphik entfernt
 Parkinson`s Definition: Involuntary tremulous motion, with lessened muscular power, in parts not in action and even when supported with a propensity to bend the trunk forwards and to pass from a walking
Parkinson`s Definition: Involuntary tremulous motion, with lessened muscular power, in parts not in action and even when supported with a propensity to bend the trunk forwards and to pass from a walking
Vorwort. 2 Epidemiologie Inzidenz Mortalität Prävalenz Prognose 7
 Inhalt Vorwort V 1 Definition von Krankheitsbildern 1 1.1 Stadium I (asymptomatische Stenose) 1 1.2 Stadium II (TIA) 1 1.3 Stadium III (progredienter Schlaganfall) 2 1.4 Stadium IV (kompletter Schlaganfall)
Inhalt Vorwort V 1 Definition von Krankheitsbildern 1 1.1 Stadium I (asymptomatische Stenose) 1 1.2 Stadium II (TIA) 1 1.3 Stadium III (progredienter Schlaganfall) 2 1.4 Stadium IV (kompletter Schlaganfall)
Diagnostische Möglichkeiten der Demenzerkrankung 5. Palliativtag am in Pfaffenhofen
 Diagnostische Möglichkeiten der Demenzerkrankung 5. Palliativtag am 12.11.2011 in Pfaffenhofen Dr. Torsten Mager, Ärztl. Direktor der Danuvius Klinik GmbH Übersicht Epidemiologische Zahlen Ursache häufiger
Diagnostische Möglichkeiten der Demenzerkrankung 5. Palliativtag am 12.11.2011 in Pfaffenhofen Dr. Torsten Mager, Ärztl. Direktor der Danuvius Klinik GmbH Übersicht Epidemiologische Zahlen Ursache häufiger
Tiefe Hirnstimulation
 Münster, 09.09.2015 Tiefe Hirnstimulation N. Warneke Klinik für Neurochirurgie Universitätsklinikum Münster Direktor: Prof. Dr. med. W. Stummer Morbus Parkinson Problem: Nach 5-6 Jahren entwickeln ca.
Münster, 09.09.2015 Tiefe Hirnstimulation N. Warneke Klinik für Neurochirurgie Universitätsklinikum Münster Direktor: Prof. Dr. med. W. Stummer Morbus Parkinson Problem: Nach 5-6 Jahren entwickeln ca.
Anatomie und Symptomatik bei Hirnveränderungen. Dr. med. Katharina Seystahl Klinik für Neurologie Universitätsspital Zürich
 Anatomie und Symptomatik bei Hirnveränderungen Dr. med. Katharina Seystahl Klinik für Neurologie Universitätsspital Zürich Übersicht 1. Anatomisch-funktionelle Grundlagen 2. Symptome bei Hirnveränderungen
Anatomie und Symptomatik bei Hirnveränderungen Dr. med. Katharina Seystahl Klinik für Neurologie Universitätsspital Zürich Übersicht 1. Anatomisch-funktionelle Grundlagen 2. Symptome bei Hirnveränderungen
Parkinson-Syndrome Parkinson-Syndrome Themen dieses Vortrags: 1.) Überblick über Parkinson-Syndrome 2.) Morbus Parkinson Pathophysiologie
 Parkinson-Syndrome Parkinson-Syndrome Themen dieses Vortrags: 1.) Überblick über Parkinson-Syndrome 2.) Morbus Parkinson - Pathophysiologie - Epidemiologie - Symptome - Diagnostik - Therapie 3.) Parkinson-plus
Parkinson-Syndrome Parkinson-Syndrome Themen dieses Vortrags: 1.) Überblick über Parkinson-Syndrome 2.) Morbus Parkinson - Pathophysiologie - Epidemiologie - Symptome - Diagnostik - Therapie 3.) Parkinson-plus
Parkinson: Zunehmende Aufmerksamkeit für nicht-motorische Störungen eröffnet neue Therapieoptionen
 European Neurological Society (ENS) 2009: Neurologen tagen in Mailand Parkinson: Zunehmende Aufmerksamkeit für nicht-motorische Störungen eröffnet neue Therapieoptionen Mailand, Italien (22. Juni 2009)
European Neurological Society (ENS) 2009: Neurologen tagen in Mailand Parkinson: Zunehmende Aufmerksamkeit für nicht-motorische Störungen eröffnet neue Therapieoptionen Mailand, Italien (22. Juni 2009)
Demenz. Gabriela Stoppe. Diagnostik - Beratung - Therapie. Ernst Reinhardt Verlag München Basel. Mit 13 Abbildungen und 2 Tabellen
 Gabriela Stoppe 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Demenz Diagnostik - Beratung - Therapie Mit 13 Abbildungen
Gabriela Stoppe 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Demenz Diagnostik - Beratung - Therapie Mit 13 Abbildungen
Die aktuelle S3-Leitlinie zur Diagnsotik, Therapie und Nachsorge des Ovarialkarzinoms. Diagnostik
 Die aktuelle S3-Leitlinie zur Diagnsotik, Therapie und Nachsorge des Ovarialkarzinoms Diagnostik Diagnostik: Zielsetzung und Fragestellungen Diagnostik (siehe Kapitel 3.3) Welche Symptome weisen auf ein
Die aktuelle S3-Leitlinie zur Diagnsotik, Therapie und Nachsorge des Ovarialkarzinoms Diagnostik Diagnostik: Zielsetzung und Fragestellungen Diagnostik (siehe Kapitel 3.3) Welche Symptome weisen auf ein
AMYVID (FLORBETAPIR 18 F-INJEKTION) AUSWERTERSCHULUNG FÜR DIE PET-BILDGEBUNG
 AMYVID (FLORBETAPIR 18 F-INJEKTION) AUSWERTERSCHULUNG FÜR DIE PET-BILDGEBUNG Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse
AMYVID (FLORBETAPIR 18 F-INJEKTION) AUSWERTERSCHULUNG FÜR DIE PET-BILDGEBUNG Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse
Neuroradiologische Diagnostik bei Demenzerkrankungen Bernd Tomandl, Anita Neumann, Tibor Mitrovics. (lat. dementia ohne Geist )
 Neuroradiologische Diagnostik bei Demenzerkrankungen Bernd Tomandl, Anita Neumann, Tibor Mitrovics (lat. dementia ohne Geist ) Demografie Altersgruppe 65- bis 69-Jährige 1,2 % 70- bis 74-Jährige 2,8 %
Neuroradiologische Diagnostik bei Demenzerkrankungen Bernd Tomandl, Anita Neumann, Tibor Mitrovics (lat. dementia ohne Geist ) Demografie Altersgruppe 65- bis 69-Jährige 1,2 % 70- bis 74-Jährige 2,8 %
Werkstatt. Radiologische Mustererkennung
 Deutsche Akademie für Seltene Neurologische Erkrankungen Einladung zum Gründungssymposium 29. Nov 1. Dez 2017 Wartburg, Eisenach Liebe Kolleginnen und Kollegen, Werkstatt hiermit laden wir Sie herzlich
Deutsche Akademie für Seltene Neurologische Erkrankungen Einladung zum Gründungssymposium 29. Nov 1. Dez 2017 Wartburg, Eisenach Liebe Kolleginnen und Kollegen, Werkstatt hiermit laden wir Sie herzlich
Aspekte der Demenz. Frontotemporale Demenz (FTD) Prof. Dr. Jens Wiltfang. Fachtagung, Göttingen,
 Aspekte der Demenz Frontotemporale Demenz (FTD) Prof. Dr. Jens Wiltfang Fachtagung, Göttingen, 14.06.207 Klinik für Psychiatrie & Psychotherapie, Universitätsmedizin Göttingen 1 Demenz: Status quo Die
Aspekte der Demenz Frontotemporale Demenz (FTD) Prof. Dr. Jens Wiltfang Fachtagung, Göttingen, 14.06.207 Klinik für Psychiatrie & Psychotherapie, Universitätsmedizin Göttingen 1 Demenz: Status quo Die
Jüngere Menschen mit Demenz Medizinische Aspekte. in absoluten Zahlen. Altersgruppe zwischen 45 und 64 Jahren in Deutschland: ca.
 Prävalenz und Inzidenz präseniler en Jüngere Menschen mit Medizinische Aspekte Priv.Doz. Dr. med. Katharina Bürger Alzheimer Gedächtniszentrum Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie LudwigMaximiliansUniversität
Prävalenz und Inzidenz präseniler en Jüngere Menschen mit Medizinische Aspekte Priv.Doz. Dr. med. Katharina Bürger Alzheimer Gedächtniszentrum Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie LudwigMaximiliansUniversität
Diagnostisches Vorgehen bei Leberraumforderungen. H. Diepolder
 Diagnostisches Vorgehen bei Leberraumforderungen H. Diepolder Bei 20% aller Routinesonographien fällt eine Leberraumforderung auf Problem Problem Bei 20% aller Routinesonographien fällt eine Leberraumforderung
Diagnostisches Vorgehen bei Leberraumforderungen H. Diepolder Bei 20% aller Routinesonographien fällt eine Leberraumforderung auf Problem Problem Bei 20% aller Routinesonographien fällt eine Leberraumforderung
Parkinson kommt selten allein
 Herausforderung Komorbiditäten Parkinson kommt selten allein Prof. Dr. Jens Volkmann, Würzburg Würzburg (14. März 2013) - Morbus Parkinson ist eine chronisch progrediente Erkrankung, für die noch keine
Herausforderung Komorbiditäten Parkinson kommt selten allein Prof. Dr. Jens Volkmann, Würzburg Würzburg (14. März 2013) - Morbus Parkinson ist eine chronisch progrediente Erkrankung, für die noch keine
Biologische Psychologie II
 Parkinson-Erkrankung: Ca. 0,5% der Bevölkerung leidet an dieser Krankheit, die bei Männern ungefähr 2,5 Mal häufiger auftritt als bei Frauen! Die Krankheit beginnt mit leichter Steifheit oder Zittern der
Parkinson-Erkrankung: Ca. 0,5% der Bevölkerung leidet an dieser Krankheit, die bei Männern ungefähr 2,5 Mal häufiger auftritt als bei Frauen! Die Krankheit beginnt mit leichter Steifheit oder Zittern der
DIAGNOSTISCHE METHODENKOMBINATION ZUR DIFFERENZIERUNG VON ATYPISCHEN PARKINSONVARIANTEN UND IDIOPATHISCHEM PARKINSON-SYNDROM.
 DIAGNOSTISCHE METHODENKOMBINATION édition scientifique VVB LAUFERSWEILER VERLAG VVB LAUFERSWEILER VERLAG STAUFENBERGRING 15 D-35396 GIESSEN Tel: 0641-5599888 Fax: -5599890 redaktion@doktorverlag.de 9 www.doktorverlag.de
DIAGNOSTISCHE METHODENKOMBINATION édition scientifique VVB LAUFERSWEILER VERLAG VVB LAUFERSWEILER VERLAG STAUFENBERGRING 15 D-35396 GIESSEN Tel: 0641-5599888 Fax: -5599890 redaktion@doktorverlag.de 9 www.doktorverlag.de
Charakterisierung von abdominellen Flüssigkeitsansammlungen mittels diffusionsgewichteter Sequenzen bei 3 Tesla. Dr. med.
 Charakterisierung von abdominellen Flüssigkeitsansammlungen mittels diffusionsgewichteter Sequenzen bei 3 Tesla Dr. med. Isabel Kaiser Zielsetzung Gelingt es mit diffusionsgewichteten Sequenzen, infektiöse
Charakterisierung von abdominellen Flüssigkeitsansammlungen mittels diffusionsgewichteter Sequenzen bei 3 Tesla Dr. med. Isabel Kaiser Zielsetzung Gelingt es mit diffusionsgewichteten Sequenzen, infektiöse
1. Bitte. Alter: andere: Jahre. 2. Bitte. 5 bis. 5 bis
 Fragebogen Demenz 1. Bitte geben Sie Ihr Alter, Ihre fachliche Ausrichtung und die Dauer Ihrer Niederlassung an. Alter: Fachliche Tätigkeitt als Neurologe Psychiater Nervenarzt Internist Allgemeinmediziner
Fragebogen Demenz 1. Bitte geben Sie Ihr Alter, Ihre fachliche Ausrichtung und die Dauer Ihrer Niederlassung an. Alter: Fachliche Tätigkeitt als Neurologe Psychiater Nervenarzt Internist Allgemeinmediziner
Handmotorik trifft Bildgebung / MRT Ein gemeinsamer Weg zur Entwicklungsdiagnostik?
 Handmotorik trifft Bildgebung / MRT Ein gemeinsamer Weg zur Entwicklungsdiagnostik? Florian Heinen, Inga Körte, Birgit Ertl-Wagner, A. Sebastian Schröder, Ingo Borggräfe, Wolfgang Müller-Felber, Adrian
Handmotorik trifft Bildgebung / MRT Ein gemeinsamer Weg zur Entwicklungsdiagnostik? Florian Heinen, Inga Körte, Birgit Ertl-Wagner, A. Sebastian Schröder, Ingo Borggräfe, Wolfgang Müller-Felber, Adrian
Frühdiagnose von Parkinson-Syndromen
 Frühdiagnose von Parkinson-Syndromen Nicht ganz trivial, aber prognostisch und therapeutisch relevant Thomas Gasser Die Diagnose des idiopathischen Parkinson-Syndroms (IPS = Parkinson-Krankheit) erfolgt
Frühdiagnose von Parkinson-Syndromen Nicht ganz trivial, aber prognostisch und therapeutisch relevant Thomas Gasser Die Diagnose des idiopathischen Parkinson-Syndroms (IPS = Parkinson-Krankheit) erfolgt
Kein Hinweis für eine andere Ursache der Demenz
 die später nach ihm benannte Krankheit. Inzwischen weiß man, dass die Alzheimer-Krankheit eine sogenannte primär-neurodegenerative Hirnerkrankung ist. Das bedeutet, dass die Erkrankung direkt im Gehirn
die später nach ihm benannte Krankheit. Inzwischen weiß man, dass die Alzheimer-Krankheit eine sogenannte primär-neurodegenerative Hirnerkrankung ist. Das bedeutet, dass die Erkrankung direkt im Gehirn
NRW-Forum Rehabilitation sensomotorischer Störungen. Bedeutung der Rehabilitation für Parkinson-Patienten
 NRW-Forum Rehabilitation sensomotorischer Störungen Bedeutung der Rehabilitation für Parkinson-Patienten Die Krankheit Parkinson ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, die progredient verläuft
NRW-Forum Rehabilitation sensomotorischer Störungen Bedeutung der Rehabilitation für Parkinson-Patienten Die Krankheit Parkinson ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, die progredient verläuft
Seltene Demenzen. Posteriore Corticale Atrophie. lic. phil. Gregor Steiger-Bächler 01-04-2011. Neuropsychologie-Basel
 Seltene Demenzen Posteriore Corticale Atrophie lic. phil. Gregor Steiger-Bächler Posteriore corticale atrophie Merkmale: Schleichender Beginn, oft in der 5. oder 6. Dekade, langsam progredienter Verlauf
Seltene Demenzen Posteriore Corticale Atrophie lic. phil. Gregor Steiger-Bächler Posteriore corticale atrophie Merkmale: Schleichender Beginn, oft in der 5. oder 6. Dekade, langsam progredienter Verlauf
Fallstricke bei der Diagnose
 PARKINSONSYNDROME Fallstricke bei der Diagnose Die Diagnose der verschiedenen Parkinsonsyndrome ist zunehmend sicherer geworden. Die Möglichkeit der Fehldiagnose besteht am ehesten in der Frühphase der
PARKINSONSYNDROME Fallstricke bei der Diagnose Die Diagnose der verschiedenen Parkinsonsyndrome ist zunehmend sicherer geworden. Die Möglichkeit der Fehldiagnose besteht am ehesten in der Frühphase der
Bildgebende Diagnostik bei Rücken- und Rumpfschmerzen
 Bildgebende Diagnostik bei Rücken- und Rumpfschmerzen Franca Wagner Universitätsinstitut für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie 1 Diagnostikziele - Ursachenabklärung der Beschwerden - Objektivierung
Bildgebende Diagnostik bei Rücken- und Rumpfschmerzen Franca Wagner Universitätsinstitut für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie 1 Diagnostikziele - Ursachenabklärung der Beschwerden - Objektivierung
Einflussfaktoren von Ernährung, Bildung und Lebensumstände auf das Altern und deren Korrelate in der modernen Neurobildgebung.
 marsilius kolleg Einflussfaktoren von Ernährung, Bildung und Lebensumstände auf das Altern und deren Korrelate in der modernen Neurobildgebung Marco Essig Auszug aus dem Jahresbericht Marsilius-Kolleg
marsilius kolleg Einflussfaktoren von Ernährung, Bildung und Lebensumstände auf das Altern und deren Korrelate in der modernen Neurobildgebung Marco Essig Auszug aus dem Jahresbericht Marsilius-Kolleg
MRT axillärer Lymphknoten mit USPIO-Kontrastmittel: Histopathologische Korrelation und Wertigkeit
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Diagnostische Radiologie Der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. Dr. math. R.P. Spielmann) MRT axillärer Lymphknoten mit USPIO-Kontrastmittel:
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Diagnostische Radiologie Der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. Dr. math. R.P. Spielmann) MRT axillärer Lymphknoten mit USPIO-Kontrastmittel:
Parkinson-Syndrome. Therapie und Verlauf neurologischer Erkrankungen. Kohlhammer. J.B. Schulz, T. Gasser. Kapitel I1 aus
 J.B. Schulz, T. Gasser Parkinson-Syndrome ISBN 978-3-17-024559-4 Kapitel I1 aus T. Brandt, H.C. Diener, C. Gerloff (Hrsg.) Therapie und Verlauf neurologischer Erkrankungen 6., vollständig überarbeitete
J.B. Schulz, T. Gasser Parkinson-Syndrome ISBN 978-3-17-024559-4 Kapitel I1 aus T. Brandt, H.C. Diener, C. Gerloff (Hrsg.) Therapie und Verlauf neurologischer Erkrankungen 6., vollständig überarbeitete
Neue diagnostische Kriterien. Warum früh diagnostizieren? Wie sicher! - diagnostizieren?
 Neue diagnostische Kriterien Warum früh diagnostizieren? Wie sicher! - diagnostizieren? MS-Forum Buchholz 14.Juni 2008 Warum Früh? chronische Erkrankung bleibende Behinderungen Berufsunfähigkeit Psychische
Neue diagnostische Kriterien Warum früh diagnostizieren? Wie sicher! - diagnostizieren? MS-Forum Buchholz 14.Juni 2008 Warum Früh? chronische Erkrankung bleibende Behinderungen Berufsunfähigkeit Psychische
Anlage 1 zur Anlage 7 zum Honorarvertrag 2017 Liste der chronischen Erkrankungen zur Förderung im hausärztlichen Versorgungsbereich
 Anlage 1 zur Anlage 7 zum Honorarvertrag 2017 Liste der chronischen Erkrankungen zur Förderung im hausärztlichen Versorgungsbereich Bereich I: Schilddrüsen-Erkrankungen E01.8 Sonstige jodmangelbedingte
Anlage 1 zur Anlage 7 zum Honorarvertrag 2017 Liste der chronischen Erkrankungen zur Förderung im hausärztlichen Versorgungsbereich Bereich I: Schilddrüsen-Erkrankungen E01.8 Sonstige jodmangelbedingte
Patienten können von früherem Behandlungsbeginn profitieren
 Morbus Parkinson Patienten können von früherem Behandlungsbeginn profitieren Düsseldorf (24. September 2015) - Erhaltung der Selbstständigkeit in den Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) und der gesundheitsbezogenen
Morbus Parkinson Patienten können von früherem Behandlungsbeginn profitieren Düsseldorf (24. September 2015) - Erhaltung der Selbstständigkeit in den Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) und der gesundheitsbezogenen
Klinische Neurologie. Herausgegeben von Thomas Brandt, Reinhard Hohlfeld, Johannes Noth und Heinz Reichmann
 Klinische Neurologie Herausgegeben von Thomas Brandt, Reinhard Hohlfeld, Johannes Noth und Heinz Reichmann Johannes Schwarz Alexander Storch Parkinson-Syndrome Grundlagen, Diagnostik und Therapie Verlag
Klinische Neurologie Herausgegeben von Thomas Brandt, Reinhard Hohlfeld, Johannes Noth und Heinz Reichmann Johannes Schwarz Alexander Storch Parkinson-Syndrome Grundlagen, Diagnostik und Therapie Verlag
AKTUELLES ZUR DEMENZDIAGNOSTIK
 AKTUELLES ZUR DEMENZDIAGNOSTIK GHF am Medizinische Diagnostik 2 Biomarker Cerebrale Atrophien (MRT) Cerebraler Hypometabolismus (PET) Liquor Erhöhte Konzentration Abeta 42 (Amyloidprotein) Erhöhte Konzentraion
AKTUELLES ZUR DEMENZDIAGNOSTIK GHF am Medizinische Diagnostik 2 Biomarker Cerebrale Atrophien (MRT) Cerebraler Hypometabolismus (PET) Liquor Erhöhte Konzentration Abeta 42 (Amyloidprotein) Erhöhte Konzentraion
Violent persons with schizophrenia and comorbid disorders: A functional magnetic resonance imaging study (Joyal et al., 2007)
 Violent persons with schizophrenia and comorbid disorders: A functional magnetic resonance imaging study (Joyal et al., 2007) Seminar: Forensische Neuropsychologie Referentin: Sarah Brettnacher Datum:
Violent persons with schizophrenia and comorbid disorders: A functional magnetic resonance imaging study (Joyal et al., 2007) Seminar: Forensische Neuropsychologie Referentin: Sarah Brettnacher Datum:
TABELLE 5. Patienten und der Kontrollpatienten (Mann-Whitney)
 4. ERGEBNISSE Einleitend soll beschrieben werden, dass der in der semiquantitativen Analyse berechnete Basalganglien/Frontalcortex-Quotient der 123 Jod-IBZM-SPECT die striatale 123 Jod-IBZM- Bindung im
4. ERGEBNISSE Einleitend soll beschrieben werden, dass der in der semiquantitativen Analyse berechnete Basalganglien/Frontalcortex-Quotient der 123 Jod-IBZM-SPECT die striatale 123 Jod-IBZM- Bindung im
Mike P. Wattjes. Neuroradiologisches Seminar Schlaganfall - klinische Entscheidungsfindung
 Neuroradiologisches Seminar Schlaganfall - klinische Entscheidungsfindung Mike P. Wattjes Institut für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie Medizinische Hochschule Hannover Email: wattjes.mike@mh-hannover.de
Neuroradiologisches Seminar Schlaganfall - klinische Entscheidungsfindung Mike P. Wattjes Institut für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie Medizinische Hochschule Hannover Email: wattjes.mike@mh-hannover.de
Beurteilung der striatalen Dopamin-D2-Rezeptorblockade durch Neuroleptika mit Hilfe der
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Nuklearmedizin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktorin: Frau Prof. Dr. med. habil. T. Mende Beurteilung der striatalen Dopamin-D2-Rezeptorblockade
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Nuklearmedizin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktorin: Frau Prof. Dr. med. habil. T. Mende Beurteilung der striatalen Dopamin-D2-Rezeptorblockade
Geschlechtsunterschiede und der Einfluss von Steroidhormonen auf das sich entwickelnde menschliche Gehirn
 Kerstin Konrad LFG Klinische Neuropsychologie des Kindes- und Jugendalters Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapie Universitätsklinikum der RWTH Aachen Geschlechtsunterschiede und der
Kerstin Konrad LFG Klinische Neuropsychologie des Kindes- und Jugendalters Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapie Universitätsklinikum der RWTH Aachen Geschlechtsunterschiede und der
Lewy-Körperchen-Demenz und Parkinson-Demenz Informationen für Betroffene und Angehörige
 Lewy-Körperchen-Demenz und Parkinson-Demenz Informationen für Betroffene und Angehörige Lewy-Körperchen-Demenz (Dementia with Lewy Bodies, DLB) und Parkinson-Demenz (Parkinson s disease dementia, PDD)
Lewy-Körperchen-Demenz und Parkinson-Demenz Informationen für Betroffene und Angehörige Lewy-Körperchen-Demenz (Dementia with Lewy Bodies, DLB) und Parkinson-Demenz (Parkinson s disease dementia, PDD)
Homepage: Online-Datenbank mit Autoren- und Stichwortsuche
 SPECT in der Diagnostik von Parkinson-Syndromen Pirker W, Brücke T Journal für Neurologie Neurochirurgie und Psychiatrie 2004; 5 (2), 9-20 Homepage: www.kup.at/ JNeurolNeurochirPsychiatr Online-Datenbank
SPECT in der Diagnostik von Parkinson-Syndromen Pirker W, Brücke T Journal für Neurologie Neurochirurgie und Psychiatrie 2004; 5 (2), 9-20 Homepage: www.kup.at/ JNeurolNeurochirPsychiatr Online-Datenbank
männlich 75,7% Abb.1: Geschlechtsverteilung der PAVK Patienten
 5. Ergebnisse 5.1. Alters- und Geschlechtsverteilung Das untersuchte Krankengut umfasste 325 Patienten. 246 (75,7 %) waren männlichen, 79 (24,3 %) weiblichen Geschlechts (Abb. 1). Das Durchschnittsalter
5. Ergebnisse 5.1. Alters- und Geschlechtsverteilung Das untersuchte Krankengut umfasste 325 Patienten. 246 (75,7 %) waren männlichen, 79 (24,3 %) weiblichen Geschlechts (Abb. 1). Das Durchschnittsalter
Ultraschalldiagnostik ermöglicht Früherkennung der Parkinson-Krankheit
 Der neue Blick in das Gehirn Ultraschalldiagnostik ermöglicht Früherkennung der Parkinson-Krankheit Hamburg (23. Juni 2009) - Manchmal hilft der Zufall der Wissenschaft. So hat sich der Ultraschall in
Der neue Blick in das Gehirn Ultraschalldiagnostik ermöglicht Früherkennung der Parkinson-Krankheit Hamburg (23. Juni 2009) - Manchmal hilft der Zufall der Wissenschaft. So hat sich der Ultraschall in
Naturprodukt AtreMorine kann Parkinsonpatienten. Spanische Wissenschaftler finden heraus!
 Naturprodukt AtreMorine kann Parkinsonpatienten helfen? Spanische Wissenschaftler finden heraus! Datum : 18/11/2016 Ramón Cacabelos, Experte für neurodegenerative Erkrankungen und genomische Medizin, und
Naturprodukt AtreMorine kann Parkinsonpatienten helfen? Spanische Wissenschaftler finden heraus! Datum : 18/11/2016 Ramón Cacabelos, Experte für neurodegenerative Erkrankungen und genomische Medizin, und
in der industrialisierten Welt stark ansteigt und auch weiter ansteigen wird, ist mit einer weiteren Zunahme der Zahl der Betroffenen
 Vorwort Der Morbus Parkinson, also die Parkinson sche Krankheit (lat. Morbus = Krankheit), ist eine häufige neurologische Krankheit. Mit höherem Lebensalter steigt die Wahrscheinlichkeit, an dieser Erkrankung
Vorwort Der Morbus Parkinson, also die Parkinson sche Krankheit (lat. Morbus = Krankheit), ist eine häufige neurologische Krankheit. Mit höherem Lebensalter steigt die Wahrscheinlichkeit, an dieser Erkrankung
Das Alter hat nichts Schönes oder doch. Depressionen im Alter Ende oder Anfang?
 Das Alter hat nichts Schönes oder doch Depressionen im Alter Ende oder Anfang? Depressionen im Alter Gedanken zum Alter was bedeutet höheres Alter Depressionen im Alter Häufigkeit Was ist eigentlich eine
Das Alter hat nichts Schönes oder doch Depressionen im Alter Ende oder Anfang? Depressionen im Alter Gedanken zum Alter was bedeutet höheres Alter Depressionen im Alter Häufigkeit Was ist eigentlich eine
Silent Strokes. wie stumm, wie relevant, was tun?
 Silent Strokes wie stumm, wie relevant, was tun? Priv.-Doz. Dr. Christian Nolte Klinik für Neurologie, Stroke Unit, Charite Centrum für Schlaganfallforschung Berlin (CSB) christian.nolte@charite.de Silent
Silent Strokes wie stumm, wie relevant, was tun? Priv.-Doz. Dr. Christian Nolte Klinik für Neurologie, Stroke Unit, Charite Centrum für Schlaganfallforschung Berlin (CSB) christian.nolte@charite.de Silent
Update Demenz und Delir
 Update Demenz und Delir Thomas Duning Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität Münster Epidemiologie S3 Leitlinie 2009 2016 Therapie von Demenzerkrankungen
Update Demenz und Delir Thomas Duning Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität Münster Epidemiologie S3 Leitlinie 2009 2016 Therapie von Demenzerkrankungen
Einführung in die Neuroradiologie
 Einführung in die Neuroradiologie B. Turowski 2010 Neuroradiologie Neuroradiologie Diagnostik und Therapie von: Gehirn und Rückenmark = Neuro-Achse Hüll- und Stützstrukturen Kompetenz Frage einer 84-jährigen
Einführung in die Neuroradiologie B. Turowski 2010 Neuroradiologie Neuroradiologie Diagnostik und Therapie von: Gehirn und Rückenmark = Neuro-Achse Hüll- und Stützstrukturen Kompetenz Frage einer 84-jährigen
