Hemmnisse und Scheitern beim Einsatz von Bio-Lebensmitteln in der Außer-Haus- Verpflegung
|
|
|
- Rudolf Schwarz
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Hemmnisse und Scheitern beim Einsatz von Bio-Lebensmitteln in der Außer-Haus- Verpflegung Constraints and failure in using organic food within the eating out sector Jan NIESSEN, René JOHN und Jana RÜCKERT-JOHN 1 Zusammenfassung In den letzten Jahren waren sowohl die Außer-Haus-Verpflegung (AHV) als auch der Bio-Markt bedeutende Wachstumsbereiche der deutschen Lebensmittelwirtschaft. Der Einsatz von Bio-Produkten in der AHV stellt für viele Akteure eine besondere Herausforderung dar. Wurden bislang vor allem Best Practice Fälle untersucht, analysiert ein laufendes Forschungsprojekt auf Basis von Fallstudien Gründe für die Reduzierung oder Aufgabe des Bio-Einsatzes in AHV-Betrieben. Hemmnisse für den Bio-Einsatz sind vielfältig und komplex. Prozesse des organisationalen Scheiterns und Lernens sind wichtige Erfolgsfaktoren, die bislang kaum Gegenstand agrarökonomischer Forschung waren. Die Ergebnisse zeigen, dass die Lernfähigkeit der AHV-Akteure einen bedeutenden Einfluss auf den Erfolg bei der Überwindung betrieblicher Entwicklungshemmnisse haben kann. Schlagworte: Bio-Lebensmittel, Außer-Haus-Verpflegung, Organisationsentwicklung Summary Over the past few years, both the eating out (EO) sector and the organic food sector have been important growth segments of the German food industry. The use of organic foodstuff in EO as the synthesis of these two segments turns out to be a particular challenge Erschienen 2011 im Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökonomie, Band 19(2): On-line verfügbar:
2 62 Niessen, John und Rückert-John to many of the players involved. Whereas research to date mainly focused on best practice cases, this ongoing study analyses the causes for reduced or ceased use of organic food in EO establishments, based on case studies. Barriers to use organic products are diverse and complex. Processes of organisational failure and learning, and accordingly the learning ability of organisations are important success factors which scarcely have been subject of agro economic research yet. The results show that the learning ability of EO players can strongly influence their success in overcoming the barriers to operational development. Keywords: Organic Food, Eating-Out, Organisation Development 1. Einleitung und Hintergründe Seit der Jahrtausendwende sind sowohl die Außer-Haus-Verpflegung (AHV) als auch der Bio-Markt stark wachsende Bereiche der deutschen Lebensmittelwirtschaft. Der ebenfalls gestiegene Einsatz von Bio- Lebensmitteln in der AHV wurde in den letzten Jahren aus verschiedenen Perspektiven erforscht. Im Fokus standen der Status Quo des Bio-Einsatzes, Einführungskonzepte, Erfolgsfaktoren, Zertifizierungsbedingungen und damit v. a. Best Practice Beispiele (vgl. RÜCKERT-JOHN et al. 2005, 45 ff.). Im Rahmen eines aktuellen Forschungsprojekts 2 wird untersucht, welche Hemmnisse dazu führen, dass ein bestehender Einsatz von Bio- Produkten in der AHV verringert oder eingestellt wird. Dieses Scheitern des Bio-Einsatzes in den beforschten Organisationen fordert von selbigen Lösungen, um den Fortbestand der Gesamtorganisation zu sichern. Derartige (Lern-)Prozesse hängen von unterschiedlichen, teils komplexen internen und externen Strukturen und Gegebenheiten ab. Ziel dieses Beitrags ist es, mit der Darstellung von Hemmnissen beim Einsatz von Bio-Lebensmitteln in der AHV die Aspekte und Bedeutung der sog. Fehlerkultur und Lernreife (EBNER et al. 2008, 46 1 "Verstetigung des Angebots von Öko-Lebensmitteln in der Außer-Haus- Verpflegung: Analyse von Gründen für den Ausstieg und Ableitung präventiver Maßnahmen", gefördert durch das BMELV, Laufzeit ,
3 Hemmnisse und Scheitern beim Einsatz von Bio-Lebensmitteln in der AHV 63 ff.), und damit strukturelle Möglichkeiten der Organisationen zur Überwindung der Bio-Krise herauszustellen. 2. Theoretischer Hintergrund Mit der Ausgangsfrage nach dem Scheitern nimmt das Projekt in der Forschungslandschaft zu Organisationen wie auch zum Ökologischen Landbau eine Sonderstellung ein. Organisationen zeichnen sich dadurch aus, dass nur solche Entscheidungen erinnert werden, die sich als erfolgreich bewährt haben. Alle anderen Entscheidungen werden schlicht zu den Akten gelegt und vergessen. So können erst durch weitere Reformanstöße diese Entscheidungen erinnert und erneut thematisiert werden. Organisationen können also nur den Erfolg weiterführen, weil sich nur auf solche strukturrelevanten Entscheidungen hin weitere Entscheidungen treffen lassen (vgl. LUHMANN 2000). Der Ökologische Landbau, als dessen Bestandteil hier auch der Einsatz von biologischen Lebensmitteln in der AHV verstanden wird, ist angesichts seiner nach wie vor minoritären Stellung gegenüber dem konventionellen Landbau auf Erfolg abonniert. Gegenüber diesem muss sich der Anbau und Verkauf als marktkonform darstellen lassen, erst recht, wenn dieser von der Agrarpolitik als eine Lösungsstrategie zur nachhaltigen Lebensmittelproduktion und -konsumption gefordert wird. Somit erscheint die Frage nach dem Scheitern des Einsatzes biologischer Produkte in der AHV zunächst kontraproduktiv. Scheitern bietet jedoch die Chance, Lernpotenziale offen zulegen und diese für die Beratung von Organisationen der AHV aufzubereiten. Das Scheitern beim Einsatz von Bio-Produkten erscheint im Gegensatz zu den Erfolgsgeschichten immer kontingent, was heißt, dass es auch immer anders hätte kommen können. Sind die Erfolgsgeschichten darum in ihrer scheinbaren Notwendigkeit (richtiger Entscheidungen, breiter Unterstützung, eines passenden Umfeldes von Lieferanten und Kunden) immer spezifisch für den entsprechenden Fall, so bietet die Beobachtung des Scheiterns in seinen vielfältigen und kontingenten Formen Chancen der Verallgemeinerung, die auch außerhalb des Entstehungszusammenhanges Orientierung zu geben vermögen. Indem die Problemlagen im Interview herausgestellt werden, wird die inhärente Invisibilisierung der Entscheidungsprozesse und der sie
4 64 Niessen, John und Rückert-John tragenden Präferenzstruktur unterlaufen, weil die explizite Thematisierung durch Fragen eine Reflexion der Ereignisse in Gang setzt. Problematische, irritierende Situationen, die die gewohnten Abläufe der Organisation negieren, führen zu einer Thematisierung schematisierter Erwartungen. Diese können erst im Moment ihrer offensichtlichen Ungültigkeit auf ihre weitere mögliche Gültigkeit gegenüber Alternativen geprüft werden. Die Rhetorik der Reform und Innovation wird dann in Organisationen schnell bemüht, um ein Akzeptanzmilieu für unerwartete Entscheidungen und damit die vorläufige Etablierung von Erwartungsstrukturen zu schaffen. Scheitern bietet somit die Möglichkeit zur Reflexion, die über die Feststellung des Offensichtlichen hinausgeht. Erst im Angesicht des Scheiterns sind Varianten thematisierbar, mit denen alternative Entscheidungsmöglichkeiten sichtbar werden, die auf konkrete Umstände bezogen werden können. Dann ist Lernen möglich, das nicht als schlichte Übertragung von Wissensbeständen, sondern immer nur als die eigensinnige Transformation von Informationen hinsichtlich eigener, spezifischer Kontexte zu verstehen ist (WILLKE 2002, 14). Lernen kann nur im eigenen Sinnanschluss aufgrund relevanter, d. h. informativer Varianz geschehen. Die Relevanz des Lernens erschließt sich in der Organisation bei der Beobachtung ihrer spezifischen Strukturelemente, die im Wesentlichen als Programm, Kommunikationsweg und Person zu beschreiben sind. Ausgehend von der internen Differenzierung der Organisation, die meistens je nach Größe in ihrer Komplexität variiert, sind Abteilungen mit verschiedenen Zweckprogrammen zu unterscheiden, die jedoch alle der primären programmatischen Selbstbeschreibung der Organisation folgen (TACKE 2001, 150 ff.; LIECKWEG und WERSIG 2001, 43). All diese Strukturelemente werden immer spezifisch in Stellen der Organisation gebündelt, so dass Kommunikation adressiert und z. B. Verantwortung personifiziert werden kann. Immer an spezifischen Stellen erfolgt die Kommunikation einerseits organisationsintern mit Mitarbeitern und Vorgesetzten und anderseits im Umweltkontakt mit Lieferanten und Kunden. Die an den verschiedenen, hierarchisch gestuften Zweckprogrammen orientierte Kommunikation erfolgt keinesfalls konfliktfrei, doch muss sie immer zu Entscheidungen führen. Den durch die Thematisierung des Scheiterns des Bio-
5 Hemmnisse und Scheitern beim Einsatz von Bio-Lebensmitteln in der AHV 65 Produkteinsatzes explizierten Geschichten der Entscheidungen gilt die empirische Aufmerksamkeit des hier vorgestellten Projektes. Als temporärer Moment des Scheiterns kommt aus evolutionstheoretischer Perspektive das Stadium der Restabilisierung in Frage. Die aus spezifischen Umweltirritationen gewonnenen Informationen provozieren Variationen des Ablaufs von Organisationsprozessen. Aus diesen Reaktionsmöglichkeiten auf als relevant erkannte Umweltveränderungen muss eine zukunftsfähige Routine per Entscheidung gewählt werden. Damit aber ist die Lage der Organisation noch nicht gegenüber der Umwelt gesichert. Die neuen Strukturelemente müssen sich nämlich erst noch ihr gegenüber als erwartungskonform und damit stabil erweisen, was als Restabilisierung zu beobachten ist. Erst hier erweist sich die gewählte Entscheidung als falsch oder richtig, erst hier kann sich die Organisation mit ihrer geplanten Absicht als gescheitert wahrnehmen und auf diese Irritation mit einem weiteren Evolutionszyklus lernend antworten, um letztlich das eigene Überleben sicher zu stellen (vgl. JOHN 2005, 59). 3. Empirie und Methoden Empirisch konzentriert sich das Projekt auf Organisationsfallstudien, mit denen möglichst realistische und ganzheitliche Bilder der Fälle erfasst werden (LAMNEK 1995, 4 ff.). Hierzu konnten 21 Fälle gewonnen werden, die verschiedene Betriebstypen der AHV im deutschen Bundesgebiet abbilden. Diese Betriebe haben in der Vergangenheit Bio- Produkte eingesetzt und diesen Einsatz eingestellt oder reduziert. Die AHV-Betriebe lassen sich den Bereichen der Individualverpflegung (IV), wie Restaurants oder Systemgastronomie, und der Gemeinschaftsverpflegung (GV), wie Betriebsverpflegung oder Mensen, zuordnen. Diese Kriterien lagen der Auswahl und Akquise der Fälle zugrunde. Die Fall-Akquise stellte eine besondere Herausforderung an das Forscherteam, da kein Betrieb von sich aus kommuniziert, den Bio-Einsatz zu reduzieren oder insgesamt aufzugeben. Die empirische Basis bildeten Leitfadeninterviews mit Akteuren in leitender Funktion der Organisation. Als Datengrundlage für die hier dargestellten Forschungsergebnisse dienten Interviews von sieben
6 66 Niessen, John und Rückert-John Betrieben der IV und zwölf der GV. Die qualitativen Leitfadeninterviews wurden transkribiert und inhaltsanalytisch nach MAYRING (2003) ausgewertet. Vor dem Hintergrund der skizzierten organisationstheoretischen Überlegungen zum Scheitern und Lernen wurden allgemeine Strukturprobleme als Problemgesichtspunkte für eine funktionale Analyse identifiziert sowie fallübergreifend und -abstrahierend verglichen. Erst damit waren die methodischen Schwierigkeiten zu bearbeiten, die im Forschungsverlauf typischerweise auftraten. Eine Herausforderung bestand darin, Tendenzen der Affektlogik des Scheiterns wie Verleugnung, Abwehr, externe Schuldzuschreibung, Scham und Enttäuschung (vgl. GÖSSLER 2007, 8 f.) zu berücksichtigen. Diese sind theoretisch und methodisch als Effekte sozialer Erwünschtheit zu diskutieren (John 2009, 12 ff.). Aufgrund der im Scheitern zum Ausdruck kommenden Negation der Maximalwerte Ökologie und wirtschaftlicher Erfolg sind hier insbesondere Rechtfertigungsstrategien als Mittel der Selbstdarstellung zu registrieren. Für die Analyse erschweren diese jedoch zwischen organisationsexternen und -internen Ursachen des Scheiterns zu unterscheiden. Allein im Absehen vom konkreten Fall mittels funktionaler Analyse sind diese Probleme zu lösen. Für die Beobachtung des Umgangs mit dem Scheitern, sind die Wahrnehmung der Probleme hinsichtlich der Organisationsstruktur und ihrer Umwelt sowie die daraufhin erneut einsetzenden variierenden (Lern-)Prozesse zur Überwindung des Scheiterns zu analysieren. Dabei stellen die Ausprägungen der Dimensionen des organisationalen Lernens wie Selbstreflexion, Problemzuschreibung, Umweltsensibilität, Umgang mit Wissen und Kooperation (EBNER 2008, 99) wichtige Anhaltspunkte dar. 4. Ergebnisse Hemmnisse für den Bio-Einsatz der Organisationen stellen sich unterschiedlich, vielschichtig und komplex dar, in Abhängigkeit von den Strukturen und Umweltbeziehungen. So können quantitative und qualitative Beschaffungsprobleme biologischer Lebensmittel für AHV- Betriebe externe Hemmnisse darstellen, die teilweise jedoch auch intern bedingt oder verstärkt werden können. Auf Enttäuschungen
7 Hemmnisse und Scheitern beim Einsatz von Bio-Lebensmitteln in der AHV 67 über mangelnde Serviceorientierung, unzureichende Liefermengen oder Produktqualitäten bei Bio-Lieferanten folgt, insbesondere bei GV- Betrieben, eine Aufgabe oder Reduzierung des Bio-Einsatzes. War der Einsatz von Bio-Produkten als neuer Programmbestandteil der Küche oder gar der Organisation vorgesehen, musste von den verantwortlichen Stellen auf die Probleme reagiert werden. Lösungsmöglichkeiten waren neben Reduzierung der oder Verzicht auf Bio-Produkte die Wahl anderer Mehrwertargumente wie regionale Produktherkunft oder artgerechte Tierhaltung bei Fleisch. Besonders deutlich wurde die kontraproduktive Wirkung der Enttäuschung dadurch, dass die Mehrheit der Akteure keine Informationen über neue Dienstleistungen, Produktentwicklungen, Beratungsangebote oder Beschaffungsmöglichkeiten eingeholt hatte. Dabei war in den letzten Jahren eine positive Marktentwicklung und -ausdifferenzierung hin zu spezialisierten Bio-AHV-Lieferanten sowie verstärkten Beratungs- und Kommunikationsangeboten, z. B. seitens der Centralen Markt- und Preisberichtsstelle, festzustellen. Eine geringe Nachfrage nach Bio-Speisen wird teilweise als intern, jedoch größtenteils als extern bedingt wahrgenommen. Häufig bleibt die Nachfrage nach Bio-Speisen hinter dem zuvor geäußerten Wunsch der Gäste zurück. Dies führt teilweise zu Enttäuschungen der AHV- Akteure über ihre Gäste und damit zu einer Externalisierung der Problemursachen. Andere Akteure sahen das niedrige Nachfrageniveau jedoch auch durch eigene Kommunikationsdefizite hinsichtlich des Bio-Angebots bedingt. Diese werden dann wiederum internen Kapazitätslimitationen für eine adäquate Kommunikationspolitik zugeschrieben. In diesen letztgenannten Fällen, die ein Reflektieren der Problemlagen verdeutlichen, wurde trotz geringer Kapazitäten nach Wegen und Lösungen für eine Stärkung der Kommunikation gesucht. Dadurch ist es zwei GV- Betrieben gelungen, ihr Bio-Angebot, welches zwischenzeitlich stark reduziert oder eingestellt worden war, wieder auszuweiten. Auch ist eine Reduzierung der Essenszahlen von Bio-Speisen eine pragmatische Lösung, um eine Übereinstimmung von Angebot und Nachfrage zu erreichen. Die höheren Preise der Bio-Lebensmittel im Einkauf stellen insbesondere GV-Betriebe mit engem Budgetrahmen und festgelegten Essenspreisen (z. B. Betriebskantinen oder Krankenhäuser) vor
8 68 Niessen, John und Rückert-John Herausforderungen. Hierbei zeigt sich, dass ein kleinerer Teil der betroffenen Betriebe den Bio-Anteil stark reduziert oder aufgibt, der größere Teil jedoch lernt, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Beispielsweise wird häufig auf Bio-Fleisch verzichtet oder statt Bio- Menüs werden lediglich einzelne (preisgünstige) Bio-Komponenten angeboten. Solche stabilisierenden Maßnahmen sichern dann nicht nur den Fortbestand der Organisation, sondern darüber hinaus auch den des Bio-Einsatzes. Deshalb können diese Maßnahmen als organisationale Lerneffekte angesehen werden. Ähnliche Maßnahmen werden auch von Beratern empfohlen, ohne das damit Erfolg garantiert wäre. Wie sich hier zeigt, reicht solch offeriertes Wissen nicht aus. Entscheidend ist, dass solche Informationen an die in der Organisation gemachten Erfahrungen anschließen, um Struktureffekte zu erreichen. Ist die Möglichkeit gegeben, höhere Einkaufspreise über die Bio-Speisen an die Gäste weiter zu geben, führt dies wiederum häufig zu einer schwächeren Nachfrage, was sich wiederum negativ auf den Bio-Einsatz auswirken kann. Anforderungen der Bio-Zertifizierung werden insbesondere von kleinen Unternehmen als externe Hemmnisse wahrgenommen, mit denen je nach Situation unterschiedlich lösungsorientiert umgegangen wird. Ein nicht lösbares Problem scheint für einige Akteure in der mangelnden Fähigkeit bestimmter Mitarbeiter (Praktikanten, Geringqualifizierte oder Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen) hinsichtlich einer zuverlässigen Einhaltung der Zertifizierungsvorschriften zu liegen. Da diese Menschen weiter beschäftigt bleiben sollen, können Bio-Produkte nur ohne Zertifizierung des Betriebes und damit ohne Auslobung der Bio- Qualität verwendet werden. In der gehobenen Gastronomie wird beim Auftreten von Problemen mit Bio (z. B. Zuverlässigkeit der Belieferung) häufiger die Bio-Zertifizierung und damit auch die Bio- Kommunikation eingestellt, Bio-Lebensmittel aber aufgrund hoher Produktqualitäten grundsätzlich weiterhin eingesetzt oder durch regionale Produkte und Spezialitäten ersetzt. 5. Diskussion und Ausblick Beratung und Förderangebote bezüglich des Einsatzes von Bio- Lebensmitteln in der AHV sollten zukünftig den Stand der
9 Hemmnisse und Scheitern beim Einsatz von Bio-Lebensmitteln in der AHV 69 Organisationsentwicklung und die Lernpotenziale innerhalb der Organisation stärker berücksichtigen. Dies ist zu betonen, da nach dem Scheitern des Bio-Einsatzes lediglich in zwei untersuchten GV- Betrieben und in keiner der IV-Betriebe nach einem kriseninduzierten Lernprozess Bio-Lebensmittel wieder verstärkt eingesetzt worden sind. Die Reflektion der jeweiligen Problemlagen durch die Akteure selbst erweist sich als geeigneter Indikator für eine produktive Lernkultur. Ein professioneller und reflektierter Umgang der Verantwortlichen mit der Problematik bedeutete für die jeweilige Organisation eine vergleichsweise rasche erneute Stabilisierung. Dies stellt eine wesentliche Bedingung für das Fortbestehen der Organisation dar, mit oder ohne Bio-Produkte. Insbesondere in Organisationen der GV, wie Schulen und Kindertagesstätten, wird unter dem Aspekt gesunder Ernährung sowie der Stärkung von Ernährungskompetenz ein verstärkter Einsatz von Bio-Lebensmitteln diskutiert. Dem stehen jedoch häufig enge Budgetrahmen gegenüber, weshalb sich die Beachtung und Förderung organisationaler Lernprozesse als interne Erfolgsfaktoren anbietet. In der Betriebsverpflegung gilt es ebenfalls häufig, einen Spagat zwischen Budgetrahmen und zunehmend gesundheitsorientierten Ernährungsangeboten zu vollziehen. Hier, wie auch in IV-Betrieben der gehobenen Gastronomie, führen Lerneffekte aus gescheiterten Bio- Projekten teils zur Wahl konventioneller regionaler Lebensmittel- Angebote. Die vorliegenden Forschungsergebnisse können wichtige Hinweise geben, um künftig Lernprozesse konstruktiv zu nutzen. Damit können interne Hemmfaktoren erkannt, verringert und der Bio- Lebensmitteleinsatz in Organisationen der AHV so gestaltet werden, dass er internen und externen Bedingungen unter Berücksichtigung von Chancen und Risiken gerecht wird. Literatur EBNER, G.; HEIMERL, P. und SCHÜTTELKOPF, E. M. (2008): Fehler Lernen Unternehmen. Wie Sie die Fehlerkultur und Lernreife Ihrer Organisation wahrnehmen und gestalten. Frankfurt (Main): Peter Lang. GÖSSLER, M. (2007): Die Kunst des Scheiterns. In: Zeitschrift für Organisationsentwicklung, 2007, Nr. 1, S JOHN, R. (2005): Innovation als irritierende Neuheit. Evolutionstheoretische Perspektiven. In: Aderhold, J. und John, R. (Hrsg.). Innovation. Sozialwissenschaftliche Perspektiven. Konstanz: UVK. S
10 70 Niessen, John und Rückert-John JOHN, R. (2009): Positive Werteerwartung als Problem qualitativer Sozialforschung. Vita rustica & Vita urbana 3. Stuttgart: Universität Hohenheim (430c). LAMNEK, S. (1995): Qualitative Sozialforschung. Band 2. Methoden und Techniken. 3. Auflage. Weinheim: Belz. LIECKWEG, T. und WERSIG, C. (2001): Zur komplementären Ausdifferenzierung von Organisationen und Funktionssystemen. Perspektiven einer Gesellschaftstheorie der Organisation. In: Tacke, V. (Hrsg.). Organisation und gesellschaftliche Differenzierung. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. S LUHMANN, N. (2000): Organisation und Entscheidung. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. MAYRING, P. (2003): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 8. Auflage. Weinheim und Basel: Beltz. RÜCKERT-JOHN, J.; HUGGER, C. und BANSBACH, P. (2005): Der Einsatz von Öko- Produkten in der Außer-Haus-Verpflegung (AHV): Status Quo, Hemmnisse und Erfolgsfaktoren, Entwicklungschancen sowie politischer Handlungsbedarf. In: Geschäftsstelle Bundesprogramm Ökologischer Landbau in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Hrsg.). TACKE, V. (2001): Funktionale Differenzierung als Schema der Beobachtung. In: Tacke, V. (Hrsg.). Organisation und gesellschaftliche Differenzierung. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag: WILLKE, H. (2002): Dystopia. Studie zur Krisis des Wissens in der modernen Gesellschaft, Frankfurt (Main): Suhrkamp. Anschriften der Verfasser Dr. Jan Niessen Universität Hohenheim (420b) D Stuttgart Tel.: Dr. René John Leibniz Universität Hannover Institut für pädagogische Psychologie Schloßwender Straße 1 D Hannover Tel.: john@psychologie.uni-hannover.de Dr. Jana Rückert-John Universität Hohenheim (430b&799) D Stuttgart Tel.: rueckert@uni-hohenheim.de
Stand der Forschung. Gliederung
 19. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökonomie Innsbruck 24. September 2008 Hemmnisse beim Einsatz von Bio-Lebensmitteln in der Außer-Haus-Verpflegung vor dem Hintergrund organisationalen
19. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökonomie Innsbruck 24. September 2008 Hemmnisse beim Einsatz von Bio-Lebensmitteln in der Außer-Haus-Verpflegung vor dem Hintergrund organisationalen
Fehler Lernen Unternehmen
 Gabriele Ebner Peter Heimerl Elke M. Schüttelkopf Fehler Lernen Unternehmen Wie Sie die Fehlerkultur und Lernreife Ihrer Organisation wahrnehmen und gestalten PETER LANG Frankfurt am Main Berlin Bern Bruxelles
Gabriele Ebner Peter Heimerl Elke M. Schüttelkopf Fehler Lernen Unternehmen Wie Sie die Fehlerkultur und Lernreife Ihrer Organisation wahrnehmen und gestalten PETER LANG Frankfurt am Main Berlin Bern Bruxelles
Reflexion als Voraussetzung für Kompetenz- und Organisationsentwicklung in der wissensintensiven Arbeit
 Reflexion als Voraussetzung für Kompetenz- und Organisationsentwicklung in der wissensintensiven Arbeit Vortrag auf der 5. Österreichischen Berufsbildungsforschungskonferenz in Steyr Freitag, 08. Juli
Reflexion als Voraussetzung für Kompetenz- und Organisationsentwicklung in der wissensintensiven Arbeit Vortrag auf der 5. Österreichischen Berufsbildungsforschungskonferenz in Steyr Freitag, 08. Juli
Die Zukunft auf dem Tisch. Konzepte für die Gemeinschaftsgastronomie
 Die Zukunft auf dem Tisch. Konzepte für die Gemeinschaftsgastronomie WORKSHOP 4 Jana Rückert John & Marion Messik, PariSERVE Fachtagung, 1. Juni 2015 Workshop: Ziel Vor dem Hintergrund aktueller Trends
Die Zukunft auf dem Tisch. Konzepte für die Gemeinschaftsgastronomie WORKSHOP 4 Jana Rückert John & Marion Messik, PariSERVE Fachtagung, 1. Juni 2015 Workshop: Ziel Vor dem Hintergrund aktueller Trends
Auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Profiküche
 Auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Profiküche Praktisches Nachhaltigkeitsmanagement in der Außer-Haus-Verpflegung 1 Herausforderungen für die Außer-Haus-Verpflegung heute Die Diskussionen über Klimawandel
Auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Profiküche Praktisches Nachhaltigkeitsmanagement in der Außer-Haus-Verpflegung 1 Herausforderungen für die Außer-Haus-Verpflegung heute Die Diskussionen über Klimawandel
Zurich Open Repository and Archive. Anatomie von Kommunikationsrollen. Methoden zur Identifizierung von Akteursrollen in gerichteten Netzwerken
 University of Zurich Zurich Open Repository and Archive Winterthurerstr. 190 CH-8057 Zurich http://www.zora.uzh.ch Year: 2008 Anatomie von Kommunikationsrollen. Methoden zur Identifizierung von Akteursrollen
University of Zurich Zurich Open Repository and Archive Winterthurerstr. 190 CH-8057 Zurich http://www.zora.uzh.ch Year: 2008 Anatomie von Kommunikationsrollen. Methoden zur Identifizierung von Akteursrollen
Organisationsentwicklung und Wissensmanagement in Pflegeeinrichtungen
 Organisationsentwicklung und Wissensmanagement in Pflegeeinrichtungen - von Einzelinterventionen zur Breitenwirkung - Manfred Borutta Amt für Altenarbeit Gliederung: I. Aspekte des Wissens II. Thesen:
Organisationsentwicklung und Wissensmanagement in Pflegeeinrichtungen - von Einzelinterventionen zur Breitenwirkung - Manfred Borutta Amt für Altenarbeit Gliederung: I. Aspekte des Wissens II. Thesen:
SUE-Projekt: Zukunft. Global. Denken. SDGs fairbinden! Think globally! Act locally!
 Zeit: 90 Minuten Zielgruppe: 9.-12. Jahrgang Abkürzungen EA = Einzelarbeit GA = Gruppenarbeit UG = Unterrichtsgespräch LK = Lehrkraft SuS =Schüler*innen Thema Begrüßung und Einstieg Folien- Inhalt Methodik
Zeit: 90 Minuten Zielgruppe: 9.-12. Jahrgang Abkürzungen EA = Einzelarbeit GA = Gruppenarbeit UG = Unterrichtsgespräch LK = Lehrkraft SuS =Schüler*innen Thema Begrüßung und Einstieg Folien- Inhalt Methodik
Schullehrplan Sozialwissenschaften BM 1
 Schullehrplan Sozialwissenschaften BM 1 1. Semester Wahrnehmung Emotion und Motivation Lernen und Gedächtnis Kommunikation - den Begriff der Wahrnehmung und ihre verschiedenen Dimensionen erklären (Sinneswahrnehmung,
Schullehrplan Sozialwissenschaften BM 1 1. Semester Wahrnehmung Emotion und Motivation Lernen und Gedächtnis Kommunikation - den Begriff der Wahrnehmung und ihre verschiedenen Dimensionen erklären (Sinneswahrnehmung,
INNOVATION VON INNEN AUSZUG LEISTUNGSSPEKTRUM 2018/19
 INNOVATION VON INNEN AUSZUG LEISTUNGSSPEKTRUM 2018/19 AUS UNSEREM AKADEMIE-BEREICH Design Thinking in a nutshell Kennenlernen des Design Thinking Prozesses und Sensibilisierung für nutzerzentriertes Denken
INNOVATION VON INNEN AUSZUG LEISTUNGSSPEKTRUM 2018/19 AUS UNSEREM AKADEMIE-BEREICH Design Thinking in a nutshell Kennenlernen des Design Thinking Prozesses und Sensibilisierung für nutzerzentriertes Denken
Regional und Artgerecht
 Regional und Artgerecht Wie können Kantinen die aktuellen Gästewünsche umsetzen? Rainer Roehl, Geschäftsführer, a verdis Inhalt 1. Herausforderungen für gastronomische Dienstleistungen heute 2. Transparente
Regional und Artgerecht Wie können Kantinen die aktuellen Gästewünsche umsetzen? Rainer Roehl, Geschäftsführer, a verdis Inhalt 1. Herausforderungen für gastronomische Dienstleistungen heute 2. Transparente
Ökobarometer Repräsentative Bevölkerungsbefragung im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)
 Ökobarometer 2007 Repräsentative Bevölkerungsbefragung im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) Pleon Kohtes Klewes Bonn, 07.02.2007 Untersuchungsmethode
Ökobarometer 2007 Repräsentative Bevölkerungsbefragung im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) Pleon Kohtes Klewes Bonn, 07.02.2007 Untersuchungsmethode
Change-Management. Veränderungsinitiativen erfolgreich steuern
 Rixa Regina Kroehl Change-Management Veränderungsinitiativen erfolgreich steuern 2., unveränderte Auflage UVK Verlagsgesellschaft mbh Konstanz und München Veränderungsmanagement wirft Probleme auf 12 Was
Rixa Regina Kroehl Change-Management Veränderungsinitiativen erfolgreich steuern 2., unveränderte Auflage UVK Verlagsgesellschaft mbh Konstanz und München Veränderungsmanagement wirft Probleme auf 12 Was
Anforderungen an die Küche von morgen Strategien und zukunftsweisende Versorgungskonzepte
 Fachtagung 2011: Brennpunkt Ernährung Aufgaben für morgen ich bin hocherfreut!!!!! Anforderungen an die Küche von morgen Strategien und zukunftsweisende Versorgungskonzepte Prof. Dr. Stephanie Hagspihl
Fachtagung 2011: Brennpunkt Ernährung Aufgaben für morgen ich bin hocherfreut!!!!! Anforderungen an die Küche von morgen Strategien und zukunftsweisende Versorgungskonzepte Prof. Dr. Stephanie Hagspihl
Inhalt 1. Einleitung: Kontrollverlust durch Social Media? Unternehmenskommunikation als wirtschaftliches Handeln 21
 Inhalt Vorwort 11 1. Einleitung: Kontrollverlust durch Social Media? 15 1.1 Forschungsinteresse: Social Media und Anpassungen des Kommunikationsmanagements 16 1.2 Vorgehensweise der Untersuchung 18 2.
Inhalt Vorwort 11 1. Einleitung: Kontrollverlust durch Social Media? 15 1.1 Forschungsinteresse: Social Media und Anpassungen des Kommunikationsmanagements 16 1.2 Vorgehensweise der Untersuchung 18 2.
Das Expertennetzwerk Nachhaltige Ernährung (ENE)
 UGB-Tagung Ernährung aktuell, Gießen, 10. 5. 2019 Das Expertennetzwerk Nachhaltige Ernährung (ENE) info@ene.network Dr. oec. troph. Karl von Koerber Arbeitsgruppe Nachhaltige Ernährung e. V., München Vorgeschichte
UGB-Tagung Ernährung aktuell, Gießen, 10. 5. 2019 Das Expertennetzwerk Nachhaltige Ernährung (ENE) info@ene.network Dr. oec. troph. Karl von Koerber Arbeitsgruppe Nachhaltige Ernährung e. V., München Vorgeschichte
Qualität in der regionalen Ernährungsproduktion 12. Netzwerkstatt Lernende Regionen
 Qualität in der regionalen Ernährungsproduktion 12. Netzwerkstatt Lernende Regionen Birgit Neuhold 22. Jänner 2015 Agenda Regionale Lebensmittel Ergebnisse der Marktforschung Qualität was ist das? AMA-Handwerksiegel
Qualität in der regionalen Ernährungsproduktion 12. Netzwerkstatt Lernende Regionen Birgit Neuhold 22. Jänner 2015 Agenda Regionale Lebensmittel Ergebnisse der Marktforschung Qualität was ist das? AMA-Handwerksiegel
Betriebspraktika ein Beitrag zur Entwicklung eines Qualitätsmodells
 Betriebspraktika ein Beitrag zur Entwicklung eines Qualitätsmodells 5. Österreichischer Wipäd-Kongress Wirtschaftsuniversität Wien 1. April 2011 Perspektive Lernende überschreiten beim Wechsel zwischen
Betriebspraktika ein Beitrag zur Entwicklung eines Qualitätsmodells 5. Österreichischer Wipäd-Kongress Wirtschaftsuniversität Wien 1. April 2011 Perspektive Lernende überschreiten beim Wechsel zwischen
1 Einleitung. Heute weiß man von allem den Preis, von nichts den Wert. Oscar Wilde
 1 Heute weiß man von allem den Preis, von nichts den Wert. Oscar Wilde 1 Einleitung 1.1 Zielsetzung und Vorgehensweise der Untersuchung Unternehmensbewertungen sind für verschiedene Anlässe im Leben eines
1 Heute weiß man von allem den Preis, von nichts den Wert. Oscar Wilde 1 Einleitung 1.1 Zielsetzung und Vorgehensweise der Untersuchung Unternehmensbewertungen sind für verschiedene Anlässe im Leben eines
Vermeidung von Lebensmittel- und Speiseabfällen beim (Veranstaltungs-)Catering. a verdis - Profil. Präsentation Rainer Roehl 1
 Vermeidung von Lebensmittel- und Speiseabfällen beim (Veranstaltungs-)Catering Rainer Roehl, a verdis, Münster a verdis - Profil ( ) Wir sichten, übersetzen und bewerten wissenschaftliche Erkenntnisse,
Vermeidung von Lebensmittel- und Speiseabfällen beim (Veranstaltungs-)Catering Rainer Roehl, a verdis, Münster a verdis - Profil ( ) Wir sichten, übersetzen und bewerten wissenschaftliche Erkenntnisse,
Univ.-Prof. Dr. Martin K.W. Schweer :: Hochschule Vechta - Universität : ISBS: Zentrum für Vertrauensforschung
 Vertrauen als Organisationsprinzip in Veränderungsprozessen Vortrag im Rahmen des Expertenworkshops Organisationale Achtsamkeit: Ein Gestaltungskonzept für betriebliche Veränderungsprozesse Bremen, 18.
Vertrauen als Organisationsprinzip in Veränderungsprozessen Vortrag im Rahmen des Expertenworkshops Organisationale Achtsamkeit: Ein Gestaltungskonzept für betriebliche Veränderungsprozesse Bremen, 18.
Soziale Normen nachhaltiger Ernährung und Chancen für Veränderungen von Alltagpraktiken. Jana Rückert-John
 Soziale Normen nachhaltiger Ernährung und Chancen für Veränderungen von Alltagpraktiken Jana Rückert-John Konsumentenperspektive in der Agrarwende Verbraucherorientierung: Verbraucher anstatt Verbrauch
Soziale Normen nachhaltiger Ernährung und Chancen für Veränderungen von Alltagpraktiken Jana Rückert-John Konsumentenperspektive in der Agrarwende Verbraucherorientierung: Verbraucher anstatt Verbrauch
Dr. Immanuel Stieß ISOE Institut für sozial-ökologische Forschung, Frankfurt am Main
 Bester Freund oder kritische Begleiterin? Gegenseitige Lernprozesse zwischen Wissenschaft und Zivilgesellschaft für nachhaltigen Konsum: der Beitrag der transdisziplinären Nachhaltigkeitsforschung Dr.
Bester Freund oder kritische Begleiterin? Gegenseitige Lernprozesse zwischen Wissenschaft und Zivilgesellschaft für nachhaltigen Konsum: der Beitrag der transdisziplinären Nachhaltigkeitsforschung Dr.
Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung
 Geisteswissenschaft Sarah Nolte Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Studienarbeit Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Sarah Nolte Universität zu Köln 1. Einleitung...1
Geisteswissenschaft Sarah Nolte Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Studienarbeit Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Sarah Nolte Universität zu Köln 1. Einleitung...1
Institutionelle Innovation zwischen Evaluation und Evolution
 Frühjahrstagung des AK Hochschulen in der DeGEval»Systeme im Wandel Hochschulen auf neuen Wegen«Institutionelle Innovation zwischen Evaluation und Evolution Paul Reinbacher Essen, am 14./15. Mai 2018 Universitäten
Frühjahrstagung des AK Hochschulen in der DeGEval»Systeme im Wandel Hochschulen auf neuen Wegen«Institutionelle Innovation zwischen Evaluation und Evolution Paul Reinbacher Essen, am 14./15. Mai 2018 Universitäten
Gesunde Arbeit gemeinsam möglich machen Gesundheitsmanagement mit Raum Für Führung. Raum Für Führung GmbH Frankfurt,
 Gesunde Arbeit gemeinsam möglich machen Gesundheitsmanagement mit Raum Für Führung Raum Für Führung GmbH Frankfurt, 13.08.2015 Inhalt der Präsentation 1 2 3 4 5 6 7 Raum Für Führung stellt sich vor Seite
Gesunde Arbeit gemeinsam möglich machen Gesundheitsmanagement mit Raum Für Führung Raum Für Führung GmbH Frankfurt, 13.08.2015 Inhalt der Präsentation 1 2 3 4 5 6 7 Raum Für Führung stellt sich vor Seite
Bildung für nachhaltige Entwicklung in Biosphärenreservaten in Deutschland
 28.09.2012 Robin Marwege Regionalentwicklung und Naturschutz, M.Sc. Tagung Theorie und Praxis: Globales Lernen und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (Leuphana Universität Lüneburg) Bildung für nachhaltige
28.09.2012 Robin Marwege Regionalentwicklung und Naturschutz, M.Sc. Tagung Theorie und Praxis: Globales Lernen und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (Leuphana Universität Lüneburg) Bildung für nachhaltige
Eine mehrebenenanalytische Betrachtung der Bedingungen von Innovationserfolg
 Eine mehrebenenanalytische Betrachtung der Bedingungen von Innovationserfolg Humboldt - Universität zu Berlin Hannah Rauterberg Wolgfang Scholl Ausgang Organizations are multi-level phenomena, and theories
Eine mehrebenenanalytische Betrachtung der Bedingungen von Innovationserfolg Humboldt - Universität zu Berlin Hannah Rauterberg Wolgfang Scholl Ausgang Organizations are multi-level phenomena, and theories
AUSBILDUNGS- UND BERUFSSTARTPROBLEME VON JUGENDLI- CHEN UNTER DEN BEDINGUNGEN VERSCHÄRFTER SITUATIONEN AUF DEM ARBEITS- UND AUSBILDUNGSSTELLENMARKT
 SOZIOLOGISCHES FORSCHUNGSINSTITUT GOTTINGEN SOFI AUSBILDUNGS- UND BERUFSSTARTPROBLEME VON JUGENDLI- CHEN UNTER DEN BEDINGUNGEN VERSCHÄRFTER SITUATIONEN AUF DEM ARBEITS- UND AUSBILDUNGSSTELLENMARKT Abschlußbericht
SOZIOLOGISCHES FORSCHUNGSINSTITUT GOTTINGEN SOFI AUSBILDUNGS- UND BERUFSSTARTPROBLEME VON JUGENDLI- CHEN UNTER DEN BEDINGUNGEN VERSCHÄRFTER SITUATIONEN AUF DEM ARBEITS- UND AUSBILDUNGSSTELLENMARKT Abschlußbericht
Diagnostische Prozesse in der Interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ)
 Diagnostische Prozesse in der Interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ) Martina Koch Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit, Institut Sozialplanung, Organisationaler Wandel und
Diagnostische Prozesse in der Interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ) Martina Koch Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit, Institut Sozialplanung, Organisationaler Wandel und
Psychische Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz. Jan Klapproth
 Wirtschaft Jan Klapproth Psychische Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz Ursachen, Problematik und Lösungsmöglichkeiten aus personalwirtschaftlicher und organisationaler Sicht Bachelorarbeit Fachbereich
Wirtschaft Jan Klapproth Psychische Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz Ursachen, Problematik und Lösungsmöglichkeiten aus personalwirtschaftlicher und organisationaler Sicht Bachelorarbeit Fachbereich
Psychotherapie als Profession
 Michael B. Buchholz Psychotherapie als Profession Psychosozial-Verlag Einleitung 11 Das veränderte Bild der Psychotherapie 24 Das Herz der Profession 26 Von der abbildenden Landkarte zum konstruierten
Michael B. Buchholz Psychotherapie als Profession Psychosozial-Verlag Einleitung 11 Das veränderte Bild der Psychotherapie 24 Das Herz der Profession 26 Von der abbildenden Landkarte zum konstruierten
Forschungsmethoden VORLESUNG WS 2017/2018
 Forschungsmethoden VORLESUNG WS 2017/2018 SOPHIE LUKES Rückblick Letztes Mal: Erhebungstechniken I Heute: Erhebungstechniken II Rückblick Lehrevaluation Einteilung von Erhebungsmethoden Selbstberichtsverfahren
Forschungsmethoden VORLESUNG WS 2017/2018 SOPHIE LUKES Rückblick Letztes Mal: Erhebungstechniken I Heute: Erhebungstechniken II Rückblick Lehrevaluation Einteilung von Erhebungsmethoden Selbstberichtsverfahren
Kommunikation und subjektive Gerechtigkeit von Vergütung
 Kerstin Geier Kommunikation und subjektive Gerechtigkeit von Vergütung Eine (theoretische und empirische) Untersuchung zu deren Zusammenhang Verlag Dr. Kovac Hamburg 2007 1 Einleitung 9 1.1 Anlass und
Kerstin Geier Kommunikation und subjektive Gerechtigkeit von Vergütung Eine (theoretische und empirische) Untersuchung zu deren Zusammenhang Verlag Dr. Kovac Hamburg 2007 1 Einleitung 9 1.1 Anlass und
IÖB-Tool Modul B1 / 3c/2014. Fragebogen zur Evaluierung innovationsfördernder Beschaffungsvorgänge. S. Supper T. Steffl U. Bodisch.
 3c/2014 IÖB-Tool Modul B1 / Fragebogen zur Evaluierung von IÖB Fragebogen zur Evaluierung innovationsfördernder Beschaffungsvorgänge der öffentlichen Hand S. Supper T. Steffl U. Bodisch Berichte aus Energie-
3c/2014 IÖB-Tool Modul B1 / Fragebogen zur Evaluierung von IÖB Fragebogen zur Evaluierung innovationsfördernder Beschaffungsvorgänge der öffentlichen Hand S. Supper T. Steffl U. Bodisch Berichte aus Energie-
Diana Pantlen. Eine theoretische und empirische Studie über Deutungsmuster von Personalverantwortlichen
 Diana Pantlen Eine theoretische und empirische Studie über Deutungsmuster von Personalverantwortlichen hoch qualifizierter älterer Arbeitnehmer/innen PL AC ADEMIC RESEARCH Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis
Diana Pantlen Eine theoretische und empirische Studie über Deutungsmuster von Personalverantwortlichen hoch qualifizierter älterer Arbeitnehmer/innen PL AC ADEMIC RESEARCH Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis
Tutorium Niklas Luhmann 8. Sitzung Abgrenzungen v. vorherigen Kommunikations- / Handlungskonzepten
 Tutorium Niklas Luhmann 8. Sitzung 17.12.2014 Abgrenzungen v. vorherigen Kommunikations- / Handlungskonzepten - Weber à Soziales Handeln als ein besonderer Fall v. Handlungen qua sozial gerichteter Intention
Tutorium Niklas Luhmann 8. Sitzung 17.12.2014 Abgrenzungen v. vorherigen Kommunikations- / Handlungskonzepten - Weber à Soziales Handeln als ein besonderer Fall v. Handlungen qua sozial gerichteter Intention
Neue Herausforderungen für Professionelle im Eingliederungsmanagement
 Neue im Eingliederungsmanagement Prof. Dr. Thomas Geisen Institut Integration und Partizipation der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW Überblick _Erwerbsarbeit und Gesellschaft _Konzept Eingliederungsmanagement
Neue im Eingliederungsmanagement Prof. Dr. Thomas Geisen Institut Integration und Partizipation der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW Überblick _Erwerbsarbeit und Gesellschaft _Konzept Eingliederungsmanagement
Inhaltsverzeichnis. Bibliografische Informationen digitalisiert durch
 Inhaltsverzeichnis Themenbegründung und Forschungsansatz 17 1.1 Ausgangslage: Nachhaltige Entwicklung und Nachhaltigkeitsforschung 17 1.2 Einfuhrung in die Thematik der unternehmerischen Nachhaltigkeitskommunikation
Inhaltsverzeichnis Themenbegründung und Forschungsansatz 17 1.1 Ausgangslage: Nachhaltige Entwicklung und Nachhaltigkeitsforschung 17 1.2 Einfuhrung in die Thematik der unternehmerischen Nachhaltigkeitskommunikation
Duisburg von Industriestadt zu Kulturstandort? (Teil 2) Duisburg from industrial city to cultural center? MA Modul 3 Lehrforschungsprojekt
 Duisburg von Industriestadt zu Kulturstandort? (Teil 2) Duisburg from industrial city to cultural center? MA Modul 3 Lehrforschungsprojekt Wintersemester 2014-2015, mittwochs 14-16 Uhr, Raum Glaucia Peres
Duisburg von Industriestadt zu Kulturstandort? (Teil 2) Duisburg from industrial city to cultural center? MA Modul 3 Lehrforschungsprojekt Wintersemester 2014-2015, mittwochs 14-16 Uhr, Raum Glaucia Peres
Nachhaltige Ernährung. Universität Greifswald
 Nachhaltige Ernährung Lieske Voget-Kleschin Universität Greifswald Gliederung Nachhaltige Ernährung Verständnis nachhaltiger Entwicklung Nachhaltige Nahrungsmittelproduktion Nachhaltige Ernährung Politische
Nachhaltige Ernährung Lieske Voget-Kleschin Universität Greifswald Gliederung Nachhaltige Ernährung Verständnis nachhaltiger Entwicklung Nachhaltige Nahrungsmittelproduktion Nachhaltige Ernährung Politische
Herzlich Willkommen!
 Herzlich Willkommen! Das Rad neu erfinden? NMG Aufgaben aus mehreren Perspektiven Dr. Hartmut Moos-Gollnisch Dr. Patric Brugger Ablauf Begrüssung und Input (10 ) -> Plenum Kulturwissenschaftliche/ naturwissenschaftliche
Herzlich Willkommen! Das Rad neu erfinden? NMG Aufgaben aus mehreren Perspektiven Dr. Hartmut Moos-Gollnisch Dr. Patric Brugger Ablauf Begrüssung und Input (10 ) -> Plenum Kulturwissenschaftliche/ naturwissenschaftliche
Unterstützte Kommunikation - ihre theoretischen Bezugssysteme
 Unterstützte Kommunikation - ihre theoretischen Bezugssysteme Prof. Dr. Dorothea Lage Unterstützte Kommunikation Perspektiven in Wissenschaft und Praxis Universität Würzburg, Institut für Sonderpädagogik
Unterstützte Kommunikation - ihre theoretischen Bezugssysteme Prof. Dr. Dorothea Lage Unterstützte Kommunikation Perspektiven in Wissenschaft und Praxis Universität Würzburg, Institut für Sonderpädagogik
Eine Konsumentensegmentierung für Fleisch und Fleischalternativen in der Schweiz
 Eine Konsumentensegmentierung für Fleisch und Fleischalternativen in der Schweiz Franziska Götze SGA-Tagung 12./13. April 2018 Inhalt Kontext Daten und Methode Datengrundlage und Sample Clusteranalyse
Eine Konsumentensegmentierung für Fleisch und Fleischalternativen in der Schweiz Franziska Götze SGA-Tagung 12./13. April 2018 Inhalt Kontext Daten und Methode Datengrundlage und Sample Clusteranalyse
Zum Stellenwert verschiedener Differenzlinien in der Hochschullehre
 Zum Stellenwert verschiedener Differenzlinien in der Hochschullehre Erkenntnisse einer qualitativen Hochschullehrenden-Befragung Tagung: Vielfältige Differenzlinien in der Diversitätsforschung 09.09.2016
Zum Stellenwert verschiedener Differenzlinien in der Hochschullehre Erkenntnisse einer qualitativen Hochschullehrenden-Befragung Tagung: Vielfältige Differenzlinien in der Diversitätsforschung 09.09.2016
Nutzung und Aneignung öffentlicher Räume eine vergleichende Untersuchung des Brüsseler Platzes und des Rathenauplatzes in Köln
 Sebastian Themann Email: sthemann@uni-bonn.de Exposé zur Masterarbeit Betreuung: Herr Prof. Dr. C.-C. Wiegandt Anmeldung: 4. April 2013 Nutzung und Aneignung öffentlicher Räume eine vergleichende Untersuchung
Sebastian Themann Email: sthemann@uni-bonn.de Exposé zur Masterarbeit Betreuung: Herr Prof. Dr. C.-C. Wiegandt Anmeldung: 4. April 2013 Nutzung und Aneignung öffentlicher Räume eine vergleichende Untersuchung
PROFESSIONELLES SCHUL-CATERING BEGEISTERUNG SCHAFFEN SRH DIENST- LEISTUNGEN
 PROFESSIONELLES SCHUL-CATERING BEGEISTERUNG SCHAFFEN SRH DIENST- LEISTUNGEN SRH DIENSTLEISTUNGEN GMBH Unser Markenzeichen: Hervorragende Qualität & exzellenter Service Dies ist das Richtmaß unserer 375
PROFESSIONELLES SCHUL-CATERING BEGEISTERUNG SCHAFFEN SRH DIENST- LEISTUNGEN SRH DIENSTLEISTUNGEN GMBH Unser Markenzeichen: Hervorragende Qualität & exzellenter Service Dies ist das Richtmaß unserer 375
Bernd Schorb, Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft eine notwendige und problematische Verbindung.
 Bernd Schorb, Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft eine notwendige und problematische Verbindung. Exposé aus Medienpädagogik Themenfeld Wechselverhältnis Medientheorie Medienpädagogik Artikel
Bernd Schorb, Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft eine notwendige und problematische Verbindung. Exposé aus Medienpädagogik Themenfeld Wechselverhältnis Medientheorie Medienpädagogik Artikel
New Trends in Business Management Theory Consequences for SME. Neue Trends in der Managementlehre Konsequenzen für KMU
 New Trends in Business Management Theory Consequences for SME Neue Trends in der Managementlehre Konsequenzen für KMU Urs Fueglistaller Thilo Wiedmann (eds./hrsg.) Table of Content Table of Diagrams.10
New Trends in Business Management Theory Consequences for SME Neue Trends in der Managementlehre Konsequenzen für KMU Urs Fueglistaller Thilo Wiedmann (eds./hrsg.) Table of Content Table of Diagrams.10
Wirtschaftswissenschaftliches Seminar/ Berufsfeldseminar Wissensmanagement im Gesundheitswesen. 05. November 2018 Methodeninput - Datenauswertung
 Wirtschaftswissenschaftliches Seminar/ Berufsfeldseminar Wissensmanagement im Gesundheitswesen 05. November 2018 Methodeninput - Datenauswertung Leitfaden 2 Rückblick letzte Veranstaltung Was waren Auffälligkeiten
Wirtschaftswissenschaftliches Seminar/ Berufsfeldseminar Wissensmanagement im Gesundheitswesen 05. November 2018 Methodeninput - Datenauswertung Leitfaden 2 Rückblick letzte Veranstaltung Was waren Auffälligkeiten
Benchmark Führung. Führung. Situation Beim Coaching von Vorgesetzten. In Seminaren zum Thema Führung.
 Situation Beim Coaching von Vorgesetzten. In Seminaren zum Thema Führung. Ziel Zusatzmaterial Dauer Vorgehensweise Auswertung Als Individualübung zum Abgleich der eigenen Führungspraxis mit Führungsvorbildern
Situation Beim Coaching von Vorgesetzten. In Seminaren zum Thema Führung. Ziel Zusatzmaterial Dauer Vorgehensweise Auswertung Als Individualübung zum Abgleich der eigenen Führungspraxis mit Führungsvorbildern
kultur- und sozialwissenschaften
 Renate Schramek/Uwe Elsholz Kurseinheit 8: Demografische Entwicklungen als Herausforderung für die betriebliche Bildung Modul 3D: Betriebliches Lernen und berufliche Kompetenzentwicklung kultur- und sozialwissenschaften
Renate Schramek/Uwe Elsholz Kurseinheit 8: Demografische Entwicklungen als Herausforderung für die betriebliche Bildung Modul 3D: Betriebliches Lernen und berufliche Kompetenzentwicklung kultur- und sozialwissenschaften
Quo Vadis Wissen(schaft)
 Christine Gassler Stefan Ivancsics Quo Vadis Wissen(schaft) 1 Die Bedeutung der Pflegewissenschaft im beruflichen Kontext 2 Einleitung Einleitung 3 Pflegerische Kernkompetenz: evidenz- und forschungsbasierte
Christine Gassler Stefan Ivancsics Quo Vadis Wissen(schaft) 1 Die Bedeutung der Pflegewissenschaft im beruflichen Kontext 2 Einleitung Einleitung 3 Pflegerische Kernkompetenz: evidenz- und forschungsbasierte
Professionelles Handeln von Ausbildungspersonen in Fehlersituationen. Alexander Baumgartner & Jürgen Seifried AG BFN-Forum 2010, Bonn 27.
 Professionelles Handeln von Ausbildungspersonen in Fehlersituationen Alexander Baumgartner & Jürgen Seifried AG BFN-Forum 2010, Bonn 27. April 2010 Übersicht 2 2 (1) Theoretischer Rahmen (2) Forschungsfrage,
Professionelles Handeln von Ausbildungspersonen in Fehlersituationen Alexander Baumgartner & Jürgen Seifried AG BFN-Forum 2010, Bonn 27. April 2010 Übersicht 2 2 (1) Theoretischer Rahmen (2) Forschungsfrage,
Feld, T. C. (2007): Volkshochschulen als lernende Organisationen. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
 Feld, T. C. (2007): n als lernende Organisationen. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. Im Zuge gesellschaftlicher Modernisierungsdynamiken verschieben sich für n politische, rechtliche, ökonomische und soziale
Feld, T. C. (2007): n als lernende Organisationen. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. Im Zuge gesellschaftlicher Modernisierungsdynamiken verschieben sich für n politische, rechtliche, ökonomische und soziale
Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse
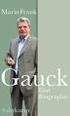 Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse These: Die organisatorische Vermittlung außenpolitischer Entscheidungen ist für die inhaltliche Ausgestaltung der Außenpolitik von Bedeutung
Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse These: Die organisatorische Vermittlung außenpolitischer Entscheidungen ist für die inhaltliche Ausgestaltung der Außenpolitik von Bedeutung
Dynamische kundenorientierte Wertschöpfungsnetzwerke in der Weiter- und Fortbildung
 Reihe: E-Learning Band 14 Herausgegeben von Prof. Dr. Dietrich Seibt, Köln, Prof. Dr. Freimut Bodendorf, Nürnberg, Prof. Dr. Dieter Euler, St. Gallen, und Prof. Dr. Udo Winand, Kassel Dr. Christine Voigtländer
Reihe: E-Learning Band 14 Herausgegeben von Prof. Dr. Dietrich Seibt, Köln, Prof. Dr. Freimut Bodendorf, Nürnberg, Prof. Dr. Dieter Euler, St. Gallen, und Prof. Dr. Udo Winand, Kassel Dr. Christine Voigtländer
Neuere konzeptionelle Entwicklungen auf dem Gebiet der psychosozialen Beratung
 Fachgruppentreffen Systemische Beratung in Magdeburg am 24.09.2015 Neuere konzeptionelle Entwicklungen auf dem Gebiet der psychosozialen Beratung Franz-Christian Schubert I. Einleitung: Entwicklung und
Fachgruppentreffen Systemische Beratung in Magdeburg am 24.09.2015 Neuere konzeptionelle Entwicklungen auf dem Gebiet der psychosozialen Beratung Franz-Christian Schubert I. Einleitung: Entwicklung und
KOMMUNALE RESILIENZ SCHUTZFAKTOREN UND STRUKTUREN
 KOMMUNALE RESILIENZ SCHUTZFAKTOREN UND STRUKTUREN Fachsymposium Gesunde Städte Netzwerk 2017 WS 4 02.06.2017 Resilienz Definition Resilienz«(lat.»resilire«= abprallen) Fähigkeit eines Systems auch eines
KOMMUNALE RESILIENZ SCHUTZFAKTOREN UND STRUKTUREN Fachsymposium Gesunde Städte Netzwerk 2017 WS 4 02.06.2017 Resilienz Definition Resilienz«(lat.»resilire«= abprallen) Fähigkeit eines Systems auch eines
Personalentwicklung an der Hochschule ein Einblick
 Praxisforum 2015 «Personalentwicklung im Fokus» Olten, 4. November 2015 Personalentwicklung an der Hochschule ein Einblick Prof. Dr. Luzia Truniger Direktorin Hochschule für Soziale Arbeit FHNW Personalentwicklung
Praxisforum 2015 «Personalentwicklung im Fokus» Olten, 4. November 2015 Personalentwicklung an der Hochschule ein Einblick Prof. Dr. Luzia Truniger Direktorin Hochschule für Soziale Arbeit FHNW Personalentwicklung
Nachhaltige Stadtentwicklung Zwischenergebnisse einer soziologischen Begleitforschung
 Nachhaltige Stadtentwicklung Zwischenergebnisse einer soziologischen Begleitforschung 2 Erwartungshorizont Transformative Forschung Ein Input zur theoretischen Rahmung Nachhaltige Stadtentwicklung in Münster
Nachhaltige Stadtentwicklung Zwischenergebnisse einer soziologischen Begleitforschung 2 Erwartungshorizont Transformative Forschung Ein Input zur theoretischen Rahmung Nachhaltige Stadtentwicklung in Münster
I. Einführung in den Wohlfahrtsstaats vergleich: Methoden, Theorien und Kontroversen
 Inhaltsverzeichnis Verzeichnis der Schaubilder 12 Vorwort zur 1. Auflage 19 Vorwort zur 2. Auflage 21 I. Einführung in den Wohlfahrtsstaats vergleich: Methoden, Theorien und Kontroversen 1 Methodisch-theoretische
Inhaltsverzeichnis Verzeichnis der Schaubilder 12 Vorwort zur 1. Auflage 19 Vorwort zur 2. Auflage 21 I. Einführung in den Wohlfahrtsstaats vergleich: Methoden, Theorien und Kontroversen 1 Methodisch-theoretische
1.1 Gesellschaftspolitische Hintergründe interreligiösen Lernens und pädagogische Verantwortung Kindertheologie und Problemlagen 6
 Inhaltsverzeichnis 1. EINLEITUNG 1 1.1 Gesellschaftspolitische Hintergründe interreligiösen Lernens und pädagogische Verantwortung 3 1.2 Kindertheologie und Problemlagen 6 1.3 Religionsdidaktik - Selbstverständnis
Inhaltsverzeichnis 1. EINLEITUNG 1 1.1 Gesellschaftspolitische Hintergründe interreligiösen Lernens und pädagogische Verantwortung 3 1.2 Kindertheologie und Problemlagen 6 1.3 Religionsdidaktik - Selbstverständnis
«Am Mittwoch nach de Schuel han i Ströfzgi und druf abe gahts i d Flöte»: Eine interdisziplinäre Perspektive auf die Musik in der Ganztagsbildung
 «Am Mittwoch nach de Schuel han i Ströfzgi und druf abe gahts i d Flöte»: Eine interdisziplinäre Perspektive auf die Musik in der Ganztagsbildung Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)
«Am Mittwoch nach de Schuel han i Ströfzgi und druf abe gahts i d Flöte»: Eine interdisziplinäre Perspektive auf die Musik in der Ganztagsbildung Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)
Aus Sicht des Gesamtprozesses Addressing the full process. Überblick Seminarangebot
 Seminars Seminare on über Investment Investment Performance Performance Analysis Aus Sicht des Gesamtprozesses Addressing the full process Überblick Performance-Messung, Investment Reporting und Investment
Seminars Seminare on über Investment Investment Performance Performance Analysis Aus Sicht des Gesamtprozesses Addressing the full process Überblick Performance-Messung, Investment Reporting und Investment
Entwicklung und Etablierung der sektorenübergreifenden Versorgung älterer Menschen nach einem Krankenhausaufenthalt in Potsdam (SEVERAM)
 Entwicklung und Etablierung der sektorenübergreifenden Versorgung älterer Menschen nach einem Krankenhausaufenthalt in Potsdam (SEVERAM) 03.03.2011 Zweite Meilensteinkonferenz Fallanalyse Herr Paul 1 Fallspezifische
Entwicklung und Etablierung der sektorenübergreifenden Versorgung älterer Menschen nach einem Krankenhausaufenthalt in Potsdam (SEVERAM) 03.03.2011 Zweite Meilensteinkonferenz Fallanalyse Herr Paul 1 Fallspezifische
Kommunikation, Koordination und soziales System
 Kommunikation, Koordination und soziales System Theoretische Grundlagen fiir die Erklarung der Evolution von Kultur und Gesellschaft von Manfred Aschke Lucius & Lucius Stuttgart 2002 Einleitung Politik
Kommunikation, Koordination und soziales System Theoretische Grundlagen fiir die Erklarung der Evolution von Kultur und Gesellschaft von Manfred Aschke Lucius & Lucius Stuttgart 2002 Einleitung Politik
Veronika Tacke (Hrsg.) Organisation und gesellschaftliche Differenzierung
 Veronika Tacke (Hrsg.) Organisation und gesellschaftliche Differenzierung Organisation und Gesellschaft Herausgegeben von Gunther Ortmann Wie wiinscht man sich Organisationsforschung? Theoretisch reflektiert,
Veronika Tacke (Hrsg.) Organisation und gesellschaftliche Differenzierung Organisation und Gesellschaft Herausgegeben von Gunther Ortmann Wie wiinscht man sich Organisationsforschung? Theoretisch reflektiert,
Bio Bio in HEIDELBERG
 Bio in HEIDELBERG Bio in Heidelberg Bio in Heidelberg ist ein Kooperationsprojekt der Stadt Heidelberg. Gemeinsam mit lokalen Akteuren aus Landwirtschaft und Handel sowie Verbraucherinnen und Verbrauchern
Bio in HEIDELBERG Bio in Heidelberg Bio in Heidelberg ist ein Kooperationsprojekt der Stadt Heidelberg. Gemeinsam mit lokalen Akteuren aus Landwirtschaft und Handel sowie Verbraucherinnen und Verbrauchern
Fritz B. Simon: Einführung in Systemtheorie und Konstruktivismus
 Jonas Civilis; Bernd Rößler Fritz B. Simon: Einführung in Systemtheorie und Konstruktivismus 24. Mai 2018 Überblick - Inhalt 1. Vom Objekt zum System 2. Vom Regelkreis zur Selbstorganisation 3. Von der
Jonas Civilis; Bernd Rößler Fritz B. Simon: Einführung in Systemtheorie und Konstruktivismus 24. Mai 2018 Überblick - Inhalt 1. Vom Objekt zum System 2. Vom Regelkreis zur Selbstorganisation 3. Von der
Attraktiv. Nachhaltig. Gesund.
 Attraktiv. Nachhaltig. Gesund. Eckpfeiler einer zukunftsfähigen Gemeinschaftsgastronomie Inhalt 1. Herausforderungen für gastronomische Dienstleistungen heute 2. Kernelemente einer zukunftsfähigen Gemeinschaftsgastronomie
Attraktiv. Nachhaltig. Gesund. Eckpfeiler einer zukunftsfähigen Gemeinschaftsgastronomie Inhalt 1. Herausforderungen für gastronomische Dienstleistungen heute 2. Kernelemente einer zukunftsfähigen Gemeinschaftsgastronomie
Lebens.Räume im Wandel nachhaltig gestalten:
 Lebens.Räume im Wandel nachhaltig gestalten: Geplanter Kursaufbau mit Stichworten zum Inhalt Organisatorischer Rahmen 3 Blöcke á 1,5 SSt, 4 ECTS-AP + 2 Blöcke á 2,25 SSt, 6 ECTS-AP + 1 Block mit 0,5 SSt,
Lebens.Räume im Wandel nachhaltig gestalten: Geplanter Kursaufbau mit Stichworten zum Inhalt Organisatorischer Rahmen 3 Blöcke á 1,5 SSt, 4 ECTS-AP + 2 Blöcke á 2,25 SSt, 6 ECTS-AP + 1 Block mit 0,5 SSt,
Vermarktung von Nichtholzgütern und Dienstleistungen
 Vermarktung von Nichtholzgütern und Dienstleistungen Walter SEKOT Vermarktung von Nichtholzgütern und Dienstleistungen - W. Sekot Vermarktung warum? 1. Erwerbswirtschaftliches Dilemma der Holzproduktion
Vermarktung von Nichtholzgütern und Dienstleistungen Walter SEKOT Vermarktung von Nichtholzgütern und Dienstleistungen - W. Sekot Vermarktung warum? 1. Erwerbswirtschaftliches Dilemma der Holzproduktion
Bevölkerungswachstum und Armutsminderung in. Entwicklungsländern. Das Fallbeispiel Philippinen
 Bevölkerungswachstum und Armutsminderung in Entwicklungsländern. Das Fallbeispiel Philippinen DISSERTATION am Fachbereich Politische Wissenschaft der Freien Universität Berlin Verfasser: Christian H. Jahn
Bevölkerungswachstum und Armutsminderung in Entwicklungsländern. Das Fallbeispiel Philippinen DISSERTATION am Fachbereich Politische Wissenschaft der Freien Universität Berlin Verfasser: Christian H. Jahn
Klausuraufgaben BWP 2 Prof. Nickolaus
 Klausuraufgaben BWP 2 Prof. Nickolaus Stellen Sie die wesentlichen gesellschaftlichen Funktionen des Bildungssystems vor (und konkretisieren Sie deren Relevanz am Beispiel der politischen Bildung). Geben
Klausuraufgaben BWP 2 Prof. Nickolaus Stellen Sie die wesentlichen gesellschaftlichen Funktionen des Bildungssystems vor (und konkretisieren Sie deren Relevanz am Beispiel der politischen Bildung). Geben
Digitale Demokratie: Chancen und Herausforderungen von sozialen Netzwerken. Bachelorarbeit
 Digitale Demokratie: Chancen und Herausforderungen von sozialen Netzwerken Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B.Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft der Wirtschaftswissenschaftlichen
Digitale Demokratie: Chancen und Herausforderungen von sozialen Netzwerken Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B.Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft der Wirtschaftswissenschaftlichen
Auswertung von ethnografischen Interviews
 Prof. Dr. Lilo schmitz FH Düsseldorf Auswertung von ethnografischen Interviews Ich schlage Ihnen hier eine von vielen Möglichkeiten zur Auswertung Ihrer ethnografischen Interviews vor, die sich gerade
Prof. Dr. Lilo schmitz FH Düsseldorf Auswertung von ethnografischen Interviews Ich schlage Ihnen hier eine von vielen Möglichkeiten zur Auswertung Ihrer ethnografischen Interviews vor, die sich gerade
Niederschwelligkeit in der Sozialen Arbeit
 Niederschwelligkeit in der Sozialen Arbeit Funktionen und Formen aus soziologischer Perspektive Bearbeitet von Hemma Mayrhofer 1. Auflage 2012. Taschenbuch. viii, 324 S. Paperback ISBN 978 3 658 00192
Niederschwelligkeit in der Sozialen Arbeit Funktionen und Formen aus soziologischer Perspektive Bearbeitet von Hemma Mayrhofer 1. Auflage 2012. Taschenbuch. viii, 324 S. Paperback ISBN 978 3 658 00192
Veränderungen in Familienunternehmen gestalten
 Veränderungen in Familienunternehmen gestalten Komplementäre Kommunikation von Eigentümern und Fremdmanagern von Kerstin Heidelmann 1. Auflage 2013 Veränderungen in Familienunternehmen gestalten Heidelmann
Veränderungen in Familienunternehmen gestalten Komplementäre Kommunikation von Eigentümern und Fremdmanagern von Kerstin Heidelmann 1. Auflage 2013 Veränderungen in Familienunternehmen gestalten Heidelmann
Von der didaktischen Reduktion zur Berufsdidaktischen Aufbereitung
 Von der didaktischen Reduktion zur Berufsdidaktischen Aufbereitung Prof. Dr. Matthias Becker 14.03.2017 Hochschultage Berufliche Bildung 2017 in Köln Fachtagung der BAG Elektrometall: Fachkräftesicherung
Von der didaktischen Reduktion zur Berufsdidaktischen Aufbereitung Prof. Dr. Matthias Becker 14.03.2017 Hochschultage Berufliche Bildung 2017 in Köln Fachtagung der BAG Elektrometall: Fachkräftesicherung
Nachhaltigkeitsberichterstattung im Hochschulkontext - Identifizierung von Qualitätskriterien aus Literatur und Praxis
 Nachhaltigkeitsberichterstattung im Hochschulkontext- Identifizierung von Qualitätskriterien aus Literatur und Praxis Nachhaltigkeitsberichterstattung im Hochschulkontext - Identifizierung von Qualitätskriterien
Nachhaltigkeitsberichterstattung im Hochschulkontext- Identifizierung von Qualitätskriterien aus Literatur und Praxis Nachhaltigkeitsberichterstattung im Hochschulkontext - Identifizierung von Qualitätskriterien
Darreichung der Speisen
 Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren in der Außer-Haus-Gastronomie AUSGABE Darreichung der Speisen Reduzieren Sie die Portionsgrößen ungesunder/ nicht nachhaltiger Komponenten. Die Größe/Menge einer
Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren in der Außer-Haus-Gastronomie AUSGABE Darreichung der Speisen Reduzieren Sie die Portionsgrößen ungesunder/ nicht nachhaltiger Komponenten. Die Größe/Menge einer
Abbildungsverzeichnis...VI Tabellenverzeichnis... VII Abkürzungsverzeichnis...VIII
 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis...VI Tabellenverzeichnis... VII Abkürzungsverzeichnis...VIII 1 Einführung... 1 1.1 Problemstellung und Zielsetzung... 1 1.2 Aufbau und Vorgehensweise der Untersuchung...
Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis...VI Tabellenverzeichnis... VII Abkürzungsverzeichnis...VIII 1 Einführung... 1 1.1 Problemstellung und Zielsetzung... 1 1.2 Aufbau und Vorgehensweise der Untersuchung...
Workload: 150 h ECTS Punkte: 5
 Modulbezeichnung: Modulnummer: DLBWPIPS Modultyp: Pflicht Interkulturelle Psychologie Semester: -- Dauer: Minimaldauer 1 Semester Regulär angeboten im: WS, SS Workload: 150 h ECTS Punkte: 5 Zugangsvoraussetzungen:
Modulbezeichnung: Modulnummer: DLBWPIPS Modultyp: Pflicht Interkulturelle Psychologie Semester: -- Dauer: Minimaldauer 1 Semester Regulär angeboten im: WS, SS Workload: 150 h ECTS Punkte: 5 Zugangsvoraussetzungen:
Strategieumsetzung. KMU*Star Erfahrungsworkshop vom 29. Juni I I 0
 Strategieumsetzung KMU*Star Erfahrungsworkshop vom 29. Juni 2009 www.forrer-lombriser.ch I I 0 Auswertung Fragebogen Drei der zehn Befragten geben an, dass Schwierigkeiten bei der Strategieumsetzung auftreten,
Strategieumsetzung KMU*Star Erfahrungsworkshop vom 29. Juni 2009 www.forrer-lombriser.ch I I 0 Auswertung Fragebogen Drei der zehn Befragten geben an, dass Schwierigkeiten bei der Strategieumsetzung auftreten,
Grundlagen und Perspektiven der Betriebsgastronomie 3.0
 Grundlagen und Perspektiven der Betriebsgastronomie 3.0 Ergebnisse aus Studien und Workshop am 17. November 2015 Das 100 Kantinen-Programm in Niedersachsen Struktur der GV in Niedersachsen Kategorie Betriebstyp
Grundlagen und Perspektiven der Betriebsgastronomie 3.0 Ergebnisse aus Studien und Workshop am 17. November 2015 Das 100 Kantinen-Programm in Niedersachsen Struktur der GV in Niedersachsen Kategorie Betriebstyp
Evaluierung von Anti-Stress Programmen innerhalb der SKEI Gewerkschaft Ergebnisse der Pilot-Studie
 Evaluierung von Anti-Stress Programmen innerhalb der SKEI Gewerkschaft Ergebnisse der Pilot-Studie Dr. Paulino Jiménez Mag. a Anita Dunkl Mag. a Simona Šarotar Žižek Dr. Borut Milfelner Dr.Alexandra Pisnik-Korda
Evaluierung von Anti-Stress Programmen innerhalb der SKEI Gewerkschaft Ergebnisse der Pilot-Studie Dr. Paulino Jiménez Mag. a Anita Dunkl Mag. a Simona Šarotar Žižek Dr. Borut Milfelner Dr.Alexandra Pisnik-Korda
Evaluation from outside?
 Evaluation from outside? Evaluierung von Organisational Change Prozessen zur Förderung von Gleichstellung Sybille Reidl & Florian Holzinger 21. Jahrestagung der DeGEval Session des AK Gender Mainstreaming
Evaluation from outside? Evaluierung von Organisational Change Prozessen zur Förderung von Gleichstellung Sybille Reidl & Florian Holzinger 21. Jahrestagung der DeGEval Session des AK Gender Mainstreaming
Responsive Evaluationsforschung
 Responsive Evaluationsforschung Zum Entwurf einer Theorie der Evaluationspraxis Gliederung 1. Eine rekonstruktiv-responsive Evaluationsmethodologie orientiert sich an dem Erfahrungswissen der Beforschten,
Responsive Evaluationsforschung Zum Entwurf einer Theorie der Evaluationspraxis Gliederung 1. Eine rekonstruktiv-responsive Evaluationsmethodologie orientiert sich an dem Erfahrungswissen der Beforschten,
Design eines Vorgehensmodells zur Entwicklung komplexer Dashboards
 Design eines Vorgehensmodells zur Entwicklung komplexer Dashboards Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B. Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft der Wirtschaftswissenschaftlichen
Design eines Vorgehensmodells zur Entwicklung komplexer Dashboards Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B. Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft der Wirtschaftswissenschaftlichen
Bildungsberatung im Dialog
 Grundlagen der Berufs- und Erwachsenenbildung 60 Bildungsberatung im Dialog Band I. Theorie - Empirie - Reflexion Bearbeitet von Rolf Arnold, Wiltrud Gieseke, Christine Zeuner 1. Auflage 2009. Taschenbuch.
Grundlagen der Berufs- und Erwachsenenbildung 60 Bildungsberatung im Dialog Band I. Theorie - Empirie - Reflexion Bearbeitet von Rolf Arnold, Wiltrud Gieseke, Christine Zeuner 1. Auflage 2009. Taschenbuch.
Biodiversität als Natur-Kultur-Vielfalt
 Biodiversität als Natur-Kultur-Vielfalt Zum Fundament geistes- und sozialwissenschaftlicher Biodiversitätsforschung Silke Lachnit Philosophisches Seminar Promotionsstudiengang Biodiversität und Gesellschaft`
Biodiversität als Natur-Kultur-Vielfalt Zum Fundament geistes- und sozialwissenschaftlicher Biodiversitätsforschung Silke Lachnit Philosophisches Seminar Promotionsstudiengang Biodiversität und Gesellschaft`
Die Seminare im Überblick
 Die Seminare im Überblick Seminar 1: Teamarbeit in der Rehabilitation Mit Anderen zu kooperieren, in einem Team zusammenzuarbeiten ist nicht neu. Dennoch scheint in vielen Stellenanzeigen die Forderung
Die Seminare im Überblick Seminar 1: Teamarbeit in der Rehabilitation Mit Anderen zu kooperieren, in einem Team zusammenzuarbeiten ist nicht neu. Dennoch scheint in vielen Stellenanzeigen die Forderung
Schriftliche Praxisreflexionen Ein Garant für Kompetenzentwicklung?
 KATHARINA ROSENBERGER Schriftliche Praxisreflexionen Ein Garant für Kompetenzentwicklung? ÖFEB-Tagung 8.-10.11.2012 KIRCHLICHE PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE WIEN/KREMS www.kphvie.ac.at Most training and post-experience
KATHARINA ROSENBERGER Schriftliche Praxisreflexionen Ein Garant für Kompetenzentwicklung? ÖFEB-Tagung 8.-10.11.2012 KIRCHLICHE PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE WIEN/KREMS www.kphvie.ac.at Most training and post-experience
Vom E-Learning zum Blended-Learning
 Vom E-Learning zum Blended-Learning Eine empirische Untersuchung zum computergestützten Lernen in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung unter besonderer Berücksichtigung der Nutzerperspektive und der
Vom E-Learning zum Blended-Learning Eine empirische Untersuchung zum computergestützten Lernen in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung unter besonderer Berücksichtigung der Nutzerperspektive und der
Was ist Gesundheitskompetenz, und wie kann sie gefördert werden?
 Was ist Gesundheitskompetenz, und wie kann sie gefördert werden? Mag.Dr. Christina Dietscher Abteilung III/6, Gesundheitsförderung & Prävention Dank an Prof. Jürgen Pelikan für gemeinsame Erarbeitung von
Was ist Gesundheitskompetenz, und wie kann sie gefördert werden? Mag.Dr. Christina Dietscher Abteilung III/6, Gesundheitsförderung & Prävention Dank an Prof. Jürgen Pelikan für gemeinsame Erarbeitung von
Vom ersten Impuls zum dauerhaften Markterfolg
 Vom ersten Impuls zum dauerhaften Markterfolg Ökologische Produktentwicklung in Unternehmen Kathrin Graulich Fachtagung Wider die Verschwendung III Berlin, 11. Mai 2017 Öko-Institut e.v. 1 Erfolgsfaktoren
Vom ersten Impuls zum dauerhaften Markterfolg Ökologische Produktentwicklung in Unternehmen Kathrin Graulich Fachtagung Wider die Verschwendung III Berlin, 11. Mai 2017 Öko-Institut e.v. 1 Erfolgsfaktoren
