Qualitäts- und Prozessmanagement in kollaborativen Arbeitsumgebungen
|
|
|
- Emil Heidrich
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Diplomarbeit Qualitäts- und Prozessmanagement in kollaborativen Arbeitsumgebungen Analyse, Konzeption und prototypische Realisation für ein organisationsübergreifendes Bewertungsmanagementsystem Prof. Dr. Ludwig Nastansky Sommersemester 2006 betreut durch Dipl.-Wirt.-Inf. Holger Ploch vorgelegt von Thi Kim Huyen Pham Tresckowstraße 22, Hannover Studiengang Wirtschaftsinformatik Matrikelnummer
2 Eidesstattliche Erklärung Ich erkläre hiermit an Eides Statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und nur unter Verwendung der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe; die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht. Paderborn, den (Datum) (Unterschrift)
3 Inhaltsverzeichnis i Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... i Abkürzungsverzeichnis... iv Abbildungsverzeichnis...v Tabellenverzeichnis... vii 1 Einleitung Szenario Zielsetzung und Aufbau der Arbeit Grundlagen und thematische Abgrenzung Prozessmanagement Definition Prozess Definition Prozessmanagement Konzepte des Prozessmanagements Qualitätsmanagement Definition Qualität Definition Qualitätsmanagement Aufgaben des Qualitätsmanagements Total Quality Management Qualitätsmanagementsystem Qualitätsmanagement als Prozessmanagement Kollaborative Arbeitsumgebung Computer Supported Cooperative Work Groupware...19
4 Inhaltsverzeichnis ii Definition Interaktionsmechanismen Systemklassen Konzept für Qualitäts- und Prozessmanagement in kollaborativen Arbeitsumgebungen Ziele Effiziente Projekt- und Teamorganisation Gezieltes Dokumentenmanagement / Archivierung Berechtigungsmanagement Unterstützungsfunktionalitäten Effiziente Kommunikation in einem Projekt oder einem Team Gezielte Informationen Terminplanung Workflow-Management Dokumentenmanagement Berechtigungsmanagement Bewertungsmanagement an Hochschulen Szenario Anforderungen Effiziente Kommunikation in einem Projekt oder einem Team Gezielte Informationen Terminplanung Workflow-Management Dokumentenmanagement Berechtigungsmanagement...57
5 Inhaltsverzeichnis iii 5 Prototypische Implementierung Grading Management System Auswahl der Funktionen Vorhandene Funktionen Realisierte Funktionen Umsetzungen zur effizienten Projekt- und Teamorganisation Umsetzungen zum gezielten Dokumentenmanagement Ausblick Zusammenfassung Literaturverzeichnis...80
6 Abkürzungsverzeichnis iv Abkürzungsverzeichnis BAM CA CSCW Dbb DGQ ECTS EFQM EPK ERP GCC GMS HIS IMT L&F-Einheit QMS TQM UML WIWI Business Activity Monitoring Certificate Authority Computer Supported Cooperative Work Die Bundesleitung des dbb Beamtenbund und Tarifunion Deutsche Gesellschaft für Qualität European Credit Transfer System European Foundation for Quality Management Ereignisgesteuerte Prozesskette Enterprise Resource Planning Groupware Competence Center Grading Management System Hochschul-Informations-System Informations- und Medientechnologien Lehr- und Forschungseinheit Qualitätsmanagement-System Total Quality Management Unified Modeling Language Wirtschaftswissenschaften
7 Abbildungsverzeichnis v Abbildungsverzeichnis Abbildung 2.1: Prozess...4 Abbildung 2.2: Geschäftsprozessmanagement-Kreislauf...7 Abbildung 2.3: Aufgaben des Qualitätsmanagements...12 Abbildung 2.4: Struktur eines prozessorientierten QM-Systems...16 Abbildung 2.5: EFQM - Modell...17 Abbildung 2.6: Klassifikationsschema nach Unterstützungsfunktionen...22 Abbildung 4.1: Anmeldeverfahren...44 Abbildung 4.2: Prüfung...45 Abbildung 4.3: Bewertung der Modulprüfung (1)...48 Abbildung 4.4: Bewertung der Modulprüfung (2)...49 Abbildung 5.1: Grading Management System...60 Abbildung 5.2: "Verwaltung/Module"...63 Abbildung 5.3: Koordinator kommuniziert mit den Teilmodulprüfern...63 Abbildung 5.4: an Koordinator schreiben...64 Abbildung 5.5: Instant Messaging...65 Abbildung 5.6: Dokumenten Vorschau...66 Abbildung 5.7: Wegweiser...67 Abbildung 5.8: Feedback...67 Abbildung 5.9: Workflow starten...68 Abbildung 5.10: Workflow erstellen...69 Abbildung 5.11: Meine Aufgaben...69 Abbildung 5.12: Initierter Workflow...69 Abbildung 5.13: Initiiertes Workflow-Dokument...70 Abbildung 5.14: Ansicht-Aktuell...71
8 Abbildungsverzeichnis vi Abbildung 5.15: Workflow Aufgaben-Dokument...71 Abbildung 5.16: Teilmodulprüfung...72 Abbildung 5.17: -Benachrichtigung...72 Abbildung 5.18: Bewertungen anzeigen...73 Abbildung 5.19: Ablage...74 Abbildung 5.20: Versionsänderung...75 Abbildung 5.21: Digitale Signatur...76
9 Tabellenverzeichnis vii Tabellenverzeichnis Tabelle 2.1: Raum-Zeit-Matrix zur Klassifikation von Groupware-Typen und Werkzeugen...20 Tabelle 3.1: GroupFlow-Continuum...33
10 Einleitung 1 1 Einleitung 1.1 Szenario (Es gibt) zwei Dinge, auf denen das Wohlgelingen in allen Verhältnissen beruht. Das eine ist, dass Zweck und Ziel der Tätigkeit richtig bestimmt sind. Das andere aber besteht darin, die zu diesem Endziel führenden Handlungen zu finden. Aristoteles ( ), griech. Philosoph, Begründer d. abendländ. Philosophie Weltweit sind derzeit in der gesamten Wirtschaft massive Umstrukturierungsprozesse zu beobachten. Den Hintergrund bilden die Umweltdynamik und der Wettbewerbsdruck, die in den Unternehmen die Entwicklung neuer Fähigkeiten oder die Aktivierung von brachliegenden Potentialen erfordern. Die Veränderungen des wirtschaftlichen Umfeldes zwingen Unternehmen zu einer ständigen Überprüfung ihrer Positionierung gegenüber den Wettbewerbern am Markt und zur Suche nach Innovationen und Wettbewerbsvorteilen (vgl. [Becker 2002], S. 3). Dabei verändern sich unter anderem die Organisationsstrukturen des Unternehmens, so dass Organisationen neu abgestimmt werden müssen. Außerdem wird die Aufgabenverteilung komplexer und Mitarbeiter sind gezwungen, über die Grenzen der Abteilungen hinaus, miteinander zu arbeiten und zu kommunizieren. Diese neue Situation erfordert eine kollaborative Unterstützung der Arbeitsprozesse. Mithilfe von Unterstützungsfunktionen wie Kommunikation, Koordination und Kooperation wird die gemeinsame Zusammenarbeit deutlich verbessert. Diese Funktionalitäten sind die zentralen Aspekte von Groupware Systemen, die Informationsverarbeitung und Kommunikationsprozesse unterstützen. In kollaborativen Arbeitsumgebungen werden den Mitarbeitern alle nötigen Funktionalitäten zur Verfügung gestellt, um die Komplexität der Aufgaben deutlich zu verringern. Dadurch wird erreicht, dass komplexe Aufgaben erfassbar gemacht werden und Benutzer die bestehende Informationsflut verarbeiten können. Zudem wird Prozessmanagement eingesetzt, um sowohl die Teilprozesse als auch den Gesamtprozess zu planen bzw. zu verbessern. Dabei wird Qualitätsmanagement als Teil des Prozessmanagements betrachtet. Auch Qualität ist im heutigen Wettbewerb ein entscheidender Faktor, um die Gunst der Kunden zu erlangen. Dafür werden die
11 Einleitung 2 Anforderungen der Kunden berücksichtigt und versucht, die gestellten Anforderungen zu erfüllen. Ein effizientes Prinzip ist es, die Qualität während des gesamten Prozesses zu überprüfen, anstatt Fehler erst am Ende zu finden und nachträglich mit hohem Aufwand zu beheben. Hierfür müssen die Prozesse so gestaltet werden, dass Fehlerquellen frühzeitig eliminiert werden können. Erst wenn der Prozess über alle betroffenen Abteilungen hinweg fehlerfrei und unter beherrschbaren Bedingungen abläuft, kann Qualität gewährleistet werden. Um der Komplexität der Prozesse entgegenzuwirken und die kollaborative Arbeitsumgebung zu unterstützen, wird ein Workflow-Management-System eingesetzt. Individuelle Arbeitsabläufe eines Unternehmens können damit automatisiert werden. Mithilfe von Modellierungswerkzeugen wie Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) und Unified Modeling Language (UML) lassen sich die Prozesse einfach modellieren. Unter anderem werden alle Ausnahmebehandlungen im Modell berücksichtigt, die sowohl für Teil- als auch für den Gesamtprozess von Bedeutung sind. 1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit Das Ziel dieser Diplomarbeit ist es, die Grundsätze des Prozessmanagements auf eine kollaborative Arbeitsumgebung anzuwenden. Die Arbeit soll den Gesamtprozess in einer kollaborativen Arbeitsumgebung verbessern und sowohl ein Augenmerk auf die Qualitätssicherung als auch auf die Nachhaltigkeit legen. Im Anschluss wird das erstellte Konzept am Beispiel des Grading Management Systems (GMS) prototypisch umgesetzt. Dieses System wurde bis jetzt vom Groupware Competence Center (GCC) realisiert, um die Prüfungsbewertungen durchführen zu können. Im folgenden Kapitel werden die Grundlagen der für diese Arbeit relevanten Begriffe erläutert. Dabei werden die zugehörigen Bereiche des Prozessmanagements, Qualitätsmanagements und einer kollaborativen Arbeitsumgebung erarbeitet. Verwandte Ansätze, die eine ähnliche Zielsetzung verfolgen, werden in diesem Abschnitt beschrieben. In Kapitel 3 werden die Ziele und Anforderungen an ein Konzept zum Qualitäts- und Prozessmanagement in einer kollaborativen Arbeitsumgebung herausgearbeitet. Es werden die zur Umsetzung der Anforderungen benötigten Unterstützungsfunktionen erarbeitet, wobei das System, das als Grundlage für das Konzept dient, abstrakt gehalten wird.
12 Einleitung 3 Aufbauend auf den vorangegangenen Kapiteln wird im vierten Kapitel das Szenario für das Bewertungsmanagement an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule Paderborn vorgestellt. Danach werden die aus Kapitel 3 vorgestellten Anforderungen auf das Bewertungsmanagement an Hochschulen konkretisiert und analysiert. Zu Beginn des fünften Kapitels wird das bisherige Bewertungsmanagement namens GMS der Universität Paderborn vorgestellt. Das System wird mit den derzeit vorhandenen Funktionen beschrieben. Im Anschluss daran wird ein Anwendungsfall des Bewertungsmanagements an der Universität Paderborn beschrieben, indem der Gesamtprozess einer Modulprüfung nachgespielt wird. Funktionen, die entsprechend des erarbeiteten Konzepts in dem System fehlen, werden ebenfalls erläutert und als Prototyp in das GMS implementiert. Kapitel 6 zeigt den Ausblick und gibt mögliche Erweiterungen des Konzeptes und weiteren Forschungsbedarf. Zum Schluss folgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeit.
13 Grundlagen und thematische Abgrenzung 4 2 Grundlagen und thematische Abgrenzung Zunächst werden die Grundlagen dieser Diplomarbeit und deren thematische Abgrenzung beschrieben, um die Diplomarbeit einzuordnen und die Verständlichkeit zu verbessern. In Kapitel 2.1 wird zunächst das Prozessmanagement erläutert, um im Anschluss in Kapitel 2.2 den Begriff des Qualitätsmanagements zu definieren. Danach findet in Kapitel 2.3 ein Vergleich zwischen Qualitäts- und Prozessmanagement statt. Abschließend wird in Kapitel 2.4 auf den Begriff kollaborative Arbeitsumgebung eingegangen. 2.1 Prozessmanagement In folgenden Abschnitt werden die Begriffe Prozess und Prozessmanagement (Kapitel und 2.1.2) beschrieben. Darauf folgt die Beschreibung des Prozessmanagement- Kreislaufs von Allweyer Definition Prozess In der Literatur existieren eine Vielzahl von Definitionen des Begriffs Prozess wobei in einigen Publikationen der Prozess mit dem Begriff Geschäftsprozess gleichgesetzt wird. Auch in dieser Arbeit sollen die beiden Begriffe gleichgesetzt werden. Ein Prozess ist die inhaltlich abgeschlossene, zeitliche und sachlogische Folge von Aktivitäten, die zur Bearbeitung eines prozessprägenden betriebswirtschaftlichen Objektes notwendig sind. ([Becker et al. 2002], S. 6). Rombach definiert einen Prozess im Kontext des Software Engineering als jede Aktivität, die ein Eingabe-Produkt konsumiert und ein Ausgabeprodukt erzeugt. Als Beispiele nennt er den gesamten Lebenszyklus, jede Aktivität des Lebenszyklus oder die Ausführung eines Übersetzungsprogramms (vgl. [Rombach 1990]). Prozess Input Aktivitäten A1 An Durchlaufzeit Output Abbildung 2.1: Prozess
14 Grundlagen und thematische Abgrenzung 5 Mit dem Fokus auf die Planung, Kosten und Qualität definiert Wallmüller, dass ein Prozess jede Aufgabe umfasst, die innerhalb eines geplanten und budgetierten Arbeitspakets auszuführen ist. Jedes Arbeitspaket konsumiert ein Eingabeprodukt mit bestimmten Anforderungen und führt zu einem (Ergebnis-)Produkt oder einer Dienstleistung, welches/welche definierten Anforderungen genügen. Ein Prozess hat einen Mehrwert und ist wiederholbar (vgl. [Wallmüller 1995], S. 136). Der Begriff Geschäftsprozess oder abgekürzt Prozess wird sowohl in der Literatur als auch in der Praxis je nach Blickwinkel oder Fachgebiet unterschiedlich benutzt. Allweyer unterscheidet sechs unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten des Prozessbegriffs (vgl. [Allweyer 2005], S. 51): Betriebswirtschaftliche Orientierung Die Definition umfasst eine zeitlich-logische Abfolge von Aktivitäten zur Erfüllung einer betrieblichen Aufgabe, wobei eine Leistung in Form von Material- und/oder Informationstransformation erbracht wird. Automatisierungsbezogene Verwendung Diese Definition bezieht sich auf Informationssysteme, deren Zweck die Automatisierung von Abläufen ist. Der Fokus liegt somit auf den durch ein Computersystem ausführbaren Teilen eines Prozesses. Schnittstellenbezogene Verwendung Diese Darstellung umfasst den im Rahmen des Prozesses stattfindenden Datenfluss, d. h. es wird definiert welche elektronischen Dokumente bei der Abwicklung eines Geschäftes ausgetauscht werden. Auf die Nutzung eines Anwendungssystems bezogene Verwendung Bei der Entwicklung von Anwendungssystemen werden häufig so genannte Use Cases betrachtet. Sie beschreiben wie bestimmte Aufgaben des Systems durchgeführt werden. Use Cases können als Geschäftsprozesse betrachtet werden, wenn sie bei betrieblichen Anwendungssystemen eingesetzt werden. Auf die Softwareentwicklung bezogene Verwendung Bei der Softwareentwicklung wird von einem Prozess gesprochen, wenn es darum geht zu beschreiben, aus welchen Phasen ein Softwareentwicklungs-
15 Grundlagen und thematische Abgrenzung 6 projekt besteht, in welcher Reihenfolge sie durchgeführt werden und welche Ergebnisse daraus erarbeitet werden. Solche Prozesse werden durch so genannte Prozessmodelle oder Vorgehensmodelle beschrieben. Falsche bzw. ungenaue Verwendung Falsche bzw. ungenaue Verwendung tritt auf, da der Begriff meist mit einer positiven Bedeutung besetzt ist. So wird der Begriff oft mit Funktionen gleichgesetzt. Aus diesen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten des Prozessbegriffes soll im weiteren Verlauf dieser Arbeit die Verwendung im betriebswirtschaftlichen Sinne genutzt werden Definition Prozessmanagement In vielen Unternehmen herrschen ungelöste Probleme, die zu Defiziten führen. Es mangelt an Effizienz, weil das Unternehmen unklare strategische Ziele und unklare Vorstellungen über Erfolgsfaktoren und -potentiale vor Augen hat. Darüber hinaus sind die Marktziele und Produktziele unklar definiert. Zudem führt die mangelhafte Kenntnis der Kundenprobleme und -bedürfnisse dazu, dass es im Unternehmen zu Einbußen kommt. Die Ursache der Effizienzprobleme liegt in der unzureichenden Beherrschung der Prozesse. Sie sind mit nicht wertschöpfenden Aktivitäten überladen und erfordern wegen vieler Schnittstellen einen hohen Koordinationsaufwand. Es ist notwendig, der Zielsetzung eine ebenso hohe Aufmerksamkeit wie der Zielumsetzung zu schenken. Effektivitäts- und Effizienzprobleme lassen sich somit durch Geschäftsprozessmanagement deutlich reduzieren (vgl. [Schmelzer/Sesselmann 2001], S. 3-5). Hier werden nun einige Definitionen beschrieben, die im Zusammenhang mit Prozessmanagement genutzt werden. Unter Prozessmanagement sind alle inhaltlichen, ablaufbezogenen und kulturellen Managementfunktionen zu verstehen, die im Zusammenhang mit dem Einsatz einer Prozessorganisation auszuüben sind. Sie beziehen sich auf die zu erteilenden Prozessaufträge, die nicht formalisierten Aktivitäten in der formalisierten Ablauforganisation von Operationen und die nicht formalisierten Abläufe. ([Hässig 2000], S. 111).
16 Grundlagen und thematische Abgrenzung 7 Prozessmanagement ist eine Vorgehensweise, die Übersicht schafft und der wachsenden Komplexität entgegenwirkt. Die Prozesse des Unternehmens werden identifiziert, beschrieben und konsequent an den Anforderungen der Kunden ausgerichtet. So kann die Wertschöpfung erhöht und die Kundenzufriedenheit gesteigert werden. ( [Füermann/Dammasch 2002], S. 6). Bei Helbig wird Prozessmanagement als die [ ] Funktion definiert, die die Ansätze der radikalen Veränderung mit denjenigen der kontinuierlichen Verbesserung kombiniert. Es kann davon ausgegangen werden, dass im Laufe der kontinuierlichen Anpassungen ein Zeitpunkt eintritt, an dem diese nicht mehr der Situation gerecht werden, sondern radikale Veränderungen notwendig erscheinen, um optimale Verbesserungen zu erzielen. ([Helbig 2003], S. 17). Für die folgende Arbeit soll die Definition von Füermann/Dammasch übernommen werden Konzepte des Prozessmanagements Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Thema Geschäftsprozessmanagement zu strukturieren. Hier wird ein Konzept nach Allweyer vorgestellt der Prozessmanagement als einen Prozessmanagement-Kreislauf darstellt. Strategisches Prozessmanagement Kernprozesse und Ziele festlegen Prozessorientierung etablieren Balanced Scorecard Business Prozess Outsourcing Prozessentwurf Prozesse modellieren Prozesse analysieren: Prozesskostenrechnung, Simulation Sollprozesse entwerfen Prozesscontrolling Kennzahlen erheben Prozesse planen und steuern Business Activity Monitoring Ständige Verbesserung Prozessimplementierung Change Management Informationssysteme implementieren: ERP, BPMS Informationssysteme integrieren Abbildung 2.2: Geschäftsprozessmanagement-Kreislauf
17 Grundlagen und thematische Abgrenzung 8 Der Prozessmanagement-Kreislauf besteht aus den vier Blöcken strategisches Prozessmanagement, Prozessentwurf, Prozessimplementierung und Prozesscontrolling. Es wird gezeigt, dass es sich beim Prozessmanagement nicht nur um ein einmaliges Projekt, sondern um eine ständige Aufgabe handelt, in der die Prozesse und das Prozessmanagement laufend verbessert werden (vgl. [Allweyer 2005], S ). Strategisches Prozessmanagement Das strategische Prozessmanagement dient dazu, das Geschäftsprozessmanagement in der Unternehmensstrategie zu verankern. Es soll sichergestellt werden, dass die Geschäftsprozesse die strategischen Ziele des Unternehmens unterstützen. Eine weitere Aufgabe ist die Ausrichtung der Prozesse auf die definierten Unternehmensziele, d. h. es muss untersucht werden, welchen Einfluss die verschiedenen Geschäftsprozesse auf die Erreichung dieser Ziele haben und wie sie entsprechend gesteuert bzw. verändert werden müssen. Strategisches Prozessmanagement muss dafür sorgen, dass die Idee und die Bedeutung der Prozessorientierung im gesamten Unternehmen bekannt sind und das Geschäftsprozessmanagement konsequent eingeführt und gelebt wird. Prozessentwurf Unter Prozessentwurf fallen Aufgaben der Identifikation, Dokumentation und Analyse der Geschäftsprozesse. Außerdem werden verbesserte Prozesse erarbeitet und beschrieben, damit diese anschließend implementiert werden können. Ein Instrument für die Dokumentation und Analyse von Prozessen ist die Geschäftsprozessmodellierung. Sie Arbeitet in Form von Text, tabellarischen Darstellungen und grafischen Ablaufdiagrammen ohne Verwendung bestimmter Regeln, sowie der Erstellung von Modellen gemäß einer bestimmten Notation wie z. B. EPK. Die Auswahl einer geeigneten Darstellungsform hängt vom jeweiligen Verwendungszweck ab. Unter anderem gehören Vorgehensweisen und Kriterien für die Gestaltung von Sollprozessen zum Prozessentwurf. Je nach Zielsetzung sind unterschiedliche Aspekte zu beachten, wie z. B. für den Aufbau eines Qualitätsmanagement-
18 Grundlagen und thematische Abgrenzung 9 systems oder den Entwurf einer Systemlandschaft zur Unterstützung der entworfenen Prozesse. Prozessimplementierung In der Prozessimplementierung werden die entworfenen Prozesse in Form von organisatorischen Maßnahmen sowie der Implementierung von Informationssystemen umgesetzt. Wichtig ist es, die betroffenen Arbeitnehmer zur Mitarbeit zu motivieren. Für die Implementierung von Informationssystemen sind unterschiedliche Aspekte zu beachten. Es muss vorab geklärt werden, ob Standard-ERP-Systeme oder Workflow-Management-Systeme eingeführt oder ganz neue Software entwickelt werden soll. Darüber hinaus ist die Integration verschiedener Anwendungssysteme im Unternehmen und evtl. die Anbindung an die Systeme von Partnerunternehmen zu berücksichtigen. Prozesscontrolling Nachdem die Prozesse implementiert sind, ist es wichtig sie kontinuierlich zu überwachen, um festzustellen, ob die angestrebten Verbesserungen tatsächlich erreicht wurden. Veränderungen von Prozesskennzahlen und auftretende Probleme sollen anhand geeigneter Kennzahlen frühzeitig erkannt werden, um geeignete Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Es ist wichtig, wie diese Kennzahlen ermittelt und ausgewertet werden, die anschließend für die Planung und Steuerung der Prozessdurchführung genutzt werden. Dafür existiert das Business Activity Monitoring (BAM), das wichtige Ereignisse über alle Prozesse und Systeme hinweg überwachen kann. Auch die Expertise der Mitarbeiter trägt zur Verbesserung bei. Der Kreislauf schließt sich mit dem Übergang vom Prozesscontrolling zum strategischen Prozessmanagement. Die Ergebnisse des Prozesscontrollings fließen, etwa in Form von unternehmensweiten Auswertungen über die Qualität, Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Effizienz der durchgeführten Geschäftsprozesse, in das strategische Prozessmanagement ein.
19 Grundlagen und thematische Abgrenzung Qualitätsmanagement In diesem Kapitel werden die Grundsätze der Qualität und des Qualitätsmanagements beschrieben und erläutert (Kapitel und 2.2.2). Des Weiteren werden die Aufgaben des Qualitätsmanagements und deren Managementkonzept vorgestellt. Anschließend wird auf das Qualitätsmanagementsystem eingegangen Definition Qualität Das Wort Qualität ist der wohl am häufigsten benutzte Begriff, wenn die Güte eines Produktes oder einer Dienstleistung zu beschreiben wird (vgl. [Gaitanides et al.1994], S. 73). Grundlegende Arbeiten zum Verständnis des Begriffes Qualität unterscheiden fünf verschiedene Ansätze (vgl. [Garvin 1988]). Transzendenter Ansatz (Transcendent) Qualität ist absolut und universell, nicht präzise zu definieren und nur durch Erfahrungen empfunden. Produktbezogener Ansatz (Product-based) Qualität ist präzise und messbar. Qualitätsunterschiede werden durch bestimmte Eigenschaften oder Bestandteile eines Produktes auch quantitativ widergespiegelt. Anwenderbezogener Ansatz (User-based) Qualität hängt von den Erwartungen und Wünschen des Betrachters und weniger vom Produkt ab. Prozessbezogener Ansatz (Manufacturing-based) Qualität ist das Einhalten von Spezifikationen. Jede Abweichung impliziert eine Verminderung. Hervorragende Qualität entsteht durch eine gut ausgeführte Arbeit, dessen Ergebnis die Anforderungen zuverlässig und sicher erfüllt. Wertorientierter Ansatz (Value-based) Dieser Ansatz berücksichtigt die Kosten und setzt Qualität mit einem bestimmten vom Anwender akzeptierten Preis-Leistungsverhältnis gleich. Die unterschiedlichen Qualitätsdefinitionen weisen Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf. Beispielsweise werden die subjektiven und objektiven Qualitätsmerkmale
20 Grundlagen und thematische Abgrenzung 11 unterschiedlich gewichtet. Die Teileigenschaften werden summarisch auf der Grundlage individueller Gewichtungen bewertet und für objektive Messkriterien bestehen unterschiedliche Zugänge (vgl. [Mengedoht 1997], S. 12). Der transzendente Ansatz entspricht dem allgemeinen umgangssprachlichen Verständnis von Qualität, während die anderen Ansätzen sich zu kundenorientierten und herstellerorientierten Qualitätsbegriffen zusammenfassen lassen (vgl. [Schildknecht 1992], S. 27f). Nach ISO 8402 ist Qualität die Beschaffenheit einer Einheit bezüglich ihrer Eignung, festgelegte und vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen ([DIN EN ISO ], S. 9). In dieser Definition kennzeichnet der Begriff Einheit alles, was beschrieben und betrachtet werden kann. Dazu gehören Tätigkeiten, Prozesse, Produkte, Organisation Systeme und Personen (vgl. [Mengedoht 1997], S. 13). Insgesamt ermöglicht die Qualitätsdefinition nach DIN EN ISO 8402, dass Qualität als Relation zwischen realisierter Beschaffenheit und geforderter Beschaffenheit betrachtet werden kann (vgl. [Geiger 1992], S. 33) Definition Qualitätsmanagement Mit der DIN EN ISO 8402 wurde Qualitätsmanagement als die Gesamtheit aller Tätigkeiten definiert, die im Rahmen des Qualitätsmanagement-Systems die Ziele und Verantwortungen festlegen sowie diese durch Mittel wie Qualitätsplanung, Qualitätslenkung, Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung verwirklichen ([DIN EN ISO ], S. 15). Die Qualitätspolitik legt die umfassenden Absichten und Zielsetzungen einer Organisation zur Qualität dar. Sie bildet ein Element der Unternehmenspolitik und ist durch die oberste Leitung genehmigt (vgl. [DIN EN ISO ], S. 15). Ein wichtiges Prinzip ist es, von Anfang an unter Beachtung von Qualitätsmaßstäben zu produzieren, anstatt Fehler erst am Ende zu finden und dann nachträglich mit hohem Aufwand zu beheben Aufgaben des Qualitätsmanagements Seghezzi rundet die obige Definition praxisnah ab, indem er dem Qualitätsmanagement vier Fachfunktionen und eine Führungsfunktion zuordnet (vgl. [Seghezzi 1994], S. 18).
21 Grundlagen und thematische Abgrenzung 12 Qualitätsplanung Die Aufgabe der Qualitätsplanung ist das Erfassen der Bedürfnisse, deren Umsetzung in neue oder verbesserte Leistungen, sowie die Gestaltung der Qualität der Prozesse, die zur Erstellung der Leistungen erforderlich sind. Qualitätslenkung Die Aufgabe der Qualitätslenkung besteht darin, die Prozesse und Abläufe so zu steuern, dass nur fehlerfreie Leistungen geboten werden, welche mit den Spezifikationen konform sind. Qualitätsplanung Qualitätssicherung Qualitätslenkung Qualitätsförderung Abbildung 2.3: Aufgaben des Qualitätsmanagements Qualitätssicherung Für die Qualitätssicherung gilt es, verbleibende Risiken zu erkennen und durch zusätzliche Maßnahmen abzudecken. Qualitätsförderung Qualitätsförderung steigert die Qualität der Produkte, der Prozesse und der Unternehmung um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Durch die Querschnittsaufgaben der vier Fachaufgaben tritt im Rahmen des Qualitätsmanagements eine Schnittstellenproblematik auf. Aus diesem Grunde ist das Lenken der Qualität von großer Bedeutung. Um solche Probleme zu beherrschen, sind klare Zielsetzungen, wirkungsvolle Koordination und effiziente Kontrolle notwendig. Zu den Führungsaufgaben gehören die normativen, strategischen und operativen Bereiche, die im St. Gallern Managementkonzept beschrieben werden ([Seghezzi 1994],
22 Grundlagen und thematische Abgrenzung 13 S. 68). Dort werden die Managementaufgaben in Bezug auf die einzelnen Führungsebenen, die organisatorischen Strukturen, die Aktivitäten und das Verhalten von Führungskräften und Beschäftigten integriert. Normative Managementebene In der normativen Managementebene werden die Qualitätsgrundsätze des Unternehmens formuliert, die Qualitätsaktivitäten begründet. Unter anderem werden generelle Ziele, Prinzipien, Normen und Regeln vorgegeben ([Mengedoht 1997], S. 23). Strategisches Management Das strategische Management ist auf den Aufbau, die Pflege und die Ausbeutung von Erfolgspotentialen ausgerichtet, für die Ressourcen eingesetzt werden müssen ([Seghezzi 1994], S. 68). Operative Managementebene Die normativen und strategischen Vorgaben werden im Rahmen der Prozessbearbeitungen in der operativen Managementebene umgesetzt (vgl. [Seghezzi 1994], S. 68). Während normatives Management durch unternehmerische Aktivitäten begründet wird, wirkt strategisches Management richtungweisend auf sie ein. Normatives und strategisches Management bilden demzufolge die konzeptionelle Seite und damit die Rahmenordnung des Unternehmens. Die operative Ebene ist die Durchführungsebene (vgl. [Bleicher 1992], S. 68ff.) Total Quality Management Total Quality Management (TQM) ist eine sehr populäre und weit verbreitete Managementmethode, die zahlreiche verschiedene Interpretationen und Implementierungsformen findet (vgl. [Dier/Lautenbacher 1994], S. 98). Das Konzept des TQM stellt die Qualität in den Mittelpunkt aller unternehmerischen Aktivitäten. TQM bezeichnet einen vom Management ausgehenden Prozess, der die gesamte Unternehmensorganisation betrifft und dessen Ziele eine permanente Qualitätsverbesserung und Kundenzufriedenheit sind ([Großmann 1998], S. 31).
23 Grundlagen und thematische Abgrenzung 14 Jedes Unternehmen sollte ein klares Qualitätskonzept haben, welches die Qualitätspolitik in Strategien und Systeme umsetzt (vgl. [Seghezzi 1994], S. 57). TQM wird auch umfassendes Qualitätsmanagement genannt. Die DIN EN ISO 8402 definiert es als [ ] eine Führungsmethode einer Organisation, bei welcher Qualität in den Mittelpunkt gestellt wird, welche auf der Mitwirkung aller Mitarbeiter beruht und welche auf langfristigen Erfolg durch Zufriedenstellung der Arbeitnehmer und durch Nutzen für die Mitglieder der Organisation und für die Gesellschaft zielt. ([DIN EN ISO 8402], S. 18). Unternehmenskultur und -strategie sind hierauf auszurichten (vgl. [Bühner 1995], S. 38). Folgende Grundsätze für TQM werden unter Allweyer aufgelistet (vgl. [Allweyer 2005], S. 281): Kundenorientierung Verantwortung der Unternehmensführung Einbeziehung der Mitarbeiter Prozessorientierung (Prozessmanagement) Systemorientierter Ansatz Ständige Verbesserung Sachbezogener Ansatz zur Entscheidungsfindung Lieferantenbeziehungen zum gegenseitigen Nutzen Qualitätsmanagementsystem Das Qualitätsmanagementsystem (QMS) stellt die zur Verwirklichung des Qualitätsmanagements festgelegte Organisationsstruktur, Verfahren, Prozesse und Mittel dar (vgl. [DGQ 1995], S. 31). Es schafft die Rahmenbedingungen für die Sicherstellung, Förderung und ständige Verbesserung der Qualität von Produkten und den dazugehörigen Prozessabläufen (vgl. [Pfeifer 1993], S. 343ff.). Normenreihe DIN EN ISO 9000:2000 Die international gültige Normenreihe zu QMS DIN EN ISO 9000ff. bzw. ISO Familie stellt die Grundlage für ein normenkonformes Qualitätsmanagement dar und wurde zur weltweit meistgenutzten ISO-Norm. Die bisherige Normenreihe ISO
24 Grundlagen und thematische Abgrenzung :1994 wurde ihrerseits im Dezember 2000 durch die weiterentwickelte und neu gefasste Normenreihe ISO 9000:2000 ersetzt. In den folgenden Absätzen werden die neuen Normenreihe vorgestellt und beschrieben. ISO Qualitätsmanagementsysteme, Grundlagen und Begriffe Diese Norm dient der Unterstützung von Unternehmen bei der Einführung und dem Arbeiten mit QMS. Dazu werden die Grundlagen von QMS erläutert und Begriffe des Qualitätsmanagements definiert und erklärt. Mithilfe dieser Norm erhält der Anwender die inhaltlichen und begrifflichen Kenntnisse zum sicheren Umgang mit der DIN EN ISO 9000-Normenfamilie (vgl. [DIN EN ISO 9000]). ISO Qualitätsmanagementsysteme, Forderungen Diese Norm legt die internationalen Forderungen an die Gestaltung von QMS fest. Sie beinhaltet die wesentlichen Inhalte für die normkonforme Darlegung von QMS und bildet damit auch die Grundlage für die Erteilung von Zertifikaten. Im Gegensatz zu den ersten Versionen der DIN EN ISO 9000 können sich Unternehmen nur noch gemäß DIN EN ISO 9001 zertifizieren lassen, unabhängig von Entwicklungsverantwortung, Fertigungstiefe und Branchenzugehörigkeit (vgl. [DIN EN ISO 9001]). ISO Qualitätsmanagementsysteme, Leitfaden Diese Norm basiert auf den Grundsätzen der DIN EN ISO 9001 und gibt Empfehlungen bzw. Anregungen zur Einführung und zur Verbesserung von QMS. Sie dient als Ergänzung und gibt Hilfestellung bei der Interpretation der DIN EN ISO 9001-Forderungen (vgl. [DIN EN ISO 9004]). ISO Leitfaden für Managementsystemaudits Diese Norm kennzeichnet die Durchführung von internen und externen Audits von QMS. Sie dient damit zur Festlegung eines einheitlichen Auditierungsablaufs durch Kunden und Dritte, gibt aber auch Hinweise für die Durchführung interner Audits zur kontinuierlichen Bewertung der Wirksamkeit des QMS (vgl. [DIN EN ISO 19011]). Die revidierten Normen DIN EN ISO 9001 und 9004 verwenden eine neue, prozessorientierte Struktur. Grundlage der Norm DIN EN ISO 9000 ist ein
25 Grundlagen und thematische Abgrenzung 16 Prozessmodell, welches die Bestandteile eines Qualitätsmanagementsystems in einen strukturellen Zusammenhang bringt (vgl. [Pfeifer 2001], S. 70). Ständige Verbesserung des Qualitätsmanagementsystems Interessierte Parteien Forderungen Management der Mittel Eingabe Verantwortung der Leitung Produktrealisierung Messung, Analyse, Verbesserung Ergebnis Produkt Zufriedenheit Interessierte Parteien Abbildung 2.4: Struktur eines prozessorientierten QM-Systems Der ablauforientierte Aufbau eines prozessorientierten QMS (Abbildung 2.4) zeigt deutlich den Ausgangspunkt jeder Produkterstellung oder Dienstleistung in den Markt und die Kundenforderungen. Der Kundenwunsch wird ermittelt und im Leistungserstellungsprozess realisiert. Die Weiterentwicklung der Produkte bzw. Dienstleistungen und die Optimierung der Abläufe erfolgt unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit (vgl. [Wiesheu/Spitzner], S. 8). Der European Quality Award operationalisiert die Philosophie des TQM auf europäischer Ebene (vgl. [Mengedoht 1997], S. 31). Unternehmen werden mit dem European Foundation for Quality Management (EFQM) ausgezeichnet, die besondere Leistungen auf dem Gebiet des Qualitätsmanagements vollbracht haben (vgl. [Pfeifer 2001], S. 28). Das in Abbildung 2.5 gezeigte Modell stellt die zur Beurteilung von Unternehmen verwendeten Kriterien im Zusammenhang dar. Es wird zwischen Befähiger und Ergebnisse unterschieden, wobei der Befähiger die Voraussetzung dafür ist, gute Ergebnisse zu erzielen. Die Analyse der erzielten Ergebnisse dient andererseits dazu, die Leistungen im Bereich der Befähiger zu verbessern (vgl. [Allweyer 2005], S. 278).
26 Grundlagen und thematische Abgrenzung 17 Befähiger Ergebnisse Mitarbeiter- Mitarbeiter bezogene Ergebnisse Führung Politik und Strategie Prozesse Kundenbezogene Schlüsselergebnisse Ergebnisse Partnerschaften Gesellschafts- und Ressourcen bezogene Ergebnisse Innovation und Lernen Abbildung 2.5: EFQM - Modell 2.3 Qualitätsmanagement als Prozessmanagement Im deutschsprachigen Raum wurde der Begriff des Prozessmanagements Ende der achtziger Jahre von Striening geprägt, der die starken Bezüge zum Qualitätsmanagement betonte (vgl. [Striening 1988]). Der Gestaltungsbereich der Prozesse bezieht sich auf ihre Struktur und Arbeitsweise sowie auf die Qualität ihrer Produkte, die innerhalb dieser Struktur fließen. Diese Form des Prozessmanagements wird in der DIN EN ISO 9000-Familie als Qualitätsmanagement betrachtet (vgl. [DIN EN ISO ], S. 15). Die weltweit gültige Normenreihe zu QMS DIN EN ISO 9000ff. setzt voraus, dass jegliches Werk durch einen Prozess geschaffen wird (vgl. [DIN EN ISO ], S. 15). Die wichtigsten betrieblichen Prozesse sind hervorzuheben und für die Zwecke des Qualitätsmanagements zu vereinfachen, einer Rangfolge zu unterwerfen und miteinander zu koordinieren. Im Rahmen eines effektiven QMS sind für die Prozesse die Verantwortlichkeiten, die Befugnisse, die Verfahren und die Mittel festzulegen (vgl. [DIN EN ISO ], S. 17). Der prozessorientierte Qualitätsbegriff zielt auf eine Verbesserung einzelner Prozesse und eine prozessübergreifende Optimierung (vgl. [Mengedoht 1997], S. 19). Das Prozessmanagement hat die Aufgabe, sicherzustellen, dass das Prozessergebnis in der angestrebten Produkt- und Prozessqualität unter Berücksichtigung der Qualität der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten erreicht wird. Es zielt dabei auf die
27 Grundlagen und thematische Abgrenzung 18 organisatorische Entwicklung des Unternehmens ab (vgl. [Großmann 1988], S. 34). Neben der einmaligen Erneuerung des gesamten Unternehmens, der Prozessorganisation und des Prozessmanagement umfasst es permanentes Prozesscontrolling, d. h. eine gesteuerte kontinuierliche Prozessverbesserung ([Gaitanides et al. 1994], S. 12). Darüber hinaus ist zu erkennen, dass Prozess- und Qualitätsmanagement bei genauer Betrachtung untrennbar miteinander verbunden sind. Der oben dargelegte, umfassende Qualitätsbegriff verfolgt wesentliche Ziele des Prozessmanagements. Qualitätsmanagement liefert außerdem wichtige Kennzahlen und Messgrößen für das Prozessmanagement und gibt Hinweise für die qualitätsgerechte Gestaltung der Prozesse. Umgekehrt sind die mit dem Qualitätsmanagement verbundenen Ziele nicht ohne eine Betrachtung und ein gezieltes Management der Prozesse zur erreichen (vgl. [Allweyer 2005], S. 278). Prozessmanagement und Qualitätsmanagement müssen einander ergänzen, denn das eine geht nicht ohne das andere. (vgl. [Striening 1988], S. 3). Der enge Zusammenhang zwischen Prozessen und Qualitätsmanagement wird auch in dem von der EFQM verwendeten EFQM - Modell deutlich, die bereits im vorherigen Kapitel erläutert wurde (siehe Kapitel 2.2.5). 2.4 Kollaborative Arbeitsumgebung In diesem Kapitel werden die Begriffe der Computer Supported kooperative Work (CSCW) und Groupware beschrieben (Kapitel und Kapitel 2.4.2). Darauf folgen die Beschreibungen der Formen der Interaktionsmechanismen und die zugehörigen Systemklassen Computer Supported Cooperative Work CSCW stellt ein Forschungsgebiet dar, das sich mit der Computerunterstützung kooperativen Arbeitens befasst. Erklärtes Ziel der CSCW-Forschung ist, die Zusammenarbeit von Menschen durch den adäquaten Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien zu verbessern, d. h. sowohl effizienter und flexibler als auch humaner und sozialer zu gestalten. Das Forschungsgebiet CSCW zeichnet sich dabei durch sein interdisziplinäres Zusammenspiel von Themen der
28 Grundlagen und thematische Abgrenzung 19 Wirtschaftsinformatik, Arbeitswissenschaft, Psychologie und Kommunikationswissenschaften aus (vgl. [Nastansky et al. 2002], S. 238). In allen Bereichen werden diese durch Modellierung von Kooperationen aus fachspezifischer Sicht die Möglichkeiten der Rechnerunterstützung erforscht. Anhand von Befragungen werden außerdem die Auswirkungen von Groupware auf Menschen und Arbeitsprozesse analysiert ([Burger 1997], S. 8) Groupware Definition Groupware bezeichnet die Menge der Technologien, die Kollaboration mithilfe des Computers unterstützen. Johansen erläutert dies genauer: "Groupware is a generic term for specialised computer aids that are designed for the use of collaborative work groups. Typically, these groups are small projectoriented teams that have important tasks and tight deadlines. Groupware can involve software, hardware, services and/or group process support." ([Johansen 1988], S. 1). Groupware ist somit eine Kategorie von Softwarewerkzeugen (vgl. [Johansen 1991], S. 4f). Da diese Hilfsmittel die Kooperation innerhalb von Teams unterstützen, können sie als Kooperations- oder Teamware bezeichnet werden. Es hat sich jedoch der Begriff Groupware eingebürgert, unter dem Hard- und Software zu verstehen ist, die zum Zweck der Kooperationsunterstützung eingesetzt wird ([Burger 1997], S. 7) Interaktionsmechanismen Beschreibendes Merkmal verteilter CSCW-Systeme ist, dass eine Aufgabe von den entfernten Elementen gemeinsam übernommen wird. Als formale Interaktionsmechanismen mit unterschiedlichen Intensitätsgraden werden Information, Koordination, Kooperation und Kollaboration unterschieden, wobei bei allen vieren die Kommunikation ein zentrales Element darstellt. Die Mechanismen der Interaktionen basieren auf dem Informationsaustausch (vgl. [Gronau 2002]). Kommunikation Unter Kommunikation wird der Austausch von Informationen verstanden, wobei Informationen im Sinne der Betriebswirtschaftslehre zweckorientierte oder zielgerichtete Daten bzw. Nachrichten darstellen. Ziel von Kommunikations-
29 Grundlagen und thematische Abgrenzung 20 handlungen ist die Erweiterung, Korrektur oder Absicherung von vorhandenen Daten- oder Informationsbeständen (vgl. [Gronau 2002]). Der Kommunikation kommt vor allem bei der Arbeit im Team eine Schlüsselrolle zu, da sie die Grundlage der Kooperation und Koordination darstellt (vgl. [Nastansky 2002], S. 240). Kooperation Als Kooperation wird die arbeitsteilige Leistungserstellung zwischen verteilten Aufgabenträgern, Organisationseinheiten oder Organisationen bezeichnet (vgl. [Schmidt 1997]). Kooperation baut auf der Dimension der Kommunikation auf und stellt den Austausch von Informationen mit einem gemeinsamen Ziel dar. Es müssen jedoch mindestens zwei Personen in einen gemeinsamen, zielgerichteten Kooperationsprozess involviert sein ([Dierker/Sander 1998], S. 104f.). Aufgabenträger arbeiten gemeinsam an einem Ergebnis, wobei individuelle Ziele dem Ziel der Gruppe untergeordnet werden und Entscheidungen gemeinsam getroffen werden. Darüber hinaus kann die Leistung jedes Einzelnen getrennt bewertet werden (vgl. [Huang 2004], S. 111). Der Grad an Verteiltheit in räumlicher oder zeitlicher Hinsicht wird durch das so genannte zweidimensionale Schema mit den Dimensionen Raum und Zeit nach Johansen veranschaulicht und wird in dem Fall benötigt, wenn das Team räumlich getrennt arbeitet (vgl. [Johansen 1988], S. 44). Zusammenarbeit der Teammitglieder am gleichen Ort an verschiedenen Orten zu gleicher Zeit Systeme zur computerunterstützten Sitzungsmoderation Präsentationssysteme Group Decision Support Systems Audio- und Videokonferenz- Systeme Screen-Sharing-Systeme Mehrautorensysteme zu verschiedenen Zeiten Systeme zum Terminkalender- Management für Gruppen Projektmanagement-Systeme -Systeme Voic -Systeme Systeme für Electronic Conferencing Elektronische Bulletin Boards Shared Information Systems Workflow-Systeme Tabelle 2.1: Raum-Zeit-Matrix zur Klassifikation von Groupware-Typen und Werkzeugen Die Raumdimension wird unterteilt am gleichen Ort oder an verschiedenen Orten wohingegen die Dimension der Zeit nach zu gleicher Zeit oder zu
30 Grundlagen und thematische Abgrenzung 21 verschiedenen Zeiten aufgegliedert wird. Die Darstellung erfolgt meist in Form einer Matrix mit vier Quadranten, in die verschiedene Systemklassen zur Unterstützung spezifischer Kooperationssituation eingetragen sind (Tabelle 2.1). Koordination Als Koordinationsmechanismen werden die Regelungen bezeichnet, die der Beherrschung von Interdependenzen und der Abstimmung und Ausrichtung der Tätigkeiten auf das Gesamtziel dienen (vgl. [Kieser/Kubicek 1992], S. 95). Die Dimension der Koordination baut demnach auf der Kommunikation und Kooperation auf und ermöglicht den aufgabengerechten Ressourceneinsatz sowie eine effiziente Teamarbeit (vgl. [Nastansky 2002], S. 242). Kollaboration Kommunikation, Koordination und Kooperation beziehen sich auf Aufgaben, die von den einzelnen Elementen verteilter Systeme ausgeführt werden. Als Spezialfall der Kooperation soll hier die gemeinsame Ausführung einer Teilaufgabe am selben Objekt durch verteilte Aufgabenträger herausgestellt werden, die als Kollaboration bezeichnet wird (vgl. [Gronau 2002]). Bei der Kollaboration werden Informationen zur Sicherstellung eines gemeinsamen Arbeitsergebnisses ausgetauscht. Sie bilden aus diesem Grund die inhaltliche Ausgestaltung der Koordination in verteilten Systemen. Aufgabenträger arbeiten gemeinsam an der Aufgabenerfüllung, so dass die Abgrenzung der einzeln zu bearbeitenden Teilaufgaben und somit die getrennte Bewertung der Leistungen der einzelnen Aufgabenträger nicht mehr möglich ist ([Huang 2004], S. 111) Systemklassen Auf Basis der Kommunikations-, Kooperations- und Koordinationsunterstützung lassen sich die Systemklassen nach Workflow-Management, Workgroup Computing, gemeinsame Informationsräume und Kommunikation einteilen. Dieses Klassifikationsschema nach Unterstützungsfunktionen ist in Abbildung 2.6 dargestellt (vgl. [Nastansky et al. 2002], S. 243).
31 Grundlagen und thematische Abgrenzung 22 Kommunikation Workflow Management Video- Konferenzsysteme Gemeinsame Informationsräume Workflow Management Wertkzeuge Spez. Datenbanken Planungssysteme Bulletin- Boad- Systeme Verteilte Hypertext- Systeme Entscheidungsund Sitzungsunterstützungssysteme Gruppeneditoren Workgroup Computing Abbildung 2.6: Klassifikationsschema nach Unterstützungsfunktionen Kommunikation Die Aufgabe von Kommunikationssystemen liegt in der Unterstützung des direkten Informationsaustausches durch die Überbrückung der Dimensionen Raum und Zeit, wie z. B. -Systeme oder Messaging-Systeme. Gemeinsame Informationsräume In gemeinsamen Informationsräumen können Informationen über längere Zeit gespeichert werden und stehen einer größeren Gruppe von Mitarbeitern zur Verfügung. Ein Beispiel dafür wären die verteilten Hypertext-Systeme. Workflow-Management Die Aufgabe des Workflow-Managements besteht in der Unterstützung stark arbeitsteiliger, meist organisationsweiter Prozesse, die einen hohen Strukturierungsgrad aufweisen und häufig durchgeführt werden. Workflow- Management-Systeme haben den Anspruch, die Bearbeitung von Vorgängen, die an Informationsobjekten vollzogen werden, durchgängig informationstechnologisch abzubilden und nach definierten Regeln zu unterstützen. Sie bieten Vorgangsgenerierung, -organisation, -steuerung, -verfolgung,
32 Grundlagen und thematische Abgrenzung 23 -information und -terminierung an (vgl. [Nastansky et al. 2002], S. 243). Es gibt zwei Arten von Workflows, die sich in ihren Nutzungsmöglichkeiten und in der Flexibilität der Vorganssteuerung unterscheiden. Transaktions Workflow- Management-Systeme legen Prozessabläufe, Vorgangs- und Statusprüfungen, Aufgabenzuordnungen und -prioritäten im Voraus durch Regeln fest, so dass die laufende Prozesssteuerung von den Bearbeitern kaum mehr beeinflusst werden kann. Infolgedessen werden sie fremdgesteuert und ihre Eingriffsmöglichkeiten in hohem Maße angeleitet. Sie stützen sich auf gut strukturierbare Abläufe, die im Voraus durch unterschiedliche Regeln und Prozeduren gut beschrieben und definiert werden können. Ad-hoc-Workflow-Management erweitert die Funktionalität transaktionsorientierter Systeme um laufende Eingriffsmöglichkeiten, so dass Prozessabläufe während des Prozessablaufs durch die Bearbeiter verändert werden können. Sie sind flexibler und unterstützen unstrukturierte, kurzlebige und in der Komplexität sehr unterschiedliche Aufgabenstellungen. Workgroup Computing Unter Workgroup Computing wird die computergestützte Zusammenarbeit überschaubarer Arbeitsgruppen und -teams im Rahmen gemeinsamer, zeitlich befristeter Arbeitsprozesse verstanden. (vgl. [Nastansky et al. 2002], S. 244). Sie unterstützen die Kooperation von in Gruppen arbeitenden Personen, die Aufgaben mittleren bis geringen Strukturierungsgrades und niedriger Wiederholfrequenz bearbeiten (vgl. [Teufel et al. 1995], S. 28).
33 Konzept für Qualitäts- und Prozessmanagement in kollaborativen Arbeitsumgebungen 24 3 Konzept für Qualitäts- und Prozessmanagement in kollaborativen Arbeitsumgebungen Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Grundsätze des Prozessmanagements auf eine kollaborative Arbeitsumgebung anzuwenden. Dies soll den Gesamtprozess verbessern und sowohl ein Augenmerk auf die Qualitätssicherung als auch auf die Nachhaltigkeit legen. Zunächst sollen die Ziele für die Prozesse einer kollaborativen Arbeitsumgebung ermittelt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Prozesse im Einklang mit den Zielen stehen. Danach werden aus diesen Zielen Unterstützungsfunktionalitäten abgeleitet, die mit den entsprechenden Anforderungen beschrieben werden. 3.1 Ziele Das Ziel dieser Diplomarbeit ist es Qualitätsmanagement und Prozessmanagement in einer kollaborativen Arbeitsumgebung zu etablieren und sicherzustellen. Optimierungspotenziale können genutzt werden, wenn bestehende innerbetriebliche Prozesse konsequent auf die Bedürfnisse des Geschäftsnetzwerkes ausgerichtet werden. Aus diesem Grund sollte der Fokus auf die Unterstützung des Prozessmanagements, die Implikation der stattfindenden Prozesse und deren Zuständigkeiten liegen. Parallel soll auf die Sicherung der Qualität eingegangen werden, da der Qualität eine besondere Rolle in der Geschäftsprozessmodellierung zukommt. Durch die Einhaltung der Qualität kann die Ausfallsquote verringert werden. In allen Zielen wird die Qualität miteinbezogen, weil sie ebenfalls der Anforderung des Prozessmanagements entspricht. Beide Managementmethoden versuchen Redundanzen zu vermeiden, die unweigerlich im Projektverlauf zu Inkonsistenzen führen könnten. Um das Hauptziel zu erreichen, müssen die im Anschluss beschriebenen Punkte in dieser Diplomarbeit berücksichtigt werden (Kapitel bis 3.1.3) Effiziente Projekt- und Teamorganisation Für die kollaborative Arbeitsumgebung ist die effiziente Projekt- und Teamorganisation relevant, da auf diese Weise der Gesamtprozess von Anfang bis Ende ohne Schwierigkeiten durchlaufen werden kann. Beispielsweise können sowohl Reaktionszeiten auf Anfragen minimiert als auch Probleme bei der Teamarbeit beseitigt
34 Konzept für Qualitäts- und Prozessmanagement in kollaborativen Arbeitsumgebungen 25 werden. Darüber hinaus wird der Dialog zwischen den Mitarbeitern gefördert. Diese Ziele werden in den Kapiteln bis detaillierter vorgestellt und es wird auf die Anforderungen eingegangen Gezieltes Dokumentenmanagement / Archivierung In einer kollaborativen Arbeitsumgebung werden meist beträchtliche Mengen an Daten und Dokumenten produziert, die strukturiert, gespeichert, verteilt, abgerufen und modifiziert werden müssen. Auf diese Weise entstehen unterschiedliche Konfigurationen und Versionen der Dokumente. Änderungen an Dokumenten führen dazu, dass eine neue Dokumentenversion erzeugt wird. Dadurch können alle Kommentare, textinhaltliche Veränderungen und sonstige, revisions- und archivrelevante Ergänzungen nachvollziehbar belegt werden. Einzelne Benutzer haben in Bezug auf die Dokumente unterschiedliche Rollen mit verschiedenen Zugriffsrechten. Unter dem Ziel des Berechtigungsmanagements (Kapitel 3.1.3) werden die Sicherheitsdienste behandelt und erläutert Berechtigungsmanagement Der Gewährleistung von Sicherheit ist besondere Beachtung zu schenken, wenn der Benutzer über öffentliche Netze an die Daten gelangen will, d. h. ein unberechtigter Zugriff auf sensible Unternehmensdaten muss unbedingt verhindert werden. Aus diesem Grund muss die Identität jedes Benutzers zweifelsfrei festgestellt werden können. Nur durch die Berechtigung im Rahmen der zugewiesenen Individual- und Gruppenrechte können sie miteinander operieren. 3.2 Unterstützungsfunktionalitäten In diesem Unterkapitel sollen nun die Ziele aus Kapitel 3.1 hergeleitet werden. Um die zuvor genannten Ziele zu erreichen, werden die Anforderungen ermittelt und beschrieben. Die Qualität wird in diesem Teil der Arbeit betrachtet, da es ein Teilgebiet des Prozessmanagements ist, so dass sie in jedem der unten genannten Abschnitte behandelt wird. Kapitel beschreibt die effiziente Kommunikation in einem Projekt oder einem Team während Kapitel auf die gezielte Information eingeht. Im Anschluss wird in Kapitel die Terminplanung erläutert. Kapitel beschreibt das Workflow-
35 Konzept für Qualitäts- und Prozessmanagement in kollaborativen Arbeitsumgebungen 26 Management. Die letzten beiden Kapitel beschreiben das Dokumentenmanagement und Berechtigungsmanagement (Kapitel und Kapitel 3.2.6) Effiziente Kommunikation in einem Projekt oder einem Team Um das Ziel effizienter Projekt- und Teamorganisation in einer kollaborativen Arbeitsumgebung zu erreichen, muss die Kommunikation möglichst effektiv gestaltet sein. Wie in den thematischen Grundlagen beschrieben, spielt die Kommunikation eine wichtige Rolle, um eine kollaborative Arbeitsumgebung zu unterstützen. Effiziente Kommunikation ermöglicht es, sowohl intern als auch extern, Prozesse zu optimieren, Abläufe zu verbessern und den Aufwand zu reduzieren. Die Basis jeglicher Zusammenarbeit ist die Kommunikation. An erster Stelle werden die Qualitätsmerkmale beschrieben, die im Zusammenhang mit effizienter Kommunikation berücksichtigt werden müssen. Anschließend werden einige Techniken daraufhin untersucht, inwiefern sie für kollaborative Arbeitsumgebungen eingesetzt werden können. Qualität bei der Zusammenarbeit bedeutet eine schnelle, sichere und vielseitige Kommunikation. Der interne Informationsfluss zwischen den Mitarbeitern soll gefördert werden, so dass bestimmte Fragen und Informationen durch den Austausch von Wissen zwischen den Teammitgliedern geklärt werden können. So kann die Produktivität in einem Team gesteigert werden. Außerdem verringern sich die Kosten für die Kommunikation im Vergleich mit der papierbasierten Form. Es gibt eine Vielzahl von anwendungsunterstützten Kommunikationsformen. An dieser Stelle werden geeignete Kommunikationstechniken wie , Chat und Instant Messaging aufgegriffen und erläutert. ist ein asynchrones Kommunikationswerkzeug, das für den elektronischen Versand von Mitteilungen in Form von Briefen, Memos und anderen Texten eingesetzt werden kann. s können durch Anhänge erweitert werden. ist eine sichere und vielseitige Kommunikationsform. Die Sicherheit wird durch Verschlüsselungsmechanismen gewährleistet, die eingesetzt werden können. Die Vielseitigkeit entsteht dadurch, dass neben reinem Text auch
36 Konzept für Qualitäts- und Prozessmanagement in kollaborativen Arbeitsumgebungen 27 Multimediaobjekte versand werden können. Schnelligkeit ist nicht gegeben, da nach dem Versenden einer Wartezeiten existieren bis der Empfänger die gelesen und darauf geantwortet hat. Chat Bei Chat werden zwei verschiedene Ausprägungen erläutert: o Instant Messaging Instant Messaging ist nicht nur eine verbreitete Kommunikationsform, die nicht nur oft privat, sondern auch im geschäftlichen Umfeld genutzt wird, weil sie schneller und effizienter ist als . Instant Messaging ist eine Form des Chat, in der jeweils zwei Personen miteinander kommunizieren können. Entscheidender Unterschied zu gewöhnlichen Chatprogrammen ist eindeutig die ständige Statusanzeige der Anwesenheit, die so genannte Presence Awareness. Beim Chat ist dies erst sichtbar, wenn der Benutzer ein Chatroom betreten hat. Eine ausführlichere Darstellung wird im Abschnitt Awareness erläutert. Auf einen Blick wird in Instant Messaging ersichtlich, ob ein gewünschter Ansprechpartner am Arbeitsplatz zu erreichen ist und für ein unmittelbares Online-Gespräch zur Verfügung steht. Diese Bereitschaft wird z. B. durch verschiedene Status-Symbole neben den Namen angezeigt. Des Weiteren besteht die Möglichkeit Dokumente auszutauschen. Die Beiträge der einzelnen Gruppenmitglieder werden in einer allen Gruppenmitgliedern zugänglichen Ablage gesammelt, dem gemeinsamen Arbeitsbereich. Während eines Online-Gesprächs werden die Daten archiviert. Folglich wird gewährleistet, dass die Gespräche dokumentiert werden können. o Konferenzsysteme Bei Konferenzen besteht die Möglichkeit, dass gleichzeitig mehrere, räumlich getrennte Kommunikationspartner sich miteinander unterhalten können. Zu den Konferenzsystemen zählen textbasierte Konferenzsysteme sowie Audio- und Videokonferenzsysteme.
37 Konzept für Qualitäts- und Prozessmanagement in kollaborativen Arbeitsumgebungen 28 Textbasierter Gruppenchat ist schnell, weil die Kommunikation in Echtzeit geschieht. Es ist sicher, weil Missverständnisse wie beispielsweise falsch verstandene Telefonnummern nicht vorkommen und der Text immer überprüft werden kann. Zudem kann die Verbindung, über die die Kommunikation stattfindet verschlüsselt werden, so dass auch ein Zugriff durch unberechtigte Personen unterbunden wird. Geführte Diskussionen können unter anderem archiviert werden, um Inhalte vergangener Konferenzen zu einem späteren Zeitpunkt nachlesen zu können. Der Vorteil bei Audiokonferenzen ist, dass kein mühseliges und manchmal langsames Schreiben benötigt wird und diese Kommunikationsform demnach als schnell betrachtet werden kann. Jedoch muss für eine gute Sprachqualität gesorgt werden um den Beteiligten die Kommunikation nicht unnötig zu erschweren. Außerdem ist das Vorhandensein von Mikrofon und Lautsprecher nötig, weil ansonsten die Audiokommunikation nicht durchgeführt werden kann. Ähnlich verhält es sich bei Videokommunikation, bei der zusätzlich noch eine Kamera benötigt wird. Ein Nachteil der Audio- und Videokommunikation ist der wesentlich höhere Speicherbedarf zur Archivierung der Konferenzen. Die Vielseitigkeit ist bei Teamkonferenzen nicht gegeben, da außer der direkten Kommunikation keine weiteren Funktionen zur Verfügung stehen. Awareness Awareness ist eine Möglichkeit die Kommunikation effizient zu gestalten. Mit dem Begriff wird das Bewusstsein über den Zustand und die Aktivitäten der Teilnehmer in kollaborativen Szenarien beschrieben. Awareness kommt im Bereich des gemeinsamen Arbeitsbereiches häufig vor, um über das Geschehen des Arbeitsprozesses wie z. B. über Änderungen oder Problemen miteinander kommunizieren zu können. Es gibt verschiedene Formen von Awareness, von denen zwei unterschiedliche Verfahren vorgestellt werden.
38 Konzept für Qualitäts- und Prozessmanagement in kollaborativen Arbeitsumgebungen 29 Presence Awareness Presence Awareness zeigt an, wer sich gerade angemeldet hat und demzufolge für jeden erreichbar ist. Weder das Telefon noch bietet dies zurzeit an. Nur das Instant Messaging, das bereits im obigen Abschnitt erläutert wurde, besitzt diese Statusanzeige. Bei Kollaborationszenarien ist es wichtig, dass jederzeit erkennbar ist, ob ein bestimmter Benutzer online und für eine Kommunikation verfügbar ist. Place Based Awareness Zusätzlich zu Presence Awareness kann bei Place Based Awareness festgestellt werden, welche Personen sich gerade an einem speziellen Ort befinden und welcher Tätigkeit der Benutzer gerade nachgeht. Deshalb ist es z. B. möglich zu sehen, wer im Moment in einem bestimmten Chatraum bzw. einer Teamkonferenz ist. Insgesamt ist Awareness eine wichtige Voraussetzung für effiziente Gruppenarbeit und wird in Chat-Tools oder in Instant-Messenger-Programmen verwendet. Die hierdurch wohl ausschlaggebende Zusatzfunktion zum Chat ist die Presence Awareness. Dadurch kann viel Zeit gespart werden, die normalerweise für die Versuche zum Erreichen eines Kollegen, per Telefon oder realer Begegnung, aufgewendet werden muss Gezielte Informationen Durch gezielte Informationen werden verschiedene Maßnahmen zur kontextgerechten Bereitstellung und Dokumentation von Informationen zur Verfügung gestellt. Um auf die Qualität und Anforderungen der Informationen einzugehen, werden diese nun beschrieben. Bei gezielten Informationen geht es darum, dem Benutzer die gewünschten Informationen schnell und ohne Umwege zur Verfügung zu stellen. Für den Benutzer sollte der Zugriff auf Informationen vereinfacht werden, damit relevante und maßgebliche Informationen schnell auffindbar sind. Auf diese Weise verbringt der Benutzer weniger Zeit damit, nach Informationen zu suchen und kann entsprechend produktiver arbeiten. Das Auffinden und Auswerten von Informationen gehört zu den Arbeitsaufgaben jedes Benutzers in einer kollaborativen Arbeitsumgebung. Daher sollte jeder Benutzer wissen,
39 Konzept für Qualitäts- und Prozessmanagement in kollaborativen Arbeitsumgebungen 30 welche Art von Informationen wo zu finden sind und wie man immer den Überblick über die tägliche Informationsflut behalten kann. So kann die Komplexität der Informationsverarbeitung verringert werden. Sie können Entscheidungen treffen, welche Informationen sie täglich gebrauchen und darüber hinaus unterschiedliche Prioritäten absteigend vergeben. Beispielsweise können bei jeder erneuten Anmeldung die für den Tag anstehenden Informationen für den Benutzer bereitgestellt werden. Es werden nachfolgend verschiedene Funktionen beschrieben, die zur Erreichung der Qualitätsmerkmale gefordert werden. Sie sollen die tägliche Arbeit des Benutzers erleichtern und seine reale Welt widerspiegeln. Anfänger- und Expertenmodus Ein Anfänger- und Expertenmodus soll dem Benutzer eine Hilfestellung geben, damit er weiß, wie spezifische Tätigkeiten ausgeführt werden können. Da jeder Benutzer unterschiedliche Kenntnisse und Ausbildung mit sich bringt, muss die Hilfestellung im System sehr flexibel und gut strukturiert sein. Die individuelle Anpassung der Hilfestellung ist ein Feature, das die Qualität der Bedienerfreundlichkeit erheblich steigern kann. Für den Anfängermodus kann beispielsweise ein Wegweiser eingesetzt werden. Der Benutzer weiß genau, was seine Aufgabe erfordert, um verschiedene Prozesse korrekt umsetzen zu können. Die Wahl des Expertenmodus ist hingegen für Benutzer, die viel Wissen mit sich bringen bzw. bereits mit dem System vertraut sind und so keine Hilfestellung mehr benötigen. Daher kann der Benutzer diese Funktion auch ausschalten bzw. ausblenden. Aufgabenübersicht Alle aktuellen oder bearbeiteten Termine sollen ersichtlich sein, so dass der Benutzer erkennen kann, welche Aufgaben er noch zu erledigen hat. Bei Fertigstellung einer Aufgabe wird diese als abgeschlossen bewertet und einer anderen Kategorie wie z. B. abgeschlossene Aktivität zugeordnet. Diese Übersichtlichkeit erleichtert es dem Benutzer, alle Termine und Fristen einhalten zu können.
40 Konzept für Qualitäts- und Prozessmanagement in kollaborativen Arbeitsumgebungen 31 Ablage In der Ablage können alle abgeschlossen Dokumente des Benutzers archiviert werden. Er hat jederzeit Zugriff auf alle eingehenden und abgehenden Dokumente, deren Bearbeitung nötig bzw. abgeschlossen ist. Suchfunktion Eine Suchfunktion ermöglicht dem Benutzer benötigte Dokumente zu finden. Auch archivierte Dokumente können schnell und leicht wieder gefunden werden. Hilfefunktion Mit der Hilfefunktion können Fragen des Benutzers nachgeschlagen werden. Unter anderem werden alle Teil- und Gesamtprozessabläufe beschrieben und schrittweise erläutert. Feedback Nicht nur Benutzer sind an gezielten Informationen interessiert, sondern auch die Entwickler bzw. Administratoren der kollaborativen Arbeitsumgebung können von Informationen profitieren. Mittels eines Feedback-Systems können die Benutzer ihre Erfahrungen und Probleme mit dem System an die zuständigen Mitarbeiter schicken. Diese Informationen können gesammelt und zur Verbesserung des Systems eingesetzt werden. Auf diesem Weg ist gewährleistet, dass das System nicht an den Wünschen der Benutzer vorbei entwickelt wird. Wegweiser Benutzer sollen bei der Bearbeitung von Aufgabenaktivitäten unterstützt werden. Dies ist vor allem für Benutzer nötig, die mit dem System noch nicht vertraut sind. Beispielsweise wird dem Benutzer bei der Erstellung eines Workflows geholfen. Dokumentenvorschau Die Dokumentenvorschau ist eine Ansicht, um die Inhalte eines Dokumentes direkt auf der Hauptseite ersichtlich zu machen. Dadurch werden Aktivitäten
41 Konzept für Qualitäts- und Prozessmanagement in kollaborativen Arbeitsumgebungen 32 zum Öffnen eines Dokumentes vermieden, wenn z. B. nur eine kurze Übersicht gewünscht wird. Workflow-Management-System Ein Workflow unterstützt Prozesszuständigkeiten, Terminierung, Vertreterregelung und andere Sonderbehandlungen. Es sind auch Aufgaben mit speziellen Abläufen denkbar, die mithilfe eines Workflows eingestellt werden können Terminplanung Die Terminplanung unterstützt Mitarbeiter in kollaborativen Arbeitsumgebungen bei der Einhaltung von Verabredungen und Fristen. Sie dient nicht nur der Planung von kurzen Zeiträumen, sondern ermöglicht die Darstellung des gesamten zeitlichen Ablaufs eines Prozesses, unabhängig von dessen Dauer. Mit einer konsequenten Terminplanung kann die Effizienz bei der Prozessdurchführung in einer kollaborativen Arbeitsumgebung vergrößert werden. Bei der Terminplanung sind verschiedene Anforderungen zu beachten, um eine hohe Qualität zu gewährleisten. So muss ständig überprüft werden, ob der aktuelle Ist-Zustand mit der Terminplanung übereinstimmt. Sollte dies nicht der Fall sein, so müssen geeignete Maßnahmen getroffen werden, um den Fehler zu korrigieren. Außerdem müssen die Leiter der Prozesse benachrichtigt werden, die qualifizierte Mitarbeiter mit der Korrektur beauftragen können. Des Weiteren müssen abhängig von der Terminplanung die Mitarbeiter rechtzeitig über ihre Aufgaben benachrichtigt werden. So können sie ihre Aufgaben planen und fristgerecht durchführen. Die Benachrichtigung über bestimmte Ereignisse sollte nicht explixit vom Benutzer angefordert werden, sondern automatisch vom System an die Mitarbeiter gesendet werden. Diese Benachrichtigung kann z. B. per versendet werden. Die Terminplanung kann unter anderem durch effiziente Kommunikation und eine Kalenderfunktion unterstützt werden Workflow-Management Innerhalb jedes Unternehmens existiert eine Vielzahl von Prozessen, die abgearbeitet werden müssen. Die Benutzer werden bei der Durchführung der Prozesse durch
42 Konzept für Qualitäts- und Prozessmanagement in kollaborativen Arbeitsumgebungen 33 Workflow-Management-Systeme unterstützt, die den Ablauf automatisieren. In Folge dessen wird eine strukturierte und kontrollierte Bearbeitung von Daten und Dokumenten ermöglicht. Außerdem werden Fehler beseitigt und die Qualität wird verbessert. Unter anderem werden Unternehmensvorgänge transparenter und jeder, der in einem Geschäftsablauf involviert ist, hat Zugriff auf die aktuellsten Informationen. Nastansky beschreibt in dem von ihm entwickelten GroupFlow-Continuum verschiedene Workflow-Typen. Diese reichen von flexiblen und offenen Ad-hoc- Vorgängen bis hin zu fest vorstrukturierten Prozessen. Ferner können unter anderem Mischformen entstehen, die in der folgenden Tabelle 3.1 vorgestellt werden (vgl. [Nastansky et al 2002], S. 301). Ad-hoc- Workflow basiert Store-and-forward - System, kein gemeinsamen Datenzugriff Task Force Nicht vorherbestimmter Workflow Gemeinsamer Datenzugriff, Einzelschritte Semi-strukturierter Workflow Vorherbestimmtes Vorherbestimmtes Ad-hoc Ausnahmen Team und nicht Team und vorherbestimmte vorherbestimmte Person(en) Anzahl von Person(en) Kombination von definierter Aufgabe und nicht vorherbestimmter Person Kombination von definierter Aufgabe und vorherbestimmter Anzahl von Personen Strukturieter Workflow mit Ausnahmebehandlung Standard- Workflow Fest strukturierter Workflow Fest vorherbestimmte Workflow Schritte Spontane (Re)action Diskussionsorientierte Person weist Eine verantwortliche Bearbeitung im Team Aufgaben innerhalb des Teams zu und definiert den Abschluss der Bearbeitung z. B. Spontanes Sammeln von Informationen z. B. Gemeinsames Verfassen von Publikationen Standard-Workflow z. B. Gemeinsames Erstellen eines Jahresberichts Die Anzahl der Teammitglieder für die Bearbeitung einer Aufgabe ist vorherbestimmt; die Bearbeitungsreihenfo lge ist variabel z. B. Mitzeichnungsverfahren Tabelle 3.1: GroupFlow-Continuum Einfach Fest durchzuführende flexible Veränderung des Workflows z. B. Konsumentenkre-dit mit besonderen Kundenwünschen vorherbestimmter und strukturierter Workflow z. B. Konsumentenkredit Standard-Workflows sind fest strukturierte Workflows, die für die Automatisierung von Routinetätigkeiten eingesetzt werden. Vordefinierte Workflow-Modelle determinieren die vollständigen Abläufe der einzelnen Aufgaben, Aktivitäten, Agenten und Weiterleitungspfade inklusive aller möglichen Alternativen. Diese sind durch geringe Variierung, hohe Stabilität und große Wiederholungsrate gekennzeichnet (vgl. [Huang 2004], S. 73).
43 Konzept für Qualitäts- und Prozessmanagement in kollaborativen Arbeitsumgebungen 34 Ad-hoc-Workflow Ad-hoc-Workflows werden nur teilweise und erst direkt vor der Verwendung des Workflows erstellt, weil sie spontan und unterschiedlich sind. Es ist auch möglich während der Laufzeit neue Schritte zu definieren indem sich die Planungs- und Ausführungsphase abwechseln (vgl. [Huang 2004], S. 73). Semi-strukturierte Workflow Semi-strukturierte Workflows sind eine Mischform aus Standard-Workflow und Ad-hoc-Workflow. Sie werden für kollaborative Geschäftsumgebungen eingesetzt, die inhärent von den Interaktionen zwischen Personen angetrieben werden und finden oft bei Prozessen wie z. B. Forschung und Entwicklung, Unternehmensplanung, Entscheidungsfindung statt (vgl. [Huang 2004], S. 73). Bei solchen Workflows werden verschiedene Qualitätsmerkmale gefordert von denen einige hier näher betrachtet werden. Es geht darum, alle elektronischen Daten, die zur Abwicklung des Prozesses benötigt werden, vom Workflow-Management-System weiterleiten zu lassen. Der Prozess setzt sich so lange fort, bis der Gesamtprozess vollständig abgewickelt ist. Hierfür werden Prozessverantwortlichkeiten und Prozesszuständigkeiten definiert, die dafür Rechnung tragen, dass der Prozess fachlich richtig abläuft. Deshalb ist die Vergabe von Rollen sehr wichtig, die mit der Auflistung der entsprechenden Kompetenzen und Verantwortung angegeben sind. Häufig wiederholte Prozesse werden so gut wie möglich automatisiert. Qualität stellt eine hohe Anforderung an die Prozesse, so dass die Art und der Zeitpunkt von Qualitätsprüfungen fortwährend kontrolliert werden sollte. Beim Planen eines Workflows können Termine eine wichtige Rolle spielen. Sie sorgen dafür, dass bestimmte Vereinbarungen der Prozesse eingehalten werden, z. B. bei Aufträgen, wo der Kunde eine Abgabefrist vorgibt. Qualität findet dort statt wo Zeitpunkt und Zeitraum die Prüfung in Anspruch nimmt. Außerdem können Ausnahmebehandlungen im Falle des Auftretens durch Regeln in die Prozesse eingebunden werden, so dass alle möglichen Ausnahmebehandlungen, wie beispielsweise Krankheitsfälle, berücksichtigt werden können. Bei einem Ausfall können die Prozesse an den Vertreter weitergeleitet werden. Mittels verschiedener Modellierungstechniken wie EPK und UML-Diagramme lassen sich die Prozesse modellieren.
44 Konzept für Qualitäts- und Prozessmanagement in kollaborativen Arbeitsumgebungen 35 Um Medienbrüche zu vermeiden wird auf papierbasierte Vorgansbearbeitung verzichtet. Es sollen nur noch elektronische Dokumente bearbeitet werden. Darüber hinaus sollen Systembrüche vermieden werden, um den Datentransfer zwischen unterschiedlichen Anwendungssystemen zu garantieren. Qualität muss aus diesem Grund über die gesamte Laufzeit des Prozesses überprüft werden. Dazu zählen unter anderem alle möglichen Ausnahmefälle, die bearbeitet werden müssen. Des Weiteren unterstützt das Workflow-System den parallelen Ablauf verschiedener Teilprozesse Dokumentenmanagement Dokumentenmanagement beinhaltet die Erfassung, Bearbeitung, Verwaltung und Speicherung von Dokumenten unter Sicherstellung von Genauigkeit, Performance, Sicherheit und Zuverlässigkeit, unabhängig davon, wo und in welchem Format die Dokumente gespeichert sind. Ein Dokument kann aus einem oder mehreren Einzelobjekten bestehen. Dokumente aus einem Einzelobjekt können z. B. ein Bild oder ein Datensatz sein. Mehrere Einzelobjekte können beispielsweise mehrere Bilder, eine Datei mit integrierten Bildern, Texten und Tabellen sein oder gemischte Inhalte aus mehreren Quellen beinhalten. Im Dokumenten-Management-System werden die Dokumente organisiert, bereitgestellt und archiviert. Unter anderem werden im Dokumenten-Management- System veränderliche dynamische Informationen flexibel gehandhabt. Im Folgenden werden Qualitätsmerkmale und Anforderungen des Dokumentenmanagements vorgestellt und erläutert. In einer kollaborativen Arbeitsumgebung werden viele Daten und Dokumente täglich verarbeitet, gespeichert und verändert. Um Redundanz zu verhindern, werden die Dokumente zentral auf einem Server gehalten. Dadurch verringern sich die Speicherplatzkosten, die durch Mehrfachablage von Dokumenten entstehen würden. Viele Dokumente sind meistens für unterschiedliche Benutzer zugänglich. Durch die parallele Zusammenarbeit kommt es vor, dass bei geänderten Dokumenten nicht klar ersichtlich ist, wer welche Änderungen vorgenommen hat. Um eine Mindestsicherheit zu gewährleisten, muss Dokumentenechtheit vorliegen. Diese kann mithilfe von Zugriffberechtigungskonzepten gewährleistet werden. Eine funktionierende
45 Konzept für Qualitäts- und Prozessmanagement in kollaborativen Arbeitsumgebungen 36 Rechteverwaltung und Sicherheit ist ein fester Bestandteil eines Dokumenten- Management-Systems. Die Sicherheit wird im Kapitel Berechtigungsmanagement näher erläutert. Sämtliche Änderungen an den Dokumenten sollen protokolliert werden. So kann die Nachvollziehbarkeit von Änderungen gewährleistet und Manipulationen verhindert werden. Bestimmte Daten müssen z. B. aus rechtlichen Gründen über einen längeren Zeitraum hinweg zugänglich sein. Deshalb sollte es möglich sein, überprüfte, korrigierte und fehlerfreie Fassungen von Dokumenten in Langzeitarchiven aufzubewahren. Durch ein automatisches Backup-System können Dokumente archiviert werden. Des Weiteren soll sichergestellt sein, dass alle archivierten Dokumente leicht auffindbar sind. Mithilfe von Stichwörtern oder einer eindeutigen Identifikation der Dokumente können Dokumente schnell gefunden werden. Benutzer können bei der Dokumentenerstellung unterstützt werden, in dem häufig benutzte Vorlagen verwaltet werden oder ein Workflow-System eingesetzt wird, das in einem Prozess die Dokumente automatisch weiterleitet. Hier werden einige Funktionalitäten vorgestellt, die für das Dokumentenmanagement in einer kollaborativen Arbeitsumgebung wichtig sind: Versionierung Um die Dokumentenechtheit in einer kollaborativen Arbeitsumgebung zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Änderungen der Dokumente den Personen zugeordnet werden können. Durch eine Versionierungsfunktion wird der Änderungsstatus von Dokumenten revisionssicher und transparent gespeichert. Dadurch soll sichergestellt werden, dass keine Manipulation an den Daten vorgenommen werden. Vor allem bei einer Änderung sollte es möglich sein, den Verlauf der geänderten Dokumente verfolgen zu können. Digitales Signieren Das Ziel des digitalen Signierens ist es, die Herkunft und Originalität einer Nachricht sicherzustellen. Durch die organisationsübergreifende Zusammenarbeit werden viele Dokumente in Umlauf gebracht, so dass die Echtheit des Dokumentes in Frage gestellt werden kann. Mit einer Signatur lassen sich Authentizität, Integrität und Vertraulichkeit erreichen. In dem Verfahren wird eine Datei in ein abgesichertes elektronisches Dokument umgesetzt und dessen
46 Konzept für Qualitäts- und Prozessmanagement in kollaborativen Arbeitsumgebungen 37 Autor identifizierbar gemacht. Um die Signatur auch überprüfen zu können, benötigt diese Person den öffentlichen Schlüssel des Dienstanbieters und ein Zertifikat einer vertrauenswürdigen Certificate Authority (CA), das belegt, dass dieser Schlüssel auch zu diesem Anbieter gehört. Als Eingabe erwartet der Signierungsdienst folglich das zu signierende Dokument. Als Ausgabe werden das signierte Dokument, der öffentliche Schlüssel zum Lesen der Signatur und das Zertifikat des Dienstanbieters zurückgeliefert. Archivierung In einer kollaborativen Arbeitsumgebung, wo viele Benutzer miteinander arbeiten, entsteht eine riesige Anzahl von Dokumenten. Dadurch ist eine Archivverwaltungsfunktion erforderlich, so dass ältere Dokumente nach vorgegebenem Fristablauf oder zu bestimmten Selektionsterminen ausgesondert werden. Suchfunktion Mithilfe einer Suchfunktion können Dokumente schnell wieder gefunden werden. Das System sucht im Archiv nach Dateien, die der Benutzer benötigt. Das erleichtert und verkürzt die Suche nach Informationen. Die heute verbreiteten Systeme erlauben eine Volltextsuche, Recherche nach bestimmten Themen, sowie eine gezielte Suche anhand mehrerer Suchkriterien. Workflow Workflow-Funktionen können eingesetzt werden, um eine direkte Weitervergabe der Dokumente zu ermöglichen. Als Beispiel können Formulare wie Urlaubsanträge erstellt und an den nächsten zuständigen Mitarbeiter geschickt werden. Auf diese Weise können Prozesse automatisiert und die Zusammenarbeit erleichtert werden, so dass der Zeitaufwand verringert werden kann. Im Kapitel Workflow-Management werden verschiedene Workflowtypen vorgestellt, die von weichen bis hin zu harten Strukturen reichen Berechtigungsmanagement Im kollaborativen Arbeitsbereich spielt das Berechtigungsmanagement eine große Rolle. Wenn es darum geht in kooperativen Prozessen mit anderen Unternehmen
47 Konzept für Qualitäts- und Prozessmanagement in kollaborativen Arbeitsumgebungen 38 zusammenzuarbeiten, ist ein zentral koordiniertes Berechtigungsmanagement erforderlich. Durch Zugriffsrechte sollen sensible Daten und Anwendungen vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden. Verschiedene Benutzerstämme mit strukturierten und nachvollziehbaren Zugriffsrechten müssen angelegt und konsequent verwaltet werden. Mithilfe von rollenbasierten Zugriffskontrollkonzepten können die Benutzer sich identifizieren und somit eine grundlegende Sicherheit im Umgang mit Dokumenten erreichen. In der heutigen Zeit wird die Bereitstellung von Sicherheitsfunktionalität auf allen Ebenen ermöglicht, um einen ortsunabhängigen Zugang zu Unternehmensdaten und -anwendungen zu erlangen. Verschiedene Anforderungen und Qualitätsmerkmale werden in den folgenden Punkten beschrieben und erläutert: Vertraulichkeit Informationen sollen vertraulich behandelt werden, so dass Schutz vor der Einsichtnahme eines Unbefugten gewährleistet werden kann. Integrität Integrität bedeutet die Sicherstellung der Korrektheit von Informationen bzw. der korrekten Funktionsweise von Systemen. Daten sollen auf dem Übertragungsweg zwischen Sender und Empfänger nicht verfälscht werden. Der Empfänger muss die Möglichkeit besitzen Manipulationen zu erkennen und darauf entsprechend zu reagieren, indem er beispielsweise die Nachricht verwerfen kann. Verfügbarkeit Daten, Dienste oder Ressourcen sollen berechtigten Nutzern jederzeit funktionsbereit und in geforderter Qualität zur Verfügung stehen, wenn ein autorisierter Benutzer darauf zugreifen will. Dies umfasst jegliche Hardware, Programme, Funktionen, Archive und Sicherungskopien. Authentizität Authentizität bedeutet die Sicherstellung der Echtheit von Informationen bzw. Identität. Es muss einerseits sichergestellt sein, dass Informationen wirklich aus der angegebenen Quelle stammen bzw. dass die vorgegebene Identität, etwa
48 Konzept für Qualitäts- und Prozessmanagement in kollaborativen Arbeitsumgebungen 39 eines Benutzers oder eines an der Kommunikation beteiligten Systems, korrekt ist. Dies kann beispielsweise durch eine Passwortvergabe geschehen. Um das mehrfache Eingeben von Passwörtern zu vermeiden, wird für die Anwender der Vorgang vereinfacht, in dem mit nur einem Anmeldevorgang verschiedenste Dienste oder Anwendungen benutzt werden können. Diesen Vorteil bietet Single-Sign-On, auf das im nächsten Punkt eingegangen wird. Single-Sign-On Für viele Benutzer ist es mühsam, sich viele verschiedene Passwörter zu merken, so dass sie überall dasselbe einsetzen, was ein nicht zu unterschätzendes Sicherheitsrisiko darstellt. Außerdem ist das Eingeben der Passwörter aufwendig. Mittels Single-Sign-On kann der Benutzer nach einer einmaligen Authentifizierung auf alle Anwendungen und Dienste zugreifen, für die er berechtigt ist. Das Arbeiten wird einfacher und effizienter, da sich Benutzer nicht jedes Mal neu anmelden müssen. Sicherheit gehört zu den Qualitätsmerkmalen, die als wichtig eingestuft werden. Es soll dennoch ein einfacher und effizienter Vorgang für den Benutzer ermöglicht werden. Mit diesen Sicherheitsdiensten soll der Zugriff auf Ressourcen transparent gesteuert, kontrolliert und dokumentiert werden. Auf die Dokumentation wurde bereits unter dem Abschnitt eingegangen.
49 Bewertungsmanagement an Hochschulen 40 4 Bewertungsmanagement an Hochschulen Im Rahmen des Bologna-Prozesses fordern die Ministerinnen und Minister im Berliner Kommuniqué von 2003 mehr Vergleichbarkeit und Kompatibilität, transparentere Hochschulsysteme und eine höhere Qualität europäischer Hochschulbildung auf institutioneller, nationaler und europäischer Ebene (vgl. [Berliner Kommuniqué], S. 3). Um ein gemeinsames europäisches Bildungssystem zu schaffen, sollen folgende Punkte umgesetzt werden: Die Schaffung eines Systems leicht verständlicher und vergleichbarer Abschlüsse Die Schaffung eines zweistufigen Systems von Studienabschlüssen (undergraduate/graduate) Die Einführung eines Leistungspunktesystems nach dem European Credit Transfer System (ECTS) Die Förderung der Mobilität durch Beseitigung von Mobilitätshemmnissen Die Förderung der europäischen Zusammenarbeit durch Qualitätssicherung Die Förderung der europäischen Dimension in der Hochschulausbildung Für die Qualitätssicherung ist gemäß dem Grundsatz der institutionellen Autonomie jede Hochschule selbst verantwortlich. Folgende Punkte sollen die nationalen Qualitätssicherungssysteme beinhalten: Eine Festlegung der Zuständigkeiten der beteiligten Instanzen und Institutionen Eine Evaluierung von Programmen oder Institutionen einschließlich interner Bewertung, externer Beurteilung, Beteiligung der Studierenden und Veröffentlichung der Ergebnisse Ein System der Akkreditierung, der Zertifizierung oder ähnlicher Verfahren Internationale Beteiligung, Kooperation und Vernetzung Um die Anforderung umzusetzen, wurden an der Universität Paderborn in der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (WIWI) die Lehrstrukturen modularisiert.
50 Bewertungsmanagement an Hochschulen 41 Die einzelnen Module sind inhaltlich und zeitlich abgeschlossene Einheiten, die als Komponenten in unterschiedlichen Studienprogrammen belegt werden können. Module können aus unterschiedlichen Teilen wie beispielsweise Vorlesungen, Übungen und Projekten bestehen. Sie können aus den Lehrangeboten mehrerer Lehrstühle gebildet werden, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Semester stattfinden können. Die zur Leistungskontrolle und -bewertung eingesetzten Prüfungen und Prüfungsbewertungen orientieren sich gleichfalls an der neuen Modulstruktur. Einzelne Prüfungsleistungen werden einzeln gewichtet und so zu einer Modulnote zusammengefasst. Eine Modulprüfung kann aus einer Abschlussprüfung oder aus mehreren Modulteilprüfungen bestehen. In den Modulteilprüfungen können unterschiedliche Prüfungsformen angewandt werden. In jedem Fall müssen die Prüfungen als Einzelleistungen bewertbar sein. 4.1 Szenario Mit dem hier vorgestellten Anwendungsszenario wird das Bewertungsmanagement an der Fakultät für WIWI der Universität Paderborn beschrieben und daraus die Anforderungen für Qualitäts- und Prozessmanagement in dieser kollaborativen Arbeitsumgebung abgeleitet. Die Prüfungsordnungen der Bachelor- und Masterstudiengänge der Fakultät für WIWI sehen die folgenden Prüfungsformen vor (vgl. [Prüfungsordnung 06/2006], S. 5): Klausuren Mündliche Prüfungsleistungen Klausuren nach dem Antwort-Wahl-Verfahren Prüfungsleistungen im Rahmen von Projekten Prüfungsleistungen im Rahmen von Übungen Hausarbeiten Präsentationen Nach Genehmigung durch den Prüfungsausschuss sind auch Prüfungsformen zulässig, die in dieser Ordnung nicht benannt werden
51 Bewertungsmanagement an Hochschulen 42 Die Prüfungsformen und Gewichtung der Modulteilprüfungen bei der Bildung der Modulnote müssen spätestens in den ersten zwei Wochen der Vorlesungszeit vom Prüfungsausschuss im Benehmen mit den Lehrenden festgelegt und veröffentlicht werden. Dies erfolgt durch Bekanntgabe im Modulhandbuch oder im Internet unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Für die Modulprüfungen müssen sich die Studenten webbasiert auf der Homepage der Fakultät für WIWI anmelden. Der Anmeldezeitraum für die Online-Anmeldung wird auf der Homepage der Fakultät für WIWI bekannt gegeben. Eine Online-Anmeldung ist nur möglich, wenn eine Registrierung vom Studierenden vorgenommen wurde. Für die Anmeldung wird ein Lotus Notes Login oder IMT-Login (Informations- und Medientechnologien) benötigt. Einen Lotus Notes Login können Studierenden übers Web beantragen. Ein IMT-Login können Studierende und Mitarbeiter im Notebook- Café beantragen. Die Anmeldung erfolgt in zwei Phasen. In der ersten Phase können die Module beliebig an- und abgemeldet werden. In der zweiten Phase, der so genannten Revisionsphase, können die Anmeldungen überarbeitet werden. Es besteht die Möglichkeit gewählte Module aus seiner Anmeldung zu löschen oder dieser neue Module hinzuzufügen. Allerdings können in der Revisionsphase einzelne Module aufgrund einer zu hohen Teilnehmerzahl für Neuanmeldungen gesperrt werden. Prozessbeschreibung: Nachdem die Studierenden sich für die einzelnen Modulprüfungen angemeldet haben, erfassen die Mitarbeiter im Prüfungssekretariat die Daten der Teilnehmer im HISPOS System. Das HISPOS System ist ein Prüfungsverwaltungssystem der deutschen Hochschulen und wurde von der Firma HIS entwickelt. Die Prüfungssekretariate nutzen dieses System für die Verwaltung der Prüfungsanmeldungen. Insbesondere wird hier die Zulassung der Teilnehmer zu einer Modulprüfung überprüft. Alle zugelassenen Kandidaten werden in einem Leistungspunktekonto des Prüfungssekretariats geführt. Die Prüfungsleistungen werden vom Prüfungssekretariat dokumentiert und alle Studierenden können auf Anfragen jederzeit formlos in den aktuellen Stand ihres Kontos Einblick nehmen. Für die Gewichtung, Zählung und Anrechnung von Prüfungsleistungen werden Leistungspunkte gemäß des ECTS verwendet (vgl. [Prüfungsordnung 06/2006], S. 7).
52 Bewertungsmanagement an Hochschulen 43 Das HISPOS System kann Anmeldelisten in Form von Excel-Tabellen im- und exportieren. Nach Abschluss der Revisionsphase können die Lehrstühle auf Anfrage beim Prüfungssekretariat Teilnehmerlisten erhalten. Die Teilnehmerliste enthält alle angemeldeten Studierenden mit Namen, Matrikelnummer, Studiengang, angestrebtem Abschluss und -Adresse. Bevor die HISPOS-Transfertabelle verschickt wird, haben die Lehrstühle die Möglichkeit nach der Revisionsphase die Teilnehmerliste aus der Online-Anmeldung herunter zu laden und zu verwenden. Diese Teilnehmerliste kann für die Semester begleitende Teilmodulprüfung vorübergehend angewendet werden. Dort können die Teilmodulbewertungen erfasst werden, bis die angefragte Teilnehmerliste vom Prüfungssekretariat zugeschickt wird. Fehlende Bewertungsdokumente werden erfasst und der Zulassungsstatus von zugelassenen Teilnehmern wird auf zugelassen gesetzt, während nicht zugelassene Teilnehmer den Status nicht zugelassen / abgemeldet bekommen. Die Teilnehmerliste ist vor allem für den Koordinator wichtig, da er alle Teilmodulbewertungen erfasst und daraus eine Modulnote generieren muss. Der Koordinator ist verantwortlich für die Planung und Koordinierung zwischen den einzelnen Lehrstühlen, die das Modul zusammen anbieten. Er legt Termine bzw. Fristen fest, die sowohl von der Prüfungsordnung vorgegeben sind, als auch für die Koordination zwischen den einzelnen Lehrstühlen nötig sind. Dabei sollen krankheitsbedingte Ausfälle und Urlaubstage der Mitarbeiter berücksichtigt werden. Aus der Teilprüfungsbewertung wird schließlich eine Modulnote gebildet. Außerdem kann die Teilnehmerliste für die Kontrolle der Anwesenheit während der Prüfung von Nöten sein. Falls ein Student nicht auf der Teilnehmerliste steht, aber trotzdem zur Prüfung antritt, hat der Prüfer die Möglichkeit diesen Studierenden unter Vorbehalt mitschreiben zu lassen oder von der Prüfung auszuschließen. Wenn der Prüfer einverstanden ist, so muss der Student nach der Klausurteilnahme diese Unstimmigkeiten mit den zuständigen Prüfungsämtern klären. Bei einer Genehmigung von den Prüfungsämtern kann er den neuen Teilnehmer mit in die Teilnehmerliste aufnehmen, andernfalls wird der Teilnehmer gelöscht. Bis zu einer Woche vor dem ersten Prüfungstermin kann sich ein angemeldeter Student von der Prüfung abmelden. Diese Abmeldung wird beim Prüfungssekretariat eingereicht. Nach diesem Zeitraum muss an der Prüfung teilgenommen werden, sofern
53 Bewertungsmanagement an Hochschulen 44 kein Ausnahmefall vorliegt. Andernfalls wird die Bewertung der Prüfung im Prüfungssekretariat als ungenügend erfasst. Student registriert sich für die Online-Anmeldung Student meldet sich online zum 1. Anmeldezeitraum an Student fügt in der Revisionsphase Modulprüfung hinzu oder löscht diese Online-Anmeldephase ist abgeschlossen Student will an der Prüfung teilnehmen Student will von der Prüfung zurücktreten Prüfung der Abmeldefristen der Prüfungsmodule Student hält die Abmeldefrist ein Student hält die Abmeldefrist nicht ein Prüfungssekretariat genehmigt die Abmeldung Prüfungssekretariat genehmigt die Abmeldung nicht Prüfungssekretariat löscht die Modulprüfung Student muss an der Prüfung teilnehmen ENDE Abbildung 4.1: Anmeldeverfahren Nach der Prüfung finden Teilmodulbewertungen an den einzelnen Lehrstühlen statt, die mit Noten oder Leistungspunkten bewertet werden.
54 Bewertungsmanagement an Hochschulen 45 Teilnehmerliste wird aus der WIWI-Modulanmeldung erstellt Abgleich der Teilnehmerliste mit der Anmeldungsliste vom Prüfungssekretariat Koordinator legt Abgabetermine der Teilmodulbewertung fest unter Berücksichtigung der Prüfungsordnungsfristen Koordinator schickt per die Fristen an die zuständigen Lehrstühlen Prüfung wird geschrieben Prüfer kontrolliert, ob Teilnehmer zugelassen Student zugelassen Student nicht zugelassen Prüfer entscheidet über weiteres Vorgehen Student darf die Klausur schreiben Student darf unter Vorbehalt mitschreiben Student darf nicht mitschreiben Prüfer klärt das Problem mit dem Prüfungssekretariat Prüfungssekr. genehmigt Prüfungssekr. nicht genehmigt Student wird i.d. Teilnehmerliste aufgenommen Student wird nicht i.d. Teilnehmerliste aufgenommen ENDE Abbildung 4.2: Prüfung
55 Bewertungsmanagement an Hochschulen 46 Unabhängig vom gewählten Prüfungsverfahren müssen die Ergebnisse der Teilmodulbewertung in eine Teilnehmerliste übertragen und per an den Koordinator dieses Moduls zugeschickt werden. Der Koordinator generiert aus der Teilmodulbewertung eine Modulnote. Die Prüfungsordnung legt nach Abschluss der Prüfung sechs Wochen als maximale Zeitspanne für die Durchführung der Bewertung fest. Innerhalb dieser Frist muss der Koordinator die Modulnoten an das Prüfungsamt übermitteln. Die Mitteilung der Modulnoten erfolgt durch Aushang am Prüfungssekretariat, am Lehrstuhl selbst oder durch Bekanntgabe im Internet unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Eine weitere Frist kann vom Koordinator festgelegt werden, um die Abgabetermine der Teilmodulbewertungen zu bestimmen. Diese sollten eingehalten werden, damit der Prozess von Anfang bis Ende reibungslos ablaufen kann und dementsprechend die Anforderungen der Prüfungsordnung erfüllt werden können. Spätestens einen Monat nach Bekanntgabe der Modulnote der jeweiligen schriftlichen Prüfungen kann der Teilnehmer eine Einsicht in die geschriebene Klausur beantragen. Die oder der Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. In vielen Fällen wird ein Termin angegeben, an dem alle Teilnehmer zusammen zu einer Einsicht erscheinen müssen. Die oder der Vorsitzende kann diese Aufgabe an die Prüfenden delegieren. Die Studenten haben die Möglichkeit ihre Prüfungsaufgaben noch einmal zu überprüfen und eventuell den Prüfer des Lehrstuhls auf falsche Bewertungen der Aufgaben aufmerksam machen. Falls eine Aufgabe nicht korrekt bewertet wurde, muss der Prüfer des Lehrstuhls die Teilmodulbewertung ändern. Er muss die Änderungen nachhaltig festhalten und ersichtlich machen, dass eine autorisierte Änderung stattgefunden hat. Dies ist für die Dokumentation äußerst wichtig, um später vorgenommene Änderungen nachvollziehen zu können. Hier muss ersichtlich sein, wer die Änderung durchgeführt und wann diese stattgefunden hat. Durch die Signierung mit Datum wird die Änderung eindeutig festgehalten. Die Änderung der Punktzahl bzw. der Note des Teilmoduls kann eine Auswirkung auf die Modulnote haben. Das muss aber nicht immer der Fall sein, z. B. wenn die Änderung nur einen Punktunterschied macht. Die Korrektur der Teilmodulbewertung führt dazu, dass die geänderte Teilmodulbewertung zurück an den Koordinator geschickt wird, der daraus eine neue Modulnote generieren muss. Zum Abschluss wird
56 Bewertungsmanagement an Hochschulen 47 die geänderte Version des Endergebnisses an das Prüfungssekretariat gesendet und der Prozess ist abgeschlossen. Folgende Ausnahmefälle können auftreten: Wegen Krankheit kann der Studierende an einer Modulteilprüfung nicht teilnehmen. Der Teilnehmer hat die Möglichkeit einen Antrag beim Prüfungssekretariat zu stellen und von dem Modul zurückzutreten, sofern kein Ersatz für die versäumte Teilprüfung angeboten wird. Die Anmeldung gilt dann als nicht vorgenommen. Des Weiteren kann der Prüfungsausschuss in Absprache mit dem verantwortlichen Lehrenden im Einzelfall die Möglichkeit organisieren, das Modul abzuschließen. Diese Möglichkeit soll insbesondere dann organisiert werden, wenn der Kandidat bereits die Hälfte oder mehr der in dem Modul geforderten Leistungen erbracht hat. Die Gewichte der Modulteilprüfungen sind dabei zu beachten. Ein ärztliches Attest ist spätestens vom Tag der Prüfung vorzulegen, das die Angaben enthält, die der Prüfungsausschuss für die Feststellung der Prüfungsunfähigkeit benötigt. In begründeten Fällen kann ein Attest eines Amtsarztes verlangt werden. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe nicht an, wird dies dem Kandidaten schriftlich mitgeteilt. Wegen Krankheit kann der Studierende die Klausureinsicht nicht wahrnehmen. In diesem Fall kann der Studierende mit dem Prüfer einen persönlichen Termin vereinbaren. Bei einer nicht bestandenen Modulprüfung hat der Teilnehmer die Möglichkeit das gleiche Modul mit der dazugehörigen Modulprüfung einmal zu wiederholen. Dafür ist eine erneute Anmeldung zu diesem Modul erforderlich. Wird dasselbe Modul zum zweiten Mal nicht bestanden, so kann das Modul nicht mehr wiederholt werden. Als Alternative hat der Teilnehmer die Möglichkeit ein anderes Modul zu belegen. Eine Prüfungsleistung gilt als mit "ungenügend" (6,0) bewertet, wenn der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.
57 Bewertungsmanagement an Hochschulen 48 Bewertung der abgelegten Prüfung an einzelnen Lehrstühlen Einzelne Lehrstühle schicken Teilmodulbewertung an Koordinator Koordinator generiert aus der Teilmodulbewertung eine Modulnote Koordinator schickt die Modulnote an das Prüfungssekretariat Ergebnisse werden veröffentlicht Klausureinsicht Teilnehmer erscheint Teilnehmer erscheint nicht Teilnehmer kann Attest vorweisen Prüfer einverstanden Prüfer nicht einverstanden Prüfer vereinbart einen neuen Termin Teilnehmer kontrolliert die Teilprüfungen Teilnehmer findet Fehler Teilnehmer findet keine Fehler Prüfer berichtigt die Teilmodulbewertung Prüfer schickt die Korrektur an den Koordinator Abbildung 4.3: Bewertung der Modulprüfung (1)
58 Bewertungsmanagement an Hochschulen 49 Koordinator generiert neue Modulnote Koordinator sendet neue Modulnote an das Prüfungssekretariat Prüfungssekretariat gibt die geänderte Modulnote in das HISPOS System ENDE Abbildung 4.4: Bewertung der Modulprüfung (2) Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschungshandlungen, z. B. das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen oder verhält sie oder er sich ordnungswidrig, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "ungenügend" (6,0) bewertet. Die Ausnahmenfälle sollen in den Prozessen integriert werden, damit der Gesamtprozess kontinuierlich und reibungslos ablaufen kann. 4.2 Anforderungen Durch die Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge werden Module aufgestellt, um die europäische Zusammenarbeit zu fördern. Module können aus unterschiedlichen Teilmodulprüfungen eines oder mehrerer Lehrstühle bestehen, die zu einer Modulnote zusammengefasst werden. Dadurch entstehen neue Herausforderungen an das Qualitäts- und Prozessmanagement des Bewertungsmanagements. An dieser Stelle werden die Anforderungen an das Bewertungsmanagement in Hochschulen gestellt. Die Anforderungen, die bereits in Kapitel 3.2 vorgestellt wurden, sollen nun für das Bewertungsmanagement konkretisiert und analysiert werden.
59 Bewertungsmanagement an Hochschulen Effiziente Kommunikation in einem Projekt oder einem Team Durch die Modularisierung entstehen im Bewertungsmanagement an Hochschulen neue Herausforderungen. Dazu zählt unter anderem eine effiziente Kommunikation, die eine Lehrstuhlübergreifende Organisation unterstützen soll. Bei organisatorischen Angelegenheiten und bei der Planung sollen verschiedene Kommunikationsmittel zur Verfügung gestellt werden, damit der Bewertungsprozess schnell und sicher ausgeführt werden kann. Bei Fragen und Problemen können die Teammitglieder untereinander mithilfe von , Instant Messaging und Teamkonferenz kommunizieren und Informationen austauschen. Die -Funktion kann an verschiedenen Stellen im Aktivitätendiagramm Prüfung angewendet werden. Wenn der Koordinator eine Teilnehmerliste benötigt, kann er auf diesem Weg Anfragen an das Prüfungssekretariat senden. Auch bei der Festlegung der Fristen der Teilmodulbewertung kann der Koordinator die Abgabetermine per bekannt geben. Des Weiteren kann der Prüfer beim Prüfungssekretariat erfragen, ob ein nicht zugelassener Teilnehmer bewertet werden darf, nachdem der Prüfer ihn unter Vorbehalt mitschreiben ließ. Im letzten Teil des Aktivitätendiagramms Bewertung der Modulnoten wird die funktion benötigt, um die Teilmodulbewertung der einzelnen Lehrstühle an den Koordinator zu senden. Wenn der Koordinator aus diesen einzelnen Teilmodulbewertungen eine Modulnote generiert hat, kann er diese an das Prüfungssekretariat weiterleiten. Auch bei Nicht-Teilnahme an der Klausureinsicht, die durch eine Krankheit begründet wird, kann der Teilnehmer eine an den Prüfer schreiben und einen neuen Termin vereinbaren. Im Falle einer falschen Bewertung, die der Teilnehmer entdeckt hat, muss der Prüfer die Teilmodulbewertung korrigieren und anschließend an den Koordinator per senden. Nachdem der Koordinator aus der geänderten Teilmodulbewertung eine neue Modulnote generiert hat, muss er diese wieder an das Prüfungssekretariat schicken.
60 Bewertungsmanagement an Hochschulen 51 Instant Messaging Alle Mitglieder, die am Bewertungsmanagement mitwirken, werden in einer Liste aufgeführt. Durch die Presence-Awareness-Funktion wird erkennbar, wer zur Verfügung steht und wer nicht angemeldet ist. Da bei Instant Messaging in Echtzeit kommuniziert wird, kann die Funktion in allen vorhandenen Prozessen eingesetzt werden. So können beispielsweise Benutzer bei der Terminplanung über Instant Messaging erfragen, ob ein Meeting vereinbart werden kann. Teamkonferenz Teamkonferenzen können bei Besprechungen zwischen verschiedenen Lehrstühlen eingesetzt werden. Vor allem in der Endphase, in der sich alle Professoren aus dem Modul treffen müssen, um die Korrektheit der Modulergebnisse zu besprechen. Der Koordinator kann per oder per Instant Messaging ein Rundschreiben an alle Professoren schicken, die am selben Modul arbeiten. In einem Gruppenchat treffen sich nun alle Teilnehmer. Bei gekonntem Einsatz in Arbeitsprozessen kann eine Teamkonferenz einerseits zum Treffpunkt für Wissensaustausch wie z. B. Meetings werden und andererseits zu einem wertvollen Informations- und Meinungsarchiv anwachsen. Die Funktion Place-Based-Awareness kann an dieser Stelle eingesetzt werden, um die Verfügbarkeit der Teammitglieder festzustellen, wo sie sich aktuell im System befinden und in welcher Diskussionsrunde sie sich aufhalten Gezielte Informationen Auch im Bewertungsmanagement sollen Informationen gezielt genutzt werden, um die Prozesse zu unterstützen. Dabei werden Funktionen eingesetzt, die die Benutzerfreundlichkeit verbessern. Informationen schnell und einfach zugänglich zu machen gehört zu den Pflichten und Aufgaben im Rahmen der Benutzerfreundlichkeit. Es werden die für das Bewertungsmanagement eingesetzten Funktionen vorgestellt. Anfänger- und Expertenmodus Anfänger- und Expertenmodus sind Funktionen, die in jeder kollaborativen Arbeitsumgebung große Vorteile für die Erlernbarkeit und das Arbeiten mit dem
61 Bewertungsmanagement an Hochschulen 52 System bringen. Deswegen sollte diese Modularität auch in einem Bewertungsmanagement-System umgesetzt werden. Im Anfängermodus sollten die Grundlagen der Arbeit mit dem System erläutert werden, wie z. B. das Anlegen eines Moduls oder die Bewertung von Teilnehmern. Dies wird unter der Funktion Wegweiser erläutert. Diese Funktion kann im Anfängermodus eingeblendet werden. Aufgabenübersicht Viele Prozesse finden in der Bewertung statt, so dass bei komplexen Aufgabenverteilungen die Übersichtlichkeit verloren geht. Alle Aufgaben des Benutzers sollen in einer Ansicht angezeigt werden. Sie werden unterteilt in aktuelle, nach Weiterverarbeitung und von mir initiiert. So weiß der Benutzer genau, welche Aufgaben er zu erledigen hat. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Termine fristgerecht eingehalten werden können. Mithilfe eines Workflows können die Prozesse weitergeleitet werden. Diese Funktion wird im Abschnitt näher erläutert. Ablage Alle bewerteten Dokumente können in der Ablage archiviert werden. Diese werden in der Ablage nach verschiedenen Kategorien aufgelistet. Es soll nach Prüfungssemestern, nach Student, nach Matrikelnummer, nach Projekt und nach Lehr- und Forschungseinheit (L&F-Einheit) kategorisiert werden können. Beim Gebrauch der Dokumente kann der Benutzer unterschiedliche Kategorisierungsmöglichkeiten aussuchen. Suchfunktion Eine Suchfunktion erleichtert das Auffinden älterer und aktueller Dokumente. Bei einer Korrektur der Teilmodulbewertung, die beispielsweise nach der Klausureinsicht stattfindet, kann der Verantwortliche dieser Teilmodulbewertung den Namen des Studierenden in der Suchleiste eingeben. Es werden alle Dokumente mit dem eingegebenen Suchbegriff aufgelistet. Der Benutzer kann das gesuchte Dokument öffnen und anschließend weiter bearbeiten.
62 Bewertungsmanagement an Hochschulen 53 Hilfefunktion Die Hilfefunktion ist ein Nachschlagewerk, das bei Unklarheiten der Teilprozesse konsultiert werden kann. Alle Prozesse werden dort beschrieben und schrittweise erläutert, um so den Benutzern eine Hilfestellung zu bieten. Die Hilfefunktion soll als Button auf jeder Seite vorhanden sein, so dass der Benutzer jederzeit die Hilfefunktion aufrufen kann. Feedback Über den Eintrag Feedback unter dem Hilfe-Button, kann der Benutzer bei Problemen oder Hinweisen eine -Benachrichtigung an dem Administrator schicken, in dem der Empfänger und die Betreffzeile automatisch eingefügt werden. In der kann das Problem oder der Hinweis näher erläutert werden. Der Benutzer muss die -Adresse der zuständigen Mitarbeiter nicht wissen, denn der Inhaber dieser Rolle steht im System fest und wird zu diesem Zweck abgerufen. Wegweiser Ein Wegweiser mit verschiedenen Prozessabläufen wird auf der Hauptseite angezeigt. Es sind die Prozesse, die am häufigsten benötigt werden. Beim Anklicken der erfragten Prozesse wird eine neue Seite aufgerufen. Dort wird der Ablauf des ausgewählten Prozesses beschrieben. Beispielsweise wird der Prozess Modulprüfung anlegen schrittweise erklärt. Dokumentenvorschau Bewertungsmodule sollen direkt auf der Hauptseite ersichtlicht sein. Dies wird durch die Funktion Dokumentenvorschau ermöglicht, die jederzeit ein- und ausgeblendet werden kann. Ansonsten wird die Bearbeitungszeit nicht effizient eingesetzt, zumal der Benutzer zuvor Aktionen zum Öffnen eines Dokumentes durchführen muss. Workflow-Management-System Ein Workflow sollte im Bewertungsmanagement verwendet werden, um beispielsweise die Aufgabenübersicht der Prozesszuständigen anzeigen zu lassen. Diese Funktion soll den Koordinator bei der Planung unterstützen, um
63 Bewertungsmanagement an Hochschulen 54 der Komplexität entgegen zu wirken. Je nach Umfang der Teil- bzw. Gesamtprozesse soll das Workflow-System die Prozesse automatisieren Terminplanung Ein Terminplaner wird im Bewertungsmanagement benötigt, um beispielsweise die Fristen der Bearbeitung einhalten zu können. So kann errechnet werden, wann das Modulergebnis feststehen sollte, damit die Fristen der Prüfungsordnung nicht überschritten werden. Bei Abweichungen in der Terminplanung sollte die Möglichkeit bestehen, Termine nach vorne oder nach hinten zu verlegen. Der Koordinator benachrichtigt alle Verantwortlichen des Moduls über den neu festgelegten Termin, damit dieser eingehalten werden kann. Mithilfe eines Workflows können Benachrichtigung automatisiert werden, so dass der neue Termin direkt in der Aufgabenübersicht Meine Aufgaben des Teilmoduls ersichtlich wird. Ansonsten bleibt die Alternative die Benachrichtigung an den Verantwortlichen des Teilmoduls per zu senden Workflow-Management Durch die Modularisierung des Bewertungsmanagements an der Universität Paderborn entsteht eine neue Prüfungsstruktur. Wie im Szenario erkennbar, ist der Prozess des Bewertungsmanagements sehr komplex. Mithilfe von Workflows soll der Prozess automatisiert werden, so dass die Beteiligten der Modulbewertung unterstützt werden. In diesem Abschnitt soll die Aufgabenübersicht, die bereits im Abschnitt beschrieben wurde, näher betrachtet werden. Bevor der Prozess mithilfe eines Workflow-Management-Systems beschrieben wird, müssen die Zuständigkeiten definiert sein. Die Zuständigkeiten werden durch Rollen vergeben, so dass das Workflow-Management-System nur wissen muss, welcher Rolle die nächste Aktivität zugeordnet ist, damit sie automatisch an einen geeigneten Rolleninhaber zugeschickt werden kann. Die eigentliche Person wird erst im konkreten Fall der Rolle zugeordnet. Dadurch wird gewährleistet, dass die Verfügbarkeit der richtigen Aufgabe zur richtigen Zeit am richtigen Ort vorhanden ist. Im Bewertungsmanagement können zwei Workflow-Typen eingesetzt werden. Der im Szenario beschriebene Gesamtprozess kann komplett als vordefinierter Prozess
64 Bewertungsmanagement an Hochschulen 55 vorliegen. Wenn im konkreten Bewertungsprozess häufig unvorhergesehene Situationen auftreten, sollten Ad-hoc-Workflows umgesetzt werden, in denen Prozesse definiert werden können. Diese könnten beispielsweise bei neuen Prüfungsformen eingesetzt werden. Viele Prozesse im Bewertungsmanagement sind häufig wiederholbar und können dementsprechend vordefiniert werden. Alle vordefinierten Prozesse sind als Vorlage vorhanden und können beim erneuten Gebrauch wieder verwendet werden. Während der Prozess aktiviert ist, hat der Koordinator die Möglichkeit den Prozess zu stoppen. In diesem Fall, der vom aktuellen Bearbeiter hervorgerufen wird, muss dieser sich bei dem Koordinator mit einer Begründung melden. Der Koordinator alleine kann genehmigen, ob der Prozess gestoppt wird oder nicht. Alle vom Koordinator initiierten Prozesse werden unter Meine Aufgabe / von mir initiiert ersichtlicht gemacht. In dieser Ansicht sind unter Anderem zwei weitere Unterkategorien vorhanden, die dem Benutzer anzeigen, in welchem Aufgabenbereich er noch etwas zu erledigen hat. Unter der Kategorie Aktuelle sieht der Benutzer, wie viele aktuelle Bewertungen er noch bearbeiten muss. In der zweiten Kategorie Nach Weiterverarbeitung finden sich sämtliche Dokumente, die an den nächsten Zuständigen weitergeleitet werden müssen Dokumentenmanagement Beim Bewertungsmanagement an Hochschulen werden viele Dokumente im Umlauf sein, die durch die Bewertungen entstehen. Dokumente sollen eine Archivierungsfunktion besitzen und auffindbar sein. Die Sicherheit im Bewertungsmanagement ist besonders wichtig, da bei der Modulbewertung Änderungen stattfinden können. Im Folgenden werden Funktionalitäten beschrieben, die das Bewertungsmanagement an Hochschulen unterstützen. Versionierung Dokumente werden von verschiedenen Mitarbeitern auf unterschiedliche Weise verändert. Dadurch wird die Gewährleistung der Dokumentensicherheit erschwert. Im Bewertungsmanagement ist es daher wichtig, dass eine Änderung der Teilmodulbewertung auch abgesichert wird und identifiziert werden kann. Falls der Teilnehmer bei der Klausureinsicht fehlerhafte Bewertungen in den
65 Bewertungsmanagement an Hochschulen 56 Aufgabenteilen entdeckt, müssen die Prüfer der zuständigen Teilmodulbewertungen die Korrektur erfassen. Die Manipulation von Dokumenten wird dadurch verhindert. Digitales Signieren Digitales Signieren soll eine höhere Sicherheit bei Änderung einer Note gewährleisten. Der Prüfer, der die Korrektur durchgeführt hat, wird durch eine digitale Signatur auffindbar. Dadurch wird die Identität des Bearbeiters gesichert und kenntlich gemacht. Archivierung Alle bewerteten Dokumente sollen archiviert werden können und bei Bedarf jederzeit wieder zugreifbar sein. Mithilfe einer Suchfunktion kann das Auffinden von bewerteten Dokumenten erleichtert werden. Wenn beispielsweise verschiedene Lehrstühle über eine bestimmte Bewertung miteinander diskutieren, können die Gesprächspartner die Matrikelnummer des Studenten eingeben. Suchfunktion Es gibt eine große Anzahl an Dokumenten, die im Umlauf sind und bereits archiviert sind. Um Dokumente wieder zu finden, muss nur ein bestimmter Name oder eine Matrikelnummer im Sucheingabefeld eingetippt werden. Alle gefundenen Dokumente werden aufgelistet und durch Auswahl des Dokumentenfeldes in das Dokumentenfeld kann der Benutzer das entsprechende Dokument öffnen. Je nach Wunsch kann es dort bearbeitet, bewertet oder geändert werden. Workflow Viele Prozesse im Bewertungsmanagement können automatisiert werden. Alle Aktivitäten können unter Meine Aufgabe aufgelistet werden. Weitere Prozesse, die mithilfe des Workflow-Management-Systems erstellt werden können, werden im Abschnitt dargestellt und erläutert.
66 Bewertungsmanagement an Hochschulen Berechtigungsmanagement Berechtigungsmanagement soll im Bewertungsmanagement eingesetzt werden, um die Daten vor dem Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Die Zugriffsrechte werden dabei mit einem Rollensystem verwaltet, in dem nur berechtigte Benutzer Lese- oder Schreibrechte bekommen. Des Weiteren wird nach der Identifikation sichergestellt, dass die Dokumente nur durch berechtigte Benutzer verändert werden. Anforderungen und Qualitätsmerkmale zur Sicherheit, die im Abschnitt bereits erläutert wurden, werden nun auf das Bewertungsmanagement konkretisiert. Vertraulichkeit Alle Dokumente im Bewertungsmanagement sollen vertraulich behandelt werden. Mitarbeiter sollen nur solche Dokumente einsehen können, bei denen sie eine Berechtigung haben. Dadurch kann die Manipulation von Bewertungsdokumente vermieden werden. In Rahmen der Kommunikationssicherheit kann das sogar bedeuten, dass selbst Wissen über das Stattfinden einer Kommunikation vertraulich bleiben soll. Integrität Integrität soll in allen Phasen des Bewertungsmanagement gewährleistet sein, um die Korrektheit von Informationen sicherzustellen. In Ausnahmefällen wie z. B. bei einem Ausfall besteht die Möglichkeit das System mithilfe eines Backups wieder herzustellen. Ein System muss sich zu jedem Zeitpunkt logisch korrekt verhalten, was die logische Vollständigkeit jeglicher Teile der Hardware und Software, die Sicherheitsfunktionen implementieren, voraussetzt. Verfügbarkeit Alle Dokumente und Funktionen des Bewertungsmanagements, die für das Bewerten der Module erforderlich sind, sollten jederzeit für den Benutzer zur Verfügung stehen.
67 Bewertungsmanagement an Hochschulen 58 Authentizität Um noch mehr Sicherheit zu gewährleisten, muss die Authentizität der Benutzer jederzeit sichergestellt sein. Im Bewertungsmanagement ist dies besonders wichtig, um unberechtigte Änderungen durch Dritte zu unterbinden. Single-Sign-On Das einmalige Eingeben der Login-Namen mit dem zugehörigen Passwort soll im Bewertungsmanagement ermöglichen, sämtliche Dienste anzuwenden. Sich bei jeder Modulbewertung erneut anmelden zu müssen wäre ein unnötiger Mehraufwand, die durch Single-Sign-On verhindert wird.
68 Prototypische Implementierung 59 5 Prototypische Implementierung Die Aufgabe im praktischen Teil der vorliegenden Arbeit war es, das erarbeitete Konzept am Beispiel des Grading Management System (GMS) prototypisch zu implementieren. Die Ergebnisse dieser Implementierung werden im folgenden Kapitel vorgestellt. Dabei wird darauf eingegangen, inwiefern die umgesetzten Funktionen die Ziele des Konzeptes unterstützen. Das Kapitel beginnt mit einer Vorstellung des bisherigen GMS. Im Anschluss werden die bereits vorhandenen und die realisierten Funktionen erläutert. 5.1 Grading Management System An der Universität Paderborn hat das GCC das GMS für die Fakultät WIWI entwickelt, um das im Szenario beschriebene Bewertungsmanagement an den Hochschulen und die Umsetzung der Anforderungen des Bologna-Prozesses zu erleichtern. Die bisherige Umsetzung des GMS in der Version 2.6 beinhaltet die Erfassung und Bewertung der Prüfungsformen nach: Klausur / Teilklausur Projektarbeit / Teamarbeit Seminararbeit / Hausarbeit Diplomarbeit / Bachelorarbeit / Masterarbeit Das vorhandene Grading Management System läuft als Datenbank unter Lotus Notes. Daher werden alle prototypischen Realisierungen mithilfe des Domino Designers implementiert. Die Abbildung 5.1 zeigt einen Screenshot des GMS, in dem die verschiedenen Kategorien Bewertungen, Prüfungen & Notenschema, Verwaltung, Administration, History und Persönliche Konfiguration abgebildet sind. Dabei kann der Menüpunkt Administration nur mit ausreichender Berechtigung eingesehen sowie dessen Inhalte genutzt werden. Die ersten drei Kategorien werden für Bewertungsaufgaben benötigt. Die Punkte Administration und Persönliche Konfiguration dienen zur Konfiguration bzw.
69 Prototypische Implementierung 60 Verwaltung des Systems. Die History zeigt alle bisher durchgeführten Änderungen an. Abbildung 5.1: Grading Management System Die einzelnen Kategorien sind wiederum in Unterkategorien unterteilt. Die Kategorie Bewertungen umfasst nach Prüfung, nach Student, nach Matrikelnummer, nach Projekt und nach L&F-Einheit 1. Die Unterkategorien von Prüfungen & Notenschema sind Modulprüfungen, Modulprüfungen (flach), Einzelprüfungen (CPS), Notenschemata 1,0-6,0 und Notenschemata 1,0-5,0. Die Kategorie Verwaltung beinhaltet Module, Lehrveranstaltung und Lehreinheiten. Die Unterkategorien führen zu den Ansichten, die die Dokumente zu den entsprechenden Modulen, Teilmodulen und den vorgenommenen Bewertungen beinhalten. In der Kategorie Bewertungen werden die Teilmodulbewertungs-Dokumente der Modulprüfungen aufgelistet. In diesen Dokumenten können von dem zuständigen Mitarbeiter die erreichten Punkte der einzelnen Studenten eingetragen werden. Erst nachdem alle Teilmodulbewertungen abgeschlossen sind, kann der Koordinator die Noten der Modulprüfung exportieren und dem Prüfungssekretariat zuschicken. 1 Lehr- & Forschungseinheit
70 Prototypische Implementierung 61 In Prüfungen & Notenschema können die benötigten Modulprüfungen mit ihren Teilmodulen erstellt und verwaltet werden. Beispielweise werden in den Dokumenten die Teilnehmerdaten importiert oder der Bewertungsstatus der Prüfung geändert. Unter Verwaltung werden Vorlagen der Modulprüfungen gespeichert. Diese Vorlagen werden bei der Erstellung von Modulprüfungen aufgerufen. Die fehlenden Daten der entsprechenden Teilmodulprüfungen werden von den zuständigen Mitarbeitern erfasst. Zu diesen Daten gehören beispielsweise das Prüfungsdatum und die Art der Klausuraufgaben. 5.2 Auswahl der Funktionen Im Abschnitt werden zunächst alle Funktionen des zuvor aufgestellten Konzepts genannt, die im GMS bereits umgesetzt waren. Im Abschnitt werden die im Prototyp realisierten Funktionen erläutert Vorhandene Funktionen In dem bisherigen GMS sind folgende Funktionalitäten enthalten: Vorlage Alle Arten von Modulprüfungen werden unter Verwaltung erfasst und dem Koordinator zur Verfügung gestellt. Beim Anlegen einer Modulprüfung kann der Koordinator die benötigte Vorlage aus einer Liste auswählen. Änderungen oder das Erfassen der noch fehlenden Daten können im Anschluss an die Erstellung direkt am Modulprüfungs-Dokument bzw. am Teilmodulprüfungs- Dokument vorgenommen werden. Ablage Die Ablage ist unter Bewertungen zu finden. Alle aktuellen und abgeschlossenen Modulbewertungen werden hier archiviert und können bearbeitet werden. Hilfefunktion Die Hilfefunktion ist bereits umgesetzt worden und unterstützt den Benutzer bei der Anwendung des GMS. Die Hilfefunktion muss nur noch bezüglich der neu realisierten Systemfunktionen angeglichen werden.
71 Prototypische Implementierung 62 Suchfunktion Die Suchfunktion ist bereits unter Lotus Notes vorhanden und ist somit für die Realisierung im GMS nicht mehr erforderlich. Berechtigungsmanagement Das Berechtigungsmanagement ist im GMS bereits umgesetzt worden. Es sind alle erforderlichen Rechte und Rollen für die Arbeit mit dem System vorhanden Realisierte Funktionen Für die prototypische Realisierung wurden die fehlenden Funktionen in das GMS integriert. Das System soll auf Prozessqualität achten und dabei den Gesamtprozess verbessern. Außerdem soll das System die Ergebnisse richtig generieren und die Zusammenarbeit lehrstuhlübergreifend unterstützen. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Umsetzung beschrieben Umsetzungen zur effizienten Projekt- und Teamorganisation Die Umsetzungen zur effizienten Projekt- und Teamorganisation beinhalten die Unterstützungsfunktionen zur effizienten Kommunikation, gezielten Information und dem Workflow-Management. Die Funktionen erleichtern die Arbeit mit dem System und die Organisation der Aufgaben im Team. Beispielsweise kann jederzeit die Kommunikation mit einem zuständigen Teilmodulprüfer aufgenommen werden, um bestehende Probleme zu klären. Zudem werden die Mitarbeiter mit Workflow- Funktionen an die fristgerechte Erledigung ihrer Aufgaben erinnert. Die umgesetzten Funktionen werden im Folgenden näher beschrieben: Bei Fragen zwischen dem Koordinator und den Teilmodulprüfern kann eine geschrieben werden. Dazu wird die -Adresse des Koordinators in der Modulvorlage erfasst, so dass diese Daten beim Erstellen der Modulprüfung übernommen werden. Bei Bedarf kann die Adresse des Koordinators im erstellten Modulprüfungs-Dokument aktualisiert werden.
72 Prototypische Implementierung 63 Abbildung 5.2: "Verwaltung/Module" Unter der zugehörigen Modulprüfung kann der Koordinator mit dem Button Kommunikation die -Funktion erreichen. Mit dem Button öffnet sich eine Dialogbox, in der die Empfänger aus einer Liste der vorhandenen Teilmodule bestimmt werden können. Nach dem Bestätigen öffnet sich ein -Formular, in dem alle ausgewählten Empfänger eingetragen sind. Die Betreffzeile beinhaltet das Semester, die Prüfungs ID und die Bezeichnung des Moduls. Abbildung 5.3: Koordinator kommuniziert mit den Teilmodulprüfern Diese Funktion benötigt eindeutige Verantwortliche für die Teilmodulprüfungen. Diese müssen im jeweiligen Dokument auf dem Reiter Berechtigungen eingetragen werden.
73 Prototypische Implementierung 64 Abbildung 5.4: an Koordinator schreiben Im Dokument der Teilmodulprüfung hat der Teilmodulprüfer ebenfalls die Möglichkeit dem Koordinator eine zu schreiben. Mit dem Button an Koordinator wird ein -Fomular mit der Adresse des Koordinators geöffnet. In der Betreffzeile wird automatisch das Semester, Prüfungsdatum und die Bezeichnung der Teilmodulprüfung übernommen. Instant Messaging Unter Teilmodulprüfung ist das Instant Messaging sowohl für den Koordinator als auch für den Teilmodulprüfer integriert, so dass sie jederzeit miteinander kommunizieren können. Das Instant Messaging befindet sich unter Koordinator/IM und unter dem Reiter Berechtigung. Mithilfe der enthaltenen Awareness-Funktion wird ersichtlich, wann der Koordinator online ist. Mit einem Rechtsklick auf den Namen des Koordinators und anschließend auf Chatten mit öffnet sich das Chat-Fenster und der Teilmodulprüfer kann mit dem Koordinator über Instant Messaging kommunizieren. Wenn der Modulprüfer aber versucht den Koordinator im Offline-Modus zu erreichen, bekommt er eine Fehlermeldung z. B. Kim Pham ist nicht mehr online.
74 Prototypische Implementierung 65 Abbildung 5.5: Instant Messaging Teamkonferenz Da der Prototyp für den Einsatz im Lehrstuhl WIWI der Universität Paderborn implementiert wird, wird auf eine Umsetzung der Teamkonferenzfunktion verzichtet. Die Mitarbeiter des Lehrstuhls sind örtlich nah beieinander, so dass ein persönliches Treffen wesentlich effektiver wäre als eine Lösung über das Grading Management System. Experten- und Anfängermodus Für den Experten- und Anfängermodus gibt es zwei Funktionen, die jeweils einund ausgeblendet werden können. Diese werden in den Abbildung 5.6 und Abbildung 5.7 dargestellt. Die Dokumenten Vorschau zeigt die Inhalte eines gewählten Dokuments in einem Teilfenster unter der Dokumentenliste an. Dazu muss sie zunächst durch einen Klick auf Dokumenten Vorschau aktiviert werden, so dass sich das Teilfenster öffnet. Auf diese Weise können die Dokumente ohne weiteren Aufwand gelesen werden.
75 Prototypische Implementierung 66 Abbildung 5.6: Dokumenten Vorschau Der Wegweiser wird durch einen Klick auf das Symbol an der Unterseite des Fensters aktiviert und nimmt das untere Viertel des Arbeitsfensters ein. Er hilft dem Anwender z. B. bei der Erstellung einer Modulprüfung, eines Workflows oder einer Teilmodulbewertung. Nach dem Öffnen kann auf der linken Seite des Wegweisers eine der angebotenen Hilfen ausgewählt werden. Die Prozessschritte, die der Benutzer danach befolgen sollte, werden auf der rechten Seite des Fensters beschrieben. So können die Erläuterungen der Grundfunktionalitäten direkt auf dem Arbeitsfenster eingesehen und befolgt werden.
76 Prototypische Implementierung 67 Abbildung 5.7: Wegweiser Feedback Unter jedem Hilfe-Button gibt es den Eintrag Feedback. Beim Anklicken dieser Funktion öffnet sich ein -Fenster, in dem die -Adresse des Empfängers und die Betreffzeile einen voreingestellten Eintrag besitzen. Hier kann der Benutzer ein Problem, einen Verbesserungswunsch usw. schildern. Auf diese Weise kann der Administrator erkennen, ob ein Handlungsbedarf zur Optimierung des Systems besteht. Diese Funktion wird im Bereich der effizienten Projekt- und Teamorganisation erläutert, weil sie zum Bereich der gezielten Information gehört. Grundsätzlich dient sie aber zur Optimierung des gesamten Systems. Abbildung 5.8: Feedback
77 Prototypische Implementierung 68 Workflow-Management An dieser Stelle werden die Workflow-Funktionen mithilfe eines Beispielfalls erläutert. Es soll verdeutlich werden, wie der Bewertungsprozess an der Universität Paderborn ablaufen kann. Mithilfe des vorliegenden Showcases sollen die Funktionen beschrieben und erläutert werden. Zuerst erstellt der Koordinator die erforderliche Modulprüfung z. B. Methoden der Wirtschaftsinformatik. Diese findet er unter der Ansicht Prüfung & Notenschemata/Modulprüfung erstellen. Anschließend kann der Koordinator einen Workflow erstellen, indem er die erstellte Modulprüfung öffnet und den Button Workflow starten auswählt. Abbildung 5.9: Workflow starten Wie in Abbildung 5.10 ersichtlich öffnet sich ein Fenster namens neuer Workflow. Unter Name wählt der Koordinator den Workflow-Typ aus und gibt die erforderlichen Informationen, wie die Priorität und die Einstellungen für die -Benachrichtigung des Koordinators unter dem Punkt Initiator ein. Der Titel wird automatisch übernommen und kann auf Wunsch verändert werden.
78 Prototypische Implementierung 69 Abbildung 5.10: Workflow erstellen Nachdem der Koordinator das Fenster mit OK bestätigt hat, kann er unter Meine Aufgaben/Von mir initiiert den erstellten Workflow betrachten. Dort werden alle vom Koordinator erstellten Workflows angezeigt, so dass er deren Verlauf und derzeitigen Status jederzeit mitverfolgen kann. Um Übersicht über die Aufgaben zu gewinnen, werden zusätzlich die Anzahl der enthaltenen Aufgaben angezeigt. Diese werden beim Starten des GMS ermittelt und bei jedem Neustart aktualisiert. Abbildung 5.11: Meine Aufgaben In der Ansicht unter Von mir initiiert werden alle Workflow Dokumente angezeigt, die vom Koordinator initiiert wurden. Die Ansicht beinhaltet die Spalten Modulbezeichnung, Erstellungsdatum, Zieldatum und Workflow, so dass ein schneller Überblick über die vorhandenen Dokumente ermöglicht wird. Die Spalte Workflow beinhaltet die Art des Workflows. Abbildung 5.12: Initierter Workflow
79 Prototypische Implementierung 70 Beim Doppelklick auf das gewünschte Dokument öffnet sich ein neues Fenster mit den entsprechenden Informationen bezüglich des Workflows und dem zugehörigen Link, der direkt auf das bearbeitete Dokument verweist. Das Workflow-Dokument gibt dem Koordinator Informationen über den Workflow. Neben der Workflow-Art und dem Status, wird im Feld Dokument ein Link zum Modul-Dokument zur Verfügung gestellt. Das Feld Zieldatum beinhaltet zu Beginn nur den Eintrag nicht festgelegt, da das Datum anhand der Prüfungsdaten der Teilmodule ermittelt wird. Das Feld Priorität stellt die Dringlichkeit des Workflows dar. Im zweiten Teil des Dokuments sind Informationen über die Teilmodule vorhanden. Neben dem Namen des Teilmoduls werden der Bearbeiter und die aktuelle Aufgabe der einzelnen Teilmodulprüfer angezeigt. Die Zeile Aufgabe gibt zudem Informationen über den Status der Bearbeitung wieder. Beispielsweise wird der Text Teilmodulprüfung erfassen: abgeschlossen wiedergegeben, wenn der Teilmodulprüfer seine Teilmodulprüfungs-Daten erfasst hat. Abbildung 5.13: Initiiertes Workflow-Dokument Nachdem der Workflow vom Koordinator initiiert wurde, können die aktuellen Bearbeiter unter Meine Aufgaben/Aktuell( ) ihre Aufgaben einsehen. Im vorliegenden Beispiel wurden alle Aufgabendokumente dem Koordinator zugeschickt, um den Vorgang überprüfen zu können.
80 Prototypische Implementierung 71 Abbildung 5.14: Ansicht-Aktuell Mit einem Doppelklick auf die aktuelle Aufgabe öffnet sich ein Fenster namens Workflow Aufgaben-Dokument. Dort erhält der aktuelle Bearbeiter die Informationen über die aktuelle Aufgabe mit einem Link auf das zugehörige Teilmodul. Zusätzlich zu den Daten, die mit dem Workflow-Dokument übereinstimmen, beinhaltet das Aufgaben-Dokument die Felder Aufgabe und Beschreibung, die alle benötigten Informationen über die aktuellen Aufgaben zur Verfügung stellen. Das Zieldatum wird zu diesem Zeitpunkt noch nicht festgelegt, da die nötigen Informationen fehlen. Abbildung 5.15: Workflow Aufgaben-Dokument Erst nachdem die Teilmodulprüfung von den Teilmodulprüfern erfasst wurde, können die Zieldaten in den folgenden Workflows festgelegt werden.
81 Prototypische Implementierung 72 Abbildung 5.16: Teilmodulprüfung Beim Klicken auf den Link wird das bearbeitete Dokument geöffnet. Auf diese Weise kann der aktuelle Bearbeiter seine Aufgabe erledigen, ohne das benötigte Teilmodul suchen zu müssen. Mit Aufgabe abschließen wird das Workflow Aufgaben-Dokument abgeschlossen. Diese werden in der Ablage aufbewahrt und können jederzeit eingesehen werden. Der Koordinator kann unter Von mir initiiert erkennen, wer die Teilmoduldokumente bereits abgeschlossen hat. Wenn alle Teilmodulprüfer die Prüfungsdaten erfasst haben, bekommt der Koordinator eine - Benachrichtigung. Abbildung 5.17: -Benachrichtigung
82 Prototypische Implementierung 73 Der Koordinator erfährt frühzeitig, dass er die Teilnehmerliste importieren muss, damit die Teilmodulprüfer die weiteren Aufgaben erhalten können. Mit dem ersten Link gelangt der Koordinator zum Workflow und mit dem zweiten Link wird er zur Modulprüfung weitergeleitet. Um zu der Teilnehmerliste zu gelangen, wird der zweite Link angewählt. Unter dem Button Teilnehmer importieren kann der Koordinator die Teilnehmerliste importieren. Mit dem ersten Link kann der Koordinator auf das Aufgaben-Dokument zugreifen und dieses abschließen. Danach erhalten die Teilmodulprüfer unter Meine Aufgaben/Aktuell( ) neue Aufgaben. Zudem erhält der Koordinator die Aufgabe HISPOS-Transfertabelle importieren. In diesem Fall ist es unabhängig, in welcher Reihenfolge die Aufgaben der Teilmodulprüfer und des Koordinators abgeschlossen werden. Sobald eine Aufgabe abgeschlossen ist, wird die nächste Aufgabe für den jeweiligen Prüfer erstellt. Den jeweiligen Bearbeitungsstatus kann der Koordinator im Workflow-Dokument in Von mir initiiert einsehen. Um auf die Teilmodulbewertung zu gelangen, muss der jeweilige Teilmodulprüfer auf dem Workflow Aufgaben-Dokument den Link anwählen. Anschließend kann der Telmodulprüfer den Button Bewertungen anzeigen anwählen. Abbildung 5.18: Bewertungen anzeigen Der Workflow setzt sich so lange fort, bis alle Prüfer die Noten der Teilmodule erfasst und eventuelle Korrekturen nach der Einsichtnahme durch die Studierenden durchgeführt haben. Wenn alle Aufgaben der Teilmodulprüfer abgeschlossen und die Teilnehmerlisten mit der HISPOS-Transfertabelle abgeglichen sind, erhält der Koordinator die Aufgabe, die Modulprüfung per HISPOS-Transfertabelle zu exportieren und diese an das Prüfungssekretariat zu
83 Prototypische Implementierung 74 senden. Zuletzt kann das Workflow-Dokument abgeschlossen werden und wird in die Ablage verschoben, in der auch alle anderen abgeschlossenen Workflow Aufgaben-Dokumente enthalten sind. Abbildung 5.19: Ablage In diesem Fall wird ein Ad-hoc-Workflow nicht benötigt, denn der vordefinierte Workflow reicht aus, um alle vorhandenen Prozesse inklusive der Ausnahmefälle abzudecken. Unter diesem Abschnitt wird die Terminplanung miteinbezogen. Diese wird durch die Ansicht Meine Aufgaben/Aktuell( ) und von mir initiiert dargestellt, da hier die Fristen der einzelnen Aufgaben jederzeit einsehbar sind. Des Weiteren bekommt der Koordinator eine -Benachrichtigung nachdem alle Teilmodulprüfer ihre Prüfungsdaten erfasst haben Umsetzungen zum gezielten Dokumentenmanagement Zum gezielten Dokumentenmanagement / Archivierung gehören die Funktionen zur Versionsänderung und der digitalen Signatur. Die Versionierungs-Funktion erlaubt den Benutzern das anlegen neuer Versionen, um wichtige Änderungen verfolgen zu können. Die digitale Signatur sichert die Bewertungen, da es durch sie möglich ist den Verantwortlichen für eine Änderung zu finden. Im Folgenden werden die genannten Funktionen näher erläutert: Versionsänderung Die Versionsänderung wird bei den Modul- und der Teilmodulbewertungs- Dokumenten eingesetzt. Diese können über die Ansichten unter der Kategorie
84 Prototypische Implementierung 75 Bewertungen erreicht werden. Öffnet man ein Dokument, können unter dem Reiter Status verschiedene Informationen zu Versionen eingesehen werden. Dort werden die aktuelle Versionsnummer, ein Kommentar und eine Liste der zuvor vorhandenen Versionen angezeigt. Eine Versionsnummer wird erst angelegt, nachdem mindestens eine Version eines Dokumentes erstellt wurde. Dabei wird mit der Version eins begonnen und jede neue Version bekommt eine höhere Nummer. Somit haben die ältesten Versionen die niedrigsten Versionsnummern. Ein erläuternder Kommentar zu einer neuen Version wird bei der Erstellung dieser über eine Inputbox abgegeben. Der eingegebene Text wird als Kommentar für die alte Version benutzt und kann auf diese Weise jederzeit eingesehen werden. Abbildung 5.20: Versionsänderung Unter der Versionsnummer und dem Kommentar befindet sich eine Liste aller älteren Versionen eines Dokuments. Die Liste wird durch eine eingebettete Ansicht realisiert und zeigt die Version, den Autor, das Erstellungsdatum und den Kommentar zum Dokument an. Mit einem Doppelklick auf die gewünschte Dokumentenversion kann diese geöffnet werden.
85 Prototypische Implementierung 76 Neue Versionen können mit dem Button neue Versionen angelegt werden. Nach dem Abschluss aller Eingaben kann direkt an der neuen Version gearbeitet werden und die bisherige Version erscheint in der zuvor beschriebenen Liste. Digitale Signatur Digitale Signaturen werden im Teilmodulbewertungs-Dokument eingesetzt, um Änderungen an den vergebenen Punkten nach zu verfolgen. Zu diesem Zweck werden beim Speichern des Dokuments die modifizierten Punkt-Felder mit der ID des Benutzers, dem Datum und dem Zeitpunkt der Speicherung automatisch signiert. Abbildung 5.21: Digitale Signatur Die Signatur kann wie in Abbildung 5.21 zu sehen ist, mithilfe eines Informationsicons eingesehen werden. Sollte keine Signatur vorhanden sein, wird der Text bisher noch nicht signiert angezeigt. Die automatische Signierung stellt sicher, dass immer nachvollzogen werden kann, welcher Mitarbeiter eine Bewertung vorgenommen bzw. modifiziert hat. Aktuelle Signaturen überschreiben die älteren, wobei aus Effiziensgründen immer nur die Felder aktualisiert werden, die auch tatsächlich verändert wurden, z. B. durch eine Korrektur nach einer Einsicht.
Übersicht über ISO 9001:2000
 Übersicht über die ISO 9001:2000 0 Einleitung 1 Anwendungsbereich 2 Normative Verweisungen 3 Begriffe Übersicht über die ISO 9001:2000 4 Qualitätsmanagementsystem 5 Verantwortung der Leitung 6 Management
Übersicht über die ISO 9001:2000 0 Einleitung 1 Anwendungsbereich 2 Normative Verweisungen 3 Begriffe Übersicht über die ISO 9001:2000 4 Qualitätsmanagementsystem 5 Verantwortung der Leitung 6 Management
2 Geschäftsprozesse realisieren
 2 Geschäftsprozesse realisieren auf fünf Ebenen Modelle sind vereinfachte Abbilder der Realität und helfen, Zusammenhänge einfach und verständlich darzustellen. Das bekannteste Prozess-Modell ist das Drei-Ebenen-Modell.
2 Geschäftsprozesse realisieren auf fünf Ebenen Modelle sind vereinfachte Abbilder der Realität und helfen, Zusammenhänge einfach und verständlich darzustellen. Das bekannteste Prozess-Modell ist das Drei-Ebenen-Modell.
Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9000ff
 Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9000ff Die Qualität von Produkten und Dienstleistungen ist ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor. Soll dauerhaft Qualität geliefert werden, ist die Organisation von Arbeitsabläufen
Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9000ff Die Qualität von Produkten und Dienstleistungen ist ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor. Soll dauerhaft Qualität geliefert werden, ist die Organisation von Arbeitsabläufen
Groupware. Stand : Februar 2006
 Groupware Stand : Februar 2006 CSCW - Definition CSCW (dt.: computerunterstützte Gruppenarbeit) "... bezeichnet Arbeitsszenarien, die mit Hilfe von Informationssystemen Gruppenarbeit verbessern." (P. Mertens
Groupware Stand : Februar 2006 CSCW - Definition CSCW (dt.: computerunterstützte Gruppenarbeit) "... bezeichnet Arbeitsszenarien, die mit Hilfe von Informationssystemen Gruppenarbeit verbessern." (P. Mertens
ISO 9001: Einleitung. 1 Anwendungsbereich. 2 Normative Verweisungen. 4 Qualitätsmanagementsystem. 4.1 Allgemeine Anforderungen
 DIN EN ISO 9001 Vergleich ISO 9001:2015 und ISO 9001:2015 0 Einleitung 1 Anwendungsbereich 2 Normative Verweisungen 3 Begriffe 4 Kontext der Organisation 4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes
DIN EN ISO 9001 Vergleich ISO 9001:2015 und ISO 9001:2015 0 Einleitung 1 Anwendungsbereich 2 Normative Verweisungen 3 Begriffe 4 Kontext der Organisation 4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes
Fragenkatalog 2 CAF-Gütesiegel - Fragenkatalog für den CAF-Aktionsplan (Verbesserungsplan)
 Fragenkatalog 2 CAF-Gütesiegel - Fragenkatalog für den CAF-Aktionsplan (Verbesserungsplan) Der Fragenkatalog deckt die Schritte sieben bis neun ab, die in den Leitlinien zur Verbesserung von Organisationen
Fragenkatalog 2 CAF-Gütesiegel - Fragenkatalog für den CAF-Aktionsplan (Verbesserungsplan) Der Fragenkatalog deckt die Schritte sieben bis neun ab, die in den Leitlinien zur Verbesserung von Organisationen
"Unternehmensziel Qualität" Wettbewerbsvorteile durch Qualitätsmanagementsysteme
 "Unternehmensziel Qualität" Wettbewerbsvorteile durch Qualitätsmanagementsysteme Gliederung 1. Wettbewerbsfaktor Qualität 2. Der Ablauf 3. Die Ist-Analyse 4. Die Dokumentation 5. Werkzeuge, Methoden, Instrumente
"Unternehmensziel Qualität" Wettbewerbsvorteile durch Qualitätsmanagementsysteme Gliederung 1. Wettbewerbsfaktor Qualität 2. Der Ablauf 3. Die Ist-Analyse 4. Die Dokumentation 5. Werkzeuge, Methoden, Instrumente
ÄNDERUNGEN UND SCHWERPUNKTE
 REVISION ISO 9001:2015 ÄNDERUNGEN UND SCHWERPUNKTE FRANKFURT, 25. JULI 2014 Folie Agenda 1. High Level Structure nach Annex SL 2. QMS Structure 3. Schwerpunkte der Änderungen Revision Iso 9001:2015 06/14
REVISION ISO 9001:2015 ÄNDERUNGEN UND SCHWERPUNKTE FRANKFURT, 25. JULI 2014 Folie Agenda 1. High Level Structure nach Annex SL 2. QMS Structure 3. Schwerpunkte der Änderungen Revision Iso 9001:2015 06/14
HERZLICH WILLKOMMEN. Revision der 9001:2015
 HERZLICH WILLKOMMEN Revision der 9001:2015 Volker Landscheidt Qualitätsmanagementbeauftragter DOYMA GmbH & Co 28876 Oyten Regionalkreisleiter DQG Elbe-Weser Die Struktur der ISO 9001:2015 Einleitung Kapitel
HERZLICH WILLKOMMEN Revision der 9001:2015 Volker Landscheidt Qualitätsmanagementbeauftragter DOYMA GmbH & Co 28876 Oyten Regionalkreisleiter DQG Elbe-Weser Die Struktur der ISO 9001:2015 Einleitung Kapitel
Qualität im üblichen Sprachgebrauch ist...
 Qualität im üblichen Sprachgebrauch ist... wenn der Kunde zurückkommt - und nicht das Produkt alles richtig machen... ein fehlerfreies f Produkt bzw. eine fehlerfreie f Leistung Übereinstimmung zwischen
Qualität im üblichen Sprachgebrauch ist... wenn der Kunde zurückkommt - und nicht das Produkt alles richtig machen... ein fehlerfreies f Produkt bzw. eine fehlerfreie f Leistung Übereinstimmung zwischen
Prozessorganisation Mitschriften aus den Vorlesung bzw. Auszüge aus Prozessorganisation von Prof. Dr. Rudolf Wilhelm Feininger
 Prozesse allgemein Typische betriebliche Prozesse: Bearbeitung von Angeboten Einkauf von Materialien Fertigung und Versand von Produkten Durchführung von Dienstleistungen Prozessorganisation befasst sich
Prozesse allgemein Typische betriebliche Prozesse: Bearbeitung von Angeboten Einkauf von Materialien Fertigung und Versand von Produkten Durchführung von Dienstleistungen Prozessorganisation befasst sich
Prozessorientierte Zertifizierung - Nachhaltigkeitsorientierte Zertifizierung Unterschied aus Sicht der Hersteller
 Prozessorientierte Zertifizierung - Nachhaltigkeitsorientierte Zertifizierung Unterschied aus Sicht der Hersteller 1 Die Normen Welche Normen und Verordnungen werden betrachtet? o DIN EN ISO 9001:2008
Prozessorientierte Zertifizierung - Nachhaltigkeitsorientierte Zertifizierung Unterschied aus Sicht der Hersteller 1 Die Normen Welche Normen und Verordnungen werden betrachtet? o DIN EN ISO 9001:2008
Shared Services: Grundlegende Konzeption und konkrete Umsetzung im Bereich Human Resources
 Wirtschaft Christine Rössler Shared Services: Grundlegende Konzeption und konkrete Umsetzung im Bereich Human Resources Diplomarbeit Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Diplom-Betriebswirtin
Wirtschaft Christine Rössler Shared Services: Grundlegende Konzeption und konkrete Umsetzung im Bereich Human Resources Diplomarbeit Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Diplom-Betriebswirtin
Grundlagen, Bedeutung und Messbarkeit von Qualität in der Arbeitsintegration
 supported employment schweiz Fachtagung 2014 Grundlagen, Bedeutung und Messbarkeit von Qualität in der Arbeitsintegration Claudio Spadarotto, KEK-CDC Consultants Universitätstrasse 69, CH-8006 Zürich spadarotto@kek.ch
supported employment schweiz Fachtagung 2014 Grundlagen, Bedeutung und Messbarkeit von Qualität in der Arbeitsintegration Claudio Spadarotto, KEK-CDC Consultants Universitätstrasse 69, CH-8006 Zürich spadarotto@kek.ch
Prozeßmanagement. Wintersemester 2014/2015 Arbeitsgruppe Wirtschaftsinformatik - Managementinformationssysteme - Prof. Dr.
 Prozeßmanagement Wintersemester 2014/2015 Arbeitsgruppe Wirtschaftsinformatik - Managementinformationssysteme - Prof. Dr. Hans-Knud Arndt Arbeitsgruppe Wirtschaftsinformatik Managementinformationssysteme
Prozeßmanagement Wintersemester 2014/2015 Arbeitsgruppe Wirtschaftsinformatik - Managementinformationssysteme - Prof. Dr. Hans-Knud Arndt Arbeitsgruppe Wirtschaftsinformatik Managementinformationssysteme
Vorwort zur 2., überarbeiteten und aktualisierten Auflage... V Vorwort zur 1. Auflage... VII Abbildungsverzeichnis... XIII
 IX Inhaltsverzeichnis Vorwort zur 2., überarbeiteten und aktualisierten Auflage................ V Vorwort zur 1. Auflage......................................... VII Abbildungsverzeichnis........................................
IX Inhaltsverzeichnis Vorwort zur 2., überarbeiteten und aktualisierten Auflage................ V Vorwort zur 1. Auflage......................................... VII Abbildungsverzeichnis........................................
Inhalt. 2.1 Grundlagen 25 2.2 Vision, Mission und Strategien 26 2.3 Das Werkzeug Balanced Scorecard nutzen 29 2.4 Die BSC mit Prozessen verknüpfen 33
 1 Mit Prozessorientiertem Qualitätsmanagement (PQM) zum Erfolg 1 1.1 Gründe für Prozessorientiertes Qualitätsmanagement 1 1.2 Die funktionsorientierte Sichtweise eines Unternehmens 3 1.3 Die prozessorientierte
1 Mit Prozessorientiertem Qualitätsmanagement (PQM) zum Erfolg 1 1.1 Gründe für Prozessorientiertes Qualitätsmanagement 1 1.2 Die funktionsorientierte Sichtweise eines Unternehmens 3 1.3 Die prozessorientierte
Notationen zur Prozessmodellierung
 Notationen zur Prozessmodellierung August 2014 Inhalt (erweiterte) ereignisgesteuerte Prozesskette (eepk) 3 Wertschöpfungskettendiagramm (WKD) 5 Business Process Model and Notation (BPMN) 7 Unified Modeling
Notationen zur Prozessmodellierung August 2014 Inhalt (erweiterte) ereignisgesteuerte Prozesskette (eepk) 3 Wertschöpfungskettendiagramm (WKD) 5 Business Process Model and Notation (BPMN) 7 Unified Modeling
Entwicklungsberatung - wir begleiten und unterstützen Sie
 Entwicklungsberatung - wir begleiten und unterstützen Sie Eine umfassende Betreuung Ihrer Entwicklung im Rahmen einzelner PE/OE-Maßnahmen und integrierter, ganzheitlicher Entwicklungsprogramme ist uns
Entwicklungsberatung - wir begleiten und unterstützen Sie Eine umfassende Betreuung Ihrer Entwicklung im Rahmen einzelner PE/OE-Maßnahmen und integrierter, ganzheitlicher Entwicklungsprogramme ist uns
Die vorliegende Arbeitshilfe befasst sich mit den Anforderungen an qualitätsrelevante
 ISO 9001:2015 Die vorliegende Arbeitshilfe befasst sich mit den Anforderungen an qualitätsrelevante Prozesse. Die ISO 9001 wurde grundlegend überarbeitet und modernisiert. Die neue Fassung ist seit dem
ISO 9001:2015 Die vorliegende Arbeitshilfe befasst sich mit den Anforderungen an qualitätsrelevante Prozesse. Die ISO 9001 wurde grundlegend überarbeitet und modernisiert. Die neue Fassung ist seit dem
Was geht Qualitätsmanagement/ Qualitätsicherung die Physiotherapeutenan? Beispiel einer zertifizierten Abteilung
 Was geht Qualitätsmanagement/ Qualitätsicherung die Physiotherapeutenan? Beispiel einer zertifizierten Abteilung Angestellten Forum des ZVK Stuttgart 04.03.2016 Birgit Reinecke ZentraleEinrichtungPhysiotherapieund
Was geht Qualitätsmanagement/ Qualitätsicherung die Physiotherapeutenan? Beispiel einer zertifizierten Abteilung Angestellten Forum des ZVK Stuttgart 04.03.2016 Birgit Reinecke ZentraleEinrichtungPhysiotherapieund
Arbeitsanweisung. Prozessorientierter Ansatz und Wechselwirkung von Prozessen VA
 Arbeitsanweisung Prozessorientierter Ansatz und Wechselwirkung von Prozessen VA04010100 Revisionsstand: 02 vom 24.11.16 Ersetzt Stand: 01 vom 14.10.08 Ausgabe an Betriebsfremde nur mit Genehmigung der
Arbeitsanweisung Prozessorientierter Ansatz und Wechselwirkung von Prozessen VA04010100 Revisionsstand: 02 vom 24.11.16 Ersetzt Stand: 01 vom 14.10.08 Ausgabe an Betriebsfremde nur mit Genehmigung der
Konzeption und Evaluation eines Ansatzes zur Methodenintegration im Qualitätsmanagement
 Konzeption und Evaluation eines Ansatzes zur Methodenintegration im Qualitätsmanagement Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Wirtschaftswissenschaft eingereicht an der Wirtschaftswissenschaftlichen
Konzeption und Evaluation eines Ansatzes zur Methodenintegration im Qualitätsmanagement Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Wirtschaftswissenschaft eingereicht an der Wirtschaftswissenschaftlichen
TÜV NORD CERT GmbH DIN EN ISO 9001:2015 und Risikomanagement Anforderungen und Umsetzung
 TÜV NORD CERT GmbH Einfach ausgezeichnet. TÜV NORD CERT GmbH Einfach ausgezeichnet. Risikomanagement Aktueller Stand 2016 DIN EN ISO 9001:2015 und Risikomanagement Anforderungen und Umsetzung DIN EN ISO
TÜV NORD CERT GmbH Einfach ausgezeichnet. TÜV NORD CERT GmbH Einfach ausgezeichnet. Risikomanagement Aktueller Stand 2016 DIN EN ISO 9001:2015 und Risikomanagement Anforderungen und Umsetzung DIN EN ISO
Inhaltsverzeichnis. Geleitwort 1 Vorwort 3 Abkürzungsverzeichnis 5
 7 Inhaltsverzeichnis Geleitwort 1 Vorwort 3 Abkürzungsverzeichnis 5 1 Zunehmende Prozessorientierung als Entwicklungstendenz im gesundheitspolitischen Umfeld des Krankenhauses 13 Günther E. Braun 1.1 Strukturwandel
7 Inhaltsverzeichnis Geleitwort 1 Vorwort 3 Abkürzungsverzeichnis 5 1 Zunehmende Prozessorientierung als Entwicklungstendenz im gesundheitspolitischen Umfeld des Krankenhauses 13 Günther E. Braun 1.1 Strukturwandel
Die wichtigsten Begriffe und ihre Verwendung
 Die wichtigsten Begriffe und ihre Verwendung Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die wichtigsten Begriffe zu Wirkungsmessung und deren Definitionen. Zudem wird der Begriff Wirkungsmessung zu Qualitätsmanagement
Die wichtigsten Begriffe und ihre Verwendung Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die wichtigsten Begriffe zu Wirkungsmessung und deren Definitionen. Zudem wird der Begriff Wirkungsmessung zu Qualitätsmanagement
6 Teilnehmerunterlage (nur auf CD-ROM)
 Modul 1: Einführung in die DIN EN ISO 9000er Reihe 1. So wenden Sie diese Praxislösung an.................... 7 1 DIN EN ISO 9000 ff. Warum? 1/01 Gründe für ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem.......................
Modul 1: Einführung in die DIN EN ISO 9000er Reihe 1. So wenden Sie diese Praxislösung an.................... 7 1 DIN EN ISO 9000 ff. Warum? 1/01 Gründe für ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem.......................
Projekt Assessment. Ermittlung und Umsetzung von Verbesserungspotentialen in der Projektarbeit. Project Consulting C o m p a n y
 Projekt Assessment Ermittlung und Umsetzung von Verbesserungspotentialen in der Projektarbeit Company KG Herbert-Weichmann-Straße 73 22085 Hamburg Telefon: 040.2788.1588 Telefax: 040.2788.0467 e-mail:
Projekt Assessment Ermittlung und Umsetzung von Verbesserungspotentialen in der Projektarbeit Company KG Herbert-Weichmann-Straße 73 22085 Hamburg Telefon: 040.2788.1588 Telefax: 040.2788.0467 e-mail:
QM nach DIN EN ISO 9001:2015. copyright managementsysteme Seiler Tel:
 QM nach DIN EN ISO 9001:2015 1 copyright managementsysteme Seiler www.erfolgsdorf.de Tel: 2 Prozessplanung copyright managementsysteme Seiler www.erfolgsdorf.de Tel: 3 Kennzahlen im Unternehmen 48 Lieferzeit
QM nach DIN EN ISO 9001:2015 1 copyright managementsysteme Seiler www.erfolgsdorf.de Tel: 2 Prozessplanung copyright managementsysteme Seiler www.erfolgsdorf.de Tel: 3 Kennzahlen im Unternehmen 48 Lieferzeit
Die Neuerungen bei den Anforderungen nach dem DStV-Qualitätssiegel. Anforderungen nach dem DStV-Qualitätssiegel
 Die Neuerungen bei den Anforderungen nach dem DStV-Qualitätssiegel Anforderungen nach dem DStV-Qualitätssiegel Neuerungen bei den Anforderungen des DStV-Qualitätssiegels aufgrund der neuen DIN EN ISO 9001:2015
Die Neuerungen bei den Anforderungen nach dem DStV-Qualitätssiegel Anforderungen nach dem DStV-Qualitätssiegel Neuerungen bei den Anforderungen des DStV-Qualitätssiegels aufgrund der neuen DIN EN ISO 9001:2015
Kundenorientiertes Qualitätsmanagement in der Automobilindustrie
 Jutta Schwarze Kundenorientiertes Qualitätsmanagement in der Automobilindustrie Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Egon Jehle A 235902 Deutscher Universitäts-Verlag XI Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis
Jutta Schwarze Kundenorientiertes Qualitätsmanagement in der Automobilindustrie Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Egon Jehle A 235902 Deutscher Universitäts-Verlag XI Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis
Zuordnung der Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2015 im QMS-Reha
 4. Kontext der Organisation Zuordnung der Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2015 im QMS-Reha 4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes 4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter
4. Kontext der Organisation Zuordnung der Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2015 im QMS-Reha 4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes 4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter
Einfluß der Prozesskostenrechnung auf die Aufbauorganisation - Stellgrößen eines aktiven Prozessmanagements
 Wirtschaft Tobias Tissberger Einfluß der Prozesskostenrechnung auf die Aufbauorganisation - Stellgrößen eines aktiven Prozessmanagements Diplomarbeit Diplomarbeit Einfluss der Prozesskostenrechnung auf
Wirtschaft Tobias Tissberger Einfluß der Prozesskostenrechnung auf die Aufbauorganisation - Stellgrößen eines aktiven Prozessmanagements Diplomarbeit Diplomarbeit Einfluss der Prozesskostenrechnung auf
11. Westsächsisches Umweltforum 12. November 2015, Meerane. Informationen zur Revision der DIN EN ISO 14001:2015
 11. Westsächsisches Umweltforum 12. November 2015, Meerane Informationen zur Revision der DIN EN ISO 14001:2015 Dipl. Kfm., Dipl. Ing. (FH) Jens Hengst qualinova Beratung für Integrierte Managementsysteme
11. Westsächsisches Umweltforum 12. November 2015, Meerane Informationen zur Revision der DIN EN ISO 14001:2015 Dipl. Kfm., Dipl. Ing. (FH) Jens Hengst qualinova Beratung für Integrierte Managementsysteme
your IT in line with your Business Geschäftsprozessmanagement (GPM)
 your IT in line with your Business Geschäftsprozessmanagement (GPM) Transparenz schaffen und Unternehmensziele effizient erreichen Transparente Prozesse für mehr Entscheidungssicherheit Konsequente Ausrichtung
your IT in line with your Business Geschäftsprozessmanagement (GPM) Transparenz schaffen und Unternehmensziele effizient erreichen Transparente Prozesse für mehr Entscheidungssicherheit Konsequente Ausrichtung
Verstehen als Grundvoraussetzung für Industrie 4.0
 Verstehen als Grundvoraussetzung für Industrie 4.0 Eine Studie der H&D International Group beleuchtet den aktuellen Stand der Zusammenarbeit zwischen IT und Produktion 2 Inhalt Einleitung 3 Aktuelle Situation
Verstehen als Grundvoraussetzung für Industrie 4.0 Eine Studie der H&D International Group beleuchtet den aktuellen Stand der Zusammenarbeit zwischen IT und Produktion 2 Inhalt Einleitung 3 Aktuelle Situation
Der Einsatz der Six Sigma-Methode zur Qualitätssteigerung in Unternehmen
 Technik Gerhard Gütl Der Einsatz der Six Sigma-Methode zur Qualitätssteigerung in Unternehmen Bachelorarbeit 2. Bachelorarbeit Six Sigma FH-Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieur Vertiefung Produktions-
Technik Gerhard Gütl Der Einsatz der Six Sigma-Methode zur Qualitätssteigerung in Unternehmen Bachelorarbeit 2. Bachelorarbeit Six Sigma FH-Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieur Vertiefung Produktions-
Rollen- und Berechtigungskonzepte in der IT-Prüfung. Bachelorarbeit
 Rollen- und Berechtigungskonzepte in der IT-Prüfung Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B.Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft der Wirtschaftswissenschaftlichen
Rollen- und Berechtigungskonzepte in der IT-Prüfung Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B.Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft der Wirtschaftswissenschaftlichen
Geschäftsprozessmanagement
 Geschäftsprozessmanagement Der INTARGIA-Ansatz Whitepaper Dr. Thomas Jurisch, Steffen Weber INTARGIA Managementberatung GmbH Max-Planck-Straße 20 63303 Dreieich Telefon: +49 (0)6103 / 5086-0 Telefax: +49
Geschäftsprozessmanagement Der INTARGIA-Ansatz Whitepaper Dr. Thomas Jurisch, Steffen Weber INTARGIA Managementberatung GmbH Max-Planck-Straße 20 63303 Dreieich Telefon: +49 (0)6103 / 5086-0 Telefax: +49
QM-Handbuch. der. ReJo Personalberatung
 QM-Handbuch der ReJo Personalberatung Version 2.00 vom 30.11.2012 Das QM-System der ReJo Personalberatung hat folgenden Geltungsbereich: Beratung der Unternehmen bei der Gewinnung von Personal Vermittlung
QM-Handbuch der ReJo Personalberatung Version 2.00 vom 30.11.2012 Das QM-System der ReJo Personalberatung hat folgenden Geltungsbereich: Beratung der Unternehmen bei der Gewinnung von Personal Vermittlung
Interkulturelles Projektmanagement in internationalen Projekten am Beispiel von afghanischen Mitarbeitern. Bachelorarbeit
 Interkulturelles Projektmanagement in internationalen Projekten am Beispiel von afghanischen Mitarbeitern Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades,,Bachelor of Science (B.Sc.) im Studiengang
Interkulturelles Projektmanagement in internationalen Projekten am Beispiel von afghanischen Mitarbeitern Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades,,Bachelor of Science (B.Sc.) im Studiengang
Nutzen Sie das in Easy Turtle voll editierbare Modell der DIN EN ISO 9001:2008
 Nutzen Sie das in Easy Turtle voll editierbare Modell der DIN EN ISO 9001:2008 Qualität ist keine Funktion Qualität ist ein Weg des Denkens. Qualität ist die Summe aller Tätigkeiten in einem Unternehmen.
Nutzen Sie das in Easy Turtle voll editierbare Modell der DIN EN ISO 9001:2008 Qualität ist keine Funktion Qualität ist ein Weg des Denkens. Qualität ist die Summe aller Tätigkeiten in einem Unternehmen.
Qualitätsmanagement. Denny Bayer
 Qualitätsmanagement Denny Bayer 2 Inhalt Was ist QM Motivation Entstehung ISO 9000 ff. Zertifizierung Methoden des QM 3 Motivation Qualität wird vom Nutzer wahrgenommen Kundenorientierung Zuverlässige
Qualitätsmanagement Denny Bayer 2 Inhalt Was ist QM Motivation Entstehung ISO 9000 ff. Zertifizierung Methoden des QM 3 Motivation Qualität wird vom Nutzer wahrgenommen Kundenorientierung Zuverlässige
DISKUSSIONSBEITRÄGE DER FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE MERCATOR SCHOOL OF MANAGEMENT UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN. Nr. 350
 DISKUSSIONSBEITRÄGE DER FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE MERCATOR SCHOOL OF MANAGEMENT UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN Nr. 350 Ein konzeptioneller Business-Intelligence-Ansatz zur Gestaltung von Geschäftsprozessen
DISKUSSIONSBEITRÄGE DER FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE MERCATOR SCHOOL OF MANAGEMENT UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN Nr. 350 Ein konzeptioneller Business-Intelligence-Ansatz zur Gestaltung von Geschäftsprozessen
Projektentwicklung mit dem. Logical Framework Approach
 Projektentwicklung mit dem Logical Framework Approach Jens Herrmann, 06/2014 Der Logical Framework Approach Der Logical Framework Ansatz ist ein Werkzeug zur Erstellung, Monitoring und der Evaluation von
Projektentwicklung mit dem Logical Framework Approach Jens Herrmann, 06/2014 Der Logical Framework Approach Der Logical Framework Ansatz ist ein Werkzeug zur Erstellung, Monitoring und der Evaluation von
Diplomarbeit. gframe und das gedas Human Change Management Framework am Beispiel einer SAP R/3 Einführung im iranischen Automotive Sektor
 Hochschule Harz Wernigerode Fachbereich Wirtschaftswissenschaften Studiengang Wirtschaftsinformatik Diplomarbeit gframe und das gedas Human Change Management Framework am Beispiel einer SAP R/3 Einführung
Hochschule Harz Wernigerode Fachbereich Wirtschaftswissenschaften Studiengang Wirtschaftsinformatik Diplomarbeit gframe und das gedas Human Change Management Framework am Beispiel einer SAP R/3 Einführung
Gerit Grübler (Autor) Ganzheitliches Multiprojektmanagement Mit einer Fallstudie in einem Konzern der Automobilzulieferindustrie
 Gerit Grübler (Autor) Ganzheitliches Multiprojektmanagement Mit einer Fallstudie in einem Konzern der Automobilzulieferindustrie https://cuvillier.de/de/shop/publications/2491 Copyright: Cuvillier Verlag,
Gerit Grübler (Autor) Ganzheitliches Multiprojektmanagement Mit einer Fallstudie in einem Konzern der Automobilzulieferindustrie https://cuvillier.de/de/shop/publications/2491 Copyright: Cuvillier Verlag,
Teil 1: Neues Obligationenrecht. Version 2.1, 22. Oktober 2007 Sven Linder, lic. oec. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer Stephan Illi, lic. oec.
 Teil 1: Neues Obligationenrecht Version 2.1, 22. Oktober 2007 Sven Linder, lic. oec. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer Stephan Illi, lic. oec. HSG Überblick Neue gesetzliche Bestimmungen Mögliche Auslegung
Teil 1: Neues Obligationenrecht Version 2.1, 22. Oktober 2007 Sven Linder, lic. oec. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer Stephan Illi, lic. oec. HSG Überblick Neue gesetzliche Bestimmungen Mögliche Auslegung
Projektmanagement mit Netzplantechnik
 NWB Studium Betriebswirtschaft Projektmanagement mit Netzplantechnik Bearbeitet von Jochen Schwarze 10., überarbeitete und erweiterte Auflage. Ausschließliche Nutzung als Online-Version. 2010. Onlineprodukt.
NWB Studium Betriebswirtschaft Projektmanagement mit Netzplantechnik Bearbeitet von Jochen Schwarze 10., überarbeitete und erweiterte Auflage. Ausschließliche Nutzung als Online-Version. 2010. Onlineprodukt.
Exposé zur Safari-Studie 2002: Der Mensch in IT-Projekten Tools und Methoden für den Projekterfolg durch Nutzerakzeptanz
 Exposé zur Safari-Studie 2002: Der Mensch in IT-Projekten Tools und Methoden für den Projekterfolg durch Nutzerakzeptanz Inhalt: Viele IT-Projekte scheitern nicht aus technisch bedingten Gründen, sondern
Exposé zur Safari-Studie 2002: Der Mensch in IT-Projekten Tools und Methoden für den Projekterfolg durch Nutzerakzeptanz Inhalt: Viele IT-Projekte scheitern nicht aus technisch bedingten Gründen, sondern
«Titel der Arbeit» SEMINARARBEIT. an der. Universität Regensburg. Eingereicht bei der Honorarprofessur für Wirtschaftsinformatik,
 «Titel der Arbeit» SEMINARARBEIT an der Universität Regensburg Eingereicht bei der Honorarprofessur für Wirtschaftsinformatik, -Prof. Dr. Hans-Gert Penzel- von: Name, Vorname Matrikel-Nr.: 123 456 Adresse:
«Titel der Arbeit» SEMINARARBEIT an der Universität Regensburg Eingereicht bei der Honorarprofessur für Wirtschaftsinformatik, -Prof. Dr. Hans-Gert Penzel- von: Name, Vorname Matrikel-Nr.: 123 456 Adresse:
Strategische Unternehmensplanung
 Hartmut Kreikebaum Strategische Unternehmensplanung 6., überarbeitete und erweiterte Auflage Verlag W. Kohlhammer Köln Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis... 11 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis...
Hartmut Kreikebaum Strategische Unternehmensplanung 6., überarbeitete und erweiterte Auflage Verlag W. Kohlhammer Köln Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis... 11 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis...
2.1.1 Modelle des Informationsmanagements ITIL Information Technology Infrastructure Library 36
 Vorwort 6 Zum Gebrauch des Kompaktkurses 8 Inhaltsverzeichnis 12 Abbildungsverzeichnis 16 Tabellenverzeichnis 18 Abkürzungsverzeichnis 20 1 Was ist Wirtschaftsinformatik? 22 1.1 Fallstudie: Reiseveranstalter
Vorwort 6 Zum Gebrauch des Kompaktkurses 8 Inhaltsverzeichnis 12 Abbildungsverzeichnis 16 Tabellenverzeichnis 18 Abkürzungsverzeichnis 20 1 Was ist Wirtschaftsinformatik? 22 1.1 Fallstudie: Reiseveranstalter
Vorwort. Wir verfolgen das Ziel die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern.
 Vorwort Wir verfolgen das Ziel die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern. Mit dieser Zielsetzung vor Augen haben wir Führungskräfte der gpe uns Führungsleitlinien gegeben. Sie basieren
Vorwort Wir verfolgen das Ziel die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern. Mit dieser Zielsetzung vor Augen haben wir Führungskräfte der gpe uns Führungsleitlinien gegeben. Sie basieren
- Leseprobe - ISO 19011:2011 Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen Kurzprofil. ISO 19011:2011 Kurzprofil Kurzbeschreibung
 ISO 19011:2011 Kurzprofil 02531 Seite 1 ISO 19011:2011 Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen Kurzprofil Titel Angaben zur aktuellen Ausgabe von Fritz von Below und Wolfgang Kallmeyer 1 Kurzbeschreibung
ISO 19011:2011 Kurzprofil 02531 Seite 1 ISO 19011:2011 Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen Kurzprofil Titel Angaben zur aktuellen Ausgabe von Fritz von Below und Wolfgang Kallmeyer 1 Kurzbeschreibung
INDUTEC Reine Perfektion!
 INDUTEC Reine Perfektion! Unsere Vision und unsere Werte Indutec Umwelttechnik GmbH & Co. KG Zeißstraße 22-24 D-50171 Kerpen / Erft Telefon: +49 (0) 22 37 / 56 16 0 Telefax: +49 (0) 22 37 / 56 16 70 E-Mail:
INDUTEC Reine Perfektion! Unsere Vision und unsere Werte Indutec Umwelttechnik GmbH & Co. KG Zeißstraße 22-24 D-50171 Kerpen / Erft Telefon: +49 (0) 22 37 / 56 16 0 Telefax: +49 (0) 22 37 / 56 16 70 E-Mail:
Ulmer Netzwerk Verantwortung im Mittelstand (ISO 26000)
 Ulmer Netzwerk im Mittelstand (ISO 26000) -Kick-off Veranstaltung, 07.05.2012 - Übersicht über die Kick-off Veranstaltung Begrüßung Vorstellungsrunde Vortrag Prof. Müller kurze Diskussion Vortrag Dr. Bauer
Ulmer Netzwerk im Mittelstand (ISO 26000) -Kick-off Veranstaltung, 07.05.2012 - Übersicht über die Kick-off Veranstaltung Begrüßung Vorstellungsrunde Vortrag Prof. Müller kurze Diskussion Vortrag Dr. Bauer
Möglichkeiten der Qualitätsentwicklung in der Hochschulverwaltung
 Möglichkeiten der Qualitätsentwicklung in der Hochschulverwaltung Simone Gruber und Anette Köster 01.06.2006 Themenübersicht 1. Begriffsklärung: Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung
Möglichkeiten der Qualitätsentwicklung in der Hochschulverwaltung Simone Gruber und Anette Köster 01.06.2006 Themenübersicht 1. Begriffsklärung: Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung
Leitfaden für das Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergespräch Spitex Burgdorf-Oberburg
 Leitfaden für das Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergespräch Spitex Burgdorf-Oberburg Das Jahresgespräch ist ein ergebnisorientierter Dialog. Einleitung Das Mitarbeiterinnengespräch ist ein zentraler Baustein
Leitfaden für das Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergespräch Spitex Burgdorf-Oberburg Das Jahresgespräch ist ein ergebnisorientierter Dialog. Einleitung Das Mitarbeiterinnengespräch ist ein zentraler Baustein
IBEC Das Konzept zu Business Excellence. Erfolg hat viele Facetten... ... und ist die Summe richtiger Entscheidungen C L A S S.
 Das Konzept zu Business Excellence Erfolg hat viele Facetten... I Q N e t B U S I N E S S C L A S S E X C E L L E N C E... und ist die Summe richtiger Entscheidungen Kurzfristig gute oder langfristiges
Das Konzept zu Business Excellence Erfolg hat viele Facetten... I Q N e t B U S I N E S S C L A S S E X C E L L E N C E... und ist die Summe richtiger Entscheidungen Kurzfristig gute oder langfristiges
Qualitätsmanagement - Umweltmanagement - Arbeitssicherheit - TQM
 Qualitätsmanagement - Umweltmanagement - Arbeitssicherheit - TQM Besteht bei Ihnen ein Bewusstsein für Die hohe Bedeutung der Prozessbeherrschung? Die laufende Verbesserung Ihrer Kernprozesse? Die Kompatibilität
Qualitätsmanagement - Umweltmanagement - Arbeitssicherheit - TQM Besteht bei Ihnen ein Bewusstsein für Die hohe Bedeutung der Prozessbeherrschung? Die laufende Verbesserung Ihrer Kernprozesse? Die Kompatibilität
Qualitätsmanagement in Fitness- und Gesundheitsstudios. Leseprobe
 Qualitätsmanagement in Fitness- und Gesundheitsstudios Kapitel 3 Qualitätsmanagement ist eine Führungsaufgabe 3.1 Grundsatz Führung 3.1.1 Unternehmensvision und Leitbild 3.1.2 Qualitätspolitik und -ziele
Qualitätsmanagement in Fitness- und Gesundheitsstudios Kapitel 3 Qualitätsmanagement ist eine Führungsaufgabe 3.1 Grundsatz Führung 3.1.1 Unternehmensvision und Leitbild 3.1.2 Qualitätspolitik und -ziele
Software-Verifikation
 Hochschule Wismar Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Semesterarbeit (Arbeitsplan und Grobkonzeption) Software-Verifikation Fernstudiengang Master Wirtschaftsinformatik Modul: Formale Methoden Semester:
Hochschule Wismar Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Semesterarbeit (Arbeitsplan und Grobkonzeption) Software-Verifikation Fernstudiengang Master Wirtschaftsinformatik Modul: Formale Methoden Semester:
Inhaltsverzeichnis. Literatur Schlagwortverzeichnis
 Inhaltsverzeichnis 1 Wesen von Geschäftsprozessen?... 1 1.1 Aufbauorganisation: Ordnung des Systems... 2 1.2 Ablauforganisation: Organisationsverbindende Prozesse... 4 1.3 Organisation ist Kommunikation...
Inhaltsverzeichnis 1 Wesen von Geschäftsprozessen?... 1 1.1 Aufbauorganisation: Ordnung des Systems... 2 1.2 Ablauforganisation: Organisationsverbindende Prozesse... 4 1.3 Organisation ist Kommunikation...
Arbeitsschutz als ein Teil von integrierten Managementsystemen
 initiative umwelt unternehmen c/o RKW Bremen GmbH Arbeitsschutz als ein Teil von integrierten Managementsystemen Martin Schulze Sie möchten sich selbstständig machen? Wir helfen Ihnen dabei mit kompetenter
initiative umwelt unternehmen c/o RKW Bremen GmbH Arbeitsschutz als ein Teil von integrierten Managementsystemen Martin Schulze Sie möchten sich selbstständig machen? Wir helfen Ihnen dabei mit kompetenter
Vision & Mission Führungsgrundsätze
 Vision & Mission Führungsgrundsätze 08/2015 pandomo www.ardex.com Vision & Mission Die Vision der ARDEX-Gruppe ist es, einer der weltweit führenden Anbieter von qualitativ hochwertigen Spezialbaustoffen
Vision & Mission Führungsgrundsätze 08/2015 pandomo www.ardex.com Vision & Mission Die Vision der ARDEX-Gruppe ist es, einer der weltweit führenden Anbieter von qualitativ hochwertigen Spezialbaustoffen
Universität [C% München
 der Bundeswehr Universität [C% München Unternehmensinterne Ideenwettbewerbe als Instrument des Ideenmanagements - Gestaltung und Potential der Nutzung für organisatorischen Wandel Daniel Klein V Abbildungsverzeichnis
der Bundeswehr Universität [C% München Unternehmensinterne Ideenwettbewerbe als Instrument des Ideenmanagements - Gestaltung und Potential der Nutzung für organisatorischen Wandel Daniel Klein V Abbildungsverzeichnis
GEFMA FM-Excellence: Lösungen für Betreiberverantwortung im Facility Management
 GEFMA FM-Excellence: Lösungen für Betreiberverantwortung im Facility Management Transparenz, Sicherheit und Qualität im Facility Management: Das dreistufige Qualitätsprogramm GEFMA FM-Excellence Gütesiegel
GEFMA FM-Excellence: Lösungen für Betreiberverantwortung im Facility Management Transparenz, Sicherheit und Qualität im Facility Management: Das dreistufige Qualitätsprogramm GEFMA FM-Excellence Gütesiegel
Collaboration. Prof. Dr. Wolfgang Riggert FH Flensburg
 Collaboration Prof. Dr. Wolfgang Riggert FH Flensburg CSCW - Definition CSCW (dt.: computerunterstützte Gruppenarbeit) "... bezeichnet Arbeitsszenarien, die mit Hilfe von Informationssystemen Gruppenarbeit
Collaboration Prof. Dr. Wolfgang Riggert FH Flensburg CSCW - Definition CSCW (dt.: computerunterstützte Gruppenarbeit) "... bezeichnet Arbeitsszenarien, die mit Hilfe von Informationssystemen Gruppenarbeit
Risikomanagement - Prozessmodelle im Kontext von Verträgen Nutzen und Standards
 - Prozessmodelle im Kontext von Verträgen Nutzen und Standards CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH Gauermanngasse, 00 Wien 5. September 05 Referentin: Claudia Gerlach Willkommen Seit 03/04 selbstständige
- Prozessmodelle im Kontext von Verträgen Nutzen und Standards CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH Gauermanngasse, 00 Wien 5. September 05 Referentin: Claudia Gerlach Willkommen Seit 03/04 selbstständige
DGQ Regionalkreis Hannover
 Stefan Heinloth DGQ Regionalkreis Hannover Lebendiges Management mit System. Teil 1: Management mit System Top Management Themen Geld verdienen. Finanzen / Gewinn Bedürfnisse des Marktes erfüllen. Kunden
Stefan Heinloth DGQ Regionalkreis Hannover Lebendiges Management mit System. Teil 1: Management mit System Top Management Themen Geld verdienen. Finanzen / Gewinn Bedürfnisse des Marktes erfüllen. Kunden
Integrierte Managementsysteme Eichenstraße 7b 82110 Germering ims@prozess-effizienz.de. 1. Qualitätsmanagement
 1. Qualitätsmanagement Die Begeisterung Ihrer Kunden, die Kooperation mit Ihren Partnern sowie der Erfolg Ihres Unternehmens sind durch ein stetig steigendes Qualitätsniveau Ihrer Produkte, Dienstleistungen
1. Qualitätsmanagement Die Begeisterung Ihrer Kunden, die Kooperation mit Ihren Partnern sowie der Erfolg Ihres Unternehmens sind durch ein stetig steigendes Qualitätsniveau Ihrer Produkte, Dienstleistungen
Lissabonner Erklärung zur Gesundheit am Arbeitsplatz in kleinen und mittleren Unternehmen KMU (2001)
 Lissabonner Erklärung zur Gesundheit am Arbeitsplatz in kleinen und mittleren Unternehmen KMU (2001) Diese Erklärung wurde vom ENBGF auf dem Netzwerktreffen am 16. Juni 2001 verabschiedet und auf der anschließenden
Lissabonner Erklärung zur Gesundheit am Arbeitsplatz in kleinen und mittleren Unternehmen KMU (2001) Diese Erklärung wurde vom ENBGF auf dem Netzwerktreffen am 16. Juni 2001 verabschiedet und auf der anschließenden
Lernfeld 11: Geschäftsprozesse darstellen und optimieren
 besitzen die Kompetenz, die Arbeits- und Geschäftsprozesse des Betriebes darzustellen, zu optimieren Sie stellen den organisatorischen Aufbau des Betriebes mit seinen Aufgaben und Zuständigkeiten und dessen
besitzen die Kompetenz, die Arbeits- und Geschäftsprozesse des Betriebes darzustellen, zu optimieren Sie stellen den organisatorischen Aufbau des Betriebes mit seinen Aufgaben und Zuständigkeiten und dessen
DE 098/2008. IT- Sicherheitsleitlinie
 DE 098/2008 IT- Sicherheitsleitlinie Chemnitz, 12. November 2008 Inhalt 1 Zweck der IT-Sicherheitsrichtlinie...2 2 Verantwortung für IT- Sicherheit...2 3 Sicherheitsziele und Sicherheitsniveau...3 4 IT-Sicherheitsmanagement...3
DE 098/2008 IT- Sicherheitsleitlinie Chemnitz, 12. November 2008 Inhalt 1 Zweck der IT-Sicherheitsrichtlinie...2 2 Verantwortung für IT- Sicherheit...2 3 Sicherheitsziele und Sicherheitsniveau...3 4 IT-Sicherheitsmanagement...3
Analyse des Betriebszustandes der ZKS-Abfall. Empfehlungen für den zukünftigen Betrieb
 Analyse des Betriebszustandes der ZKS-Abfall Empfehlungen für den zukünftigen Betrieb Stand: 21. März 2011 Neutrale Prüfung der ZKS-Abfall Nachdem die ZKS-Abfall ab 1. April 2010, dem Inkrafttreten der
Analyse des Betriebszustandes der ZKS-Abfall Empfehlungen für den zukünftigen Betrieb Stand: 21. März 2011 Neutrale Prüfung der ZKS-Abfall Nachdem die ZKS-Abfall ab 1. April 2010, dem Inkrafttreten der
Lean Management. Unterschiede zu anderen Unternehmensführungskonzepten
 Wirtschaft Turhan Yazici Lean Management. Unterschiede zu anderen Unternehmensführungskonzepten Studienarbeit Hochschule für Wirtschaft Hausarbeit im Fach Sozialwissenschaften Thema : Lean Management
Wirtschaft Turhan Yazici Lean Management. Unterschiede zu anderen Unternehmensführungskonzepten Studienarbeit Hochschule für Wirtschaft Hausarbeit im Fach Sozialwissenschaften Thema : Lean Management
Alles richtig machen Prozessorientierung hilft Ziele zu erreichen und schafft Vertrauen
 Information zum Thema Prozess Der Erfolg eines Unternehmens die Durchsetzung seiner Produkte und Dienstleistungen auf dem Markt, effiziente interne Abläufe, eine gesunde wirtschaftliche Situation hängt
Information zum Thema Prozess Der Erfolg eines Unternehmens die Durchsetzung seiner Produkte und Dienstleistungen auf dem Markt, effiziente interne Abläufe, eine gesunde wirtschaftliche Situation hängt
Prozessmanagement. Fokus Finanzierungen Nutzen und Vorgehen. Kurzpräsentation, April 2012 Dominik Stäuble
 Prozessmanagement Fokus Finanzierungen Nutzen und Vorgehen Kurzpräsentation, April 2012 Dominik Stäuble dd li b addval Consulting GmbH ds@addval consulting.ch www.addval consulting.ch Prozessmanagement
Prozessmanagement Fokus Finanzierungen Nutzen und Vorgehen Kurzpräsentation, April 2012 Dominik Stäuble dd li b addval Consulting GmbH ds@addval consulting.ch www.addval consulting.ch Prozessmanagement
Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse
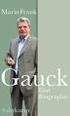 Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse These: Die organisatorische Vermittlung außenpolitischer Entscheidungen ist für die inhaltliche Ausgestaltung der Außenpolitik von Bedeutung
Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse These: Die organisatorische Vermittlung außenpolitischer Entscheidungen ist für die inhaltliche Ausgestaltung der Außenpolitik von Bedeutung
Workflowmanagement. Business Process Management
 Workflowmanagement Business Process Management Workflowmanagement Workflowmanagement Steigern Sie die Effizienz und Sicherheit Ihrer betrieblichen Abläufe Unternehmen mit gezielter Optimierung ihrer Geschäftsaktivitäten
Workflowmanagement Business Process Management Workflowmanagement Workflowmanagement Steigern Sie die Effizienz und Sicherheit Ihrer betrieblichen Abläufe Unternehmen mit gezielter Optimierung ihrer Geschäftsaktivitäten
Leitlinie für die Informationssicherheit
 Informationssicherheit Flughafen Köln/Bonn GmbH Leitlinie für die Informationssicherheit ISMS Dokumentation Dokumentenname Kurzzeichen Leitlinie für die Informationssicherheit ISMS-1-1-D Revision 2.0 Autor
Informationssicherheit Flughafen Köln/Bonn GmbH Leitlinie für die Informationssicherheit ISMS Dokumentation Dokumentenname Kurzzeichen Leitlinie für die Informationssicherheit ISMS-1-1-D Revision 2.0 Autor
Zielsetzung. Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Ziele können unterschieden werden nach:
![Zielsetzung. Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Ziele können unterschieden werden nach: Zielsetzung. Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Ziele können unterschieden werden nach:](/thumbs/50/26220103.jpg) Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Zielsetzung Jedes Unternehmen setzt sich Ziele Egal ob ein Unternehmen neu gegründet oder eine bestehende Organisation verändert werden soll, immer wieder
Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Zielsetzung Jedes Unternehmen setzt sich Ziele Egal ob ein Unternehmen neu gegründet oder eine bestehende Organisation verändert werden soll, immer wieder
ISO 9001:2015 Designen und Umsetzen
 Herzlich Willkommen zur Veranstaltung DGQ Regionalkreis Darmstadt ISO 9001:2015 Designen und Umsetzen Darmstadt, den 19.01.2016 Christian Ziebe Christian Ziebe ich freue mich auf Sie Beratung Audit & Assessment
Herzlich Willkommen zur Veranstaltung DGQ Regionalkreis Darmstadt ISO 9001:2015 Designen und Umsetzen Darmstadt, den 19.01.2016 Christian Ziebe Christian Ziebe ich freue mich auf Sie Beratung Audit & Assessment
Risiko-Management bei Klein- und Mittelunternehmen (KMU) Leistungsangebot der Assekuranz im Netzwerk
 Risiko-Management bei Klein- und Mittelunternehmen (KMU) Leistungsangebot der Assekuranz im Netzwerk DISSERTATION der Universität St. Gallen, Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften
Risiko-Management bei Klein- und Mittelunternehmen (KMU) Leistungsangebot der Assekuranz im Netzwerk DISSERTATION der Universität St. Gallen, Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften
Qualitätsstandards im Fachreferat? Wie lässt sich Fachreferatsarbeit in ein Qualitätsmanagement integrieren? Dr. Bruno Klotz-Berendes
 Qualitätsstandards im Fachreferat? Wie lässt sich Fachreferatsarbeit in ein Qualitätsmanagement integrieren? Dr. Bruno Klotz-Berendes Gliederung des Vortrags Qualitätsmanagement Basis - Prozessbeschreibung
Qualitätsstandards im Fachreferat? Wie lässt sich Fachreferatsarbeit in ein Qualitätsmanagement integrieren? Dr. Bruno Klotz-Berendes Gliederung des Vortrags Qualitätsmanagement Basis - Prozessbeschreibung
I SO ISO DQS DQS
 Forderungen der ISO 14001 Gründe für die Implementierung eines Umweltmanagementsystems t t Kosteneinsparung durch systematisches und vorsorgendes Denken und Handeln 12% Mitarbeitermotivation 11% Verbesserung
Forderungen der ISO 14001 Gründe für die Implementierung eines Umweltmanagementsystems t t Kosteneinsparung durch systematisches und vorsorgendes Denken und Handeln 12% Mitarbeitermotivation 11% Verbesserung
Prozessmanagement. Erfahrung mit der ISO 9001:2000. Vortrag von Dr. Jan Schiemann Juni 2005
 Prozessmanagement Erfahrung mit der ISO 9001:2000 Vortrag von Dr. Jan Schiemann Juni 2005 Zweck des Referats Folgende Fragen werden versucht zu beantworten : - inwieweit haben die neuen QM- Regelwerke
Prozessmanagement Erfahrung mit der ISO 9001:2000 Vortrag von Dr. Jan Schiemann Juni 2005 Zweck des Referats Folgende Fragen werden versucht zu beantworten : - inwieweit haben die neuen QM- Regelwerke
Leitfaden zur Erstellung der Masterarbeit in der Erziehungswissenschaft Schwerpunkt Sozialpädagogik
 Stand: SoSe 204 Institut für Erziehungswissenschaft Arbeitsbereich Sozialpädagogik Georgskommende 33 4843 Münster Leitfaden zur Erstellung der Masterarbeit in der Erziehungswissenschaft Schwerpunkt Sozialpädagogik
Stand: SoSe 204 Institut für Erziehungswissenschaft Arbeitsbereich Sozialpädagogik Georgskommende 33 4843 Münster Leitfaden zur Erstellung der Masterarbeit in der Erziehungswissenschaft Schwerpunkt Sozialpädagogik
I.O. BUSINESS. Checkliste Teamentwicklung
 I.O. BUSINESS Checkliste Teamentwicklung Gemeinsam Handeln I.O. BUSINESS Checkliste Teamentwicklung Der Begriff Team wird unterschiedlich gebraucht. Wir verstehen unter Team eine Gruppe von Mitarbeiterinnen
I.O. BUSINESS Checkliste Teamentwicklung Gemeinsam Handeln I.O. BUSINESS Checkliste Teamentwicklung Der Begriff Team wird unterschiedlich gebraucht. Wir verstehen unter Team eine Gruppe von Mitarbeiterinnen
Qualitätsmanagement European Quality Management Licence. Guten Morgen!
 Qualitätsmanagement European Quality Management Licence Guten Morgen! 1 Die 18 Module des EQML: 1 bis 9 Modul 1: Grundbegriffe und Grundsätze Modul 2: QMS aufbauen und betreiben Modul 3: Philosophie und
Qualitätsmanagement European Quality Management Licence Guten Morgen! 1 Die 18 Module des EQML: 1 bis 9 Modul 1: Grundbegriffe und Grundsätze Modul 2: QMS aufbauen und betreiben Modul 3: Philosophie und
Dipl. Inf. Ali M. Akbarian
 Dipl. Inf. Ali M. Akbarian 2012 Einführung Globalisierung, Innovation und Kundenzufriedenheit sind auch in Zukunft die wichtigsten Herausforderungen der Unternehmen. Diese Herausforderungen verlangen:
Dipl. Inf. Ali M. Akbarian 2012 Einführung Globalisierung, Innovation und Kundenzufriedenheit sind auch in Zukunft die wichtigsten Herausforderungen der Unternehmen. Diese Herausforderungen verlangen:
Qualitätssicherung in der Produktion
 Qualitätssicherung in der Produktion Dr.-Ing. Detlef Brumbi Mai 2003 1. Einleitung Wenn man ein Produkt oder eine Dienstleistung erwirbt, möchte man damit auch ein qualitativ hochwertiges Gut erwerben.
Qualitätssicherung in der Produktion Dr.-Ing. Detlef Brumbi Mai 2003 1. Einleitung Wenn man ein Produkt oder eine Dienstleistung erwirbt, möchte man damit auch ein qualitativ hochwertiges Gut erwerben.
Qualitätssicherung im Projektgeschäft
 Qualitätssicherung im Projektgeschäft Edmund Dehnel Am Ottersberg 27 D-88287 Grünkraut Tel.: +49 (0)751-3550408 E-Mail: 1 Inhaltsverzeichnis: 1. Was ist Projektmanagement? 2. Was ist Qualität im Projektmanagement?
Qualitätssicherung im Projektgeschäft Edmund Dehnel Am Ottersberg 27 D-88287 Grünkraut Tel.: +49 (0)751-3550408 E-Mail: 1 Inhaltsverzeichnis: 1. Was ist Projektmanagement? 2. Was ist Qualität im Projektmanagement?
Neue Herausforderungen durch die vierte industrielle Revolution
 Smart Services Management von Veränderungen Die Unternehmen leben heute in einer dynamischen und komplexen Welt. Das Leistungsangebot an Produkten und Produktvarianten wird immer komplexer und die Dynamik
Smart Services Management von Veränderungen Die Unternehmen leben heute in einer dynamischen und komplexen Welt. Das Leistungsangebot an Produkten und Produktvarianten wird immer komplexer und die Dynamik
Integration von SBVR in Workflows der Windows Workflow Foundation und Veröffentlichung unter Microsoft SharePoint
 Technik Christoph Zoller Integration von SBVR in Workflows der Windows Workflow Foundation und Veröffentlichung unter Microsoft SharePoint Diplomarbeit FH JOANNEUM - University of Applied Sciences Integration
Technik Christoph Zoller Integration von SBVR in Workflows der Windows Workflow Foundation und Veröffentlichung unter Microsoft SharePoint Diplomarbeit FH JOANNEUM - University of Applied Sciences Integration
Struktur der Querschnittsfunktionen und Effektivität: Prozessverbesserung
 Struktur der Querschnittsfunktionen und Effektivität: Prozessverbesserung Unternehmen haben neben der funktionalen Aufbauorganisation auch bereichsübergreifende Aufgaben. Die Zielsetzung einer Querschnittsfunktion
Struktur der Querschnittsfunktionen und Effektivität: Prozessverbesserung Unternehmen haben neben der funktionalen Aufbauorganisation auch bereichsübergreifende Aufgaben. Die Zielsetzung einer Querschnittsfunktion
Process Consulting. Beratung und Training. Branchenfokus Energie und Versorgung. www.mettenmeier.de/bpm
 Process Consulting Process Consulting Beratung und Training Branchenfokus Energie und Versorgung www.mettenmeier.de/bpm Veränderungsfähig durch Business Process Management (BPM) Process Consulting Im Zeitalter
Process Consulting Process Consulting Beratung und Training Branchenfokus Energie und Versorgung www.mettenmeier.de/bpm Veränderungsfähig durch Business Process Management (BPM) Process Consulting Im Zeitalter
Aufbau, Entwicklung & Optimierung eines integrierten Managementsystems unter Berücksichtigung der DIN EN ISO 9001:2015 Revision
 Eric Hohmuth Aus der Reihe: e-fellows.net stipendiaten-wissen e-fellows.net (Hrsg.) Band 1567 Aufbau, Entwicklung & Optimierung eines integrierten Managementsystems unter Berücksichtigung der DIN EN ISO
Eric Hohmuth Aus der Reihe: e-fellows.net stipendiaten-wissen e-fellows.net (Hrsg.) Band 1567 Aufbau, Entwicklung & Optimierung eines integrierten Managementsystems unter Berücksichtigung der DIN EN ISO
INHALTSÜBERSICHT. Geleitwort des Herausgebers
 INHALTSÜBERSICHT Geleitwort des Herausgebers V Danksagung VII Inhaltsübersicht IX XI Abbildungsverzeichnis XV Tabellenverzeichnis XIX Abkürzungsverzeichnis XXI 1 Einleitung 1 1.1 Problemstellung 3 1.2
INHALTSÜBERSICHT Geleitwort des Herausgebers V Danksagung VII Inhaltsübersicht IX XI Abbildungsverzeichnis XV Tabellenverzeichnis XIX Abkürzungsverzeichnis XXI 1 Einleitung 1 1.1 Problemstellung 3 1.2
