USER COM. Wahl der Heizrate TA-TIP. Dezember Sehr geehrter Kunde Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte
|
|
|
- Reiner Rosenberg
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 USER COM Informationen für Anwender von METTLER TOLEDO Thermoanalysen-Systeme Sehr geehrter Kunde Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen in diesem Jahr. Wir freuen uns über den regen Kontakt mit Ihnen, welcher immer wieder zu neuen Verbesserungen unserer Produkte führt. Auch dieses Mal können wir Ihnen neben interessanten Applikationsbeispielen wieder neue Produkte vorstellen. Wir möchten Sie aber auch ermuntern, das User Com als eine Plattform zu verwenden, um Erfahrungen mit anderen Thermoanalysen- Interessierten auszutauschen. Um in Zukunft noch besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können, bitten wir Sie, uns Ihre Meinung zum User Com mitzuteilen. Wahl der Heizrate Dezember TA-TIP Mit der Wahl der Heizrate können Sie sich die Interpretation der Messung erleichern oder erschweren. 1. Temperaturdifferenz zwischen Probe und Temperatursensor Bedingt dadurch, dass der Temperatursensor nicht direkt in der Probe, sondern nur in der Nähe der Probe die Temperatur misst, tritt bei jeder Thermoanalysenmesszelle eine Temperaturdifferenz zwischen Probe und Temperatursensor auf. Diese ist abhängig von der Heizrate und der Temperatur. Kann dies nicht kalibieriert werden, so müssen bei abweichender Heizrate von der Kalibrierung die Temperaturresultate von Hand korrigiert werden. Bei Mettler können Sie diese Heizratenabhängigkeit kalibrieren (Taulag- Kalibrierung). Die Onsetwerte werden dadurch, wie es der Physik entspricht, auch bei verschiedenen Heizraten praktisch identisch (Abb. 1: Indium Schmelzpeaks). Indium with different heating rates :30:53 Inhaltsverzeichnis TA-TiP: Wahl der Heizrate NEU im Verkaufsprogramm: Neues DSC821 e Modul Neue Kühloption (Intra Cooler) Automatisches Tiegelöffnen vor der Messung Applikationen TGA 850 Spezifische Wärme aus der SDTA -Kurve? Aushärteverhalten von Klebstoffen METTLER TOLEDO TA 8000 Abb. 1 Indium Schmelzpeaks bei verschiedenen Heizraten USER COM Dezember 95 1
2 Sie sparen sich dadurch die manuelle und fehlerbehaftete Resultatkorrektur. Wenn Sie Ihr Modul über einen weiten Temperaturbereich einsetzen wollen, dann empfehlen wir lhnen, die Taulag-Kalibrierung mit mehreren verschiedenen Substanzen zu machen, sodass das System auch noch die Temperaturabhängigkeit dieser Korrekturfunktion berücksichtigen kann. Die Onsettemperatur ist bei unterschiedlichen Heizraten bei chemischen Reaktionen natürlich nicht konstant (die Differenzen der Onsettemperaturen würden bei falscher oder nicht vorhandener Taulag-Kalibrierung allerdings noch grösser). 2. Erhöhung der Empfindlichkeit mit zunehmender Heizrate Wie Sie sicher schon festgestellt haben, werden zum Beispiel Schmelzpeaks mit zunehmender Heizrate grösser. Sie können also auf ganz einfache Art und Weise kleine Effekte verstärken, indem Sie eine grössere Heizrate wählen (Abb 2: Glasumwandlung). 3. Verbesserung der Auflösung mit abnehmender Heizrate Für eine gute Peaktrennung ist eine kleine Heizrate und eine kleine Signalzeitkonstante erforderlich. Mit dem Keramiksensor haben Sie einen schnell reagierenden Sensor (Signalzeitkonstante ca. 3 s mit dem Aluminium Standardtiegel) zur Verfügung. Um Effekte sauber zu trennen, sollte die Zeit dazwischen ca. 5 Zeitkonstanten betragen. Die Auslenkung fällt damit auf 1% der ursprünglichen Basislinie zurück. Liegen Ihre Effekt beispielsweise ca. 5 C auseinander, dann können Sie bei einer Signalzeitkonstanten von 3 s die maximale Heizrate wie folgt berechnen: 5 C / (5 * 3 s)* 60 s/min = 20 C/min (Abb. 3: Peaktrennung) 4. Blindkurvenkorrektur Auch die Blindkurvenform hängt von der Heizrate ab. Bei der TSW870 sucht Ihnen die Datenbank automatisch die aktuellste, mit identischer Heizrate gefahrenen Blindkurve und macht während der Messung eine Onlinekorrektur. Abb. 2: Glasumwandlung Haben Sie aber eine Substanz, welche zwei Effekte hat, die nahe beieinander liegen, so verfliessen diese Peaks bei grosser Heizrate zu einem Peak. Smektische Umwandlungen eines ferroelektrischen Flüssigkristalls mit 2, bzw. 5 K/min gemessen. Die ersten 3 Phasen haben einen schmalen Stabilitätsbereich von nur ca. 1 C. Die Umwandlungen sind nicht ganz scharf, weshalb die Basislinie auch bei 2 C/min nicht ganz erreicht wird. Die untere Kurve mit 5 C/min ist deutlich schlechter aufgelöst. Denken Sie daran, dass die Peakflächen von DDK-Kurven, welche gegen die Temperatur dargestellt sind, nicht der Wärmetönung entsprechen (die Enthalpieänderung ist das zeitliche Integral der DDK-Kurve). Abb. 3: Peaktrennung eines Flüssigkristalles 2 USER COM Dezember 95
3 Das neue DDK-Modul DSC821 e Im Januar wird das DSC821 e als Nachfolger des DSC820-Modules eingeführt, welches auf dem neusten Stand der Technik basiert. Das Modul ist in zwei Temperaturversionen erhältlich. Das modulare Konzept der DSC820 wurde noch erweitert, sodass wir noch besser auf Ihre spezifischen Wünsche eingehen können. Mit den bisherigen und neuen Optionen sind unzählige Systemkombinationen möglich. Wir sind überzeugt, Ihnen damit genau die richtige Lösung anbieten zu können. Sie bezahlen nur das, was Sie wirklich brauchen. Die Zukunft steht Ihnen aber dennoch offen. Sie können Ihr Gerät jederzeit mit weiteren Optionen ausbauen und Ihren Bedürfnissen anpassen. Intra Cooler Als neue Kühloption steht lhnen für das DSC820/821 e ein lntra Cooler (von Lab Plant oder Haake) zur Verfügung. Sie können lhr bisheriges System neben der Luftkühlung, der Kryostat- oder Wasserkühlung und der Flüssigstickstoffkühlung nun auch mit dem Intra Cooler aufrüsten. Der Kühlfinger wird direkt mit dem Kühlmedium gekühlt, der Zwischenkreislauf wie beim Kryostaten entfällt. Sie können somit sehr kostengünstig und sehr schnell Tieftemperaturmessungen bis in den Bereich von -65 C machen. Die Kühlzeiten können Sie aus Abbildung 4 entnehmen. Die Eigenschaften des DSC821 e Modules auf einen Blick: Grosser Messbereich ± 350 mw bei RT Hohe Auflösung 0,7 µw bei RT Weiter Temperaturbereich 150 C max. 500/700 C Hohe Temperaturgenauigkeit ± 0,2 C Ausgezeichnete Peaktrennung kleine Signalzeitkonstante (3s) Modularer Aufbau offen für die Zukunft Automatisierbar mit Probenwechsler 34 Proben Weitere Optionen Automatischer Ofendeckel Gaskontroller Peripherieansteuerung SW-geschalteter Netzausgang Lokale Modulbedienung Leistungsverstärker 400 W (für die Temperaturerweiterung bis 700 C) Kühlsysteme Flüssigstickstoff ( 150 C), Intra Cooler ( 65 C), Kryostat ( 50 C) Abb. 4: Abkühlkurve mit Intra Cooler METTLER TOLEDO TA 8000 USER COM Dezember 95 3
4 Automatisches Tiegelöffnen vor der Messung Neu können beim DSC820/821 e und beim TGA850 die Probenwechsler mit einem Zusatz ausgerüstet werden, der die Tiegel kurz vor der Messung automatisch öffnet. Ein am Greifer befestigter Mechanismus sticht den Tiegel auf dem Probenteller auf. Während der Wartezeit auf dem Probenteller tauscht die Probe somit keine Feuchtigkeit mit der Umgebung aus. Gerade bei leicht flüchtigen Anteilen der Probe in der Pharma-, der Lack- und der Lebensmittelindustrie ist dies von grossem Vorteil. TGA850 Spezifische Wärme aus der SDTA-Kurve? Im Moment gibt es zwei Tiegelarten, die sich für diese Art der Messung eignen: Der bisherige Aluminium-Standardtiegel 40 µl (DSC) und der neue Aluminium 100 µl (DSC und TGA). Es gibt zusätzlich folgende vier neue Tiegelsets: Tiegelset Al 40 µl ohne Deckel (400 Stk.) Tiegelset Al 100 µl ohne Deckel (400 Stk.) Tiegeldeckel Al (400 Stk.) Membrandeckel Al (400 Stk.) Für bisherige Kunden eines DSC820- oder TGA850-Modules gibt es Aufrüstmöglichkeiten: Umbaukit für den (DSC) Probenwechsler Kalibrationstiegel Nadeln (3 Typen) Tiegelabstreifer Antriebsachse* Modul Software ( V3.10)* Umbaukit für den (TGA) Probenwechsler Gaugeblock Kalibrationstiegel Nadeln (3 Typen) Tiegelabstreifer Antriebsachse* Greifer Typ 1 (7,8 mm)* Tiegelträger * (Waagschale + Auslenker ) Module Software* ( V3.02) * muss je nach Version separat bestellt werden. G.Widmann Einige Anwender haben uns angefragt, ob eine mindestens halbquantitative Messung der spezifischen Wärme aus dem SDTA-Signal möglich sei. Da die Temperaturfunktion der kalorischen Empfindlichkeit (noch) nicht bekannt ist, kommt nur die Saphirmethode in Frage. Sie beruht ja darauf, dass eine blindkurvenverrechnete Saphirmessung aufgrund der bekannten cp-temperaturfunktion von Saphir als Standardisierung dient. Durch Dreisatz berechnet die Software die Spezifische Wärme aus der blinkurvenverrechneten Probenmessung: cp = cpsap m Sap SDTA Probe / (mprobe SDTA Sap) Wie es geht, zeigt die Abbildung (Abb. 5). Im eingeblendeten Koordinatensystem sehen Sie die Saphir- und die Proben-SDTA-Kurven (beide blindkurvenverrechnet). Als Probe diente 4 Abb. 5 cp Messung mit TGA 850 -Quarz mit seiner Fest-Fest- Umwandlung bei ca. 570 C. Im grossen Koordinatensystem ist die daraus berechnete cp-kurve von Quarz dargestellt. Enthalpieänderungen: Wie Sie wissen, werden Enthalpieänderungen bei DDK-Kurven durch Integration des Wärmestromes nach der Zeit berechnet. Analog können Wärmetönungen durch Integrieren der Spezifischen Wärme nach der Temperatur bestimmt werden. Die Version 3.01 unserer Sofware integriert allerdings immer nach der Zeit. Deshalb muss das Resultat, das mit der Einheit Js/gK anfällt, durch die Heizrate in K/s dividiert werden, um das Resultat in J/g zu kriegen (die nächste Softwareversion wird zusätzlich über eine Integration nach der Abszisse verfügen). Der Umweg über die cp-bestimmung mit der Saphirmethode erlaubt also mindestens halbquantitative kalorimetrische Messungen. Für solche Messungen sollten Sie den Pt-Tiegel, wenn möglich mit Deckel, verwenden. USER COM Dezember 95
5 Alternierende Dynamische Differenzkalorimetrie, ADDK eröffnet neue Möglichkeiten genannt (Spezifische Wärme synonym mit fühlbarer Wärme). Der andere Anteil heisst sinngemäss latenter Wärmestrom. Das ADDK-Messsignal eines jeden Segmentes ist nach der Einschwingzeit der Wärmekapazität der Probe proportional. Die Software verbindet die Punkte der Messkurve am Ende jedes Heizsegmentes zur unteren Hüllkurve und diejenigen am Ende der Kühlsegmente zur oberen Hüllkurve. Die halbe Differenz der beiden Hüllkurven entspricht dem fühlbaren Wärmestrom. Abb. 6: Ausschnitt aus einer ADDK-Messung. Oben ist das alternierende Temperaturprogramm dargestellt. Auf der zugehörigen ADDK-Kurve erscheinen die entsprechenden Anfahrauslenkungen. Ab ca. 20 min beginnt eine Wärmetönung beide Hüllkurven nach oben zu verschieben. Dr. B. Benzler, G. Widmann Üblicherweise wird bei der DDK der Wärmestrom der untersuchten Probe bei konstanter Heiz- oder Kühlgeschwindigkeit gemessen. Dabei haben hohe Heiz- und Kühlraten 10 K/min und höher den Vorteil hoher Messempfindlichkeit (grosse Peaks), verbunden allerdings mit niedriger Auflösung bezüglich der Temperaturachse. Bei niedrigen Raten dagegen liegen die Verhältnisse umgekehrt: fast unsichtbar kleine Peaks, welche dafür oft sehr gut getrennt sind. Die ADDK mit ihrem periodischen Temperaturprogramm kombiniert die Vorteile beider Messweisen: Hohe Empfindlichkeit dank hoher momentaner Heizrate Hohe Temperaturauflösung dank niedriger mittlerer Heizrate höher, als die Starttemperatur der vorangehenden Heizphase, was zur niedrigen mittleren Rate führt: Der gemessene Wärmestrom setzt sich aus Anteilen, die von der Wärmekapazität Cp herrühren und solchen aus physikalischen Umwandlungen bzw. chemischen Reaktionen zusammen. Der Cp-Anteil wird deshalb auch fühlbarer Wärmestrom Cp-Änderungen treten bei den folgenden Effekten auf: Glasumwandlung amorpher Stoffe Kaltkristallisation Chemische Reaktionen (die Edukte haben nicht die gleichewärmekapazität wie die entstehenden Produkte) Der zusätzliche latente Wärmestrom tritt bei Wärmetönungen sowohl in der Heiz- als auch in der Kühlphase auf. Der Mittelwert der beiden Hüllkurven entspricht deshalb dem latenten Wärmestrom. Das Temperaturprogramm der ADSC besteht aus einer periodischen Folge von kurzen linearen Heiz - und Kühlphasen. Die Heiz-, bzw. Kühlraten liegen dabei zwischen 2 und 5 K/min. Für eine Aufheizmessung liegt die Endtemperatur der Kühlphase um einen kleinen Betrag Abb. 7: ADDK-Kurve von 20,425 mg PET im Temperaturbereich von 40 bis 140 C. Jedes Heizsegment erhöht die Temperatur um 4 C mit einer momentanen Rate von 3 C/min. Das anschliessende Kühlsegment senkt sie mit der gleichen Rate um 3 C. Eine Periode dauert damit 2 min und 20 s. Die mittlere Heizrate wird 1 C/2,33 min = 0,43 C/min. Zusätzlich sind die beiden Hüllkurven dargestellt, welche zur Berechnung der Kurven in Abb. 8 benötigt werden. USER COM Dezember 95 5
6 Auf diese Weise werden gewisse latente Effekte von cp-änderungen getrennt: Enthalpierelaxationspeak während Glasumwandlung Kaltkristallisation beim Erwärmen unterkühlter Schmelzen Kristallisation von Schmelzen beim Abkühlen Chemische Reaktionen Verdunsten von flüchtigen Stoffen (Trocknen) Solche Effekte werden auch nichtreversierend genannt. Problematischer sind reversible Umwandlungen wie Schmelzen und Kristallisieren; die beim Erreichen des Schmelzpunktes gerade angeschmolzenen Kristalle würden im folgenden Kühlsegment sofort kristallisieren. Um dies zu verhindern, werden in solchen Fällen statt der Abkühlphasen isotherme Verweilzeiten programmiert. Die Auftrennung der ADDK-Aufheizkurve in den fühlbaren und latenten Wärmestrom zeigt die Abbildung 8 am Beispiel von Polyethylen-Terephthalat, PET. Die übliche DDK-Aufheizkurve würde die Glasumwandlung wegen der gleichzeitigen Relaxationspeaks verfälschen. Überdies wäre die cp-änderung der Kaltkristallisation kaum sichtbar (Abb. 9). Die aufgetrennten Kurven lassen sich mit der Software genau wie gemessene Kurven auswerten. Die Auftrennung kann auch durch die optionale Fourier-Analyse erfolgen. (Zusätzlich erscheint dabei die Phasenverschiebung als Kurve.) Zusammenfassung: Abb. 8: Auf der Kurve der Latenten Wärme (Mittelwert der Hüllkurven) erscheinen zwei endotherme Peaks (Enthalpierelaxation) während der Glasumwandlung bei 70 C sowie der exotherme Kristallisationspeak bei 110 C. Die Kurve der Fühlbaren Wärme (halbe Differenz der Hüllkurven) zeigt die entsprechenden Cp-Änderungen. Abb. 9: Vergleich der üblichen dynamischen DDK-Kurve mit konstanter Heizrate von 0,43 C/min mit den beiden aufgetrennten DDK-Kurven aus der ADDK-Messung. Addiert man die Kurve der latenten Wärme und die durch den Heizratenfaktor dividierte Kurve der fühlbaren Wärme kriegt man die klassische DDK-Kurve. Der Heizratenfaktor ist das Verhältnis der Momentanrate zur mittleren Rate, 3/0,43 = 7 Die ADDK-Messtechnik im Zusammenhang mit der TA-Software TSW870 bietet gegenüber der klassischen DDK folgende Vorteile: Hohe Auflösung der mit Wärmtönungen verbundenen Prozesse durch niedrige mittlere Heizrate. Die gemessenen Temperaturen liegen nahe bei den Gleichgewichtswerten. Grosse Empfindlichkeit des Messsignals durch relativ hohe momentane Heiz- und Kühlgeschwindigkeit. Getrennte Darstellung von fühlbarem und latentem Wärmestrom. Allerdings gibt es auch einige Nachteile: Zusätzliche Parameter bei der Methodenerstellung erhöhen die Qual der Wahl. Längere Messzeiten wegen den geringen mittleren Heizrate. Genormte Methoden verlangen konstante Heizraten 6 USER COM Dezember 95
7 Aushärteverhalten von Klebstoffen Dr. J. de Buhr Mit Einführung der neuen Softwareversion wurde im letzten User Com auch die neue Modellfreie Kinetik vorgestellt. Wie zahlreiche Messungen gezeigt haben, gestattet diese neue Modellfreie Kinetik in den allermeisten Fällen eine wesentlich genauere Vorhersage als die herkömmlichen Modellvorstellungen. Und zwar auch dann, wenn komplexe oder mehrstufige Reaktionen vorliegen. Lediglich drei oder mehr dynamische Messkurven (mittels DDK oder TGA aufgenommen) genügen, um das dynamische oder das isotherme Verhalten einer Reaktion zu analysieren. Dazu wird die Aktivierungsenergie E(α) als Funktion des Umsatzes α berechnet. Dieses E(α) ist bei einfachen Reaktionen mit der klassischen Aktivierungsenergie Ea vergleichbar, ermöglicht aber aus dessen Verlauf zusätzliche Aussagen zur Komplexizität einer Reaktion zu machen. Die Aushärtung eines 2-Komponenten-Harzes wurde bei Heizraten von 2, 5, 10 und 20 K/min. aufgezeichnet (Abb.10, 1. Dynamic curing measured). Automatisch wird die zugehörige Aktivierungsenergie E(α) berechnet (Abb. 10, 3. Activation Energy calculated). Zum Vergleich wurde das Kinetikmodell n-ter Ordnung angewandt, wobei sich für eine Heizrate von 5 K/min die folgenden Parameter ergaben: ln (ko) = 88, Ea = 267 kj/mol und n = 1,76. Mit diesen beiden kinetischen Datensätzen wurde die isotherme Aushärtung für 60 C simuliert und mit der tatsächlich gemessenen Kurve verglichen (Abb. 10, 4. Isothermal Conversion at 60 C). Dabei wird deutlich, dass die Modellfreie Kinetik das Verhalten um Faktoren besser beschreiben kann, als die Kinetik n- ter Ordnung. Abb. 10: Aushärtung eines 2-Komponenten-Harzes Die DDK-Analyse eines Spezialklebstoffes aus der Automobilbranche zeigt dessen schnell einsetzende Aushärtung, die sich in einem sehr steilen Reaktionspeak äussert (Abb. 11, 1. DSC-curves measured). Die Komplexizität dieser Reaktion deutet sich auch in der Analyse der Aktivierungsenergie E(α) an, die zu Reaktionsbeginn sehr hohe Werte annimmt (Abb. 11, 2. Activation Energy calculated). Auch bei dieser komplexen Reaktion gestattet die Modellfreie Kinetik die Simulation der dynamischen Aushärtung bei verschiedenen Heizraten, wie der Vergleich zwischen simulierter und gemessener Kurve zeigt (Abb. 11, 3. Simulated curves). Ebenso kann tabellarisch und/oder grafisch der Zusammenhang zwischen Umsatz, Zeit und Temperatur dargestellt werden (Abb. 11, 4. Iso-Conversion). Abb. 11: Aushärtung eines Spezialklebstoffes USER COM Dezember 95 7
8 Veranstaltungen/ Konferenzen: Pittsburgh Conference März 96 Chicago (USA) Forum Laboratoire April 96 Paris (F) Analytica (Halle 18/Stand B14) April 96 München (D) Instrurama Juni 96 Brüssel (B) ICTAC August 96 Philadelphia (USA) Het Instrument Oktober 96 Utrecht (NL) GEFTA/AFCAT/STK Sept. 96 Freiburg im Brsg. (D) Ilmac Nov. 96 Basel (CH) TA-Kundenkurse und -Seminare (CH): Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Mettler-Toledo AG, Analytical Tel Fax TA-Kundenkurs (Französisch) Mai 96 Greifensee (CH) TA-Kundenkurs (Deutsch) Mai 96 Greifensee (CH) TA-Kundenkurs (Englisch) Mai 96 Greifensee (CH) TA-Kundenkurs (Deutsch) Nov. 96 Greifensee (CH) TA-Kundenkurs (Englisch) Nov. 96 Greifensee (CH) Lab.-Talk-Vorankündigungen 96 (CH): Interessenten melden sich für weitere Informationen bitte an Mettler-Toledo (Schweiz) AG (Tel. 01/ , Fax. 01/ ) TA8000 Anwenderseminar April Greifensee (CH) TA8000 Anwenderseminar Mai Greifensee (CH) 2. Fachseminar Prüfmittelüberwachung in Q-Systemen Mai Basel (CH) TA-Informationstage und -Ausbildungskurse (USA): Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Gerätespezialisten oder R. Truttmann Tel METTLER ( ) oder Fax Bei Fragen zu weiteren Tagungen, den Produkten oder Applikationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale METTLER TOLEDO Vertretung. Internet: Redaktion Mettler-Toledo AG, Analytical Sonnenbergstrasse 74 CH-8603 Schwerzenbach, Switzerland Tel Fax joerimann@ana-ta.mtg.mt.com U. Jörimann, Dr. B. Benzler, Dr. J. de Buhr, Dr. R. Riesen, J. Widmann Layout und Produktion: MCG MarCom Greifensee ME
Kalibrierung TA TIP. USER COM Dezember 97 1
 Kalibrierung TA TIP 1.1 Allgemeine Betrachtungen Eine Kalibrierung zeigt Ihnen, ob Ihr Modul korrekte Messwerte liefert. Je nachdem, wie viele Sensoren Ihr Gerät hat, müssen Sie unterschiedliche Kalibrierungen
Kalibrierung TA TIP 1.1 Allgemeine Betrachtungen Eine Kalibrierung zeigt Ihnen, ob Ihr Modul korrekte Messwerte liefert. Je nachdem, wie viele Sensoren Ihr Gerät hat, müssen Sie unterschiedliche Kalibrierungen
Thermal Analysis Excellence
 Thermal Analysis Excellence DSC 2 STAR e System Innovative Technologie Unbegrenzte Modularität Schweizer Qualität Dynamische Differenzkalorimetrie für alle Anforderungen DSC Excellence Unvergleichliche
Thermal Analysis Excellence DSC 2 STAR e System Innovative Technologie Unbegrenzte Modularität Schweizer Qualität Dynamische Differenzkalorimetrie für alle Anforderungen DSC Excellence Unvergleichliche
Erweiterte Methoden der Thermischen Analyse. 11. Tagung des AK Polymeranalytik am in Darmstadt Dipl.-Chem. Ing.
 Erweiterte Methoden der Thermischen Analyse 11. Tagung des AK Polymeranalytik am 11.03.2016 in Darmstadt Dipl.-Chem. Ing. Peter Bamfaste Was ist Thermische Analyse? Definition Thermische Analyse: "a group
Erweiterte Methoden der Thermischen Analyse 11. Tagung des AK Polymeranalytik am 11.03.2016 in Darmstadt Dipl.-Chem. Ing. Peter Bamfaste Was ist Thermische Analyse? Definition Thermische Analyse: "a group
Thermal Analysis Premium DSC 3+ STAR e System Innovative Technologie Unbegrenzte Modularität Schweizer Qualität
 Thermal Analysis Premium DSC 3+ STAR e System Innovative Technologie Unbegrenzte Modularität Schweizer Qualität Dynamische Differenzkalorimetrie für höchste Anforderungen DSC Premium Unvergleichliche DSC-Leistung
Thermal Analysis Premium DSC 3+ STAR e System Innovative Technologie Unbegrenzte Modularität Schweizer Qualität Dynamische Differenzkalorimetrie für höchste Anforderungen DSC Premium Unvergleichliche DSC-Leistung
Fortgeschrittenen-Praktikum. Differential Scanning Calorimetry -DSC
 Fortgeschrittenen-Praktikum Institut für Physik, Universität Rostock, AG Polymerphysik, Dr. Andreas Wurm Differential Scanning Calorimetry -DSC März 2013 1. Grundlagen 1.1. Funktionsweise und Aufbau eines
Fortgeschrittenen-Praktikum Institut für Physik, Universität Rostock, AG Polymerphysik, Dr. Andreas Wurm Differential Scanning Calorimetry -DSC März 2013 1. Grundlagen 1.1. Funktionsweise und Aufbau eines
Thermal Analysis Excellence
 Thermal Analysis Excellence DSC 1 STAR e System Innovative Technologie Unbegrenzte Modularität Schweizer Qualität Dynamische Differenzkalorimetrie für alle Anforderungen DSC Excellence Unvergleichliche
Thermal Analysis Excellence DSC 1 STAR e System Innovative Technologie Unbegrenzte Modularität Schweizer Qualität Dynamische Differenzkalorimetrie für alle Anforderungen DSC Excellence Unvergleichliche
Applikationen. Auswertung und Interpretation von Peaktemperaturen bei DSC-Kurven: Beispiele. Schmelzen von reinen Materialien.
 Auswertung und Interpretation von Peaktemperaturen bei DSC-Kurven: Beispiele Applikationen Abbildung 1: Illers-Diagramm von Indium, gemessen mit unterschiedlichen Tiegeln. T m,p ist die Peaktemperatur,
Auswertung und Interpretation von Peaktemperaturen bei DSC-Kurven: Beispiele Applikationen Abbildung 1: Illers-Diagramm von Indium, gemessen mit unterschiedlichen Tiegeln. T m,p ist die Peaktemperatur,
Thermische Analyse. Was ist Thermische Analyse?
 Thermische Analyse Was ist Thermische Analyse? Thermische Analyse (TA) bezeichnet eine Gruppe von Methoden, bei denen physikalische und chemische Eigenschaften einer Substanz bzw. eines Substanzund/oder
Thermische Analyse Was ist Thermische Analyse? Thermische Analyse (TA) bezeichnet eine Gruppe von Methoden, bei denen physikalische und chemische Eigenschaften einer Substanz bzw. eines Substanzund/oder
Praktikum Innovative Werkstoffkunde
 Labor für Werkstoffe Prof. Dr.-Ing. Karin Lutterbeck Polymere Werkstoffe und Keramik Prof. Dr.-Ing. Helmut Winkel Metallische Werkstoffe Praktikum Innovative Werkstoffkunde Verhalten von Kunststoffen beim
Labor für Werkstoffe Prof. Dr.-Ing. Karin Lutterbeck Polymere Werkstoffe und Keramik Prof. Dr.-Ing. Helmut Winkel Metallische Werkstoffe Praktikum Innovative Werkstoffkunde Verhalten von Kunststoffen beim
Auswertung einer DSC-Kurve
 Versuch Nr. 7 Auswertung einer DSC-Kurve Einleitung: Sie haben bislang bereits die Thermogravimetrie (TG) und die Differenzthermoanalyse (DTA) als wichtige thermische Analysenverfahren kennengelernt. Während
Versuch Nr. 7 Auswertung einer DSC-Kurve Einleitung: Sie haben bislang bereits die Thermogravimetrie (TG) und die Differenzthermoanalyse (DTA) als wichtige thermische Analysenverfahren kennengelernt. Während
Grundlagen der Kinetik
 Kapitel 1 Grundlagen der Kinetik In diesem Kapitel werden die folgenden Themen kurz wiederholt: Die differenziellen und integralen Geschwindigkeitsgesetze von irreversiblen Reaktionen., 1., und. Ordnung
Kapitel 1 Grundlagen der Kinetik In diesem Kapitel werden die folgenden Themen kurz wiederholt: Die differenziellen und integralen Geschwindigkeitsgesetze von irreversiblen Reaktionen., 1., und. Ordnung
Thermoanalyse. Kapitel 3.5. Lothar Schwabe, Freie Universität Berlin
 Kapitel 3.5. Thermoanalyse Lothar Schwabe, Freie Universität Berlin 1. Einleitung Mit dem Begriff Thermoanalyse oder Thermische Analyse (TA) werden Verfahren bezeichnet, mit denen temperaturbedingte Änderungen
Kapitel 3.5. Thermoanalyse Lothar Schwabe, Freie Universität Berlin 1. Einleitung Mit dem Begriff Thermoanalyse oder Thermische Analyse (TA) werden Verfahren bezeichnet, mit denen temperaturbedingte Änderungen
Thermal Analysis Excellence
 Thermal Analysis Excellence DSC 3 STAR e System Innovative Technologie Unbegrenzte Modularität Schweizer Qualität Dynamische Differenzkalorimetrie für Routineanwendungen DSC Excellence Unvergleichliche
Thermal Analysis Excellence DSC 3 STAR e System Innovative Technologie Unbegrenzte Modularität Schweizer Qualität Dynamische Differenzkalorimetrie für Routineanwendungen DSC Excellence Unvergleichliche
Thermische Analyse von Polymeren, Teil 2: TGA, TMA und DMA an Thermoplasten
 Thermische Analyse von Polymeren, Teil 2: TGA, TMA und DMA an Thermoplasten Dr. Angela Hammer In Teil 1 (UserCom 31) dieses Beitrages wurde gezeigt, welche Effekte mit DSC auf dem Gebiet der Thermoplaste
Thermische Analyse von Polymeren, Teil 2: TGA, TMA und DMA an Thermoplasten Dr. Angela Hammer In Teil 1 (UserCom 31) dieses Beitrages wurde gezeigt, welche Effekte mit DSC auf dem Gebiet der Thermoplaste
Versuch V2 Version 12/2012. Legierungsbildung. und. Differential-Thermo-Analyse
 Anorganisches Praktikum 3. Semester FB Chemieingenieurwesen Labor für Anorg. Chemie Angew. Materialwiss. Versuch V2 Version 12/2012 Legierungsbildung und Differential-Thermo-Analyse Herstellung von Bronze
Anorganisches Praktikum 3. Semester FB Chemieingenieurwesen Labor für Anorg. Chemie Angew. Materialwiss. Versuch V2 Version 12/2012 Legierungsbildung und Differential-Thermo-Analyse Herstellung von Bronze
Polymorphie von Triamcinoloacetonid
 Versuch F4 Polymorphie von Triamcinoloacetonid Einführung Der Begriff Polymorphie bezeichnet die Eigenschaft chemischer Verbindung in mehreren kristallinen Modifikationen vorzukommen. Findet sich für eine
Versuch F4 Polymorphie von Triamcinoloacetonid Einführung Der Begriff Polymorphie bezeichnet die Eigenschaft chemischer Verbindung in mehreren kristallinen Modifikationen vorzukommen. Findet sich für eine
Versuch Nr.53. Messung kalorischer Größen (Spezifische Wärmen)
 Versuch Nr.53 Messung kalorischer Größen (Spezifische Wärmen) Stichworte: Wärme, innere Energie und Enthalpie als Zustandsfunktion, Wärmekapazität, spezifische Wärme, Molwärme, Regel von Dulong-Petit,
Versuch Nr.53 Messung kalorischer Größen (Spezifische Wärmen) Stichworte: Wärme, innere Energie und Enthalpie als Zustandsfunktion, Wärmekapazität, spezifische Wärme, Molwärme, Regel von Dulong-Petit,
Mit Wärme den Fasern auf der Spur Thermische Analyse an Polyester- und Polyamidtextilien
 Mit Wärme den Fasern auf der Spur Thermische Analyse an Polyester- und Polyamidtextilien Dr.-Ing. Eva Bittmann, Sachverständigenbüro werkstoff&struktur, Herreth Textilien aus Chemiefasern durchlaufen einen
Mit Wärme den Fasern auf der Spur Thermische Analyse an Polyester- und Polyamidtextilien Dr.-Ing. Eva Bittmann, Sachverständigenbüro werkstoff&struktur, Herreth Textilien aus Chemiefasern durchlaufen einen
TA Instruments TGA Q500
 Kunststoffanalyse 2 Kunststoffanalyse Untersuchungsmethode Infrarot ( IR-) Spektralanalyse Thermogravimetrie Differential Scanning Calorimetry ( DSC ) Kurzzeichen FT-IR TGA DSC Prüfnormen Gerätetyp und
Kunststoffanalyse 2 Kunststoffanalyse Untersuchungsmethode Infrarot ( IR-) Spektralanalyse Thermogravimetrie Differential Scanning Calorimetry ( DSC ) Kurzzeichen FT-IR TGA DSC Prüfnormen Gerätetyp und
Reaktorvergleich mittels Verweilzeitverteilung
 Reaktorvergleich mittels Verweilzeitverteilung Bericht für das Praktikum Chemieingenieurwesen I WS06/07 Studenten: Francisco José Guerra Millán fguerram@student.ethz.ch Andrea Michel michela@student.ethz.ch
Reaktorvergleich mittels Verweilzeitverteilung Bericht für das Praktikum Chemieingenieurwesen I WS06/07 Studenten: Francisco José Guerra Millán fguerram@student.ethz.ch Andrea Michel michela@student.ethz.ch
Pflichtpraktikum Methodik
 Lehrstuhl für Adhäsion und Interphasen in Polymeren Prof. Dr. Wulff Possart Dipl.-Ing. Jan Christoph Gaukler Geb. C6.3, Raum 6.05 Email: j.gaukler@mx.uni-saarland.de Pflichtpraktikum Methodik Versuch:
Lehrstuhl für Adhäsion und Interphasen in Polymeren Prof. Dr. Wulff Possart Dipl.-Ing. Jan Christoph Gaukler Geb. C6.3, Raum 6.05 Email: j.gaukler@mx.uni-saarland.de Pflichtpraktikum Methodik Versuch:
PP Physikalisches Pendel
 PP Physikalisches Pendel Blockpraktikum Frühjahr 2007 (Gruppe 2) 25. April 2007 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 2 2 Theoretische Grundlagen 2 2.1 Ungedämpftes physikalisches Pendel.......... 2 2.2 Dämpfung
PP Physikalisches Pendel Blockpraktikum Frühjahr 2007 (Gruppe 2) 25. April 2007 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 2 2 Theoretische Grundlagen 2 2.1 Ungedämpftes physikalisches Pendel.......... 2 2.2 Dämpfung
PHYSIKALISCHES INSTITUT F-PRAKTIKUM. Protokoll. Differenz-Thermoanalyse
 PHYSIKALISCHES INSTITUT F-PRAKTIKUM Protokoll Differenz-Thermoanalyse Intsar Ahmad Bangwi und Sven T. Köppel Abgabe: 20.02.2011 Versuchsdurchführung: 24.01.2011 Thermische Analyse Der Begriff Thermische
PHYSIKALISCHES INSTITUT F-PRAKTIKUM Protokoll Differenz-Thermoanalyse Intsar Ahmad Bangwi und Sven T. Köppel Abgabe: 20.02.2011 Versuchsdurchführung: 24.01.2011 Thermische Analyse Der Begriff Thermische
Überlegungen zur Leistung und zum Wirkungsgrad von Solarkochern
 Überlegungen zur Leistung und zum Wirkungsgrad von Solarkochern (Dr. Hartmut Ehmler) Einführung Die folgenden Überlegungen gelten ganz allgemein für Solarkocher, unabhängig ob es sich um einen Parabolkocher,
Überlegungen zur Leistung und zum Wirkungsgrad von Solarkochern (Dr. Hartmut Ehmler) Einführung Die folgenden Überlegungen gelten ganz allgemein für Solarkocher, unabhängig ob es sich um einen Parabolkocher,
a) Welche der folgenden Aussagen treffen nicht zu? (Dies bezieht sind nur auf Aufgabenteil a)
 Aufgabe 1: Multiple Choice (10P) Geben Sie an, welche der Aussagen richtig sind. Unabhängig von der Form der Fragestellung (Singular oder Plural) können eine oder mehrere Antworten richtig sein. a) Welche
Aufgabe 1: Multiple Choice (10P) Geben Sie an, welche der Aussagen richtig sind. Unabhängig von der Form der Fragestellung (Singular oder Plural) können eine oder mehrere Antworten richtig sein. a) Welche
Diskussionshilfe zum Thema: mit Ergebnissen der Wareneingangskontrolle
 Vergleich der Angaben in Datenblättern mit Ergebnissen der Wareneingangskontrolle H. Mehling Ausgangssituation Messtechnischer Hintergrund Diskussion: gespeicherte Wärmemenge Ausgangssituation Zusammenhang
Vergleich der Angaben in Datenblättern mit Ergebnissen der Wareneingangskontrolle H. Mehling Ausgangssituation Messtechnischer Hintergrund Diskussion: gespeicherte Wärmemenge Ausgangssituation Zusammenhang
Vollständige Analyse mit DDK, TMA und TGA-EGA
 Vollständige Analyse mit DDK, TMA und TGA-EGA Diese Arbeit soll am Beispiel der Untersuchung von Leiterplatten zeigen, wie die Informationen aus den verschiedenen thermoanalytischen Messverfahren zu einer
Vollständige Analyse mit DDK, TMA und TGA-EGA Diese Arbeit soll am Beispiel der Untersuchung von Leiterplatten zeigen, wie die Informationen aus den verschiedenen thermoanalytischen Messverfahren zu einer
Thermische Analyse mittels Wärmestrom-DDK (DSC)
 7.1 Thermische Analyse mittels Wärmestrom-DDK (DSC) 1. Vorausgesetzte Kenntnisse Grundlagen der thermodynamischen Behandlung von Phasenumwandlungen und chemischen Reaktionen; Schmelzdiagramme; Kryoskopie;
7.1 Thermische Analyse mittels Wärmestrom-DDK (DSC) 1. Vorausgesetzte Kenntnisse Grundlagen der thermodynamischen Behandlung von Phasenumwandlungen und chemischen Reaktionen; Schmelzdiagramme; Kryoskopie;
Schmelzdiagramm eines binären Stoffgemisches
 Praktikum Physikalische Chemie I 30. Oktober 2015 Schmelzdiagramm eines binären Stoffgemisches Guido Petri Anastasiya Knoch PC111/112, Gruppe 11 1. Theorie hinter dem Versuch Ein Schmelzdiagramm zeigt
Praktikum Physikalische Chemie I 30. Oktober 2015 Schmelzdiagramm eines binären Stoffgemisches Guido Petri Anastasiya Knoch PC111/112, Gruppe 11 1. Theorie hinter dem Versuch Ein Schmelzdiagramm zeigt
Fragen zum Versuch 11a Kinetik Rohrzuckerinversion:
 Fragen zum Versuch 11a Kinetik Rohrzuckerinversion: 1. Die Inversion von Rohrzucker ist: a. Die Umwandlung von Rohrzucker in Saccharose b. Die katalytische Spaltung in Glucose und Fructose c. Das Auflösen
Fragen zum Versuch 11a Kinetik Rohrzuckerinversion: 1. Die Inversion von Rohrzucker ist: a. Die Umwandlung von Rohrzucker in Saccharose b. Die katalytische Spaltung in Glucose und Fructose c. Das Auflösen
Thermal Analysis Excellence
 Thermal Analysis Excellence Flash DSC 1 STAR e System Innovative Technologie Unbegrenzte Modularität Schweizer Qualität Flash Dynamische Differenzkalorimetrie für Forschung und Entwicklung Flash DSC Excellence
Thermal Analysis Excellence Flash DSC 1 STAR e System Innovative Technologie Unbegrenzte Modularität Schweizer Qualität Flash Dynamische Differenzkalorimetrie für Forschung und Entwicklung Flash DSC Excellence
Versuch 3 Differential Scanning Calorimetry
 Versuch 3 Differential Scanning Calorimetry 1 Einleitung Die Differntial Scanning Calorimetry (DSC), auch Dynamische-Differenz-Kalorimetrie (DDK) genannt, ist eine der bedeutendsten Methoden im Bereich
Versuch 3 Differential Scanning Calorimetry 1 Einleitung Die Differntial Scanning Calorimetry (DSC), auch Dynamische-Differenz-Kalorimetrie (DDK) genannt, ist eine der bedeutendsten Methoden im Bereich
Betrachtung der Stoffwerte und ihrer Bezugstemperatur. Von Franz Adamczewski
 Betrachtung der Stoffwerte und ihrer Bezugstemperatur Von Franz Adamczewski Inhaltsverzeichnis Einleitung... 3 Bezugstemperatur... 4 Eintrittstemperatur des Kühlmediums 4 Austrittstemperatur des Kühlmediums
Betrachtung der Stoffwerte und ihrer Bezugstemperatur Von Franz Adamczewski Inhaltsverzeichnis Einleitung... 3 Bezugstemperatur... 4 Eintrittstemperatur des Kühlmediums 4 Austrittstemperatur des Kühlmediums
Verbrennungsrechnung als kinetischer Simulationsansatz
 Verbrennungsrechnung als kinetischer Simulationsansatz Simulationsansatz mit CHEMCAD Die Daten für Flammpunkt, Zündtemperatur, Explosionsgrenzen diverser Stoffe sind weitestgehend bekannt. Methoden zur
Verbrennungsrechnung als kinetischer Simulationsansatz Simulationsansatz mit CHEMCAD Die Daten für Flammpunkt, Zündtemperatur, Explosionsgrenzen diverser Stoffe sind weitestgehend bekannt. Methoden zur
Thermoanalyse Excellence
 Thermoanalyse Excellence PolymerDSC 1-Pakete Schnelle Wareneingangskontrolle Einfache Produktionsoptimierung Effiziente Fertigungskontrolle Effiziente & verlässliche Kunststoffanalytik für Ihren Erfolg
Thermoanalyse Excellence PolymerDSC 1-Pakete Schnelle Wareneingangskontrolle Einfache Produktionsoptimierung Effiziente Fertigungskontrolle Effiziente & verlässliche Kunststoffanalytik für Ihren Erfolg
Keimbildung und Klärung von Polyethylen
 Keimbildung und Klärung von Polyethylen Die Suche nach einem Zusatzstoff, der Polyethylen durchsichtig macht ohne die Eigenschaften des Kunstoffs negativ zu beeinflussen. Kaspar Bührer, Kantonsschule Schaffhausen,
Keimbildung und Klärung von Polyethylen Die Suche nach einem Zusatzstoff, der Polyethylen durchsichtig macht ohne die Eigenschaften des Kunstoffs negativ zu beeinflussen. Kaspar Bührer, Kantonsschule Schaffhausen,
SC-PROJEKT EISWÜRFEL: HÖHE = 21MM. Patrick Kurer & Marcel Meschenmoser
 SC-PROJEKT EISWÜRFEL: HÖHE = 21MM Patrick Kurer & Marcel Meschenmoser 2.1.2013 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis... 1 Allgemeine Parameter... 2 Aufgabe A Allgemeine Berechnung des Eiswürfels... 2 Aufgabe
SC-PROJEKT EISWÜRFEL: HÖHE = 21MM Patrick Kurer & Marcel Meschenmoser 2.1.2013 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis... 1 Allgemeine Parameter... 2 Aufgabe A Allgemeine Berechnung des Eiswürfels... 2 Aufgabe
Praktikum Physik. Protokoll zum Versuch 5: Spezifische Wärme. Durchgeführt am Gruppe X
 Praktikum Physik Protokoll zum Versuch 5: Spezifische Wärme Durchgeführt am 10.11.2011 Gruppe X Name 1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuer: Wir bestätigen hiermit, dass wir das
Praktikum Physik Protokoll zum Versuch 5: Spezifische Wärme Durchgeführt am 10.11.2011 Gruppe X Name 1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuer: Wir bestätigen hiermit, dass wir das
Thermodynamik. Thermodynamik ist die Lehre von den Energieänderungen im Verlauf von physikalischen und chemischen Vorgängen.
 Thermodynamik Was ist das? Thermodynamik ist die Lehre von den Energieänderungen im Verlauf von physikalischen und chemischen Vorgängen. Gesetze der Thermodynamik Erlauben die Voraussage, ob eine bestimmte
Thermodynamik Was ist das? Thermodynamik ist die Lehre von den Energieänderungen im Verlauf von physikalischen und chemischen Vorgängen. Gesetze der Thermodynamik Erlauben die Voraussage, ob eine bestimmte
T1: Wärmekapazität eines Kalorimeters
 Grundpraktikum T1: Wärmekapazität eines Kalorimeters Autor: Partner: Versuchsdatum: Versuchsplatz: Abgabedatum: Inhaltsverzeichnis 1 Physikalische Grundlagen und Aufgabenstellung 2 2 Messwerte und Auswertung
Grundpraktikum T1: Wärmekapazität eines Kalorimeters Autor: Partner: Versuchsdatum: Versuchsplatz: Abgabedatum: Inhaltsverzeichnis 1 Physikalische Grundlagen und Aufgabenstellung 2 2 Messwerte und Auswertung
Thermische Analyse Thermomechanische Analyse für alle Ansprüche
 Thermische Analyse Thermomechanische Analyse für alle Ansprüche TMA/SDTA840 METTLER TOLEDO Thermomechanisches Modul TMA/SDTA840 Ausgezeichnete Leistung, einfacher und sicherer Betrieb Mit der thermomechanischen
Thermische Analyse Thermomechanische Analyse für alle Ansprüche TMA/SDTA840 METTLER TOLEDO Thermomechanisches Modul TMA/SDTA840 Ausgezeichnete Leistung, einfacher und sicherer Betrieb Mit der thermomechanischen
Übungsaufgaben zur HPLC für Biolaboranten
 Übungsaufgaben zur HPLC für Biolaboranten 1.1 Trennung von Paracetamol und HPLC Im LTC-Praktikum wurde in einer Kalibrierlösung Paracetamol und Coffein über eine HPLC getrennt. Bedingungen: β(cof) = 12,5
Übungsaufgaben zur HPLC für Biolaboranten 1.1 Trennung von Paracetamol und HPLC Im LTC-Praktikum wurde in einer Kalibrierlösung Paracetamol und Coffein über eine HPLC getrennt. Bedingungen: β(cof) = 12,5
Elastizität und Torsion
 INSTITUT FÜR ANGEWANDTE PHYSIK Physikalisches Praktikum für Studierende der Ingenieurswissenschaften Universität Hamburg, Jungiusstraße 11 Elastizität und Torsion 1 Einleitung Ein Flachstab, der an den
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE PHYSIK Physikalisches Praktikum für Studierende der Ingenieurswissenschaften Universität Hamburg, Jungiusstraße 11 Elastizität und Torsion 1 Einleitung Ein Flachstab, der an den
Einfache Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit von Polymeren mittels DSC
 Tipps und Hinweise Einfache Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit von Polymeren mittels DSC Dr. Rudolf Riesen Mit einfachen DSC-Messungen kann die Wärmeleitfähigkeit von Polymeren und anderen Materialien mit
Tipps und Hinweise Einfache Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit von Polymeren mittels DSC Dr. Rudolf Riesen Mit einfachen DSC-Messungen kann die Wärmeleitfähigkeit von Polymeren und anderen Materialien mit
Thermal Analysis Excellence
 Thermal Analysis Excellence STAR e Excellence Software STAR e System Innovative Technologie Unbegrenzte Modularität Schweizer Qualität Software für die Thermische Analyse mit unerreichter Flexibilität
Thermal Analysis Excellence STAR e Excellence Software STAR e System Innovative Technologie Unbegrenzte Modularität Schweizer Qualität Software für die Thermische Analyse mit unerreichter Flexibilität
TA-Tipp. Messen mit hohen Heizraten Vorteile und Grenzen Dr. Matthias Wagner, Dr. Rod Bottom, Philippe Larbanois, Dr. Jürgen Schawe 1/2004
 1/2004 Informationen für Anwender von METTLER TOLEDO Thermoanalysen-Systemen Sehr geehrter Kunde, 19 40 Jahre Thermische Analyse dieses Ereignis feiern wir dieses Jahr bei METTLER TOLEDO. 1964 wurde der
1/2004 Informationen für Anwender von METTLER TOLEDO Thermoanalysen-Systemen Sehr geehrter Kunde, 19 40 Jahre Thermische Analyse dieses Ereignis feiern wir dieses Jahr bei METTLER TOLEDO. 1964 wurde der
Hall Effekt und Bandstruktur
 Hall Effekt und Bandstruktur Themen zur Vorbereitung (relevant im Kolloquium zu Beginn des Versuchstages und für den Theorieteil des Protokolls): Entstehung von Bandstruktur. Halbleiter Bandstruktur. Dotierung
Hall Effekt und Bandstruktur Themen zur Vorbereitung (relevant im Kolloquium zu Beginn des Versuchstages und für den Theorieteil des Protokolls): Entstehung von Bandstruktur. Halbleiter Bandstruktur. Dotierung
LabX UV/VIS Software. PC Software LabX UV/VIS. Optimieren Sie Ihre UV/VIS-Arbeitsabläufe
 LabX UV/VIS Software PC Software LabX UV/VIS LabX UV/VIS Software Optimieren Sie Ihre UV/VIS-Arbeitsabläufe Optimierung von Arbeitsabläufen Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe Einfach, effizient und sicher
LabX UV/VIS Software PC Software LabX UV/VIS LabX UV/VIS Software Optimieren Sie Ihre UV/VIS-Arbeitsabläufe Optimierung von Arbeitsabläufen Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe Einfach, effizient und sicher
Moderne Methoden der Chemie - die Differenz-Thermo- Analyse (DTA)
 Moderne Methoden der Chemie - die Differenz-Thermo- Analyse (DTA) Einleitung Moderne Anaylsemethoden haben die Chemie - insbesondere in den letzten 50 Jahren - stark verändert. Sie ermöglichen völlig neue
Moderne Methoden der Chemie - die Differenz-Thermo- Analyse (DTA) Einleitung Moderne Anaylsemethoden haben die Chemie - insbesondere in den letzten 50 Jahren - stark verändert. Sie ermöglichen völlig neue
DSC Differential Scanning Calorimetrie
 DSC Differential Scanning Calorimetrie Ziel: Ermittlung von Materialeigenschaften aufgrund von Enthalpieänderungen. Grundprinzip: Die Differential Scanning Calorimetrie (DSC) ist definiert als eine Messmethode,
DSC Differential Scanning Calorimetrie Ziel: Ermittlung von Materialeigenschaften aufgrund von Enthalpieänderungen. Grundprinzip: Die Differential Scanning Calorimetrie (DSC) ist definiert als eine Messmethode,
8.4.5 Wasser sieden bei Zimmertemperatur ******
 8.4.5 ****** 1 Motivation Durch Verminderung des Luftdrucks siedet Wasser bei Zimmertemperatur. 2 Experiment Abbildung 1: Ein druckfester Glaskolben ist zur Hälfte mit Wasser gefüllt, so dass die Flüsigkeit
8.4.5 ****** 1 Motivation Durch Verminderung des Luftdrucks siedet Wasser bei Zimmertemperatur. 2 Experiment Abbildung 1: Ein druckfester Glaskolben ist zur Hälfte mit Wasser gefüllt, so dass die Flüsigkeit
Einführung. Ablesen von einander zugeordneten Werten
 Einführung Zusammenhänge zwischen Größen wie Temperatur, Geschwindigkeit, Lautstärke, Fahrstrecke, Preis, Einkommen, Steuer etc. werden mit beschrieben. Eine Zuordnung f, die jedem x A genau ein y B zuweist,
Einführung Zusammenhänge zwischen Größen wie Temperatur, Geschwindigkeit, Lautstärke, Fahrstrecke, Preis, Einkommen, Steuer etc. werden mit beschrieben. Eine Zuordnung f, die jedem x A genau ein y B zuweist,
Thermische Analyse. Einführung ins Thema. Bilderquelle Netzsch
 Thermische Analyse Einführung ins Thema Bilderquelle Netzsch Definition nach DIN 51005: Die Ausgangsbasis Was ist die thermische Analyse? (TA) Thermische Analyse: Oberbegriff für Methoden, bei denen physikalische
Thermische Analyse Einführung ins Thema Bilderquelle Netzsch Definition nach DIN 51005: Die Ausgangsbasis Was ist die thermische Analyse? (TA) Thermische Analyse: Oberbegriff für Methoden, bei denen physikalische
Chemilumineszenz, MALDI TOF MS, DSC Vergleichende Messungen an Polymeren
 Chemilumineszenz, MALDI TF MS, DSC Vergleichende Messungen an Polymeren Urs von Arx und Ingo Mayer Berner Fachhochschule Architektur, Holz und Bau F+E, Werkstoffe und Holztechnologie Biel Problemstellung
Chemilumineszenz, MALDI TF MS, DSC Vergleichende Messungen an Polymeren Urs von Arx und Ingo Mayer Berner Fachhochschule Architektur, Holz und Bau F+E, Werkstoffe und Holztechnologie Biel Problemstellung
Verwandte Begriffe Maxwell-Gleichungen, elektrisches Wirbelfeld, Magnetfeld von Spulen, magnetischer Fluss, induzierte Spannung.
 Verwandte Begriffe Maxwell-Gleichungen, elektrisches Wirbelfeld, Magnetfeld von Spulen, magnetischer Fluss, induzierte Spannung. Prinzip In einer langen Spule wird ein Magnetfeld mit variabler Frequenz
Verwandte Begriffe Maxwell-Gleichungen, elektrisches Wirbelfeld, Magnetfeld von Spulen, magnetischer Fluss, induzierte Spannung. Prinzip In einer langen Spule wird ein Magnetfeld mit variabler Frequenz
1/2000. Informationen für Anwender von METTLER TOLEDO Thermoanalysen. Inhaltsverzeichnis
 1/2000 Informationen für Anwender von METTLER TOLEDO Thermoanalysen Sehr geehrter Kunde Das Jahr 2000 wird für METTLER TOLEDO auf dem Gebiet der Thermischen Analyse äusserst interessant. Wir wollen durch
1/2000 Informationen für Anwender von METTLER TOLEDO Thermoanalysen Sehr geehrter Kunde Das Jahr 2000 wird für METTLER TOLEDO auf dem Gebiet der Thermischen Analyse äusserst interessant. Wir wollen durch
Versuchsanleitungen zum Praktikum Physikalische Chemie für Anfänger 1
 Versuchsanleitungen zum Praktikum Physikalische Chemie für Anfänger 1 A 6 Kalorimetrie Aufgabe: Mittels eines Flüssigkeitskalorimeters ist a) die Neutralisationsenthalpie von säure b) die ösungsenthalpie
Versuchsanleitungen zum Praktikum Physikalische Chemie für Anfänger 1 A 6 Kalorimetrie Aufgabe: Mittels eines Flüssigkeitskalorimeters ist a) die Neutralisationsenthalpie von säure b) die ösungsenthalpie
Thermische Eigenschaften von Polymeren. Thermische Eigenschaften von Polymeren
 Thermische Eigenschaften von Polymeren Thermische Eigenschaften von Polymeren Vier wichtige Temperaturen/Temperaturintervalle charakterisieren teilkristalline Polymere: 1. Glastemperatur T g Beim Abkühlen
Thermische Eigenschaften von Polymeren Thermische Eigenschaften von Polymeren Vier wichtige Temperaturen/Temperaturintervalle charakterisieren teilkristalline Polymere: 1. Glastemperatur T g Beim Abkühlen
Vorwort... VI. Inhaltsverzeichnis...VII. Normen zur Thermischen Analyse... XIV. Liste der verwendeten Abkürzungen und Formelzeichen...
 VII Vorwort... VI...VII Normen zur Thermischen Analyse... XIV Liste der verwendeten Abkürzungen und Formelzeichen...XVII Abkürzungen der verwendeten Kunststoffe... XXIII 1 Dynamische Differenzkalorimetrie
VII Vorwort... VI...VII Normen zur Thermischen Analyse... XIV Liste der verwendeten Abkürzungen und Formelzeichen...XVII Abkürzungen der verwendeten Kunststoffe... XXIII 1 Dynamische Differenzkalorimetrie
Thermodynamik & Kinetik
 Thermodynamik & Kinetik Inhaltsverzeichnis Ihr versteht die Begriffe offenes System, geschlossenes System, isoliertes System, Enthalpie, exotherm und endotherm... 3 Ihr kennt die Funktionsweise eines Kalorimeters
Thermodynamik & Kinetik Inhaltsverzeichnis Ihr versteht die Begriffe offenes System, geschlossenes System, isoliertes System, Enthalpie, exotherm und endotherm... 3 Ihr kennt die Funktionsweise eines Kalorimeters
Viskosität und Formgebung von Glas
 Viskosität und Formgebung von Glas Stefan Kuhn Stefan.Kuhn@uni-jena.de Tel.: (9)48522 1.1 Zielstellung In diesem Praktikum soll der Flieÿpunkt der im Praktikumsversuch Schmelzen von Glas hergestellten
Viskosität und Formgebung von Glas Stefan Kuhn Stefan.Kuhn@uni-jena.de Tel.: (9)48522 1.1 Zielstellung In diesem Praktikum soll der Flieÿpunkt der im Praktikumsversuch Schmelzen von Glas hergestellten
Kohlenmonoxid aus Ethanal, CH 3 -CHO
 Kohlenmonoxid aus Ethanal, CH 3 -CHO Peter Bützer Chemiker haben viele nette Reaktionen! Inhalt 1 Einleitung/Theorie... 1 2 Aufgabenstellung... 2 2.1 Beobachtungen/Messungen, Datenbasis... 2 2.2 Reaktionsgleichungen/Berechnungen...
Kohlenmonoxid aus Ethanal, CH 3 -CHO Peter Bützer Chemiker haben viele nette Reaktionen! Inhalt 1 Einleitung/Theorie... 1 2 Aufgabenstellung... 2 2.1 Beobachtungen/Messungen, Datenbasis... 2 2.2 Reaktionsgleichungen/Berechnungen...
Übungsscheinklausur,
 Mathematik IV für Maschinenbau und Informatik (Stochastik) Universität Rostock, Institut für Mathematik Sommersemester 27 Prof. Dr. F. Liese Übungsscheinklausur, 3.7.27 Dipl.-Math. M. Helwich Name:...
Mathematik IV für Maschinenbau und Informatik (Stochastik) Universität Rostock, Institut für Mathematik Sommersemester 27 Prof. Dr. F. Liese Übungsscheinklausur, 3.7.27 Dipl.-Math. M. Helwich Name:...
Bevor man sich an diesen Hauptsatz heranwagt, muss man sich über einige Begriffe klar sein. Dazu gehört zunächst die Energie.
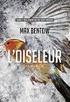 Thermodynamik 1 1.Hauptsatz der Thermodynamik Bevor man sich an diesen Hauptsatz heranwagt, muss man sich über einige Begriffe klar sein. Dazu gehört zunächst die Energie. Energie ist die Fähigkeit Arbeit
Thermodynamik 1 1.Hauptsatz der Thermodynamik Bevor man sich an diesen Hauptsatz heranwagt, muss man sich über einige Begriffe klar sein. Dazu gehört zunächst die Energie. Energie ist die Fähigkeit Arbeit
Nachweis von Strukturänderungen mit Flash-DSC-Technik
 Nachweis von Strukturänderungen mit Flash-DSC-Technik Dynamische Differenzkalorimetrie. Bei teilkristallinen Polymeren bestimmen Gefügeunterschiede die mechanischen Eigenschaften der Produkte. Am Beispiel
Nachweis von Strukturänderungen mit Flash-DSC-Technik Dynamische Differenzkalorimetrie. Bei teilkristallinen Polymeren bestimmen Gefügeunterschiede die mechanischen Eigenschaften der Produkte. Am Beispiel
Übungen mit dem Applet Vergleich von zwei Mittelwerten
 Vergleich von zwei Mittelwerten 1 Übungen mit dem Applet Vergleich von zwei Mittelwerten 1 Statistischer Hintergrund... 2 1.1 Typische Fragestellungen...2 1.2 Fehler 1. und 2. Art...2 1.3 Kurzbeschreibung
Vergleich von zwei Mittelwerten 1 Übungen mit dem Applet Vergleich von zwei Mittelwerten 1 Statistischer Hintergrund... 2 1.1 Typische Fragestellungen...2 1.2 Fehler 1. und 2. Art...2 1.3 Kurzbeschreibung
BGI 505.55 (bisher ZH 1/120.55) Verfahren zur Bestimmung von cis- und trans-1,3- Dichlorpropen
 BGI 505.55 (bisher ZH 1/120.55) Verfahren zur Bestimmung von cis- und trans-1,3- Dichlorpropen Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften Fachausschuß "Chemie" November 1994 Erprobtes und von
BGI 505.55 (bisher ZH 1/120.55) Verfahren zur Bestimmung von cis- und trans-1,3- Dichlorpropen Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften Fachausschuß "Chemie" November 1994 Erprobtes und von
4 Hauptsätze der Thermodynamik
 I Wärmelehre -21-4 Hauptsätze der hermodynamik 4.1 Energieformen und Energieumwandlung Innere Energie U Die innere Energie U eines Körpers oder eines Systems ist die gesamte Energie die darin steckt. Es
I Wärmelehre -21-4 Hauptsätze der hermodynamik 4.1 Energieformen und Energieumwandlung Innere Energie U Die innere Energie U eines Körpers oder eines Systems ist die gesamte Energie die darin steckt. Es
Auswertung: Wärmekapazität
 Auswertung: Wärmekapazität M. Axwel & Marcel Köpke 4.06.202 Inhaltsverzeichnis spezische Wärmekapazität von Aluminium und Kupfer 3. einzelnes Metallstück.............................. 4.. Diskussion der
Auswertung: Wärmekapazität M. Axwel & Marcel Köpke 4.06.202 Inhaltsverzeichnis spezische Wärmekapazität von Aluminium und Kupfer 3. einzelnes Metallstück.............................. 4.. Diskussion der
Identifizierung des Farbstoffes in blauen M&Ms durch Dünnschichtchromatographie
 Name Datum Identifizierung des Farbstoffes in blauen M&Ms durch Dünnschichtchromatographie Material: DC-Karten (Kieselgel), Glas mit Deckel(DC-Kammer), Kapillare, Messzylinder Chemikalien: Blaue M&Ms,
Name Datum Identifizierung des Farbstoffes in blauen M&Ms durch Dünnschichtchromatographie Material: DC-Karten (Kieselgel), Glas mit Deckel(DC-Kammer), Kapillare, Messzylinder Chemikalien: Blaue M&Ms,
Entwicklung spezieller Lösungen für die Messtechnik. Schallgeschwindigkeits-, Viskositäts- und Leitfähigkeitsmessungen an Polymer - Dispersionen
 Mess - und Analysentechnik Dr. Dinger Entwicklung spezieller Lösungen für die Messtechnik Applikationsberatung und technische Untersuchungen MAT Dr. Dinger Ludwig-Erhard-Strasse 12 34131 Kassel Vertrieb
Mess - und Analysentechnik Dr. Dinger Entwicklung spezieller Lösungen für die Messtechnik Applikationsberatung und technische Untersuchungen MAT Dr. Dinger Ludwig-Erhard-Strasse 12 34131 Kassel Vertrieb
1 Ein mathematisches Modell und die Änderungsrate
 1 Ein mathematisches Modell und die Änderungsrate Die Differenzial- und Integralrechnung 1 ist eine Sprache zur Beschreibung des quantitativen Zusammenhangs verschiedener Grössen in einem bestimmten Kontext
1 Ein mathematisches Modell und die Änderungsrate Die Differenzial- und Integralrechnung 1 ist eine Sprache zur Beschreibung des quantitativen Zusammenhangs verschiedener Grössen in einem bestimmten Kontext
UNTERSUCHUNG POLYMORPHER UMWANDLUNGEN MITTELS DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY
 UNTERSUCHUNG POLYMORPHER UMWANDLUNGEN MITTELS DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY Ziel des Versuchs Ziel des Versuchs Untersuchung polymorpher Umwandlungen mittels Differential Scanning Calorimetry ist die
UNTERSUCHUNG POLYMORPHER UMWANDLUNGEN MITTELS DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY Ziel des Versuchs Ziel des Versuchs Untersuchung polymorpher Umwandlungen mittels Differential Scanning Calorimetry ist die
E2 Stand: 03.04 Seite - 1 - E2. Charakterisierung von Polymeren mit der DSC
 E2 Stand: 03.04 Seite - 1 - E2. Charakterisierung von Polymeren mit der DSC Aufgabe Bestimmung der Glasübergangs-, Schmelz- bzw. Erweichungstemperatur in Abhängigkeit von der Zusammensetzung von Copolymeren.
E2 Stand: 03.04 Seite - 1 - E2. Charakterisierung von Polymeren mit der DSC Aufgabe Bestimmung der Glasübergangs-, Schmelz- bzw. Erweichungstemperatur in Abhängigkeit von der Zusammensetzung von Copolymeren.
Protokoll Grundpraktikum I: T6 Thermoelement und newtonsches Abkühlungsgesetz
 Protokoll Grundpraktikum I: T6 Thermoelement und newtonsches Abkühlungsgesetz Sebastian Pfitzner 5. Juni 03 Durchführung: Sebastian Pfitzner (553983), Anna Andrle (55077) Arbeitsplatz: Platz 3 Betreuer:
Protokoll Grundpraktikum I: T6 Thermoelement und newtonsches Abkühlungsgesetz Sebastian Pfitzner 5. Juni 03 Durchführung: Sebastian Pfitzner (553983), Anna Andrle (55077) Arbeitsplatz: Platz 3 Betreuer:
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Grundlegung WS 2014/15 Chemie I Dr. Helge Klemmer
 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Grundlegung WS 2014/15 Chemie I 12.12.2014 Gase Flüssigkeiten Feststoffe Wiederholung Teil 2 (05.12.2014) Ideales Gasgesetz: pv Reale Gase: Zwischenmolekularen Wechselwirkungen
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Grundlegung WS 2014/15 Chemie I 12.12.2014 Gase Flüssigkeiten Feststoffe Wiederholung Teil 2 (05.12.2014) Ideales Gasgesetz: pv Reale Gase: Zwischenmolekularen Wechselwirkungen
3 Thermogravimetrie - TG
 150 3.1 Grundlagen der Thermogravimetrie 3 Thermogravimetrie - TG 3.1 Grundlagen der Thermogravimetrie 3.1.1 Einleitung Mit Hilfe der Thermogravimetrie (TG) wird die Masse bzw. die Massenänderung einer
150 3.1 Grundlagen der Thermogravimetrie 3 Thermogravimetrie - TG 3.1 Grundlagen der Thermogravimetrie 3.1.1 Einleitung Mit Hilfe der Thermogravimetrie (TG) wird die Masse bzw. die Massenänderung einer
Prof. Dr. J. Gmehling Universität Oldenburg, Institut für Reine und Angewandte Chemie, Technische Chemie, D Oldenburg
 Abschlussbericht an die Max-Buchner-Forschungsstiftung (FKZ: 277) Messung der Gleichgewichtslage und der Kinetik ausgewählter Veretherungsreaktionen und Überprüfung der Vorhersagbarkeit der Lösungsmitteleffekte
Abschlussbericht an die Max-Buchner-Forschungsstiftung (FKZ: 277) Messung der Gleichgewichtslage und der Kinetik ausgewählter Veretherungsreaktionen und Überprüfung der Vorhersagbarkeit der Lösungsmitteleffekte
NICHT: W = ± 468 J, sondern: W = ± J oder: W = (1.283 ± 0.005) 10 5 J
 Musterbericht Allgemeines Der Versuchsbericht sollte kurz gehalten werden, aber das Notwendige enthalten. Er sollte klar vermitteln was - wie gemessen wurden. Kapitelüberschriften helfen bei der sauberen
Musterbericht Allgemeines Der Versuchsbericht sollte kurz gehalten werden, aber das Notwendige enthalten. Er sollte klar vermitteln was - wie gemessen wurden. Kapitelüberschriften helfen bei der sauberen
Thermal Analysis Excellence
 Thermal Analysis Excellence STAR e Excellence Software STAR e System Innovative Technologie Unbegrenzte Modularität Schweizer Qualität Software für die Thermische Analyse mit unerreichter Flexibilität
Thermal Analysis Excellence STAR e Excellence Software STAR e System Innovative Technologie Unbegrenzte Modularität Schweizer Qualität Software für die Thermische Analyse mit unerreichter Flexibilität
Messtechnik-Praktikum. Spektrumanalyse. Silvio Fuchs & Simon Stützer. c) Berechnen Sie mit FFT (z.b. ORIGIN) das entsprechende Frequenzspektrum.
 Messtechnik-Praktikum 10.06.08 Spektrumanalyse Silvio Fuchs & Simon Stützer 1 Augabenstellung 1. a) Bauen Sie die Schaltung für eine Einweggleichrichtung entsprechend Abbildung 1 auf. Benutzen Sie dazu
Messtechnik-Praktikum 10.06.08 Spektrumanalyse Silvio Fuchs & Simon Stützer 1 Augabenstellung 1. a) Bauen Sie die Schaltung für eine Einweggleichrichtung entsprechend Abbildung 1 auf. Benutzen Sie dazu
Grundlagen: Die Zersetzung von Ameisensäure in konzentrierter Schwefelsäure verläuft nach folgendem Mechanismus:
 A 35: Zersetzung von Ameisensäure Aufgabe: Für die Zersetzung von Ameisensäure in konzentrierter Schwefelsäure sind die Geschwindigkeitskonstante bei 30 und 40 C sowie der präexponentielle Faktor und die
A 35: Zersetzung von Ameisensäure Aufgabe: Für die Zersetzung von Ameisensäure in konzentrierter Schwefelsäure sind die Geschwindigkeitskonstante bei 30 und 40 C sowie der präexponentielle Faktor und die
7. Thermische Eigenschaften
 7. Thermische Eigenschaften 7.1 Definitionen und Methoden mit der Gibbschen Freien Energie G ist die Entroie S = ( G ) das Volumen V = G T die Enthalie H = G + TS = G T ( G ) die isobare Wärmekaazität
7. Thermische Eigenschaften 7.1 Definitionen und Methoden mit der Gibbschen Freien Energie G ist die Entroie S = ( G ) das Volumen V = G T die Enthalie H = G + TS = G T ( G ) die isobare Wärmekaazität
Aufgabe: Untersuchung der Kinetik der Zersetzung von Harnstoff durch Urease.
 A 36 Michaelis-Menten-Kinetik: Hydrolyse von Harnstoff Aufgabe: Untersuchung der Kinetik der Zersetzung von Harnstoff durch Urease. Grundlagen: a) Michaelis-Menten-Kinetik Im Bereich der Biochemie spielen
A 36 Michaelis-Menten-Kinetik: Hydrolyse von Harnstoff Aufgabe: Untersuchung der Kinetik der Zersetzung von Harnstoff durch Urease. Grundlagen: a) Michaelis-Menten-Kinetik Im Bereich der Biochemie spielen
GRUNDLAGENLABOR CLASSIC NICHTLINEARITÄTEN UND KENNLINIEN
 GRUNDLGENLBOR CLSSIC NICHTLINERITÄTEN UND KENNLINIEN Inhalt: 1. Einleitung und Zielsetzung...2 2. Theoretische ufgaben Vorbereitung...2 3. Praktische Messaufgaben...8 Filename: Version: uthor: Kennlinien_Nichtlinearitäten_3_0.doc
GRUNDLGENLBOR CLSSIC NICHTLINERITÄTEN UND KENNLINIEN Inhalt: 1. Einleitung und Zielsetzung...2 2. Theoretische ufgaben Vorbereitung...2 3. Praktische Messaufgaben...8 Filename: Version: uthor: Kennlinien_Nichtlinearitäten_3_0.doc
Übung 3. Ziel: Bedeutung/Umgang innere Energie U und Enthalpie H verstehen (Teil 2) Verständnis des thermodynamischen Gleichgewichts
 Ziel: Bedeutung/Umgang innere Energie U und Enthalpie H verstehen (Teil 2) adiabatische Flammentemperatur Verständnis des thermodynamischen Gleichgewichts Definition von K X, K c, K p Berechnung von K
Ziel: Bedeutung/Umgang innere Energie U und Enthalpie H verstehen (Teil 2) adiabatische Flammentemperatur Verständnis des thermodynamischen Gleichgewichts Definition von K X, K c, K p Berechnung von K
Hauptsätze der Thermodynamik
 Platzhalter für Bild, Bild auf Titelfolie hinter das Logo einsetzen Hauptsätze der Thermodynamik Dominik Pfennig, 31.10.2012 Inhalt 0. Hauptsatz Innere Energie 1. Hauptsatz Enthalpie Satz von Hess 2. Hauptsatz
Platzhalter für Bild, Bild auf Titelfolie hinter das Logo einsetzen Hauptsätze der Thermodynamik Dominik Pfennig, 31.10.2012 Inhalt 0. Hauptsatz Innere Energie 1. Hauptsatz Enthalpie Satz von Hess 2. Hauptsatz
Kettenreaktionen. Kapitel 2. In diesem Kapitel sollen die folgenden Fragen beantwortet werden:
 Kapitel 2 Kettenreaktionen In diesem Kapitel sollen die folgenden Fragen beantwortet werden: Was versteht man unter einer Kettenreaktion? Welches sind die verschiedenen Typen von Reaktionsschritten, die
Kapitel 2 Kettenreaktionen In diesem Kapitel sollen die folgenden Fragen beantwortet werden: Was versteht man unter einer Kettenreaktion? Welches sind die verschiedenen Typen von Reaktionsschritten, die
Reaktionskinetik. bimolekularen Reaktion. Für die Konzentraton des Dinitrochlorbenzols [a] gilt: = k
![Reaktionskinetik. bimolekularen Reaktion. Für die Konzentraton des Dinitrochlorbenzols [a] gilt: = k Reaktionskinetik. bimolekularen Reaktion. Für die Konzentraton des Dinitrochlorbenzols [a] gilt: = k](/thumbs/42/22840880.jpg) Versuche des Kapitel 7 Reaktionskinetik Einleitung Die Reaktion von Piperidin mit Dinitrochlorbenzol zum gelben Dinitrophenylpiperidin soll auf die Geschwindigkeitskonstante und die Arrheniusparameter
Versuche des Kapitel 7 Reaktionskinetik Einleitung Die Reaktion von Piperidin mit Dinitrochlorbenzol zum gelben Dinitrophenylpiperidin soll auf die Geschwindigkeitskonstante und die Arrheniusparameter
Fehlerrechnung. Aufgaben
 Fehlerrechnung Aufgaben 2 1. Ein digital arbeitendes Längenmeßgerät soll mittels eines Parallelendmaßes, das Normalcharakter besitzen soll, geprüft werden. Während der Messung wird die Temperatur des Parallelendmaßes
Fehlerrechnung Aufgaben 2 1. Ein digital arbeitendes Längenmeßgerät soll mittels eines Parallelendmaßes, das Normalcharakter besitzen soll, geprüft werden. Während der Messung wird die Temperatur des Parallelendmaßes
DSC PT10. thermal analysis. with outlimits
 TA DSC PT10 thermal analysis with outlimits DSC PT10 Platinum Serie Die Dynamische Wärmestrom Differenz Kalorimetrie (DDK, englisch DSC) ist eine sehr weit verbreitete Methode zur Bestimmung von Umwandlungstemperaturen
TA DSC PT10 thermal analysis with outlimits DSC PT10 Platinum Serie Die Dynamische Wärmestrom Differenz Kalorimetrie (DDK, englisch DSC) ist eine sehr weit verbreitete Methode zur Bestimmung von Umwandlungstemperaturen
Versuch 2: Kristallisation (und Reaktionskinetik)
 Praktikum Chemie I WS 2006/2007 Versuch 2: Kristallisation (und Reaktionskinetik) Sylvie Ruch Annette Altwegg Patricia Doll Sylvie Ruch 18.12.06 Assistent: Dean Glettig sruch@student.ethz.ch 1. Zusammenfassung
Praktikum Chemie I WS 2006/2007 Versuch 2: Kristallisation (und Reaktionskinetik) Sylvie Ruch Annette Altwegg Patricia Doll Sylvie Ruch 18.12.06 Assistent: Dean Glettig sruch@student.ethz.ch 1. Zusammenfassung
Labor Elektrotechnik. Versuch: Temperatur - Effekte
 Studiengang Elektrotechnik Labor Elektrotechnik Laborübung 5 Versuch: Temperatur - Effekte 13.11.2001 3. überarbeitete Version Markus Helmling Michael Pellmann Einleitung Der elektrische Widerstand ist
Studiengang Elektrotechnik Labor Elektrotechnik Laborübung 5 Versuch: Temperatur - Effekte 13.11.2001 3. überarbeitete Version Markus Helmling Michael Pellmann Einleitung Der elektrische Widerstand ist
2.2 Spezifische und latente Wärmen
 1 Einleitung Physikalisches Praktikum für Anfänger - Teil 1 Gruppe 2 Wärmelehre 2.2 Spezifische und latente Wärmen Die spezifische Wärme von Wasser gibt an, wieviel Energie man zu 1 kg Wasser zuführen
1 Einleitung Physikalisches Praktikum für Anfänger - Teil 1 Gruppe 2 Wärmelehre 2.2 Spezifische und latente Wärmen Die spezifische Wärme von Wasser gibt an, wieviel Energie man zu 1 kg Wasser zuführen
Mathematische Grundlagen der dynamischen Simulation
 Mathematische Grundlagen der dynamischen Simulation Dynamische Systeme sind Systeme, die sich verändern. Es geht dabei um eine zeitliche Entwicklung und wie immer in der Informatik betrachten wir dabei
Mathematische Grundlagen der dynamischen Simulation Dynamische Systeme sind Systeme, die sich verändern. Es geht dabei um eine zeitliche Entwicklung und wie immer in der Informatik betrachten wir dabei
Grundlagen der Chromatographie
 Grundlagen der Chromatographie Was ist Chromatographie? Trennung ähnlicher Moleküle aus komplexen Gemischen o Die Analyte werden in einer mobilen Phase gelöst und darin durch eine stationäre Phase transportiert.
Grundlagen der Chromatographie Was ist Chromatographie? Trennung ähnlicher Moleküle aus komplexen Gemischen o Die Analyte werden in einer mobilen Phase gelöst und darin durch eine stationäre Phase transportiert.
WU Crash Experimente und Simulation des partiellen Presshärtens mit Werkzeugtemperierung. R. Helmholz, M. Medricky, D. Lorenz
 WU Crash Experimente und Simulation des partiellen Presshärtens mit Werkzeugtemperierung R. Helmholz, M. Medricky, D. Lorenz 11.11.2013 Agenda 1. Einleitung 2. Stand der Technik 3. Experimentelle Durchführung
WU Crash Experimente und Simulation des partiellen Presshärtens mit Werkzeugtemperierung R. Helmholz, M. Medricky, D. Lorenz 11.11.2013 Agenda 1. Einleitung 2. Stand der Technik 3. Experimentelle Durchführung
A= A 1 A 2. A i. A= i
 2. Versuch Durchführung siehe Seite F - 3 Aufbau eines zweistufigen Verstärkers Prof. Dr. R Schulz Für die Verstärkung 'A' eines zwei stufigen Verstärkers gilt: oder allgemein: A= A 1 A 2 A= i A i A i
2. Versuch Durchführung siehe Seite F - 3 Aufbau eines zweistufigen Verstärkers Prof. Dr. R Schulz Für die Verstärkung 'A' eines zwei stufigen Verstärkers gilt: oder allgemein: A= A 1 A 2 A= i A i A i
Mathematischer Vorkurs für Physiker WS 2012/13: Vorlesung 1
 TU München Prof. P. Vogl Mathematischer Vorkurs für Physiker WS 2012/13: Vorlesung 1 Komplexe Zahlen Das Auffinden aller Nullstellen von algebraischen Gleichungen ist ein Grundproblem, das in der Physik
TU München Prof. P. Vogl Mathematischer Vorkurs für Physiker WS 2012/13: Vorlesung 1 Komplexe Zahlen Das Auffinden aller Nullstellen von algebraischen Gleichungen ist ein Grundproblem, das in der Physik
ein eindrückliches Hilfsmittel zur Visualisierung im naturwissenschaftlichen Unterricht
 Atomarium ein eindrückliches Hilfsmittel zur Visualisierung im naturwissenschaftlichen Unterricht Das Atomarium ist ein Computerprogramm, das chemische und physikalische Phänomene auf atomarer Ebene simuliert
Atomarium ein eindrückliches Hilfsmittel zur Visualisierung im naturwissenschaftlichen Unterricht Das Atomarium ist ein Computerprogramm, das chemische und physikalische Phänomene auf atomarer Ebene simuliert
