SPRACH- UND TEXTARBEIT IM RAHMEN VON FLEXIBLEN BILINGUALEN MODULEN
|
|
|
- Alexandra Schuster
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 1 von :57 SPRACH- UND TEXTARBEIT IM RAHMEN VON FLEXIBLEN BILINGUALEN MODULEN 1. Vorbemerkungen Hans-Ludwig Krechel Neben der Konsolidierung der bilingualen Zweige lässt sich heute in der nordrheinwestfälischen Schullandschaft ein zunehmendes Angebot an flexiblen bilingualen Modulen beobachten, und zwar insbesondere an Gymnasien, Realschulen und Gesamtschulen. Dies haben Erhebungen im Rahmen des vom Ministerium für Schule, Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung geförderten Programms zur "Intensivierung des Fremdsprachenlernens" (1998) gezeigt. Im Modellversuch "Wege zur Mehrsprachigkeit" werden diese neuen Wege bilingualen Lehrens und Lernens erprobt und evaluiert. Im Unterschied zum "klassischen Angebot" von bilingualem Unterricht in den Fächern Erdkunde, Geschichte, Politik an den Schulen mit bilingualen Zweigen wird unter "flexiblen Modulen" das fakultative, phasenhaft durchgeführte Angebot von Fachunterricht in der Fremdsprache in allen nicht-sprachlichen Fächern verstanden. Im Einzelnen können folgende Formen von flexiblen bilingualen Modulen unterschieden werden: 1. epochale Unterrichtsphasen mit einer Fremdsprache als Arbeitssprache im regulären Fachunterricht in einem breiten Spektrum von Fächern 2. fachbezogene Arbeitsgemeinschaften in der Fremdsprache 3. fachübergreifende bilinguale, inhaltlich orientierte Projekte oder entsprechende Projekte zum Methodenerwerb (Erarbeitung bestimmter sprachlicher Fertigkeiten (skills), um damit unterschiedliche fachliche Situationen fremdsprachlich bewältigen zu lernen (Beobachtungen versprachlichen, Experimente/Handlungsabfolgen beschreiben, Vergleiche und Bewertungen anstellen...) 4. der gezielte Einsatz der Fremdsprache als Arbeitssprache in Kleinprojekten/ grenzüberschreitenden Projekten: Internetprojekte, Projekte von Austauschmaßnahmen und internationalen Begegnungen, Betriebspraktika im Ausland. Ziele des Einsatzes flexibler bilingualer Module sind im Wesentlichen: die Ausweitung des fremdsprachlichen Handelns auf andere fachbezogene Anwendungsbereiche: an Schulen ohne bilingualen Zweig auf alle nicht-sprachlichen Fächer an Schulen mit bilingualen Zügen auf nicht-sprachliche Fächer, die nicht bereits als bilinguale Sachfächer angeboten werden
2 2 von :57 die Erweiterung der fremdsprachlichen Kompetenz bei der Bewältigung fachspezifischer Situationen und Anforderungen -2- die Vermittlung einer erhöhten Einsicht des Nutzens einer Fremdsprache in einem fachbezogenen Rahmen und damit Erhöhung der Motivation für das Lernen von Fremdsprachen die Verbesserung der Berufsvorbereitung durch den Kontakt mit fachspezifischem Französisch oder Englisch der Erwerb von Kenntnissen, die nicht nur beruflich verwendbar sind, sondern auch ein anderes Verständnis für die außersprachliche Wirklichkeit; Bewusstmachung von kulturellen Unterschieden, besonders in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern die zeitlich und inhaltlich flexible Anpassung an die Bedürfnisse der Schüler und an schulstandortspezifische Gegebenheiten (fremdsprachliche Unterstützung von Schwerpunktsetzungen z. B. im Rahmen des Schulprogramms). Bei der Durchführung dieser flexiblen bilingualen Module ist insbesondere die Durchführung von Sprach- und Textarbeit von entscheidender Bedeutung. Im Folgenden sollen Möglichkeiten und Grenzen von Sprach- und Textarbeit, wie sie in der konkreten unterrichtlichen Praxis durchgeführt wurden, sowie besondere Stützmaßnahmen und methodische Hilfen dargestellt werden. Dabei kann auf eigene Erfahrungen, Unterrichtsbeobachtungen und insbesondere auch auf Erfahrungen mit fachbezogenem Lernen mit Englisch als Fremdsprache in Österreich zurückgegriffen werden. Zum Schluss sollen zwei Unterrichtsreihen kurz vorgestellt werden, bei deren Durchführung wesentliche Prinzipien der Verknüpfung von Sprach- und Textarbeit berücksichtigt wurden: ein Modul in der Fremdsprache, das im regulären Erdkundeunterricht der Jahrgangsstufe 9 im nicht-bilingualen Zweig zum Thema Evry - ville nouvelle dans la région parisienne durchgeführt wurde ein Modul zum Chemieunterricht in der Fremdsprache Evolution des modèles atomiques à travers le temps, das von der Studienreferendarin Odile Hérold in der Jahrgangsstufe 9 im bilingualen Zweig einer Schule als erweiterter bilingualer Fachunterricht in einem "nicht-klassisch bilingualen" Fach durchgeführt wurde. 2. Möglichkeiten und Grenzen der Text- und Spracharbeit im Rahmen von flexiblen bilingualen Modulen Wichtige Grundprinzipien des bilingualen Unterrichtes können auf das sprachliche Handeln im Rahmen der flexiblen Module übertragen werden. Auch hier werden authentische Anwendungssituationen für fremdsprachliches Handeln geschaffen. Die Fremdsprache ist
3 3 von :57 nicht Gegenstand des Unterrichtes, sondern Vehikular- oder Arbeitssprache. Sie wird hier nur als Vehikel, als Instrument zum Transport von Informationen benutzt, die fachlichen Inhalte stehen im Vordergrund. Die Fremdsprache dient als Instrument zur Bewältigung fachbezogener Inhalte. Die Spracharbeit ist auch hier inhaltsorientiert, d. h., sie ist funktionalisiert. Die inhaltsbezogene Spracharbeit, die sprachliches Lernen mit methodischem und inhaltlichem Lernen verknüpft, hat zum Ziel, die Lernenden zu einer erhöhten fremdsprachlichen Flexibilität zu führen, und dies unter fachspezifischen Bedingungen. -3- Auch bei der Durchführung flexibler bilingualer Module werden Sprach- und Textarbeit miteinander verknüpft. Die inhaltsbezogene Spracharbeit wird ausgehend von der Rezeption von Texten sprachlicher und nicht-sprachlicher Zeichen organisiert. Insofern findet eine enge Verknüpfung von Sprach- und Textarbeit statt. Dabei werden bestimmte Methoden der Spracharbeit, der Textrezeption und der Textproduktion aus dem Fremdsprachen- und Deutschunterricht auf den Fachunterricht übertragen und mit fachlich relevanten Arbeitsweisen der Materialauswertung verknüpft. Texte sprachlicher Zeichen haben dabei eine andere Funktion als im Fremdsprachenunterricht. Sie sind ähnlich wie Statistiken, Diagramme, Schaubilder, Karten, Photos, Videos etc. nicht Ausgangspunkt für Sprachanalysen, sondern als Träger fachrelevanter Informationen Ausgangspunkt für die Informationsentnahme und Informationsverarbeitung. Dabei erfordert die Durchführung der Textarbeit im Rahmen von flexiblen bilingualen Modulen von den Unterrichtenden ein noch wesentlich sensibleres und behutsameres Vorgehen als im "klassischen" bilingualen Unterricht. Die Schüler verfügen in der Regel über deutlich geringere fremdsprachliche Kompetenzen als Schüler der bilingualen Zweige, und zwar insbesondere in den Bereichen Wortschatz, Redemittel, Umgang mit authentischen Materialien und mündliche Kommunikationsfähigkeit. Dabei ergibt sich wie in den Anfangsphasen des "klassisch" bilingualen Unterrichtes das Problem zwischen inhaltlich-fachlicher und sprachlicher Adäquatheit: Materialien, die dem sprachlichen Stand der Schüler entgegenkommen, sind oft inhaltlich zu anspruchslos. Ansonsten sind die Schüler bei inhaltlich altersadäquaten fremdsprachlichen Materialien oft sprachlich überfordert. Authentische Texte sprachlicher Zeichen bieten oft sprachliche Stützen für die Versprachlichung der Ergebnisse der Auswertung in der Fremdsprache, sind aber schwer auswertbar, weil sie die Schüler sprachlich oft deutlich überfordern. Authentische Texte nicht-sprachlicher Zeichen sind für die Schüler oft leichter auswertbar, jedoch ist die Verbalisierung der gewonnenen Informationen in der Fremdsprache schwieriger, weil häufiger nur die Legenden sprachliche Stützen darstellen. So kann der Unterricht im Rahmen flexibler Module nicht nur bei der ersten Erprobung eines Moduls lediglich sporadisch in der Fremdsprache erfolgen. In Phasen der Planung von Lernwegen und der Evaluation der Arbeitsergebnisse und -prozesse werden weite Teile in der Muttersprache durchgeführt werden müssen. Besondere Probleme bereiten auch die jeweiligen Lernvoraussetzungen der Schüler, die besonders bei der Durchführung von jahrgangsstufenübergreifenden Arbeitsgemeinschaften und Projekten je nach Lernstufe sehr unterschiedlich sind, so dass der Unterrichtende eine genaue Bestandsaufnahme der jeweiligen Kenntnisse und Kompetenzen machen, sehr flexibel auf die jeweils unterrichtliche Situation reagieren und entsprechende Stützmaßnahmen und methodische Hilfen einplanen muss.
4 4 von :57 3. Stützmaßnahmen und methodische Hilfen für die Durchführung von Sprach- und Textarbeit Eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Durchführung flexibler bilingualer Module ist, dass Sprach- und Sachfachlehrer eng miteinander kooperieren. Häufig werden die flexiblen bilingualen Module vom Sachfachlehrer gemeinsam mit dem Fremdsprachenlehrer durchgeführt, besonders im Rahmen der Projektarbeit. Meist ist der Sachfachlehrer auch Fremdsprachenlehrer, was die Planung und Durchführung solcher flexiblen Module erleichtert. Führt ein Sachfachlehrer, der kein Fremdsprachenlehrer ist, allein phasenweise Fachunterricht in der Fremdsprache oder ein bilinguales Projekt durch, sollte er über überdurchschnittliche Fremdsprachenkenntnisse und auch angemessene fremdsprachendidaktische Kompetenzen verfügen und in Kooperation mit dem Fremdsprachenlehrer der jeweiligen Lerngruppe seinen Unterricht zumindest planen. -4- Bei der Auswahl der Stoffe sollte darauf geachtet werden, dass auf Themen mit frankophonem Bezug zurückgegriffen wird und auf solche, die sich für ein fachübergreifendes Arbeiten anbieten. Es kann nicht darum gehen, wahllos ein Thema aufzugreifen und fremdsprachlich "abzuhandeln". Stets ist wichtig zu überlegen, aus welchen Gründen der Einsatz der Fremdsprache motiviert ist. Auf sinnvolle Stoffreduzierung, klare Schwerpunktsetzung und Eingrenzung des Stoffes sollte geachtet werden. Neben der Auswahl motivierender Themen und Inhalte sollte der Einsatz authentischer Materialien sowie vielfältiger Medien und Arbeitsmittel die Motivation der Schüler aufbauen und erhalten. In der Regel müssen die Unterrichtsmaterialien mit großer Sorgfalt ausgesucht und zusammengestellt werden. Für die Textarbeit werden nach Möglichkeit nicht nur Instruktionstexte in der Fremdsprache (z. B. die Beschreibung eines Versuchs, eines Experimentes) ausgewählt, sondern vielfältige authentische Textformen: Reiseberichte, Erlebnisberichte, Zeitungsartikel, Leserbriefe, Gutachtertexte, politische Reden, Programme, Pamphlete, Wahlplakate, Werbetexte, satirische, politische Lieder (Chansons) usw. Zudem sollte der überlegte und gezielte Einsatz von audiovisuellen Materialien und geeigneten Computerprogrammen erfolgen. Um mehrere informationsverarbeitende Kanäle bei den Lernenden zu nutzen und die Textverarbeitung, das Verknüpfen mit dem Vorwissen und die Behaltensleistung zu fördern, sollte der Einsatz von Karrikaturen, Graphiken, Photos sowie Hörtexten (z. B. Interviews) und Videos die Textarbeit vorbereiten, begleiten und vertiefend nachbereiten. Da der sprachliche Schwierigkeitsgrad der authentischen Texte das Leistungsniveau der Schüler häufiger nicht nur leicht überfordert, ist die sprachliche Vorbereitung auf das Lesen des Textes und die Verbalisierung der Inhalte besonders wichtig. Folgende Stützmaßnahmen bieten sich hier besonders an: die freie oder bildgestützte Reaktivierung des sprachlichen Vorwissens durch Brainstorming-Verfahren (mindmapping, clustering...) oder durch motivierende Wortschatzübungen (mots croisés, maximots...) (vgl. Beispiel 1) [Achtung: Grosse
5 5 von :57 Datei: 128 MB] die Bereitstellung von zweisprachigen Wortschatzlisten mit themenspezifischem fachorientiertem Vokabular (vgl. doc. Beispiel 2 [82 MB], Beispiel 3 [68 MB], Beispiel 4 [24 MB], Beispiel 5 [18MB], Beispiel 6 [24 MB]) die Bereitstellung von elementaren Redemittellisten zum Beschreiben, Erklären, Vergleichen, Schlussfolgern, Bewerten von Sachverhalten (vgl. Beispiel 7 [Grosse Datei: 161 MB], Beispiel 8 [67 MB]) die Bereitstellung von Redemittellisten zum Klassenzimmerdiskurs die Bereitstellung von Redemitteln zur Durchführung von Experimenten, Befragungen, Interviews, Erkundungen die Bereitstellung von zweisprachigen Wörterbüchern (die Arbeit mit einsprachigen Wörterbüchern mit sachfachlich wenig relevanten Definitionen bietet sich weniger an; die Arbeit mit Fachwörterbüchern würde die Schüler sprachlich im Allgemeinen überfordern) die Erläuterung nicht behandelter grammatischer Phänomene, um das Textverständnis zu erleichtern bzw. zu ermöglichen. -5- Zudem sollte der Unterrichtende Tipps geben, die den Arbeitsprozess fördern und erleichtern, z. B. Arbeitsanweisungen, die das methodische Vorgehen unterstützen, oder Fragestellungen, die den Blick der Schüler auf relevante Informationen lenken, oder er sollte Auswertungsgitter zur Verfügung stellen. Zudem sollte er in Kooperation mit dem Sprachlehrer Arbeitstechniken vermitteln bzw. auf diese zurückgreifen, die das selbständige Arbeiten der Schüler fördern. Diese Techniken müssen vor der Durchführung flexibler bilingualer Module im Sprachunterricht eingeführt bzw. eingeübt sein: Techniken, mit deren Hilfe vor der Texterschließung bereits vorhandenes themenoder sachbezogenes Wissen der Schüler aktiviert bzw. die Aufmerksamkeit auf konkrete Problemstellungen oder inhaltliche Fragestellungen gelenkt wird: Brainstorming-Verfahren, Aufstellen von Hypothesen über den Textinhalt auf der Grundlage z. B. von Überschriften oder von den Text begleitenden Bildmaterialien; Worterschließungstechniken: das Inferieren von Wortbedeutungen mit Hilfe des sprachlichen Vorwissens (in der Muttersprache, in der Fremdsprache, in anderen Fremdsprachen), des Weltwissens und des Kontextwissens (hier muss der Fremdsprachenunterricht wichtige Voraussetzungen schaffen: Wiedererkennen von Wortformen, Segmentieren von Wörtern, Kennen der Bedeutungen von Präfixen und Suffixen, Kennen von Wortbildungsregeln usw.) (vgl. Beispiel 9 [24MB]); Techniken zur Arbeit mit Wörterbüchern: Finden der Wortformen, Ermitteln der
6 6 von :57 jeweiligen Kontextbedeutungen der Wörter durch Kontextvergleich; Finden von Formulierungshilfen; Techniken des überfliegenden Lesens (scanning, skimming: Erfassen der wichtigsten Informationen über Verstehensinseln) und des detaillierten Lesens, darunter auch Techniken, mit deren Hilfe das Erkennen bzw. Verarbeiten von (satz-)übergreifenden Gedanken- und Argumentationsstrukturen unterstützt werden kann; Techniken des note-taking oder note-making, die auch die mündliche und schriftliche Textproduktion vorbereiten; Visualisierungstechniken: Zeichnen von Bildern (besonders in unteren Lernstufen), Anfertigen von Skizzen, Erarbeiten von Flussdiagrammen oder Organigrammen zur Verdeutlichung von Ursache-Wirkungszusammenhängen und zur Integration des aus dem Text erschlossenen Wissens in das vorhandene Vorwissen in visueller Form zur übersichtlichen Darstellung von Inhalten, die die Textproduktion vorbereitet (vgl. Beispiel 10 [Grosse Datei: 147 MB]); Schreibtechniken: Bereitstellungstechniken, Gliederungstechniken, Formulierungstechniken, Korrektur- und Überarbeitungstechniken (vgl. Beispiel 11 [24 MB]); Techniken der mündlichen Kommunikation, die im Fremdsprachenunterricht aufgebaut sein sollten: Techniken des Paraphrasierens, Übersetzens und Dolmetschens, Techniken des Verhandelns, Techniken des Korrigierens, Darstellungstechniken, Techniken des code-switching (besonders in den frühen Lernstufen). -6- Im Unterrichtsgespräch sollte auf strikte Einsprachigkeit verzichtet werden. Der funktionale Einsatz der Muttersprache bei Verständigungsschwierigkeiten, bei der Auswertung der Materialien, besonders bei der Versprachlichung schwierigerer komplexer Sachverhalte, ist absolut erforderlich. Ziel ist zwar auch hier die möglichst breite Verwendung der Fremdsprache, was aber nicht dogmatische Einsprachigkeit erfordert: So ist es üblich, in unteren Lernstufen wichtige Informationen in Deutsch zusammenzufassen, zu übersetzen, zu erklären. Auch die Beschreibung und Evaluation von Lernwegen und Arbeitsprozessen sollte in unteren Lernstufen in der Muttersprache erfolgen. Die Muttersprache sollte auch bei der Arbeit mit thematisch relevanten muttersprachlichen Materialien verwendet werden. In flexiblen bilingualen Modulen in den unteren Lernstufen bietet sich der Einsatz der Muttersprache auch an, um Schwellenängste abzubauen. Da die rezeptiven Fähigkeiten (Hören und Lesen) in einer Fremdsprache generell größer sind als die produktiven (Schreiben, Sprechen), sollte die Lehrkraft in den meisten Fällen die Fremdsprache verwenden. Allerdings ist es wenig sinnvoll und nicht möglich, allgemeingültige Richtlinien für den Gebrauch der Muttersprache zu erstellen. Jede Lehrkraft sollte sich hier auf das eigene Gespür und pädagogische Geschick verlassen (vgl. Abuja und Heindler, 1993, S. 19).
7 7 von :57 Die Fehlertoleranz gegenüber der fremdsprachlichen Leistung muss erhöht werden. Auch code-switching sollte erlaubt werden, um den Erfolg des flexiblen bilingualen Moduls zu ermöglichen. In unteren Lernstufen sollten fachsprachliche Elemente sehr behutsam in den produktiven Wortschatz überführt werden. Der Rückgriff auf allgemeinsprachliche sachfachorientierte Ausdrücke sollte nicht nur toleriert, sondern in besonderem Maße gefördert werden, um Kommunikation in der Fremdsprache im Unterrichtsgespräch anzubahnen. Die sinnvolle Einbeziehung muttersprachlicher Frankophoner sollte gewährleistet sein. Die Begegnung mit native speaker sollte bei der Durchführung der Module in besonderem Maße gefördert werden, um die Kommunikation in der Fremdsprache aufzubauen. Erfahrungen haben aber gezeigt, dass erst in späteren Lernstufen (frühestens ab dem 3. Lernjahr in der Fremdsprache) der Unterricht in kürzeren oder längeren Phasen gänzlich in der Fremdsprache geführt wird. Unterrichtsmethodisch sollten Phasen selbständigen Arbeitens, vor allem Gruppen- und Partnerarbeiten besonders häufig eingeplant werden. Zudem sollten die Ergebnisse der Erarbeitungsphasen besonders nachhaltig gesichert werden. Wiederholungen und daraus erwachsenen Erweiterungen sollte mehr Raum gewährt werden als im "klassischen" bilingualen Unterricht, damit besonders schwächere Schüler die Inhalte mehrfach erfassen und für sich strukturieren. 4. Fazit und Ausblick -7- Die Durchführung flexibler bilingualer Module wird im Allgemeinen dadurch erschwert, dass die Schüler ein geringeres deklaratives und prozedurales Sprachwissen haben als Schüler, die einen bilingualen Bildungsgang absolvieren. Zudem stellt bei der Durchführung jahrgangsstufen-übergreifender Projekte oder Arbeitsgemeinschaften die Heterogenität der jeweiligen Lerngruppen besondere Anforderungen an den Unterrichtenden. Er muss sehr flexibel auf die jeweilige unterrichtliche oder außerunterrichtliche Situation reagieren, eng mit dem jeweiligen Fremdsprachenlehrer zusammenarbeiten, die Themen und die Dokumente sehr sorgfältig auswählen und entsprechende Maßnahmen und Hilfen bereitstellen, die den Arbeitsprozess unterstützen. Dies erfordert besondere didaktisch-methodische Kompetenzen von Seiten der Unterrichtenden. Während an Schulen im Ausland wie in Österreich bereits langjährige Erfahrungen mit der Durchführung flexibler bilingualer Module vorliegen, werden solche Module in Deutschland zurzeit noch sporadisch und ohne große Erfahrungen auf Seiten der Unterrichtenden durchgeführt. Die Ausweitung von bilingualem Unterricht und der Erfolg solcher flexibler bilingualer Module wird aber nicht zuletzt von der Weiterbildung dazu bereiter Kollegen und von der Ausbildung neuer Lehrer abhängen. Neben der Ausbildung von Studierenden an den Universitäten Bochum und Wuppertal wird am Studienseminar in Bonn versucht, im Rahmen des Innovationsschwerpunktes "Erziehung zur Mehrsprachigkeit" Studienreferendare auf die Durchführung solcher Module vorzubereiten. Hierzu werden neben dem "klassisch bilingualen" Fachseminar "Geschichte in Englisch" Blockveranstaltungen zu den Themenfeldern "Jeder Unterricht ist auch Sprachunterricht" und "Interkulturelle Dimensionen des Lernens" sowie eine Arbeitsgemeinschaft "Fachunterrricht in der Fremdsprache" angeboten. Zudem führen die Studienreferendare an den Ausbildungsschulen Unterrichtsversuche und Unterrichtsprojekte in Zusammenarbeit mit dem Fachleiter
8 8 von :57 Französisch oder Englisch, bzw. mit dem Fachleiter des jeweils nicht-sprachlichen Faches und dem Hauptseminarleiter durch, um die erworbenen Kenntnisse in der Praxis zu erproben und angemessene Kompetenzen aufzubauen, die es ihnen erlauben, flexible bilinguale Module erfolgreich zu planen, zu realisieren und zu evaluieren. Literaturverzeichnis Abuja, Gunther & Heindler, Dagmar. (Hrsg.). (1993). Englisch als Arbeitssprache. Fachbezogenes Lernen von Fremdsprachen (= Berichte des Zentrums für Schulversuche und Schulentwicklung, Reihe III). Graz: Zentrum für Schulversuche und Schulentwicklung Abteilung III. Christ, Ingeborg. (1992). Bilingualität in der Schule, Chance oder Notwendigkeit im Europa der Zukunft? In Goethe-Institut (Hrsg.). (1992). Grenzübergreifender Sprachunterricht 1 (S ). Amsterdam: Goethe Institut. Coste, Daniel. (1994). L'enseignement bilingue dans tous ses états. Etudes en Linguistique Appliquée, 96, Helbig, Beate. (1998). Lern- und Arbeitstechniken im bilingualen Sachfachunterricht aufgezeigt am Beispiel von Texterschließungsstrategien (Sekundarstufe 1). Der Fremdsprachliche Unterricht Französisch, 34, Krechel, Hans-Ludwig. (1995). Inhaltsbezogene Spracharbeit im bilingualen Sachfach Erdkunde. Triangle, 13, Krechel, Hans-Ludwig. (1999). Methodological aspects of content-based language work in bilingual education. In Bettina Mißler & Uwe Multhaup. (Hrsg.). (1999). The construction of knowledge, learner autonomy and related issues in foreign language learning. Essays in honour of Dieter Wolff (S ). Tübingen: Stauffenburg. Krechel, Hans-Ludwig. (1999). Der Einsatz von Lern- und Arbeitstechniken im bilingualen Unterricht - ein Beispiel für fächerübergreifendes methodisches Arbeiten. In Hans-Ludwig Krechel, Marx, Diemo & Franz-Josef Meißner. (Hrsg.). (1999). Kognition und neue Praxis im Französischunterricht (S ). Tübingen: Gunter Narr. Krechel, Hans-Ludwig & Wolff, Dieter. (1995). Rapport de l'enquête sur les techniques d'apprentissage et de travail dans les classes bilingues en Allemagne. In Conseil de l'europe. (Hrsg.). (1995). Second progress report of the research and development programme of workshop 12 A. (S , S ). Strasburg: Conseil de l'europe. Mäsch, Nando. (1993). Grundsätze des bilingual deutsch-französischen Bildungsganges an Gymnasien in Deutschland. Der fremdsprachliche Unterricht Französisch, 9, 4-8.
9 9 von :57 Ministerium für Schule, Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung NRW. (Hrsg.). (1998). Zweisprachiger Unterricht. Bilinguale Bildungsangebote in Nordrhein-Westfalen. Frechen: Ritterbach. Otten, Edgar & Thürmann, Eike. (1993). Bilinguales Lernen in Nordrhein-Westfalen: ein Werkstattbericht - Konzepte, Probleme, Lösungsversuche. Die Neueren Sprachen, 1/2, Copyright 1999 Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht Krechel, Hans-Ludwig. (1999). Sprach- und Textarbeit im Rahmen von flexiblen bilingualen Modulen. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht [Online], 4(2), 8 pp. Available: [Zurück zur Leitseite der Nummer im Archiv]
Bilingualer Unterricht: Bestandsaufnahme und Perspektiven
 Dr.. Hans-Ludwig Krechel Studienseminar Bonn Bilingualer Unterricht: Bestandsaufnahme und Perspektiven 1. Entwicklung des bilingualen Unterrichtes in Deutschland 2. Didaktisch-methodische Orientierungen
Dr.. Hans-Ludwig Krechel Studienseminar Bonn Bilingualer Unterricht: Bestandsaufnahme und Perspektiven 1. Entwicklung des bilingualen Unterrichtes in Deutschland 2. Didaktisch-methodische Orientierungen
Praxis des bilingualen Unterrichts
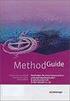 Manfred Wildhage Edgar Otten (Hrsg.) Praxis des bilingualen Unterrichts fornelsen SCRIPTOR Inhaltsverzeichnis Vorwort 10 I. Einführung 1. Content and Language Integrated Learning Eckpunkte einer kleinen"
Manfred Wildhage Edgar Otten (Hrsg.) Praxis des bilingualen Unterrichts fornelsen SCRIPTOR Inhaltsverzeichnis Vorwort 10 I. Einführung 1. Content and Language Integrated Learning Eckpunkte einer kleinen"
Vorschriften für die Ausbildung für den Unterricht in bilingualen Sachfächern im Rahmen des Vorbereitungsdienstes
 Vorschriften für die Ausbildung für den Unterricht in bilingualen Sachfächern im Rahmen des Vorbereitungsdienstes Vom 25. November 1998 (GMBl. Saar 1990, S. 26), zuletzt geändert am 20. Juli 2004 (Amtsbl.
Vorschriften für die Ausbildung für den Unterricht in bilingualen Sachfächern im Rahmen des Vorbereitungsdienstes Vom 25. November 1998 (GMBl. Saar 1990, S. 26), zuletzt geändert am 20. Juli 2004 (Amtsbl.
Bilingualer Sachfachunterricht. Chancen und Herausforderungen Ein Einblick in theoretische Hintergründe
 Bilingualer Sachfachunterricht Chancen und Herausforderungen Ein Einblick in theoretische Hintergründe Bilingualer Sachfachunterricht 1. Begriffe und Definitionen 2. Rahmenbedingungen des bilingualen Sachfachunterrichts
Bilingualer Sachfachunterricht Chancen und Herausforderungen Ein Einblick in theoretische Hintergründe Bilingualer Sachfachunterricht 1. Begriffe und Definitionen 2. Rahmenbedingungen des bilingualen Sachfachunterrichts
1. Kommunikative Kompetenzen
 Schulinternes Curriculum im Fach Englisch Bilinguale Profilklasse Jahrgangsstufe 5 Stand Oktober 2013 Zunächst orientiert sich das schulinterne Curriculum und die Leistungsbewertung für die englische Profilklasse
Schulinternes Curriculum im Fach Englisch Bilinguale Profilklasse Jahrgangsstufe 5 Stand Oktober 2013 Zunächst orientiert sich das schulinterne Curriculum und die Leistungsbewertung für die englische Profilklasse
Bilingual für alle. Bilingualer Unterricht für alle Unterrichtsentwicklung und Zertifizierung im neu geregelten bilingualen Unterricht
 Bilingualer Unterricht für alle Unterrichtsentwicklung und Zertifizierung im neu geregelten bilingualen Unterricht Gliederung Der bilinguale Unterricht und seine Umsetzung in der S I Organisation Zertifikation
Bilingualer Unterricht für alle Unterrichtsentwicklung und Zertifizierung im neu geregelten bilingualen Unterricht Gliederung Der bilinguale Unterricht und seine Umsetzung in der S I Organisation Zertifikation
Leistungsnachweise und Modulprüfungen im Fach Französisch (PO 2015) MA Studiengang Sekundarstufe I
 Leistungsnachweise und en im Fach Französisch (PO 2015) Die Abteilung Französisch hat folgende Regelungen über Form und der en beschlossen. Diese haben ab WS 2018/19 Gültigkeit (Stand: 01.10.2018): 1.
Leistungsnachweise und en im Fach Französisch (PO 2015) Die Abteilung Französisch hat folgende Regelungen über Form und der en beschlossen. Diese haben ab WS 2018/19 Gültigkeit (Stand: 01.10.2018): 1.
Bilingualer Unterricht (CLIL) theoretische und didaktische Grundlagen
 Spaß mit Deutsch in Thessaloniki 13. Dezember 2009 Bilingualer Unterricht (CLIL) theoretische und didaktische Grundlagen Angelos Bandas Deutschlehrer-Mitarbeiter im Zentrum für die Griechische Sprache
Spaß mit Deutsch in Thessaloniki 13. Dezember 2009 Bilingualer Unterricht (CLIL) theoretische und didaktische Grundlagen Angelos Bandas Deutschlehrer-Mitarbeiter im Zentrum für die Griechische Sprache
Inhalte Wahlfachseminar Englisch auf 6 Ausbildungs-Quartale (18 Monate VD = 60 Kw = ca. 30 Seminarsitzungen = 5 pro Quartal)
 Inhalte Wahlfachseminar Englisch auf 6 Ausbildungs-Quartale (18 Monate VD = 60 Kw = ca. 30 Seminarsitzungen = 5 pro Quartal) Quartal Handlungssituation Erschließungsfragen Fachliche Ausbildungsinhalte
Inhalte Wahlfachseminar Englisch auf 6 Ausbildungs-Quartale (18 Monate VD = 60 Kw = ca. 30 Seminarsitzungen = 5 pro Quartal) Quartal Handlungssituation Erschließungsfragen Fachliche Ausbildungsinhalte
Fächerübergreifender Unterricht Deutsch Erdkunde
 EWA DOROTA MIARECZKO Fächerübergreifender Unterricht Deutsch Erdkunde Jak realizować tzw. ścieżki międzyprzedmiotowe? Nauczanie zintegrowane; język obcy- przedmiot niejęzykowy Der traditionelle bilinguale
EWA DOROTA MIARECZKO Fächerübergreifender Unterricht Deutsch Erdkunde Jak realizować tzw. ścieżki międzyprzedmiotowe? Nauczanie zintegrowane; język obcy- przedmiot niejęzykowy Der traditionelle bilinguale
Fachunterricht in Französisch. flexiblen bilingualen Modulen
 Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen Fachunterricht in Französisch im Rahmen von flexiblen bilingualen Modulen H a n d r e i c h u n g 2 Herausgeber: Ministerium
Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen Fachunterricht in Französisch im Rahmen von flexiblen bilingualen Modulen H a n d r e i c h u n g 2 Herausgeber: Ministerium
nete von Droste-Hülsh n AvD o A f Gymnasium
 AvD Annette von Droste-Hülshoff Gymnasium 2 3 Bilingualer Bildungsgang ab Klasse 5 schafft ein Bewusstsein für unterschiedliche Begrifflichkeiten und Konzepte Was ist eigentlich bilingualer Unterricht?
AvD Annette von Droste-Hülshoff Gymnasium 2 3 Bilingualer Bildungsgang ab Klasse 5 schafft ein Bewusstsein für unterschiedliche Begrifflichkeiten und Konzepte Was ist eigentlich bilingualer Unterricht?
Gymnasium der Stadt Frechen FK Spanisch
 Gymnasium der Stadt Frechen FK Spanisch Vereinbarungen zur Leistungsbewertung Die Vereinbarungen zur Leistungsbewertung für das Fach Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache beruhen auf den Vorgaben der
Gymnasium der Stadt Frechen FK Spanisch Vereinbarungen zur Leistungsbewertung Die Vereinbarungen zur Leistungsbewertung für das Fach Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache beruhen auf den Vorgaben der
D F U. Dr. Katalin Árkossy ELTE Germanistisches Institut Budapest
 D F U Dr. Katalin Árkossy ELTE Germanistisches Institut Budapest Deutschsprachiger Fachunterricht D F U Deutschsprachiger Fachunterricht (das Unterrichten von Sachfächern in einer Fremdsprache) ist ein
D F U Dr. Katalin Árkossy ELTE Germanistisches Institut Budapest Deutschsprachiger Fachunterricht D F U Deutschsprachiger Fachunterricht (das Unterrichten von Sachfächern in einer Fremdsprache) ist ein
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus
 Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 80327 München An alle Gymnasien in Bayern Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom Unser Zeichen
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 80327 München An alle Gymnasien in Bayern Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom Unser Zeichen
Bilingualer Unterricht. (Biologie auf Englisch)
 Bilingualer Unterricht (Biologie auf Englisch) Stand: Dezember 2014 Inhaltsverzeichnis 2 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 2 1 Vorbemerkung... 3 2 Bilingualer Unterricht am Theodor-Heuss-Gymnasium...
Bilingualer Unterricht (Biologie auf Englisch) Stand: Dezember 2014 Inhaltsverzeichnis 2 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 2 1 Vorbemerkung... 3 2 Bilingualer Unterricht am Theodor-Heuss-Gymnasium...
Das bilinguale Eduard-Nebelthau-Gymnasium. Ein Konzept.
 Ab August 2010 wird eine neue Rechtslage für den bilingualen Unterricht in Bremen vorliegen, die bisher noch nicht veröffentlicht wurde. Das bilinguale Eduard-Nebelthau-Gymnasium. Ein Konzept. Bremen,
Ab August 2010 wird eine neue Rechtslage für den bilingualen Unterricht in Bremen vorliegen, die bisher noch nicht veröffentlicht wurde. Das bilinguale Eduard-Nebelthau-Gymnasium. Ein Konzept. Bremen,
Bilingualer Unterricht in Deutschland
 Bilingualer Unterricht in Deutschland Entwicklungstendenzen Konsolidierung: Lehrpläne Didaktische Grundlagen Ausbildung Materialentwicklung Flexibilisierung: Sprachen Sachfächer Schulformen Modularisierung
Bilingualer Unterricht in Deutschland Entwicklungstendenzen Konsolidierung: Lehrpläne Didaktische Grundlagen Ausbildung Materialentwicklung Flexibilisierung: Sprachen Sachfächer Schulformen Modularisierung
Bilingualer Unterricht an der Pestalozzischule
 Bilingualer Unterricht an der Pestalozzischule Der bilinguale Unterricht, d.h. der Sachfachunterricht in zwei Arbeitssprachen (Englisch als Zielsprache und Deutsch) wird bereits seit dem Schuljahr 2010/2011
Bilingualer Unterricht an der Pestalozzischule Der bilinguale Unterricht, d.h. der Sachfachunterricht in zwei Arbeitssprachen (Englisch als Zielsprache und Deutsch) wird bereits seit dem Schuljahr 2010/2011
Herderschule Gymnasium der Universitätsstadt Gießen gegründet Informationen zum Bilingualen Unterricht
 Herderschule Gymnasium der Universitätsstadt Gießen gegründet 1837 Informationen zum Bilingualen Unterricht Bilingualer Unterricht an der Herderschule Bilingualer Unterricht Was ist das? Bilingualer Unterricht
Herderschule Gymnasium der Universitätsstadt Gießen gegründet 1837 Informationen zum Bilingualen Unterricht Bilingualer Unterricht an der Herderschule Bilingualer Unterricht Was ist das? Bilingualer Unterricht
Zur Entwicklung von Curricula für f den bilingualen Sachfachunterricht
 Prof. Dr. em. Dieter Wolff Bergische Universität Wuppertal Email: wolff.dieter@t-online.de Zur Entwicklung von Curricula für f den bilingualen Sachfachunterricht (London, 12.02.2009) Gliederung 1 Gründe
Prof. Dr. em. Dieter Wolff Bergische Universität Wuppertal Email: wolff.dieter@t-online.de Zur Entwicklung von Curricula für f den bilingualen Sachfachunterricht (London, 12.02.2009) Gliederung 1 Gründe
CLIL IN DER UKRAINE: EIN- UND AUSBLICKE ZUR TRANSDISZIPLINÄREN LEHRERFORTBILDUNG 2017 IN KIEW. DAGMAR OSTERLOH, Kiew,
 CLIL IN DER UKRAINE: EIN- UND AUSBLICKE ZUR TRANSDISZIPLINÄREN LEHRERFORTBILDUNG 2017 IN KIEW DAGMAR OSTERLOH, Kiew, 13.10.2017 dd.osterloh@mail.de HISTORIE RAHMENBEDINGUNGEN PRÄMISSEN ZIELSETZUNGEN Max-Weber-Haus,
CLIL IN DER UKRAINE: EIN- UND AUSBLICKE ZUR TRANSDISZIPLINÄREN LEHRERFORTBILDUNG 2017 IN KIEW DAGMAR OSTERLOH, Kiew, 13.10.2017 dd.osterloh@mail.de HISTORIE RAHMENBEDINGUNGEN PRÄMISSEN ZIELSETZUNGEN Max-Weber-Haus,
Gesamtschule Hennef-West. Bilingualer Bildungsgang Englisch
 Gesamtschule Hennef-West Bilingualer Bildungsgang Englisch Ziele des en Unterrichts erhöhte Sprachkompetenz Ziele des Sachfachunterrichts Erwerb interkultureller Kompetenz, d.h. die Schülerinnen u. Schüler
Gesamtschule Hennef-West Bilingualer Bildungsgang Englisch Ziele des en Unterrichts erhöhte Sprachkompetenz Ziele des Sachfachunterrichts Erwerb interkultureller Kompetenz, d.h. die Schülerinnen u. Schüler
Krechel Studienseminar Bonn
 Dr. Hans-Ludwig Krechel Studienseminar Bonn Qualitätsstandards tsstandards bilingualen Unterrichts am Beispiel des Exzellenzlabels CertiLingua für r mehrsprachige, europäische und internationale Kompetenzen
Dr. Hans-Ludwig Krechel Studienseminar Bonn Qualitätsstandards tsstandards bilingualen Unterrichts am Beispiel des Exzellenzlabels CertiLingua für r mehrsprachige, europäische und internationale Kompetenzen
Bilingualer Geschichtsunterricht am Erftgymnasium. Hr. Dehne,
 Bilingualer Geschichtsunterricht am Erftgymnasium Hr. Dehne, 12.04.2018 Inhalt 1. Bilingualer Geschichtsunterricht eine Definition 2. Hauptziele des bilingualen Geschichtsunterrichts 3. Gründe für bilingualen
Bilingualer Geschichtsunterricht am Erftgymnasium Hr. Dehne, 12.04.2018 Inhalt 1. Bilingualer Geschichtsunterricht eine Definition 2. Hauptziele des bilingualen Geschichtsunterrichts 3. Gründe für bilingualen
Schuleigener Arbeitsplan im Fach Französisch für die Jahrgangsstufen 6-10
 Schuleigener Arbeitsplan im Fach Französisch für die Jahrgangsstufen 6-10 Gymnasium Marianum Meppen (Stand: August 2016) Einleitende Bemerkungen Der niedersächsische Bildungsserver (NiBis) hält zu den
Schuleigener Arbeitsplan im Fach Französisch für die Jahrgangsstufen 6-10 Gymnasium Marianum Meppen (Stand: August 2016) Einleitende Bemerkungen Der niedersächsische Bildungsserver (NiBis) hält zu den
Hermann Hesse-Gymnasium Calw. Schulcurriculum Englisch. Zielsetzung - 1
 Zielsetzung Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der englischen Sprache im Alltag nimmt das Fach Englisch als 1. Fremdsprache eine herausragende Stellung ein. Die Schulcurricula zielen auf eine ständig sich
Zielsetzung Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der englischen Sprache im Alltag nimmt das Fach Englisch als 1. Fremdsprache eine herausragende Stellung ein. Die Schulcurricula zielen auf eine ständig sich
Bilingualer Unterricht. Schwerpunkt im Fach Erdkunde
 Schwerpunkt im Fach Erdkunde 28 an der Realschule Krautheim 1. Was ist das eigentlich? bedeutet, dass ein Sachfach in einer Fremdsprache (an deutschen Schulen in der Regel Englisch) unterrichtet wird.
Schwerpunkt im Fach Erdkunde 28 an der Realschule Krautheim 1. Was ist das eigentlich? bedeutet, dass ein Sachfach in einer Fremdsprache (an deutschen Schulen in der Regel Englisch) unterrichtet wird.
Modulhandbuch Studiengang Master of Education (Lehramt) Französisch, HF Prüfungsordnung:
 Modulhandbuch Studiengang Master of Education (Lehramt) Französisch, HF Prüfungsordnung: 659-1-2017 Sommersemester 2018 Stand: 09. April 2018 Universität Stuttgart Keplerstr. 7 70174 Stuttgart Kontaktpersonen:
Modulhandbuch Studiengang Master of Education (Lehramt) Französisch, HF Prüfungsordnung: 659-1-2017 Sommersemester 2018 Stand: 09. April 2018 Universität Stuttgart Keplerstr. 7 70174 Stuttgart Kontaktpersonen:
Der Bilinguale Zweig am SGR
 Der Bilinguale Zweig am SGR 1 Städtisches Gymnasium Rheinbach mit deutsch-englischem bilingualem Zweig Fachunterricht in nicht-sprachlichen Fächern, in dem überwiegend eine Fremdsprache für den fachlichen
Der Bilinguale Zweig am SGR 1 Städtisches Gymnasium Rheinbach mit deutsch-englischem bilingualem Zweig Fachunterricht in nicht-sprachlichen Fächern, in dem überwiegend eine Fremdsprache für den fachlichen
Arbeitsmarkt Deutsch lehren
 Arbeitsmarkt Deutsch lehren Schlüsselqualifikationen Fremdsprachen und Interkulturelle Kompetenz 26.05.2010 Birgit Kraus 1 Gliederung Was sind Schlüsselqualifikationen? Warum sind Schlüsselqualifikationen
Arbeitsmarkt Deutsch lehren Schlüsselqualifikationen Fremdsprachen und Interkulturelle Kompetenz 26.05.2010 Birgit Kraus 1 Gliederung Was sind Schlüsselqualifikationen? Warum sind Schlüsselqualifikationen
Deutsch als Fremdsprache
 Dietmar Rösler Deutsch als Fremdsprache Eine Einführung Mit 46 Abbildungen Verlag J. B. Metzler Stuttgart Weimar Dank XI Einleitung 1 1. Lernende und Lehrende 5 1.1 Die Lernenden 5 1.1.1 Die Vielfalt der
Dietmar Rösler Deutsch als Fremdsprache Eine Einführung Mit 46 Abbildungen Verlag J. B. Metzler Stuttgart Weimar Dank XI Einleitung 1 1. Lernende und Lehrende 5 1.1 Die Lernenden 5 1.1.1 Die Vielfalt der
Verpflich tungsgrad. Voraussetzung für die Teilnahme. Modulbezeichnung Englischer Modultitel Modul 1. Niveaustufe. für die Vergabe von LP
 Anlage 2: Modulliste Modulbezeichnung Englischer Modultitel Modul 1 Grundwissen Deutsch als Fremdsprache Fundamentals of German as a Foreign Language LP Verpflich tungsgrad Niveaustufe 9 Pflicht Basismodul
Anlage 2: Modulliste Modulbezeichnung Englischer Modultitel Modul 1 Grundwissen Deutsch als Fremdsprache Fundamentals of German as a Foreign Language LP Verpflich tungsgrad Niveaustufe 9 Pflicht Basismodul
EUROKOM. "Europäische Kommunikationsfähigkeit" Schriftliche Abschlussprüfung an der Realschule
 EUROKOM "Europäische Kommunikationsfähigkeit" Schriftliche Abschlussprüfung an der Realschule Weiterentwicklung - warum? Veränderte Anforderungen durch das Zusammenwachsen Europas die Internationalisierung
EUROKOM "Europäische Kommunikationsfähigkeit" Schriftliche Abschlussprüfung an der Realschule Weiterentwicklung - warum? Veränderte Anforderungen durch das Zusammenwachsen Europas die Internationalisierung
Kerncurriculum Französisch, 3. Lernjahr (Découvertes Band III)
 Kerncurriculum Französisch, 3. Lernjahr (Découvertes Band III) Die vorliegenden Raster sind ein Beispiel für ein Kerncurriculum Französisch (3. Lernjahr) auf der Grundlage des Lehrwerks Découvertes III.
Kerncurriculum Französisch, 3. Lernjahr (Découvertes Band III) Die vorliegenden Raster sind ein Beispiel für ein Kerncurriculum Französisch (3. Lernjahr) auf der Grundlage des Lehrwerks Découvertes III.
Kommentierte Lernaufgabe zum LehrplanPLUS Geschichte
 Seite 1 von 5 Kommentierte Lernaufgabe zum LehrplanPLUS Geschichte Stand: 06.02.17 Kommentierte und gekürzte Version einer Lernaufgabe zum LehrplanPLUS Geschichte, Jahrgangsstufe 6, Lernbereich 6. 3 Die
Seite 1 von 5 Kommentierte Lernaufgabe zum LehrplanPLUS Geschichte Stand: 06.02.17 Kommentierte und gekürzte Version einer Lernaufgabe zum LehrplanPLUS Geschichte, Jahrgangsstufe 6, Lernbereich 6. 3 Die
Lehrplan Grundlagenfach Französisch
 toto corde, tota anima, tota virtute Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft Lehrplan Grundlagenfach Französisch A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wochenstunden 4 3 3 4 B. Didaktische
toto corde, tota anima, tota virtute Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft Lehrplan Grundlagenfach Französisch A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wochenstunden 4 3 3 4 B. Didaktische
Amtliche Mitteilungen
 Amtliche Mitteilungen Datum 19. März 2014 Nr. 24/2014 I n h a l t : Fachspezifische Bestimmung für das Modul Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte (DSSZ) im Bachelorstudiengang
Amtliche Mitteilungen Datum 19. März 2014 Nr. 24/2014 I n h a l t : Fachspezifische Bestimmung für das Modul Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte (DSSZ) im Bachelorstudiengang
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Wenn Naturgewalt zur Katastrophe wird. Texte und Schaubilder sicher analysieren (Klasse 9/10) Das komplette Material finden Sie hier:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Wenn Naturgewalt zur Katastrophe wird. Texte und Schaubilder sicher analysieren (Klasse 9/10) Das komplette Material finden Sie hier:
Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Erweiterungsstudium
 Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Erweiterungsstudium Frühjahr 2014 bis Herbst 2017 Sortiert nach Schwerpunkten Schwerpunktübersicht: 1. Zweitspracherwerbsforschung / Hypothesen / Neurolinguistik 2. Fehler
Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Erweiterungsstudium Frühjahr 2014 bis Herbst 2017 Sortiert nach Schwerpunkten Schwerpunktübersicht: 1. Zweitspracherwerbsforschung / Hypothesen / Neurolinguistik 2. Fehler
Bilinguale Bildungsgänge in Deutschland
 . Geschichte. Allgemeine Bilinguale in Deutschland Die Vorteile der Bilingualität. Geschichte der Bilinguale in Deutschland.Geschichte des 9 Deutsch-französischer Kooperationsvertrag. Allgemeine 99 / 97
. Geschichte. Allgemeine Bilinguale in Deutschland Die Vorteile der Bilingualität. Geschichte der Bilinguale in Deutschland.Geschichte des 9 Deutsch-französischer Kooperationsvertrag. Allgemeine 99 / 97
1 Informationen zur schulischen Situation
 Methodenkonzept Grundschule 1 Informationen zur schulischen Situation Ein Unterricht ohne Methoden ist nicht denkbar. Was aber versteht man überhaupt unter Methodenlernen? Methode kommt aus dem Griechischen
Methodenkonzept Grundschule 1 Informationen zur schulischen Situation Ein Unterricht ohne Methoden ist nicht denkbar. Was aber versteht man überhaupt unter Methodenlernen? Methode kommt aus dem Griechischen
UNTERRICHT MIT NEUEN MEDIEN. Karl Ulrich Templ Didaktik der Politischen Bildung
 UNTERRICHT MIT NEUEN MEDIEN Didaktische Anforderungen an Unterricht mit Medien Unterricht soll jeweils von einer für die Lernenden bedeutsamen Aufgabe ausgehen (Probleme, Entscheidungsfälle, Gestaltungsund
UNTERRICHT MIT NEUEN MEDIEN Didaktische Anforderungen an Unterricht mit Medien Unterricht soll jeweils von einer für die Lernenden bedeutsamen Aufgabe ausgehen (Probleme, Entscheidungsfälle, Gestaltungsund
Präsentation von Susanne Flükiger, Stabsstelle Pädagogik, Kanton Solothurn. PP Medienanlass
 Präsentation von Susanne Flükiger, Stabsstelle Pädagogik, Kanton Solothurn (Didaktische) Grundgedanken Was ist das Ziel des Fremdsprachenunterrichts? Wie erwerben wir neues Wissen? Wie lernen wir die erste
Präsentation von Susanne Flükiger, Stabsstelle Pädagogik, Kanton Solothurn (Didaktische) Grundgedanken Was ist das Ziel des Fremdsprachenunterrichts? Wie erwerben wir neues Wissen? Wie lernen wir die erste
Erwartete Kompetenzen am Ende des 4. Schuljahrganges. Die Schüler erwerben Kompetenzen in folgenden Bereichen :
 Ebene 1 erwerben Kompetenzen in folgenden Bereichen : 1. Funktionale kommunikative Kompetenzen 1.2 Verfügung über sprachliche Mittel 2. Methodenkompetenzen 3. Interkulturelle Kompetenzen Ebene 2 1. Funktionale
Ebene 1 erwerben Kompetenzen in folgenden Bereichen : 1. Funktionale kommunikative Kompetenzen 1.2 Verfügung über sprachliche Mittel 2. Methodenkompetenzen 3. Interkulturelle Kompetenzen Ebene 2 1. Funktionale
Sommercamp 2010 Umweltbildung und Nachhaltigkeit Lernen in der Ökostation Freiburg vom 6. bis Bildungsplanbezug Englisch
 7. Bildungsplanbezug Sommercamp 2010 Umweltbildung und Nachhaltigkeit Lernen in der Ökostation Freiburg vom 6. bis 10. 9.2010 Bildungsplanbezug Englisch Grundlage für die Konzeption und Vermittlung der
7. Bildungsplanbezug Sommercamp 2010 Umweltbildung und Nachhaltigkeit Lernen in der Ökostation Freiburg vom 6. bis 10. 9.2010 Bildungsplanbezug Englisch Grundlage für die Konzeption und Vermittlung der
1. Einführung in das Thema 2. Fehler Definition und Beispiele 3. Leistungsmessung Ideen und. Beispiele. 4. Fragen & Diskussion 5.
 1. Einführung in das Thema 2. Fehler Definition und Beispiele 3. Leistungsmessung Ideen und Beispiele 4. Fragen & Diskussion 5. Feedback Fehlerkorrektu r & Leistungsmessung Text- & Wortschatzarbeit Grundlagen:
1. Einführung in das Thema 2. Fehler Definition und Beispiele 3. Leistungsmessung Ideen und Beispiele 4. Fragen & Diskussion 5. Feedback Fehlerkorrektu r & Leistungsmessung Text- & Wortschatzarbeit Grundlagen:
Fremdsprachenunterricht im Sekundarbereich I. Eine Präsentation von Sarah Bräuer, Jennifer Homfeld, Julia Pfeil und Julia Strauch
 Fremdsprachenunterricht im Sekundarbereich I Eine Präsentation von Sarah Bräuer, Jennifer Homfeld, Julia Pfeil und Julia Strauch 17.01.2007 Übersicht Von der Primarstufe in den Sekundarbereich I Sekundarbereich
Fremdsprachenunterricht im Sekundarbereich I Eine Präsentation von Sarah Bräuer, Jennifer Homfeld, Julia Pfeil und Julia Strauch 17.01.2007 Übersicht Von der Primarstufe in den Sekundarbereich I Sekundarbereich
Impulsreferat. Sächsische Strategie für das Nachbarsprachenlernen in Kitas und Schulen im Grenzraum. Martina Adler. Sächsisches Bildungsinstitut
 Impulsreferat Sächsische Strategie für das Nachbarsprachenlernen in Kitas und Schulen im Grenzraum Martina Adler Sächsisches Bildungsinstitut Sächsische Strategie für das Nachbarsprachenlernen in Kitas
Impulsreferat Sächsische Strategie für das Nachbarsprachenlernen in Kitas und Schulen im Grenzraum Martina Adler Sächsisches Bildungsinstitut Sächsische Strategie für das Nachbarsprachenlernen in Kitas
Nataša Ćorić Gymnasium Mostar Bosnien und Herzegowina
 Nataša Ćorić Gymnasium Mostar Bosnien und Herzegowina n Inhalt Der passive und der aktive Wortschatz Das vernetzte Lernen Die Einführung von neuem Wortschatz Phasen der Wortschatzvermittlung Techniken
Nataša Ćorić Gymnasium Mostar Bosnien und Herzegowina n Inhalt Der passive und der aktive Wortschatz Das vernetzte Lernen Die Einführung von neuem Wortschatz Phasen der Wortschatzvermittlung Techniken
Bilingualer Unterricht. Ralf Hölzer-Germann (Mai 2011)
 Bilingualer Unterricht Ralf Hölzer-Germann (Mai 2011) Gliederung Problemaufriss: Worum geht es beim bilingualen Unterricht (nicht)? Begründungszusammenhang: Warum bilingualer Unterricht? Ziele des bilingualen
Bilingualer Unterricht Ralf Hölzer-Germann (Mai 2011) Gliederung Problemaufriss: Worum geht es beim bilingualen Unterricht (nicht)? Begründungszusammenhang: Warum bilingualer Unterricht? Ziele des bilingualen
Chemie S I. Kriterien zur Beurteilung des Leistungsbereichs Sonstige Leistungen
 Chemie S I Kriterien zur Beurteilung des Leistungsbereichs Sonstige Leistungen Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten
Chemie S I Kriterien zur Beurteilung des Leistungsbereichs Sonstige Leistungen Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten
PHYSIK. Allgemeine Bildungsziele. Richtziele. Grundkenntnisse
 PHYSIK Allgemeine Bildungsziele Physik erforscht mit experimentellen und theoretischen Methoden die messend erfassbaren und mathematisch beschreibbaren Erscheinungen und Vorgänge in der Natur. Der Physikunterricht
PHYSIK Allgemeine Bildungsziele Physik erforscht mit experimentellen und theoretischen Methoden die messend erfassbaren und mathematisch beschreibbaren Erscheinungen und Vorgänge in der Natur. Der Physikunterricht
DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten
 Germanistik Mohamed Chaabani DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten Wissenschaftlicher Aufsatz 1 DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten Chaabani Mohamed Abstract Die
Germanistik Mohamed Chaabani DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten Wissenschaftlicher Aufsatz 1 DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten Chaabani Mohamed Abstract Die
Dank... XI Einleitung... 1
 Inhaltsverzeichnis Dank... XI Einleitung... 1 1. Lernende und Lehrende... 5 1.1 Die Lernenden... 5 1.1.1 Die Vielfalt der Einflussfaktoren... 6 1.1.2 Biologische Grundausstattung... 7 1.1.3 Sprachlerneignung...
Inhaltsverzeichnis Dank... XI Einleitung... 1 1. Lernende und Lehrende... 5 1.1 Die Lernenden... 5 1.1.1 Die Vielfalt der Einflussfaktoren... 6 1.1.2 Biologische Grundausstattung... 7 1.1.3 Sprachlerneignung...
Modul: Kompetenzorientierung im Französischunterricht (11 Leistungspunkte - Variante 1)
 Auszug aus der Studienordnung Französisch Modul: Kompetenzorientierung im Französischunterricht (11 Leistungspunkte - Variante 1) Qualifikationsziele Inhalte: Das Modul bereitet die Studentinnen Studenten
Auszug aus der Studienordnung Französisch Modul: Kompetenzorientierung im Französischunterricht (11 Leistungspunkte - Variante 1) Qualifikationsziele Inhalte: Das Modul bereitet die Studentinnen Studenten
Fachseminar Fremdsprachen/ Pflicht 1. Thema: Grundlagen der Planung einer Fremdsprachenstunde
 Fachseminar Fremdsprachen/ Pflicht 1. Thema: Grundlagen der Planung einer Fremdsprachenstunde Lernbereich im LP: Relevanz: Klassenstufe 3/ 4 Charakter, Stellung und Prinzipien von Fremdsprachenunterricht
Fachseminar Fremdsprachen/ Pflicht 1. Thema: Grundlagen der Planung einer Fremdsprachenstunde Lernbereich im LP: Relevanz: Klassenstufe 3/ 4 Charakter, Stellung und Prinzipien von Fremdsprachenunterricht
Evaluation der Ausbildung im Hinblick auf die vermittelten Kompetenzen und Standards des Kerncurriculums
 Evaluation der Ausbildung im Hinblick auf die vermittelten Kompetenzen und Standards des Kerncurriculums Der Evaluationsbogen orientiert sich an den Formulierungen des Kerncurriculums; die hier vorgegebenen
Evaluation der Ausbildung im Hinblick auf die vermittelten Kompetenzen und Standards des Kerncurriculums Der Evaluationsbogen orientiert sich an den Formulierungen des Kerncurriculums; die hier vorgegebenen
Leistungsbewertung im Fach Kunst in der Sekundarstufe I. Grundlegende Bewertungskriterien
 Leistungsbewertung im Fach Kunst in der Sekundarstufe I Grundlegende Bewertungskriterien Das Selbstverständnis des Fachbereichs Kunst legt besonderen Wert auf die Berücksichtigung und Betonung der spezifischen
Leistungsbewertung im Fach Kunst in der Sekundarstufe I Grundlegende Bewertungskriterien Das Selbstverständnis des Fachbereichs Kunst legt besonderen Wert auf die Berücksichtigung und Betonung der spezifischen
Englisch. Berufskolleg Gesundheit und Pflege I. Schuljahr 1. Landesinstitut für Erziehung und Unterricht Abteilung III
 Berufskolleg Gesundheit und Pflege I Schuljahr 1 2 Vorbemerkungen Die immer enger werdende Zusammenarbeit der Staaten innerhalb und außerhalb der Europäischen Union verlangt in Beruf und Alltag in zunehmendem
Berufskolleg Gesundheit und Pflege I Schuljahr 1 2 Vorbemerkungen Die immer enger werdende Zusammenarbeit der Staaten innerhalb und außerhalb der Europäischen Union verlangt in Beruf und Alltag in zunehmendem
Kompetenzorientiertes Kerncurriculum basierend auf dem Lehrplan Rheinland/Pfalz, Realschule, Französisch als zweite Fremdsprache, 2000
 Realschule Jahrgang: 9/10 Fach: Französisch Kompetenzorientiertes Kerncurriculum basierend auf dem Lehrplan Rheinland/Pfalz, Realschule, Französisch als zweite Fremdsprache, 2000 Die Schülerinnen und Schüler
Realschule Jahrgang: 9/10 Fach: Französisch Kompetenzorientiertes Kerncurriculum basierend auf dem Lehrplan Rheinland/Pfalz, Realschule, Französisch als zweite Fremdsprache, 2000 Die Schülerinnen und Schüler
Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Didaktikfach
 Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Didaktikfach Frühjahr 2014 bis Herbst 2017 Sortiert nach Schwerpunkten Themenübersicht: 1. Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle Kompetenz 2. Literarische Texte
Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Didaktikfach Frühjahr 2014 bis Herbst 2017 Sortiert nach Schwerpunkten Themenübersicht: 1. Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle Kompetenz 2. Literarische Texte
Dokumentation der Tagung
 Claudia Benholz / Ursula Mensel (September 2013) Dokumentation der Tagung Vielfalt als Herausforderung annehmen und Chancen nutzen: Sprachliches Lernen in allen Fächern. Konsequenzen für die Lehramtsausbildung
Claudia Benholz / Ursula Mensel (September 2013) Dokumentation der Tagung Vielfalt als Herausforderung annehmen und Chancen nutzen: Sprachliches Lernen in allen Fächern. Konsequenzen für die Lehramtsausbildung
Sprachförderung in der beruflichen Bildung
 Studien zur Wirtschaftspädagogik und Berufsbildungsforschung aus der Humboldt-Universität zu Berlin Band 10.1 Steffi Badel, Antje Mewes, Constanze Niederhaus Sprachförderung in der beruflichen Bildung
Studien zur Wirtschaftspädagogik und Berufsbildungsforschung aus der Humboldt-Universität zu Berlin Band 10.1 Steffi Badel, Antje Mewes, Constanze Niederhaus Sprachförderung in der beruflichen Bildung
SPANISCH OBERSTUFENCURRICULUM
 SPANISCH OBERSTUFENCURRICULUM KERNCURRICULUM SCHULCURRICULUM Hör- und Hör-/Sehverstehen KOMMUNIKATIVE FERTIGKEITEN Gesprächen, Berichten, Diskussionen, Referaten etc. folgen, sofern Standardsprache gesprochen
SPANISCH OBERSTUFENCURRICULUM KERNCURRICULUM SCHULCURRICULUM Hör- und Hör-/Sehverstehen KOMMUNIKATIVE FERTIGKEITEN Gesprächen, Berichten, Diskussionen, Referaten etc. folgen, sofern Standardsprache gesprochen
Schulinterner LEHRPLAN PÄDAGOGIK für die Jahrgangsstufe Q2
 UNTERRICHTSVORHABEN THEMENÜBERBLICK JGST. Q2.1 Umfang GK / LK (Wochenstunden) 1. Normen und Werte in der Erziehung 4 / 4 2. Nur LK: Entwicklung von der Ausländerpädagogik zur interkulturellen Pädagogik
UNTERRICHTSVORHABEN THEMENÜBERBLICK JGST. Q2.1 Umfang GK / LK (Wochenstunden) 1. Normen und Werte in der Erziehung 4 / 4 2. Nur LK: Entwicklung von der Ausländerpädagogik zur interkulturellen Pädagogik
Konkretisierung der Ausbildungslinien im Fach Spanisch
 Konkretisierung der slinien im Fach Spanisch Stand: September 2012 slinie Entwicklungsstufen der slinien im VD Gym A: Unterricht konzipieren 1 Den Wortschatz und die Grammatik kommunikationsorientiert
Konkretisierung der slinien im Fach Spanisch Stand: September 2012 slinie Entwicklungsstufen der slinien im VD Gym A: Unterricht konzipieren 1 Den Wortschatz und die Grammatik kommunikationsorientiert
Standards Englisch Hauptschule
 Standards Englisch Hauptschule Aufgabenfeld Unterrichten: Ich habe gelernt, weitgehend einsprachig zu unterrichten. Planungskompetenz Personale Kompetenz insbesondere Entscheidungskompetenz und Flexibilität
Standards Englisch Hauptschule Aufgabenfeld Unterrichten: Ich habe gelernt, weitgehend einsprachig zu unterrichten. Planungskompetenz Personale Kompetenz insbesondere Entscheidungskompetenz und Flexibilität
Unterrichtsentwurf. Thema: Lösungsvorgänge. Titel der Unterrichtssequenz: "Salz trifft Eis"
 Unterrichtsentwurf Thema: Lösungsvorgänge Titel der Unterrichtssequenz: "Salz trifft Eis" Lerngruppe: Schülerinnen und Schüler der 5./6. Jahrgangsstufe (Sekundarstufe I) Zeitrahmen: 90 Inhalt: Aggregatzustände
Unterrichtsentwurf Thema: Lösungsvorgänge Titel der Unterrichtssequenz: "Salz trifft Eis" Lerngruppe: Schülerinnen und Schüler der 5./6. Jahrgangsstufe (Sekundarstufe I) Zeitrahmen: 90 Inhalt: Aggregatzustände
Methodencurriculum Rahmenplan Überfachliche Kompetenzen
 Methodencurriculum Rahmenplan Überfachliche Kompetenzen Vorbemerkungen: Dieses Methodencurriculum hat zum Ziel, den Erwerb und die Vertiefung ausgewählter überfachlicher Kompetenzen in den Jahrgangsstufen
Methodencurriculum Rahmenplan Überfachliche Kompetenzen Vorbemerkungen: Dieses Methodencurriculum hat zum Ziel, den Erwerb und die Vertiefung ausgewählter überfachlicher Kompetenzen in den Jahrgangsstufen
AUSBILDUNG Sekundarstufe I. Fachwegleitung Natur und Technik
 AUSBILDUNG Sekundarstufe I Fachwegleitung Natur und Technik Inhalt Schulfach/Ausbildungfach 4 Das Schulfach 4 Das Ausbildungsfach 4 Fachwissenschaftliche Ausbildung 5 Fachdidaktische Ausbildung 5 Gliederung
AUSBILDUNG Sekundarstufe I Fachwegleitung Natur und Technik Inhalt Schulfach/Ausbildungfach 4 Das Schulfach 4 Das Ausbildungsfach 4 Fachwissenschaftliche Ausbildung 5 Fachdidaktische Ausbildung 5 Gliederung
Modulhandbuch Lehramt Englisch an Gymnasien und Gesamtschulen Titel des Moduls Linguistik Kennnummer. Studiensemester bzw
 Modulhandbuch Lehramt Englisch an Gymnasien und Gesamtschulen Titel des Moduls Linguistik Kennnummer MEdE GYMGeM1 Workload 330 h 1.1 Vertiefung Ling 1: Sprachstruktur 1.2 Vertiefung Ling 2: Sprachgebrauch
Modulhandbuch Lehramt Englisch an Gymnasien und Gesamtschulen Titel des Moduls Linguistik Kennnummer MEdE GYMGeM1 Workload 330 h 1.1 Vertiefung Ling 1: Sprachstruktur 1.2 Vertiefung Ling 2: Sprachgebrauch
Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017)
 Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017) Übersicht - Themen der letzten Jahre Themenbereiche Prüfung (H : Herbst, F : Frühjahr) Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle
Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017) Übersicht - Themen der letzten Jahre Themenbereiche Prüfung (H : Herbst, F : Frühjahr) Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle
Konzept zur Leistungsbewertung im Fach Englisch
 Konzept zur Leistungsbewertung im Fach Englisch Gültig ab 10.03.2014 auf Beschluss der Fachkonferenz Englisch vom 06.03.2014 Klasse 1/2 Vorrangige Kriterien für die Einschätzung der Leistungen sind die
Konzept zur Leistungsbewertung im Fach Englisch Gültig ab 10.03.2014 auf Beschluss der Fachkonferenz Englisch vom 06.03.2014 Klasse 1/2 Vorrangige Kriterien für die Einschätzung der Leistungen sind die
Methodenkompetenz fördern durch ein längerfristiges, internetgestütztes Projekt
 Methodenkompetenz fördern durch ein längerfristiges, internetgestütztes Projekt Schüler erarbeiten mit Hilfe neuer Medien und anderer Informationsquellen selbstständig ein Sachthema. Ziele Die Schüler
Methodenkompetenz fördern durch ein längerfristiges, internetgestütztes Projekt Schüler erarbeiten mit Hilfe neuer Medien und anderer Informationsquellen selbstständig ein Sachthema. Ziele Die Schüler
allgemeines Methodencurriculum
 allgemeines Methodencurriculum Lernen-lernen in den Jahrgangsstufen 5 und 6 am Gymnasium St. Christophorus Um einen guten Start in die erhöhten Anforderungen des Gymnasiums zu gewährleisten, bieten wir
allgemeines Methodencurriculum Lernen-lernen in den Jahrgangsstufen 5 und 6 am Gymnasium St. Christophorus Um einen guten Start in die erhöhten Anforderungen des Gymnasiums zu gewährleisten, bieten wir
AMTLICHE MITTEILUNGEN Verkündungsblatt der Bergischen Universität Wuppertal Herausgegeben vom Rektor Jahrgang 40 Datum Nr.
 AMTLICHE MITTEILUNGEN Verkündungsblatt der Bergischen Universität Wuppertal Herausgegeben vom Rektor Jahrgang 40 Datum 14.09.2011 Nr. 96 Prüfungsordnung (Fachspezifische Bestimmungen) für den Teilstudiengang
AMTLICHE MITTEILUNGEN Verkündungsblatt der Bergischen Universität Wuppertal Herausgegeben vom Rektor Jahrgang 40 Datum 14.09.2011 Nr. 96 Prüfungsordnung (Fachspezifische Bestimmungen) für den Teilstudiengang
Wirtschaft-Arbeit-Technik im neuen Rahmenlehrplan für die Jahrgangsstufe 1 bis 10 (Berlin/Brandenburg) 24. Februar 2015
 Wirtschaft-Arbeit-Technik im neuen Rahmenlehrplan für die Jahrgangsstufe 1 bis 10 (Berlin/Brandenburg) 24. Februar 2015 Auftrag Entwicklung neuer Rahmenlehrpläne für die Grundschule und die Sekundarstufe
Wirtschaft-Arbeit-Technik im neuen Rahmenlehrplan für die Jahrgangsstufe 1 bis 10 (Berlin/Brandenburg) 24. Februar 2015 Auftrag Entwicklung neuer Rahmenlehrpläne für die Grundschule und die Sekundarstufe
Zur Vorbereitung auf die ÖSD-PrüferInnenausbildung
 Zur Vorbereitung auf die ÖSD-PrüferInnenausbildung Bitte lesen Sie folgende Informationen als Vorbereitung auf die ÖSD-PrüferInnenschulung genau durch! Wir möchten Sie auf den folgenden Seiten für die
Zur Vorbereitung auf die ÖSD-PrüferInnenausbildung Bitte lesen Sie folgende Informationen als Vorbereitung auf die ÖSD-PrüferInnenschulung genau durch! Wir möchten Sie auf den folgenden Seiten für die
DaZ-Förderung im Deutschunterricht Sprachbewusstheit anregen, Fördersituationen schaffen. Beate Lütke. Blitzlicht
 DaZ-Förderung im Deutschunterricht Sprachbewusstheit anregen, Fördersituationen schaffen Fortbildung Sprache im Fachunterricht" 07./08.04.2011, Bozen Blitzlicht Geben Sie reihum einen kurzen Kommentar
DaZ-Förderung im Deutschunterricht Sprachbewusstheit anregen, Fördersituationen schaffen Fortbildung Sprache im Fachunterricht" 07./08.04.2011, Bozen Blitzlicht Geben Sie reihum einen kurzen Kommentar
Fachunterricht. für eine chancengerechte Wissensvermittlung in Deutsch als Unterrichtssprache. Wo Qualität zur Sprache kommt.
 Sprachsensibler Fachunterricht für eine chancengerechte Wissensvermittlung in Deutsch als Unterrichtssprache (CHAWID) Wo Qualität zur Sprache kommt. www.oesz.at Im Auftrag des Worum geht s? Sprachliche
Sprachsensibler Fachunterricht für eine chancengerechte Wissensvermittlung in Deutsch als Unterrichtssprache (CHAWID) Wo Qualität zur Sprache kommt. www.oesz.at Im Auftrag des Worum geht s? Sprachliche
Grundsätze zur Leistungsbewertung im Fach Latein. 1. Allgemeine Vereinbarungen / Vorbemerkungen
 Grundsätze zur Leistungsbewertung im Latein 1. Allgemeine Vereinbarungen / Vorbemerkungen Das Leistungskonzept orientiert sich an den Vorgaben des Kernlehrplans NRW. Die rechtlich verbindlichen Grundsätze
Grundsätze zur Leistungsbewertung im Latein 1. Allgemeine Vereinbarungen / Vorbemerkungen Das Leistungskonzept orientiert sich an den Vorgaben des Kernlehrplans NRW. Die rechtlich verbindlichen Grundsätze
Natur und Technik. Fachwegleitung. AUSBILDUNG Sekundarstufe I
 AUSBILDUNG Sekundarstufe I Fachwegleitung Integrierter Bachelor-/Master-Studiengang Vollzeit und Teilzeit Konsekutiver Master-Studiengang für Personen mit Fachbachelor Natur und Technik Inhalt Schulfach
AUSBILDUNG Sekundarstufe I Fachwegleitung Integrierter Bachelor-/Master-Studiengang Vollzeit und Teilzeit Konsekutiver Master-Studiengang für Personen mit Fachbachelor Natur und Technik Inhalt Schulfach
Die Entnazifizierung ein politischer Neuanfang? (Deutsche Geschichte nach 1945)
 Geschichte Friedrich Kollhoff Die Entnazifizierung ein politischer Neuanfang? (Deutsche Geschichte nach 1945) Unterrichtspraktische Prüfung (UPP) im Fach Geschichte (2. Staatsexamen) Unterrichtsentwurf
Geschichte Friedrich Kollhoff Die Entnazifizierung ein politischer Neuanfang? (Deutsche Geschichte nach 1945) Unterrichtspraktische Prüfung (UPP) im Fach Geschichte (2. Staatsexamen) Unterrichtsentwurf
Leistungskonzept des Faches Physik
 Leistungskonzept des Faches Physik Inhalt Leistungskonzept des Faches Physik... 1 Inhalt... 1 Anzahl und Dauer von Klassenarbeiten bzw. Klausuren... 2 Sekundarstufe II... 2 Einführungsphase... 2 Qualifikationsphase...
Leistungskonzept des Faches Physik Inhalt Leistungskonzept des Faches Physik... 1 Inhalt... 1 Anzahl und Dauer von Klassenarbeiten bzw. Klausuren... 2 Sekundarstufe II... 2 Einführungsphase... 2 Qualifikationsphase...
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Deutsch mit Vater und Sohn (DaF / DaZ)
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Deutsch mit Vater und Sohn (DaF / DaZ) Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Vorwort Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen!
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Deutsch mit Vater und Sohn (DaF / DaZ) Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Vorwort Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen!
CAS Bilingualer Unterricht in der Berufsbildung weiterentwickeln.
 Weiterbildung Weiterbildungsstudiengänge CAS Bilingualer Unterricht in der Berufsbildung weiterentwickeln. Zielgruppe CAS Bilingualer Unterricht in der Berufsbildung (BILU BB) Der Zertifikatslehrgang richtet
Weiterbildung Weiterbildungsstudiengänge CAS Bilingualer Unterricht in der Berufsbildung weiterentwickeln. Zielgruppe CAS Bilingualer Unterricht in der Berufsbildung (BILU BB) Der Zertifikatslehrgang richtet
Schulinternes Curriculum für das Fach Latein (G 8) am Alten Gymnasium Flensburg
 1 Schulinternes Curriculum für das Fach Latein (G 8) am Alten Gymnasium Flensburg Flensburg, den 07.06.12 I Schulübergreifende Grundlagen für das schulinterne Fachcurriculum 1. Lehrplan Für den Lateinunterricht
1 Schulinternes Curriculum für das Fach Latein (G 8) am Alten Gymnasium Flensburg Flensburg, den 07.06.12 I Schulübergreifende Grundlagen für das schulinterne Fachcurriculum 1. Lehrplan Für den Lateinunterricht
DLL Deutsch Lehren Lernen
 DLL Deutsch Lehren Lernen Was ist DLL - Deutsch lehren lernen? Deutsch Lehren Lernen (DLL) rückt den Unterricht ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Die neue Fort- und Weiterbildungsreihe des Goethe-Instituts
DLL Deutsch Lehren Lernen Was ist DLL - Deutsch lehren lernen? Deutsch Lehren Lernen (DLL) rückt den Unterricht ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Die neue Fort- und Weiterbildungsreihe des Goethe-Instituts
DaZ und Alphabetisierung
 http://www.caritasakademie.at/home/ DaZ und Alphabetisierung Alphabetisierung, Grund- und Mittelstufenunterricht unter besonderer Berücksichtigung der Zielgruppe Flüchtlinge Lehrgang DaZ und Alphabetisierung
http://www.caritasakademie.at/home/ DaZ und Alphabetisierung Alphabetisierung, Grund- und Mittelstufenunterricht unter besonderer Berücksichtigung der Zielgruppe Flüchtlinge Lehrgang DaZ und Alphabetisierung
Lichtenbergschule Darmstadt Europaschule Gymnasium
 Sprachenlernen, Kunst und Musik Schulisches Zentrum für Sprachen und Begabtenförderung Fachbereich I Sprachenlernen, Kunst und Musik 1 Fachbereich I Sprachenlernen, Kunst und Musik 2 Der Fachbereich I
Sprachenlernen, Kunst und Musik Schulisches Zentrum für Sprachen und Begabtenförderung Fachbereich I Sprachenlernen, Kunst und Musik 1 Fachbereich I Sprachenlernen, Kunst und Musik 2 Der Fachbereich I
Kreditpunk te 9 LP. Studiensemester. 1. Sem. Kontaktzeit 2 SWS / 22,5 h. 2 SWS / 22,5 h
 Modulhandbuch Lehramt Master Französisch Haupt, Real und Gesamtschulen Workload 270 h 1.1 Literatur und Medientheorie 1.2 Modelle zur Beschreibung sprachlicher Strukturen 1.3 Eine Prüfungsleistung in 1.2
Modulhandbuch Lehramt Master Französisch Haupt, Real und Gesamtschulen Workload 270 h 1.1 Literatur und Medientheorie 1.2 Modelle zur Beschreibung sprachlicher Strukturen 1.3 Eine Prüfungsleistung in 1.2
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg
 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg Schulversuch 44-6512.-2328/103 vom 30. Juli 2012 Lehrplan für das Berufskolleg Berufskolleg für Sozialpädagogik Fachschule für Sozialpädagogik
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg Schulversuch 44-6512.-2328/103 vom 30. Juli 2012 Lehrplan für das Berufskolleg Berufskolleg für Sozialpädagogik Fachschule für Sozialpädagogik
Lehrplan Gymnasiale Oberstufe EW-Qualifikationsphase (Q1) Grundkurs
 Lehrplan Gymnasiale Oberstufe EW-Qualifikationsphase (Q1) Grundkurs Inhaltsfeld 3: Entwicklung, Sozialisation und Erziehung 1. Unterrichtsvorhaben: Anlage und/oder Umwelt? (ca. 3 Std.) Die Schülerinnen
Lehrplan Gymnasiale Oberstufe EW-Qualifikationsphase (Q1) Grundkurs Inhaltsfeld 3: Entwicklung, Sozialisation und Erziehung 1. Unterrichtsvorhaben: Anlage und/oder Umwelt? (ca. 3 Std.) Die Schülerinnen
Englischunterricht im Sonderpädagogischen Bereich, besonders in der Inklusion
 Englischunterricht im Sonderpädagogischen Bereich, besonders in der Inklusion Ausgangssituation am Ende der 4. Schulstufe Die Ergebnisse des FU weisen (auch) bei Regelschüler/innen z. T. große Unterschiede
Englischunterricht im Sonderpädagogischen Bereich, besonders in der Inklusion Ausgangssituation am Ende der 4. Schulstufe Die Ergebnisse des FU weisen (auch) bei Regelschüler/innen z. T. große Unterschiede
Wortschatzarbeit im Englischunterricht: Strategien zum Vokabellernen (5. Klasse Hauptschule)
 Pädagogik Jens Goldschmidt Wortschatzarbeit im Englischunterricht: Strategien zum Vokabellernen (5. Klasse Hauptschule) Laut Kompetenz 1.2.1 der APVO-Lehr Examensarbeit Jens Goldschmidt (LiVD) Anwärter
Pädagogik Jens Goldschmidt Wortschatzarbeit im Englischunterricht: Strategien zum Vokabellernen (5. Klasse Hauptschule) Laut Kompetenz 1.2.1 der APVO-Lehr Examensarbeit Jens Goldschmidt (LiVD) Anwärter
Variante 1: Für Studierende, die ihre MA-Arbeit in der Fachdidaktik schreiben wollen
 Fachdidaktisches Modul: Kompetenzorientierung im Französischunterricht für 120 LP MA Variante 1: Für Studierende, die ihre MA-Arbeit in der Fachdidaktik schreiben wollen Auszug aus der Studienordnung Modul:
Fachdidaktisches Modul: Kompetenzorientierung im Französischunterricht für 120 LP MA Variante 1: Für Studierende, die ihre MA-Arbeit in der Fachdidaktik schreiben wollen Auszug aus der Studienordnung Modul:
