Teilskriptum für den Aufnahmetest im Fachbereich Betriebswirtschaftslehre. Skriptum. Teilskriptum für den Aufnahmetest. in den FH-Studiengang
|
|
|
- Elvira Schuler
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Skriptum Teilskriptum für den Aufnahmetest in den FH-Studiengang "Logistik und Transportmanagement" Fachbereich Betriebswirtschaftslehre Aufnahmeverfahren am FH-Studiengang Logistik und Transportmanagement (LOGT) an der Fachhochschule des bfi Wien von Thomas Kirchberger und Roland König Kirchberger/König Seite I
2 Inhaltsverzeichnis INHALTSVERZEICHNIS...II 1. EINFÜHRUNG IN DIE BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE GEGENSTAND DER BWL WAS BEDEUTET WIRTSCHAFT, WAS HEIßT WIRTSCHAFTEN? WAS SIND GÜTER? DAS ÖKONOMISCHE PRINZIP DEFINITION DER BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE EINTEILUNG DER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE DER BETRIEB DEFINITION: BETRIEB NACH LECHNER/EGGER/SCHAUER WEITERE ÄHNLICHE BEGRIFFE GLIEDERUNG DER BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE ORGANISATION LINIENSYSTEM AUFBAUORGANISATION FUNKTIONALE ORGANISATION DIVISIONALE ORGANISATION MATRIXORGANISATION PROFIT-COST-CENTER...25 Kirchberger/König Seite II
3 3. DIE PRODUKTION LEISTUNGSERSTELLUNG GRUNDFUNKTIONEN DER BETRIEBLICHEN LEISTUNGSERSTELLUNG GESTALTUNG DES PRODUKTIONSPROZESSES FERTIGUNGSVERFAHREN EINTEILUNG VON FERTIGUNGSVERFAHREN EINZELFERTIGUNG MASSENFERTIGUNG...32 VORTEIL SERIENFERTIGUNG SORTENFERTIGUNG WERKSTATTFERTIGUNG WEITERE FERTIGUNGSVERFAHREN SYSTEMATIK DER PRODUKTIONSFAKTOREN PRODUKTIONSFAKTOREN ARTEN VON FAKTORVERZEHR PRODUKTIONSFAKTOR: MENSCHLICHE ARBEITSLEISTUNG BESCHAFFUNG MATERIALBESCHAFFUNGSPROZESS BESCHREIBUNG DER TEILPROZESSE MATERIALBESCHAFFUNGSMANAGEMENT MATERIALBEDARFSPLANUNG MATERIAL- UND BESTANDSMANAGEMENT MATERIALFLUSSSTEUERUNG...45 Kirchberger/König Seite III
4 5. DER ABSATZ ABSATZPOLITISCHE INSTRUMENTE PREISPOLITIK PRODUKTPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK DISTRIBUTIONSPOLITIK ARTEN VON VERTRIEBSKANÄLEN DISTRIBUTION IM KONSUMGÜTERBEREICH DISTRIBUTION IM INDUSTRIEGÜTERBEREICH UNTERNEHMENSFÜHRUNG UND MANAGEMENT DIE UNTERNEHMENSFÜHRUNG ALS TRÄGER VON ENTSCHEIDUNGEN UNTERNEHMENSZIELE INHALT VON ZIELEN AUSMAß VON ZIELEN ZEITLICHER BEZUG VON ZIELEN EINTEILUNG NACH DER STELLUNG IM ZIELSYSTEM FÜHRUNGSSTILE PATRIARCHALISCHER FÜHRUNGSSTIL CHARISMATISCHER FÜHRUNGSSTIL AUTOKRATISCHER FÜHRUNGSSTIL BÜROKRATISCHER FÜHRUNGSSTIL AUTORITÄRER UND KOOPERATIVER FÜHRUNGSSTIL...61 Kirchberger/König Seite IV
5 7. PLANUNG DEFINITION VON PLANUNG IMPROVISATION PROGNOSE PLANUNG DER PLANUNGSPROZESS DAS RECHNUNGSWESEN BUCHHALTUNG UND BILANZIERUNG JAHRESABSCHLUSS BILANZ GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG KOSTENRECHNUNG KOSTENARTENRECHNUNG KOSTENSTELLENRECHNUNG KOSTENTRÄGERRECHNUNG KOSTENTRÄGERERFOLGSRECHNUNG PERIODENERFOLGSRECHNUNG...78 Kirchberger/König Seite V
6 9. FINANZIERUNG UND INVESTITION INVESTITION INVESTITIONSENTSCHEIDUNGEN EINTEILUNG VON INVESTITIONEN EINTEILUNG NACH DER ZIELSETZUNG FINANZIERUNG FINANZIERUNGSARTEN ERWEITERUNG DER GLIEDERUNGEN DER FINANZIERUNG PRÜFUNGSVORBEREITUNG...85 LITERATURVERZEICHNIS...87 Kirchberger/König Seite VI
7 1. Einführung in die Betriebswirtschaftslehre 1.1. Gegenstand der BWL Die BWL ist nach überwiegender Meinung eine selbständige wissenschaftliche Disziplin. Als gemeinsames Untersuchungsgebiet aller Wirtschaftswissenschaften ist die Wirtschaft anzusehen. 1 Untersuchungsgegenstand der Betriebswirtschaftslehre ist die wirtschaftliche Seite des Betriebes Was bedeutet Wirtschaft, was heißt Wirtschaften? Menschen haben Wünsche und Bedürfnisse, die sie befriedigt wissen wollen. Im Spannungsfeld der herrschenden Güterknappheit ist es für alle Individuen notwendig, Aktivitäten zu setzen, um ihre Bedürfnisse und Wünsche befriedigen zu können. Der Mensch muss, um dieses Ziel erreichen zu können, mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln bestmöglich arbeiten, folglich muss er wirtschaften. Er disponiert über Güter, die aus seiner Situation heraus knapp, aber verfügbar und übertragbar sind, derart, dass er seine eigenen Bedürfnisse bestmöglich erfüllen kann Was sind Güter? Güter sind Sachen oder Rechte die für Individuen einen Wert besitzen. Dieser Wert resultiert daraus, dass diese Sachen oder Rechte genutzt, benutzt, verbraucht oder auch getauscht werden können. 1 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 31 Kirchberger/König Seite 1
8 Güter können eingeteilt werden in freie Güter und Wirtschaftsgüter. 3 Freie Güter sind Güter, die (im Normalfall) in beliebiger Menge zur Verfügung stehen. Ein Beispiel für ein freies Gut ist Luft. Luft ist in unseren Breiten in beliebiger Menge für alle Individuen vorhanden. Aus diesem Grund wird das Gut Luft auch nicht zum Verkauf angeboten. Ein weiterer Grund dafür, dass es Luft nicht im Verkaufsregal gibt, ist dass niemand von der Konsumtion ausgeschlossen werden kann. Niemand kann jemand anderem das Atmen verbieten, um ihm dann Luft teuer verkaufen zu können. Versetzen wir uns nun in eine andere Situation, begeben wir uns ins Weltall. Dort wird das bei uns freie Gut Luft zu einem begehrten knappen Gut, dass auch einen Wert und folglich einen Preis haben wird. Daraus ist zu erkennen, dass die Frage, ob ein Gut ein freies ist oder nicht, sehr stark von folgenden Kriterien abhängigen räumliche Verhältnisse, zeitliche Verhältnisse und situative Verhältnisse. 4 3 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 31 Kirchberger/König Seite 2
9 In der BWL sind Wirtschaftsgüter von besonderem Interesse. Diese lassen sich wie folgt einteilen: 5 Materielle Güter (Sachgüter) und immaterielle Güter (Arbeitsleistung, Rechte, Lizenzen). Realgüter (materielle und immaterielle Güter) sowie Nominalgüter (Geld oder Geldwertrechte). Produktionsgüter (indirekte Bedürfnisbefriedigung) und Konsumgüter (direkte Bedürfnisbefriedigung). Inputgüter (Einsatzgüter für die Produktion, wie Rohstoffe) und Outputgüter (Ergebnisse des Produktionsprozesses). Gebrauchsgüter (werden im Produktionsprozess genutzt, wie Maschinen) und Verbrauchsgüter (verbrauchen sich im Produktionsprozess, wie Materialien, Energie etc.) Das ökonomische Prinzip Es stellt sich beim Wirtschaften für den Einzelnen die Frage: Wie sollen vorhandene Mittel kombiniert werden, um eigene Bedürfnisse bestmöglich befriedigen zu können? Es erscheint logisch, dass der Einzelne versuchen wird 6 mit dem geringsten Mitteleinsatz (Minimalprinzip) ein bestimmtes Ziel zu erreichen; 5 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 32 Kirchberger/König Seite 3
10 das maximal erreichbare Ergebnis mit einem bestimmten Mitteleinsatz zu erzielen (Maximalprinzip). Diese Vorgehensweise wird gemeinhin als Rationalitätsprinzip (allgemeines Vernunftprinzip) bezeichnet. Die wirtschaftsbezogene Auslegung dieser Vorgangsweise wird als ökonomisches Prinzip bezeichnet. Dieses ist ein Grundprinzip (normatives Prinzip) auf dem die Wirtschaftswissenschaften und demnach auch die Betriebswirtschaftslehre aufbauen Definition der Betriebswirtschaftslehre Einteilung der Wirtschaftswissenschaften Wie bereits mehrfach angesprochen, lässt sich das Untersuchungsgebiet Wirtschaft unter den Wirtschaftswissenschaften subsumieren. Die Wirtschaftswissenschaften werden traditionell in Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre untergliedert. 8 7 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 33 Kirchberger/König Seite 4
11 Volkswirtschaftslehre Die Volkswirtschaftslehre, auch als Nationalökonomie oder politische Ökonomie bezeichnet, untersucht in erster Linie gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge der von einzelnen Wirtschaftseinheiten (Wirtschaftssubjekten) ausgehenden Aktivitäten. 9 Die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge werden vorrangig aus Sicht einer bestimmten Wirtschaftsregion (ein Staat zb. Österreich, USA oder Japan oder eines Staatenbundes, wie etwa die EU oder auch Wirtschaftsbundes, wie etwa EFTA) untersucht. Durchleuchtet werden in erster Linie die Strukturen und die Abläufe aus ganzheitlicher Sicht. Bedeutende volkswirtschaftliche Kenngrößen sind etwa: Arbeitslosigkeit, Inflationsrate, Staatsverschuldung, Bruttoinlandsprodukt bzw. Bruttosozialprodukt Betriebswirtschaftslehre Die Betriebswirtschaftslehre orientiert sich hingegen an den einzelnen Organisationseinheiten (Einzelwirtschaften) und untersucht die mit dem Aufbau und Ablauf der Einzelwirtschaften (Betriebe) zusammenhängenden Tatbestände und Vorgänge. Im Mittelpunkt stehen die wirtschaftlichen Sach- 9 Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 33 Kirchberger/König Seite 5
12 verhalte der Leistungserstellung und Leistungsabgabe bzw. der Leistungsinanspruchnahme in diesen Wirtschaftseinheiten. 10 Die Betriebswirtschaftslehre untersucht somit die mit dem Aufbau und Ablauf der Einzelwirtschaften (Betrieben) zusammenhängenden Tatbeständen und Vorgänge. Gesamtwirtschaftliche Aspekte werden insoweit berücksichtigt, als sie Auswirkungen auf einzelwirtschaftliche Betrachtungsweisen haben. Aufgrund der einzelwirtschaftlichen Erfordernisse sind auch 11 technische, soziologische, juristische und andere Komponenten zu berücksichtigen, insoweit sie mithelfen können, betriebliche Entscheidungsprozesse zu erläutern Der Betrieb Ein Betrieb ist eine Wirtschaftseinheit, die durch ein mehr oder weniger geordnetes Zusammenwirken von Menschen, Sachgütern und immateriellen Gütern gekennzeichnet ist. Dieses Zusammenwirken erfordert 10 Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 33 Kirchberger/König Seite 6
13 eine Ordnung bzw. Organisation, die einerseits die Struktur und andererseits den Ablauf festlegt. 12 Die Organisation umfasst: die Aufbauorganisation (Betriebsstruktur) und die Ablauforganisation (Ablauf der Leistungserstellung) Definition: Betrieb nach Lechner/Egger/Schauer Ein Betrieb ist demnach eine organisierte Wirtschaftseinheit, in der verfügbare Mittel (Vermögen) unter Wagnissen zur Erstellung von Leistungen und Abgabe dieser Leistungen an außenstehende Bedarfsträger eingesetzt werden Weitere ähnliche Begriffe Begrifflich werden folgende Bezeichnungen in der Literatur oft synonym oder mit unterschiedlicher Differenzierung verwendet: Betrieb, Unternehmen, Unternehmung oder Unternehmer. 12 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 34 Kirchberger/König Seite 7
14 Des Weiteren werden häufig auch diese Begriffe verwendet: 15 Firma, Werk, Geschäft, Fabrik. Der Begriff Betrieb bringt die unmittelbare Tätigkeit, die Leistungserstellung, einer Einzelwirtschaft zum Ausdruck. So werden u.a. folgende Einzelwirtschaften betrieben : Handelsbetrieb, Produktionsbetrieb, Transportbetrieb, Bankbetrieb. Der Begriff Unternehmen oder Unternehmung wird im betriebswirtschaftlichen Verständnis als der Rechtsrahmen der Einzelwirtschaft, in dem die Tätigkeit ausgeführt wird, angesehen. Es lassen sich zwei grundlegende Rechtsrahmen unterscheiden: Personengesellschaften (Einzelunternehmen, OHG, KG etc.), Kapitalgesellschaften (GmbH und AG). Der Begriff Firma ist der juristische Begriff, der den Namen unter dem ein Kaufmann 16 seinen Betrieb führt, angibt. 15 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Der Begriff des Kaufmannes ist eine juristische Bezeichnung des Handelsgesetzbuches (HGB). Kirchberger/König Seite 8
15 Als Geschäft wird entweder ein Handelsbetrieb oder der Verkaufsbereich eines Produktions- oder Dienstleistungsbetriebes angesehen. Als Werk und Fabrik werden Stätten der Leistungserstellung vorrangig von Produktionsbetrieben bezeichnet. Eine weitere Möglichkeit Betriebe zu differenzieren, bietet die Unternehmensgröße. Es können Kleinbetriebe, Mittelbetriebe und Großbetriebe unterschieden werden. 17 Nach der Art von Leistungen können grundsätzlich zwei wesentliche Typen von Betrieben unterschieden werden, nämlich Produktionsbetriebe (Sachleistungsbetriebe) und Dienstleistungsbetriebe. Diese Einteilung kann dahingehend verfeinert werden, dass unterschiedliche Betriebe unterschiedlich dominierende Produktionsfaktoren besitzen. So kann zwischen arbeitsintensiven Betrieben, anlagenintensiven (betriebsmittelintensiven) Betrieben und 17 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 43 Kirchberger/König Seite 9
16 materialintensiven (werkstoffintensiven) Betrieben differenziert werden. 18 Beim arbeitsintensiven Betrieb herrscht der Arbeitskostenanteil im Gesamtkostengefüge vor, beim betriebsmittelintensiven Betrieb sind die Anlagekosten von großer Bedeutung, der werkstoffintensive Betrieb weist vornehmlich Rohstoffkosten im Gesamtkostenbild auf. Dienstleistungsunternehmen sind zumeist arbeitsintensive Betriebe. Produktionsbetriebe sind meistens materialsintensive oder anlagenintensive Betriebe. Beispiele für anlagenintensive Betriebe sind Automobilproduzenten, Anlagenbauer, im Prinzip alle Massenfertigungsunternehmen. Als materialintensive Betriebe gelten solche, bei denen das Fertigungsmaterial wertmäßig dominiert. Als Beispiel kann ein Sägewerk angeführt werden. 18 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 44 Kirchberger/König Seite 10
17 1.4. Gliederung der Betriebswirtschaftslehre Wie bereits angedeutet, umfasst die Betriebswirtschaftslehre als Untersuchungsgegenstand vorrangig Einzelwirtschaften. Aufgrund der großen Vielfalt an unterschiedlichen Arten von Betrieben bietet es sich an, die BWL nach den Arten der Tätigkeiten, dem Betreiben, zu unterscheiden, wobei es grundsätzlich Aspekte und Fragestellungen gibt, die in allen Unternehmen gleich sind. Diese allgemein gültigen Aspekte und Fragen werden in der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre (ABWL) behandelt. 19 Nach der Art des Betreibens kann die BWL unter obigen Erkenntnissen wie folgt unterteilt werden: Allgemeine BWL; 2. Besondere (Spezielle/Institutionelle) BWL Industriebetriebe, Handelsbetriebe, Bankbetriebe, Transportbetriebe, Handwerksbetriebe, Versicherungsbetriebe, landwirtschaftliche Betriebe. 19 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 39 Kirchberger/König Seite 11
18 In der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre steht die Beschreibung und Erklärung von betrieblichen Sachverhalten im Vordergrund, die allen Betrieben eigen sind, und zwar unabhängig von ihrer Wirtschaftszweigzugehörigkeit, ihrer Rechtsform und ihrer Eigentümerschaft. Sie ist in die betriebswirtschaftliche Theorie und in die (angewandte) Betriebspolitik zu gliedern. Die betriebswirtschaftliche Theorie ist auf die Erkenntnis des Betriebsprozesses ausgerichtet, die Betriebspolitik auf dessen Gestaltung. 21 Die Speziellen Betriebswirtschaftslehren haben die betrieblichen Sachverhalte zum Gegenstand, die sich aus den speziellen Gegebenheiten (Problemen und Fragen) der einzelnen Wirtschaftszweige ergeben. Neben den Wirtschaftszweiglehren haben sich im Laufe der Zeit auch andere Besonderheiten von Betrieben aufgrund unterschiedlicher Rechtsformen, durch die Art der Verflechtung mit anderen Betrieben (Konzerne) oder durch Unterschiede in der Eigentümerstruktur und dadurch in Steuerfragen entwickelt. So sind unter anderem die betriebswirtschaftliche Steuerlehre, die betriebswirtschaftliche Prüfungslehre (BWL des Revisionund Treuhandwesen), Kirchberger/König Seite 12
19 die BWL der öffentlichen Verwaltung, die BWL von Verbänden, die BWL von Genossenschaften entstanden. 22 Eine andere Art der Enteilung der BWL erfolgt nach den (prozessualen) Betriebsabläufen und den dahinterliegenden Funktionen. Dies führt zu folgender Gliederung: Allgemeine BWL; 2. Funktionale BWL Führungsfunktion, Finanzierungsfunktion, Investitionsfunktion, Leistungserstellungsfunktion, Leistungsverwertungsfunktion, Verwaltungsfunktion, Überwachungsfunktion. Diese beiden Einteilungen stehen nicht im Widerspruch bzw. in Konkurrenz zueinander, sondern zeigen, dass in unterschiedlichen Wirtschaftszweigen (speziellen BWLs) wesentliche Funktionen von Betrieben unterschiedlich 21 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 41 Kirchberger/König Seite 13
20 ausgestaltet sein können. Ob die eine oder andere Betrachtungsweise vorzuziehen ist, hängt von der im Einzelfall vorliegenden Fragestellung ab. Kirchberger/König Seite 14
21 Funktionell Institutionell Industrie Handel Bank Transport... Führung Investition Finanzierung Leistungse rstellung Leistungsverwertung Kontrolle... Quelle: in Anlehnung an Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 42 Die Theorie vom Betrieb beschränkt sich auf die Behandlung der Probleme im Betriebsaufbau und Betriebsablauf. Die Lehre von Betrieben hat sich jedoch auch mit betriebswirtschaftlichen Techniken, wie Buchhaltung und Bilanz, Kostenrechnung, Organisationstechniken, Planungs- und Entscheidungstechniken zu beschäftigen. 24 Mit deren Hilfe werden Daten er- und verarbeitet, die die Grundlage für betriebswirtschaftliche Entscheidungen bilden. Verschiedene Fragestellungen der betriebswirtschaftlichen Techniken sind selbstverständlich auch Prob- 24 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 42 Kirchberger/König Seite 15
22 lemstellungen der Allgemeinen wie auch der Besonderen Betriebswirtschaftslehren, vor allem solche der Bilanz und der Kostenrechnung. Somit unterscheidet man: 1. Allgemeine Betriebswirtschafslehre, 2. Spezielle Betriebswirtschaftslehre, 3. Betriebswirtschaftliche Techniken bzw. 1. Allgemeine Betriebswirtschafslehre, 2. Funktionale Betriebswirtschaftslehre, 3. Betriebswirtschaftliche Techniken Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 42 Kirchberger/König Seite 16
23 2. Organisation Die Organisation umfasst die Struktur des Betriebsaufbaues und die Arbeitsabläufe im Betrieb. Die Normen hiezu hat die Unternehmensführung zu schaffen. Sie besteht, wie bereits dargestellt, aus Aufbauorganisation und Ablauforganisation. 26 Durch das Leitungssystem werden Befehlswege (Instanzenzug) festgelegt. Dies wird zumeist mithilfe eines Organigramms dargestellt: Leitungsstelle Zwischenstelle 1 Zwischenstelle 2 Ausführungs- Ausführungs- Ausführungs- Ausführungs- ebene 1 ebene 2 eben 3 ebene 4 Die Leitungsstelle, auch Führungsstelle genannt, bildet die Spitze des Unternehmens. Die Ausführungsebenen bilden die unterste, ausführende Ebene eines Betriebs. Zwischen der Leitungsstelle und der Ausführungsstelle, befinden sich zumeist Zwischenstellen, welche Weisungen von der Führungsstelle an die unterste Ebene weiterleiten Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 111 Kirchberger/König Seite 17
24 Die meistverwendete Form des Leitungssystems ist das Liniensystem. Daneben gibt es auch noch weitere Systeme wie zb. das Funktionssystem. 28 Aufgrund der herausragenden Bedeutung des Liniensystems wird dieses ausführlicher behandelt Liniensystem Das Liniensystem legt den Befehlsweg von der obersten unternehmerischen Leitungsstelle bis zu den Verrichtungsträgern der untersten Ebenen fest. Das Weisungsrecht der übergeordneten Stelle (Instanz) bedeutet gleichzeitig eine Ausführungspflicht für untergeordnete Stellen. 29 Die Vorteile dieser straffen Organisationsform liegen auf der Hand: eindeutig geklärte Über- und Unterordnungsverhältnisse, präzise Kompetenzregelung und übersichtliche Darstellung der Gesamtzusammenhänge bei großen Betriebseinheiten. 28 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 112 Kirchberger/König Seite 18
25 Demgegenüber weist diese Organisationsform folgende Nachteile auf: gewisse Trägheit/Schwerfälligkeit aufgrund des Instanzenzuges, Fachwissen für Leitungsstelle ist notwendig. Leitungsstelle Zwischenstelle 1 Zwischenstelle 2 Ausführungs- Ausführungs- Ausführungs- Ausführungs- ebene 1 ebene 2 eben 3 ebene 4 Das reine Leitungssystem in eben besprochener Form, wird in der Praxis häufig durch ein Mischsystem ergänzt. In dieser Variante wird eine Stabstelle der Unternehmensleitung (Führungsstelle) beigestellt, um die Unternehmensleitung bei der Lösung spezieller Probleme zu unterstützen Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 111 f. Kirchberger/König Seite 19
26 Unternehmensleitung STABSTELLE Einkauf Produktion Verkauf Produktion 1 Produktion 2 Die Stabstellen übernehmen Aufgaben, um die Unternehmensleitung zu entlasten. So werden Entscheidungsvarianten für die Geschäftsführung aufbereitet, um der Führung bei der Entscheidungsfindung Informationsmaterial zu geben. Stabstellen sind bspw. 31 Rechtsabteilung, Planungsstelle. 31 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 114 Kirchberger/König Seite 20
27 2.2. Aufbauorganisation Die traditionelle horizontale Gliederung erfolgt in der Regel nach den wichtigsten Funktionen im Unternehmen Funktionale Organisation Unternehmensführung Produktmanagement für Produkt 1 Produktmanagement für Pr odukt 2 Produktmanage- Forschung und Entwicklung Beschaffung Fertigung Absatz Personal ment für Pr odukt 3 Wie bereits auch in der Gliederung der BWL dargestellt wurde, kann ein Betrieb in unterschiedliche Funktionen eingeteilt werden. Auf diese Einteilung wird in der weiteren Folge näher eingegangen Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 116 Kirchberger/König Seite 21
28 Vorteil hohe Spezialisierung - hoher Nutzen Einschränkung der erforderlichen Qualifikation Arbeitsteilung direkte Kontrolle durch Leitung Nachteil Kommunikationsprobleme zwischen den Funktionsbereichen Abteilungsblindheit (Was kümmern mich die anderen?) Probleme eines Bereiches betreffen alle sehr unflexibel, wenn sich Einflussfaktoren ändern Divisionale Organisation Unternehmensführung Produktgruppe 1 (Spartenleiter 1) Produktgruppe 2 (Spartenleiter 2) Produktgruppe 3 (Spartenleiter 3) Produktgruppe 4 (Spartenleiter 4) ggf. Personal, Verwaltung, Rechnungswesen F&E F&E F&E F&E Materialwirtschaft Materialwirtschaft Materialwirtschaft Materialwirtschaft Fertigung Fertigung Fertigung Fertigung Absatz Absatz Absatz Absatz (Verwaltung/ (Verwaltung/ (Verwaltung/ (Verwaltung/ Rechnungsw e- Rechnungsw e- Rechnungsw e- Rechnungsw e- sen/personal) sen/personal) sen/personal) sen/personal) Kirchberger/König Seite 22
29 Bei dieser Art der Organisation wird das Unternehmen in unterschiedliche Sparten/Divisionen unterteilt, die jeweils alle Funktionen eines Betriebes aufweisen. Es bestehen also Betriebe im Betrieb. 33 Vorteil sehr flexibel - Konzentration auf Produkt- bzw. Marktverhältnisse geringer Koordinationsaufwand zwischen den einzelnen Divisionen klare Kosten- bzw. Gewinnerfassung Nachteil Doppelgleisigkeit zwischen den Sparten (z. B. Forschung) schwindende Identität mit Gesamtorganisation schlechte Kundenbetreuung bei Gliederung nach Produktgruppen 33 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 117 Kirchberger/König Seite 23
30 Matrixorganisation Leitungsstelle Zwischenstelle 1 Zwischenstelle 2 Ausführungs- Ausführungs- Ausführungs- Ausführungs- ebene 1 ebene 2 eben 3 ebene 4 In dieser Organisationsform haben untere Stellen mehrere Vorgesetzte. Dies ermöglicht enorme Flexibilität, aber diese Organisationsstruktur erfordert großen Koordinationsaufwand und hohe soziale Kompetenz der Mitarbeiter. 34 Wie obiges Organigramm andeutet, haben die Ausführungsebene 2 und 3 jeweils zwei unmittelbare Vorgesetzte, nämlich Zwischenebene 1 und Zwischenebene 2, während hingegen die Ausführungsebene 1 mit Zwischenstelle 1 und die Ausführungsebene 4 mit Zwischenstelle 2 lediglich einen Vorgesetzten aufweisen. 34 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 117 Kirchberger/König Seite 24
31 Vorteil sehr flexibel und innovativ Gruppenarbeit (wenige Fehler) hohes Problem- und Konfliktlösungspotential in den Schnittstellen Nachteil hoher Kommunikationsbedarf und hohes Konfliktpotential erhöhte Arbeitsbelastung Verzögerung der Entscheidungsprozesse Profit-Cost-Center Eine Spezialvariante der divisionalen Organisationsstruktur ist die Organisation in Form des Profit-Cost-Centers. In dieser Variante werden nicht nur in den Sparten alle Funktionen erfüllt, sondern noch zusätzlich je Sparte eine eigene Kostenrechnung durchgeführt, die den Erfolg jeder Sparte dokumentiert. Cost-Center: Unternehmensführung Produktgruppe 1 (Spartenleiter 1) Produktgruppe 2 (Spartenleiter 2) Personal, Verwaltung, Rechnungswesen, Absatz F&E Materialwirtschaft Fertigung F&E Materialwirtschaft Fertigung Kirchberger/König Seite 25
32 Profit-Center: Unternehmensführung Produktgruppe 1 (Spartenleiter 1) Produktgruppe 2 (Spartenleiter 2) Verwaltung F&E Materialwirtschaft Fertigung Absatz Rechnungsw esen Personal F&E Materialwirtschaft Fertigung Absatz Rechnungsw esen Personal Wie die beiden obigen Darstellungen zeigen, gibt es zwischen einem Profit- Center und einem Cost-Center einen wesentliche Unterschied: Profit-Center verfügen zumeist über alle Funktionen eines Betriebes (ähnlich einer Division bzw. Sparte) und es werden daher neben Kosten auch Erlöse/Umsätze spezifisch verrechnet/zugerechnet und diesbezügliche Kompetenzen an den Verantwortlichen abgetreten. Bei Cost-Centern werden lediglich Kosten zugerechnet und die damit verbundene Verantwortung an den Leiter abgegeben. Kirchberger/König Seite 26
33 Kirchberger/König Seite 27
34 3. Die Produktion Als Produktion wird im Allgemeinen jener Bereich im Rahmen des prozesualen Betriebsgeschehen angesehen, der unmittelbar auf die Hervorbringung von Betriebsleistungen ausgerichtet ist. 35 Im Rahmen des Produktionsprozesses erfolgt eine Transformation von Produktionsfaktoren (Input) in Erzeugnisse (Output). In der modernen Literatur wird anstelle des Begriffs Produktion die umfassendere Bezeichnung Leistungserstellung verwendet Leistungserstellung Die Leistungserstellung umfasst die Bereiche: 36 Gewinnung von Rohstoffen (Urproduktion), Herstellung von Erzeugnissen (Fabrikate) in Fertigungsbetrieben, Bearbeitung von Rohstoffen und Erzeugnissen in Bearbeitungsbetrieben (Veredelungsbetriebe), Erbringung von Dienstleistungen durch Dienstleistungsbetriebe. 35 Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 383 Kirchberger/König Seite 28
35 Die Leistungserstellung ist ein wesentlicher Bereich des gesamtbetrieblichen Geschehens, weitere Bereiche sind die Leistungsverwertung und die Finanzierung Grundfunktionen der betrieblichen Leistungserstellung Die betriebliche Leistungserstellung umfasst folgende wesentliche Grundfunktionen Beschaffung, Lagerhaltung und Fertigung. 38 Die Lagerhaltung ist neben dem Bereich der Leistungserstellung auch ein wichtiger Bestandteil im Bereich der Leistungsverwertung. Im Rahmen der Produktion geht es um die Lagerung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, sowie Rohprodukten (unfertige Erzeugnisse) im unmittelbaren Produktionsprozess. Im Bereich des Vertriebes geht es um die Lagerung von Fertigerzeugnissen und/oder Handelswaren. Bei der Lagerhaltung ist auch die Transportfunktion im Zuge der Leistungserstellung zu nennen. Hiebei geht es um den Gütertransport vom Be- 37 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 384 Kirchberger/König Seite 29
36 schaffungsmarkt bis zu den Transportwegen während einzelner Fertigungsschritte bzw. stufen. Die Beschaffung wird in einem eigenen Abschnitt behandelt Gestaltung des Produktionsprozesses Die Produktionsplanung hat folgende Problemfelder für das Unternehmen zu klären 39 Art der zu erstellenden Leistungen, Häufigkeit der Wiederholungen einzelner Fertigungsvorgänge (Breite des Fertigungsprogramms) und Kriterien für einen optimalen Produktionsumfang. Diese Überlegungen werden beeinflusst durch: 40 die betriebstechnische Ausstattung, die betrieblichen Kapazitäten, die Absatzmöglichkeiten, die Finanzierungsmöglichkeiten, die Kostenverhältnisse. 39 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 117 Kirchberger/König Seite 30
37 3.4. Fertigungsverfahren Die Fertigungsverfahren stellen die verschiedenen Möglichkeiten zur Gestaltung des Fertigungsprogramms und des Fertigungablaufs dar Einteilung von Fertigungsverfahren Nach dem Aufbau des Fertigungsprogramms kann unterschieden werden zwischen: Einzelfertigung; 2. Mehrfachfertigung: Massenfertigung, Serienfertigung, Sortenfertigung. Nach dem Fertigungsablauf kann unterschieden werden: Werkstättenfertigung, 2. Gruppenfertigung, 3. Fließfertigung. 41 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 390 Kirchberger/König Seite 31
38 Einzelfertigung Die Einzelfertigung 43 ist durch folgende Kriterien gekennzeichnet: spezielle Produktion nach Kundenwunsch, hoher Vertriebs- und Arbeitsvorbereitungsaufwand, qualifiziertes und anpassungsfähiges Personal. Vorteil Hohe Flexibilität Konjunkturelle Unabhängigkeit Nachteil Hohe Kosten (Personalintensität) Keine Festlegung auf spezielles Programm Massenfertigung Die Massenfertigung 44 ist durch folgende Kriterien gekennzeichnet: Herstellung gleicher Produkte in großer Menge: 1. einfache Massenfertigung Ein Endprodukt; 2. mehrfache Massenfertigung Kuppelprodukte (Zwangsweise Entstehung von Nebenprodukten); 3. Sonderfall: parallele Massenfertigung (spezielle Aggregate); qualifizierte Facharbeiter. 43 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 390 f. Kirchberger/König Seite 32
39 Vorteil Spezialisierung geringere Kosten (Personal und Anlagen) Fixkostendegression Nachteil unflexibel eine Festlegung auf spezielles Programm Serienfertigung Die Serienfertigung 45 ist durch folgende Kriterien gekennzeichnet: Fertigung einer Zahl gleicher Produkte, dann Umstellung auf andere Serie, Produktionsverwandtschaft zwischen den einzelnen Serien. Vorteil Spezialisierung geringere Kosten (Personal und Anlagen) Fixkostendegression Nachteil unflexibel eine Festlegung auf spezielles Programm Sortenfertigung Die Sortenfertigung zeichnet sich durch gleichzeitige Herstellung verschiedener Güter mit Rohstoff- und Produktionsverwandtschaft 46 aus. 45 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 392 Kirchberger/König Seite 33
40 Vorteil Spezialisierung mit gewisser Flexibilität Nachteil Insgesamt dennoch statisch Werkstattfertigung Die Werkstattfertigung 47 ist durch folgende Kriterien gekennzeichnet: örtliche Trennung der Fachabteilungen (Werkstätten); Abkopplung der Fertigungsschritte vom Produktionsfluss; Produkte berühren die Werkstätten nach Bedarf. Vorteil Spezialisierung Nachteil Lange Transportwege; Lagerkosten Weitere Fertigungsverfahren Gruppenfertigung: 48 Zusammenfassen mehrerer Teilproduktionsvorgänge um die Transportwege zu verkürzen. Fließfertigung: 49 Anordnung der Arbeitsvorgänge in nach produktionstechnischen Kriterien erforderlicher Reihenfolge; 47 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 392 f. 48 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 393 Kirchberger/König Seite 34
41 Vorteil Reduktion der Gesamtbearbeitungszeit Lagerersparnis geringere Raumkosten Nachteil Sehr unflexible Hohe Kosten durch Spezialisierung 3.5. Systematik der Produktionsfaktoren Abschließend sollen die im Produktionsprozess zur Leistungserstellung notwendigen Faktoren systematisiert werden. Produktionsfaktoren Dispositive Faktoren Elementarfaktoren Unter- Planung Werkstoff e nehmens- führung Organisation Betriebsmittel (ausführende) menschliche Arbeitsleistung Produktionsfaktoren Produktionsfaktoren lassen sich nach ihrem Verwendungszweck wie folgt klassifizieren 1. Rohstoffe 49 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 393 f. Kirchberger/König Seite 35
42 Werkstoffe direkter Verzehr, Hauptbestandteil des Erzeugnisses Hilfsstoffe direkter Verzehr, Nebenbestandteil des Erzeugnisses (Bsp.: Leim, Farbe etc.) Betriebsstoffe indirekter Verzehr, nicht Bestandteil des Erzeugnisses (Bsp.: Treibstoff, Energie, Kleinwerkzeug) 2. Betriebsmittel indirekter Verzehr, nicht Bestandteil des Erzeugnisses (Bsp.: Fertigungsmaschinen) Arten von Faktorverzehr Es gibt drei unterschiedliche Arten des Faktorverzehrs: 1. physischer Untergang im Produktionsprozess (ggf. mit Rückständen), 2. Energieumwandlung, 3. Verschleiß. Verschleiß kann auch ein nicht produktionsbedingter Verzehr (Vergeudung, Vernichtung, Verderb, Zeitverschleiß, Zugriff Unberechtigter) sein. Kirchberger/König Seite 36
43 Demzufolge ist Verzehr nicht notwendigerweise mit physischer Mengenabnahme gleichzusetzen. (z.b. kontinuierlicher Verschleiß einer Produktionsanlage) Produktionsfaktor: menschliche Arbeitsleistung Die menschliche Arbeitsleistung ist sowohl im ausführenden wie auch im dispositiven Bereich erforderlich Arten von Arbeitslöhnen Arbeitslohn Zeitlohn Leistungslohn Ergebnisbeteiligung Freiwillige sozial Leistungen Akkordlohn Prämienlohn Umsatzbeteiligung Zeitakkord Geldakkord Einzelakkord Gruppenakkord Einzelakkord Gruppenakkord Kirchberger/König Seite 37
44 Quelle: Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 138 Kirchberger/König Seite 38
45 Zeitlohn Von Zeitlohn wird gesprochen, wenn die Entlohnungsgrundlage für den Arbeitnehmer die Arbeits- bzw. Anwesenheitszeit ist. Der Lohn wird auf Basis von Stunden, Tagen, Wochen oder Monaten errechnet. Diese Form der Entlohnung bietet wenig Leistungsanreiz, da ein höheres Einkommen nur durch längere Arbeitszeit nicht jedoch durch mehr oder bessere Leistungen in der Zeiteinheit erzielt werden kann. Dennoch wird der Zeitlohn jedoch ü- berall dort zur Anwendung kommen, wo der Arbeitnehmer keinen Einfluss auf das Arbeitstempo nehmen kann und sich ein höheres Arbeitstempo negativ auf die Qualität des Erzeugnisses auswirken würde Akkordlohn Diese Art der Entlohung liegt vor, wenn ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Leistung (Ergebnis menschlicher Arbeit) und dem Entgelt besteht. 50 Eine Mehrleistung in der Zeiteinheit wirkt sich somit in Form eines höheren Entgelts aus. Es werden die beiden Grundvarianten Zeitakkord und Geldakkord unterschieden. 50 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 138 f. Kirchberger/König Seite 39
46 Prämienlohn Der Arbeitnehmer erhält einen Grundlohn (Zeitlohn) und hat die Möglichkeit durch besondere Leistungen eine Prämie zusätzlich zu verdienen. Dies wird sehr stark im Vertriebsbereich bei Verkäufern angewandt. Ein Autoverkäufer erhält beispielsweise ein monatliches Grundentgelt von 1.500,-- und bekommt pro verkauftem Auto eine zusätzliche Prämie von 100,--. Diese Variante wird auch als Umsatzbeteiligung bezeichnet. 51 Weiters gibt es auch Mehrleistungs-, Qualitätsprämien usw Ergebnis- bzw. Gewinnbeteiligung Es besteht auch die Möglichkeit Arbeitnehmer am Unternehmenserfolg bzw. Gewinn zu beteiligen. Diese Variante wird vor allem für das Management eingesetzt Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 142 f. Kirchberger/König Seite 40
47 4. Beschaffung Am Beginn des Prozesses der Leistungserstellung steht die Beschaffung der für den Produktionsprozess benötigten Güter. Unter Beschaffung sind all jene Tätigkeiten zu subsumieren, die der Bereitstellung jener Mittel dienen, die der Betrieb zur Erfüllung seiner Ziele benötigt. 53 Beschafft werden vorrangig Produktionsfaktoren wie: Betriebsmittel, Betriebsstoffe/Werkstoffe und auch menschliche Arbeitsleistung. 54 Der Betrieb tritt als Nachfrager auf folgenden Märkten auf: Waren- und Dienstleistungsmarkt, Arbeitsmarkt aber auch am Geld- und Kapitalmarkt. Es werden folgende Abteilungen in den Beschaffungsprozess miteingebunden: 55 Einkaufsabteilung, Personalabteilung und Finanzabteilung. 53 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 369 Kirchberger/König Seite 41
48 Am Arbeitsmarkt agiert die Personalabteilung, um geeignete Arbeitskräfte bereitzustellen. Die Finanzabteilung hat am Geld- und Kapitalmarkt zu agieren, um finanzielle Mittel zu beschaffen, die für die Betriebstätigkeit erforderlich sind. Die Beschaffung von Waren- und Dienstleistungen, die für die Produktion erforderlich sind, wird von der Einkaufsabteilung vorgenommen Materialbeschaffungsprozess Material- beschaffungs- management Materialbedarfsmanagement Material- bestands- management Materialflusssteuerung Der Beschaffungsprozess besteht aus den obigen Komponenten. Diese sollen in der Folge kurz umrissen werden. Kirchberger/König Seite 42
49 4.2. Beschreibung der Teilprozesse Materialbeschaffungsmanagement Das Materialbeschaffungsmanagement befasst sich vorrangig mit dem eigentlichen Bestellprozess. Dabei erfolgt die Suche nach den richtigen Lieferanten, die bspw. die Rohstoffe: kostengünstig, in hoher Qualität und verlässlich liefern Materialbedarfsplanung Die Materialbedarfsplanung setzt sich mit: dem erwarteten Bedarf, den vorhandenen Fertigungsplänen und dem zu erwartenden Absatz auseinander, um die richtige Qualität und Quantität an Materialien zur richtigen Zeit zur Verfügung zu haben. 56 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 372 Kirchberger/König Seite 43
50 Die Bedarfsplanung wird umso einfacher und genauer vorgenommen werden, je kleiner die Zahl der Artikel des Fertigungsprogramms (bzw. des Absatzplanes) ist; weniger Materialien für einen Artikeln gebraucht werden; größer die Losgrößen in der Fertigung sind, d.h. also, je weniger Umstellungen in der Produktion erfolgen müssen Material- und Bestandsmanagement Das Bestandsmanagement setzt sich mit der Frage nach der Höhe des richtigen Lagerbestandes auseinander. Dabei geht es sowohl um den richtigen Lagerbestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (eigentliches Materialbestandsmanagement), der für den reibungslosen Ablauf der Produktion erforderlich ist, wie auch um die Höhe des Lagerbestandes an Fertigprodukten (Bestandsmanagement). Somit ist das Materialbestandsmanagement ein Teil des Bestandsmanagement. Das Bestandsmanagement beschäftig sich noch zusätzlich mit den Beständen an Halb- und Fertigerzeugnissen, da insbesondere Produktion und Absatz häufig nicht synchron ablaufen, gilt es mithilfe des Lagers einen Ausgleich zu schaffen. 57 Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 373 Kirchberger/König Seite 44
51 Materialflusssteuerung Die Materialflusssteuerung ist eine Funktion, die als Klammer über alle eben genannten Bereiche des Beschaffungsprozesses zu sehen ist und helfen soll, alle Bereiche zu optimieren. Wesentliche Ansatzpunkte zur Optimierung dieser Abläufe liefert die Logistik. Kirchberger/König Seite 45
52 5. Der Absatz Unter Absatz versteht man alle Maßnahmen, die zur Verwertung der erzeugten Produkte oder der erstellten Dienstleistungen beitragen. Die Begriffe Absatz und Leistungsverwertung werden synonym verwendet. Ebenso wird der Begriff Vertrieb oft eingesetzt. Die Leistungsverwertung sichert den Rückfluss der Werte (Geldmittel), die für den Leistungserstellungsprozess eingesetzt wurden, und bildet die Basis für die Weiterführung der Produktionstätigkeit. 58 Der Absatz hat nicht nur die Funktion passiv zur Befriedigung einer vorhandene Nachfrage zu dienen, sondern die Erzeugung neuer Nachfrage durch das Wecken neuer Bedürfnisse zu fördern. 59 Schließlich kann die ganze Unternehmenskonzeption auf die optimale Befriedigung gegenwärtiger und künftiger Märkte ausgerichtet sein. Dies wird als Marketing bezeichnet. 58 Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 450 Kirchberger/König Seite 46
53 5.1. Absatzpolitische Instrumente Nachfolgend findet sich eine Liste der bedeutendsten absatzpolitischen Instrumente: Preispolitik, Produkt- und Sortimentsgestaltung, Kommunikationspolitik und Distributionspolitik. Entscheidend für den Erfolg eines Betriebes ist der optimale Mix obiger Instrumente. Diese werden nachfolgend kurz behandelt Preispolitik Grundsätzlich haben viele Unternehmen über die Preispolitik Möglichkeiten den Umsatz zu beeinflussen. Daraus lässt sich jedoch nicht ableiten, ob zb. niedrigere Preise zu mehr oder weniger Umsatz führen werden. Die Unternehmensgröße kann durchaus ein wesentlicher Faktor für die Preisgestaltung sein. 60 So haben kleine Unternehmen, mit einem geringen Marktanteil, oft keine Möglichkeit den Marktpreis zu beeinflussen. Vor allem trifft dies auf jene Fälle zu, in denen die angebotene Leistung leicht substituierbar ist. Hier haben sich Unternehmen an den Markpreisen zu orientieren und können dem- 60 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 483 Kirchberger/König Seite 47
54 nach bei gegebenem Preis ihr Unternehmensergebnis nur über die angebotene Menge optimieren (Mengenanpasser und Preisnehmer). 61 Anders sieht die Situation bei Unternehmen mit großem Marktanteil (Marktmacht) aus. Diese können durch: aktive Preispolitik (setzten von Preisen Preissetzer) oder Mengenpolitik (Anpassen der Menge, um den Preis zu beeinflussen) ihr Unternehmensergebnis optimieren Produktpolitik Das von einem Unternehmen angebotene Leistungsspektrum bietet ebenfalls die Möglichkeit den Absatz zu optimieren. Ein wesentliches Mittel ist die Produktpolitik, die sich mit drei Themen beschäftigt: 63 Produktinnovation (neue Produkte werden eingeführt): o Produktdifferenzierung, o Diversifikation; Produktvariation (Modifikation bestimmter Eigenschaften in vorhandenen Produkte); Produktelimination (Verzicht auf bisherige Produkte bzw. Produktgruppen Programmbereinigung). 61 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 443 f. 63 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 484 f. Kirchberger/König Seite 48
55 Gegenwärtige Märkte Neue Märkte Ansoff-Matrix Obige Möglichkeiten lassen sich in der Ansoff-Matrix, auch Produkt- Markt-Expansionsraster genannt, übersichtlich als (Wachstums-) Strategien darstellen. 64 Gegenwärtige Produkte Marktdurchdringungsstrategie Marktentwicklungsstrategie Neue Produkte Produktentwicklungsstrategie (Diversifizierungsstrategie) Quelle: Kotler/Bliemel (1995), S Kommunikationspolitik Diese wird als Sprachrohr des Marketing bezeichnet. Ziel ist es, tatsächlichen und potentiellen Abnehmern ein für den Absatz förderliches Bild vom jeweiligen Angebot und dem Unternehmen selbst zu vermitteln. 65 Die wichtigsten Formen der Kommunikationspolitik sind: Werbung, Verkaufsförderung, persönlicher Verkauf und Öffentlichkeitsarbeit Vgl. Kotler/Bliemel (1995), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 485 f. Kirchberger/König Seite 49
56 Die Werbung nimmt aufgrund der Entwicklung der Massenmedien wie Presse, Rundfunk, Fernsehen und verstärkt auch durch das Internet eine herausragende Stellung ein. Weitere Werbemittel sind Postwurfsendungen, Kataloge, Plakate und Werbezettel. Ziel der Werbung ist es, den Absatz eines Unternehmens mithilfe des Einsatzes von Werbemitteln zu fördern. Der Prognose des Erfolges von Werbemaßnahmen und der Erfolgskontrolle ist grundsätzliches Augenmerk zu schenken, wenngleich zum Teil erhebliche Schwierigkeiten bei der Quantifizierung und Erfolgszurechnung bestehen. 67 Bei verkaufsfördernden Maßnahmen geht es darum, kurzfristig den Absatz eines Produktes zu beeinflussen. 68 Die Öffentlichkeitsarbeit (Public Relation) versucht Informationen über das Unternehmen und seinen Werthaltungen (Normen, Werte und Leitbild des Unternehmens) zu kommunizieren, um dadurch die Einstellung der Öffentlichkeit gegenüber dem Unternehmen in gewünschter Weise zu steuern Distributionspolitik Hier geht es darum, geeignete Formen der Vertriebsorganisation bzw. das Vertriebssystem zu finden, um die erbrachten Leistung den Abnehmern zur Verfügung zu stellen Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 487 f. Kirchberger/König Seite 50
57 Hiebei sind zwei Arten der Distribution zu unterscheiden: Akquisitorische und Physische Distribution. 71 Erstere dient der Schaffung oder Ausweitung von Absatzmöglichkeiten und betrifft die Probleme von Distributionswegen (-kanälen) und deren Distributionsorgane. Die physische Distribution hingegen betrifft: die Verpackungs-, die Versand- die Transport-, die Lager- und die Lieferservicethematik. 71 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 488 Kirchberger/König Seite 51
58 5.6. Arten von Vertriebskanälen Abschließend werden noch die bedeutendsten Vertriebskanäle dargestellt Distribution im Konsumgüterbereich Einzelhändler händler Hersteller Großhändler Einzel- Konsument Großhändler Quelle: Kotler/Bliemel (1995), S. 807 Jobber Einzelhändler Da es im Vertriebsprozess einen Unterschied ausmacht, ob Unternehmen für Endverbraucher (Konsumenten) produzieren oder für Industrieunternehmen, sehen auch die Distributionskanäle anders aus. Kirchberger/König Seite 52
59 Distribution im Industriegüterbereich derlassung Industrie- unterneh- men Herstelleigene Industriegroßhandel Generalvertretung Hersteller Verkaufsnie- Quelle: Kotler/Bliemel (1995), S. 807 Kirchberger/König Seite 53
60 6. Unternehmensführung und Management Die Unternehmensführung hat die Aufgabe alle Entscheidungen, die nur aus dem Ganzen des Unternehmens heraus getroffen werden können, zu fällen. Die Gesamtheit der mit überwiegend dispositiven Aufgaben beschäftigen Personen bezeichnet man als Management, wobei sich dieses grundsätzlich in: Top-Management (mitarbeitende Eigentümer, Geschäftsführer, Vorstand), Middle-Management (Leiter der einzelnen Funktionsbereiche wie Einkauf, Produktion, Verwaltung, Finanzen,...) und Lower-Management (wie Abteilungsleiter, Meister, Vorarbeiter) unterteilen lässt. 72 Das markante an der Unternehmensführung ist, dass diese richtungsweisende, das gesamte Unternehmen betreffende Entscheidungen fällt Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 64 Kirchberger/König Seite 54
61 6.1. Die Unternehmensführung als Träger von Entscheidungen Führungsentscheidungen weisen folgende Merkmale auf: 74 sie sind für den Bestand des Unternehmens von grundlegender Bedeutung, sie betreffen das Unternehmen als Ganzes und sie sind nicht an untere Instanzen delegierbar. Beispiele für Führungsentscheidungen: 75 Vorgabe von Unternehmenszielen, Festlegung der Unternehmenspolitik, Koordination von Teilbereichen, Personalpolitik Unternehmensziele An dieser Stelle werden Unternehmensziele nach: ihren inhaltlichen Kriterien, ihrem angestrebten Ausmaß und ihren zeitlichen Bezug 74 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 64 Kirchberger/König Seite 55
62 eingeteilt. 76 Diese drei Kriterien bezeichnet man als Zieldimensionen, die als Mindestanforderung bei der Formulierung eines realisierbaren Zieles anzusehen sind Inhalt von Zielen Quantifizierbare Ziele: 77 Streben nach ausreichendem Gewinn, Streben nach Aufrechterhaltung des finanziellen Gleichgewichtes, Streben nach Produktivität, Streben nach Wirtschaftlichkeit, Streben nach Liquidität. Die Realisierbarkeit dieser Ziele lässt sich zumeist relativ gut messen. Nicht-Quantifizierbare Ziele: 78 Streben nach Unabhängigkeit/Vereinigung/Kooperation, Streben nach Prestige, Streben nach Macht, ethnische und soziale Bestrebungen. 76 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 69 Kirchberger/König Seite 56
63 Bei der Gruppe der Nicht-Quantifizierbaren Ziele ist vor allem die Messung des Zielerreichungsgrades mit erheblichen Problemen verbunden Ausmaß von Zielen Hiebei kann zwischen: unbegrenzt formulierten und begrenzt formulierten Zielen unterschieden werden Zeitlicher Bezug von Zielen Durch den zeitlichen Bezug wird die Frist festgelegt in der ein Ziel erreicht werden soll. Hiebei lassen sich: kurz-, mittel- und langfristige Ziele unterscheiden Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 77 Kirchberger/König Seite 57
64 Einteilung nach der Stellung im Zielsystem Ziele könne auch anhand ihrer Stellung im Zielsystem eingeteilt werden. Wobei grundsätzlich: Oberziele, Zwischenziele und Unterziele unterschieden werden können. 81 Diese Einteilung lässt sich anhand eines kurzen Beispiels verdeutlichen: Oberziel Unternehmungsführung (Gewinnerzielung, Erhöhung der Rentabilität) Zwischen- Produktionsbereich Finanzbereich Absatzbereich ziele Senkung der Produkti- Verbesserung der Ka- Steigerung des Umsat- onskosten pitalstruktur zes Unterziele Senkung der Lohnkosten Senkung des Materialverbrauches Verbesserung der Instandhaltung der Maschine Beschaffung langfristiger Kredite Beschaffung zinsgünstiger Kredite Gutes Mahnwesen Verbesserung des Vertriebssystems Besseres Sortiment Niedrigere Einführungspreis Quelle: Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 79 Kirchberger/König Seite 58
65 6.3. Führungsstile Um Unternehmensziele erreichen zu können, ist es für das Management notwendig, zu führen. Dies kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Nachfolgend werden die wesentlichsten Führungsstile erläutert Patriarchalischer Führungsstil Der patriarchalische Führungsstil weist folgende Kriterien auf: 82 Absoluter Herrschaftsanspruch des Patriarchen liegt vor. Mitarbeiter werden an der Führung nicht beteiligt. Die Organisationsform ist einfach und wird oft in kleinen Gruppen praktiziert. Ein Leitbild,,Vater-Kinder" begründet einen Treue- und Versorgungsanspruch gegenüber den Mitarbeitern Charismatischer Führungsstil Der charismatische Führungsstil ist dem patriarchalischen ähnlich und zeigt einige zusätzliche Merkmale: Herrschaftsanspruch leitet sich aus dem Charisma des Führers ab und wird akzeptiert. Untergebene sind mit Verheißung einmaliger, überraschender Erfolge für jede Aufgabe zu begeistern. 81 Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S Vgl. Lechner/Egger/Schauer (2001), S. 118 Kirchberger/König Seite 59
Industrielle Betriebswirtschaftslehre. Wintersemester 2008/2009 Gruppe 1E: Donnerstags, 17:00 18:30 Uhr Raum B 256
 Industrielle Betriebswirtschaftslehre Wintersemester 2008/2009 Gruppe 1E: Donnerstags, 17:00 18:30 Uhr Raum B 256 Seite 2 Vorlesung IBL I. Kontakt. Dr. Stefan Zanner Email: stefan.zanner@lrz.fh-muenchen.de
Industrielle Betriebswirtschaftslehre Wintersemester 2008/2009 Gruppe 1E: Donnerstags, 17:00 18:30 Uhr Raum B 256 Seite 2 Vorlesung IBL I. Kontakt. Dr. Stefan Zanner Email: stefan.zanner@lrz.fh-muenchen.de
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre
 Einführung in die Betriebswirtschaftslehre Dipl. Betriebswirtin (FH) Nicole Kalina-Klensch www.fh-kl.de 21.10.2011 Überblick Produktionsfaktoren Volkswirtschaftliche PF Betriebswirtschaftliche PF Ökonomisches
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre Dipl. Betriebswirtin (FH) Nicole Kalina-Klensch www.fh-kl.de 21.10.2011 Überblick Produktionsfaktoren Volkswirtschaftliche PF Betriebswirtschaftliche PF Ökonomisches
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. für die Verwaltung
 Schriftenreihe der Forschungsstelle für Betriebsführung und Personalmanagement e.v. Band 7 Einführung in die Betriebswirtschaftslehre für die Verwaltung von Prof. Dr. Peter Cornelius Prof. Dr. Roland Dincher
Schriftenreihe der Forschungsstelle für Betriebsführung und Personalmanagement e.v. Band 7 Einführung in die Betriebswirtschaftslehre für die Verwaltung von Prof. Dr. Peter Cornelius Prof. Dr. Roland Dincher
Kapitel 1 Grundlagen der Wirtschaft
 Kapitel 1 Grundlagen der Wirtschaft Jeder Mensch hat Bedürfnisse, sie sind unbegrenzt unterschiedlich wandelbar von verschiedenen Bedingungen abhängig mehr oder minder dringlich 30.01.2014 BWL 2 Bedürfnisse
Kapitel 1 Grundlagen der Wirtschaft Jeder Mensch hat Bedürfnisse, sie sind unbegrenzt unterschiedlich wandelbar von verschiedenen Bedingungen abhängig mehr oder minder dringlich 30.01.2014 BWL 2 Bedürfnisse
1. Gegenstand und Methoden der Betriebswirtschaftslehre 1 / 12
 1. Gegenstand und Methoden der Betriebswirtschaftslehre 1 / 12 1.1 Wirtschaften und wirtschaftliches Prinzip 2 1.2 Die Güterarten 5 1.3 Der Betrieb als Objekt der Betriebswirtschaftslehre 6 1.3.1 Definition
1. Gegenstand und Methoden der Betriebswirtschaftslehre 1 / 12 1.1 Wirtschaften und wirtschaftliches Prinzip 2 1.2 Die Güterarten 5 1.3 Der Betrieb als Objekt der Betriebswirtschaftslehre 6 1.3.1 Definition
Hauptfunktionen im Unternehmen
 1.2 Hauptfunktionen im Unternehmen Folie 1 Hauptfunktionen im Unternehmen 1.2 Hauptfunktionen im Unternehmen Folie 2 1.2.2 Wechselwirkungen Rechnungswesen Skript IHK Augsburg in Überarbeitung Christian
1.2 Hauptfunktionen im Unternehmen Folie 1 Hauptfunktionen im Unternehmen 1.2 Hauptfunktionen im Unternehmen Folie 2 1.2.2 Wechselwirkungen Rechnungswesen Skript IHK Augsburg in Überarbeitung Christian
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Wozu brauchen wir Unternehmen? Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Wozu brauchen wir Unternehmen? Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de III Unternehmen und Unternehmensgründung Beitrag
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Wozu brauchen wir Unternehmen? Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de III Unternehmen und Unternehmensgründung Beitrag
1 Grundlagen Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre Produktionsfaktoren des Betriebes 7
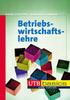 Inhalt Seite 1 Grundlagen 1 1.1 Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre 1 1.1.1 Wirtschaften als Erkenntnisobjekt der Betriebswirtschaftslehre 1 1.1.2 Betrieb als Erfahrungsobjekt der Betriebswirtschaftslehre
Inhalt Seite 1 Grundlagen 1 1.1 Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre 1 1.1.1 Wirtschaften als Erkenntnisobjekt der Betriebswirtschaftslehre 1 1.1.2 Betrieb als Erfahrungsobjekt der Betriebswirtschaftslehre
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. für die Verwaltung
 Schriftenreihe der Forschungsstelle für Betriebsführung und Personalmanagement e.v. Band 7 Einführung in die Betriebswirtschaftslehre für die Verwaltung von Prof. Dr. Roland Dincher Prof. Dr. Heinrich
Schriftenreihe der Forschungsstelle für Betriebsführung und Personalmanagement e.v. Band 7 Einführung in die Betriebswirtschaftslehre für die Verwaltung von Prof. Dr. Roland Dincher Prof. Dr. Heinrich
Ein Unternehmen, was ist das eigentlich? Grundfunktionen, Ziele und gesellschaftliche Stellung von Betrieben
 Ein Unternehmen, was ist das eigentlich? Grundfunktionen, Ziele und gesellschaftliche Stellung von Betrieben Von Annika Prescher, Norderney Themen: Ziele: Die betrieblichen Grundfunktionen: Beschaffung
Ein Unternehmen, was ist das eigentlich? Grundfunktionen, Ziele und gesellschaftliche Stellung von Betrieben Von Annika Prescher, Norderney Themen: Ziele: Die betrieblichen Grundfunktionen: Beschaffung
Unternehmen: Grundfunktionen, Ziele und gesellschaftliche Stellung Reihe 13 S 1. Verlauf Material Klausuren Glossar Literatur
 Reihe 13 S 1 Verlauf Material Ein Unternehmen, was ist das eigentlich? Grundfunktionen, Ziele und gesellschaftliche Stellung von Betrieben Von Annika Prescher, Norderney Themen: Die betrieblichen Grundfunktionen:
Reihe 13 S 1 Verlauf Material Ein Unternehmen, was ist das eigentlich? Grundfunktionen, Ziele und gesellschaftliche Stellung von Betrieben Von Annika Prescher, Norderney Themen: Die betrieblichen Grundfunktionen:
Hauptfunktionen im Unternehmen
 1.2 Hauptfunktionen im Unternehmen Folie 1 Hauptfunktionen im Unternehmen 1.2 Hauptfunktionen im Unternehmen Folie 2 1.2.1 Funktionen 1.2.2 Wechselwirkungen 1.2.1 Funktionen Folie 3 Finanzbereich Leistungsbereich
1.2 Hauptfunktionen im Unternehmen Folie 1 Hauptfunktionen im Unternehmen 1.2 Hauptfunktionen im Unternehmen Folie 2 1.2.1 Funktionen 1.2.2 Wechselwirkungen 1.2.1 Funktionen Folie 3 Finanzbereich Leistungsbereich
Organisationsformen LMU Student und Arbeitsmarkt - Kurs Personalwesen WS 2016/17
 Organisationsformen 29.10.2016 LMU Student und Arbeitsmarkt - Kurs Personalwesen WS 2016/17 1 Ziel Verständnis für den unterschiedlichen Aufbau von Organisationen. In der Personalabteilung arbeitet man
Organisationsformen 29.10.2016 LMU Student und Arbeitsmarkt - Kurs Personalwesen WS 2016/17 1 Ziel Verständnis für den unterschiedlichen Aufbau von Organisationen. In der Personalabteilung arbeitet man
1 Das Wirtschaften von sozialen Organisationen
 1 Das Wirtschaften von sozialen Organisationen 1.1 Knappheit der Mittel Die Knappheit der Mittel ist das Schicksal der Menschen. Nur in der Traumwelt des Schlaraffenlandes können sie diesem Los entkommen.
1 Das Wirtschaften von sozialen Organisationen 1.1 Knappheit der Mittel Die Knappheit der Mittel ist das Schicksal der Menschen. Nur in der Traumwelt des Schlaraffenlandes können sie diesem Los entkommen.
Informationsblatt: Aufgaben des Rechnungswesens
 Informationsblatt: Aufgaben des Rechnungswesens Arbeitsauftrag: Nr. 1 Think: Lies in Einzelarbeit den nachfolgenden Text und beantworte die darin enthaltenen Fragen. Nr. 2 Square: Vergleiche Deine Antworten
Informationsblatt: Aufgaben des Rechnungswesens Arbeitsauftrag: Nr. 1 Think: Lies in Einzelarbeit den nachfolgenden Text und beantworte die darin enthaltenen Fragen. Nr. 2 Square: Vergleiche Deine Antworten
Fachhochschule Deggendorf
 Fachhochschule Deggendorf Entscheidungsorientierte Einführung in die Betriebswirtschaftslehre Prof. Dr. Thomas Bartscher Fachhochschule Deggendorf Kapitel 1 Der Alltag eines Unternehmers Ein Angebot der
Fachhochschule Deggendorf Entscheidungsorientierte Einführung in die Betriebswirtschaftslehre Prof. Dr. Thomas Bartscher Fachhochschule Deggendorf Kapitel 1 Der Alltag eines Unternehmers Ein Angebot der
Wie werden Güter und Dienstleistungen erzeugt?
 Wie werden Güter und Dienstleistungen erzeugt? Die Produktion und ihre Faktoren Definition (Volkswirtschaft) Produktion sind sämtliche Handlungen, mit deren Hilfe Sachgüter gewonnen, umgeformt und bearbeitet,
Wie werden Güter und Dienstleistungen erzeugt? Die Produktion und ihre Faktoren Definition (Volkswirtschaft) Produktion sind sämtliche Handlungen, mit deren Hilfe Sachgüter gewonnen, umgeformt und bearbeitet,
Entscheidungsorientierte Einführung in die Betriebswirtschaftslehre
 Entscheidungsorientierte Einführung in die Betriebswirtschaftslehre Prof. Dr. Johann Nagengast Technische Hochschule Deggendorf Kapitel 1 Der Alltag eines Unternehmers Ein Angebot der vhb - virtuelle hochschule
Entscheidungsorientierte Einführung in die Betriebswirtschaftslehre Prof. Dr. Johann Nagengast Technische Hochschule Deggendorf Kapitel 1 Der Alltag eines Unternehmers Ein Angebot der vhb - virtuelle hochschule
Ökonomisches Prinzip. Lösung: Spannungsverhältnis knappe Ressourcen unbegrenzte Menschliche Bedürfnisse
 Ökonomisches Prinzip Spannungsverhältnis knappe Ressourcen unbegrenzte Menschliche Bedürfnisse Lösung: ökonomisches Prinzip, möglichst günstiges Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag 1. Maximalprinzip:
Ökonomisches Prinzip Spannungsverhältnis knappe Ressourcen unbegrenzte Menschliche Bedürfnisse Lösung: ökonomisches Prinzip, möglichst günstiges Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag 1. Maximalprinzip:
Marketing 6 Marketing-Management
 1 Marketing 6 Marketing-Management Prof. Dr. H.P. Wehrli 6 Marketing-Management 2 61 Management 3 Wenn mehrere Menschen in einem sozialen System arbeitsteilig Probleme lösen, tritt das Phänomen der Führung
1 Marketing 6 Marketing-Management Prof. Dr. H.P. Wehrli 6 Marketing-Management 2 61 Management 3 Wenn mehrere Menschen in einem sozialen System arbeitsteilig Probleme lösen, tritt das Phänomen der Führung
Vorgaben zur Erstellung eines Businessplans
 Vorgaben zur Erstellung eines Businessplans 1. Planung Dem tatsächlichen Verfassen des Businessplans sollte eine Phase der Planung vorausgehen. Zur detaillierten Ausarbeitung eines Businessplans werden
Vorgaben zur Erstellung eines Businessplans 1. Planung Dem tatsächlichen Verfassen des Businessplans sollte eine Phase der Planung vorausgehen. Zur detaillierten Ausarbeitung eines Businessplans werden
Andreas Daum I Jürgen Petzold Matthias Pletke. BWL für Juristen. Eine praxisnahe Einführung in die betriebswirtschaftlichen Grundlagen GABLER
 Andreas Daum I Jürgen Petzold Matthias Pletke BWL für Juristen Eine praxisnahe Einführung in die betriebswirtschaftlichen Grundlagen GABLER Inhaltsverzeichnis Vorwort V 1 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre
Andreas Daum I Jürgen Petzold Matthias Pletke BWL für Juristen Eine praxisnahe Einführung in die betriebswirtschaftlichen Grundlagen GABLER Inhaltsverzeichnis Vorwort V 1 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre
Name:... Studienrichtung:... Teilklausur Grundlagen des Management Grundlagen der Allgemeinen BWL Sommersemester
 TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN Fachbereich Wirtschaft und Management Institut für Betriebswirtschaftslehre Lehrgebiet Strategisches Controlling Prof. Dr. U. Krystek Punktzahl: Name:... Studienrichtung:...
TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN Fachbereich Wirtschaft und Management Institut für Betriebswirtschaftslehre Lehrgebiet Strategisches Controlling Prof. Dr. U. Krystek Punktzahl: Name:... Studienrichtung:...
Fertigungsverfahren und Fertigungsprinzipien
 Fertigungsverfahren und Fertigungsprinzipien Fertigungsverfahren und Fertigungsprinzipien Lars Erkelenz, Jochen Dirkling, Wiebke Goller 1 Gliederung 1. Fertigungsverfahren 1. Werkstattfertigung 2. Reihen-
Fertigungsverfahren und Fertigungsprinzipien Fertigungsverfahren und Fertigungsprinzipien Lars Erkelenz, Jochen Dirkling, Wiebke Goller 1 Gliederung 1. Fertigungsverfahren 1. Werkstattfertigung 2. Reihen-
DAA Wirtschafts-Lexikon
 DAA Wirtschafts-Lexikon Aufbauorganisation Unter Aufbauorganisation ist die Planung und Umsetzung der statischen Strukturierung der Aufgabenhierarchie in einem Unternehmen und damit die Regelung der Unterstellung
DAA Wirtschafts-Lexikon Aufbauorganisation Unter Aufbauorganisation ist die Planung und Umsetzung der statischen Strukturierung der Aufgabenhierarchie in einem Unternehmen und damit die Regelung der Unterstellung
Business Workshop. Reorganisation. Die Entwicklung der idealen Organisation
 Business Workshop Organisation GRONBACH Die Entwicklung der idealen Organisation Jedes Unternehmen steht irgendwann vor der Aufgabe, die Organisation an den aktuellen oder künftigen Gegebenheit anzupassen.
Business Workshop Organisation GRONBACH Die Entwicklung der idealen Organisation Jedes Unternehmen steht irgendwann vor der Aufgabe, die Organisation an den aktuellen oder künftigen Gegebenheit anzupassen.
Stabsstellen. Instanzen
 Stellenarten Leitungssysteme im Unternehmen im Unternehmen Ausführende Stellen Stabsstellen Dienstleistungsstellen Ausführungs-, ggf. Verfügungskompetenzen Unmittelbar am Leistungserstellungsprozess beteiligt
Stellenarten Leitungssysteme im Unternehmen im Unternehmen Ausführende Stellen Stabsstellen Dienstleistungsstellen Ausführungs-, ggf. Verfügungskompetenzen Unmittelbar am Leistungserstellungsprozess beteiligt
Betriebliche Funktionen
 Betriebliche Funktionen oder auch als betriebswirtschaftliche Funktionen bezeichnet Jedes Unternehmen besteht aus gegeneinander abgegrenzten Organisationseinheiten. Die Organisationseinheiten tragen je
Betriebliche Funktionen oder auch als betriebswirtschaftliche Funktionen bezeichnet Jedes Unternehmen besteht aus gegeneinander abgegrenzten Organisationseinheiten. Die Organisationseinheiten tragen je
Einführung 1. Einführung S. 14. Was versteht man unter dem Begriff Wirtschaft? Unter dem Begriff Wirtschaft verstehen wir
 Einführung 1 Was versteht man unter dem Begriff Wirtschaft? Unter dem Begriff Wirtschaft verstehen wir alles, was Menschen unternehmen, um ihre Bedürfnisse zu decken z.b. Bedürfnisse nach Nahrung, Wohnraum,
Einführung 1 Was versteht man unter dem Begriff Wirtschaft? Unter dem Begriff Wirtschaft verstehen wir alles, was Menschen unternehmen, um ihre Bedürfnisse zu decken z.b. Bedürfnisse nach Nahrung, Wohnraum,
Betriebswirtschaftslehre im Grundstudium 1
 Klaus-Peter Kistner Marion Steven Betriebswirtschaftslehre im Grundstudium 1 Produktion, Absatz, Finanzierung Vierte, aktualisierte Auflage mit 100 Abbildungen und 17 Tabellen Physica-Verlag Ein Unternehmen
Klaus-Peter Kistner Marion Steven Betriebswirtschaftslehre im Grundstudium 1 Produktion, Absatz, Finanzierung Vierte, aktualisierte Auflage mit 100 Abbildungen und 17 Tabellen Physica-Verlag Ein Unternehmen
Durchsetzung. Informationen. Realisierung. Management als informationsverarbeitender Entscheidungsprozess
 Planung Realisierung Durchsetzung Kontrolle Informationen Abb. 1-1: Management als informationsverarbeitender Entscheidungsprozess Beschaffungsmärkte Realgut- Produktionsfaktoren Produkte Absatzmärkte
Planung Realisierung Durchsetzung Kontrolle Informationen Abb. 1-1: Management als informationsverarbeitender Entscheidungsprozess Beschaffungsmärkte Realgut- Produktionsfaktoren Produkte Absatzmärkte
Inhaltsübersicht. Inhaltsübersicht
 Inhaltsübersicht 1. Kapitel Grundlagen einer Verwaltungsbetriebslehre I. Entwicklungstendenzen und Funktionswandel im öffentlichen Dienst Begründung für die Notwendigkeit einer Verwaltungsbetriebslehre
Inhaltsübersicht 1. Kapitel Grundlagen einer Verwaltungsbetriebslehre I. Entwicklungstendenzen und Funktionswandel im öffentlichen Dienst Begründung für die Notwendigkeit einer Verwaltungsbetriebslehre
Studienbrief (Auszug) Sportbetriebswirt. Betriebswirtschaftslehre. Bilder: vic&dd, 2011 Benutzung unter Lizenz von Shutterstock.
 Studienbrief (Auszug) Sportbetriebswirt Bilder: vic&dd, 2011 Benutzung unter Lizenz von Shutterstock.com 1 Grundbegriffe der Wirtschaftsprozess der Unternehmung Betrachtet man den Leistungs- und den Finanzprozess
Studienbrief (Auszug) Sportbetriebswirt Bilder: vic&dd, 2011 Benutzung unter Lizenz von Shutterstock.com 1 Grundbegriffe der Wirtschaftsprozess der Unternehmung Betrachtet man den Leistungs- und den Finanzprozess
Betriebswirtschaftslehre
 Klaus-Peter Kistner Marion Steven Betriebswirtschaftslehre im Grundstudium 1 Produktion, Absatz, Finanzierung Dritte, neubearbeitete und erweiterte Auflage Mit 101 Abbildungen und 17 Tabellen Physica-Verlag
Klaus-Peter Kistner Marion Steven Betriebswirtschaftslehre im Grundstudium 1 Produktion, Absatz, Finanzierung Dritte, neubearbeitete und erweiterte Auflage Mit 101 Abbildungen und 17 Tabellen Physica-Verlag
2. Die betrieblichen Produktionsfaktoren 1 / 10
 2. Die betrieblichen Produktionsfaktoren 1 / 10 2.1 DIE PRODUKTIONSFAKTOREN 2 2.1.1 AUS VOLKSWIRTSCHAFTLICHER SICHT 2 2.1.2 AUS BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHER SICHT 3 2.2 DIE FUNKTIONEN DES DISPOSITIVEN FAKTORS
2. Die betrieblichen Produktionsfaktoren 1 / 10 2.1 DIE PRODUKTIONSFAKTOREN 2 2.1.1 AUS VOLKSWIRTSCHAFTLICHER SICHT 2 2.1.2 AUS BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHER SICHT 3 2.2 DIE FUNKTIONEN DES DISPOSITIVEN FAKTORS
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre
 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre Gegenstand der BWL und Basics Technische Studiengänge Dr. Horst Kunhenn Fachhochschule Münster, ITB Steinfurt Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Dr. Horst Kunhenn
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre Gegenstand der BWL und Basics Technische Studiengänge Dr. Horst Kunhenn Fachhochschule Münster, ITB Steinfurt Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Dr. Horst Kunhenn
Die Zielsetzungen der Betriebe
 34 Teil 1: Die Betriebswirtschaftslehre Die Zielsetzungen der Betriebe Unternehmensziele sind in der BWL die Zielsetzungen, die der unternehmerischen Betätigung zugrundeliegen. Ökonomische Ziele Das Hauptziel
34 Teil 1: Die Betriebswirtschaftslehre Die Zielsetzungen der Betriebe Unternehmensziele sind in der BWL die Zielsetzungen, die der unternehmerischen Betätigung zugrundeliegen. Ökonomische Ziele Das Hauptziel
Volkswirtschaftliche Grundlagen
 Themenbereich I: Volkswirtschaftliche Grundlagen 1 Volkswirtschaftliche Grundlagen Themenbereich I: Volkswirtschaftliche Grundlagen 2 Volkswirtschaftslehre Mikroökonomie Makroökonomie Wirtschaftspolitik
Themenbereich I: Volkswirtschaftliche Grundlagen 1 Volkswirtschaftliche Grundlagen Themenbereich I: Volkswirtschaftliche Grundlagen 2 Volkswirtschaftslehre Mikroökonomie Makroökonomie Wirtschaftspolitik
Material- und Warenwirtschaft BWL Berufsreifeprüfung
 Material- und Warenwirtschaft BWL Berufsreifeprüfung 1. Material- und Warenwirtschaft im Überblick Tätigkeit und Teilbereiche der Material- und Warenwirtschaft Hat die Aufgabe, die von einem Unternehmen
Material- und Warenwirtschaft BWL Berufsreifeprüfung 1. Material- und Warenwirtschaft im Überblick Tätigkeit und Teilbereiche der Material- und Warenwirtschaft Hat die Aufgabe, die von einem Unternehmen
Betriebliche Funktionsbereiche
 Betriebliche Funktionsbereiche Beschaffung Produktion Absatz Prof. Dr. Güdemann Allgemeine BWL 2. 2.1 Funktion Beschaffung Produktionsfaktor Beispiel Arbeit Mitarbeiter Betriebsmittel Investitionsgüter
Betriebliche Funktionsbereiche Beschaffung Produktion Absatz Prof. Dr. Güdemann Allgemeine BWL 2. 2.1 Funktion Beschaffung Produktionsfaktor Beispiel Arbeit Mitarbeiter Betriebsmittel Investitionsgüter
Betriebswirtschaft und Unternehmensführung
 Dr. oec. HSG Michael Käppeli Betriebswirtschaft und Unternehmensführung Eine Einführung in unternehmerisches Denken und Handeln Versus Zürich Inhaltsverzeichnis Kapitel 1 Das Unternehmen als Teil von Wirtschaft
Dr. oec. HSG Michael Käppeli Betriebswirtschaft und Unternehmensführung Eine Einführung in unternehmerisches Denken und Handeln Versus Zürich Inhaltsverzeichnis Kapitel 1 Das Unternehmen als Teil von Wirtschaft
Zielsetzung. Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Ziele können unterschieden werden nach:
![Zielsetzung. Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Ziele können unterschieden werden nach: Zielsetzung. Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Ziele können unterschieden werden nach:](/thumbs/50/26220103.jpg) Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Zielsetzung Jedes Unternehmen setzt sich Ziele Egal ob ein Unternehmen neu gegründet oder eine bestehende Organisation verändert werden soll, immer wieder
Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Zielsetzung Jedes Unternehmen setzt sich Ziele Egal ob ein Unternehmen neu gegründet oder eine bestehende Organisation verändert werden soll, immer wieder
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre für Nicht- Wirtschaftswissenschaftler: Kapitel 1. Prof. Dr. Leonhard Knoll
 Einführung in die Betriebswirtschaftslehre für Nicht- Wirtschaftswissenschaftler: Kapitel 1 Prof. Dr. Leonhard Knoll Kapitel 1 1. Was ist Betriebswirtschaftslehre? 1.1. Das Abgrenzungsproblem 1.2. Definitionsversuch
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre für Nicht- Wirtschaftswissenschaftler: Kapitel 1 Prof. Dr. Leonhard Knoll Kapitel 1 1. Was ist Betriebswirtschaftslehre? 1.1. Das Abgrenzungsproblem 1.2. Definitionsversuch
VERSTEHEN UND VERARBEITEN EINES HÖRTEXTES
 VERSTEHEN UND VERARBEITEN EINES HÖRTEXTES Die Betriebswirtschaftslehre als Entscheidungslehre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Die Betriebswirtschaftslehre ist in Deutschland ein sehr beliebtes Studienfach.
VERSTEHEN UND VERARBEITEN EINES HÖRTEXTES Die Betriebswirtschaftslehre als Entscheidungslehre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Die Betriebswirtschaftslehre ist in Deutschland ein sehr beliebtes Studienfach.
Betriebswirtschaftslehre Wintersemester 2016/17. Prof. Dr. Laszlo Goerke Lehrstuhl für Personalökonomik
 Betriebswirtschaftslehre Wintersemester 2016/17 Prof. Dr. Laszlo Goerke Lehrstuhl für Personalökonomik 1 Was ist BWL? 2 Was ist BWL I? Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre ist die Untersuchung von individuellen,
Betriebswirtschaftslehre Wintersemester 2016/17 Prof. Dr. Laszlo Goerke Lehrstuhl für Personalökonomik 1 Was ist BWL? 2 Was ist BWL I? Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre ist die Untersuchung von individuellen,
Dozentenskript zum Wöhe : 2. Abschnitt
 Dozentenskript zum Wöhe : 2. Abschnitt Wöhe / Döring / Brösel 26. Auflage, 2016 Verlag Vahlen 2. Abschnitt Folie 1 Alle Hinweise auf Seiten, Kapitel und Abbildungen in diesem Skript beziehen sich auf das
Dozentenskript zum Wöhe : 2. Abschnitt Wöhe / Döring / Brösel 26. Auflage, 2016 Verlag Vahlen 2. Abschnitt Folie 1 Alle Hinweise auf Seiten, Kapitel und Abbildungen in diesem Skript beziehen sich auf das
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre
 Prof. Dr. Fritz Unger Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre November 2015 MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION IM FERNSTUDIENGANG UNTERNEHMENSFÜHRUNG Modul 1 Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen 1.1
Prof. Dr. Fritz Unger Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre November 2015 MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION IM FERNSTUDIENGANG UNTERNEHMENSFÜHRUNG Modul 1 Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen 1.1
BWL für Ingenieure und Ingenieurinnen
 Andreas Daum Wolfgang Greife Rainer Przywara BWL für Ingenieure und Ingenieurinnen Was man über Betriebswirtschaft wissen sollte Mit 146 Bildern und 31 Tabellen STUDIUM VIEWEG+ TEUBNER VII 1 Einleitung
Andreas Daum Wolfgang Greife Rainer Przywara BWL für Ingenieure und Ingenieurinnen Was man über Betriebswirtschaft wissen sollte Mit 146 Bildern und 31 Tabellen STUDIUM VIEWEG+ TEUBNER VII 1 Einleitung
Durch- Informationen. Realisie- Abb. 1-1: Management als informationsverarbeitender Entscheidungsprozess
 Informationen Durch- Planung setzung Kontrolle Realisie- rung Abb. 1-1: Management als informationsverarbeitender Entscheidungsprozess Realgut- Produktionsfaktoren Beschaffungsmärkte Produkte Einstandspreise
Informationen Durch- Planung setzung Kontrolle Realisie- rung Abb. 1-1: Management als informationsverarbeitender Entscheidungsprozess Realgut- Produktionsfaktoren Beschaffungsmärkte Produkte Einstandspreise
Betriebswirtschaftslehre
 Betriebswirtschaftslehre Eine Einführung unter besonderer Berücksichtigung öffentlicher Betriebe von Reinhard Wolff Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Offenburg Zweite, überarbeitete
Betriebswirtschaftslehre Eine Einführung unter besonderer Berücksichtigung öffentlicher Betriebe von Reinhard Wolff Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Offenburg Zweite, überarbeitete
Bedürfnis Bedarf Nachfrage
 Wirtschaftskunde 2010 2011 Frau Dr. Jäpel Private Haushalte und Konsum Ökonomisches Handeln = wirtschaftliches Handeln Tendenziell unendliche Bedürfnisse Knappheit der Güter Lösung: Wirtschaften Spannungsverhältnis
Wirtschaftskunde 2010 2011 Frau Dr. Jäpel Private Haushalte und Konsum Ökonomisches Handeln = wirtschaftliches Handeln Tendenziell unendliche Bedürfnisse Knappheit der Güter Lösung: Wirtschaften Spannungsverhältnis
Betriebswirtschaftslehre für die Verwaltung
 Betriebswirtschaftslehre für die Verwaltung Modul 1.01: Betriebswirtschaftslehre für die Verwaltung HdBA Modul 1.01: Betriebswirtschaftliche Grundlagen KW 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 Vorlesung:
Betriebswirtschaftslehre für die Verwaltung Modul 1.01: Betriebswirtschaftslehre für die Verwaltung HdBA Modul 1.01: Betriebswirtschaftliche Grundlagen KW 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 Vorlesung:
Inhaltsverzeichnis. Vorwort 5 Literaturverzeichnis 13
 Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 Literaturverzeichnis 13 I. Betriebswirtschaft als wissenschaftliche Disziplin 19 A. Gegenstand und Objektbereiche der Betriebswirtschaftslehre 20 1. Wirtschaft und wirtschaftliches
Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 Literaturverzeichnis 13 I. Betriebswirtschaft als wissenschaftliche Disziplin 19 A. Gegenstand und Objektbereiche der Betriebswirtschaftslehre 20 1. Wirtschaft und wirtschaftliches
Marketingkonzeption zur erfolgreichen Markteinführung des Softdrinks "Mountain Dew"
 Wirtschaft Marc Steinebach Marketingkonzeption zur erfolgreichen Markteinführung des Softdrinks "Mountain Dew" Akademische Arbeit Marketingkonzeption zur erfolgreichen Markteinführung des Softdrinks Mountain
Wirtschaft Marc Steinebach Marketingkonzeption zur erfolgreichen Markteinführung des Softdrinks "Mountain Dew" Akademische Arbeit Marketingkonzeption zur erfolgreichen Markteinführung des Softdrinks Mountain
Produktion = Kombination von Produktionsfaktoren zum Zweck der betrieblichen Leistungserstellung. Frage: Zu welchem Bereich gehört Ihr Unternehmen?
 Definition Produktion = Kombination von Produktionsfaktoren zum Zweck der betrieblichen Leistungserstellung Beschaffung Produktion Absatz Lagerhaltung Frage: Zu welchem Bereich gehört Ihr nternehmen? Typologie
Definition Produktion = Kombination von Produktionsfaktoren zum Zweck der betrieblichen Leistungserstellung Beschaffung Produktion Absatz Lagerhaltung Frage: Zu welchem Bereich gehört Ihr nternehmen? Typologie
Inhaltsverzeichnis. Teil I Allgemeine öffentliche Betriebswirtschaftslehre. Vorwort Erkenntnisobjekt der BWL... 13
 Inhaltsverzeichnis Vorwort... 12 Teil I Allgemeine öffentliche Betriebswirtschaftslehre 1 Erkenntnisobjekt der BWL... 13 1.1 Begriffsabgrenzungen...13 1.1.1 Wirtschaft und wirtschaftliches Prinzip...13
Inhaltsverzeichnis Vorwort... 12 Teil I Allgemeine öffentliche Betriebswirtschaftslehre 1 Erkenntnisobjekt der BWL... 13 1.1 Begriffsabgrenzungen...13 1.1.1 Wirtschaft und wirtschaftliches Prinzip...13
Industrielle Betriebswirtschaftslehre. Wintersemester 2008/2009 Gruppe 1E: Donnerstags, 17:00 18:30 Uhr Raum B 256
 Industrielle Betriebswirtschaftslehre Wintersemester 2008/2009 Gruppe 1E: Donnerstags, 17:00 18:30 Uhr Raum B 256 Seite 2 Gliederungsübersicht. 1 Grundbegriffe des Produktionsmanagements 2 Produktionsplanung
Industrielle Betriebswirtschaftslehre Wintersemester 2008/2009 Gruppe 1E: Donnerstags, 17:00 18:30 Uhr Raum B 256 Seite 2 Gliederungsübersicht. 1 Grundbegriffe des Produktionsmanagements 2 Produktionsplanung
Betriebswirtschaftslehre Einführung (Teil 3) Wintersemester 2016/17
 Betriebswirtschaftslehre Einführung (Teil 3) Wintersemester 2016/17 Nur zum Gebrauch an Dr. Thomas Burghardt (thomas.burghardt@wirtschaft-tu-chemnitz.de) Betriebswirtschaftslehre Produktion Quelle: autobild.de
Betriebswirtschaftslehre Einführung (Teil 3) Wintersemester 2016/17 Nur zum Gebrauch an Dr. Thomas Burghardt (thomas.burghardt@wirtschaft-tu-chemnitz.de) Betriebswirtschaftslehre Produktion Quelle: autobild.de
Christof Klees. Einführung in die Volks- und Betriebswirtschaft
 Christof Klees Einführung in die Volks- und Betriebswirtschaft Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 1. GrundbegriffeLdes^Wirtsjchaftens 13 1.1 Bedürfnisse, Bedarf, Nachfrage 14 1.2 Güter die Mittel zur Bedürfnisbefriedigung
Christof Klees Einführung in die Volks- und Betriebswirtschaft Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 1. GrundbegriffeLdes^Wirtsjchaftens 13 1.1 Bedürfnisse, Bedarf, Nachfrage 14 1.2 Güter die Mittel zur Bedürfnisbefriedigung
gebunden. 2 Sie ist wie in Abb. 1.1 gegliedert.
 gebunden. 2 Sie ist wie in Abb. 1.1 gegliedert. Abb. 1.1: Teilgebiete des Rechnungswesens Die Betriebsstatistik generiert Zeit- und Betriebsvergleiche (z. B. Soll-Ist- Vergleiche) und ermittelt Kennzahlen.
gebunden. 2 Sie ist wie in Abb. 1.1 gegliedert. Abb. 1.1: Teilgebiete des Rechnungswesens Die Betriebsstatistik generiert Zeit- und Betriebsvergleiche (z. B. Soll-Ist- Vergleiche) und ermittelt Kennzahlen.
B. Das Unternehmen als ein auf die Umwelt ausgerichtetes sozio-ökonomisches System
 B. Das Unternehmen als ein auf die Umwelt ausgerichtetes sozio-ökonomisches System I. Allgemeines Im Allgemeinen ist das Unternehmen durch folgende Kriterien gekennzeichnet: 1. Es ist ein künstliches,
B. Das Unternehmen als ein auf die Umwelt ausgerichtetes sozio-ökonomisches System I. Allgemeines Im Allgemeinen ist das Unternehmen durch folgende Kriterien gekennzeichnet: 1. Es ist ein künstliches,
3.3.2 Organisationsstrukturen
 1 3.3.2 Organisationsstrukturen 2 Was versteht man unter einer Organisation? Organisationen sind soziale Systeme (sozial = aus Personen bestehend), die ein festgelegtes Ziel erreichen wollen und eine formale
1 3.3.2 Organisationsstrukturen 2 Was versteht man unter einer Organisation? Organisationen sind soziale Systeme (sozial = aus Personen bestehend), die ein festgelegtes Ziel erreichen wollen und eine formale
3 Gliederungsmöglichkeiten von Kostenarten
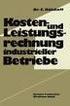 1 von 5 04.10.2010 14:21 Hinweis: Diese Druckversion der Lerneinheit stellt aufgrund der Beschaffenheit des Mediums eine im Funktionsumfang stark eingeschränkte Variante des Lernmaterials dar. Um alle
1 von 5 04.10.2010 14:21 Hinweis: Diese Druckversion der Lerneinheit stellt aufgrund der Beschaffenheit des Mediums eine im Funktionsumfang stark eingeschränkte Variante des Lernmaterials dar. Um alle
Christian Klaus Sozialkunde Wirtschaftspolitik
 Wirtschaftspolitik Bedürfnisse: - Primär- oder Existenzbedürfnisse - Sekundär, Kultur- Luxusbedürfnisse richten sich nach: - Umweltbedingungen - wirtschaftliche Verhältnisse - Stand der Zivilisation Bedürfnisse:
Wirtschaftspolitik Bedürfnisse: - Primär- oder Existenzbedürfnisse - Sekundär, Kultur- Luxusbedürfnisse richten sich nach: - Umweltbedingungen - wirtschaftliche Verhältnisse - Stand der Zivilisation Bedürfnisse:
Bedürfnisse. Existenzbedürfnisse. Individualbedürfnisse. Grundbedürfnisse. Kollektivbedürfnisse. Luxusbedürfnisse
 Bedürfnisse Nach Dringlichkeit der Befriedigung Nach Anzahl der zur Befriedigung notwendigen Personen Existenzbedürfnisse Individualbedürfnisse Grundbedürfnisse Kollektivbedürfnisse Luxusbedürfnisse Maslow-Pyramide
Bedürfnisse Nach Dringlichkeit der Befriedigung Nach Anzahl der zur Befriedigung notwendigen Personen Existenzbedürfnisse Individualbedürfnisse Grundbedürfnisse Kollektivbedürfnisse Luxusbedürfnisse Maslow-Pyramide
Gibt es eine Produktionstheorie (auch) für Dienstleistungen?
 Otto Altenburger Universität Wien Gibt es eine Produktionstheorie (auch) für Dienstleistungen? Konstituierende Sitzung der Wissenschaftlichen Kommission Dienstleistungsmanagement im Verband der Hochschullehrer
Otto Altenburger Universität Wien Gibt es eine Produktionstheorie (auch) für Dienstleistungen? Konstituierende Sitzung der Wissenschaftlichen Kommission Dienstleistungsmanagement im Verband der Hochschullehrer
1 Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre Betriebswirtschaftslehre als Teil der Wirtschaftswissenschaften... 2
 Inhaltsverzeichnis 1 Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre... 1 1.1 Betriebswirtschaftslehre als Teil der Wirtschaftswissenschaften... 2 1.2 Betriebswirtschaftliche Funktionen... 6 1.2.1 Grundlegende
Inhaltsverzeichnis 1 Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre... 1 1.1 Betriebswirtschaftslehre als Teil der Wirtschaftswissenschaften... 2 1.2 Betriebswirtschaftliche Funktionen... 6 1.2.1 Grundlegende
2. Firmengründer/in Daten, Fakten und Hintergründe zur Unternehmerperson
 BUSINESSPLAN 1 Checkliste: Businessplan Erstellen Sie Ihren Businessplan knapp und präzise. Er sollte nicht mehr als 30 A4-Seiten umfassen. Mit Vorteil geben Sie Zahlen - insbesondere Schätzungen - mit
BUSINESSPLAN 1 Checkliste: Businessplan Erstellen Sie Ihren Businessplan knapp und präzise. Er sollte nicht mehr als 30 A4-Seiten umfassen. Mit Vorteil geben Sie Zahlen - insbesondere Schätzungen - mit
Persönliche Stellenbeschreibung 1. Persönliche Stellenbeschreibung (PSB) Juergen Kramer International Consulting
 Persönliche Stellenbeschreibung 1 Persönliche Stellenbeschreibung (PSB) Ein wesentliches Instrument der betrieblichen Organisation ist die Stellenbeschreibung (oder Funktionsbeschreibung). Sie dient dazu,
Persönliche Stellenbeschreibung 1 Persönliche Stellenbeschreibung (PSB) Ein wesentliches Instrument der betrieblichen Organisation ist die Stellenbeschreibung (oder Funktionsbeschreibung). Sie dient dazu,
Handlungsfeld 3: Unternehmensführungsstrategien entwickeln
 1.1 Aufbauorganisation Handlungsfeld 3: Unternehmensführungsstrategien entwickeln 1. Bedeutung der Aufbau- und Ablauforganisation für die Entwicklung eines Unternehmens beurteilen; Anpassungen vornehmen
1.1 Aufbauorganisation Handlungsfeld 3: Unternehmensführungsstrategien entwickeln 1. Bedeutung der Aufbau- und Ablauforganisation für die Entwicklung eines Unternehmens beurteilen; Anpassungen vornehmen
Grundzüge der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre
 IV. Betriebsführung Neben den elementaren Produktionsfaktoren Arbeit, Betriebsmittel und Werkstoffe stellt die Betriebsführung bzw. das Management den dispositiven Faktor dar. 1. Aufgaben Oberstes Ziel
IV. Betriebsführung Neben den elementaren Produktionsfaktoren Arbeit, Betriebsmittel und Werkstoffe stellt die Betriebsführung bzw. das Management den dispositiven Faktor dar. 1. Aufgaben Oberstes Ziel
Funktion (Wie gestaltet man eine Organisation?) Gestaltung zur Veränderung von Strukturen
 06.10.2012 Aufbau Organisation Organisation Institution (Was ist eine Organisation?) Funktion (Wie gestaltet man eine Organisation?) Instrument (Wie kann man eine Organisation nutzen?) Zielgerichtetes,
06.10.2012 Aufbau Organisation Organisation Institution (Was ist eine Organisation?) Funktion (Wie gestaltet man eine Organisation?) Instrument (Wie kann man eine Organisation nutzen?) Zielgerichtetes,
Marketinggrundlagen und Marketingkonzept
 Marketinggrundlagen und Marketingkonzept Teil 8 5. Schritt: Aktions-/Massnahmenpläne Submix Distribution Autor: Christoph Portmann, Score Marketing, Stäfa 126 Hinweis Dieser Script (alle Folien des Bereiches
Marketinggrundlagen und Marketingkonzept Teil 8 5. Schritt: Aktions-/Massnahmenpläne Submix Distribution Autor: Christoph Portmann, Score Marketing, Stäfa 126 Hinweis Dieser Script (alle Folien des Bereiches
PRODUKTION. Betriebswirtschaftslehre
 PRODUKTION PRODUKTION Systemanalyse: Unternehmen, Umwelt und Umsatzprozess Beschaffungsmärkte Beschaffung Ausgaben Staat/EU Gesellschaft (Gesetze, Verordnungen usw. ) Natur Aufwand/ Kosten Input Produktionsprozess
PRODUKTION PRODUKTION Systemanalyse: Unternehmen, Umwelt und Umsatzprozess Beschaffungsmärkte Beschaffung Ausgaben Staat/EU Gesellschaft (Gesetze, Verordnungen usw. ) Natur Aufwand/ Kosten Input Produktionsprozess
Qualitäts- und Umwelt-Management-Handbuch
 84453 Mühldorf QM-HANDBUCH Rev10 gültig ab: 01/14 Seite 1 von 5 Qualitäts- und Umwelt-Management-Handbuch 1 Anwendungsbereich 2 Darstellung des Unternehmens 3 Qualitäts- und Lebensmittelsicherheitspolitik
84453 Mühldorf QM-HANDBUCH Rev10 gültig ab: 01/14 Seite 1 von 5 Qualitäts- und Umwelt-Management-Handbuch 1 Anwendungsbereich 2 Darstellung des Unternehmens 3 Qualitäts- und Lebensmittelsicherheitspolitik
Corporate Management. Scientific Abstract WS 2010/2011. Zusammenhang von Produktion und Marketing
 Corporate Management Scientific Abstract Alexander Gruber WS 2010/2011 Zusammenhang von Produktion und Marketing Alexander Gruber, Zusammenhang von Produktion und Marketing 1 Agenda 1. Einführung 2. Zusammenhang
Corporate Management Scientific Abstract Alexander Gruber WS 2010/2011 Zusammenhang von Produktion und Marketing Alexander Gruber, Zusammenhang von Produktion und Marketing 1 Agenda 1. Einführung 2. Zusammenhang
Prozessorganisation Mitschriften aus den Vorlesung bzw. Auszüge aus Prozessorganisation von Prof. Dr. Rudolf Wilhelm Feininger
 Prozesse allgemein Typische betriebliche Prozesse: Bearbeitung von Angeboten Einkauf von Materialien Fertigung und Versand von Produkten Durchführung von Dienstleistungen Prozessorganisation befasst sich
Prozesse allgemein Typische betriebliche Prozesse: Bearbeitung von Angeboten Einkauf von Materialien Fertigung und Versand von Produkten Durchführung von Dienstleistungen Prozessorganisation befasst sich
Volkswirtschaft und Volkswirtschaftslehre
 6 Wie eine Volkswirtschaft funktioniert Volkswirtschaft und Volkswirtschaftslehre Die Volkswirtschaftlehre (VWL) beschäftigt sich mit den gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen eines Staates: der Volkswirtschaft.
6 Wie eine Volkswirtschaft funktioniert Volkswirtschaft und Volkswirtschaftslehre Die Volkswirtschaftlehre (VWL) beschäftigt sich mit den gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen eines Staates: der Volkswirtschaft.
BWL 1 - Grundlagen. Name: Vorname: Matrikelnummer: Studiengang: BW - MM Semester: 1. Semester - Gruppe B
 BWL 1 - Grundlagen Name: Vorname: Matrikelnummer: Studiengang: BW - MM Semester: 1. Semester - Gruppe B Prüfungsdatum: 30.11.2012 Lehrveranstaltung: BWL 1 Dozent/in: Dr. Nicola Herchenhein Erlaubte Hilfsmittel:
BWL 1 - Grundlagen Name: Vorname: Matrikelnummer: Studiengang: BW - MM Semester: 1. Semester - Gruppe B Prüfungsdatum: 30.11.2012 Lehrveranstaltung: BWL 1 Dozent/in: Dr. Nicola Herchenhein Erlaubte Hilfsmittel:
Grundlagen des Wirtschaftens
 1 Bedürfnisse steuern Nachfrage Markt und Marktformen steuert mithilfe des ökonomischen Prinzips daraus ergeben sich und bilden Angebot Sektoren Betriebe Kooperation/Konzentration Fertigungsverfahren Produktionstypen
1 Bedürfnisse steuern Nachfrage Markt und Marktformen steuert mithilfe des ökonomischen Prinzips daraus ergeben sich und bilden Angebot Sektoren Betriebe Kooperation/Konzentration Fertigungsverfahren Produktionstypen
BF I W 2016 VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE HJ 1 KAPITEL 1
 1 MENSCH UND UNTERNEHMEN IM GESAMTWIRTSCHAFTLICHEN ZUSAMMENHANG 1.1 Einführung in die Volkswirtschaftslehre 1.1.1 Gegenstand der Wirtschaftswissenschaften Was ist Wirtschaft? Brainstorming Abgrenzung von
1 MENSCH UND UNTERNEHMEN IM GESAMTWIRTSCHAFTLICHEN ZUSAMMENHANG 1.1 Einführung in die Volkswirtschaftslehre 1.1.1 Gegenstand der Wirtschaftswissenschaften Was ist Wirtschaft? Brainstorming Abgrenzung von
Instandhaltungslogistik
 Kurt Matyas Instandhaltungslogistik Qualität und Produktivität steigern 5., aktualisierte Auflage 1.5 Logistikkosten 7 Unternehmensleitung Stab Forschung & Entwicklung Beschaffung Produktion Marketing
Kurt Matyas Instandhaltungslogistik Qualität und Produktivität steigern 5., aktualisierte Auflage 1.5 Logistikkosten 7 Unternehmensleitung Stab Forschung & Entwicklung Beschaffung Produktion Marketing
Industriemeister/Metall
 Industriemeist er Metall Industriemei ster Metall Industriemeister Metall Industriemeister/Metall 1 2 1.1 Aufgaben der Fertigung Vorgegeben sind in der Regel: Abmessungen Genauigkeit Werkstoff Bestimmte
Industriemeist er Metall Industriemei ster Metall Industriemeister Metall Industriemeister/Metall 1 2 1.1 Aufgaben der Fertigung Vorgegeben sind in der Regel: Abmessungen Genauigkeit Werkstoff Bestimmte
Betriebswirtschaft. 2) Die Betriebe. Folie 1/1. Manz Verlag Schulbuch
 2) Die Betriebe Folie 1/1 Der Betrieb und sein gesellschaftliches Umfeld Betriebswirtschaft Die Partner des Betriebs Die Partner des Betriebs Funktionen des Gewinns Betriebstypen Mitarbeiter Eigentümer
2) Die Betriebe Folie 1/1 Der Betrieb und sein gesellschaftliches Umfeld Betriebswirtschaft Die Partner des Betriebs Die Partner des Betriebs Funktionen des Gewinns Betriebstypen Mitarbeiter Eigentümer
Kapitel 1 Vorbemerkungen
 Kapitel 1 Vorbemerkungen Lekt. Dr. Irina-Marilena Ban Pearson Studium 2014 2014 Wirtschaftswissenshaften Betriebswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Mikroökonomie Makroökonomie Beschaffung Produktion
Kapitel 1 Vorbemerkungen Lekt. Dr. Irina-Marilena Ban Pearson Studium 2014 2014 Wirtschaftswissenshaften Betriebswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Mikroökonomie Makroökonomie Beschaffung Produktion
Gegenüberstellung von Lagerarten
 Wirtschaft Uwe Kimmich Gegenüberstellung von Lagerarten Studienarbeit Seminar: Logistische Methoden und Anwendungen (Logistik 1) im Wintersemester 2002/2003 zum Thema: Welche unterschiedlichen Lagerarten
Wirtschaft Uwe Kimmich Gegenüberstellung von Lagerarten Studienarbeit Seminar: Logistische Methoden und Anwendungen (Logistik 1) im Wintersemester 2002/2003 zum Thema: Welche unterschiedlichen Lagerarten
Businessplan-Fragebogen
 Projekt / Firma: Kontaktadresse: Kontaktperson: Telefon: Internet/eMail: Datum: / Stichwort Frage(n) Beschreibung Geschäftsprojekt/Profil des Unternehmens Unternehmenskompetenz Absicht Argumente Worin
Projekt / Firma: Kontaktadresse: Kontaktperson: Telefon: Internet/eMail: Datum: / Stichwort Frage(n) Beschreibung Geschäftsprojekt/Profil des Unternehmens Unternehmenskompetenz Absicht Argumente Worin
Organisatorische und personelle Themen des
 Organisatorische und personelle Themen des Aufbauorganisation Einordnung des s im Unternehmen Linienfunktion Stabsfunktion Organisation innerhalb des s Disziplinarische Einordnung Anforderungen an Controller
Organisatorische und personelle Themen des Aufbauorganisation Einordnung des s im Unternehmen Linienfunktion Stabsfunktion Organisation innerhalb des s Disziplinarische Einordnung Anforderungen an Controller
Handlungsfelder der Medienbetriebswirtschaftslehre
 1 Handlungsfelder der Medienbetriebswirtschaftslehre (1) Die produktorientierte Perspektive 2 Medienunternehmen und ihr Umsystem Kapitalmarkt Absatzmarkt Fremdkapital Eigenkapital Personalmarkt Redakteure
1 Handlungsfelder der Medienbetriebswirtschaftslehre (1) Die produktorientierte Perspektive 2 Medienunternehmen und ihr Umsystem Kapitalmarkt Absatzmarkt Fremdkapital Eigenkapital Personalmarkt Redakteure
Universität Ulm SS 2007 Institut für Betriebswirtschaft Hellwig/Meuser Blatt 1
 Universität Ulm SS 2007 Institut für Betriebswirtschaft 24.04.2007 Hellwig/Meuser Blatt 1 Lösungen zu AVWL III Aufgabe 1 a) Hauptziel der Wirtschaftswissenschaften: Erforschung wirtschaftlicher Erscheinungen
Universität Ulm SS 2007 Institut für Betriebswirtschaft 24.04.2007 Hellwig/Meuser Blatt 1 Lösungen zu AVWL III Aufgabe 1 a) Hauptziel der Wirtschaftswissenschaften: Erforschung wirtschaftlicher Erscheinungen
Die Produktion. 16 Wie eine Volkswirtschaft funktioniert. Beispiele: Güter und Dienstleistungen
 16 Wie eine Volkswirtschaft funktioniert Beispiele: Güter und Dienstleistungen Ü Sachgüter: Für den privaten Haushalt sind Waschmaschine und Waschmittel Konsumgüter, die Waschmaschine ein Gebrauchsgut
16 Wie eine Volkswirtschaft funktioniert Beispiele: Güter und Dienstleistungen Ü Sachgüter: Für den privaten Haushalt sind Waschmaschine und Waschmittel Konsumgüter, die Waschmaschine ein Gebrauchsgut
Inhaltsverzeichnis René Scholz Volkswirtschaftslehre
 Inhaltsverzeichnis René Scholz Volkswirtschaftslehre 1. Der Wirtschaftskreislauf...1 1.1 Grundlagen der Volkswirtschaftslehre... 1 1.1.1 Die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse durch Güter... 2 1.1.2
Inhaltsverzeichnis René Scholz Volkswirtschaftslehre 1. Der Wirtschaftskreislauf...1 1.1 Grundlagen der Volkswirtschaftslehre... 1 1.1.1 Die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse durch Güter... 2 1.1.2
Einordnung der Enabling-Bereiche in
 Einordnung der Enabling-Bereiche in 2 die Unternehmenshierarchie Die organisatorische Gliederung der allermeisten Enabling-Bereiche (z. B. Marketing, Personal, IT, Rechnungswesen, Controlling, Revision,
Einordnung der Enabling-Bereiche in 2 die Unternehmenshierarchie Die organisatorische Gliederung der allermeisten Enabling-Bereiche (z. B. Marketing, Personal, IT, Rechnungswesen, Controlling, Revision,
Grundlagen der Leistungserstellung Teil 1
 Fernstudium Guide Online Vorlesung Wirtschaftswissenschaft Grundlagen der Leistungserstellung Teil 1 Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche unzulässige Form der Entnahme, des Nachdrucks,
Fernstudium Guide Online Vorlesung Wirtschaftswissenschaft Grundlagen der Leistungserstellung Teil 1 Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche unzulässige Form der Entnahme, des Nachdrucks,
1 MENSCH UND UNTERNEHMEN IM GESAMTWIRTSCHAFTLICHEN ZUSAMMENHANG 1.1 Einführung in die Volkswirtschaftslehre Bedürfnisse, Bedarf, Nachfrage
 1 MENSCH UND UNTERNEHMEN IM GESAMTWIRTSCHAFTLICHEN ZUSAMMENHANG 1.1 Einführung in die Volkswirtschaftslehre 1.1.1 Bedürfnisse, Bedarf, Nachfrage Definition des Begriffes Bedürfnisse Bedürfnisse sind Wünsche,
1 MENSCH UND UNTERNEHMEN IM GESAMTWIRTSCHAFTLICHEN ZUSAMMENHANG 1.1 Einführung in die Volkswirtschaftslehre 1.1.1 Bedürfnisse, Bedarf, Nachfrage Definition des Begriffes Bedürfnisse Bedürfnisse sind Wünsche,
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre
 Einführung in die Betriebswirtschaftslehre in Übersichtsdarstellungen Von Prof. Dr. F. W Selchert Professor für Betriebswirtschaftslehre 2., wesentlich erweiterte Auflage R. Oldenbourg Verlag München Wien
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre in Übersichtsdarstellungen Von Prof. Dr. F. W Selchert Professor für Betriebswirtschaftslehre 2., wesentlich erweiterte Auflage R. Oldenbourg Verlag München Wien
BWLfür Ingenieure. von Prof. Dr. Marion Steven 3., korrigierte und aktualisierte Auflage. Oldenbourg Verlag München
 BWLfür Ingenieure von Prof. Dr. Marion Steven 3., korrigierte und aktualisierte Auflage Oldenbourg Verlag München Inhalt 1 Das Unternehmen in seinem Umfeld 1 1.1 Der Aufbau eines Unternehmens 1 1.1.1 Begriffsbestimmung
BWLfür Ingenieure von Prof. Dr. Marion Steven 3., korrigierte und aktualisierte Auflage Oldenbourg Verlag München Inhalt 1 Das Unternehmen in seinem Umfeld 1 1.1 Der Aufbau eines Unternehmens 1 1.1.1 Begriffsbestimmung
Inhaltsverzeichnis VII
 VII 1 Einleitung... 1 2 Unternehmensstrategien und Marketing... 3 2.1 Märkte... 3 2.1.1 Marktbeschreibung... 4 2.1.2 Kundengruppenbezogene Marktdifferenzierung... 5 2.1.3 Marktsegmentierung... 6 2.2 Einführung
VII 1 Einleitung... 1 2 Unternehmensstrategien und Marketing... 3 2.1 Märkte... 3 2.1.1 Marktbeschreibung... 4 2.1.2 Kundengruppenbezogene Marktdifferenzierung... 5 2.1.3 Marktsegmentierung... 6 2.2 Einführung
1 Die Betriebswirtschaftslehre als Wissenschaft
 11 1 Die Betriebswirtschaftslehre als Wissenschaft 1.1 Wissenschaftliche Grundlagen Als Wissenschaft wird ein dynamisches System von allgemein gültigen Aussagen über reale Sachverhalte verstanden, wobei
11 1 Die Betriebswirtschaftslehre als Wissenschaft 1.1 Wissenschaftliche Grundlagen Als Wissenschaft wird ein dynamisches System von allgemein gültigen Aussagen über reale Sachverhalte verstanden, wobei
