Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz
|
|
|
- Volker Gerstle
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz Indexed in Medline, SCIE and SCOPUS Elektronischer Sonderdruck für H.-E. Wichmann Ein Service von Springer Medizin Bundesgesundheitsbl : DOI /s y Springer-Verlag 2012 zur nichtkommerziellen Nutzung auf der privaten Homepage und Institutssite des Autors H.-E. Wichmann R. Kaaks W. Hoffmann K.-H. Jöckel K.H. Greiser J. Linseisen Die Nationale Kohorte
2 Leitthema Bundesgesundheitsbl : DOI /s y Online publiziert: 7. Juni 2012 Springer-Verlag 2012 H.-E. Wichmann 1 R. Kaaks 2 W. Hoffmann 3 K.-H. Jöckel 3 K.H. Greiser 2 J. Linseisen 1 1 Helmholtz-Zentrum München, Neuherberg 2 Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg 3 Universität Greifswald, Greifswald 4 Universitätsklinikum Essen, Essen Die Nationale Kohorte Chronische Krankheiten sind in Deutschland ebenso wie in anderen westlichen Industrieländern die Haupttodesursache. Durch den demografischen Wandel wird die Bedeutung dieser sogenannten Volkskrankheiten in den kommenden Jahrzehnten weiter zunehmen und eine große Belastung für das Gesundheitssystem darstellen. Eine starke Erhöhung der Patientenanzahl wird besonders für Diabetes mellitus, Schlaganfälle, Lungenerkrankungen, Krebs sowie neuropsychiatrische Erkrankungen erwartet [1]. Die Folgen sind steigende Kosten für die Kurativmedizin, Rehabilitation und Pflege. Beispielsweise belaufen sich aktuelle Schätzungen für die direkten kurativmedizinischen Kosten von Herz-Kreislauf- Erkrankungen auf 35 Mrd. Euro jährlich, für die von Diabetes auf 5,6 Mrd. und für die von Krebs 15 Mrd. Euro [1]. Gesundheitsökonomische Analysen zeigen, dass die Krankheitsvorbeugung (Prävention) ein kostengünstigeres Mittel als die kurative Medizin ist, um die Morbidität und Mortalität bei den meisten chronischen Erkrankungen zu senken [2, 3]. Zur Entwicklung effektiver Strategien für die Prävention chronischer Krankheiten besteht weiter großer Forschungs bedarf. Als Grundlage hierfür sind exakte Daten über die Ursachen dieser Erkrankungen und über die Effekte des Vermeidens oder Verringerns ihrer wichtigsten Risikofaktoren erforderlich. Diese Daten werden in epidemiologischen Studien gewonnen; das hierfür optimale Studiendesign ist die prospektive Kohortenstudie. Auf diese Weise können durch wiederholte medizinische Untersuchungen, wiederholte Befragungen und Entnahmen von Blutproben Informationen über die Studienteilnehmer vor der eventuellen Diagnose einer Krankheit gesammelt werden. Somit können für eine Vielfalt von Gesundheitszuständen oder Krankheitskombinationen (Multimorbidität) die Auswirkungen von Lebensstil, Umwelt und genetischer Konstellationen gemeinsam untersucht und umfassend, valide und verlässlich quantifiziert werden. Bisher gibt es in Deutschland einige mittelgroße Kohortenstudien mit zusammen etwa bis Teilnehmern. Zu nennen sind hier zum Beispiel folgende Studien: CARLA (Cardiovascular Disease, Living and Ageing in Halle), EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition in Heidelberg und Potsdam), KORA (kooperative Gesundheitsforschung im Raum Augsburg), Heinz Nixdorf Recall Studie (Risk Factors, Evaluation of Coronary Calcification and Lifestyle) in Essen und SHIP (Study of Health In Pomerania in Greifswald) [4, 5, 6, 7, 8]. Viele wurden jedoch unabhängig voneinander geplant und haben unterschiedliche Studienelemente. Daher können Daten aus den bestehenden Kohortenstudien nur in einem eingeschränkten Umfang zusammengefasst und für gemeinsame wissenschaftliche Auswertungen genutzt werden. Zudem liegt der Median der Altersverteilung bei den Probanden in den meisten Studien mittlerweile bei deutlich über 55 Jahren, sodass die frühe Entwicklung von Krankheiten oft nicht untersucht werden kann. Hinzu kommt, dass viele der existierenden Kohortenstudien zu einer Zeit initiiert wurden (vor bis zu 25 Jahren), als zahlreiche der heute üblichen Untersuchungstechniken noch nicht verfügbar waren. Des Weiteren werden bei einigen der größeren deutschen Kohortenstudien die Bioproben der für die Forschung interessanten Personen in den nächsten zehn bis 20 Jahren größtenteils aufgebraucht sein. Daher hat ein Netzwerk von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der Helmholtz-Gemeinschaft, den Universitäten, der Leibniz-Gemeinschaft und der Ressortforschung deutschlandweit die Initiative zum Aufbau einer groß angelegten, bevölkerungsbezogenen Langzeit-Kohortenstudie ergriffen [9]. Diese Nationale Kohorte wird eine hoch standardisierte und umfassende Datenbasis liefern, die der Heterogenität der deutschen Bevölkerung sowohl in Bezug auf Risikofaktoren als auch auf die bedeutendsten Erkrankungen Rechnung trägt. Die Nationale Kohorte zielt auch darauf ab, ein breites Spektrum von Biomaterialien auch wiederholt zu sammeln und für wissenschaftliche Analysen zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise wird die Bearbeitung einer Vielzahl von Forschungsthemen mit ausreichender statistischer Power ermöglicht, was mit bestehenden deutschen Kohorten nicht umsetzbar wäre (zur Berechnung der statistischen Power siehe [13]). Ähnlich große Kohortenstudien in Europa sind die UK Biobank in Großbritannien, CONSTANCES in Frankreich und LifeGene in Schweden [10, 11, 12]. Gegenüber diesen Studien wird die Nationale Kohorte einige Besonderheiten aufweisen, wie zum Beispiel die Bereit- Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 6/
3 Leitthema stellung hochwertiger Bioproben durch eine hochgradig standardisierte Präanalytik und automatische Lagerung, die wiederholte Untersuchung aller Probanden nach fünf Jahren, eine detaillierte Untersuchung präklinischer Krankheitsstadien und die Implementierung der Magnetresonanztomographie (MRT) als zeitgemäße Bildgebungstechnik in der medizinischen Forschung [13]. Das wissenschaftliche Konzept der Nationalen Kohorte wurde durch das Epidemiologische Planungskomitee (EPC) und das Projektmanagement Team auf der Basis intensiver Vorarbeiten der Thematischen Arbeitsgruppen ausgearbeitet [14, 15]. Die Thematischen Arbeitsgruppen bestehen nicht nur aus Epidemiologen, sondern aus Wissenschaftlern aus vielen medizinischen Fächern sowie aus den Natur- und Geisteswissenschaften. Diese Experten wurden vom EPC ausgewählt, um bei spezifischen Themen, wie zum Beispiel den wichtigsten Krankheitsbildern oder MRT, aus ihrer fachlichen Perspektive heraus Ratschläge zum Einsatz geeigneter Instrumente zu erhalten. Die Details des Konzepts zur Nationalen Kohorte sollen im Folgenden näher vorgestellt werden. Abb. 1 9 Rekrutierungscluster (Kreise), Studienzentren und Rekrutierungsgebiete der Nationalen Kohorte Wissenschaftliche Fragestellungen und Ziele der Nationalen Kohorte Die Nationale Kohorte hat im Wesentlichen vier Hauptziele: F die Ursachen chronischer Krankheiten und ihren Zusammenhang mit genetischen, Lebensstil- und Umweltfaktoren aufzuklären, F neue Risikofaktoren zu identifizieren und zur Aufklärung der bestehenden geografischen und sozioökonomischen Ungleichheiten im Gesundheitszustand und Krankheitsrisiko in Deutschland beizutragen, F Risikovorhersagemodelle für chronische Erkrankungen zu entwickeln und Wege einer wirksamen Vorbeugung aufzuzeigen (personalisierte Präventionsstrategien) sowie F Möglichkeiten zur Früherkennung chronischer Krankheiten zu identifizieren (Evaluation von Markern als effektive Hilfsmittel zur Krankheitsprävention). Folgende chronische Krankheiten spielen in der Nationalen Kohorte eine besondere Rolle: kardiovaskuläre Erkrankungen (v. a. Herzinfarkt, Schlaganfall), Diabetes mellitus, Krebs (vor allem Brust-, Darm-, Prostata- und Lungenkrebs), neurodegenerative und neuropsychiatrische Krankheiten (vor allem Demenz, Depression), Erkrankungen der Atemwege (vor allem chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), Asthma) und Infektionskrankheiten (vor allem bezüglich Atemwegssystem, Magen-Darm-Trakt und Mundgesundheit). Neben den klinisch manifesten Erkrankungen steht die Untersuchung subklinischer Vorstufen (zum Beispiel durch Messung der kognitiven Funktion, der Lungenfunktion oder der Intima-Media-Dicke der Halsschlagader) und funktioneller Veränderungen (zum Beispiel muskuloskelettale Untersuchungen) im Fokus. Zu den Risikofaktoren bzw. Expositionen, die besondere Beachtung finden werden, zählen Lebensstilfaktoren (zum Beispiel körperliche Aktivität und Fitness, Ernährung), psychosoziale und sozioökonomische Faktoren sowie genetische Faktoren und Umweltbedingungen [13]. Beispiele für einzelne wissenschaftliche Fragestellungen, die sich mithilfe der Nationalen Kohorte beantworten lassen werden, finden sich im wissenschaftlichen Konzept der Nationalen Kohorte [13]. Ausgangsbevölkerung und Studienregion Die Studienbevölkerung für die Nationale Kohorte wird in insgesamt 18 Studienzentren über ganz Deutschland verteilt rekrutiert (. Abb. 1). Aus den regionalen Einwohnermelderegistern wird eine nach Alter und Geschlecht stratifizierte Zufallsstichprobe der Allgemeinbevölkerung im Alter von 20 bis 69 Jahren gezogen, um insgesamt Personen, davon Frauen und Männer, zu untersuchen [13]. Es wird ein Beteiligungsanteil von 50% angestrebt, das heißt, die Einwohnermelderegisterstichprobe umfasst ca Personen (Bruttostichprobe). Die Ziehung dieser Stichprobe findet voraussichtlich zu zwei Zeitpunkten statt, zu Beginn und nach 2,5 Jahren. Es erfolgt eine Anreicherung höherer Altersgruppen. So sind die beiden Dekaden Jahre und Jahre mit je 10% in der Kohorte vertreten, die älteren Dekaden mit einem Anteil von je 26,7%. Dieser höhere Anteil an 40- bis 69-Jährigen ist durch das größere Risiko gerechtfertigt, in diesem Alter chronische Krankheiten in der näheren Zukunft zu entwickeln. Um die Untersuchung früher Krankheitsstadien (intermediäre Phäno- 782 Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 6/7 2012
4 Zusammenfassung Abstract typen, frühe Funktionsstörungen, subklinische Krankheitsstadien) zu ermöglichen, werden aber auch Personen ab 20 Jahren eingeschlossen. Diese Verteilung nach Alter und Geschlecht wird in jedem Studienzentrum gleich sein. Eine Unterstichprobe von Personen wird ein zusätzliches beziehungsweise umfangreicheres Untersuchungsprogramm durchlaufen. Diese Personen werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, jedoch entsprechend der prozentualen Alters- und Geschlechtsverteilung der Gesamtstichprobe. Die zufällige Zuordnung zu dieser Gruppe erfolgt vor der Kontaktaufnahme, da sich das Informationsmaterial für diese von dem für die Basisgruppe unterscheidet. Der gewählte Studienumfang stellt einen Kompromiss dar, der auf Schätzungen der Zahl der Neuerkrankungen an wichtigen Krankheitsbildern und der Häufigkeit und Verteilung wichtiger Risikofaktoren basiert. Zusätzlich sind natürlich auch finanzielle Aspekte eingeflossen. Umfangreiche, komplexe Fallzahlabschätzungen sind im Anhang des Antrags dargestellt [13]. Beispielhaft werden nach zehn Jahren Follow-up folgende Zahlen an Neuerkrankungen erwartet: für Herzinfarkt ca. 5000, für Diabetes ca. 9000, für Brustkrebs ca. 3600, für Lungenkrebs ca Rekrutierung der Studienteilnehmer Die Personen aus den Bevölkerungsstichproben werden in einem mehrstufigen Einladungsverfahren in die Studienzentren eingeladen. Als Erstes wird eine schriftliche Einladung auf dem Postweg verschickt. Dieser Brief enthält ein Einladungsanschreiben, eine Beschreibung der Ziele und Untersuchungselemente der Studie, den Hinweis auf die Zustimmung des Datenschutzbeauftragten und der Ethikkommission und möglicherweise Unterstützungsbriefe regionaler Behörden und der Schirmherren des Projekts. Personen, deren Telefonnummer aus öffentlichen Telefonbüchern bekannt ist, werden im Verlauf der folgenden Tage vom Studienpersonal angerufen. Gleichzeitig wird den Personen die Telefonnummer des lokalen Studienzen- Bundesgesundheitsbl : Springer-Verlag 2012 DOI /s y H.-E. Wichmann R. Kaaks W. Hoffmann K.-H. Jöckel K.H. Greiser J. Linseisen Die Nationale Kohorte Zusammenfassung Die Nationale Kohorte (NK) ist ein gemeinsames interdisziplinäres Vorhaben von Wissenschaftlern aus der Helmholtz-Gemeinschaft, den Universitäten und anderen Forschungsinstituten in Deutschland. Ihr Ziel ist es, die Entstehung der wichtigsten chronischen Krankheiten (Krankheiten des Herz- Kreislauf-Systems und der Lunge, Diabetes, Krebs, neurodegenerative/-psychiatrische und Infektionskrankheiten), ihre subklinischen Vorstufen und auftretende funktionelle Veränderungen zu untersuchen. Die NK soll Männer und Frauen im Alter von Jahren umfassen, die in 18 Studienzentren aus einer repräsentativen Stichprobe der Bevölkerung ausgewählt werden. Zusätzlich zu Interviews und Fragebogenerhebungen werden eine Reihe medizinischer Untersuchungen durchgeführt und verschiedene Bioproben gesammelt. Bei 20% der Personen wird The German National Cohort Abstract The German National Cohort (GNC) is a joint interdisciplinary endeavour of scientists from the Helmholtz Association, universities and other German research institutes. Its aim is to investigate the development of major chronic diseases (cardiovascular diseases, cancer, diabetes, neurodegenerative psychiatric diseases, pulmonary and infectious diseases), the subclinical stages and functional changes. In 18 study centres across Germany, a representative sample of the general population will be drawn to recruit in total 200,000 men and women aged years. In addition to interviews and questionnaires, the baseline assessment includes a series of medical examinations and the collection of a diverse range of biomaterials. In 20% of the participants, an intensified assessment programme ein noch ausführlicheres Programm eingesetzt. Ferner werden etwa Probanden eine Untersuchung mittels Magnetresonanztomographie (MRT) erhalten. Nach fünf Jahren werden alle Teilnehmer nochmals untersucht. Postalische Nachbefragungen zur Gesundheitssituation werden alle zwei bis drei Jahre erfolgen. Mit der NK wird eine herausragende Basis für die zukünftige epidemiologische Forschung in Deutschland geschaffen. Ihre Ergebnisse werden neue Möglichkeiten zur Prävention, Vorhersage und Früherkennung der wichtigsten Volkskrankheiten eröffnen. Schlüsselwörter Bevölkerungsbezogene Kohorte Chronische Krankheiten Lebensstilfaktoren Magnetresonanztomographie Subklinische Vorstufen Funktionelle Veränderungen is foreseen. Also in 40,000 participants, magnetic resonance imaging of the whole body, heart and brain will be performed. After 5 years, a follow-up examination will be performed in all subjects and active follow-up by postal questionnaires is planned every 2 3 years. The GNC will provide an excellent basis for future population-based epidemiology in Germany and results will help identify new and tailored strategies for prevention, prediction and early detection of major diseases. Keywords Population-based cohort Chronic disease Life-style factors Magnet resonance imaging Subclinical stages Functional changes trums genannt, um Termine zu vereinbaren oder um zusätzliche Informationen erfragen zu können. Wenn innerhalb von vier Wochen kein Kontakt hergestellt werden konnte, wird eine Erinnerungseinladung per Post geschickt zusammen mit eine\r vorgefertigten, frankierten Antwortkarte und mit Terminvorschlägen für den Besuch des Studienzentrums. Sowohl bei Telefonanrufen als auch Hausbesuchen wird dem Anteil der arbeitenden Bevölkerung Rechnung getragen, da sie nicht ausschließlich tagsüber stattfinden, sondern auch abends und am Wochenende. Um eine hohe Teilnahme zu erreichen, werden verschiedene Maßnahmen ergriffen. Es wird Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden, um den Bekanntheitsgrad der Nationalen Kohorte in der Bevölkerung zu erhöhen. Dies beinhaltet auch die Informationsweitergabe an und die Integration regionaler Allgemeinärzte und Apothe- Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 6/
5 Leitthema Tab. 1 Nationale Kohorte: Studiendesign und Zeitplan Studiendesign Bevölkerungsbezogene prospektive Kohorte (Männer und Frauen) Alter 20 bis 69 Jahre Zufallsstichprobe von Einwohnern definierter geografischer Regionen 18 Studienzentren Level 1, n= Level 2, n= Level 3, n=variabel (Zusätzliche Forschungsfragen mit zusätzlicher Finanzierung) Magnetresonanztomographie (MRT)-Programm, n= Basisuntersuchung mit Interviews, Fragebogen-Modulen, körperlicher Untersuchung, Tests der kognitiven Funktion, Sammlung von Bioproben (Blut, Urin, Speichel, Nasenabstriche, Stuhl) 2,5 Stunden Untersuchungsprogramm für Level 1 und 4 Stunden intensiviertes Untersuchungsprogramm für Level 2 Nach 5 Jahren Folgeuntersuchung bei allen Studienteilnehmern Kalibrierungs-Substudie (Messungswiederholungen sowohl innerhalb der Basisuntersuchung als auch der Folgeuntersuchung) Kombination von aktiver (postalische Fragebögen alle 2 3 Jahre) und passiver Nachbeobachtung (Verknüpfung mit Registern) Zeitplan Planung, Pretests 2013 Pilotstudie Basisuntersuchung Folgeuntersuchung Ab 2015 Aktive Nachbeobachtung, alle 2 3 Jahre (Fragebögen per Post) Ab 2018 Nutzung für epidemiologische Studien Tab. 2 Nationale Kohorte: Fragebögen Allgemeine Fragebögen Soziodemografische und sozioökonomische Faktoren ken sowie die Einrichtung eines Servicetelefons und einer Homepage im Internet. Zudem wird es Informationskampagnen in Printmedien, Radio und Fernsehen geben. Wichtige Anreize für die individuelle Teilnahme stellt beispielsweise die Mitteilung der eigenen Ergebnisse der Spezielle Fragebögen a Neurologische und psychiatrische Faktoren (Symptomfragebögen zu Depression, Angststörung, Kopfschmerz und Schlaf) Medizinische Anamnese Psychosoziale Faktoren (Persönlichkeit, chronischer Stress, Trauma, beruflicher Stress, soziales Netzwerk; Konflikte im Beruf und in der Familie, berufliche Unsicherheit) Familienanamnese Infektionen und Immunfunktion Medikation der letzten sieben Tage Schmerzen im Muskel-Skelett-System Teilnahme an Screening-Untersuchungen Mundgesundheit Frauen-/Männergesundheit Körperliche Aktivität (Beruf, Freizeit, Sport) Rauchen, Alkohol, weitere Drogen Ernährung Gesundheitsbezogene Lebensqualität Umweltfaktoren (Wohnungsadresse, Berufsadresse) Weitere persönliche Charakteristika Beruf (Screening spezieller Arbeitsbedingungen) Nutzung des Gesundheitssystems (Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte) a Die Machbarkeit wird derzeit zum Teil noch erprobt. Basisuntersuchung, einschließlich der Labordaten. Das Untersuchungsprogramm Die Studienteilnehmer werden bei ihrem Besuch im Studienzentrum ausführlich befragt, medizinisch untersucht und um die Abgabe von Biomaterialien gebeten. Die Befragung erfolgt über ein computergestütztes persönliches Interview sowie mittels Fragebögen, die zum Teil im Untersuchungszentrum am Touchscreen- Computer ausgefüllt werden und zum Teil von zu Hause im Internet oder als Papierversion ausgefüllt werden können. Eine Folgeuntersuchung (Nachuntersuchung) aller Probanden ist nach fünf Jahren geplant, ergänzt durch postalische Befragungen (Nachbeobachtung) alle zwei bis drei Jahre. Die Durchführung der Basisund Folgeuntersuchung wird insgesamt zehn Jahre umfassen (. Tab. 1). Die im Laufe der Nachbeobachtung über weitere zehn bis 20 Jahre bei einigen Teilnehmern auftretenden Erkrankungen können dann mit den zuvor zur Basisuntersuchung bzw. zur Folgeuntersuchung erhobenen Daten in Verbindung gebracht werden. Basisuntersuchung In der Intensitätsstufe 1 (Level 1), die von allen Teilnehmern durchlaufen wird und ca. 2,5 Stunden dauert, werden Interviews und Fragebögen (. Tab. 2) sowie verschiedene Untersuchungsverfahren (. Tab. 3) eingesetzt. In der Befragung werden Informationen zu soziodemografischen Faktoren, zu Lebensgewohnheiten (zum Beispiel körperliche Aktivität, Rauchen, Ernährung, Beruf), zu psychosozialen und sozioökonomischen Faktoren, zur medizinischen Anamnese und zur Familienanamnese erhoben. Die Untersuchungen umfassen Messungen anthropometrischer Indizes, des Blutdrucks, der arteriellen Steifigkeit, ein Elektrokardiogramm (EKG), eine Spirometrie, Messungen der körperlichen Aktivität (Akzelerometrie) und Fitness, der kognitiven Funktionen und die Erfassung des Zahnstatus. Ein weiteres wichtiges Element ist die Sammlung von Biomaterialien von allen Teilnehmern. Die Protokolle zur Probenentnahme und Lagerung von Aliquots werden so geplant, dass sie die größtmögliche Auswahl für zukünftige Laboranalysen erlauben. Die Bioproben umfassen Blutproben, Plasma, Serum, Dimethylsulfoxid-präparierte lebende weiße Blutzellen (in einer Untergruppe), Erythrozyten, Urin, Speichel, Nasen- 784 Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 6/7 2012
6 Tab. 3 Nationale Kohorte: Untersuchungsmodule und Bioproben Untersuchungsmodule a Herz-Kreislauf-System [Blutdruck, Herzfrequenz, EKG (10 s, 12 Ableitungen; 24 h), Carotis- Sonographie (Intima-Media-Dicke)] Diabetes [Oraler Glukose-Toleranz-Test (OGTT), Advanced-Glycation-Endproducts (AGE)-Messung der Haut] Bioproben a Biomaterialien [Serum, Blut, Plasma, Erythrozyten, Desoxyribonukleinsäure (DNA), Ribonukleinsäure (RNA), lebende Zellen, Urin, Speichel, Nasenabstrich, Stuhl] Umfang: 20 Mio. Aliquots, 100 Aliquots pro Proband Kognitive Funktion (Testbatterie) Zentrales Biorepository (insgesamt 2/3 aller Proben, dabei 1/6 im automatischen Lager, 1/2 im zentralen Flüssigstickstoff-Lager) Lungenfunktion (Spirometrie, exhaliertes Stickstoffmonoxid) Muskel-Skelett-System (medizinische Untersuchung) Mundgesundheit (Zahnstatus, Untersuchung der Mundhöhle) Sinnesorgane (Augenuntersuchung, Hörtest, Riechtest) Körperliche Aktivität und Fitness (7-Tage-Akzelerometrie, kardiorespiratorischer Fitness-Test, Handgreifstärke) Anthropometrie (Körpergewicht, Körpergröße, Taillen- und Hüftumfang) a Die Machbarkeit wird derzeit zum Teil noch erprobt. Regionale Flüssigstickstoff-Lagerung (1/3 aller Proben) Magnetresonanztomographie (MRT) a Ganzkörper-MRT Herz-MRT Gehirn-MRT abstriche und Stuhlproben, die in einem zentralen Biorepository mit dezentraler Backup-Lagerung langfristig gelagert werden (. Tab. 3). In der Intensitätsstufe 2 (Level 2) wird bei einer repräsentativen Untergruppe der Kohorte (20%, Teilnehmer) ein umfangreicheres Untersuchungsprogramm von insgesamt vier Stunden durchgeführt (. Tab. 1). Zusätzlich zu den Untersuchungen aus Level 1 sollen eine Carotis-Sonographie mit Messung der Intima-Media-Dicke, ein Langzeit- EKG und erweiterte motorische, sensorische und kognitive Funktionstests durchgeführt werden. Außerdem wird ein Marker für Atemwegsentzündung gemessen, es werden die Mundhöhle und der Bewegungsapparat untersucht und zusätzliche Fragebögen eingesetzt. Ein weiterer Programmpunkt ist die Magnetresonanztomographie (MRT). Diese wird an ca Personen durchgeführt und umfasst eine Ganzkörperuntersuchung mit zusätzlichen speziellen Untersuchungselementen für Gehirn und Herz. Die MRT-Untersuchungen werden umfassende Daten liefern, die es gestatten, die Prävalenz und Inzidenz MRT-basierter Befunde und ihre räumliche Verteilung sowie ihre zeitlichen Veränderungen darzustellen. Diese Datenbasis wird verwendet, um neue morphologische, MRTbasierte Risikomarker für verschiedene Krankheitszustände und subklinische morphologische und funktionelle Veränderungen zu identifizieren. Schließlich sind zusätzlich Level 3 -Studien mit weiteren vertiefenden Untersuchungen oder gesundheitlichen Endpunkten möglich. Voraussetzung ist allerdings, dass sie unabhängig finanziert werden und nicht mit dem Level-1- und Level-2-Programm kollidieren. Für die Rekrutierung und Basisuntersuchung aller Studienteilnehmer ist ein Zeitraum von fünf Jahren vorgesehen. Folgeuntersuchung nach fünf Jahren Alle Teilnehmer der Nationalen Kohorte werden zu einer Folgeuntersuchung fünf Jahre nach der Basisuntersuchung eingeladen. Es werden auch Probanden nachverfolgt, die inzwischen nicht mehr in ihrer ursprünglichen Studienregion wohnen; diese werden dann im nächstgelegenen Studienzentrum untersucht. Der Zeitraum, in dem die Folgeuntersuchungen durchgeführt werden, beträgt analog zur Basisuntersuchung fünf Jahre, sodass im Mittel jede Person fünf Jahre nach Eintritt in die Studie ein zweites Mal untersucht werden kann. Auf Basis der Erfahrungen aus anderen deutschen Kohortenstudien, wird bei der Folgeuntersuchung von einer Beteiligung von 80% ausgegangen [4, 5]. In der Folgeuntersuchung wird ein großer Teil der Untersuchungen aus der Basisuntersuchung erneut durchgeführt. In dieser werden Veränderungen bei den Risikofaktoren, bei quantitativen Parametern der präklinischen Morbidität und bei anderen funktionellen Parametern sowie neu aufgetretene Krankheitsdiagnosen erfasst. Kalibrierungs-/ Reliabilitäts-Substudie Zusätzlich zur mittelfristigen (Fünf-Jahres-)Wiederholung von Messungen im Rahmen der Folgeuntersuchung werden Kurzzeit-Wiederholungsmessungen innerhalb eines Jahres (im Mittel 6 Monate) nach der Erstuntersuchung durchgeführt. Sie werden an einer Subgruppe von 6000 Personen aus der Basisuntersuchung und von 4000 Personen aus der Folgeuntersuchung durchgeführt. Diese Kalibrierungs-/Reliabilitäts-Substudien dienen dazu, intraindividuelle Zufallsvariation bei den unterschiedlichen Messungen zu bestimmen, um bei den statistischen Auswertungen Korrekturen für Abschwächungseffekte zu ermöglichen, die sich aus der zufälligen Fehlklassifizierung ergeben. Methoden der Nachbeobachtung (Follow-up) Neben den beiden Untersuchungen (Basis- und Folgeuntersuchung) im Studienzentrum werden die Studienteilnehmer alle zwei bis drei Jahre kontaktiert und gebeten, Kurzfragebögen auszufüllen. Mit dieser werden Veränderungen im Lebensstil und anderer gesundheitsrelevanter Charakteristika (Medikamenteneinnahme, Rauchen, Menopause, ausgewählte Krankheitssymptome) und das Neuauftreten ausgewählter, wichtiger Erkran- Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 6/
7 Leitthema kungen erfasst ( aktives Follow-up), und es wird für wichtige Entitäten durch Einsichtnahme in medizinische Unterlagen validiert. Bei Krebserkrankungen wird ein Abgleich mit existierenden Krebsregistern durchgeführt ( passives Follow-up). Parallel dazu wird alle zwei bis drei Jahre ein Mortalitäts-Follow-up mithilfe der Einwohnermelderegister durchgeführt. Darüber hinaus wird eine Verknüpfung mit weiteren Sekundärdaten zur gesundheitlichen Situation und Versorgung angestrebt, zum Beispiel mit Krankenversicherungsdaten. Für die interne Validität der Ergebnisse aus der Nationalen Kohorte ist eine möglichst geringe Ausfallrate (loss to follow-up) entscheidend. Aufgrund der sehr positiven Erfahrungen in bestehenden deutschen Kohortenstudien wird auch für die Nationale Kohorte von einer Beteiligungsrate an der Nachbeobachtung von über 80% ausgegangen. Von besonderer Bedeutung ist hierfür die kontinuierliche Kommunikation mit den Studienteilnehmern. Lagerung von Biomaterialien (Biobanking) Der größte Teil der Bioproben, die während der Basisuntersuchung und der Nachuntersuchung gesammelt werden, wird in einer zentralen Biobank (Biorepository) der Nationalen Kohorte eingelagert, die am Helmholtz-Zentrum München eingerichtet wird und ein vollautomatisches Lagersystem und ein manuelles Lager in Flüssigstickstoff-Tanks umfasst. Eine zusätzliche lokale Back-up- Lagerung (in den Clustern beziehungsweise Studienzentren) ist für ein Drittel der Proben geplant (. Tab. 3). Für alle inzidenten Fälle wichtiger Krebserkrankungen ist die systematische Sammlung von Tumorgewebe vorgesehen, das in einer zentralen Tumorbank am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg gelagert werden wird. Ethik und Datenschutz Die Nationale Kohorte wird auf der Grundlage der deutschen Datenschutzgesetze [16] und weiterer Vorschriften durchgeführt. Ferner werden die Empfehlungen des Deutschen Ethikrats zu Forschungsbiobanken [17] sowie andere ethisch relevante Richtlinien zugrunde gelegt. Wichtiges Ziel ist die Sicherstellung des Vertrauens in die Art der Datensammlung und Speicherung. Das Konzept der Nationalen Kohorte wurde in enger Abstimmung mit dem Arbeitskreis Wissenschaft der Datenschutzbeauftragten auf Grundlage der Empfehlungen des Deutschen Ethikrats zu Biomaterialien entwickelt. Vor Beginn der Rekrutierung wird die finale Fassung des Studienprotokolls umfassend durch die jeweils verantwortlichen Datenschutzbeauftragten und Ethikkommissionen überprüft. Ein externer Ethikbeirat wird die Kohorte während ihrer gesamten Laufzeit begleiten. Qualitätssicherung und -kontrolle Um sicherzustellen, dass die Nationale Kohorte im Ganzen einschließlich Datenerhebung und Umgang mit den Daten sowie der Biomaterialgewinnung, -aufbereitung und -lagerung von standardisiert hoher Qualität ist sowohl über die Zeit als auch über die 18 Studienzentren hinweg, wird ein Qualitätsmanagementsystem etabliert werden. Eine Zertifizierung gemäß ISO 9001 wird angestrebt. Es wird sowohl ein internes als auch ein externes Qualitätsmanagement geben. Für die Erhebung werden ausschließlich standardisierte Instrumente eingesetzt, und alle Untersuchungen werden anhand detailliert beschriebener Vorgehensweisen, das heißt anhand sogenannter Standard Operating Procedures (SOPs), durchgeführt. Das durchführende Personal wird umfangreich geschult und für jedes einzelne Element in der Erhebung zertifiziert. Über den Zeitverlauf werden in regelmäßigen Abständen wiederholte Trainings und die Erneuerung der Zertifizierung stattfinden. Ebenso erfolgt eine standardisierte Dokumentation der Abläufe im Studienzentrum. Unangekündigte Besuche zur Überprüfung der Abläufe und Untersuchungen im Studienzentrum werden durch ein internes Qualitätssicherungsteam durchgeführt werden. Die Qualitätskontrolle der Daten erfolgt auf lokaler und zentraler Ebene. Die beiden Integrationszentren sind für die zentrale Datenspeicherung und zugehörige Datenqualitätsüberprüfungen verantwortlich. Zusätzlich wird es sogenannte Kompetenzeinheiten zur Bearbeitung komplexer Studiendaten (zum Beispiel Akzelerometrie-Daten, EKG-Daten) geben, die auch für die jeweiligen qualitätssicherungsbezogenen Aspekte zuständig sind. Für das externe Qualitätsmanagement wird eine unabhängige Expertengruppe beauftragt werden. Diese evaluiert engmaschig und systematisch die internen Qualitätssicherungsprozesse und leitet bei Auffälligkeiten die Informationen über notwendige Korrekturen rasch an die zuständigen Stellen weiter. Sowohl die interne als auch die externe Qualitätssicherung werden ihre Erkenntnisse in Berichten dokumentieren. Bisherige Ergebnisse und aktueller Stand Die Vorarbeiten zur Nationalen Kohorte laufen seit Ihr wissenschaftliches Konzept wurde im Februar 2011 beim Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zur Begutachtung eingereicht. Die Begutachtung durch ein internationales Gremium erfolgte im April Alle wesentlichen Eckpunkte der Studie wurden von den Gutachtern sehr positiv bewertet. Derzeit werden an den beteiligten Studienzentren Machbarkeitsstudien (Pretests) durchgeführt. Eine Gruppe von etwa 2000 Probanden, die über eine nach Alter und Geschlecht stratifizierte Einwohnermeldeamtsstichprobe ausgewählt wird, wird analog der geplanten Basisuntersuchung in den Studienzentren befragt und medizinisch untersucht; auch wird die Abnahme von Biomaterialien getestet. Ziel der Machbarkeitsstudien ist es, zentrale Funktionseinheiten (zum Beispiel Management der Bioproben, Datenmanagement und Qualitätskontrolle) einzurichten sowie Arbeitsabläufe zu entwickeln, zu testen und auf ihre Machbarkeit hin zu prüfen. Des Weiteren werden beispielsweise verschiedene Instrumente zur Datenerhebung und medizinische Untersuchungsgeräte auf ihre Verwendbarkeit und Praktikabilität in großen populationsbezogenen Kohortenstudien, ein- 786 Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 6/7 2012
8 schließlich ihre Akzeptanz bei den Probanden, getestet, um die Auswahl der am besten geeigneten Instrumente zu ermöglichen und vorhandene Instrumente speziell für die Studienzwecke anzupassen. Anhand der Empfehlungen der Gutachter und auf Basis der Ergebnisse der Machbarkeitsstudien ist das Konzept für die Nationale Kohorte bis zum Frühjahr 2012 überarbeitet worden und im Mai 2012 erneut begutachtet worden. Im Jahr 2013 ist die Durchführung der Pilotstudie geplant, die dann bereits das volle Untersuchungsprogramm für die Hauptstudie umfasst. Nach kleineren Korrekturen, die sich aus den Erfahrungen der Pilotstudie ableiten lassen, wird zügig mit der Hauptphase begonnen werden. Ab 2013 sollen für die ersten zehn Jahre die benötigten Fördermittel zur Rekrutierung der Probanden gemeinsam vom BMBF, der Helmholtz-Gemeinschaft und den Ländern zur Verfügung gestellt werden. Die Nutzung von Daten und Bioproben für epidemiologische Auswertungen kann beginnen, sobald die Basisuntersuchung (einschließlich Qualitätssicherung) abgeschlossen ist. Insgesamt soll die Nationale Kohorte der Forschung für eine Periode von mindestens Jahren zur Verfügung stehen. Fazit Die Nationale Kohorte wird wesentlich dazu beitragen, neue und zielgenaue Strategien zur Prävention, Vorhersage und Früherkennung von chronischen Krankheiten zu entwickeln. Ihr Beitrag wird durch vielfältige Synergien mit den deutschen Zentren für Gesundheitsforschung, die an vielen Standorten Patientenkohorten aufbauen, noch verstärkt werden. Die Nationale Kohorte stellt eine hervorragende Basis für die zukünftige epidemiologische Gesundheitsforschung in Deutschland dar und hebt sich im Vergleich zu großen internationalen Kohortenstudien in besonderer Weise ab, insbesondere hinsichtlich (i) der verstärkten Erfassung subklinischer Krankheitsmerkmale und funktioneller Messungen (in Ergänzung zu den klinischen Endpunkten), (ii) einer Nachuntersuchung aller Studienteilnehmer, (iii) der Qualität und Diversität der gesammelten Biomaterialien und (iv) der Durchführung einer MRT-Untersuchung bei Personen (und der damit einhergehenden Erstellung einer Datenbank zur Bildgebung). Limitationen einer so breit angelegten Kohorte sind, dass (i) die Gesamtzahl komplexer und teurer Untersuchungsinstrumente aus Zeit- und Kostengründen eingeschränkt ist, (ii) sehr aufwändige Verfahren zum Erreichen einer hohen Beteiligung, nicht möglich sind und (iii) die Logistik und Qualitätssicherung durch die große Zahl von Studienzentren kompliziert wird. Insgesamt überwiegen nach Ansicht der Autoren die Vorteile gegenüber den Limitationen deutlich. Die Nationale Kohorte stellt eine wichtige Investition in die Zukunft dar, wird von großem Nutzen für die medizinische Forschung sein und wichtige Erkenntnisse zur Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung liefern. Korrespondenzadresse Prof. Dr. Dr. H.-E. Wichmann Helmholtz-Zentrum München Ingolstädter Landstr. 1, Neuherberg Danksagung. Wir danken den vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die durch ihre Beteiligung an den Thematischen Arbeitsgruppen maßgeblich an der Konzeptentwicklung der Nationalen Kohorte mitgewirkt haben. Für die Mitwirkung an dem vorliegenden Artikel danken wir Frau Dipl.-Geol. Inke Thiele, MPH. Des Weiteren sind wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die lokal und überregional am Aufbau der Infrastruktur und der Durchführung der Pretests beteiligt waren, zu großem Dank verpflichtet. Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autor gibt für sich und seine Koautoren an, dass kein Interessenkonflikt besteht. Literatur 1. Robert Koch-Institut (Hrsg) (2006) Gesundheit in Deutschland. Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Robert Koch-Institut, Berlin 2. Van Baal P, Polder J, Wit A de et al (2008) Lifetime medical costs of obesity: prevention no cure for increasing health expenditure. PLoS Med 5(2):29 3. Rappange DR, Brouwer WB, Rutten FF, Baal PH van (2010) Lifestyle intervention: from cost savings to value for money. J Public Health 32: Greiser KH, Kluttig A, Schumann B et al (2005) Cardiovascular disease, risk factors and heart rate variability in the elderly general population: design and objectives of the Cardiovascular dis ease, Living and Ageing in Halle (CARLA) Study. BMC Cardiovasc Disord 5:33 5. Bergmann MM, Bussas U, Boeing H (2000) Follow-up procedures in EPIC Germany data quality aspects. Ann Nutr Metab 43(4): Holle R, Happich M, Lowel H, Wichmann HE (2005) KORA a research platform for population based health research. Gesundheitswesen 67(Suppl 1): John U, Greiner B, Hensel E et al (2001) Study of Health In Pomerania (SHIP): a health examination survey in an east German region: objectives and design. Soz Praventivmed 46: Erbel R, Möhlenkamp S, Moebus S et al (2010) Coronary risk stratification, discrimination, and reclassification improvement based on quantification of subclinical coronary atherosclerosis: the Heinz Nixdorf Recall study. J Am Coll Cardiol 56: Nationale Kohorte (2012) Nationale Kohorte UK Biobank (2012) UK Biobank Constances (2012) Constances. rokdown loads &view=folder&itemid=126&id=237%3aannexesdu-protocole-de-la-phase-pilote&limitstart= LifeGene (2012) LifeGene. Forscientists/Questionnaire-Overview/ 13. Nationale Kohorte (2012) Wissenschaftliches Konzept. wissenschaftliches_konzept_der_nationalen_kohorte.pdf 14. Nationale Kohorte (2012) EPC-Mitglieder Nationale Kohorte (2012) Thematische Arbeitsgruppen Bundesdatenschutzgesetz (2010) Bundesdatenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2003 (BGBl. I S. 66), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. August 2009 (BGBl. I S. 2814) geändert worden ist. gesetze-iminternet.de/bundesrecht/bdsg_1990/ gesamt.pdf 17. Deutscher Ethikrat (2010) Humanbiobanken für die Forschung. Stellungnahme. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 6/
Epidemiologische Kohortenstudien
 Epidemiologische Kohortenstudien Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Teil 1 Prof. Dr. K.-H. Jöckel Festsymposium"60 Jahre GMDS", 28. Oktober 2015, Köln Bekannte Kohortenstudien I Studie Ziele Umfang (Alter)
Epidemiologische Kohortenstudien Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Teil 1 Prof. Dr. K.-H. Jöckel Festsymposium"60 Jahre GMDS", 28. Oktober 2015, Köln Bekannte Kohortenstudien I Studie Ziele Umfang (Alter)
Die Nationale Kohorte: Datensammlung für eine gesündere Zukunft
 Powered by Seiten-Adresse: https://www.gesundheitsindustriebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/die-nationale-kohortedatensammlung-fuer-eine-gesuendere-zukunft/ Die Nationale Kohorte: Datensammlung für eine gesündere
Powered by Seiten-Adresse: https://www.gesundheitsindustriebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/die-nationale-kohortedatensammlung-fuer-eine-gesuendere-zukunft/ Die Nationale Kohorte: Datensammlung für eine gesündere
Der Ethikkodex der Nationalen Kohorte. Jochen Taupitz
 Der Ethikkodex der Nationalen Kohorte Jochen Taupitz 1 Nationale Kohorte Langzeit-Bevölkerungsstudie eines Netzwerks deutscher Forschungseinrichtungen, um die Ursachen von Volkskrankheiten wie z.b. Herz-Kreislauferkrankungen,
Der Ethikkodex der Nationalen Kohorte Jochen Taupitz 1 Nationale Kohorte Langzeit-Bevölkerungsstudie eines Netzwerks deutscher Forschungseinrichtungen, um die Ursachen von Volkskrankheiten wie z.b. Herz-Kreislauferkrankungen,
Body Mass Index und Selbsteinschätzung des Gesundheitszustands. Ergebnisse aus dem MONICA/KORA - Projekt Augsburg
 Body Mass Index und Selbsteinschätzung des Gesundheitszustands. Ergebnisse aus dem MONICA/KORA - Projekt Augsburg B.Sc. Ernähr.-Wiss. Christina Holzapfel 1,2 (G. Karg 2, K.-H. Ladwig 1, A. Döring 1 ) 1
Body Mass Index und Selbsteinschätzung des Gesundheitszustands. Ergebnisse aus dem MONICA/KORA - Projekt Augsburg B.Sc. Ernähr.-Wiss. Christina Holzapfel 1,2 (G. Karg 2, K.-H. Ladwig 1, A. Döring 1 ) 1
Die Nationale Kohorte
 Die Nationale Kohorte Gemeinsam forschen für eine gesündere Zukunft 19.11.2015 1 Ziele Erforschung der typischen Volkskrankheiten Sammlung von umfangreichen Gesundheitsdaten Relevante Fragestellungen Wie
Die Nationale Kohorte Gemeinsam forschen für eine gesündere Zukunft 19.11.2015 1 Ziele Erforschung der typischen Volkskrankheiten Sammlung von umfangreichen Gesundheitsdaten Relevante Fragestellungen Wie
Gemeinsam forschen für eine gesündere Zukunft Die Nationale Kohorte (NAKO) Prof. Dr. Wolfgang Ahrens für den Verein Nationale Kohorte e.v.
 Gemeinsam forschen für eine gesündere Zukunft Die Nationale Kohorte (NAKO) Prof. Dr. Wolfgang Ahrens für den Verein Nationale Kohorte e.v. Nationale Kohorte National Befragt und untersucht wird die in
Gemeinsam forschen für eine gesündere Zukunft Die Nationale Kohorte (NAKO) Prof. Dr. Wolfgang Ahrens für den Verein Nationale Kohorte e.v. Nationale Kohorte National Befragt und untersucht wird die in
Epidemiologische Kohortenstudien
 Epidemiologische Kohortenstudien Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Teil 1 Prof. Dr. K.-H. Jöckel Festsymposium"60 Jahre GMDS", 28. Oktober 2015, Köln Bekannte Kohortenstudien I Studie Ziele Umfang (Alter)
Epidemiologische Kohortenstudien Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Teil 1 Prof. Dr. K.-H. Jöckel Festsymposium"60 Jahre GMDS", 28. Oktober 2015, Köln Bekannte Kohortenstudien I Studie Ziele Umfang (Alter)
Antragstellung für Level 3-Projekte der Nationalen Kohorte 1. Aufruf
 Antragstellung für Level 3-Projekte der Nationalen Kohorte 1. Aufruf Stand 10.4.2014 Grundlage für Level 3 Projekte der Nationalen Kohorte ist die letzte von der Mitgliederversammlung genehmigte Level
Antragstellung für Level 3-Projekte der Nationalen Kohorte 1. Aufruf Stand 10.4.2014 Grundlage für Level 3 Projekte der Nationalen Kohorte ist die letzte von der Mitgliederversammlung genehmigte Level
Forschungsnetzwerk Nationale Kohorte setzt für Bevölkerungsstudie auf Siemens-MRT
 von Siemens und Presse Forschungsnetzwerk Nationale Kohorte setzt für Bevölkerungsstudie auf Siemens-MRT Studienzentren in Augsburg, Berlin, Essen, Mannheim und Neubrandenburg werden mit Siemens-Magnetresonanztomographen
von Siemens und Presse Forschungsnetzwerk Nationale Kohorte setzt für Bevölkerungsstudie auf Siemens-MRT Studienzentren in Augsburg, Berlin, Essen, Mannheim und Neubrandenburg werden mit Siemens-Magnetresonanztomographen
Die NAKO Gesundheitsstudie als Ressource der nationalen Gesundheitsforschung
 Die NAKO Gesundheitsstudie als Ressource der nationalen Gesundheitsforschung Prof. Wolfgang Ahrens Leibniz Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie BIPS Statistiktage Bamberg/ Fürth Die Gesundheit
Die NAKO Gesundheitsstudie als Ressource der nationalen Gesundheitsforschung Prof. Wolfgang Ahrens Leibniz Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie BIPS Statistiktage Bamberg/ Fürth Die Gesundheit
Chronische Krankheiten German National Cohort*
 *EPC-Sprecher: Hoffmann, Jöckel, Kaaks, Wichmann Chronische Krankheiten German National Cohort* Wichmann, Erich Institut für Epidemiologie I, Helmholtz-Zentrum München IBE, Lehrstuhl für Epidemiologie,
*EPC-Sprecher: Hoffmann, Jöckel, Kaaks, Wichmann Chronische Krankheiten German National Cohort* Wichmann, Erich Institut für Epidemiologie I, Helmholtz-Zentrum München IBE, Lehrstuhl für Epidemiologie,
Biobanking in der Nationalen Kohorte und anderen epidemiologischen Studien
 Biobanking in der Nationalen Kohorte und anderen epidemiologischen Studien Prof. Dr. Dr. H.-Erich Wichmann, München 1. Nat. Biobanken-Symposium 12.12.2012 TMF Berlin 1 Inhalt Bevölkerungsbezogene Biobanken
Biobanking in der Nationalen Kohorte und anderen epidemiologischen Studien Prof. Dr. Dr. H.-Erich Wichmann, München 1. Nat. Biobanken-Symposium 12.12.2012 TMF Berlin 1 Inhalt Bevölkerungsbezogene Biobanken
Zentrales Datenmanagement in der Nationalen Kohorte. Stefan Ostrzinski & Daniel Kraft
 Zentrales Datenmanagement in der Nationalen Kohorte Stefan Ostrzinski & Daniel Kraft Nationale Kohorte: Studiendesign Bevölkerungsbasierte prospektive Kohortenstudie Altersbereich 20-69 Jahre zur Baseline-Untersuchung
Zentrales Datenmanagement in der Nationalen Kohorte Stefan Ostrzinski & Daniel Kraft Nationale Kohorte: Studiendesign Bevölkerungsbasierte prospektive Kohortenstudie Altersbereich 20-69 Jahre zur Baseline-Untersuchung
Die ESTHER-Studie. Landesweite Kohortenstudie im Saarland
 Die ESTHER-Studie Epidemiologische Studie zu Chancen der Verhütung, Früherkennung und optimierten Therapie chronischer Erkrankungen in der älteren Bevölkerung Landesweite Kohortenstudie im Saarland Hintergründe
Die ESTHER-Studie Epidemiologische Studie zu Chancen der Verhütung, Früherkennung und optimierten Therapie chronischer Erkrankungen in der älteren Bevölkerung Landesweite Kohortenstudie im Saarland Hintergründe
Bremer Institut für Präventionsforschung und Sozialmedizin (BIPS) Zentrum für Public Health der Universität Bremen
 Bremer Institut für Präventionsforschung und Sozialmedizin (BIPS) Zentrum für Public Health der Universität Bremen Institutsdirektor: Prof. Dr. med. E. Greiser Krebs durch Wechseljahres-Hormone in Deutschland
Bremer Institut für Präventionsforschung und Sozialmedizin (BIPS) Zentrum für Public Health der Universität Bremen Institutsdirektor: Prof. Dr. med. E. Greiser Krebs durch Wechseljahres-Hormone in Deutschland
Eröffnung des Studienzentrums Nationale Kohorte , Uhr, UKE, Martinistr. 52 Studienzentrum
 Seite 1 von 7 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wissenschaft und Forschung DIE SENATORIN Eröffnung des Studienzentrums Nationale Kohorte 25. 11. 2014, 13.00 Uhr, UKE, Martinistr. 52 Studienzentrum
Seite 1 von 7 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wissenschaft und Forschung DIE SENATORIN Eröffnung des Studienzentrums Nationale Kohorte 25. 11. 2014, 13.00 Uhr, UKE, Martinistr. 52 Studienzentrum
Statistische Analysen am Beispiel unterschiedlicher Fragestellungen der NAKO
 Statistische Analysen am Beispiel unterschiedlicher Fragestellungen der NAKO Institut für Medizinische Biometrie und Statistik Universitätsklinikum Freiburg 1. Beiratssitzung der NAKO Freiburg, No. 2 Kurzfristige
Statistische Analysen am Beispiel unterschiedlicher Fragestellungen der NAKO Institut für Medizinische Biometrie und Statistik Universitätsklinikum Freiburg 1. Beiratssitzung der NAKO Freiburg, No. 2 Kurzfristige
Bevölkerungsbezogene Biobank KORA-gen
 Bevölkerungsbezogene Biobank KORA-gen H.-Erich Wichmann 1, 2 1 GSF, Neuherberg 2 LMU - Lehrstuhl für Epidemiologie, Universität München Vortrag auf der MEDICA am 18.11.2005 in Düsseldorf genetische Erforschung
Bevölkerungsbezogene Biobank KORA-gen H.-Erich Wichmann 1, 2 1 GSF, Neuherberg 2 LMU - Lehrstuhl für Epidemiologie, Universität München Vortrag auf der MEDICA am 18.11.2005 in Düsseldorf genetische Erforschung
Alexandra Lang, Gabriele Ellsäßer
 INFAKTUM Depression (12-Monatsprävalenz) in der Brandenburger Bevölkerung - Ergebnisse des telefonischen Gesundheitssurveys Gesundheit in Deutschland aktuell (GEDA) I. Datengrundlage Alexandra Lang, Gabriele
INFAKTUM Depression (12-Monatsprävalenz) in der Brandenburger Bevölkerung - Ergebnisse des telefonischen Gesundheitssurveys Gesundheit in Deutschland aktuell (GEDA) I. Datengrundlage Alexandra Lang, Gabriele
Der Krebs nach dem Krebs
 Bundestagung 2010 der Frauenselbsthilfe nach Krebs 27.08.2010, 2010 Magdeburg Der Krebs nach dem Krebs Wie häufig ist die zweite Krebserkrankung? Prof. Dr. med. Institut für Krebsepidemiologie e.v. Universität
Bundestagung 2010 der Frauenselbsthilfe nach Krebs 27.08.2010, 2010 Magdeburg Der Krebs nach dem Krebs Wie häufig ist die zweite Krebserkrankung? Prof. Dr. med. Institut für Krebsepidemiologie e.v. Universität
Epidemiologie - Ansätze. Anke Huss, PhD Institute for Risk Assessment Sciences Utrecht University
 Epidemiologie - Ansätze Anke Huss, PhD Institute for Risk Assessment Sciences Utrecht University Epidemiologie Epidemiology is the study of the distribution of health and disease in the population, and
Epidemiologie - Ansätze Anke Huss, PhD Institute for Risk Assessment Sciences Utrecht University Epidemiologie Epidemiology is the study of the distribution of health and disease in the population, and
Bluthochdruck trotz Behandlung? Frauen und Männer mit niedrigen Einkommen sind häufiger betroffen
 Bluthochdruck trotz Behandlung? Frauen und Männer mit niedrigen Einkommen sind häufiger betroffen Dragano* N, Moebus S, Stang A, Möhlenkamp S, Mann K, Erbel R, Jöckel KH, Siegrist J, für die Heinz Nixdorf
Bluthochdruck trotz Behandlung? Frauen und Männer mit niedrigen Einkommen sind häufiger betroffen Dragano* N, Moebus S, Stang A, Möhlenkamp S, Mann K, Erbel R, Jöckel KH, Siegrist J, für die Heinz Nixdorf
Fettsäureprofil der roten Blutkörperchen steht im Zusammenhang mit dem Diabetes-Risiko
 Fettsäureprofil der roten Blutkörperchen steht im Zusammenhang mit dem Diabetes-Risiko Potsdam-Rehbrücke (28. Oktober 2010) Zellmembranen sind zum Großteil aus Fettsäuremolekülen unterschiedlichster Art
Fettsäureprofil der roten Blutkörperchen steht im Zusammenhang mit dem Diabetes-Risiko Potsdam-Rehbrücke (28. Oktober 2010) Zellmembranen sind zum Großteil aus Fettsäuremolekülen unterschiedlichster Art
Fertilität und psychische Gesundheit im Alter
 Fertilität und psychische Gesundheit im Alter Kai Eberhard Kruk MEA, Universität Mannheim MEA Jahreskonferenz, 30.11.2010 Mannheim Research Institute for the Economics of Aging www.mea.uni-mannheim.de
Fertilität und psychische Gesundheit im Alter Kai Eberhard Kruk MEA, Universität Mannheim MEA Jahreskonferenz, 30.11.2010 Mannheim Research Institute for the Economics of Aging www.mea.uni-mannheim.de
PROBASE: Große deutsche Studie zum Prostatakrebs-Screening. PROBASE Große deutsche Studie zum Prostatakrebs-Screening
 PROBASE Große deutsche Studie zum Prostatakrebs-Screening Dresden (27. September 2013) Ziel der PROBASE-Studie (Risk-adapted prostate cancer early detection study based on a baseline PSA value in young
PROBASE Große deutsche Studie zum Prostatakrebs-Screening Dresden (27. September 2013) Ziel der PROBASE-Studie (Risk-adapted prostate cancer early detection study based on a baseline PSA value in young
Die Nationale Kohorte Verknüpfung von Primär-, Sekundär- und Registerdaten
 Die Nationale Kohorte Verknüpfung von Primär-, Sekundär- und Registerdaten Svenja Jacobs Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie - BIPS 02.07.2015 1 Die Nationale Kohorte 02.07.2015
Die Nationale Kohorte Verknüpfung von Primär-, Sekundär- und Registerdaten Svenja Jacobs Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie - BIPS 02.07.2015 1 Die Nationale Kohorte 02.07.2015
Die Verbreitung von Übergewicht und Adipositas
 Angelika Schaffrath Rosario, Bärbel-M. Kurth Die Verbreitung von Übergewicht und Adipositas Korrespondenzadresse: Robert Koch-Institut Seestr. 10 13353 Berlin rosarioa@rki.de KiGGS-Geschäftsstelle: Seestr.
Angelika Schaffrath Rosario, Bärbel-M. Kurth Die Verbreitung von Übergewicht und Adipositas Korrespondenzadresse: Robert Koch-Institut Seestr. 10 13353 Berlin rosarioa@rki.de KiGGS-Geschäftsstelle: Seestr.
Stellungnahme. des Medizinischen Dienstes. des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.v. (MDS) zur öffentlichen Anhörung
 Stellungnahme des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.v. (MDS) zur öffentlichen Anhörung zum Änderungsantrag der Fraktionen CDU/CSU und SPD Ausschussdrucksache 18(14)0107.1
Stellungnahme des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.v. (MDS) zur öffentlichen Anhörung zum Änderungsantrag der Fraktionen CDU/CSU und SPD Ausschussdrucksache 18(14)0107.1
Nationale Biobanken und internationale Vernetzung: KORA-gen
 Nationale Biobanken und internationale Vernetzung: KORA-gen Christian Gieger 1, 2, H.-Erich Wichmann 1, 2 1 GSF, Neuherberg 2 LMU - Lehrstuhl für Epidemiologie, Universität München Biomaterialbanken TMF-Symposium
Nationale Biobanken und internationale Vernetzung: KORA-gen Christian Gieger 1, 2, H.-Erich Wichmann 1, 2 1 GSF, Neuherberg 2 LMU - Lehrstuhl für Epidemiologie, Universität München Biomaterialbanken TMF-Symposium
Epidemiologie von Tumorerkrankungen in Deutschland
 Martin Meyer Epidemiologie von Tumorerkrankungen in Deutschland www.krebsregister-bayern.de Krebsregister in Deutschland Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e.v. (www.gekid.de)
Martin Meyer Epidemiologie von Tumorerkrankungen in Deutschland www.krebsregister-bayern.de Krebsregister in Deutschland Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e.v. (www.gekid.de)
Welche Hinweise liefern aktuelle Daten und Fakten zur Männergesundheit?
 1 2. Männergesundheitskongress Man(n) informiert sich Fragen und Antworten zur Männergesundheit Welche Hinweise liefern aktuelle Daten und Fakten zur Männergesundheit? Anne Starker Robert Koch-Institut
1 2. Männergesundheitskongress Man(n) informiert sich Fragen und Antworten zur Männergesundheit Welche Hinweise liefern aktuelle Daten und Fakten zur Männergesundheit? Anne Starker Robert Koch-Institut
Betriebliches Gesundheitsmanagement
 Betriebliches Gesundheitsmanagement Angebot von verhaltensorientierten Maßnahmen durch vital for work mit dem Zentrum für sportmedizinische Prävention (ZsP) an der Universität Bielefeld Ein betriebliches
Betriebliches Gesundheitsmanagement Angebot von verhaltensorientierten Maßnahmen durch vital for work mit dem Zentrum für sportmedizinische Prävention (ZsP) an der Universität Bielefeld Ein betriebliches
Möglichkeiten und Grenzen der Epidemiologie in der Arbeitsmedizin
 Möglichkeiten und Grenzen der Epidemiologie in der Arbeitsmedizin Prof. Dr. T. Brüning, PD Dr. B. Pesch, Prof. Dr. K.-H. Jöckel 55. Wissenschaftliche Jahrestagung der DGAUM e.v. München, 18. 20. März 2015
Möglichkeiten und Grenzen der Epidemiologie in der Arbeitsmedizin Prof. Dr. T. Brüning, PD Dr. B. Pesch, Prof. Dr. K.-H. Jöckel 55. Wissenschaftliche Jahrestagung der DGAUM e.v. München, 18. 20. März 2015
Selbstbestimmung über Liebe,Partnerschaft und Sexualität im Alter(-sheim)
 Geisteswissenschaft Heike Rieperdinger Selbstbestimmung über Liebe,Partnerschaft und Sexualität im Alter(-sheim) Aktueller Forschungsstand und Empfehlungen für zukünftige Forschung Bachelorarbeit Selbstbestimmung
Geisteswissenschaft Heike Rieperdinger Selbstbestimmung über Liebe,Partnerschaft und Sexualität im Alter(-sheim) Aktueller Forschungsstand und Empfehlungen für zukünftige Forschung Bachelorarbeit Selbstbestimmung
BARMER GEK Studienergebnisse zur Versorgung von Patienten mit Diabetes mellitus
 BARMER GEK Studienergebnisse zur Versorgung von Patienten mit Diabetes mellitus 1 Impressum Herausgeber BARMER GEK 10837 Berlin www.barmer-gek.de Autorin des Textes Dipl.-Soz.-Wiss. Petra Kellermann-Mühlhoff,
BARMER GEK Studienergebnisse zur Versorgung von Patienten mit Diabetes mellitus 1 Impressum Herausgeber BARMER GEK 10837 Berlin www.barmer-gek.de Autorin des Textes Dipl.-Soz.-Wiss. Petra Kellermann-Mühlhoff,
Max. Sauerstoffaufnahme im Altersgang
 Max. Sauerstoffaufnahme im Altersgang Motorische Hauptbeanspruchungsformen im Alter Anteil chronischer Erkrankungen an den Gesamtkosten in Abhängigkeit vom Alter AOK Bundesverband, Bonn, 2002 Prävalenz
Max. Sauerstoffaufnahme im Altersgang Motorische Hauptbeanspruchungsformen im Alter Anteil chronischer Erkrankungen an den Gesamtkosten in Abhängigkeit vom Alter AOK Bundesverband, Bonn, 2002 Prävalenz
Geburts-/Kinderkohorte in der NAKO Erhebung von Stilldaten
 Geburts-/Kinderkohorte in der NAKO Erhebung von Stilldaten Mirjam Frank, M.Sc. Institut für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie, Universitätsklinikum Essen Geburts-/Kinderkohorte der NAKO
Geburts-/Kinderkohorte in der NAKO Erhebung von Stilldaten Mirjam Frank, M.Sc. Institut für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie, Universitätsklinikum Essen Geburts-/Kinderkohorte der NAKO
Die Nationale Kohorte
 Die Nationale Kohorte Prof. Dr. Karl-Heinz Jöckel für den Verein Nationale Kohorte e.v. Delegiertenkonferenz der AWMF, Frankfurt, 15.11. 2014 Ziele der Nationalen Kohorte Erforschung der typischen Volkskrankheiten
Die Nationale Kohorte Prof. Dr. Karl-Heinz Jöckel für den Verein Nationale Kohorte e.v. Delegiertenkonferenz der AWMF, Frankfurt, 15.11. 2014 Ziele der Nationalen Kohorte Erforschung der typischen Volkskrankheiten
Passivrauch-Exposition und Koronarsklerose bei Nichtrauchern
 Passivrauch-Exposition und Koronarsklerose bei Nichtrauchern Peinemann F, 1,2 Moebus S, 2 Dragano N, 3 Möhlenkamp S, 2 Lehmann N, 2 Zeeb H, 1 Erbel R, 2 Jöckel KH, 2 Hoffmann B, 2 im Namen der Heinz Nixdorf
Passivrauch-Exposition und Koronarsklerose bei Nichtrauchern Peinemann F, 1,2 Moebus S, 2 Dragano N, 3 Möhlenkamp S, 2 Lehmann N, 2 Zeeb H, 1 Erbel R, 2 Jöckel KH, 2 Hoffmann B, 2 im Namen der Heinz Nixdorf
Querschnittsbereich Nr. 1: Epidemiologie, Med. Biometrie und Med. Informatik
 Prävalenz Die Prävalenz ist eine Maßzahl für die Häufigkeit eines Zustandes zu einem bestimmten Zeitpunkt, z. B. der Anteil der Bevölkerung, der zu einem bestimmten Zeitpunkt übergewichtig ist oder der
Prävalenz Die Prävalenz ist eine Maßzahl für die Häufigkeit eines Zustandes zu einem bestimmten Zeitpunkt, z. B. der Anteil der Bevölkerung, der zu einem bestimmten Zeitpunkt übergewichtig ist oder der
Antrag zur Durchführung einer epidemiologischen Studie
 Absender/ Begleitschreiben: Antrag zur Durchführung einer epidemiologischen Studie 1. Bezeichnung der Studie 2. Ziel der Studie Fragestellung (einschl. Formulierung der Forschungshypothese) Relevanz für
Absender/ Begleitschreiben: Antrag zur Durchführung einer epidemiologischen Studie 1. Bezeichnung der Studie 2. Ziel der Studie Fragestellung (einschl. Formulierung der Forschungshypothese) Relevanz für
2. Arbeitstreffen Stellungnahmen der wissenschaftlichen Fachgesellschaften Zwischenbilanz und weitere Schritte
 2. Arbeitstreffen Stellungnahmen der wissenschaftlichen Fachgesellschaften Zwischenbilanz und weitere Schritte H. Tönnies Robert Koch-Institut Geschäftsstelle der Gendiagnostik-Kommission (GEKO) www.rki.de\geko
2. Arbeitstreffen Stellungnahmen der wissenschaftlichen Fachgesellschaften Zwischenbilanz und weitere Schritte H. Tönnies Robert Koch-Institut Geschäftsstelle der Gendiagnostik-Kommission (GEKO) www.rki.de\geko
EVIDENZ KOMPAKT. Lungenfunktionstestung mittels Spirometrie bei asymptomatischen Erwachsenen
 EVIDENZ KOMPAKT Lungenfunktionstestung mittels Spirometrie bei asymptomatischen Erwachsenen Stand: 14.02.2017 Autoren Stefanie Butz (M. Sc. Public Health) Dr. med. Dagmar Lühmann (Oberärztliche Koordinatorin
EVIDENZ KOMPAKT Lungenfunktionstestung mittels Spirometrie bei asymptomatischen Erwachsenen Stand: 14.02.2017 Autoren Stefanie Butz (M. Sc. Public Health) Dr. med. Dagmar Lühmann (Oberärztliche Koordinatorin
Internationale Evaluationen von Mammographie-Screening-Programmen. Strategien zur Kontrolle von Bias
 Internationale Evaluationen von Mammographie-Screening-Programmen Strategien zur Kontrolle von Bias Untersuchung im Auftrag des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung in der BRD Marcial Velasco
Internationale Evaluationen von Mammographie-Screening-Programmen Strategien zur Kontrolle von Bias Untersuchung im Auftrag des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung in der BRD Marcial Velasco
Lebensstilfaktoren und das Risiko
 Lebensstilfaktoren und das Risiko chronischer Erkrankungen Ute Nöthlings Sektion für Epidemiologie Institute für Experimentelle Medizin Christian-Albrechts-Universität zu Kiel SYMPOSIUM REHA 2020, Freiburg,
Lebensstilfaktoren und das Risiko chronischer Erkrankungen Ute Nöthlings Sektion für Epidemiologie Institute für Experimentelle Medizin Christian-Albrechts-Universität zu Kiel SYMPOSIUM REHA 2020, Freiburg,
Körperfettverteilung beeinflusst Prostatakrebsrisiko
 Körperfettverteilung beeinflusst Prostatakrebsrisiko Potsdam-Rehbrücke (18. November 2008) - Wie eine der weltweit größten Langzeitstudien nun zeigt, spielt die Körperfettverteilung an Taille und Hüfte
Körperfettverteilung beeinflusst Prostatakrebsrisiko Potsdam-Rehbrücke (18. November 2008) - Wie eine der weltweit größten Langzeitstudien nun zeigt, spielt die Körperfettverteilung an Taille und Hüfte
PRAXISEMPFEHLUNGEN DDG. Diabetologie und Stoffwechsel. Supplement CLINICAL PRACTICE RECOMMENDATIONS
 Diabetologie und Stoffwechsel Supplement S2 Oktober 2018 Seite S83 S290 13. Jahrgang This journal is listed in Science Citation Index, EMBASE and SCOPUS Offizielles Organ der Deutschen Diabetes Gesellschaft
Diabetologie und Stoffwechsel Supplement S2 Oktober 2018 Seite S83 S290 13. Jahrgang This journal is listed in Science Citation Index, EMBASE and SCOPUS Offizielles Organ der Deutschen Diabetes Gesellschaft
PROJEKTMANAGEMENT IN EINER GROßEN EPIDEMIOLOGISCHEN STUDIE - ERFAHRUNGEN BEI DER IMPLEMENTATION DES DERMATOLOGIE- MODULS IN SHIP
 PROJEKTMANAGEMENT IN EINER GROßEN EPIDEMIOLOGISCHEN STUDIE - ERFAHRUNGEN BEI DER IMPLEMENTATION DES DERMATOLOGIE- MODULS IN SHIP A d We e 02. April 2009 Institut für Community Medicine Ernst-Moritz-Arndt-Universität
PROJEKTMANAGEMENT IN EINER GROßEN EPIDEMIOLOGISCHEN STUDIE - ERFAHRUNGEN BEI DER IMPLEMENTATION DES DERMATOLOGIE- MODULS IN SHIP A d We e 02. April 2009 Institut für Community Medicine Ernst-Moritz-Arndt-Universität
SOZIALPOLITISCHE STUDIENREIHE. Kinder und Jugendliche als pflegende Angehörige
 SOZIALPOLITISCHE STUDIENREIHE BAND 19 Kinder und Jugendliche als pflegende Angehörige Einblick in die Situation Betroffener und Möglichkeiten der Unterstützung Zwei Studien des Instituts für Pflegewissenschaft
SOZIALPOLITISCHE STUDIENREIHE BAND 19 Kinder und Jugendliche als pflegende Angehörige Einblick in die Situation Betroffener und Möglichkeiten der Unterstützung Zwei Studien des Instituts für Pflegewissenschaft
Einfacher Risikotest für Diabetes nach der Schwangerschaft
 Gestationsdiabetes Einfacher Risikotest für Diabetes nach der Schwangerschaft Neuherberg (22. Oktober 2015) - Gestationsdiabetes ist eine der häufigsten Begleiterkrankungen während der Schwangerschaft.
Gestationsdiabetes Einfacher Risikotest für Diabetes nach der Schwangerschaft Neuherberg (22. Oktober 2015) - Gestationsdiabetes ist eine der häufigsten Begleiterkrankungen während der Schwangerschaft.
Sport und Bewegung. Körperliche Aktivität. Das Potenzial körperlicher Aktivität. Das Potenzial körperlicher Aktivität
 Körperliche Aktivität Fachtagung Psychische Belastungen im Beruf Bad Münstereifel - 27./28. Mai 2010 körperliche Bewegung Sport und Bewegung Gesundheitssport Training Susanne Brandstetter Universitätsklinikum
Körperliche Aktivität Fachtagung Psychische Belastungen im Beruf Bad Münstereifel - 27./28. Mai 2010 körperliche Bewegung Sport und Bewegung Gesundheitssport Training Susanne Brandstetter Universitätsklinikum
HPV-Antikörpertest als Frühwarnsystem für Krebs im Mund-Rachen-Raum
 Humane Papillomviren HPV-Antikörpertest als Frühwarnsystem für Krebs im Mund-Rachen-Raum Heidelberg (18. Juni 2013) - Der Nachweis von Antikörpern gegen Humane Papillomviren des Hochrisiko-Typs HPV 16
Humane Papillomviren HPV-Antikörpertest als Frühwarnsystem für Krebs im Mund-Rachen-Raum Heidelberg (18. Juni 2013) - Der Nachweis von Antikörpern gegen Humane Papillomviren des Hochrisiko-Typs HPV 16
Im Namen der Bayerischen Staatsregierung begrüße ich Sie sehr herzlich zur Eröffnung des Studienzentrums der Nationalen Kohorte in Augsburg.
 Sperrfrist: 22. Oktober 2014, 13.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der
Sperrfrist: 22. Oktober 2014, 13.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der
Vorwort... v. Danksagung... vii. 1 Einführung Besonderheiten epidemiologischer Methoden... 1
 Inhalt Vorwort... v Danksagung... vii 1 Einführung... 1 1.1 Besonderheiten epidemiologischer Methoden... 1 1.2 Anwendungsgebiete epidemiologischer Forschung... 5 1.3 Überblick über den weiteren Inhalt...
Inhalt Vorwort... v Danksagung... vii 1 Einführung... 1 1.1 Besonderheiten epidemiologischer Methoden... 1 1.2 Anwendungsgebiete epidemiologischer Forschung... 5 1.3 Überblick über den weiteren Inhalt...
Dickdarmkrebs ist eine häufig auftretende Form der Krebserkrankung. Einige Fakten hierzu:
 COLOgen-Test Dickdarmkrebs Prof Dr. B. Weber Laboratoires Réunis Risiken erkennen Der COLOgen Test gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr persönliches Risiko und Prädisposition an Darmkrebs zu erkranken, zu bestimmen.
COLOgen-Test Dickdarmkrebs Prof Dr. B. Weber Laboratoires Réunis Risiken erkennen Der COLOgen Test gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr persönliches Risiko und Prädisposition an Darmkrebs zu erkranken, zu bestimmen.
Glück ist machbar. Nutzen und Sinn Beruflicher Rehabilitation
 Glück ist machbar Nutzen und Sinn Beruflicher Rehabilitation Ergebnisse der Evaluationsstudie Von Synthesis Forschung und IBE im Auftrag des BBRZ Mai 2015 Untersuchungsgegenstand: Nutzen und Sinn Beruflicher
Glück ist machbar Nutzen und Sinn Beruflicher Rehabilitation Ergebnisse der Evaluationsstudie Von Synthesis Forschung und IBE im Auftrag des BBRZ Mai 2015 Untersuchungsgegenstand: Nutzen und Sinn Beruflicher
Blutzucker- Tagebuch. für Menschen mit Diabetes. www.diabetesinformationsdienst-muenchen.de
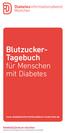 Blutzucker- Tagebuch für Menschen mit Diabetes www.diabetesinformationsdienst-muenchen.de Lieber Patient, für eine erfolgreiche Diabetes-Therapie ist es wichtig, seine Blutzuckerwerte zu kennen und langfristig
Blutzucker- Tagebuch für Menschen mit Diabetes www.diabetesinformationsdienst-muenchen.de Lieber Patient, für eine erfolgreiche Diabetes-Therapie ist es wichtig, seine Blutzuckerwerte zu kennen und langfristig
Medizinische Verbundforschung Perspektiven und Ausblick. Joachim Krebser BMBF
 Medizinische Verbundforschung Perspektiven und Ausblick Joachim Krebser BMBF Zehn Jahre TMF / Kompetenznetze in der Medizin, Jubiläumsveranstaltung 2009, 11.06.2009, Berlin Herausforderungen Chancen Zukunftsorientierte
Medizinische Verbundforschung Perspektiven und Ausblick Joachim Krebser BMBF Zehn Jahre TMF / Kompetenznetze in der Medizin, Jubiläumsveranstaltung 2009, 11.06.2009, Berlin Herausforderungen Chancen Zukunftsorientierte
Muster ANTRAGSTELLER / PROJEKT-SPEZIFIKATION
 An den Forschungsverbund COMMUNITY MEDICINE (FVCM) Geschäftsstelle FVCM c/o Prof. W. Hoffmann Institut für Community Medicine Abt. Versorgungsepidemiologie und Community Health Ellernholzstraße 1-2 17487
An den Forschungsverbund COMMUNITY MEDICINE (FVCM) Geschäftsstelle FVCM c/o Prof. W. Hoffmann Institut für Community Medicine Abt. Versorgungsepidemiologie und Community Health Ellernholzstraße 1-2 17487
Vorsorgen ist besser Unsere Angebote zur Früherkennung
 Vorsorgen ist besser Unsere Angebote zur Früherkennung Deutsche BKK Weil vorbeugen besser ist als heilen Die Deutsche BKK als Ihr Partner in Sachen Gesundheit bietet Ihnen nicht nur einen Rundum-Schutz,
Vorsorgen ist besser Unsere Angebote zur Früherkennung Deutsche BKK Weil vorbeugen besser ist als heilen Die Deutsche BKK als Ihr Partner in Sachen Gesundheit bietet Ihnen nicht nur einen Rundum-Schutz,
Audit. Qualität und Gras wachsen hören. Hartmut Vöhringer
 Qualität und Gras wachsen hören QM in der Pflege Vorgegeben durch 113 SGB XI Produktqualität (Ergebnisqualität) Prozessqualität Systemqualität Überprüfung der Qualitätswirksamkeit von Prozessen Systemen
Qualität und Gras wachsen hören QM in der Pflege Vorgegeben durch 113 SGB XI Produktqualität (Ergebnisqualität) Prozessqualität Systemqualität Überprüfung der Qualitätswirksamkeit von Prozessen Systemen
des von Vortrages chronisch kranken Patienten Ergebnisse der gesetzlichen Evaluation der AOK-Programme (Bundesauswertung)
 Hier DMP steht verbessern das Thema die Versorgung des von Vortrages chronisch kranken Patienten Ergebnisse der gesetzlichen Evaluation der AOK-Programme (Bundesauswertung) Wirksamkeit der DMPs Gesetzliche
Hier DMP steht verbessern das Thema die Versorgung des von Vortrages chronisch kranken Patienten Ergebnisse der gesetzlichen Evaluation der AOK-Programme (Bundesauswertung) Wirksamkeit der DMPs Gesetzliche
3.13 Prostata. Kernaussagen
 98 Ergebnisse zur Prostata 3.13 Prostata Kernaussagen Inzidenz und Mortalität: Prostatakrebs ist inzwischen die häufigste Krebserkrankung bei n. Die altersstandardisierten Erkrankungsraten an Prostatakrebs
98 Ergebnisse zur Prostata 3.13 Prostata Kernaussagen Inzidenz und Mortalität: Prostatakrebs ist inzwischen die häufigste Krebserkrankung bei n. Die altersstandardisierten Erkrankungsraten an Prostatakrebs
Epidemiologie. Vorlesung Klinische Psychologie, WS 2009/2010
 Epidemiologie Prof. Tuschen-Caffier Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie Universität Freiburg Sprechstunde: Mi, 14.00 15.00 Uhr, Raum 1013 Vorlesung Klinische Psychologie, WS 2009/2010
Epidemiologie Prof. Tuschen-Caffier Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie Universität Freiburg Sprechstunde: Mi, 14.00 15.00 Uhr, Raum 1013 Vorlesung Klinische Psychologie, WS 2009/2010
Seelische Gesundheit in der Kindheit und Adoleszenz
 Seelische Gesundheit in der Kindheit und Adoleszenz Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Forschungssektion Child Public Health Auszug aus dem Vortrag in Stade am 09.10.2013 1 Public Health Relevanz In
Seelische Gesundheit in der Kindheit und Adoleszenz Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Forschungssektion Child Public Health Auszug aus dem Vortrag in Stade am 09.10.2013 1 Public Health Relevanz In
Querschnittsbereich Nr. 1: Epidemiologie, Medizinische Biometrie und Medizinische Informatik. Behandelt werden 4 Themenblöcke
 Querschnittsbereich Nr. 1: Epidemiologie, Medizinische Biometrie und Medizinische Informatik Behandelt werden 4 Themenblöcke Ätiologie und Risiko Diagnose und Prognose Intervention Medizinische Informatik
Querschnittsbereich Nr. 1: Epidemiologie, Medizinische Biometrie und Medizinische Informatik Behandelt werden 4 Themenblöcke Ätiologie und Risiko Diagnose und Prognose Intervention Medizinische Informatik
(Ausbaufähiges) Präventionspotenzial des deutschen Koloskopie-Screenings M Schäfer, A Weber, L Altenhofen
 (Ausbaufähiges) Präventionspotenzial des deutschen Koloskopie-Screenings M Schäfer, A Weber, L Altenhofen Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung in Deutschland US-Preventive Service Task Force:
(Ausbaufähiges) Präventionspotenzial des deutschen Koloskopie-Screenings M Schäfer, A Weber, L Altenhofen Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung in Deutschland US-Preventive Service Task Force:
Neues zur Epidemiologie von Stürzen und sturzbedingten Verletzungen in Deutschland
 Neues zur Epidemiologie von Stürzen und sturzbedingten Verletzungen in Deutschland Christa Scheidt-Nave, Judith Fuchs Robert Koch-Institut Berlin in Kooperation mit Ellen Freiberger Institut für Biomedizin
Neues zur Epidemiologie von Stürzen und sturzbedingten Verletzungen in Deutschland Christa Scheidt-Nave, Judith Fuchs Robert Koch-Institut Berlin in Kooperation mit Ellen Freiberger Institut für Biomedizin
Der informierte Patient als Wegbereiter der zukünftigen Forschung
 Der informierte Patient als Wegbereiter der zukünftigen Forschung Riegler S., Macheiner T., Riegler A. MedPro 2014, Brandenburg Agenda Die Rolle des informierten Patienten im Bereich Biobanking Der Einwilligungsprozess
Der informierte Patient als Wegbereiter der zukünftigen Forschung Riegler S., Macheiner T., Riegler A. MedPro 2014, Brandenburg Agenda Die Rolle des informierten Patienten im Bereich Biobanking Der Einwilligungsprozess
Körperliche (In)Aktivität: wie lassen sich notwendige Daten für die Modellierung von Präventionseffekten in NRW gewinnen? Monika Mensing Odile Mekel
 Körperliche (In)Aktivität: wie lassen sich notwendige Daten für die Modellierung von Präventionseffekten in NRW gewinnen? Odile Mekel DGSMP - Jahrestagung 2016 Hintergrund Gesundheitliche Auswirkungen
Körperliche (In)Aktivität: wie lassen sich notwendige Daten für die Modellierung von Präventionseffekten in NRW gewinnen? Odile Mekel DGSMP - Jahrestagung 2016 Hintergrund Gesundheitliche Auswirkungen
VERWALTUNGSAUFWAND IM STATIONÄREN BEREICH IN ZEITEN DES FACHKRÄFTEMANGELS
 VERWALTUNGSAUFWAND IM STATIONÄREN BEREICH IN ZEITEN DES FACHKRÄFTEMANGELS Ausgangssituation: Bedingt durch einen zunehmenden Mangel an medizinischem Fachpersonal, kommt der zukünftigen Entlastung durch
VERWALTUNGSAUFWAND IM STATIONÄREN BEREICH IN ZEITEN DES FACHKRÄFTEMANGELS Ausgangssituation: Bedingt durch einen zunehmenden Mangel an medizinischem Fachpersonal, kommt der zukünftigen Entlastung durch
Exposé zur Safari-Studie 2002: Der Mensch in IT-Projekten Tools und Methoden für den Projekterfolg durch Nutzerakzeptanz
 Exposé zur Safari-Studie 2002: Der Mensch in IT-Projekten Tools und Methoden für den Projekterfolg durch Nutzerakzeptanz Inhalt: Viele IT-Projekte scheitern nicht aus technisch bedingten Gründen, sondern
Exposé zur Safari-Studie 2002: Der Mensch in IT-Projekten Tools und Methoden für den Projekterfolg durch Nutzerakzeptanz Inhalt: Viele IT-Projekte scheitern nicht aus technisch bedingten Gründen, sondern
Vitamin D Das Sonnenhormon für unsere Gesundheit und der Schlüssel zur Prävention
 Vitamin D Das Sonnenhormon für unsere Gesundheit und der Schlüssel zur Prävention Prof. Dr. Jörg Spitz FA Nuklearmedizin, Ernährungsmediziner,Präventionsmediziner Gesellschaft für medizinische Information
Vitamin D Das Sonnenhormon für unsere Gesundheit und der Schlüssel zur Prävention Prof. Dr. Jörg Spitz FA Nuklearmedizin, Ernährungsmediziner,Präventionsmediziner Gesellschaft für medizinische Information
Prof. Dr. med. D. Bitter-Suermann Präsident des Medizinischen Fakultätentages Präsident der Medizinischen Hochschule Hannover Carl-Neuberg-Straße 1
 DGEpi Geschäftsstelle Bünteweg 2 D-30559 Hannover Prof. Dr. med. D. Bitter-Suermann Präsident des Medizinischen Fakultätentages Präsident der Medizinischen Hochschule Hannover Carl-Neuberg-Straße 1 30625
DGEpi Geschäftsstelle Bünteweg 2 D-30559 Hannover Prof. Dr. med. D. Bitter-Suermann Präsident des Medizinischen Fakultätentages Präsident der Medizinischen Hochschule Hannover Carl-Neuberg-Straße 1 30625
Unangeforderte Stellungnahme
 Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung Ausschussdrucksache 18(18)232 c 21.06.2016 Deutsche Hochschulmedizin e. V., Berlin Unangeforderte Stellungnahme Öffentliches Fachgespräch zum
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung Ausschussdrucksache 18(18)232 c 21.06.2016 Deutsche Hochschulmedizin e. V., Berlin Unangeforderte Stellungnahme Öffentliches Fachgespräch zum
Check-up Starnberger See
 Check-up Starnberger See Die Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. A. Schopenhauer Schön Klinik. Messbar. Spürbar. Besser. Nicht nur glauben, sondern wissen, dass alles in
Check-up Starnberger See Die Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. A. Schopenhauer Schön Klinik. Messbar. Spürbar. Besser. Nicht nur glauben, sondern wissen, dass alles in
Tanja Zeller 3. Dezember Nationales Biobanken-Symposium 2014, Berlin
 Zentrale wissenschaftliche Infrastruktur für klinische Forschung im Deutschen Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung Biobanking und zentrales Datenmanagement Tanja Zeller 3. Dezember 2014 3. Nationales Biobanken-Symposium
Zentrale wissenschaftliche Infrastruktur für klinische Forschung im Deutschen Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung Biobanking und zentrales Datenmanagement Tanja Zeller 3. Dezember 2014 3. Nationales Biobanken-Symposium
DMP als Werkzeug der Sekundärprävention - Evaluationsergebnisse aus Deutschland. Katrin Tomaschko
 DMP als Werkzeug der Sekundärprävention - Evaluationsergebnisse aus Deutschland Katrin Tomaschko AOK Baden-Württemberg DMP in Deutschland Überblick DMP = Disease Management Programme = strukturierte Behandlungsprogramme
DMP als Werkzeug der Sekundärprävention - Evaluationsergebnisse aus Deutschland Katrin Tomaschko AOK Baden-Württemberg DMP in Deutschland Überblick DMP = Disease Management Programme = strukturierte Behandlungsprogramme
DR. ARZT MUSTER MEIN TEAM MEIN TEAM. Ich freue mich, dass Sie meine Ordination gewählt haben. Herzlich willkommen in meiner Ordination!
 1 DR. ARZT MUSTER Facharzt für Neurologie und Psychiatrie 2 Herzlich willkommen in meiner Ordination! Ich freue mich, dass Sie meine Ordination gewählt haben. 3 4 Dr. Arzt Muster MEIN TEAM MEIN TEAM Medizinstudium
1 DR. ARZT MUSTER Facharzt für Neurologie und Psychiatrie 2 Herzlich willkommen in meiner Ordination! Ich freue mich, dass Sie meine Ordination gewählt haben. 3 4 Dr. Arzt Muster MEIN TEAM MEIN TEAM Medizinstudium
Extra: Schilddrüsenprobleme. Alle wichtigen Heilmethoden Das können Sie selbst tun. Gesunde Rezepte für die Schilddrüse. natürlich behandeln
 DR. ANDREA FLEMMER Schilddrüsenprobleme natürlich behandeln Alle wichtigen Heilmethoden Das können Sie selbst tun Extra: Gesunde Rezepte für die Schilddrüse Krankheiten und Probleme Schilddrüsenerkrankungen
DR. ANDREA FLEMMER Schilddrüsenprobleme natürlich behandeln Alle wichtigen Heilmethoden Das können Sie selbst tun Extra: Gesunde Rezepte für die Schilddrüse Krankheiten und Probleme Schilddrüsenerkrankungen
Adipositas im Kindes- und Jugendalter
 Adipositas im Kindes- und Jugendalter Eine retrospektive Studie Gerhard Steinau, Carsten J. Krones, Rafael Rosch, Volker Schumpelick Entsprechend einer repräsentativen Studie des Robert- Koch-Instituts
Adipositas im Kindes- und Jugendalter Eine retrospektive Studie Gerhard Steinau, Carsten J. Krones, Rafael Rosch, Volker Schumpelick Entsprechend einer repräsentativen Studie des Robert- Koch-Instituts
Abschlussbericht (Kurzversion)
 Prof. Dr. Klaus Stüwe Marion Kühn M. A. Jasmin Gotschke M. Sc. Maßnahmen der deutschen (Erz-) Bistümer zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer Familienfreundlichkeit in den deutschen
Prof. Dr. Klaus Stüwe Marion Kühn M. A. Jasmin Gotschke M. Sc. Maßnahmen der deutschen (Erz-) Bistümer zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer Familienfreundlichkeit in den deutschen
Sozioökonomische demografische Indikatoren und Krebsmortalität: eine ökologische Untersuchung des Epidemiologischen Krebsregisters Niedersachsen (EKN)
 Sozioökonomische demografische Indikatoren und Krebsmortalität: eine ökologische Untersuchung des Epidemiologischen s (EKN) Dr. Eunice Sirri, Joachim Kieschke - Oldenburg/Hannover http://www.krebsregister-niedersachsen.de
Sozioökonomische demografische Indikatoren und Krebsmortalität: eine ökologische Untersuchung des Epidemiologischen s (EKN) Dr. Eunice Sirri, Joachim Kieschke - Oldenburg/Hannover http://www.krebsregister-niedersachsen.de
Risikokonstellationen für Pflegebedarf
 Risikokonstellationen für Pflegebedarf Befunde einer Kohortenstudie zu Prädiktoren von Pflegebedarf bei Frauen und Männern ab 70 Jahren Susanne Schnitzer, Stefan Blüher, Andrea Teti, Elke Schaeffner, Natalie
Risikokonstellationen für Pflegebedarf Befunde einer Kohortenstudie zu Prädiktoren von Pflegebedarf bei Frauen und Männern ab 70 Jahren Susanne Schnitzer, Stefan Blüher, Andrea Teti, Elke Schaeffner, Natalie
Gesellschaftliche Krankheitslast des Tabak-Konsums in der Schweiz
 Gesellschaftliche Krankheitslast des Tabak-Konsums in der Schweiz Simon Wieser, Prof. Dr. oec. publ. wiso@zhaw.ch Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Gesellschaftliche Krankheitslast des Tabak-Konsums in der Schweiz Simon Wieser, Prof. Dr. oec. publ. wiso@zhaw.ch Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Themenfindung im Gesundheitsforschungsprogramm der Bundesregierung
 DLR-PT.de Folie 1 A. Lücke Themenfindung im Gesundheitsforschungsprogramm der Bundesregierung 23.09.2015 Themenfindung im Gesundheitsforschungsprogramm der Bundesregierung PD Dr. med. Anne Lücke DLR Projektträger
DLR-PT.de Folie 1 A. Lücke Themenfindung im Gesundheitsforschungsprogramm der Bundesregierung 23.09.2015 Themenfindung im Gesundheitsforschungsprogramm der Bundesregierung PD Dr. med. Anne Lücke DLR Projektträger
3.4 Darm. Hintergrund. Kernaussagen
 ICD-10 C18 C21 Ergebnisse zur 37 3.4 Darm Kernaussagen Inzidenz und Mortalität: Bösartige Neubildungen des Dickdarms und des Mastdarms sind für wie inzwischen die zweithäufigste Krebserkrankung und Krebstodesursache.
ICD-10 C18 C21 Ergebnisse zur 37 3.4 Darm Kernaussagen Inzidenz und Mortalität: Bösartige Neubildungen des Dickdarms und des Mastdarms sind für wie inzwischen die zweithäufigste Krebserkrankung und Krebstodesursache.
Erfahrungen und Methoden aus den Ex-post- Evaluierungen von ESF und EFRE 2007-2013
 Erfahrungen und Methoden aus den Ex-post- Evaluierungen von ESF und EFRE 2007-2013 Work Package Ten: Ex-post evaluation of Urban Development and Social Infrastructures (No. 2014CE16BAT035) Christine Hamza,
Erfahrungen und Methoden aus den Ex-post- Evaluierungen von ESF und EFRE 2007-2013 Work Package Ten: Ex-post evaluation of Urban Development and Social Infrastructures (No. 2014CE16BAT035) Christine Hamza,
Design Recruitment Response Projections
 Design Recruitment Response Projections Wolfgang Ahrens GMDS Präsidiumssitzung Krefeld, 6. September 2015 19.11.2015 1 Design 19.11.2015 2 18 Studienzentren 19.11.2015 3 Ziele der Nationalen Kohorte Erforschung
Design Recruitment Response Projections Wolfgang Ahrens GMDS Präsidiumssitzung Krefeld, 6. September 2015 19.11.2015 1 Design 19.11.2015 2 18 Studienzentren 19.11.2015 3 Ziele der Nationalen Kohorte Erforschung
Waist-to-height Ratio als Prädiktor für kardiovaskuläre Erkrankungen
 Waist-to-height Ratio als Prädiktor für kardiovaskuläre Erkrankungen Rapid Assessment zum Vergleich anthropometrischer Messmethoden Department für Evidenzbasierte Medizin und Klinische Epidemiologie Autorin
Waist-to-height Ratio als Prädiktor für kardiovaskuläre Erkrankungen Rapid Assessment zum Vergleich anthropometrischer Messmethoden Department für Evidenzbasierte Medizin und Klinische Epidemiologie Autorin
Phase: I. GKM Service Consulting, preparation of study synopses and protocols in the context of the early benefit assessment
 Statistical consulting Statistical consulting Beratung, Erstellung von Studiensynopsen und Prüfplänen zu Phase III Studien in verschiedenen Indikationen unter Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen
Statistical consulting Statistical consulting Beratung, Erstellung von Studiensynopsen und Prüfplänen zu Phase III Studien in verschiedenen Indikationen unter Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen
Vorsorgepass zur Früherkennung von. Krebs bei Männern
 Vorsorgepass zur Früherkennung von Krebs bei Männern Vorsorgepass zur Früherkennung von Krebs bei Männern In Schleswig-Holstein erkranken jährlich 18.000 Menschen neu an Krebs. Wird Krebs früh erkannt,
Vorsorgepass zur Früherkennung von Krebs bei Männern Vorsorgepass zur Früherkennung von Krebs bei Männern In Schleswig-Holstein erkranken jährlich 18.000 Menschen neu an Krebs. Wird Krebs früh erkannt,
Disease-Management-Programme (DMP)
 Management im Gesundheitswesen Krankenversicherung und Leistungsanbieter Disease-Management-Programme (DMP) Reinhard Busse, Prof. Dr. med. MPH FFPH FG Management im Gesundheitswesen, Technische Universität
Management im Gesundheitswesen Krankenversicherung und Leistungsanbieter Disease-Management-Programme (DMP) Reinhard Busse, Prof. Dr. med. MPH FFPH FG Management im Gesundheitswesen, Technische Universität
Depressive Störungen bei Frauen und Männern mit koronarer Herzerkrankung: Behandlungsraten und Einstellungen zu antidepressiver Therapie
 Depressive Störungen bei Frauen und Männern mit koronarer Herzerkrankung: Behandlungsraten und Einstellungen zu antidepressiver Therapie N. Rieckmann, V. Arolt, W. Haverkamp, P. Martus, A. Ströhle, J.
Depressive Störungen bei Frauen und Männern mit koronarer Herzerkrankung: Behandlungsraten und Einstellungen zu antidepressiver Therapie N. Rieckmann, V. Arolt, W. Haverkamp, P. Martus, A. Ströhle, J.
KOGNITIVES PRETESTING ZUR PRÜFUNG VON KONSTRUKTVALIDITÄT AM BEISPIEL DER HLS-EU SKALA
 KOGNITIVES PRETESTING ZUR PRÜFUNG VON KONSTRUKTVALIDITÄT AM BEISPIEL DER HLS-EU SKALA Robert Moosbrugger Joachim Gerich Institut für Soziologie Johannes Kepler Universität Linz Umfrageforschung in Österreich
KOGNITIVES PRETESTING ZUR PRÜFUNG VON KONSTRUKTVALIDITÄT AM BEISPIEL DER HLS-EU SKALA Robert Moosbrugger Joachim Gerich Institut für Soziologie Johannes Kepler Universität Linz Umfrageforschung in Österreich
Statusseminar Klinische Studien. Herausforderungen und Probleme in der Studienvorbereitung Workshop 1
 Herausforderungen und Probleme in der Studienvorbereitung Workshop 1 Bericht der Arbeitsgruppe I Gründe für das Fortführen des Programms Herausforderungen bei Antragstellung und Begutachtung Herausforderungen
Herausforderungen und Probleme in der Studienvorbereitung Workshop 1 Bericht der Arbeitsgruppe I Gründe für das Fortführen des Programms Herausforderungen bei Antragstellung und Begutachtung Herausforderungen
Der PROCAM Risiko Score
 International Task Force for Prevention Of Coronary Heart Disease Coronary heart disease and stroke: Risk factors and global risk Slide Kit 7 (Prospective Cardiovascular Münster Heart Study) Der Risiko
International Task Force for Prevention Of Coronary Heart Disease Coronary heart disease and stroke: Risk factors and global risk Slide Kit 7 (Prospective Cardiovascular Münster Heart Study) Der Risiko
