Die Veränderung von Lauftechniken bei Anfängern im Ausdauerlauf
|
|
|
- Silke Hermann
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Universität Osnabrück 14. Januar 2004 Hausarbeit im Rahmen der ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien Die Veränderung von Lauftechniken bei Anfängern im Ausdauerlauf eine empirische Studie Vorgelegt von: Erstgutachter: Till Voßmerbäumer Prof. Dr. H.-G. Scherer
2 Inhalt 1 Vorwort 4 2 Thema Ausdauerlauf Eingrenzung des Themas Literaturbasis 8 3 Theorie des Ausdauerlaufs Anatomie und Physiologie der unteren Extremitäten Physiologie des Laufens Laufen in biomechanischen Begriffen und Größen Gliederung in Phasen Schrittlänge Körperschwerpunkt Körperwinkel und Raumlagewinkel Gutes Laufen, biomechanisch beschrieben Pathologie des Laufens 27 4 Untersuchung Versuchsgruppe Anlage und Ablauf der Untersuchung Vor der Untersuchung Setzen der Marker Kleidung und Umfeld Aufnahme Erstellen eines 3D-Modells Auswertungsfehler und Datenglättung Auswertung der Untersuchung Statistische Auswertung Erste Untersuchungsreihe Zweite Untersuchungsreihe Vergleich von erster und zweiter Untersuchungsreihe Vergleich mit den Werten der erfahrenen Läuferin 52 5 Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick 57 6 Glossar medizinischer Fachbegriffe 60 Seite 2
3 Inhalt 7 Literatur 64 8 Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen 66 9 Anhang 77 Seite 3
4 1 Vorwort 1 Vorwort Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach der Veränderung von Laufstil nach. Zur Untersuchung dieser Fragestellung wurde in einem Längsschnitt eine Gruppe von Studenten während der Vorbereitung auf den Berlin- Marathon analysiert. In Kapitel zwei wird zunächst einmal das Thema vorgestellt und eingegrenzt. Die verwendete Literatur wird vorgestellt und die hier relevanten Erkenntnisse der Autoren dargestellt. Kapitel drei legt die theoretische Basis dieser Arbeit. Neben den anatomischen Grundlagen wird hier die Biomechanik des Laufens genauer dargestellt. Kapitel vier stellt in einem ersten Abschnitt die Versuchsgruppe und deren Auswahl vor. In einem weiteren Abschnitt wird dann die Anlage der Untersuchung und ihr Ablauf ausführlich dargelegt. Die Rahmenbedingungen werden erläutert, der Umgang mit den Versuchspersonen und nicht zuletzt die Umwandlung der gewonnenen Daten in die 3D-Modelle. In einem dritten Abschnitt dann werden die gewonnenen Daten ausführlich dargestellt und auf Besonderheiten untersucht. Außerdem werden die beiden Datenreihen untereinander und mit denen einer erfahrenen Läuferin verglichen. Kapitel fünf hat zum Ziel die wesentlichen Ergebnisse dieser Untersuchung kurz und knapp zusammen zu fassen und damit schnell verfügbar zu machen. Außerdem wird hier der weitere Forschungsbedarf, so er in dieser Arbeit zutage getreten ist, benannt. In Kapitel sechs werden die medizinischen Fachbegriffe, die in der Arbeit verwendet wurden, in einem kurzen Glossar zusammengefasst und knapp erläutert. Dies kann und soll kein Lexikon ersetzen, wohl aber dem Vorwissenden als Erinnerungsstütze dienen und allen anderen eine erste Orientierung geben. In Kapitel sieben und acht finden sich Verzeichnisse der Literatur, sowie der Tabellen und Abbildungen. Zuletzt schließt sich der Anhang an. Seite 4
5 1 Vorwort In der gesamten Arbeit wurde darauf verzichtet, beide generischen Formen (Läufer und Läuferinnen, etc.) zu verwenden, wenn sowohl männliche als auch weibliche Beteiligte angesprochen waren. Dies dient ausschließlich der besseren Lesbarkeit und soll in keiner Weise klassifizieren oder gar diskriminieren. Diejenigen medizinischen Fachbegriffe, die im Glossar erläutert werden, sind im Text der Arbeit kursiv gesetzt. Autorennamen sind immer in KAPITÄLCHEN zu lesen. Das Sammeln und Auswerten der Daten hat sich rückblickend als schwieriger herausgestellt, als ursprünglich angenommen. Wie so oft, steckte auch hier die Tücke im Detail. Mal waren es unterschiedliche Videoformate oder Codecs, mal Probleme im Betriebssystem oder der Hardware des Auswertungsrechners, mal die Tücken der (leicht betagten) Auswertungssoftware und manchmal schlichte Bedienungsfehler, die beim Auswerten der Videos zu der einen oder anderen Spät- und Wochenendschicht geführt haben. Immer wieder wurde deutlich, dass die Videoanalyse gestützt durch Computer und die Umsetzung in 3D-Modelle noch eine relativ junge Technik ist. An vielen Stellen musste leider das System Try and Error angewandt werden, was mitunter viel Zeit gekostet hat. Besonderer Dank gilt allen, die im Verlauf der Untersuchung Unterstützung angeboten und geleistet haben. Die Firma Molitor hat neben ihren Räumlichkeiten und ihrem Equipment viel Fachwissen und viele gute Hinweise beigesteuert. Außerdem hat sie die Läufer auch über diese Untersuchung hinaus exzellent beraten und betreut. Ein weiterer Dank gilt Prof. Dr. Karin Grube, Dr. Christian Simon und nicht zuletzt Katrin Kröger, die alle bei vielen technischen Fragen wertvolle Tipps aus der eigenen Erfahrung beisteuern konnten. Seite 5
6 2 Thema Ausdauerlauf Seite 6
7 2 Thema Ausdauerlauf 2 Thema Ausdauerlauf Welchen Effekt hat Training auf unseren Laufstil? Ändert sich Laufstil auch, ohne dass wir ihn bewusst trainieren? Welche stilistischen Veränderungen vollziehen sich im Verlauf eines Lauftrainings? In welchen Zeiträumen vollziehen sich stilistische Veränderungen beim Laufen? Das alles sind Fragen, die sowohl den aktiven, interessierten Läufer, wie auch Trainer und nicht zuletzt Sportwissenschaftler interessieren werden. 2.1 Eingrenzung des Themas Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, ob, und wenn ja, wie sich Technik im Verlauf des (Ausdauer-) Lauftrainings verändert, sich also Laufstil bzw. Lauftechnik durch bloßes Laufen wandelt. Ferner ist untersucht worden, welche Parameter des Laufens sich in welcher Weise während eines etwa dreimonatigen Trainings verändern. Dieser Fragestellung liegt eine Beobachtung des Autors zugrunde (an sich selbst und an diversen Trainingpartnern), dass viele Laufanfänger nach wenigen Wochen des Trainings im Ausdauerlauf massive orthopädische Probleme bekommen: Die Hüfte, die Füße und besonders auch die Knie die Problemzone des Sportlers schmerzen. Eine weitere Beobachtung des Autors geht dahin, dass diese Beschwerden nach einigen Wochen des Läufer(innen) mit: Anteil Dauer in Wochen Standardabweichung Trainingspause ( 2 Wochen) wegen Laufverletzung 19,4 4,9 ±4,5 Wegen Beschwerden reduziertem Training 29% 5,1 ±6,5 Vollem Training nur unter Beschwerden 29,1% 7,3 ±8,9 Tabelle 1: Häufigkeit und Dauer von Laufbedingten Überlastungsbeschwerden vor dem GP von Bern. (entnommen aus MARTI 1987, S. 240) fortgesetzten Trainings bei einem guten Teil der Läufer wieder abnehmen oder verschwinden. MARTI hat Teilnehmer der GP von Bern nach (orthopädischen) Problemen im Verlauf ihrer Vorbereitung befragt. Nach dieser Befragung musste jeder fünfte Läufer dieses Langstreckenlaufes sein Training innerhalb von zwölf Monaten vor dem Wettkampf mindestens einmal wegen laufbedingter Be- Seite 7
8 2 Thema Ausdauerlauf schwerden unterbrechen. 1 Alle Befragten sind dennoch zum Wettkampf angetreten (sonst wären sie ja nicht während des Wettkampfes befragt worden), konnten also offenbar ihr Training fortsetzen und haben vermutlich einen Beschwerderückgang erfahren. Dies legt die Vermutung nahe, dass sich neben der Physiologie des Laufapparates einer besseren Stütz- und Haltemuskulatur, besser trainierten Bändern und Sehnen, etc. auch die Technik des Laufens verändert Literaturbasis Monographien und Aufsätze, die sich mit dem Thema Ausdauerlauf beschäftigen, finden sich im Buchhandel und in unseren Bibliotheken ausgesprochen zahlreich. Die Anzahl derer, die sich mit dem Aspekt Technik auseinandersetzen, ist dann schon weitaus geringer. Die meisten dieser Bücher beschränken sich jedoch darauf, zu erwähnen, dass es gute und schlechte Lauftechniken, sowie verschiedene Lauftypen, wie etwa Vor-, Mittel- und Rückfußläufer, gibt. Einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis von Lauftechnik und ihrer Veränderung, hat SIMON mit seiner Dissertation Zur Effizienz und Ökonomie des Mittel-/ Langstreckenlaufs [...] 3 geleistet. Die Ergebnisse aus SIMONS Veröffentlichung bilden eine wesentliche Grundlage dieser Arbeit. Die zu messenden Parameter sind hieraus abgeleitet, ebenso die Normalwerte für die einzelnen Parameter. SIMON hat sich in seiner Studie über das Laufen, als einer der Ersten der 3D- Bewegungsanalyse 4 zur Erhebung von Winkelmerkmalen bedient 5 und damit zum einen den Einfluss der Kameraperspektive auf das Ergebnis der Auswertung deutlich verringert 6 und zum anderen die Möglichkeit genutzt, reale 1 Vgl. Tabelle 1 2 Vgl. hierzu auch MARTI 1987, S SIMON Vgl. Kapitel Erstellen eines 3D-Modells 5 Vgl. SIMON 1998, S Vgl. VOLKAMER 1978, S Seite 8
9 2 Thema Ausdauerlauf Winkel einer Bewegung zu messen und nicht deren Projektion auf eine bestimmte Ebene. Werden Winkel nur anhand eines Kamerabildes gemessen und nicht an einem daraus modellierten 3D-Modell, so kann nur die Projektion des Winkels auf die Film- bzw. Bildebene der Kamera betrachtet werden. Es wird nur unter idealen Aufnahmebedingungen (Filmebene der Kamera und Bewegungsebene des Winkels sind parallel über die Aufnahmedauer) und in wenigen Fällen so sein, dass ein reales Winkelmerkmal einer Bewegung und seine Projektion auf eine bestimmte Bildebene überein-stimmen. In allen andern Fällen wird mit der 3D-Bewegungsanalyse eine wesentliche Fehlerquelle ausgeschaltet. Ein weiteres Defizit bisheriger Forschung zur Lauftechnik, war das Fehlen zeitkontinuierlicher Analyseverfahren 7. Die zeitkontinuierliche Analyse von Bewegungsmerkmalen lässt es zu, Bewegungen nun wesentlich differenzierter zu betrachten. Ein gleicher z.b. Kniegelenkwinkel, im Moment der Landung und im Moment des Abdrucks, in Bewegungen unterschiedlicher Läufer, kann dennoch einen völlig unterschiedlichen Verlauf haben und somit relevante Unterschiede für die Beurteilung der Bewegung aufweisen. Das heißt konkret: Obwohl Bewegungen in der Zeitdiskreten Analyse gleich erscheinen, können relevante Unterschiede vorhanden sein. 8 MARTIN/COE 9 beschreiben in ihrem Aufsatz die Auswirkungen eingeschränkter bzw. erweiterter Beweglichkeit in verschiedenen Gelenken auf den Laufstil. Hiernach führt eine subnormale Beweglichkeit in aller Regel zu einer kompensatorischen Haltungsveränderung, was in der Folge einen weniger effektiven Bewegungsablauf hervorruft. Gute bis überdurch-schnittliche Beweglichkeit führt zu Optimierung des Laufstils Vgl. SIMON 1998 S Vgl. hierzu auch Abbildung 10 und 11, wo zu Beginn und Ende der Bewegung durchaus ähnliche Werte auftreten, der Verlauf dazwischen aber ein gänzlich unterschiedlicher ist. 9 MARTIN/COE Vgl. MARTIN/COE 1992, S. 17f. Seite 9
10 2 Thema Ausdauerlauf WINKELMANN 11 liefert die Definitionen der in der vorliegenden Arbeit verwandten biomechanischen Beschreibungsgrößen und beschreibt lauftypische Beschwerdebilder (Shin-Splint-Syndrom, Runner s Knee, etc.). Ferner gibt er qualitative und teilweise quantitative Hinweise darauf, wie ein effizienter Laufstil aussieht. Bei STEFFENS/GRUENING 12 finden sich, neben sehr praktisch orientierten Hinweisen auf effizienten bzw. gesunden Laufstil, einige Möglichkeiten, diesen zu trainieren. Eine Studie, die der Frage nach Unterschieden in der Entwicklung von Laufstil mit und ohne Intervention nachgeht (Selbstorganisation vs. gezielte Steuerung durch Training), könnte die Anregungen von STEFFENS/GRUENING aufgreifen und damit die Idee der vorliegenden Arbeit ergänzen und erweitern. Zusammenfassend kann also SIMON als grundlegend für diese Arbeit betrachtet werden. Er wird von diversen anderen Autoren, teils wissenschaftlich, teils eher populär bzw. eher an der täglichen Trainingsarbeit orientiert, ergänzt. Die Werke von WESSINGHAGE 13 und STEFFENS/GRUENING bieten dem Leser die Chance, sich dem Thema Laufen und Lauftechnik von Grund auf zu nähern. Spezifisches Fachwissen wird hier nicht vorausgesetzt, lediglich Interesse. 11 WINKELMANN STEFFENS/GRUENING WESSINGHAGE 1996 Seite 10
11 3 Theorie des Ausdauerlaufs 3 Theorie des Ausdauerlaufs Im folgenden Kapitel wird die theoretische Basis der in Kapitel vier beschriebenen Untersuchung dargestellt. Zunächst wird die Physiologie der unteren Extremitäten dargestellt und die Physiologie des Laufens beschrieben. In zwei weiteren Punkten werden die biomechanischen Begrifflichkeiten erläutert und Laufen in diesen Begrifflichkeiten dargestellt. Außerdem werden hier Normalwerte einzelner Autoren genannt und damit Richtgrößen für die Beurteilung dieser Untersuchung geliefert. Mit der Pathologie des Laufens, dem Letzten Teilabschnitt werden typische Beschwerdebilder von Läufern vorgestellt und es wird kurz auf mögliche Ursachen eingegangen. 3.1 Anatomie und Physiologie der unteren Extremitäten Abbildung 1: Ebenen des menschlichen Körpers. (v. Autor geänd. n. Vorlage von ~jadiff/hubibo1.gif (Stand: 13. Dezember 2003)) In diesem Teilabschnitt wird ein kurzer Abriss zu Anatomie und Physiologie der unteren Extremitäten gegeben, soweit dies für die weiteren Ausführungen relevant ist. Der menschliche Körper lässt sich (zur besseren Orientierung), wie in Abbildung 1 zu sehen ist, in drei Ebenen einteilen: die Frontalebene, die Sagitalebene und die Transversalebene. Des Weiteren erhalten die Richtungen im und am Körper eigene Begriffe zur besseren Orientierung, sie sind auch in Abbildung 2 näher dargestellt. Zur Körpermitte hin gerichtet heißt medial, von der Mitte zur Körperseite hin wird lateral genannt. Superior bedeutet weiter oben, was auch mit kranial zum Kopf hin bezeichnet wird. Das Gegenstück dazu ist inferior, Seite 11
12 3 Theorie des Ausdauerlaufs weiter unten oder kaudal zum Schwanz hin. Die letzten möglichen Richtungen liegen auf der Transversalebene. Sie heißen die anterior weiter vorn oder ventral zum Bauch hin bzw. posterior weiter hinten oder dorsal zum Rücken hin. Das Hüftgelenk verbindet, als oberste Struktur der unteren Extremität, Rumpf und Oberschenkel. Es bietet dem Oberschenkel zwei Bewegungsmöglichkeiten. Es kann gebeugt und gestreckt, sowie nach lateral und medial rotiert werden (Abduktion und Adduktion). Das nächste Gelenk kaudal ist das Kniegelenk, Ober- und Unterschenkel sind hier verbunden. Es kann sich beugen und strecken (Extension und Flexion) und ermöglicht die Rotation des Fußes nach lateral und medial (Inversion und Eversion). Weiter nach kaudal folgen das obere und untere Sprunggelenk, die jedoch funktional als Einheit betrachtet werden können. Hier gibt es die Bewegungsmöglichkeiten Extension Abbildung 2: Lagebezeichnungen in der Anatomie. (v. und Flexion, sowie Abduktion und Adduktion Aut. geänd. n. Vorlage von (das Kippen des Fußes nach lateral oder medial). Dezember 2003) ~jadiff/hubibo1.gif (Stand: 13. Aus der gleichzeitigen Kombination von Inversion (Fußdrehung aus dem Kniegelenk), Adduktion und Flexion (beide im Sprunggelenk) resultiert die Suppinationsbewegung, aus den entgegengesetzten Bewegungen (Eversion, Abduktion und Extension) resultiert die Pronationsbewegung 14. Der Fuß selber beginnt, von dorsal gesehen, mit dem Fersenbein, das an das untere Sprunggelenk anschließt. Die Mittelfußknochen spannen ein Quer- und ein Längsgewölbe auf, die wesentlich zur Federung des Ganges 14 Vgl. KRABBE 1994, S. 15 Seite 12
13 3 Theorie des Ausdauerlaufs beitragen. Es folgen der Fußballen und die Zehen, von medial nach lateral mit eins bis fünf durchnummeriert. Analog zur Bezeichnung der Zehen wird der Fuß längs in fünf Strahlen gegliedert. Die gedachte Verbindungslinie von einem Zeh zur Ferse hin, wird Strahl genannt. Ein Strahl umfasst also sowohl den eigentlichen Zeh, als auch die funktionell dazu gehörenden Zehknochen Ossa Metatarsalia I V. 3.2 Physiologie des Laufens Laufen ist eine Ganzkörperbewegung. Darin liegt sein Reiz und der hohe gesundheitliche Nutzen, der durch regelmäßiges Laufen erreicht werden kann. Wenn jemand läuft, so laufen nicht nur seine Beine, auch wenn diese einen wesentlichen Teil der Bewegung durchführen, sondern der ganze Körper läuft mit. Der Oberkörper ist aufgerichtet, der Blick geht nach vorn, Schultern und Arme sind locker und unverkrampft. Die Arme pendeln neben dem Körper parallel zur Laufrichtung vor und zurück, Arme und Beine bewegen sich rund und harmonisch. Die Armbewegung hat, zumindest beim Langstreckenlauf, keinen Anteil am Vortrieb, ein aktives Ziehen der Arme, wie man es etwa bei den Sprintern sieht, ist also nicht nötig bzw. nicht effektiv. Die Füße setzen parallel zur Laufrichtung auf, möglichst nahe einer gedachten Projektionslinie des Körperschwerpunktes 15 auf die Fußboden-ebene, treten jedoch nicht darüber. 16 Ein wesentliches Merkmal des Laufstils ist der Aufsetzpunkt des Fußes. Dieser variiert zwischen verschiedenen Läufern von der Ferse bis zum Ballen. Laut SIMON lässt sich keine Korrelation zwischen dem Aufsetzpunkt des Fußes und der Effizienz des Laufens finden. 17 Mit Blick auf die Frage der ener- 15 Erläuterungen zum Körperschwerpunkt (im Folgenden auch KSP genannt) siehe unter Körperschwerpunkt. 16 Vgl. STEFFENS/GRUENING 1999, S. 42ff 17 Vgl. SIMON 1998, S. 14 Seite 13
14 3 Theorie des Ausdauerlaufs getischen Ökonomie des Laufens lässt sich also nicht sagen, welche Lauftechnik besser ist. Die Frage, ob jemand Vor- oder Rückfuß läuft, scheint wesentlich von der Laufgeschwindigkeit abzuhängen: Je höher die Laufgeschwindigkeit, desto stärker wird auf dem Vorfuß gelaufen. Ein ähnliches Phänomen ist beim Übergang vom Gehen zum Laufen zu beobachten. Auch dieser Übergang geschieht mehr oder minder unwillkürlich beim Überschreiten einer bestimmten Geschwindigkeit. 18 Vergleichbar scheint es beim Laufen zu sein: Der Läufer landet mehr Richtung Abbildung 3: Vergleich, Bodenreaktionskraft bei Rückfuß (oben) Mittel- bzw. Vorfuß, je schneller er läuft 19. und bei Vorfußläufern (unten). Heute sind etwa 95% aller Langstreckenläufer Fersenläufer. Dies könnte ein Indiz (entnommen aus WESSINGHAGE 1996, S. 17) für die Ursache vieler Laufbe-schwerden sein, denn die natürlichen Dämpfungselemente des Körpers werden nur beim Vorfußlauf optimal eingesetzt. 20 Die Dämpfung des Laufschrittes erfolgt beim Fersenlauf erst in der Stützphase durch das Einknicken des Fußes nach innen (Pronation) und das Nachgeben des Fußgewölbes. Während der Landung auf der Ferse, also im Moment, in dem der Fuß das erste Mal belastet wird, werden, aufgrund nicht vorhandener, dämpfender Systeme im hinteren Fuß, alle Stoßkräfte direkt an höhere Strukturen (Knie, Hüfte, Wirbelsäule) weitergeleitet. Dies wird über diverse Dämpfungselemente im Laufschuh auszugleichen versucht. 18 Allerdings vollzieht sich der Übergang vom Gehen zum Laufen sehr wohl nach energieökonomischen Gesichtspunkten, er erfolgt nämlich genau an der Stelle, wo Laufen ökonomischer als Gehen ist. 19 Vgl. MARQUART 2002, S Vgl. EBD. S. 13 Seite 14
15 3 Theorie des Ausdauerlaufs Beim Vor- und Mittelfußlauf, bei dem die Landung auf dem Fußballen oder dem ganzen Fuß erfolgt, können körpereigene Dämpfelemente das Körpergewicht abfangen. Zunächst wirkt die Wadenmuskulatur federnd, indem sie den Fuß langsam absetzt (sofern sie, entsprechend des Körpergewichtes des Läufers, stark genug ausgebildet ist). Als nächstes federt das Fußgewölbe und zuletzt ergänzt die natürliche Pronation diese beiden. Der Vorfußlauf gilt mittlerweile als der, auch für den Langstreckenlauf, schonendere Laufstil. Es ist allerdings auch der Kraftaufwändigere. 21 Misst man die Bodenreaktionskraft von Vorfuß- und Rückfußläufern (wie in Abbildung 3 geschehen), so lässt sich erkennen, dass sich die auftretenden Kräfte insgesamt nicht hinsichtlich ihrer Maximalwerte unterscheiden. Allerdings sind beim Rückfußlauf zwei Kraftspitzen zu sehen, beim Vorfußlauf nur eine. Das heißt, dass alle beteiligten Strukturen beim Rückfußlauf zweimal belastet werden, beim Vorfuß lauf nur einmal pro Schritt. 22 Oder anders formuliert: Ein Vorfußläufer kann doppelt so viel laufen, wie ein Rückfußläufer, bis die Belastung der unteren Extremitäten das Maß eines Rückfußläufers erreicht hat. Die meisten Menschen laufen, wenn sie barfuss laufen, mehr auf dem Vorfuß, als mit Schuhen. Daraus kann man unter anderem ableiten, dass es sich beim Vorfußlaufen um eine ursprünglichere, natürlichere Form des Laufens handelt. 23 Zumindest im Ansatz erscheint dies einleuchtend und könnte damit eine Möglichkeit sein, viele Laufbeschwerden zu behandeln. RADOVANOVIČ dokumentiert deutliche Verbesserungen vorhandener Kniebeschwerden von Läufern durch gezielte Änderung der Lauftechnik (Laufen auf dem Mittelfuß) Vgl. WINKELMANN 1995, S. 101f / WESSINGHAGE1996, S. 17f / MARQUART 1999, S Vgl. CAVANAGH 1987, S Man könnte auch folgern, dass viele Läufer sich auf gute Dämpfungseigenschaften des Schuhs verlassen 24 Vgl. RADOVANOVIČ 1999, S.107 Seite 15
16 3 Theorie des Ausdauerlaufs 3.3 Laufen in biomechanischen Begriffen und Größen Gliederung in Phasen Laufen lässt sich, wie alle sportlichen Bewegungen, in Phasen gliedern. Ob dies im Sinne einer Bewegungsanalyse sinnvoll ist, oder nicht, soll an dieser Stelle nicht diskutiert werden. Die Gliederung dient hier lediglich der besseren Verständigung. Man unterscheidet beim Laufen Abbildung 4: Gliederung der Schrittlänge. (entnommen aus SIMON 1998, S. 15) die Flug- und die Stützphase, die zwar jeweils gleichzeitig ablaufen, sich aber bei separater Betrachtung der Beine, zyklisch aneinander anschließen. Die Bewegungen der Beine sind zueinander gegenläufig, sie werden nach Schwungbei- und Stützbeinbewegung unterschieden. In Abbildung 4 ist die Flugphase als Flugweite benannt, dennoch ist das gleiche gemeint, Stemm- und Abdruckweite sind in der Abbildung mit der Stützphase identisch. Die Stützbeinbewegung gliedert sich, in chronologischer Folge, in eine vordere und eine hintere Stützphase. Die vordere Stützphase reicht vom ersten Bodenkontakt des Beines bis zum sogenannten Mittelstütz, dem Moment, in dem der KSP senkrecht über dem Stützpunkt liegt. Die hintere Stützphase reicht dementsprechend vom Mittelstütz bis zum lösen des Fußes vom Boden. In Abbildung vier ist rechts der vordere und links der hintere Stütz zu sehen. Es schließt sich die Schwungphase an, die ebenfalls in eine hintere und eine vordere unterteilt ist. Die hintere Schwungphase dauert vom verlassen des Bodens bis zum Mittelstütz des Stützbeines, die vordere Schwungphase vom Mittelstütz des Stützbeines bis zum ersten Bodenkon- Seite 16
17 3 Theorie des Ausdauerlaufs takt des Schwungbeines. 25 Die Schwungphase ist in Abbildung vier in der Mitte zu sehen Schrittlänge Analog zur Phasengliederung lässt sich die Schrittlänge in Abdruckweite, Flugweite und Stemmweite unterteilen. 26 Die Abdruckweite ist die in der Transversalebene gemessene Distanz vom Abdruckpunkt zum KSP. Die Flugweite ist die vom KSP in der Transversalebene zurückgelegte Entfernung zwischen Abdruckpunkt und Landepunkt. Die Stemmweite ist die transversale Distanz zwischen KSP und Landepunkt im Moment der Landung. Addiert man Abdruckweite, Flugweite und Stemmweite, so erhält man als Ergebnis die Schrittlänge Körperschwerpunkt Zur Berechnung des KSP werden mehr oder weniger detaillierte Segmentmodelle herangezogen. Diese gliedern den Körper in einfach zu berechnende geometrische Formen (Kugeln, Zylinder und Kegel bzw. Kegelstümpfe). Deren Größe und Masse wird anhand bestimmter Körpermaße des Probanden (z.b.: Oberschenkelumfang, Schulterhöhe, Beinlänge, etc.) festgelegt. Mit einem solchen Modell wird dann der theoretische Mittelpunkt dieser einzelnen Massen errechnet. Diesen Mittelpunkt bezeichnet man als Körperschwerpunkt. Er liegt bei den meisten Menschen etwa in der Körpermitte hinter dem Bauchnabel. Bei der vorliegenden Untersuchung wird vereinfachend davon ausgegangen, dass der Abstand vom KSP zur Hüftlinie, also der Verbindung der funktionalen Mittelpunkte beider Hüftgelenke, fix ist. Im Folgenden wird also angenommen, dass die Hüftlinie ein Indikator für Bewegung des KSP ist, insbesondere in vertikaler Richtung. 25 Vgl. SIMON 1998, S.13 / Winkelmann 1995, S Vgl. Abbildung 4. Seite 17
18 3 Theorie des Ausdauerlaufs Körperwinkel und Raumlagewinkel Für die hier beschriebenen Körperwinkel, also die Winkel zwischen den Achsen einzelner Körpersegmente (z.b. zwischen Ober- und Unterschenkel), werden nun die funktionellen Mittelpunkte der betreffenden Gelenke von kranial nach kaudal näher definiert. Am Schultergelenk ist von lateral die Prominenz des Acronion der funktionelle Mittelpunkt, von dorsal muss geschätzt werden. Dieses Schätzen geschieht am besten indem die tatsächlichen Bewegungen des betreffenden Armes vollzogen werden und deren funktioneller Mittelpunkt anhand dessen ermittelt wird. Die Mittelpunkte der Hüftgelenke lie-gen, von dorsal betrachtet, 54 Milli-meter medial des Abbildung 5: Körper- und Raumlagewinkel. (entnommen aus WINKELMANN 1995, S. 105) jeweiligen Trochanter Major. Von lateral betrachtet ist der jeweilige Trochanter Major der funktionelle Mittelpunkt. Betrachtet man das Kniegelenk frontal, liegt der funktionelle Mittelpunkt 26 Millimeter proximal des Kniegelenkspaltes, bei medialer und lateraler Betrachtung ist die Prominenz des Epicondylus lateralis femoris identisch mit dem funktionellen Mittelpunkt des Gelenks. 27 Die Beschreibung des Mittelpunktes des Sprunggelenkes gestaltet sich etwas komplexer. Hierfür wird zunächst eine Achse von medial nach lateral beschrieben: Von lateral beginnt diese ca. drei Millimeter distal und acht Millimeter anterior des lateralen Malleolus, von medial betrachtet beginnt sie fünf Millimeter distal der distalen Spitze des medialen Malleolus. Von frontal bzw. dorsal betrachtet ist die Halbierung dieser Achse der funktionelle Mittelpunkt. 28 Um auch den Winkel zwischen Fuß und Unterschenkel betrachten 27 Vgl. KRABBE 1994, S Vgl. KRABBE 1994, S.51 Seite 18
19 3 Theorie des Ausdauerlaufs zu können, bedurfte es eines weiteren Punktes an der Fußspitze. Hierfür wurde das jeweilige Großzehköpfchen (Os digitori Pedes I.) als Punkt angenommen. Bei der biomechanischen Betrachtung von (Lauf-) Bewegung unterscheidet man solche Winkel, die zwischen den funktionellen Achsen zweier Körpersegmente gemessen werden, die Körperwinkel und solche, die die Lage eines Körpersegmentes im Raum ange- Abbildung 6: Körper- und Raumlagewinkel. (entnommen aus WINKELMANN 1995, ben, die Raumlagewinkel. S. 105) Die wichtigsten Winkel zur Beschreibung von Laufbewegung sind die der unteren Extremität. Der Fußgelenkwinkel wird über die drei Punkte Fußspitze, Sprunggelenk und Kniegelenk definiert. Das Sprunggelenk, das Kniegelenk und das Hüftgelenk definieren den Kniewinkel. Mit Knie, Hüfte und Schulter sind drei Punkte für den Hüftwinkel gegeben. 29 Der Oberarm-Rumpf-Winkel 30 ist mit beiden Schultergelenken und dem jeweiligen Ellenbogen beschrieben. Der Rumpflagewinkel 31 und Kopflagewinkel 32 sind definiert als die Abweichung der Linie Hüfte-Schulter (für die Rumpflage) bzw. Kopf-Schulter (für die Kopflage) von der Senkrechten im Raum. Die Achse für den Kopflagewinkel wird dabei zum Mittelpunkt zwischen den beiden Schulter-gelenken gezogen. Die Achse für den Rumpflagewinkel, vom Mittelpunkt zwischen den Schultergelenken zum Mittelpunkt zwischen den Hüftgelenken. Zu beschreiben bleiben noch die Winkel zwischen verschiedenen Körperebenen, der Hüft-Schulter-Verwringungswinkel 33, der Oberschenkel-Rumpf- 29 Anschaulich in Abbildung 5 dargestellt. 30 Abbildung Abbildung Abbildung Anschaulich in Abbildung 7. Seite 19
20 3 Theorie des Ausdauerlaufs Verwringungswinkel 33 und der Oberschenkel-Unterschenkel- Verwringungswinkel 34. Hierfür muss man sich verdeutlichen, dass jeweils drei Punkte eine Ebene aufspannen und zwischen zwei Ebenen wiederum Winkel gemessen werden können. Für die Beschreibung der Verwringung zwischen Schulter und Hüfte wird eine E- bene durch beide Schultergelenke und ein Hüftgelenk definiert. Eine zweite Ebene wird durch beide Hüftgelenke und ein Schultergelenk definiert. Das Schultergelenk liegt dann hier auf der gleichen Seite, wie das Hüftgelenk der ersten Ebene (z.b.: Erste Ebene aus beiden Schultergelenken und dem rechten Hüftgelenk und Abbildung 7:Winkel zwischen zweite Ebene aus beiden Hüftgelenken Körperebenen. (entnommen aus WINKELMANN 1995, S. 105) und dem rechten Schulter-gelenk.) Der Winkel zwischen diesen beiden Ebenen wird Hüft-Schulter-Verwringung genannt. Zur Beschreibung des Oberschenkel-Rumpf- Verwringungswinkels spannen (wie oben) beide Hüftpunkte und ein Schulterpunkt die Rumpfebene auf, die Oberschenkelebene ist durch die Punkte Hüfte, Knie, Sprunggelenk (der entsprechenden Seite) gegeben. Abbildung 8: Der Achillessehnenwinkel (hier β). (entnommen aus WINKELMANN Mit der Oberschenkelebene und der, Unterschenkelebene, ist der Ober-Unterschenkel- 1995, S. 103) Verwringungswinkel definiert. Knie, Knöchel und Fußspitze spannen hier die Unterschenkelebene auf. 34 Anschaulich in Abbildung 6. Seite 20
21 3 Theorie des Ausdauerlaufs Ein letzter wichtiger Winkel ist der Achillessehnen- oder Pronationswinkel 35 : Er wird medial zwischen den Achsen Knie-Sprunggelenk und Sprunggelenk- Ferse gemessen und gibt Grad der Pronation an. 3.4 Gutes Laufen, biomechanisch beschrieben Im Folgenden werden die Normalwerte der oben genannten biomechanischen Parameter des Laufens dargestellt. Dies stützt sich wesentlich auf SIMON und seine Literaturrecherche, dennoch sollte bei der gesamten folgenden Darstellung weiterhin bedacht werden, dass es Den einen für alle Läufer gültigen Laufstil [...] 36 nicht gibt. Woher aber dann einen Anhaltspunkt für die Beurteilung von Lauftechnik nehmen, wenn ein guter Stil nicht benannt werden kann? SIMON ist hier zwei Wege gegangen. Zum einen hat er bei seiner Versuchsgruppe die verrichtete physikalische Arbeit errechnet und gefolgert: Weniger zu verrichtende Arbeit bei gleicher Laufleistung ist besser, ökonomischer. Zum andern hat er festgestellt, dass die Varianz innerhalb seiner untersuchten Gruppe der Spezialisten (erfahrene Spitzenläufer) geringer war, als bei seiner Vergleichsgruppe (Sportstudenten). Dies Ergebnis legt nahe, dass die Gruppe der Spezialisten sich näher an einem stilistischen und ökonomischen Optimum bewegt, als die Sportstudenten. Als eine Erkenntnis aus seinen Untersuchungen hat SIMON formuliert, dass weniger intersegmentelle Arbeit besser ist. Das heißt, je weniger Arbeit durch die Gegenbewegungen anderer Körpersegmente kompensiert wird, desto effizienter wird die insgesamt eingesetzte Arbeit für den Vortrieb genutzt. 37 Ein erster Punkt, an dem dies deutlich wird, ist die ruhigere Haltung des O- berkörpers bei den Spezialisten, also eine möglichst geringe Veränderung des Rumpflagewinkels. 35 Anschaulich in Abbildung Vgl. DAHMS 2001, S Vgl. SIMON 1998, S.130 Seite 21
22 3 Theorie des Ausdauerlaufs Eine größere Kniebeugung des Stützbeines (kleinerer Kniewinkel) und eine größere Flexion des Sprunggelenkes des Schwungbeines (kleinerer Fußgelenkwinkel) stellt sich ebenfalls als positiv heraus. 38 Wird diese größere Flexion im Fußgelenk während der Schwungphase mit einer aktiven Plantarflexion kurz vor der Landung kombiniert, dann resultiert, dass durch den greifenden Fußaufsatz horizontale Bremskräfte im Moment der Landung reduziert werden. 39 Während der Stützphase führt eine höhere Flexion bzw. Flexibilität des Sprunggelenks dazu, dass die Ferse des Stützbeines längeren Bodenkontakt hält, die Wadenmuskulatur stärker vorgespannt ist und im Ergebnis das Kraftpotential der Wadenmuskulatur für die Abstoßkraft größer wird. 40 Der KSP beschreib während des Laufens, in der Sagitalebene betrachtet, eine oszillierende Kurve. Hierfür sieht SIMON zwei Einflussgrößen: Die Laufgeschwindigkeit, je größer sie ist, desto weniger oszilliert der KSP 41 und die Technik des Fußaufsatzes, ziehendes Laufen ergibt weniger Oszillation als stoßendes Laufen 42. Ein passender Vergleich ist hier der von Katzen (ziehendes Laufen) und Kängurus (eher Hüpfen). Bei Katzen oszilliert der KSP beinahe gar nicht, bei Kängurus maximal. Ein starker und betonter Kniehub, ähnlich dem von Sprintern, führt im Langstreckenlauf zu einer stärkeren vertikalen Oszillation des KSP und ist damit Energieverschwendung Vgl. SIMON 1998, S Vgl. SIMON 1998, S.137f. Anschaulich wird dies in Abbildung drei, wo der Berg kleiner würde. 40 Vgl. MARTIN/COE 1992, S hier nennt er drei weitere Autoren, die dies mit Zahlen untermauert haben: LUHTANEN/KOMI 1978 nennen als Durchschnittliche Oszillation des KSP bei 3,9m/s 10,9cm, bei 6,4m/s 8,6cm und bei 8m/s 7cm. BUCKALEW 1985 nennt für 4m/s 6cm. (Alles entnommen SIMON 1998, S.20f) 42 Vgl. SIMON 1998, S.20f / STEFFENS/GRUENING2001, S Vgl. MARTIN/COE 1992, S.17 Seite 22
23 3 Theorie des Ausdauerlaufs Ebenfalls im Zusammenhang mit der vertikalen Oszillation des KSP dürfte der Kniewinkel des Stützbeins sowohl bei der Landung, als auch beim Abdruck stehen. SIMON stellt fest, dass zu beiden Zeitpunkten ein geringerer Kniewinkel positiv ist. 44 Je geringer die Verwringung zwischen Rumpf und Hüfte und zwischen Hüfte und Oberschenkel ausfällt, desto weniger intersegmentelle Arbeit (Ausgleichsbewegungen) wird geleistet und desto ökonomischer wird gelaufen. 45 Mangelnde Beweglichkeit der Hüfte hat zur Folge, dass die Abdruckweite reduziert wird. Um dies zu kompensieren, nehmen einige Läufer eine Oberkörper-Vorlage ein. Diese ist aufgrund der im Oberkörper zu verrichtenden Haltearbeit unökonomisch und belastet die Bandscheiben im Bereich der Lendenwirbel unnötig. 46 Unter gesundheitlichen Aspekten wurde bereits in Kapitel 3.2 Physiologie des Laufens das Rückfußlaufen kritisch betrachtet. Es ist auch im biomechanischen Sinne nicht zweckmäßig. Beim Rückfußlauf erfolgt der Fußaufsatz vor dem KSP, die Ferse wird also wie bei einer Stemmbewegung entgegen (!!) der Laufrichtung aufgesetzt und erzeugt so eine Bremswirkung. 47 Wenn also jemand Rückfuß läuft, so ist dies um so weniger ökonomisch, je stärker er stemmt, je größer also die passive Kraftspitze beim Fußaufsatz ist. 48 SIMON hat anhand der von ihm verwandten Literatur eine Gegenüberstellung der Merkmalsausprägungen von Fußgelenkwinkel und Kniewinkel angefertigt, die im Anhang einzusehen ist. 49 Darüber hinaus hat SIMON, als ein Ergebnis seiner Untersuchung, aufgeführt, in welchen Merkmalen es signifikante Unterschiede zwischen seinen beiden 44 Vgl. SIMON 1998, S Vgl. SIMON 1998, S Vgl. MARTIN/COE 1992, S Vgl. MARQUART 2002, S.28 / MARTIN/COE 1992, S Vgl. Abb. 3 / Vgl. WINKELMANN 1995, S Tabelle 15: Fußgelenkwinkel in der Literatur. (aus Simon 1998, 1.17) und Tabelle 16: Kniegelenkwinkel in der Literatur (nach SIMON 1998, S. 17) Seite 23
24 3 Theorie des Ausdauerlaufs Versuchsgruppen gab und dies in Tabelle 2 und in Tabelle 17 in der Spalte ANOVA 50 klassifiziert. 50 ANOVA ist hier ein Begriff, der von SIMON übernommen wurde. Er steht für ANalysis Of Variance, die sogenannte Varianzanalyse. Seite 24
25 3 Theorie des Ausdauerlaufs Studenten Spezialisten Winkelmerkmal Stand. Abw. Stand. Abw. ANOVA Mittelw. (in ) Mittelw. (in ) (in ) (in ) Fußgelenkwinkel re. ANF 137 6, ,8 ** Fußgelenkwinkel re. MAX 138 6, ,6 ** Fußgelenkwinkel li. MAX 124 6, ,7 * Fußgelenkwinkel li. END 123 7, ,9 * Kniegelenkwinkel re. ANF , ,2 ** Kniegelenkwinkel re. MAX , ,1 ** Kniegelenkwinkel re. MIN 75 13, ,1 * Kniegelenkwinkel re. END , ,3 * Kniegelenkwinkel li. ANF 164 3, ,8 ** Kniegelenkwinkel li. MAX 169 3, ,0 ** Kniegelenkwinkel li. END 165 4, ,4 * Hüftgelenkwinkel li. MIN 150 5, ,9 * Schultergelenkw. Re. ANF 30 4,6 34 4,0 * Schultergelenkw. Re. MIN 30 4,4 34 4,0 * Schultergelenkw. li. ANF 40 7,7 45 6,4 * Schultergelenkw. li. MAX 41 6,0 45 6,4 * Kopfneigungswinkel ANF 172 4, ,0 * Unter-Obersch.-Winkel re. END 14 5,0 18 4,3 ** Unter-Obersch.-Winkel li. ANF ,2 * OS-Rumpf-Verwring. re. MIN 80 5,4 83 3,9 * OS-Rumpf-Verwring. li. ANF 75 15, ,4 ** OS-Rumpf-Verwring. li. MAX 88 8, ,0 ** OS-Rumpf-Verwring. li. MIN 71 14,6 77 8,1 ** OS-Rumpf-Verwring. li. END 83 14, ,0 ** Rumpflagewinkel ANF 9 3,3 6 2,9 ** Rumpflagewinkel MAX 11 3,5 9 3,3 ** Rumpflagewinkel MIN 7 2,8 6 3,1 * Rumpflagewinkel END 9 3,6 7 6,4 ** re. li. ANF MAX Stützphase MIN END ** * = rechts = links = am Anfang d. Stützphase = Maximum während der = Minimum während der Stützphase = am Ende der Stützphase p<0,01 (Signifikanzniveau) p<0,05 (Signifikanzniveau) Tabelle 2: Mittelwerte und Gruppenunterschiede der Winkelmerkmale - linke Stützphase (nach Simon 1998, S. 136) Die Merkmale, die sich nicht signifikant unterscheiden (p 0,05), sind nicht aufgeführt. 51 Der Vergleich beider Tabellen (Tabelle 2 und Tabelle 17) ergibt, dass sich Trainingsfortschritt bzw. Trainingsentwicklung im Ausdauerlauf mit folgenden Parametern auf biomechanischer Ebene dokumentieren lässt: Fußgelenkwinkel des Schwungbeines, Fußgelenkwinkel des Stützbeines, Kniegelenkwinkel von Schwung- und Stützbein, Hüftbeweglichkeit im Stützbein, Oberschenkel-Rumpf-Verwringung und Rumpflage. Diese Merkmale wiesen in der 51 Die entsprechende Tabelle für die rechte Stützphase (Tabelle 17) befindet sich im Anhang. Seite 25
26 3 Theorie des Ausdauerlaufs Abbildung 10: Vergleich der Ober-Unterschenlewinkel von Sportstudenten (links) und Spezialisten (rechts). (entnommen aus SIMON 1998, S. 134) Untersuchung von SIMON signifikante Unterschiede zwischen den beiden Versuchsgruppen auf. Die Unterschiede der verschiedenen Versuchsgruppen bei SIMON lassen sich auf biomechanischer Ebene, im Sinne der oben geforderten zeitkontinuierlichen Analyse, auch grafisch, in Form von Verlaufsdiagrammen 52 einzelner Winkel, veranschaulichen. Hierzu wurden in Abbildung 9, 10 und 11 die Verläufe einzelner Körperwinkel von Studenten und Spezialisten gegenüber gestellt. Abbildung 9: Vergleich d. Rumpflagewinkels von Sportstudenten (links) und Spezialisten (rechts). (entnommen aus SIMON 1998, S. 134) Deutlich ist anhand dieser Winkelverläufe 53 zu erkennen, dass ganz wesentliche Unterschiede in der Technik vorhanden sind. Auch der Schritt, festzustellen, dass der jeweils rechte Winkelverlauf eines Spezialisten energetisch 52 SIMON hat hier den Winkel in des jeweiligen Merkmals gegen die Zeit für einen Bewegungszyklus aufgetragen. Hier müsste eigentlich (es handelt sich um eine zyklische Bewegung) das Ende des Graphen das gleiche Niveau wie der Anfang haben. Ist die nicht der Fall, liegt das entweder am verwendeten Lowpass-Filter, der Anfang und Ende einer solchen Kurve ein wenig verzerren kann, oder daran, dass der Ausschnitt nicht exakt die Länge eines Zyklus hat. 53 Vgl. Abbildung neun, zehn und elf. Seite 26
27 3 Theorie des Ausdauerlaufs günstiger ist, kann anhand der glatter verlaufenden Kurve gut nachvollzogen werden. Auch beim zweiten Vergleich, in Abbildung zehn, wird durch bloße Anschauung klar, dass die beim Sportstudenten häufig Spitzen und Täler in der Verlaufskurve vorhandenen sind. Beim Spezialisten ist eine energetisch günstigere, glatter verlaufenden Kurve beim Spezialisten zu sehen. Abbildung 11: Vergleich d. Hüft-Schulter-Verwringungswinkels von Sportstudenten (links) und Spezialisten (rechts). (entnommen aus SIMON 1998, S. 134) Selbst beim Vergleich des Hüft-Schulter-Verwringungswinkels, für den bei SIMON anhand der zeitdiskreten Analyse in Tabelle 2 und Tabelle 17 keine signifikanten Unterschiede zwischen den Versuchsgruppen nachgewiesen werden konnten, ist hier in der zeitkontinuierlichen Analyse sichtbar, dass wesentliche Unterschiede bestehen können. Die Abbildungen neun bis elf stellen individuelle Winkelverläufe dar. Um die Aussagen generalisieren zu können, müssten diese jedoch über die jeweiligen Versuchsgruppen gemittelt und dann erneut verglichen werden. Dennoch kann der hier gemachte Vergleich einen Anhalt geben. 3.5 Pathologie des Laufens Neben den im vorausgehenden Teil erläuterten biomechanischen Parametern des Laufens, mit denen jede physiologische und pathologische Veränderung des Laufstils beschrieben werden kann, haben sich einige Termini etabliert, um häufige Lauffehler zu benennen. Im Folgenden werden diese genannt und charakterisiert. Seite 27
28 3 Theorie des Ausdauerlaufs Beim sogenannten Toeing-Out 54 ist deutlich eine verstärkte Abduktion des Fußes während des Bodenkontaktes zu sehen. Die logische Folge daraus ist, dass das Abrollverhalten des Fußes sich ändert. Die Trittspur, also der auf die Fußsohle projezierte Verlauf der Druckbelastung, liegt beim Toeing- Out im Vorderfuß nach medial verschoben. Der normale Verlauf der Trittspur läge zwischen dem ersten und zweiten Strahl, beim Abbildung 12: Lauffehler "Toeing-Out". (entnommen aus SCHULTZ 1988, S. 44) Toeing-Out liegt sie häufig medial des ersten Strahles. Die Folge dieser Verschiebung ist eine ungünstige Belastungsänderung, die sich häufig in einer Überpronation äußert. 55 Ein weiterer verbreiteter Fehler ist das sogenannte Crossing-Over 56. Hierbei setzt der Läufer den rechten Fuß links der Körpermittelline auf und umgekehrt. Die Trittspur verlagert sich beim Crossing-Over von der Ideallinie zwischen erstem und zweitem Strahl nach lateral. Hierdurch verschieben sich die Hebelverhältnisse ungünstig, das Knie etwa wird nicht mehr in Richtung der Beinachse belastet, was entgegen seiner funktionellen Bestimmung ist. Die Winkelverhältnisse der Belastung im Abbildung 13: Lauffehler "Crossing over". (entnommen Hüftgelenk verändern sich ebenfalls; stark vereinfacht läßt sich sagen, dass der Winkel aus SCHULTZ 1998, S. 44) 54 Anschaulich in Abbildung zwölf dargestellt. 55 Vgl. WINKELMANN 1995, S Anschaulich in Abbildung 13 dargestellt. Seite 28
29 3 Theorie des Ausdauerlaufs zwischen Oberschenkel und Hüftachse spitzer wird. In Folge dessen verringert sich die Auflagefläche zwischen Hüftkopf und Hüftpfanne. Damit steigt die Belastung der verbleibenden Fläche. 57 Nicht zuletzt wird beim Crossing-Over, wie auch bei zu breitem Aufsetzen der Füße, eine laterale Pendelbewegung des gesamten Körpers ausgelöst, die energetisch ungünstig ist und, an der Wirbelsäule, unnötige Belastungen hervorruft. 58 Ein weiterer Lauffehler, der ausschließlich beim Rückfuß- bzw. Fersenläufer relevant ist, ist der Versuch, zu große Schritte zu machen. Dies führt beim Rückfußlauf zu einer heftigen Stemmbewegung 59 und belastet alle schrittdämpfenden Strukturen, sowie Knie und Wirbelsäule stark. 57 Vgl. WINKELMANN 1995, S Vgl. STEFFENS / GRÜNING 2001 S Vgl. Abb. 3 Seite 29
30 4 Untersuchung 4 Untersuchung Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, herauszufinden, ob und wenn ja wie, sich Lauftechnik bei Anfängern im Ausdauerlauf in den ersten Wochen und Monaten des Trainings verändert. Als Versuchsgruppe dienten Studierende des Fachgebietes Sport der Universität Osnabrück, die zeitgleich mit Beginn der Untersuchung das Training für den Berlin-Marathon aufnahmen. 4.1 Versuchsgruppe Im Mai 2003 wurde einem Kurs von ca. 30 Studierenden, die sich gemeinsam unter sportmedizinischer Betreuung auf den Berlin-Marathon vorbereiteten, die Idee dieser Untersuchung vorgestellt. Sie wurden gebeten, sich freiwillig als Versuchsperson zur Verfügung zu stellen. Es meldeten sich 13 Personen freiwillig für den ersten Untersuchungstermin. Beim zweiten Untersuchungstermin, etwa zwei Monate später, waren noch acht Personen bereit, teilzunehmen. Sieben der acht Versuchspersonen des zweiten Durchganges waren auch beim ersten Durchgang Versuchspersonen und bildeten so in den Teil der Versuchsgruppe, der als Längsschnitt untersucht wurde. Der Datensatz einer Versuchsperson wurde im Verlauf der Untersuchung zerstört, so dass für den Längsschnitt eine Gruppe von sechs Versuchspersonen verbliebt, die im folgenden enge Versuchsgruppe genannt wird. Die in Tabelle 3 erhobenen Daten wurden unter der Frage Vorerfahrungen Läufer- Nr Geschlecht Alter Größe (in cm) Gewicht BMI Schuh- größe Laufdauer (Jahre) Trainings- häufigkeit km/woche 2 männlich weiblich weiblich weiblich männlich männlich ø - 24,5 173,7 65, , Tabelle 3: Die "enge Versuchsgruppe" Seite 30
31 4 Untersuchung erhoben, insbesondere die Laufleistung und die Trainingshäufigkeit können sich also zwischen den beiden Untersuchungsterminen verändert haben. In der engen Versuchsgruppe ist zu sehen, dass es eine ausgesprochen erfahrene Läuferin (Nr. 9) gibt, mit einer Laufleistung von 100 km/woche. Diese Läuferin wird im weiteren Verlauf der Untersuchung dazu dienen, Unterschiede in der Entwicklung aufzuzeigen. Wenn eine Entwicklung der Lauftechnik hin auf ein Optimum grade am Trainingsanfang stattfindet, dann müsste dies bei den eher unerfahrenen Läufern gut zu erkennen sein, und bei der erfahrenen Läuferin weniger gut. 4.2 Anlage und Ablauf der Untersuchung Die Untersuchung ist, wie bereits erwähnt, als Längsschnitt angelegt und sucht zunächst nach individuellen Entwicklungen. Es werden also für die Versuchsgruppe die Kennzahlen der ersten Untersuchung mit denen der zweiten Untersuchung verglichen. In diesem Zusammenhang wird nach Unterschieden bzw. Veränderungen gesucht. Die Untersuchung gliedert sich in zwei Untersuchungsreihen. Die erste Reihe wurde bei den Probanden zu Beginn ihrer Vorbereitung auf den Berlin- Marathon im Mai 2003 durchgeführt. Nach drei Monaten regelmäßigen Trainings (ca. drei Einheiten pro Woche) wurde im August 2003 die zweite Untersuchungsreihe durchgeführt. Das Training der Probanden erfolgte auf Basis eines sportärztlich erstellten Trainingplanes, der seine Empfehlungen wiederum aus einem Laktatstufentest zu verschiedenen Zeitpunkten des Trainings ableitete. Die Probanden waren in ihrem Trainingsplan angehalten, drei verschiedene Einheiten pro Woche zu trainieren. In einer langen Einheit, die im Verlauf des Gesamttrainings auf 75% der angestrebten Marathonzeit ausgedehnt wurde, sollte der Körper auf die Belastungsdauer vorbereitet werden. In der Tempo- Einheit, die zwischen einer 20-minütigen Ein- und Auslaufphase eine ca. 30 Minuten dauernde Laufeinheit mit submaximaler Belastung (ca. 80% - 90% der maximalen Herzfrequenz) beinhaltete, sollte die aerob-anaerobe- Schwelle angehoben werden. Diese beiden Trainingsschwer-punkte wurden Seite 31
32 4 Untersuchung im Wochenverlauf ergänzt durch eine ca. einstündige lockere Laufeinheit, die eine aktive Erholung ermöglichen sollte. Auf weitere Details der Trainingsplanung und des Trainingsablaufes soll hier nicht eingegangen werden, sie sind nicht systematisch erhoben worden. Es ist ferner nicht überprüft worden, welcher Umfang von den Probanden tatsächlich trainiert wurde und inwieweit die Trainingspläne eingehalten wurden. Dennoch kann von regelmäßigem und umfangreichem Training ausgegangen werden, denn alle Probanden haben den Marathon erfolgreich bestritten. Ausdrückliche Empfehlungen zur Änderung der Lauftechnik oder Tipps zum Techniktraining wurden den Probanden nicht gegeben. Lediglich am Ende jeder Aufnahmesequenz wurde die Aufnahme nach Augenschein zusammen mit den Läufern besprochen und analysiert Vor der Untersuchung Bereits vor der ersten Untersuchung hat jede Versuchsperson einen Fragebogen 60 erhalten, um Vorerfahrungen, Probleme beim Laufen, orthopädische Probleme etc. abzuklären. Läufer-Nr Laufziel Laufdauer (in Jahren) Trainingshäufigketi km/woche orthopädische Hilfen Schmerzen? Schmerzen Wo? 2 Freizeit Einlagen Kniekehle, links Schemrzen Wann? in Ruhe, n. langem Sitzen Verletzungen? Verletzungen Wo? Freizeit Kniebandagen Knie Selten Leistung li Knöchel seit 6 Monaten Sehnen am Fuß, beim Laufen Knie 12 Freizeit re. Knöchel, Bänderriß 14 Leistung Freizeit Knie rechts medial Tabelle 4: Orthopädische Probleme / Verletzungen Die Informationen, die mit dem Fragebogen vor Beginn der Untersuchung erhoben wurden, waren wesentlich umfangreicher, als hier angegeben. Der gesamten Fragebogen sowie das gesamte Datenmaterial ist im Anhang bei- 60 siehe Abbildung Seite 32
33 4 Untersuchung gefügt. Im Kontext dieser Untersuchung dienen diese Angaben dazu, den Gesundheitszustand und das Ziel bzw. die Motivation der Läufer abzuschätzen. Da außer normalen Sportverletzungen keine Nennenswerten Verletzungen oder Probleme vorlagen, wurde der gesundheitliche Status der Probanden nicht weiter berücksichtigt. Vor Beginn der ersten Aufnahmen wurde außerdem die gesamte Versuchsgruppe Fußorthopädisch untersucht. Diese Untersuchung war nicht ausdrücklich Bestandteil der vorliegenden Arbeit, wohl aber Bestandteil der Betreuung des Marathonkurses. Bei dieser Untersuchung wurden einfache funktionelle Tests der unteren Extremitäten vorgenommen. Die Dehnfähigkeit der hinteren Unterschenkelmuskulatur wurde mit der tiefen Hocke (beide Fersen am Boden) gestestet. Es wurde geschaut, ob die Beinachsen lotrecht verlaufen und das Fußgewölbe wurde beurteilt. Da die dort gewonnen Daten für eine weitere Interpretation dieser Arbeit von Interesse sein können, sind sie ebenfalls im Anhang, in Tabelle 18 und Tabelle 19 zu finden. Sie wurden jedoch bei der Auswertung der Videoanalysen nicht berücksichtigt. Außerdem konnte mit dieser Untersuchung weitgehend ausgeschlossen werden, dass orthopädische Fehlstellungen Einfluss auf das Untersuchungsergebnis haben. Versuchspersonen mit bekannten Problemen (Cox varus oder Cox valgus, Beinlängendifferenzen, etc.) wurden als Versuchsperson verworfen. Auch die Tatsache, dass zur Durchführung der Untersuchung auf einem Laufband gelaufen wurde, hat vermutlich die Laufbewegung beeinflusst. Ein anderer Untergrund, eine andere akustische Wahrnehmung und nicht zuletzt eine, von der Kinästhesie entkoppelte und ihr entgegengesetzte optische Wahrnehmung 61 machen das Laufen auf dem Laufband zu einem ungewohnten Ereignis. Dies merkt der Beobachter vor allem daran, dass die meisten Läufer zunächst taumeln, nicht ihr Tempo finden, den Blick zu den Füßen gesenkt haben. Auch wenn es eine Störgröße darstellt, war das Lauf- 61 Die Beine sagen Du läufst, aber die Augen sagen Du stehst. Seite 33
EINÜHRUNG IN DEN SPRINTLAUF
 EINÜHRUNG IN DEN SPRINTLAUF Autoren: Cosima Gethöffer, Florian Witzler 2015 WWW.KNSU.DE Seite 1 Übersicht Technikbeschreibung: Sprinten o Allgemeines o Die vier Phasen des Sprintlaufes Vorübungen für den
EINÜHRUNG IN DEN SPRINTLAUF Autoren: Cosima Gethöffer, Florian Witzler 2015 WWW.KNSU.DE Seite 1 Übersicht Technikbeschreibung: Sprinten o Allgemeines o Die vier Phasen des Sprintlaufes Vorübungen für den
Armwinkel 145,8 Grad Fusswinkel 2,8 Grad. Hüftwinkel 113,6 Grad Knie über Pedal 3,0 cm. Knie Winkel Max 144,3 Grad Kniewinkel Min 76,2 Grad
 Winkel und Maße Armwinkel 145,8 Grad Fusswinkel 2,8 Grad Hüftwinkel 113,6 Grad Knie über Pedal 3,0 cm Knie Winkel Max 144,3 Grad Kniewinkel Min 76,2 Grad Körperrumpf Winkel Touring 35,3 Grad Schulterwinkel
Winkel und Maße Armwinkel 145,8 Grad Fusswinkel 2,8 Grad Hüftwinkel 113,6 Grad Knie über Pedal 3,0 cm Knie Winkel Max 144,3 Grad Kniewinkel Min 76,2 Grad Körperrumpf Winkel Touring 35,3 Grad Schulterwinkel
Ich bin für Sie da. Stefan Maisenbacher Sportwissenschaftler, B.A. Hallo Herr Schroth,
 Ich bin für Sie da Hallo Herr Schroth, ich bin hier bei shop4runners für die Auswertung von Laufanalysen, die Durchführung der Leistungsdiagnostik und für die Erstellung von individuellen Trainingsplänen
Ich bin für Sie da Hallo Herr Schroth, ich bin hier bei shop4runners für die Auswertung von Laufanalysen, die Durchführung der Leistungsdiagnostik und für die Erstellung von individuellen Trainingsplänen
Sportliche Ausbildung Sprint/Lauf
 Sportliche Ausbildung Sprint/Lauf hier: Folie 1 Themenübersicht Leistungsbasis Ziele Technikleitbild Praxistipps Folie 2 Basis einer guten Sprintleistung Reaktionszeit und Start mit kräftigem Abdruck aus
Sportliche Ausbildung Sprint/Lauf hier: Folie 1 Themenübersicht Leistungsbasis Ziele Technikleitbild Praxistipps Folie 2 Basis einer guten Sprintleistung Reaktionszeit und Start mit kräftigem Abdruck aus
Dänk a Glänk Kräftigen mit dem Thera-Band. Programm für die Beine
 Kräftigen mit dem Thera-Band Programm für die Beine Kräftigen mit dem Thera-Band Kraft ist ein wichtiger Faktor für einen gesunden Bewegungsapparat. Kraft, gekoppelt mit Beweglichkeit und Koordination,
Kräftigen mit dem Thera-Band Programm für die Beine Kräftigen mit dem Thera-Band Kraft ist ein wichtiger Faktor für einen gesunden Bewegungsapparat. Kraft, gekoppelt mit Beweglichkeit und Koordination,
im folgenden Verlauf finden Sie den Bericht zu Ihrer Bewegungsanalyse und Sportberatung am. in unserer Niederlassung Dillenburg- Frohnhausen.
 MIO-Sportakademie OHG Auf der Langaar 8 35684 Dillenburg-Frohnhausen Sehr geehrte Frau, im folgenden Verlauf finden Sie den Bericht zu Ihrer Bewegungsanalyse und Sportberatung am. in unserer Niederlassung
MIO-Sportakademie OHG Auf der Langaar 8 35684 Dillenburg-Frohnhausen Sehr geehrte Frau, im folgenden Verlauf finden Sie den Bericht zu Ihrer Bewegungsanalyse und Sportberatung am. in unserer Niederlassung
Koordination. 1) Einbeinstand. 2) Kniebeuge. 3) Zehen- und Fersenstand
 Koordination 1) Einbeinstand Stellen Sie sich auf den Stabilisationstrainer und balancieren Sie abwechselnd auf einem Bein. Das Standbein ist dabei minimal gebeugt. Wenn Sie den Schwierigkeitsgrad steigern
Koordination 1) Einbeinstand Stellen Sie sich auf den Stabilisationstrainer und balancieren Sie abwechselnd auf einem Bein. Das Standbein ist dabei minimal gebeugt. Wenn Sie den Schwierigkeitsgrad steigern
Lauftechnikanalyse. Max Muster besserlaufen.at, Josef Hartl, Bergstraße 29, 5223 Pfaffstätt,
 Lauftechnikanalyse Max Muster 19.10.2015 Hallo Max, ich berichte Dir im Folgenden über Deine Lauftechnikanalyse vom 05.08.2015 in Pfaffstätt. Allgemeine Angaben: Name: Max Muster Körpergröße: 183 Gewicht:
Lauftechnikanalyse Max Muster 19.10.2015 Hallo Max, ich berichte Dir im Folgenden über Deine Lauftechnikanalyse vom 05.08.2015 in Pfaffstätt. Allgemeine Angaben: Name: Max Muster Körpergröße: 183 Gewicht:
Training der allgemeinen Grundlagenausdauer. Judo-Wettkampfförderung U14
 Training der allgemeinen Grundlagenausdauer Judo-Wettkampfförderung U14 Trainingsplanung Stufe 1 2 3 4 5 6 7 8 Belastung L= Laufen G= Gehen 2 min L, 2 min G, 2 min L, 2 min G, 2 min L, 2 min G, 2 min L,
Training der allgemeinen Grundlagenausdauer Judo-Wettkampfförderung U14 Trainingsplanung Stufe 1 2 3 4 5 6 7 8 Belastung L= Laufen G= Gehen 2 min L, 2 min G, 2 min L, 2 min G, 2 min L, 2 min G, 2 min L,
Sinn und Zweck: Anfersen. -http://www.runnersworld.de/laufabc
 Laufschule: Mögliche Übungen Aus verschiedenen Quellen -http://www.indurance.ch -www.lauftipps.ch -https://www.mobilesport.ch/leichtathletik/leichtathletik-laufschule-das-lauf-abc-alsgrundlage/ -http://www.runnersworld.de/laufabc
Laufschule: Mögliche Übungen Aus verschiedenen Quellen -http://www.indurance.ch -www.lauftipps.ch -https://www.mobilesport.ch/leichtathletik/leichtathletik-laufschule-das-lauf-abc-alsgrundlage/ -http://www.runnersworld.de/laufabc
Trainingsplan. 1 Warm Up Seilspringen. 2 Ausfallschritt vorw ärts (erhöht) 3 Rumpfkr äftigung Physioball Rückenlage. Ausgangsposition - wie vorgegeben
 1 Warm Up Seilspringen 5497 25 2 30 2 Ausfallschritt vorw ärts (erhöht) 0805 Ausgangsposition Beine h üftbreit auseinander, Kniegelenke etwas gebeugt, Stand auf Erhöhung, Oberkörper aufrecht, Arme dicht
1 Warm Up Seilspringen 5497 25 2 30 2 Ausfallschritt vorw ärts (erhöht) 0805 Ausgangsposition Beine h üftbreit auseinander, Kniegelenke etwas gebeugt, Stand auf Erhöhung, Oberkörper aufrecht, Arme dicht
Laufanalyse Pro. Max Musterläufer besserlaufen.at, Josef Hartl, Bergstraße 29, 5223 Pfaffstätt,
 Laufanalyse Pro Max Musterläufer 19.10.2015 Hallo Max, ich berichte Dir im Folgenden über Deine Laufanalyse Pro vom 05.10.2015 in Pfaffstätt. Allgemeine Angaben: Name: Körpergröße: Gewicht: Sport: Wochenumfang
Laufanalyse Pro Max Musterläufer 19.10.2015 Hallo Max, ich berichte Dir im Folgenden über Deine Laufanalyse Pro vom 05.10.2015 in Pfaffstätt. Allgemeine Angaben: Name: Körpergröße: Gewicht: Sport: Wochenumfang
Kräftigungsübungen für zu Hause
 Kräftigungsübungen für zu Hause Die Anleitungen aus der Reihe Übungen für zu Hause wurden für die Ambulante Herzgruppe Bad Schönborn e.v. von Carolin Theobald und Katharina Enke erstellt. Weitergabe, Veränderung
Kräftigungsübungen für zu Hause Die Anleitungen aus der Reihe Übungen für zu Hause wurden für die Ambulante Herzgruppe Bad Schönborn e.v. von Carolin Theobald und Katharina Enke erstellt. Weitergabe, Veränderung
Stabilisierung. Fit mit den kleinen Muskeln
 Stabilisierung Fit mit den kleinen Muskeln Sprints, Sprünge, Schüsse und Zweikämpfe - Fußball erfordert gute athletische Fähigkeiten und eine allgemeine Kräftigung des ganzen Körpers ist hierfür eine unverzichtbare
Stabilisierung Fit mit den kleinen Muskeln Sprints, Sprünge, Schüsse und Zweikämpfe - Fußball erfordert gute athletische Fähigkeiten und eine allgemeine Kräftigung des ganzen Körpers ist hierfür eine unverzichtbare
1. Rückenbeweglichkeit. 2. Verkürzung der Hüftaussenrotatoren
 1. Rückenbeweglichkeit Mit gestreckten Knien versuchen den Fingerspitzen den Boden zu erreichen. 2. Verkürzung der Hüftaussenrotatoren Im Sitzen den Fuss auf das Knie der Gegenseite legen. Den Unterschenkel
1. Rückenbeweglichkeit Mit gestreckten Knien versuchen den Fingerspitzen den Boden zu erreichen. 2. Verkürzung der Hüftaussenrotatoren Im Sitzen den Fuss auf das Knie der Gegenseite legen. Den Unterschenkel
Übung 1: Kräftigen Sie Ihre Oberschenkelmuskulatur
 Fitnessübungen für den Schneesport Level 2 mittel Beim Skifahren und Snowboarden wird die Rumpf und Beinmuskulatur besonders stark gefordert. Eine gute körperliche Verfassung verbessert das technische
Fitnessübungen für den Schneesport Level 2 mittel Beim Skifahren und Snowboarden wird die Rumpf und Beinmuskulatur besonders stark gefordert. Eine gute körperliche Verfassung verbessert das technische
Inhaltsverzeichnis. A. Allgemeine Anatomie
 Inhaltsverzeichnis A. Allgemeine Anatomie A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 Allgemeine Ausdrücke, Richtungen im Raum Allgemeine Ausdrücke, Bewegungen, Ebenen Knochenentwicklung Enchondrale
Inhaltsverzeichnis A. Allgemeine Anatomie A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 Allgemeine Ausdrücke, Richtungen im Raum Allgemeine Ausdrücke, Bewegungen, Ebenen Knochenentwicklung Enchondrale
Studienbrief. Fachpraktiker Dorn-Breuß. Die Behandlung mit der Dorn-Breuß-Methode: Eine sanfte Therapie für Wirbelsäule und Gelenke
 Studienbrief Fachpraktiker Dorn-Breuß : Eine sanfte Therapie für Wirbelsäule und Gelenke Bild: DAN - Fotolia.com 4 Die verschiedenen Testungen und Korrekturen der Dorn-Methode 4. DIE VERSCHIEDENEN TESTUNGEN
Studienbrief Fachpraktiker Dorn-Breuß : Eine sanfte Therapie für Wirbelsäule und Gelenke Bild: DAN - Fotolia.com 4 Die verschiedenen Testungen und Korrekturen der Dorn-Methode 4. DIE VERSCHIEDENEN TESTUNGEN
Fitnessübungen für den Schneesport
 Fitnessübungen für den Schneesport Level 3 schwierig Beim Skifahren und Snowboarden wird die Rumpf und Beinmuskulatur besonders stark gefordert. Eine gute körperliche Verfassung verbessert das technische
Fitnessübungen für den Schneesport Level 3 schwierig Beim Skifahren und Snowboarden wird die Rumpf und Beinmuskulatur besonders stark gefordert. Eine gute körperliche Verfassung verbessert das technische
Stretching für Schützen
 Stretching für Schützen Zur Förderung der Beweglichkeit: Mit Stretching kann die Beweglichkeit kurzfristig verbessert werden. Die Muskulatur neigt aber dazu, sich wieder auf ihre Ursprungslänge zurückzubilden.
Stretching für Schützen Zur Förderung der Beweglichkeit: Mit Stretching kann die Beweglichkeit kurzfristig verbessert werden. Die Muskulatur neigt aber dazu, sich wieder auf ihre Ursprungslänge zurückzubilden.
Biomechanik im Sporttheorieunterricht
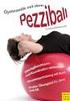 Betrifft 22 DR. MARTIN HILLEBRECHT Biomechanik im Sporttheorieunterricht - Grafische Schwerpunktbestimmung - 1. EINLEITUNG Im ersten Teil diese Artikels (vgl. Betrifft Sport 4/ 98) wurden zwei Verfahren
Betrifft 22 DR. MARTIN HILLEBRECHT Biomechanik im Sporttheorieunterricht - Grafische Schwerpunktbestimmung - 1. EINLEITUNG Im ersten Teil diese Artikels (vgl. Betrifft Sport 4/ 98) wurden zwei Verfahren
Die Füße stehen parallel am Boden, d. h. der Abstand zwischen den Fersen ist ebenso groß wie jener zwischen den Fußspitzen.
 Ins Lot kommen Mache die Übung im Stehen. Stelle dich schulterbreit hin und lass die Arme locker hängen. Die Füße stehen parallel am Boden, d. h. der Abstand zwischen den Fersen ist ebenso groß wie jener
Ins Lot kommen Mache die Übung im Stehen. Stelle dich schulterbreit hin und lass die Arme locker hängen. Die Füße stehen parallel am Boden, d. h. der Abstand zwischen den Fersen ist ebenso groß wie jener
Mittelpunkt des Sprunggelenks
 IDEAL Technologien IDEAL HEEL Fördert die korrekte Ausrichtung und reduziert Hebelarme Ideal Heel führt dazu, dass sich der Bodenkontakt und Kraftansatzpunkt weiter nach vorn verlagert. Der Läufer landet
IDEAL Technologien IDEAL HEEL Fördert die korrekte Ausrichtung und reduziert Hebelarme Ideal Heel führt dazu, dass sich der Bodenkontakt und Kraftansatzpunkt weiter nach vorn verlagert. Der Läufer landet
Übung 1: Kräftigen Sie Ihre Oberschenkelmuskulatur
 Fitnessübungen für den Schneesport Level 3 schwierig Beim Skifahren und Snowboarden wird die Rumpf und Beinmuskulatur besonders stark gefordert. Eine gute körperliche Verfassung verbessert das technische
Fitnessübungen für den Schneesport Level 3 schwierig Beim Skifahren und Snowboarden wird die Rumpf und Beinmuskulatur besonders stark gefordert. Eine gute körperliche Verfassung verbessert das technische
Trainingsplan. Pause sec Dauer sec. Gew. kg Level Anstieg. Wdh. 12 RPM U/min Wdst. Watt
 1 Brücke einbeinig Rolle Rückenlage 1191 Wdh. 12 Ausgangsposition Rückenlage, ein Bein 90 in Hüft- und Kniegelenk gebeugt, das andere Bein gestreckt, feste Rolle oä.unterhalb Kniekehle, Arme gestreckt
1 Brücke einbeinig Rolle Rückenlage 1191 Wdh. 12 Ausgangsposition Rückenlage, ein Bein 90 in Hüft- und Kniegelenk gebeugt, das andere Bein gestreckt, feste Rolle oä.unterhalb Kniekehle, Arme gestreckt
Bei der Übungsabfolge führen alle Teilnehmer die Übung gemeinsam aus, ehe die nächste Übung in Angriff genommen wird. 1
 Zeit Organisation Beschreibung Material 24 Ort: Halle / Gelände Organisation: Übungsabfolge; eine Übung nach der anderen Ausführung: Einzelarbeit Anzahl Übungen: 12 o Oberkörper: 2 o Körpermitte: 3 o Unterkörper:
Zeit Organisation Beschreibung Material 24 Ort: Halle / Gelände Organisation: Übungsabfolge; eine Übung nach der anderen Ausführung: Einzelarbeit Anzahl Übungen: 12 o Oberkörper: 2 o Körpermitte: 3 o Unterkörper:
Bewegungsbeschreibung der E - Pflichtübungen Aufgabe E1
 Bewegungsbeschreibung der E - Pflichtübungen Aufgabe E1 E1-Sitz Gültig ab 01.01.2015 Grundsitzposition analog Aufgabenheft Voltgieren 2012, S. 36 Armhaltung: - Die Hand des inneren Arms fasst während der
Bewegungsbeschreibung der E - Pflichtübungen Aufgabe E1 E1-Sitz Gültig ab 01.01.2015 Grundsitzposition analog Aufgabenheft Voltgieren 2012, S. 36 Armhaltung: - Die Hand des inneren Arms fasst während der
Radlabor Core Stability Programm
 CORESTABILITY Danksagung Vielen Dank an unseren langjährigen Kooperationspartner Olympiastützpunkt Freiburg-Schwarzwald für die hilfreiche Unterstützung bei den Fotos an den Geräten. Radlabor Core Stability
CORESTABILITY Danksagung Vielen Dank an unseren langjährigen Kooperationspartner Olympiastützpunkt Freiburg-Schwarzwald für die hilfreiche Unterstützung bei den Fotos an den Geräten. Radlabor Core Stability
TRAINING 1. Für extra Motivation darf gerne die Musik etwas aufgedreht werden. Ideal sind Tracks mit einem BPM von
 TRAINING 1 Dieses Training bedarf keiner Hilfsmittel und nur wenig Platz. Ich führe dich in die Übung ein, erkläre Haltung und Ausführung, zeige dir mit Fotos den Bewegungsablauf und gebe dir 3 Optionen
TRAINING 1 Dieses Training bedarf keiner Hilfsmittel und nur wenig Platz. Ich führe dich in die Übung ein, erkläre Haltung und Ausführung, zeige dir mit Fotos den Bewegungsablauf und gebe dir 3 Optionen
Fotoreihe 1 Fußgelenksarbeit (Fotoreihen sind immer von links nach rechts zu lesen.) Diese Kriterien dienen gleichzeitig als wesentliche Beobachtungsm
 Martin Hillebrecht Lauf- ABC Verbesserung der Koordination beim Laufen Anwender: Lehrer, Übungsleiter Adressaten: Kinder und Jugendliche, Freizeitsportgruppen, Schulsportgruppen, Vereinssportgruppen Ziele:
Martin Hillebrecht Lauf- ABC Verbesserung der Koordination beim Laufen Anwender: Lehrer, Übungsleiter Adressaten: Kinder und Jugendliche, Freizeitsportgruppen, Schulsportgruppen, Vereinssportgruppen Ziele:
Zuhause trainieren für mehr Kraft und Beweglichkeit. Ein Programm für Arthrosepatienten
 Zuhause trainieren für mehr Kraft und Beweglichkeit Ein Programm für Arthrosepatienten Inhalt 4 Übungen für Hüfte und Knie 8 Übungen für die Hände 9 Übungen für die Füsse 10 Persönliches Übungsprogramm
Zuhause trainieren für mehr Kraft und Beweglichkeit Ein Programm für Arthrosepatienten Inhalt 4 Übungen für Hüfte und Knie 8 Übungen für die Hände 9 Übungen für die Füsse 10 Persönliches Übungsprogramm
Lauf-Vor- und -nachbereitungen. Variante 1, oberer Anteil: Zwillingswadenmuskel (M. gastrocnemius) Wo soll es ziehen? Vor allem im oberen Wadenbereich
 Variante 1, oberer Anteil: Zwillingswadenmuskel (M. gastrocnemius) 17 Ausgangsposition für Variante 1 und 2 Schrittstellung, vorne an einer Wand oder auf Oberschenkel abstützen, Fuß des hinteren Beines
Variante 1, oberer Anteil: Zwillingswadenmuskel (M. gastrocnemius) 17 Ausgangsposition für Variante 1 und 2 Schrittstellung, vorne an einer Wand oder auf Oberschenkel abstützen, Fuß des hinteren Beines
Ziel: Schulter- und Rückenmuskeln kräftigen. Sie brauchen: eine Tür oder eine Wand. Ziel: die geraden Rückenmuskeln kräftigen
 Fitness-Übungen für den Rücken: Rückenmuskeln kräftigen (viele weitere Tips unter: http://www.vitanet.de/krankheiten-symptome/ rueckenschmerzen/ratgeber-selbsthilfe/rueckengymnastik/) Die Rückenmuskulatur
Fitness-Übungen für den Rücken: Rückenmuskeln kräftigen (viele weitere Tips unter: http://www.vitanet.de/krankheiten-symptome/ rueckenschmerzen/ratgeber-selbsthilfe/rueckengymnastik/) Die Rückenmuskulatur
MIT HERZ UND VERSTAND. IM PINZGAU. SICHER IN DEN SKIWINTER.
 MIT HERZ UND VERSTAND. IM PINZGAU. SICHER IN DEN SKIWINTER. >> MIT DEM TAUERNKLINIKUM 7 TIPPS FÜR EINEN SPORTLICHEN SKIWINTER. 1 >> Vorbereitungstraining 2 >> Pistenauswahl & Geschwindigkeit anpassen 3
MIT HERZ UND VERSTAND. IM PINZGAU. SICHER IN DEN SKIWINTER. >> MIT DEM TAUERNKLINIKUM 7 TIPPS FÜR EINEN SPORTLICHEN SKIWINTER. 1 >> Vorbereitungstraining 2 >> Pistenauswahl & Geschwindigkeit anpassen 3
Übungskatalog zum Kräftigen
 Übungskatalog zum Kräftigen Kräftigen der Arm-Schultermuskulatur Vereinfachter Liegestütz: Im Vierfüßlerstand die Füße anheben und verschränken. Den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule halten und die
Übungskatalog zum Kräftigen Kräftigen der Arm-Schultermuskulatur Vereinfachter Liegestütz: Im Vierfüßlerstand die Füße anheben und verschränken. Den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule halten und die
Springseil-Workout mit Fernanda Brandao
 Springseil-Workout mit Fernanda Brandao Seilspringen ist ein intensives Ganzkörper-Workout, das die Herzfrequenz nach oben treibt und den Stoffwechsel in Schwung bringt. Neben Körperspannung und Kraftausdauer
Springseil-Workout mit Fernanda Brandao Seilspringen ist ein intensives Ganzkörper-Workout, das die Herzfrequenz nach oben treibt und den Stoffwechsel in Schwung bringt. Neben Körperspannung und Kraftausdauer
ANLEITUNG. Die Übungen sind im Stehen, zum Großteil auch mit Rollator und im Sitzen durchführbar. Folgende Grundregeln sollten Sie beachten:
 ANLEITUNG Die Übungen sind im Stehen, zum Großteil auch mit Rollator und im Sitzen durchführbar. Folgende Grundregeln sollten Sie beachten: Stabiler Stand: Auf einen festen Untergrund achten, bei Übungen
ANLEITUNG Die Übungen sind im Stehen, zum Großteil auch mit Rollator und im Sitzen durchführbar. Folgende Grundregeln sollten Sie beachten: Stabiler Stand: Auf einen festen Untergrund achten, bei Übungen
10 Übungen zur Kräftigung Ihrer Muskulatur
 1 Für einen starken Rücken 1. Sie stehen in Schrittstellung, das rechte Bein steht vorn. Ihr Oberkörper ist so weit vorgebeugt, dass Ihr linkes Bein, Rücken und Kopf eine Linie bilden. Die Hände erfassen
1 Für einen starken Rücken 1. Sie stehen in Schrittstellung, das rechte Bein steht vorn. Ihr Oberkörper ist so weit vorgebeugt, dass Ihr linkes Bein, Rücken und Kopf eine Linie bilden. Die Hände erfassen
Kurzprogramm zur Dehnung
 Kurzprogramm zur Dehnung allgemeine Hinweise Atmen Sie während der Übungen ruhig und gleichmäßig weiter. Vor den Dehnübungen sollten Sie unbedingt Ihren Körper fünf Minuten erwärmen. Führen Sie das Dehnprogramm
Kurzprogramm zur Dehnung allgemeine Hinweise Atmen Sie während der Übungen ruhig und gleichmäßig weiter. Vor den Dehnübungen sollten Sie unbedingt Ihren Körper fünf Minuten erwärmen. Führen Sie das Dehnprogramm
KRÄFTIGUNGSPROGRAMM DFB-STÜTZPUNKTE OSTBAYERN
 Übung 1: Unterarmstütz bäuchlings Unterarmstütz mit Bauch zum Boden, gestreckte Beine mit Fußspitzen aufsetzen. Schulter, Hüfte und Sprunggelenke bilden eine Linie. Die Bauchmuskulatur wird während der
Übung 1: Unterarmstütz bäuchlings Unterarmstütz mit Bauch zum Boden, gestreckte Beine mit Fußspitzen aufsetzen. Schulter, Hüfte und Sprunggelenke bilden eine Linie. Die Bauchmuskulatur wird während der
LAUFSPORT AUS LEIDENSCHAFT KOMM INS LAUFLABOR: LAUFLABOR, LAUFSTILOPTIMIERUNG, LAUFSCHULE
 LAUFSPORT AUS LEIDENSCHAFT KOMM INS LAUFLABOR: LAUFLABOR, LAUFSTILOPTIMIERUNG, LAUFSCHULE DAS LAUFLABOR NUR FÜR PROFIS? Das ändern wir für Sie. Bisher waren Analysen professionellen Athleten vorbehalten.
LAUFSPORT AUS LEIDENSCHAFT KOMM INS LAUFLABOR: LAUFLABOR, LAUFSTILOPTIMIERUNG, LAUFSCHULE DAS LAUFLABOR NUR FÜR PROFIS? Das ändern wir für Sie. Bisher waren Analysen professionellen Athleten vorbehalten.
Expander Gymnastikband Art.-Nr
 Diedrich Filmer GmbH Jeringhaver Gast 5 D - 26316 Varel Tel.: +49 (0) 4451 1209-0 www.filmer.de Expander Gymnastikband Art.-Nr. 22.022 Zu Ihrer Sicherheit: Lassen Sie vor Aufnahme des Trainings durch Ihren
Diedrich Filmer GmbH Jeringhaver Gast 5 D - 26316 Varel Tel.: +49 (0) 4451 1209-0 www.filmer.de Expander Gymnastikband Art.-Nr. 22.022 Zu Ihrer Sicherheit: Lassen Sie vor Aufnahme des Trainings durch Ihren
Level TRAININGSZIRKEL GELANDER & CO
 Level 2 TRANNGSZRKEL GELANDER & CO 1W5EDXER HÄNGENDE DPS Kräftigt die Arm- und Schultermuskulatur 1. Für diese Übung benötigen Sie etwas Ähnliches wie einen Barren. Stellen Sie sich aufrecht zwischen die
Level 2 TRANNGSZRKEL GELANDER & CO 1W5EDXER HÄNGENDE DPS Kräftigt die Arm- und Schultermuskulatur 1. Für diese Übung benötigen Sie etwas Ähnliches wie einen Barren. Stellen Sie sich aufrecht zwischen die
Technik Weitsprung. Der Anlauf. Anlauf Absprung Flugphase Landung
 Technik Weitsprung Allgemeines Der Weitsprung ist eine der elementaren Disziplinen in der Leichtathletik und vereint verschiedene Fähigkeiten, welche von den Sportlern beherrscht werden müssen. Die Athleten
Technik Weitsprung Allgemeines Der Weitsprung ist eine der elementaren Disziplinen in der Leichtathletik und vereint verschiedene Fähigkeiten, welche von den Sportlern beherrscht werden müssen. Die Athleten
Hand in Hand. aktiv Hand in Hand-Workout. Text und Übungen: Sylvia Krieg. 78 active woman
 aktiv Hand in Hand-Workout Hand in Hand Text und Übungen: Sylvia Krieg Zu zweit macht das Training einfach mehr Spaß. Unser Partner-Workout ist auch in einer weiteren Hinsicht doppelt effektiv, weil man
aktiv Hand in Hand-Workout Hand in Hand Text und Übungen: Sylvia Krieg Zu zweit macht das Training einfach mehr Spaß. Unser Partner-Workout ist auch in einer weiteren Hinsicht doppelt effektiv, weil man
Endposition Beine gespreizt, Füße zusammen
 1 Dehnung Oberschenkel Vorderseite Bauchlage 1129 Ausgangsposition Bauchlage, Kniegelenk des zu dehnenden Beins gebeugt, seitengleiche Hand fixiert den Unterschenkel oberhalb Sprunggelenk, alternativ Schlaufe/Handtuch
1 Dehnung Oberschenkel Vorderseite Bauchlage 1129 Ausgangsposition Bauchlage, Kniegelenk des zu dehnenden Beins gebeugt, seitengleiche Hand fixiert den Unterschenkel oberhalb Sprunggelenk, alternativ Schlaufe/Handtuch
Bauchmuskulatur. Position 1: In Rückenlage die Knie anziehen und die Unterschenkel von außen umfassen.
 Double-Leg-Stretch Untere gerade und schräge Bauchmuskulatur Position 1: In Rückenlage die Knie anziehen und die Unterschenkel von außen umfassen. Position 2: Den Bauchnabel einziehen. Kopf und Schultern
Double-Leg-Stretch Untere gerade und schräge Bauchmuskulatur Position 1: In Rückenlage die Knie anziehen und die Unterschenkel von außen umfassen. Position 2: Den Bauchnabel einziehen. Kopf und Schultern
Bewegungsprogramm für arginin.de
 Bewegungsprogramm für arginin.de Ausdauertraining Klassische Ausdauersportarten wie Walken, Laufen oder Radfahren zählen zu den einfachsten Methoden um das Herz Kreislauf System zu aktivieren. Für die
Bewegungsprogramm für arginin.de Ausdauertraining Klassische Ausdauersportarten wie Walken, Laufen oder Radfahren zählen zu den einfachsten Methoden um das Herz Kreislauf System zu aktivieren. Für die
Walking und Nordic Walking,
 Walking und Nordic Walking, eine empirische Untersuchung zu Gemeinsamkeiten, Unterschieden und Qualität Studie von Steffen Bader DWI 26 Gründe für die Untersuchung Aufzeigen des Ist Zustand der Walking/
Walking und Nordic Walking, eine empirische Untersuchung zu Gemeinsamkeiten, Unterschieden und Qualität Studie von Steffen Bader DWI 26 Gründe für die Untersuchung Aufzeigen des Ist Zustand der Walking/
Funktionelle Gymnastik
 Funktionelle Gymnastik ÜBUNGSZIEL RICHTIG Kräftigung der Beinmuskulatur. Mit dem Rücken an eine Wand lehnen und die Knie beugen. Winkel im Kniegelenk nicht unter 90º. Dehnung der Rücken- und hinteren Beinmuskulatur.
Funktionelle Gymnastik ÜBUNGSZIEL RICHTIG Kräftigung der Beinmuskulatur. Mit dem Rücken an eine Wand lehnen und die Knie beugen. Winkel im Kniegelenk nicht unter 90º. Dehnung der Rücken- und hinteren Beinmuskulatur.
Übungsanleitung. Original PEZZI Formula Fit-Roll - Übungsanleitung
 Übungsanleitung Übung 1 Bevor du startest ein paar Tipps * Bei akuten Schmerzen oder frischen Verletzungen solltest du vorab mit deinem Arzt sprechen. * Treten Schmerzen während einer Übung auf, brich
Übungsanleitung Übung 1 Bevor du startest ein paar Tipps * Bei akuten Schmerzen oder frischen Verletzungen solltest du vorab mit deinem Arzt sprechen. * Treten Schmerzen während einer Übung auf, brich
Gymnastikprogramm. Kräftigungsübungen mit dem Ball
 Gymnastikprogramm Kräftigungsübungen mit dem Ball - Bauch, Beine, Gesäß, Rücken und Arme - Vorbemerkungen/Ziele Auch mit einem kleinen weichen Ball kann ein hocheffektives Programm zur Steigerung der Muskelkraft
Gymnastikprogramm Kräftigungsübungen mit dem Ball - Bauch, Beine, Gesäß, Rücken und Arme - Vorbemerkungen/Ziele Auch mit einem kleinen weichen Ball kann ein hocheffektives Programm zur Steigerung der Muskelkraft
Kräftigungsprogramm CCJL-B
 Kräftigungsprogramm CCJL-B Saison 2016/17 Mit gezielten Präventionsmaßnahmen und Athletik-Training lassen sich Risiken von Verletzungen und die damit verbundenen Ausfälle in der Mannschaft verringern.
Kräftigungsprogramm CCJL-B Saison 2016/17 Mit gezielten Präventionsmaßnahmen und Athletik-Training lassen sich Risiken von Verletzungen und die damit verbundenen Ausfälle in der Mannschaft verringern.
Trainingsplan. Wdh. RPM U/min Wdst. Watt. Pause sec Dauer sec 15. Gew. kg Level Anstieg
 1 Dehnung Oberschenkel Vorderseite Bauchlage 1129 Wdh. Dauer sec 15 Ausgangsposition Bauchlage, Kniegelenk des zu dehnenden Beins gebeugt, seitengleiche Hand fixiert den Unterschenkel oberhalb Sprunggelenk,
1 Dehnung Oberschenkel Vorderseite Bauchlage 1129 Wdh. Dauer sec 15 Ausgangsposition Bauchlage, Kniegelenk des zu dehnenden Beins gebeugt, seitengleiche Hand fixiert den Unterschenkel oberhalb Sprunggelenk,
Kräftigung. PARAMETER: mindestens 6 Wochen Anzahl Wiederholungen: Wiederholungen
 Kräftigung PARAMETER: Dauer: mindestens 6 Wochen Anzahl Wiederholungen: 10-15 Wiederholungen Anzahl Sätze: 3 Sätze Anzahl Trainingseinheiten: 2-3 Einheiten pro Woche Anzahl der Übungen: 4-6 Übungen, individuelle
Kräftigung PARAMETER: Dauer: mindestens 6 Wochen Anzahl Wiederholungen: 10-15 Wiederholungen Anzahl Sätze: 3 Sätze Anzahl Trainingseinheiten: 2-3 Einheiten pro Woche Anzahl der Übungen: 4-6 Übungen, individuelle
Fitness-Expanderset. Art.-Nr
 Diedrich Filmer GmbH Jeringhaver Gast 5 D - 26316 Varel Tel.: +49 (0) 4451 1209-0 www.filmer.de Fitness-Expanderset Art.-Nr. 22.033 Wir freuen uns, dass Sie sich für den Erwerb dieses 3-teiligen Sets entschieden
Diedrich Filmer GmbH Jeringhaver Gast 5 D - 26316 Varel Tel.: +49 (0) 4451 1209-0 www.filmer.de Fitness-Expanderset Art.-Nr. 22.033 Wir freuen uns, dass Sie sich für den Erwerb dieses 3-teiligen Sets entschieden
Knie-, Hüft- und Rückenprobleme sind die nahezu unausweichlichen Folgen dieser unnatürlichen
 Lauftechnik - Die Körperaufrichtung Die sogenannte natürliche Lauftechnik: Ein scheinbar raumgreifender Schritt durch den Vorschwung des Unterschenkels, ein fersenbetontes Aufsetzen des Fußes, Oberkörpervorlage
Lauftechnik - Die Körperaufrichtung Die sogenannte natürliche Lauftechnik: Ein scheinbar raumgreifender Schritt durch den Vorschwung des Unterschenkels, ein fersenbetontes Aufsetzen des Fußes, Oberkörpervorlage
Auswahl = Dies kann eine Auswahl aus der Region sein, Talente, oä. im Alter MU15 MU15 = männlich unter 15 Jahre MU17 = männlich unter 17 Jahre usw.
 Leistungsdiagnostik: Inhalt: YoYo - Test Rumpfkraftausdauer Ventral Rumpfkraftausdauer Lateral Rumpfkraftausdauer Dorsal Medizinballwurf aus dem Stand, Medizinball 2kg Kugelschocker (vorwärts) aus dem
Leistungsdiagnostik: Inhalt: YoYo - Test Rumpfkraftausdauer Ventral Rumpfkraftausdauer Lateral Rumpfkraftausdauer Dorsal Medizinballwurf aus dem Stand, Medizinball 2kg Kugelschocker (vorwärts) aus dem
# 1 Hip Crossover. Ausgangslage. Durchführung
 Rumpf # 1 Hip Crossover Lege dich mit dem Rücken auf den Boden und halte dich mit den Armen an einer stabilen Verankerung fest (z.b. Sprossenwand, ). Winkle die Beine und das Becken durch verdrehen des
Rumpf # 1 Hip Crossover Lege dich mit dem Rücken auf den Boden und halte dich mit den Armen an einer stabilen Verankerung fest (z.b. Sprossenwand, ). Winkle die Beine und das Becken durch verdrehen des
Fange mit einem kleinen Stabilisierungstraining pro Woche an, und steigere dich dann auf zwei Einheiten.
 Fit mit den kleinen Muskeln Sprints, Sprünge, Schüsse und Zweikämpfe - Fußball erfordert gute athletische Fähigkeiten, und eine allgemeine Kräftigung des ganzen Körpers ist hierfür eine unverzichtbare
Fit mit den kleinen Muskeln Sprints, Sprünge, Schüsse und Zweikämpfe - Fußball erfordert gute athletische Fähigkeiten, und eine allgemeine Kräftigung des ganzen Körpers ist hierfür eine unverzichtbare
Entwicklung turnspezifischer Kraft. 1 Grundlagen
 Entwicklung turnspezifischer Kraft 1 Grundlagen Zeitraum aufrecht erhalten werden muss. Ein Battement (Beinwurf) hingegen stellt eine dynamische Bewegung dar. Für das Training dieser Bewegungsform sollten
Entwicklung turnspezifischer Kraft 1 Grundlagen Zeitraum aufrecht erhalten werden muss. Ein Battement (Beinwurf) hingegen stellt eine dynamische Bewegung dar. Für das Training dieser Bewegungsform sollten
ÜBUNG 6: Laufschule. Ausführung. Österreichischer Skiverband. Institut für Sportwissenschaft Innsbruck
 Österreichischer Skiverband ÜBUNG 6: Laufschule Aus den sechs angeführten Übungen werden vier Übungen vorgegeben. Diese müssen laut Vorgabe miteinander verbunden und zwischen den Markierungen (ca. 4m)
Österreichischer Skiverband ÜBUNG 6: Laufschule Aus den sechs angeführten Übungen werden vier Übungen vorgegeben. Diese müssen laut Vorgabe miteinander verbunden und zwischen den Markierungen (ca. 4m)
Die zehn Aufwärmübungen (Movement Preps)
 Die zehn Aufwärmübungen (Movement Preps) Übung 2: Skorpion Pro Übung 6-15 Wdh. Dann Schwierigkeit erhöhen oder zügigeres Tempo bei sauberer Ausführung.!!SAUBERE AUSFÜHRUNG VOR TEMPO!! Übung 1: Hüftrollen
Die zehn Aufwärmübungen (Movement Preps) Übung 2: Skorpion Pro Übung 6-15 Wdh. Dann Schwierigkeit erhöhen oder zügigeres Tempo bei sauberer Ausführung.!!SAUBERE AUSFÜHRUNG VOR TEMPO!! Übung 1: Hüftrollen
GANZKÖRPER WORKOUT. Deine Dominique Au
 Mit diesem Ganzkörper Workout wird Dein gesamter Körper beansprucht. Der Fokus hierbei, liegt auf den großen Muskelgruppen. Beine, Rücken, Brust und Bauch. Danach wird dein Körper sich wie neugeboren fühlen.
Mit diesem Ganzkörper Workout wird Dein gesamter Körper beansprucht. Der Fokus hierbei, liegt auf den großen Muskelgruppen. Beine, Rücken, Brust und Bauch. Danach wird dein Körper sich wie neugeboren fühlen.
Warm Up Movement Prep by Peak Five Sports FISHERMAN S FRIEND StrongmanRun
 Warm Up: Movement Prep (zur Vorbereitung von Gelenkstrukturen und des Muskelapparates) Definition und Keypoints Durch ein dynamisches Aufwärmen mit Movement Prep Übungen oder sogenannten Flows wird der
Warm Up: Movement Prep (zur Vorbereitung von Gelenkstrukturen und des Muskelapparates) Definition und Keypoints Durch ein dynamisches Aufwärmen mit Movement Prep Übungen oder sogenannten Flows wird der
Die besten Rückenübungen für zu Hause. Der Trainingsplan passend zum Artikel auf Daytraining.de
 Die besten Rückenübungen für zu Hause Der Trainingsplan passend zum Artikel auf Daytraining.de Rückentrainingsplan Das Training für einen starken Rücken und eine stabile Körpermitte muss nicht kompliziert
Die besten Rückenübungen für zu Hause Der Trainingsplan passend zum Artikel auf Daytraining.de Rückentrainingsplan Das Training für einen starken Rücken und eine stabile Körpermitte muss nicht kompliziert
Workout des Monats: Januar
 Workout des Monats: Januar Warm-Up Aufwärmen des Fußgelenkes: Stelle dich auf ein Standbein deiner Wahl Setze dein Spielbein mit der Fußspitze leicht auf den Boden auf Lasse dein Spielbein nun im Kreis
Workout des Monats: Januar Warm-Up Aufwärmen des Fußgelenkes: Stelle dich auf ein Standbein deiner Wahl Setze dein Spielbein mit der Fußspitze leicht auf den Boden auf Lasse dein Spielbein nun im Kreis
DIE FINGERÜBUNGEN VOR DEM KLAVIERSPIELEN SIND DAS LAUF ABC VOR DEM LAUFEN
 DIE FINGERÜBUNGEN VOR DEM KLAVIERSPIELEN SIND DAS LAUF ABC VOR DEM LAUFEN 12. Sportmedizinisches Forum Rhein-Lahn 2018 Tim Gondorf Samstag, 10.März Nastätten - Bürgerhaus WELCHEN ZWECK HAT DAS LAUF ABC?
DIE FINGERÜBUNGEN VOR DEM KLAVIERSPIELEN SIND DAS LAUF ABC VOR DEM LAUFEN 12. Sportmedizinisches Forum Rhein-Lahn 2018 Tim Gondorf Samstag, 10.März Nastätten - Bürgerhaus WELCHEN ZWECK HAT DAS LAUF ABC?
Design Home-Trainer. Wir heißen Sie mit Ihrem neuen Trainingsgerät herzlich willkommen.
 Design Home-Trainer Wir heißen Sie mit Ihrem neuen Trainingsgerät herzlich willkommen. Nachfolgend werden wir Ihnen das Trainingsgerät genauer zeigen. Vorteile auf einen Blick: Prägnant, klares und modernes
Design Home-Trainer Wir heißen Sie mit Ihrem neuen Trainingsgerät herzlich willkommen. Nachfolgend werden wir Ihnen das Trainingsgerät genauer zeigen. Vorteile auf einen Blick: Prägnant, klares und modernes
Auf den nächsten Seiten findest du beispielhafte Übungskombinationen, die deine Fitness verbessern.
 Fussball Seite 1 Grundsätzliches Dienstag, 21. Juli 2015 08:01 Für die allgemeine Kräftigung ist eine gute Bauch- und Rückenmuskulatur besonders wichtig. Nur wenn diese gut trainiert ist, besitzt dein
Fussball Seite 1 Grundsätzliches Dienstag, 21. Juli 2015 08:01 Für die allgemeine Kräftigung ist eine gute Bauch- und Rückenmuskulatur besonders wichtig. Nur wenn diese gut trainiert ist, besitzt dein
Übungen mit dem Theraband für zu Hause (Teil 1) Allgemeine Hinweise zu den Übungen
 Übungen mit dem Theraband für zu Hause (Teil 1) Die Anleitungen aus der Reihe Übungen für zu Hause wurden für die Ambulante Herzgruppe Bad Schönborn e.v. von Carolin Theobald und Katharina Enke erstellt.
Übungen mit dem Theraband für zu Hause (Teil 1) Die Anleitungen aus der Reihe Übungen für zu Hause wurden für die Ambulante Herzgruppe Bad Schönborn e.v. von Carolin Theobald und Katharina Enke erstellt.
Die Top 10 CORE - Übungen
 Die Top 10 CORE - Übungen In den Top 10 unserer Kräftigungs- uns Stabilisationsübungen stellen wir Euch einen kleinen Auszug unseres breiten Übungsangebotes bereit. Durch auf den Athleten individuell angepasste
Die Top 10 CORE - Übungen In den Top 10 unserer Kräftigungs- uns Stabilisationsübungen stellen wir Euch einen kleinen Auszug unseres breiten Übungsangebotes bereit. Durch auf den Athleten individuell angepasste
TECHNIK UND METHODIK SPRINT
 TECHNIK UND METHODIK SPRINT Creative-Commons-Lizenz Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0) Autor: Christian Kirberger 2018 WWW.KNSU.DE Seite 1 Übersicht Einleitung
TECHNIK UND METHODIK SPRINT Creative-Commons-Lizenz Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0) Autor: Christian Kirberger 2018 WWW.KNSU.DE Seite 1 Übersicht Einleitung
Biomechanik. Läuferspezifisch
 Biomechanik Läuferspezifisch Grundlagen der Biomechanik (Sportmechanik) Was ist Biomechanik / Sportmechanik? o Unter Biomechanik versteht man die Mechanik des menschlichen Körpers beim Sporttreiben. o
Biomechanik Läuferspezifisch Grundlagen der Biomechanik (Sportmechanik) Was ist Biomechanik / Sportmechanik? o Unter Biomechanik versteht man die Mechanik des menschlichen Körpers beim Sporttreiben. o
Ergebnisse und Interpretation 54
 Ergebnisse und Interpretation 54 4 Ergebnisse In den Abbildungen 24/4.1 bis 29/4.1 werden die Laktat-Geschwindigkeits-Kurve und die Herzfrequenzwerte der beiden Schwimmgruppen (Männer: n=6, Frauen: n=8)
Ergebnisse und Interpretation 54 4 Ergebnisse In den Abbildungen 24/4.1 bis 29/4.1 werden die Laktat-Geschwindigkeits-Kurve und die Herzfrequenzwerte der beiden Schwimmgruppen (Männer: n=6, Frauen: n=8)
Walking-Trainingsplan
 Walking-Trainingsplan Bevor es losgeht Als Einsteiger besuchen Sie bitte Ihren Hausarzt und besprechen mit ihm, dass Sie nun sportlich aktiv werden möchten. Er wird Sie gut beraten können, worauf Sie aufgrund
Walking-Trainingsplan Bevor es losgeht Als Einsteiger besuchen Sie bitte Ihren Hausarzt und besprechen mit ihm, dass Sie nun sportlich aktiv werden möchten. Er wird Sie gut beraten können, worauf Sie aufgrund
Mobilisations- und Stabilisationstraining im Leistungssport
 Handball-Verband Berlin 14. Februar 2017 Geschäftsstelle Glockenturmstraße 3/5 14053 Berlin Charlottenburg Telefon: 030/89090988 Email: info@hvberlin.de Autorin: Tanja Hackenbroich Mobilisations- und Stabilisationstraining
Handball-Verband Berlin 14. Februar 2017 Geschäftsstelle Glockenturmstraße 3/5 14053 Berlin Charlottenburg Telefon: 030/89090988 Email: info@hvberlin.de Autorin: Tanja Hackenbroich Mobilisations- und Stabilisationstraining
Zusammenfassung der Daten zur Fallstudien Untersuchung des KNEEPFLEXX Geräts
 Zusammenfassung der Daten zur Fallstudien Untersuchung des KNEEPFLEXX Geräts 3. April 21 Protokoll Der Teilnehmer absolvierte zwei Runden Laufbandübungen, bei der ersten das Gerät tragend, die zweite ohne
Zusammenfassung der Daten zur Fallstudien Untersuchung des KNEEPFLEXX Geräts 3. April 21 Protokoll Der Teilnehmer absolvierte zwei Runden Laufbandübungen, bei der ersten das Gerät tragend, die zweite ohne
Krafttraining für Läufer Bereich Oberschenkelmuskulatur
 Krafttraining für Läufer Bereich Oberschenkelmuskulatur Oberschenkelmuskulatur Du stellst dich leicht nach vorne gebeugt auf und hältst dich zum Beispiel an einer Wand fest. Der Fuß des Standbeines stellst
Krafttraining für Läufer Bereich Oberschenkelmuskulatur Oberschenkelmuskulatur Du stellst dich leicht nach vorne gebeugt auf und hältst dich zum Beispiel an einer Wand fest. Der Fuß des Standbeines stellst
Modernes Sprungtraining
 Modernes Sprungtraining 55726 Michael Gruhl Betrachtet man die Gesamtheit der Stützsprünge, so ist festzustellen, daß die Qualität der Sprünge wesentlich von der Qualität des Anlaufes und des Absprunges
Modernes Sprungtraining 55726 Michael Gruhl Betrachtet man die Gesamtheit der Stützsprünge, so ist festzustellen, daß die Qualität der Sprünge wesentlich von der Qualität des Anlaufes und des Absprunges
Übungsziel: Kräftigung der Beinmuskulatur Hauptmuskelgruppe: Hintere und vordere Oberschenkelmuskulatur Übungsziel:
 Kräftigung der Beinmuskulatur Hauptmuskelgruppe: Hintere und vordere Oberschenkelmuskulatur - Wadenmuskulatur, Gesäßmuskulatur Kräftigung der Beinmuskulatur Hauptmuskelgruppe: Hintere Oberschenkelmuskulatur
Kräftigung der Beinmuskulatur Hauptmuskelgruppe: Hintere und vordere Oberschenkelmuskulatur - Wadenmuskulatur, Gesäßmuskulatur Kräftigung der Beinmuskulatur Hauptmuskelgruppe: Hintere Oberschenkelmuskulatur
Wallholz. acti vdis pens.ch. Ausgangsstellung Bewegungsverlauf Endstellung. Quantitative Kriterien Wiederholungen Beweglichkeitsübung.
 25 Wallholz Wiederholungen 15 20 Beweglichkeitsübung Kontinuierliche Bewegung Gesamtzeit der Übung 4 Minuten 25 25 25 Sitz auf Langbank. Beine je seitlich am Boden. Rücken aufgerichtet. Ball auf Langbank
25 Wallholz Wiederholungen 15 20 Beweglichkeitsübung Kontinuierliche Bewegung Gesamtzeit der Übung 4 Minuten 25 25 25 Sitz auf Langbank. Beine je seitlich am Boden. Rücken aufgerichtet. Ball auf Langbank
Das Bett des Fakirs. 9.1 Lernziel Lernweg Analyse 73
 6 Das Bett des Fakirs.1 Lernziel 70.2 Lernweg 70.3 Analyse 73 70 Kapitel Das Bett des Fakirs.1 Lernziel Der Übende soll lernen, 44die Bauch-, Rücken- und Hüftmuskulatur koordiniert zu aktivieren, 44die
6 Das Bett des Fakirs.1 Lernziel 70.2 Lernweg 70.3 Analyse 73 70 Kapitel Das Bett des Fakirs.1 Lernziel Der Übende soll lernen, 44die Bauch-, Rücken- und Hüftmuskulatur koordiniert zu aktivieren, 44die
GANG ABC
 GANG ABC 29.10.2014 1 Vorbereitende Übungen Ausführung ohne Schuhe Ziel: Kräftigung der Unterschenkelmuskulatur + Beinmuskulatur Richtiger Fußaufsatz Bewegungsvorstellung entwickeln Wahrnehmung schulen
GANG ABC 29.10.2014 1 Vorbereitende Übungen Ausführung ohne Schuhe Ziel: Kräftigung der Unterschenkelmuskulatur + Beinmuskulatur Richtiger Fußaufsatz Bewegungsvorstellung entwickeln Wahrnehmung schulen
Das perfekte Gymnastikball Training für Zuhause von GORILLA SPORTS.
 WORK OUT Das perfekte Gymnastikball Training für Zuhause von GORILLA SPORTS https://www.gorillasports.de/gymnastikball5575cm 6 effektive GanzkörperÜbungen mit dem Fitnessball Er ist rund, bunt und überzeugt
WORK OUT Das perfekte Gymnastikball Training für Zuhause von GORILLA SPORTS https://www.gorillasports.de/gymnastikball5575cm 6 effektive GanzkörperÜbungen mit dem Fitnessball Er ist rund, bunt und überzeugt
Wirbelsäulengymnastik mit dem Redondo Ball Plus
 Wirbelsäulengymnastik mit dem Redondo Ball Plus Gabi Fastner, gabs@gabi-fastner.de, www.gabi-fastner.de RückenFit, Wirbelsäulengymnastik, Rückengymnastik, stabiler Rücken,... sind sehr beliebte Kursformate!
Wirbelsäulengymnastik mit dem Redondo Ball Plus Gabi Fastner, gabs@gabi-fastner.de, www.gabi-fastner.de RückenFit, Wirbelsäulengymnastik, Rückengymnastik, stabiler Rücken,... sind sehr beliebte Kursformate!
TECHNIKEN PITCHING TECHNIK. 1. Gewichtsverlagerung und kurzer Schritt nach hinten, um das Standbein in Ausgangsposition zu bringen (Windup).
 TECHNIKEN PITCHING TECHNIK 1. Gewichtsverlagerung und kurzer Schritt nach hinten, um das Standbein in Ausgangsposition zu bringen (Windup). 2. Gewichtsverlagerung auf das Standbein. Das andere Bein schwingt
TECHNIKEN PITCHING TECHNIK 1. Gewichtsverlagerung und kurzer Schritt nach hinten, um das Standbein in Ausgangsposition zu bringen (Windup). 2. Gewichtsverlagerung auf das Standbein. Das andere Bein schwingt
BRUSTBEINBEWEGUNG FEHLERBILDER UND KORREKTURMÖGLICHKEITEN
 BRUSTBEINBEWEGUNG FEHLERBILDER UND KORREKTURMÖGLICHKEITEN Creative-Commons-Lizenz Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0) Autoren: Simon Jung 2018 WWW.KNSU.DE
BRUSTBEINBEWEGUNG FEHLERBILDER UND KORREKTURMÖGLICHKEITEN Creative-Commons-Lizenz Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0) Autoren: Simon Jung 2018 WWW.KNSU.DE
Das Trainingsprogramm «Die 11». Sie fragen wir antworten. Für Trainerinnen und Trainer.
 Das Trainingsprogramm «Die 11». Sie fragen wir antworten. Für Trainerinnen und Trainer. Suva Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Postfach, 6002 Luzern Für Auskünfte: Telefon 041 419 51 11 Für Bestellungen:
Das Trainingsprogramm «Die 11». Sie fragen wir antworten. Für Trainerinnen und Trainer. Suva Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Postfach, 6002 Luzern Für Auskünfte: Telefon 041 419 51 11 Für Bestellungen:
Bodenübung Nachwuchsklasse und Team Turn10 Beschreibung
 Bodenübung Nachwuchsklasse und Team Turn10 Beschreibung Bewegung Kommentar 0 Grätsche; linke Hand hinter dem Rücken; rechte Hand bei linker Schulter; Handgelenk gerade; Ellbogen bis Handgelenk Kopf links
Bodenübung Nachwuchsklasse und Team Turn10 Beschreibung Bewegung Kommentar 0 Grätsche; linke Hand hinter dem Rücken; rechte Hand bei linker Schulter; Handgelenk gerade; Ellbogen bis Handgelenk Kopf links
Kontroll- und Übungsfragen Teil II zur Kursreihe Manuelle Therapie (Stand )
 Kontroll- und Übungsfragen Teil II zur Kursreihe Manuelle Therapie (Stand 09.01.2012) Gelenkmechanik: Richtung des Gleitens der Gelenkflächen Anmerkungen: Die hier beschriebenen Richtungen des Gleitens
Kontroll- und Übungsfragen Teil II zur Kursreihe Manuelle Therapie (Stand 09.01.2012) Gelenkmechanik: Richtung des Gleitens der Gelenkflächen Anmerkungen: Die hier beschriebenen Richtungen des Gleitens
Tourenski oder Schneeschuh?
 HFR sport sport.h-fr.ch sport@h-fr.ch 026 426 89 40 (ab 20. November: 026 306 24 80) Tourenski oder Schneeschuh? Seien Sie bereit der Winter naht! Publikumsvortrag «fokus gesundheit» HFR sport 17. Oktober
HFR sport sport.h-fr.ch sport@h-fr.ch 026 426 89 40 (ab 20. November: 026 306 24 80) Tourenski oder Schneeschuh? Seien Sie bereit der Winter naht! Publikumsvortrag «fokus gesundheit» HFR sport 17. Oktober
Material. Trainingsplan. Walking
 Trainingsplan Walking Trainingsplan Walking Bevor es losgeht Walking ist eine ideale und schonende Sportart, mit der Sie Ausdauer und Figur verbessern können. Sie brauchen keine Hochleistungsschuhe fürs
Trainingsplan Walking Trainingsplan Walking Bevor es losgeht Walking ist eine ideale und schonende Sportart, mit der Sie Ausdauer und Figur verbessern können. Sie brauchen keine Hochleistungsschuhe fürs
PRAXISELEMENTE ABENTEUER- UND ERLEBNISSPORT. Akrobatik
 PRAXISELEMENTE ABENTEUER- UND ERLEBNISSPORT Akrobatik INHALTSANGABE Grundfigur FLIEGER Grundfigur GALIONSFIGUR Grundfigur KNIE-SCHULTER-STAND Grundfigur KNIE-SCHULTERSTAND Grundfigur STUHL Akrobatik Grundfigur
PRAXISELEMENTE ABENTEUER- UND ERLEBNISSPORT Akrobatik INHALTSANGABE Grundfigur FLIEGER Grundfigur GALIONSFIGUR Grundfigur KNIE-SCHULTER-STAND Grundfigur KNIE-SCHULTERSTAND Grundfigur STUHL Akrobatik Grundfigur
Durchbewegen der unteren Extremität zur Kontrakturenprophylaxe
 Durchbewegen der unteren Extremität zur Kontrakturenprophylaxe Kontrakturenprophylaxe untere Extremität Herzlich willkommen zur Schulung! Thema: Dauer: Ziel: Durchbewegen der unteren Extremität zur Kontrakturenprophylaxe
Durchbewegen der unteren Extremität zur Kontrakturenprophylaxe Kontrakturenprophylaxe untere Extremität Herzlich willkommen zur Schulung! Thema: Dauer: Ziel: Durchbewegen der unteren Extremität zur Kontrakturenprophylaxe
Legen Sie sich auf den Rücken. Heben Sie Kopf und Beine und ziehen Sie die Knie vorsichtig so nah wie möglich zur Stirn.
 Mobilisation der geraden Rückenmuskulatur Übung 1: Knien Sie sich hin und stützen Sie sich vorne mit etwas gebeugten Armen ab. Wechseln Sie dann langsam zwischen "Pferderücken" (leichtes Hohlkreuz) und
Mobilisation der geraden Rückenmuskulatur Übung 1: Knien Sie sich hin und stützen Sie sich vorne mit etwas gebeugten Armen ab. Wechseln Sie dann langsam zwischen "Pferderücken" (leichtes Hohlkreuz) und
Station 1 Running. dicke Matte, 4 Gewichte. Holz, Feuer. Die Energie zirkuliert. hüftbreiter Stand auf dem Boden
 Station 1 Running dicke Matte, 4 Gewichte Holz, Feuer. Die Energie zirkuliert. hüftbreiter Stand auf dem Boden Laufe auf der Stelle und ziehe dabei die Knie im Wechsel hoch. Die Ferse drückst du aktiv
Station 1 Running dicke Matte, 4 Gewichte Holz, Feuer. Die Energie zirkuliert. hüftbreiter Stand auf dem Boden Laufe auf der Stelle und ziehe dabei die Knie im Wechsel hoch. Die Ferse drückst du aktiv
Rudertechnisches Leitbild Riemen Ausheben und hintere Bewegungsumkehr
 Rudertechnisches Leitbild Riemen Ausheben und hintere Bewegungsumkehr Nach dem Ausschieben der voll getauchten Blätter erfolgt das senkrechte Ausheben mit anschließendem Flachdrehen der Blätter. Beim Ausheben
Rudertechnisches Leitbild Riemen Ausheben und hintere Bewegungsumkehr Nach dem Ausschieben der voll getauchten Blätter erfolgt das senkrechte Ausheben mit anschließendem Flachdrehen der Blätter. Beim Ausheben
