ZU DEN FUNKTIONEN VON HABEN IM DEUTSCHEN
|
|
|
- Margarete Schenck
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 ZU DEN FUNKTIONEN VON HABEN IM DEUTSCHEN Bogdana CÎRTILĂ Äußerungen wie z.b.: er hat einen Wagen, er hat eine Schwester, er hat Mut, er hat Fieber enthalten alle das Verb haben und eine humane Entität als Subjekt. Ihre abstrakte Tiefenstruktur ist identisch, trotzdem liegen die Sätze semantisch weit auseinander. So wird in der ersten Äußerung dem Subjekt ein materieller Gegenstand als Besitz zugeschrieben, in der zweiten steht das Subjekt in einer bestimmten Verwandtschaftsrelation zu einer anderen humanen Entität, in der dritten kommt eine Charaktereigenschaft des Subjekts zum Ausdruck und in der vierten wird schließlich assertiert, dass ein Wesen sich in einem bestimmten temporären Zustand befindet. Solche Beispiele zeugen eindeutig von einem sehr weiten Bedeutungsspektrum und von einer stark ausgeprägten Polyfunktionalität des Verbs haben in der deutschen Gegenwartssprache. Wie sich im Folgenden zeigen wird, ist haben eher ein Relationsverb, das eine Vielzahl von Relationen zwischen zwei Entitäten ausdrücken kann, prototypischerweise eine Possessivrelation. Der vorliegende Bericht nimmt sich eine systematische und anschauliche Darstellung der lexikalischen Funktionen vom Verb haben sowie eine integrative Behandlung seiner Gebrauchsparadigmen vor. Das Verb haben hat in der Gegenwartssprache Deutsch eine herausragende Stellung wegen seiner unvergleichbaren Funktionsweite. Es ist ein Fall konventionalisierter Grammatikalisierung und deswegen in jeder Grammatik gleich zweimal zu finden. Zum einen kann es die semantische Relation der Possessivität ausdrücken und fungiert dabei als Vollverb, worauf hier ausführlicher eingegangen wird. Zum anderen übt haben auch mehrere grammatische Funktionen aus, was als eine Hilfsverbverwendung zu vereindeutlichen ist. Hier sei an erster Stelle sein Gebrauch als Tempusauxiliar zur Bildung des analytischen Perfekts / Plusquamperfekts / Futurperfekts erwähnt: haben + Partizip II: er hat / hatte gelesen / wird gelesen haben. Syntaktisch homonym mit dem haben-perfekt ist das haben-passiv oder Dativ-Zustandspassiv, das das Zustandspassiv eines bekommen-passivs ausdrückt: die Kirchen haben die Fenster gestrichen, mit der Bedeutung die Fenster der Kirchen sind gestrichen. Als Modalitätsverb dient haben + zu + Infinitiv zum Ausdruck der Notwendigkeit: ich habe das auswendig zu lernen, seltener zum Ausdruck der Möglichkeit: was hast du zu berichten?. Grammatisch feste Verbindungen liegen bei den Funktionsverbgefügen: unter Kontrolle haben, zur Folge haben, zum Ergebnis haben, Ahnung haben oder bei den zahlreichen haben-kollokationen vor: eine Wirkung haben, die Absicht haben, Bedeutung haben, einen Nutzen haben. Alle diese sind Kombinationen aus inhaltsstärkeren, abstrakten Substantiven und dem semantisch neutralisierten haben. Stilistisch sind solche Fügungen zumeist bestimmten Funktionsstile (z.b. dem der Verwaltung) vorbehalten, in denen die kommunikative und sprachliche Genauigkeit und Ökonomie vor Prinzipien der sprachlichen Differenzierung und
2 Variation rangieren (Sowinski 1991: 226). Im Gegenwartsdeutsch kommt das Verb haben auch in vielen idiomatischen Wendungen vor, in denen es eine geschwächte Bedeutung aufweist: etwas hat Hand und Fuß, er hat Köpfchen, einen Kater haben, der hat aber einen Bart!, es in sich haben, ich habe den grünen Daumen, Schwein gehabt, sie hat ein großes Herz, er hat Flausen im Kopf. Das Vollverb haben ist ein transitives, nicht-passivfähiges 1 (daher pseudotransitives) zweiwertiges Zustandsverb, das keine Verlaufsform aufweist (*ich bin am Haben). Semantisch gesehen ist haben das wichtigste und häufigste possessive Verb des Deutschen. Wir haben es hier mit einem hochgradig ambigen und unscharfen Verb zu tun, bei dessen Interpretation vielfältige Möglichkeiten gegeben sind. Das Lexem haben ist sehr vielseitig einsetzbar bei humanem, belebtem oder unbelebtem Possessor, wie bei konkretem oder abstraktem Possessum. Wie es sich im Folgenden zeigen wird, dient es zum Ausdruck der verschiedensten Typen sowohl alienabler (typischerweise) als auch inalienabler Possession (unter bestimmten Bedingungen) und ragt auch weiter über die Domäne der Possession hinaus (Existenz, örtliches Befinden). Das Verb haben etabliert prototypischerweise eine Besitz-Relation bei humanem Possessor und materiellem Possessum. Der Possessor tritt als Satzsubjekt und Prädikationsbasis bzw. Thema und das indefinite, nicht-relationale und nichtbelebte Possessum als Akkusativobjekt bzw. Rhema auf: ich habe einen neuen Wagen, seine Frau hat sehr kostbare Sachen. Bei dieser permanenten alienablen Possession ist das Ersetzen des possessiven Verbs durch besitzen möglich, ja sogar erwünscht zur eindeutigen Klärung der Possessivverhältnisse als Eigentum: ich besitze einen neuen Wagen. Mithilfe von haben wird oft ebenfalls bei humanem Possessor und gegenständlichem Possessum ein bloßes temporäres Nutzungsverhältnis etabliert: er hat einen Wagen, er hat ein Zimmer im Wohnheim, Müllers haben ein Haus zur Miete. In diesem Fall ist die Paraphrase von haben mit dem Verb besitzen ausgeschlossen: er hat ein Auto, aber er besitzt es nicht, es gehört nicht ihm, es ist nur ein Betriebswagen. In Äußerungen wie: hast du den Schlüssel?, hast du Feuer?, ich habe genug Geld dabei geht es um eine rein zufällige momentane und physische Beziehung zwischen einem Menschen und einem Gegenstand. Das Possessum wird nicht dem Possessor zugeschrieben, sondern eher lokal mit ihm assoziiert. Mit der Frage hast du den Schlüssel? wird nicht danach gefragt, ob jemand einen Schlüssel besitzt, sondern ob jemand einen gewissen Schlüssel in der gegebenen Diskurssituation bei sich hat. Zum noch expliziteren Ausdruck steht hier oft eine präpositionale Fügung: ich habe den Schlüssel dabei / mit dabei / bei mir mit der Bedeutung der Schlüssel ist bei mir. Diese lokale Fügung wandelt einen Ausdruck des permanenten Besitzes, der übrigens die prototypische Possessivrelation schlechthin ist, in einen Ausdruck, der eher marginal mit Possession assoziiert wird (Heine 1997: 220). Die syntaktisch komplexere Konstruktion vermittelt, dass ein Possessum, das nicht inhärent zu einem humanen Possessor gehört und auch nicht notwendigerweise dessen Besitztum ist, sich eher rein zufällig und momentan an diesem befindet.
3 Die Lokalität des Possessors stimmt vorübergehend mit der des Possessums überein. An dieser Stelle soll noch darauf hingewiesen werden, dass ein Definitartikel beim Possessum steht. So ist z.b. sie hat ein Auto als Ausdruck eines Besitzverhältnisses zu verstehen im Sinne von sie besitzt ein Auto, wobei sie hat das Auto als akzidentielle, physische Beziehung gedeutet wird im Sinne von das Auto befindet sich bei ihr. Zu den Verben der akzidentiellen Possession sind neben der entsprechenden Lesart von haben auch verbale Fügungen wie: über etwas verfügen, zur Verfügung haben zu zählen: sie hat das Auto zur Verfügung. Zu all den bisher besprochenen Gebrauchssituationen des Verbs haben muss noch gesagt werden, dass eine Unterscheidung von Besitz im engen Sinne, Verfügung und akzidentieller Possession nicht ohne weiter ergänzenden Kontext möglich ist: er hat Geld ( er ist reich ) vs. er hat Geld ( er hat Geld zur Verfügung ). Bei einem Abstraktum mit Nullartikel als Possessum drückt haben temporäre physische: er hat Hunger / Durst / Angst / Fieber / Schnupfen oder psychisch-mentale Zustände aus: er hat Probleme / Glück / Langeweile / Freude / Spaß. Hier geht es nicht um die Zuschreibung eines Besitzes an einen Possessor. Solche Konstruktionen besagen eher, dass sich eine Entität in einem gewissen Zustand befindet, weshalb sie nicht von allen Linguisten zur Possession gezählt werden (Herslund/Baron 2001: 3). Es ist eine abstrakte Possession, in der der Possessor zugleich auch als Experiencer fungiert. Dass wir uns mit diesen Äußerungen an der Peripherie der Domäne der Possession befinden, beweist auch die hier oft mögliche Umschreibung mit sein und einem vom abstraktem Nomen abgeleiteten Adjektiv: er ist durstig / ängstlich / glücklich / gelangweilt. Das Gebrauchsfeld des Verbs haben beschränkt sich im Deutschen nicht nur auf die alienable Possession. Alienable und inalienable haben-prädikationen weisen dieselbe Struktur auf, wobei der wesentliche Unterschied in der internen Struktur des Possesum Nomens liegt. Hier fällt der Zugriff auf den weiteren Kontext zur Disambiguierung der possessiven Beziehung aus, da das relationale Possessum-Nomen den nötigen Hinweis dafür darstellt. Ist der Possessor belebt, lässt er sowohl belebte als auch unbelebte Possessa zu. Wenn diesem Possessor ein humanes Possessum zugeschrieben wird, drückt der Satz fakultative Verwandtschaftsbeziehungen: er hat eine Tochter / eine Schwester oder soziale zwischenmenschliche Beziehungen aus: er hat einen Freund / einen netten Arbeitskollegen. Falls der Possessor ein unbelebtes Konkretum ist und ihm auch ein unbelebtes Konkretum als Possessum zugeschrieben wird, drückt der Satz eine Teil-Ganzes-: das Auto hat ein Airbag, der Tisch hat vier Beine oder eine Zugehörigkeitsrelation aus: das Haus hat einen Balkon. Der Hund hat eine Hundehütte zeigt eine possessive Relation bei einem nicht-humanen aber belebten Possessor. Hat der Possessor das semantische Merkmal [+INSTITUTION], drückt der Satz die Zugehörigkeitsrelation aus, unabhängig davon, ob das Possessum belebt ist: unsere Stadt hat über Einwohner oder nicht: unsere Stadt hat ein historisches Museum.
4 Äußerungen mit dem Verb haben und einem relationalen Nomen wie z. B.: jeder Mensch hat einen Vater und eine Mutter, ein Haus hat eine Tür, ein Vogel hat zwei Flügel, ein Kilo hat 1000 Gramm können als All-Aussagen oder - prinzipien interpretiert werden, wenn der Possessor indefinit ist. Ist das Subjekt der haben-konstruktion eine Maßeinheit, muss das Objekt auch eine sein wie im letzten Beispiel (Clasen 1981: 28). In diesem Fall werden diese All-Aussagen oder -prinzipien immer im Präsens ausgedrückt. Obwohl in der Regel dem Ganzen nicht ein Teil dessen durch haben zugeschrieben werden kann, ist das durchaus möglich, wenn der Teil über spezielle Eigenschaften in der Form eines adjektivischen Attributs verfügt: *der Wagen hat Türen vs. der Wagen hat zwei / rote / beschädigte Türen, *er hat eine Zunge vs. er hat eine scharfe / lose / böse Zunge. Ein abstraktes Possessum kann sowohl bei einem belebten: er hat Mut, die Studierenden haben solide Kenntnisse als auch bei einem unbelebten Possessor auftreten: dieses Buch hat ein Alter von über 100 Jahren (Heine 1997: 155). In solchen Äußerungen wird das Possessum eher als permanentes eigenes Merkmal des Possessors und weniger als dessen Possession gedeutet. Das Referenzobjekt ist oft ein Derivat eines Adjektivs: Größe, Höhe, Fläche. Dasselbe Lexem haben wird im Deutschen auch für den Sonderfall Verfügung bei thematischem Subjekt mit lokalem Rahmen verwendet. Die Umschreibung mit es gibt oder sein ist für alle Beispielsätze möglich: hast du Gift in deinem Laboratorium? ( gibt es Gift in deinem Laboratorium? ), er hat einen Pickel im Gesicht / ein Muttermal am rechten Oberarm, wir haben viele Hasen in der Gegend. Solche Äußerungen mit haben und einer obligatorischen präpositionalen Lokalergänzung sind in der Regel keine Possessivkonstruktionen (Gerstl 1994: 61). Sie vermitteln primär eine räumliche Relation zwischen dem direkten Objekt und der Lokalergänzung. Nur sekundär wird auch eine Possessivrelation ausgedrückt. Dies ist jedoch im allgemeinen sehr stark von kontextuellen Faktoren abhängig. Umgangssprachlich kann noch der Infinitiv von stehen, liegen, sitzen hinzutreten: wir haben den neuen Teppich im Flur liegen, wo habt ihr das Auto stehen?, er hat das Kind bei sich auf den Schultern sitzen. Das Verb haben ermöglicht hier eine syntaktische Struktur mit einem belebten Wesen als Subjekt, obwohl der Sachverhalt selbst sich auf die statische räumliche Positionierung eines Gegenstandes bezieht. Das possessive Verb tritt in seiner Funktion als sein-substitutor auf. Eine Behauptung über einen Gegenstand, der in ein Zugehörigkeitsverhältnis zu einer Person steht, wird in eine haben-äußerung umformuliert mit dem Possessor in topikalisierter Subjektsposition. Haben wird zu einem sprachlichen Mittel, das dem Ausdruck der Personenprominenz in den europäischen Sprachen und auch im Deutschen dient, in mehr oder weniger grammatikalisierten Strukturen, was noch ein zusätzliches Argument für die anthropozentrische Perspektivierung im europäischen Sprachraum ist. Zahlreiche unterschiedliche haben-kollokationen eher umgangssprachlichen Charakters bezeichnen eine Relation zwischen Menschen und für sie relevante Situationen, z. B. bei Temporal- und Wetterangaben: wir haben schönes Wetter,
5 35, Dauerregen, Sturm, Weihnachten, den 11. April, 11 Uhr usw. Oft wird hier die Existenz in einem temporalen Rahmen ausgedrückt, daher auch die mögliche Paraphrasierung mit sein. In einer typischen Existenzprädikation fungiert das unpersönliche es (es ist, es gibt) als grammatisches Subjekt. In einer haben- Konstruktion zum Ausdruck der Existenz aber steht ein persönliches, humanes Nomen oder Pronomen in der Position und Rolle des Satzsubjekts. Hier ist wiederum die Tendenz des Deutschen zu erkennen, der empathischen Entität in einer Äußerung die syntaktische Funktion des Subjekts und die Rolle der Prädikationsbasis zuzuweisen. Im süddeutschen Sprachraum kann das grammatikalisierte unpersönliche haben eine Existenzprädikation ausdrücken: es hat mit der Bedeutung es ist, es gibt : es hat Regen / 20 Grad, in der Schweiz hat es hohe Berge, am Berg hat s Schnee. Ebenfalls außerhalb der Domäne der Possession befindet sich der eindeutig umgangssprachliche, aber häufige Gebrauch von haben zum Ausdruck einer Aufforderung: kann ich bitte noch einen Kaffee haben?, kann ich den auch in weiß haben?, ich möchte das Bier kalt haben, ich brauche dieses Wörterbuch nicht mehr, aber du kannst es gerne haben, im Sinne von ich möchte, ich bekomme. Diese möglicherweise noch nicht einmal vollständige Aufzählung der wichtigsten Gebrauchsparadigmen von haben verdeutlicht aber eindeutig, welch hoher Grad an Ambiguität und Unschärfe in einem so häufig verwendeten Verb steckt (Herslund/Baron 2001: 3, Bach 1967: 476f). Eben wegen dieser stark ausgeprägten Polyfunktionalität des Verbs haben gehen die Meinungen der Linguisten dazu weit auseinander. Es ist noch nicht klar festgelegt worden, ob es sich um eine lexikalische Einheit oder eher um ein funktionales Element handelt. Oder welches die gemeinsame semantische Basis für die unterschiedlichen possessiven und nicht-posessiven (existentiellen, lokativen, perfektiven, modalen) haben-konstruktionen ist. Der Ausdruck der Possession auf Satzebene ist schon lange nicht der einzige Anwendungsbereich von haben. Nur zu behaupten, dass es ein transitives Verb wie jedes andere ist, das den zwei Partizipanten die thematischen Rollen eines Possessors und eines Possessums zuordnet, wäre stark vereinfachend. Mit so einem universalen haben-verb kann man im Deutschen von einem Abbauprozess hinsichtlich der Differenzierung der Possessionsarten sprechen. Die anderen possessiven Verben sind von der Gebrauchsfrequenz her ziemlich selten, verfügen aber dafür über ein enges, sehr spezialisiertes Bedeutungsspektrum und werden immer mehr von haben verdrängt. Es zeigt sich somit eine eindeutige Tendenz zur Reduktion der Vielfalt der possessiven Verben und eine Generalisierung des Gebrauchs von haben. Dieses weist das breiteste Distributionsspektrum unter den Possessionrelatoren auf und ist ein semantisch leeres Verb, das ein undefiniertes possessives Verhältnis zwischen zwei Entitäten herstellt. Das ursprüngliche Tätigkeitsverb mit der Bedeutung halten, anfassen, nehmen dient dem Ausdruck der Possession, also einem Zustand. Daher pseudo-
6 transitiv oder, moderner ausgedrückt, es stellt kein prototypisches transitives Verb dar. Haben tritt in einer Agens-Patiens syntaktischen Konfiguration auf. Eine prototypische transitive Situation setzt folgendes voraus: ein Agens, das eine gezielte, aktive und kontrollierte Handlung an einem Patiens ausübt und ein Patiens, das von der Handlung des Agens affiziert ist. Hier kann sehr deutlich ein Ikonizitätsprinzip erkannt werden: weder semantisch noch syntaktisch ist haben ein prototypisches Transitivverb. Eine nicht-prototypische Konzeptualisierung als transitives Verb, das den Partizipanten die semantischen Rollen Possessor und Possessum zuweist und eine statische Relation zwischen zwei Nomen ausdrückt, geht mit einem nicht-prototypischen syntaktischen Verhalten einher. Eine syntaktische Transitivität kann im Falle von haben schon festgestellt werden: es gibt ein Subjekt und ein Akkusativobjekt, allerdings ist die Passivtransformation blockiert. Von semantischer Transitivität kann hier keine Spur erkannt werden. In eine allgegenwärtige, unmarkierte syntaktische Transitivstruktur wird ein völlig untypischer semantischer Inhalt eingequetscht. NOTE 1 Haben ist nicht passivfähig, weil es ein umgekehrtes sein ist. Hier wird das Subjekt und nicht das Objekt effiziert. Nur in der Sekundärbedeutung dominieren, beherrschen kann man sagen: er ist von seiner Eifersucht / der Arbeit besessen, er ist ein Besessener. BIBLIOGRAPHIE Bach, Emon, Have and Be in English Syntax, in Language 43, 1967, S (Bach 1967) Clark, Eve, Locationals: Existential, Locative and Possessive Constructions, in Universals of Human Language, Greenberg, Joseph H. (ed.), vol. 4 Syntax, Stanford University Press, California, 1978, S Clasen, Bernd, Inhärenz und Etablierung, akup 41, Köln, Institut für Sprachwissenschaft, (Clasen 1981) Gerstl, Peter, Die Berechnung von Wortbedeutung in Sprachverarbeitungsprozessen Possessivkonstruktionen als Vermittler konzeptueller Information, Dissertationsschrift, (Gerstl 1994) Heine, Bernd, Possession. Cognitive Sources, Forces, and Grammaticalization, Cambridge University Press, (Heine 1997) Herslund, Michael, Baron, Irène, Dimensions of Possession, in Baron, I., Herslund, M., Sorensen, F. (ed.), Dimensions of Possession, Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, Typological Studies in Language, vol. 47, 2001, S (Herslund/Baron 2001) Koch, Peter, Haben und Sein im romanisch-deutschen und im innerromanischen Sprachvergleich, in Studien zum romanisch-deutschen Sprachvergleich, Rovere, G. / Wotjak, G. (Hrsg.), Tübingen, Niemeyer, Linguistische Arbeiten 297, 1993, S
7 Lehmann, Christian, Possession in Yucatec Maya. Structures Functions Typology, second, revised edition, Arbeitspapiere des Seminars für Sprachwissenschaft der Universität Erfurt (ASSidUE, 10), Schumacher, Helmut (Hrsg.), Verben in Feldern. Valenzwörterbuch zur Syntax und Semantik deutscher Verben, Berlin / New York, W. de Gruyter, Seiler, Hansjakob, Possession as an Operational Dimension of Language, Tübingen, G. Narr, Language Universals Series, volume 2, Sowinski, Bernhard, Deutsche Stilistik. Beobachtungen zur Sprachverwendung und Sprachgestaltung im Deutschen, Frankfurt am Main, Fischer, (Sowinski 1991) ABSTRACT The goal of this article is to give a detailed description of the lexical functions of the verb haben in present-day German. The semantic analysis points out numerous and quite different uses, ranging from alienable to inalienable possession, but also covering non-possessive cognitive domains such as existence and location. The verb proves to establish ultimately a relationship between two discourse participants. Syntactically, it is a transitive, but non-agentive structure, in which the human being is coded in topical position as the grammatical subject of the sentence. Key words: haben, predicative possession, atypical transitive structure
Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache
 Karl-Ernst Sommerfeldt / Günter Starke Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache 3., neu bearbeitete Auflage unter Mitwirkung von Werner Hackel Max Niemeyer Verlag Tübingen 1998 Inhaltsverzeichnis
Karl-Ernst Sommerfeldt / Günter Starke Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache 3., neu bearbeitete Auflage unter Mitwirkung von Werner Hackel Max Niemeyer Verlag Tübingen 1998 Inhaltsverzeichnis
UBUNGS- GRAMMATIK DEUTSCH
 GERHARD HELBIG JOACHIM BUSCHA UBUNGS- GRAMMATIK DEUTSCH Langenscheidt Berlin München Wien Zürich New York SYSTEMATISCHE INHALTSÜBERSICHT VORWORT Übung Seite ÜBUNGSTEIL FORMENBESTAND UND EINTEILUNG DER
GERHARD HELBIG JOACHIM BUSCHA UBUNGS- GRAMMATIK DEUTSCH Langenscheidt Berlin München Wien Zürich New York SYSTEMATISCHE INHALTSÜBERSICHT VORWORT Übung Seite ÜBUNGSTEIL FORMENBESTAND UND EINTEILUNG DER
Grammatikanalyse. Prof. Dr. John Peterson. Sprechstunde: Montags, 14:30-15:30h Raum LS10/Raum 425. Sommersemester 2015 Donnerstags, 14:15h-15:45h
 Grammatikanalyse Sommersemester 2015 Donnerstags, 14:15h-15:45h Prof. Dr. John Peterson Sprechstunde: Montags, 14:30-15:30h Raum LS10/Raum 425 1 Termin Thema 16.4. Einführung Zerlegung des Satzes in seine
Grammatikanalyse Sommersemester 2015 Donnerstags, 14:15h-15:45h Prof. Dr. John Peterson Sprechstunde: Montags, 14:30-15:30h Raum LS10/Raum 425 1 Termin Thema 16.4. Einführung Zerlegung des Satzes in seine
Kapitel 5 von Deutsche Syntax: Ein Arbeitsbuch (Pittner, Karin & Berman, Judith)
 Kapitel 5 von Deutsche Syntax: Ein Arbeitsbuch (Pittner, Karin & Berman, Judith) Introdução à Linguística Alemã I Profª. Drª. Maria Helena Voorsluys Battaglia Beatriz Ayres Santos (8573011) Lucas B. M.
Kapitel 5 von Deutsche Syntax: Ein Arbeitsbuch (Pittner, Karin & Berman, Judith) Introdução à Linguística Alemã I Profª. Drª. Maria Helena Voorsluys Battaglia Beatriz Ayres Santos (8573011) Lucas B. M.
Welche Geschichte verspricht versprechen zu versprechen?
 Welche Geschichte verspricht versprechen zu versprechen? Łukasz Jędrzejowski l.jedrzejowski@uni-koeln.de 29. Juni 2017 HS: Das Verb in der deutschen Sprachgeschichte 29.06.17 1 Worum geht es? Ausgangsbeobachtung:
Welche Geschichte verspricht versprechen zu versprechen? Łukasz Jędrzejowski l.jedrzejowski@uni-koeln.de 29. Juni 2017 HS: Das Verb in der deutschen Sprachgeschichte 29.06.17 1 Worum geht es? Ausgangsbeobachtung:
Morphologische Merkmale. Merkmale Merkmale in der Linguistik Merkmale in der Morpholgie Morphologische Typologie Morphologische Modelle
 Morphologische Merkmale Merkmale Merkmale in der Linguistik Merkmale in der Morpholgie Morphologische Typologie Morphologische Modelle Merkmale Das Wort 'Merkmal' ' bedeutet im Prinzip soviel wie 'Eigenschaft'
Morphologische Merkmale Merkmale Merkmale in der Linguistik Merkmale in der Morpholgie Morphologische Typologie Morphologische Modelle Merkmale Das Wort 'Merkmal' ' bedeutet im Prinzip soviel wie 'Eigenschaft'
SATZGLIEDER UND WORTARTEN
 SATZGLIEDER UND WORTARTEN 1. SATZGLIEDER Was ist ein Satzglied? Ein Satzglied ist ein Bestandteil eines Satzes, welches nur als ganzes verschoben werden kann. Beispiel: Hans schreibt einen Brief an den
SATZGLIEDER UND WORTARTEN 1. SATZGLIEDER Was ist ein Satzglied? Ein Satzglied ist ein Bestandteil eines Satzes, welches nur als ganzes verschoben werden kann. Beispiel: Hans schreibt einen Brief an den
Sprachprüfung (24 Punkte)
 Berufsmittelschulen des Kantons Zürich Aufnahmeprüfung 00 DEUTSCH Sprachprüfung (4 Punkte) () Jedenfalls ist sie zur Verabredung gekommen, Mischa fiel ein Stein vom Herzen, er hat in die Tasche gegriffen
Berufsmittelschulen des Kantons Zürich Aufnahmeprüfung 00 DEUTSCH Sprachprüfung (4 Punkte) () Jedenfalls ist sie zur Verabredung gekommen, Mischa fiel ein Stein vom Herzen, er hat in die Tasche gegriffen
Lexikalische Semantik. Was ist ein Wort? Was ist in einem Wort?
 Lexikalische Semantik Was ist ein Wort? Was ist in einem Wort? Was ist ein Wort? Er machte nicht viele Wörter. Deine Wörter in Gottes Ohr! Ich stehe zu meinen Wörtern Ein Essay von 4000 Worten Im Deutschen
Lexikalische Semantik Was ist ein Wort? Was ist in einem Wort? Was ist ein Wort? Er machte nicht viele Wörter. Deine Wörter in Gottes Ohr! Ich stehe zu meinen Wörtern Ein Essay von 4000 Worten Im Deutschen
Die Grammatikalisierungsparameter am Beispiel der Modalverben. Grammatikalisierung. Modalverben. Sprachhistorische Aspekte
 Grammatikalisierung Hauptseminar WS 2004/05 Prof. Karin Pittner Die Grammatikalisierungsparameter am Beispiel der Modalverben Modalverben dürfen können mögen müssen sollen Wollen 2 verschiedene Modalverbsysteme
Grammatikalisierung Hauptseminar WS 2004/05 Prof. Karin Pittner Die Grammatikalisierungsparameter am Beispiel der Modalverben Modalverben dürfen können mögen müssen sollen Wollen 2 verschiedene Modalverbsysteme
Proseminar Syntax. Diana Schackow
 Proseminar Syntax Diana Schackow 1 Fahrplan Inhalt: Analyse syntaktischer Strukturen deskriptive Perspektive, typologische Vielfalt Vergleich verschiedener theoretischer Ansätze 2 Fahrplan Voraussetzungen:
Proseminar Syntax Diana Schackow 1 Fahrplan Inhalt: Analyse syntaktischer Strukturen deskriptive Perspektive, typologische Vielfalt Vergleich verschiedener theoretischer Ansätze 2 Fahrplan Voraussetzungen:
Vertiefung der Grundlagen der Computerlinguistik. Semesterüberblick und Einführung zur Dependenz. Robert Zangenfeind
 Vertiefung der Grundlagen der Computerlinguistik Semesterüberblick und Einführung zur Dependenz Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 17.10.2017 Zangenfeind:
Vertiefung der Grundlagen der Computerlinguistik Semesterüberblick und Einführung zur Dependenz Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 17.10.2017 Zangenfeind:
Das Aktantenpotenzial beschreibt die Möglichkeit eines Verbs andere Wörter an
 1 2 Das Aktantenpotenzial beschreibt die Möglichkeit eines Verbs andere Wörter an sich zu binden, nämlich die Aktanten. Aktant ist demzufolge ein Begriff, der für die Valenzpartner eines Verbs auf der
1 2 Das Aktantenpotenzial beschreibt die Möglichkeit eines Verbs andere Wörter an sich zu binden, nämlich die Aktanten. Aktant ist demzufolge ein Begriff, der für die Valenzpartner eines Verbs auf der
Deutsch als Fremdsprache. Übungsgrammatik für die Grundstufe
 Deutsch als Fremdsprache Übungsgrammatik für die Grundstufe Inhalt Vorwort 5 Abkürzungen 6 A Verben 7 1. Grundverben 8 1.1 haben sein werden 8 1.2 Modalverben 11 2. Tempora 19 2.1 Präsens 19 2.2 Perfekt
Deutsch als Fremdsprache Übungsgrammatik für die Grundstufe Inhalt Vorwort 5 Abkürzungen 6 A Verben 7 1. Grundverben 8 1.1 haben sein werden 8 1.2 Modalverben 11 2. Tempora 19 2.1 Präsens 19 2.2 Perfekt
Satzstruktur und Wortstellung im Deutschen
 Hauptstudium-Linguistik: Syntaxtheorie (DGA 32) WS 2016-17 / A. Tsokoglou Satzstruktur und Wortstellung im Deutschen 2. Satzstruktur und Wortstellung in den deskriptiven Grammatiken Relativ freie Wortstellung
Hauptstudium-Linguistik: Syntaxtheorie (DGA 32) WS 2016-17 / A. Tsokoglou Satzstruktur und Wortstellung im Deutschen 2. Satzstruktur und Wortstellung in den deskriptiven Grammatiken Relativ freie Wortstellung
Semantik. Anke Himmelreich Prädikation und verbale Bedeutung. Universität Leipzig, Institut für Linguistik
 1 / 42 Semantik Prädikation und verbale Bedeutung Anke Himmelreich anke.assmann@uni-leipzig.de Universität Leipzig, Institut für Linguistik 11.05.2017 2 / 42 Inhaltsverzeichnis 4 Nomen und Adjektive 1
1 / 42 Semantik Prädikation und verbale Bedeutung Anke Himmelreich anke.assmann@uni-leipzig.de Universität Leipzig, Institut für Linguistik 11.05.2017 2 / 42 Inhaltsverzeichnis 4 Nomen und Adjektive 1
Teil II: Phrasen und Phrasenstruktur
 Teil II: Phrasen und Phrasenstruktur Übersicht: Grammatische Funktionen Kategorien Konstituenten & Strukturbäume Konstituententest Endozentrizität 1 Einfacher Satzbau Drei allgemeine Grundfragen der Syntax:
Teil II: Phrasen und Phrasenstruktur Übersicht: Grammatische Funktionen Kategorien Konstituenten & Strukturbäume Konstituententest Endozentrizität 1 Einfacher Satzbau Drei allgemeine Grundfragen der Syntax:
Relationen zwischen Nomen und ihren Assoziationen. Michael Roth
 Relationen zwischen Nomen und ihren Assoziationen Michael Roth 2 Assoziationen sind psychologisch interessant. Wie erfolgt der Zugriff auf sie? Welche Bedeutung haben sie? erfüllen einen linguistischen
Relationen zwischen Nomen und ihren Assoziationen Michael Roth 2 Assoziationen sind psychologisch interessant. Wie erfolgt der Zugriff auf sie? Welche Bedeutung haben sie? erfüllen einen linguistischen
Vorwort. 1. Syntax und Semantik
 Vorwort 1. Syntax und Semantik 1.1. Struktur und Funktion 1.1.1. Nur formal bestimmte Relationen 1.1.2. Formal bestimmte und semantisch interpretierbare Relationen 1.1.3. Semantische Relationen ohne formalsyntaktische
Vorwort 1. Syntax und Semantik 1.1. Struktur und Funktion 1.1.1. Nur formal bestimmte Relationen 1.1.2. Formal bestimmte und semantisch interpretierbare Relationen 1.1.3. Semantische Relationen ohne formalsyntaktische
1 Darstellung von Modalverben in einschlägigen Grammatiken am Beispiel von Eisenberg (1989) und Engel (1988)
 Textmuster Daniel Händel 2003-2015 (daniel.haendel@rub.de) 1 5 1 Darstellung von Modalverben in einschlägigen Grammatiken am Beispiel von Eisenberg (1989) und Engel (1988) Zur Klassifizierung beziehungsweise
Textmuster Daniel Händel 2003-2015 (daniel.haendel@rub.de) 1 5 1 Darstellung von Modalverben in einschlägigen Grammatiken am Beispiel von Eisenberg (1989) und Engel (1988) Zur Klassifizierung beziehungsweise
Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft
 University of Vechta Universität Vechta Prof. Dr. J. A. Bär Fakultät III Germanistische Sprachwissenschaft Vorlesung Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft Sitzung 9: Semantik II Zur Erinnerung:
University of Vechta Universität Vechta Prof. Dr. J. A. Bär Fakultät III Germanistische Sprachwissenschaft Vorlesung Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft Sitzung 9: Semantik II Zur Erinnerung:
Rolle der Input und Korrektur beim Spracherwerb. Liudmyla Liakhova
 Rolle der Input und Korrektur beim Spracherwerb Liudmyla Liakhova Gliederung Einleitung Das Problem von Ursache und Wirkung im Spracherwerb. Die Instruktionshypohese. Form und Funktion korrektiver Rückmeldung.
Rolle der Input und Korrektur beim Spracherwerb Liudmyla Liakhova Gliederung Einleitung Das Problem von Ursache und Wirkung im Spracherwerb. Die Instruktionshypohese. Form und Funktion korrektiver Rückmeldung.
GÜNTHER ÖLSCHLÄGER 3.3 MEHRDEUTIGKEIT SPRACHLICHER AUSDRÜCKE
 1 GÜNTHER ÖLSCHLÄGER 3.3 MEHRDEUTIGKEIT SPRACHLICHER AUSDRÜCKE MEHRDEUTIGKEIT SPRACHLICHER AUSDRÜCKE 2 GLIEDERUNG Vermeintliche Mehrdeutigkeit im Alltag Vagheit Ambiguität - Übersicht Kompositional Lexikalisch
1 GÜNTHER ÖLSCHLÄGER 3.3 MEHRDEUTIGKEIT SPRACHLICHER AUSDRÜCKE MEHRDEUTIGKEIT SPRACHLICHER AUSDRÜCKE 2 GLIEDERUNG Vermeintliche Mehrdeutigkeit im Alltag Vagheit Ambiguität - Übersicht Kompositional Lexikalisch
Grammatik des Standarddeutschen III. Michael Schecker
 Grammatik des Standarddeutschen III Michael Schecker Einführung und Grundlagen Nominalgruppen Nomina Artikel Attribute Pronomina Kasus (Subjekte und Objekte, Diathese) Verbalgruppen Valenz und Argumente
Grammatik des Standarddeutschen III Michael Schecker Einführung und Grundlagen Nominalgruppen Nomina Artikel Attribute Pronomina Kasus (Subjekte und Objekte, Diathese) Verbalgruppen Valenz und Argumente
Vollständige Liste mit Könnens-Standards zur Erstellung didaktischer Analysen
 @ 8005-21, Seite 1 Vollständige Liste mit Könnens-Standards zur Erstellung didaktischer Analysen Abschnitt 1 (allgemeine Lernvoraussetzungen) Die Lerner kennen die Eigennamen, können die Personen auf Abbildungen
@ 8005-21, Seite 1 Vollständige Liste mit Könnens-Standards zur Erstellung didaktischer Analysen Abschnitt 1 (allgemeine Lernvoraussetzungen) Die Lerner kennen die Eigennamen, können die Personen auf Abbildungen
Terminus Sprache, Phonologie und Grammatik
 Terminus Sprache, Phonologie und Grammatik Terminus Sprache Beinhaltet 4 verschiedene Bedeutungen Langage: menschliche Fähigkeit Langue: eine bestimmte Sprache, Untersuchungsgebiet der Linguistik Parole:
Terminus Sprache, Phonologie und Grammatik Terminus Sprache Beinhaltet 4 verschiedene Bedeutungen Langage: menschliche Fähigkeit Langue: eine bestimmte Sprache, Untersuchungsgebiet der Linguistik Parole:
ENGLISCHER SPRACHGEBRAUCH UND ENGLISCHE SCHULGRAMMATIK
 ENGLISCHER SPRACHGEBRAUCH UND ENGLISCHE SCHULGRAMMATIK i Beobachtungen und Ergänzungen von FRITZ FIEDLER LANGENSCHEIDT BERLIN MÜNCHEN ZÜRICH INHALTSVERZEICHNIS Seite Geleitwort 5 Vorwort 7 Inhaltsverzeichnis
ENGLISCHER SPRACHGEBRAUCH UND ENGLISCHE SCHULGRAMMATIK i Beobachtungen und Ergänzungen von FRITZ FIEDLER LANGENSCHEIDT BERLIN MÜNCHEN ZÜRICH INHALTSVERZEICHNIS Seite Geleitwort 5 Vorwort 7 Inhaltsverzeichnis
.««JüetlCa.Jjyad Übungsbuch der deutschen Grammatik
 Dreyer Schmitt.««JüetlCa.Jjyad Übungsbuch der deutschen Grammatik Neubearbeitung Verlag für Deutsch Inhaltsverzeichnis Teil I < 1 Deklination des Substantivs I 9 Artikel im Singular 9 I Artikel im Plural
Dreyer Schmitt.««JüetlCa.Jjyad Übungsbuch der deutschen Grammatik Neubearbeitung Verlag für Deutsch Inhaltsverzeichnis Teil I < 1 Deklination des Substantivs I 9 Artikel im Singular 9 I Artikel im Plural
3.1.2 Der Beitrag von Wortarten für die Sprachbeschreibung Bisherige Forschungsarbeiten und ihre Anwendung auf das Kreolische...
 Inhaltsverzeichnis 1. Mauritius und das Kreolische auf Mauritius... 13 1.1 Landeskundlicher Teil ein Vorwort... 13 1.2 Zu Geographie, Bevölkerungsgruppen und Sprachen auf Mauritius... 14 1.3 Definition:
Inhaltsverzeichnis 1. Mauritius und das Kreolische auf Mauritius... 13 1.1 Landeskundlicher Teil ein Vorwort... 13 1.2 Zu Geographie, Bevölkerungsgruppen und Sprachen auf Mauritius... 14 1.3 Definition:
Deutsche Wortbildung in Grundzügen
 Wolfgang Motsch Deutsche Wortbildung in Grundzügen wde G Walter de Gruyter Berlin New York 1999 INHALT Vorwort xi Kapitel 1: Grundlagen 1. Der allgemeine Rahmen 1 2. Lexikoneintragungen 3 3. Wortbildungsmuster
Wolfgang Motsch Deutsche Wortbildung in Grundzügen wde G Walter de Gruyter Berlin New York 1999 INHALT Vorwort xi Kapitel 1: Grundlagen 1. Der allgemeine Rahmen 1 2. Lexikoneintragungen 3 3. Wortbildungsmuster
Dreyer Schmitt. Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatil< Hueber Verlag
 Hilke Richard Dreyer Schmitt Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatil< Hueber Verlag Inhaltsverzeichnis Teil I 9 13 Transitive und intransitive Verben, die schwer zu unterscheiden sind 75 1 Deklination
Hilke Richard Dreyer Schmitt Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatil< Hueber Verlag Inhaltsverzeichnis Teil I 9 13 Transitive und intransitive Verben, die schwer zu unterscheiden sind 75 1 Deklination
Syntax. Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI
 Syntax Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI Traditionale Syntaxanalyse Was ist ein Satz? Syntax: ein System von Regeln, nach denen aus einem Grundinventar kleinerer Einheiten (Wörter und Wortgruppen)
Syntax Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI Traditionale Syntaxanalyse Was ist ein Satz? Syntax: ein System von Regeln, nach denen aus einem Grundinventar kleinerer Einheiten (Wörter und Wortgruppen)
H A U S A R B E I T Analyse zweier Sätze hinsichtlich syntaktischer und semantischer Valenz (Abgabedatum: 28. Juni 2005)
 Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg Institut für deutsche Philologie: Lehrstuhl für deutsche Sprachwissenschaft Sprachwissenschaftliches Seminar 2 Dozentin: Dr. Sabine Krämer-Neubert Sommersemester
Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg Institut für deutsche Philologie: Lehrstuhl für deutsche Sprachwissenschaft Sprachwissenschaftliches Seminar 2 Dozentin: Dr. Sabine Krämer-Neubert Sommersemester
5 Die Gegenwart a Das simple present b Das present progressive... 30
 Haken Sie die Themen ab, die Sie durchgearbeitet oder wiederholt haben. Inhalt Contents A 1 2 3 Verben Die Zeiten Vollverben... 14 Die Verben be, have, do... 16 Modale Hilfsverben... 17 a Gebrauch... 17
Haken Sie die Themen ab, die Sie durchgearbeitet oder wiederholt haben. Inhalt Contents A 1 2 3 Verben Die Zeiten Vollverben... 14 Die Verben be, have, do... 16 Modale Hilfsverben... 17 a Gebrauch... 17
Georg-August-Universität Göttingen University of Göttingen Seminar für Slavische Philologie Slavic Department
 Hagen Pitsch Dr. phil. University of Göttingen Slavic Department Humboldtallee 19 37073 Göttingen Germany Zimmer room 3.116 November November 2007 Die Kopula(sätze) im Russischen The Copula (and Copular
Hagen Pitsch Dr. phil. University of Göttingen Slavic Department Humboldtallee 19 37073 Göttingen Germany Zimmer room 3.116 November November 2007 Die Kopula(sätze) im Russischen The Copula (and Copular
Deutsche Wortbildung in Grundzügen
 Wolfgang Motsch Deutsche Wortbildung in Grundzügen 2., überarbeitete Auflage W DE G Walter de Gruyter Berlin New York INHALT Vorwort V Kapitel 1: Grundlagen 1. Der allgemeine Rahmen 1 2. Lexikoneintragungen
Wolfgang Motsch Deutsche Wortbildung in Grundzügen 2., überarbeitete Auflage W DE G Walter de Gruyter Berlin New York INHALT Vorwort V Kapitel 1: Grundlagen 1. Der allgemeine Rahmen 1 2. Lexikoneintragungen
Man verwendet das Präsens - wenn die Handlung, von der gesprochen wird, im Augenblick des Sprechens abläuft:
 Die wichtigsten Zeitformen Man verwendet das Präsens - wenn die Handlung, von der gesprochen wird, im Augenblick des Sprechens abläuft: Wo ist Tom? Er ist im Kino. ich laufe du läufst er/sie/es läuft Ich
Die wichtigsten Zeitformen Man verwendet das Präsens - wenn die Handlung, von der gesprochen wird, im Augenblick des Sprechens abläuft: Wo ist Tom? Er ist im Kino. ich laufe du läufst er/sie/es läuft Ich
Kontrastive Linguistik und Übersetzung
 Kontrastive Linguistik und Übersetzung WS 2014/15 29.04.2015 EINFÜHRUNG IN DIE SYNTAX Syntax Die syntaktische Analyse (von gr. syntaxis Zusammenstellung ) befasst sich mit den Regeln und Verfahren, mit
Kontrastive Linguistik und Übersetzung WS 2014/15 29.04.2015 EINFÜHRUNG IN DIE SYNTAX Syntax Die syntaktische Analyse (von gr. syntaxis Zusammenstellung ) befasst sich mit den Regeln und Verfahren, mit
Syntax natürlicher Sprachen
 Syntax natürlicher Sprachen 05: Dependenz und Valenz Martin Schmitt Ludwig-Maximilians-Universität München 22.11.2017 Martin Schmitt (LMU) Syntax natürlicher Sprachen 22.11.2017 1 Themen der heutigen Übung
Syntax natürlicher Sprachen 05: Dependenz und Valenz Martin Schmitt Ludwig-Maximilians-Universität München 22.11.2017 Martin Schmitt (LMU) Syntax natürlicher Sprachen 22.11.2017 1 Themen der heutigen Übung
Meilensteine des Spracherwerbs Erwerb von Wort- und Satzbedeutung Lexikon, Semantik, Syntax. Ein Referat von Nicole Faller.
 Meilensteine des Spracherwerbs Erwerb von Wort- und Satzbedeutung Lexikon, Semantik, Syntax Ein Referat von Nicole Faller. Es gibt eine spezifisch menschliche, angeborene Fähigkeit zum Spracherwerb. Der
Meilensteine des Spracherwerbs Erwerb von Wort- und Satzbedeutung Lexikon, Semantik, Syntax Ein Referat von Nicole Faller. Es gibt eine spezifisch menschliche, angeborene Fähigkeit zum Spracherwerb. Der
Sprachen im Vergleich
 Sprachen im Vergleich Deutsch-Ladinisch-Italienisch Peter Gallmann Heidi Siller-Runggaldier Horst Sitta Unter Mitarbeit von Giovanni Mischi und Marco Forni istitut Pedagogich ladin Das Inhaltsverzeichnis
Sprachen im Vergleich Deutsch-Ladinisch-Italienisch Peter Gallmann Heidi Siller-Runggaldier Horst Sitta Unter Mitarbeit von Giovanni Mischi und Marco Forni istitut Pedagogich ladin Das Inhaltsverzeichnis
Logik und modelltheoretische Semantik. Grundlagen zum Bedeutung-Text-Modell (BTM)
 Logik und modelltheoretische Semantik Grundlagen zum Bedeutung-Text-Modell (BTM) Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 13.6.2017 Zangenfeind: BTM 1 / 26 Moskauer
Logik und modelltheoretische Semantik Grundlagen zum Bedeutung-Text-Modell (BTM) Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 13.6.2017 Zangenfeind: BTM 1 / 26 Moskauer
Deutsche Grammatik WS 14/15. Kerstin Schwabe
 Deutsche Grammatik WS 14/15 Kerstin Schwabe Generelle Information Dr. Kerstin Schwabe Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft Schützenstraße 18, R. 432 10117 Berlin Tel.: 20192410 E-mail: schwabe@zas.gwz-berlin.de
Deutsche Grammatik WS 14/15 Kerstin Schwabe Generelle Information Dr. Kerstin Schwabe Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft Schützenstraße 18, R. 432 10117 Berlin Tel.: 20192410 E-mail: schwabe@zas.gwz-berlin.de
Valenzgrammatik des Deutschen
 De Gruyter Studium Valenzgrammatik des Deutschen Eine Einführung Bearbeitet von Klaus Welke 1. Auflage 2011. Taschenbuch. X, 353 S. Paperback ISBN 978 3 11 019538 5 Gewicht: 530 g Weitere Fachgebiete >
De Gruyter Studium Valenzgrammatik des Deutschen Eine Einführung Bearbeitet von Klaus Welke 1. Auflage 2011. Taschenbuch. X, 353 S. Paperback ISBN 978 3 11 019538 5 Gewicht: 530 g Weitere Fachgebiete >
Inhaltsverzeichnis. Abkürzungen... 9 Niveaustufentests Tipps & Tricks Auf einen Blick Auf einen Blick Inhaltsverzeichnis
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abkürzungen... 9 Niveaustufentests... 10 Tipps & Tricks... 18 1 Der Artikel... 25 1.1 Der bestimmte Artikel... 25 1.2 Der unbestimmte Artikel... 27 2 Das Substantiv...
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abkürzungen... 9 Niveaustufentests... 10 Tipps & Tricks... 18 1 Der Artikel... 25 1.1 Der bestimmte Artikel... 25 1.2 Der unbestimmte Artikel... 27 2 Das Substantiv...
ÜBERBLICK ÜBER DAS KURS-ANGEBOT
 ÜBERBLICK ÜBER DAS KURS-ANGEBOT Alle aufgeführten Kurse sind 100 % kostenfrei und können unter http://www.unterricht.de abgerufen werden. SATZBAU & WORTSTELLUNG - WORD ORDER Aussagesätze / Affirmative
ÜBERBLICK ÜBER DAS KURS-ANGEBOT Alle aufgeführten Kurse sind 100 % kostenfrei und können unter http://www.unterricht.de abgerufen werden. SATZBAU & WORTSTELLUNG - WORD ORDER Aussagesätze / Affirmative
Passiv und Passiversatz
 Passiv und Passiversatz Werden-Passiv (oder Vorgangspassiv) Alle vier Jahre wird in Deutschland ein neues Parlament gewählt. Die Partei wurde mit großer Mehrheit gewählt. Die Partei ist mit großer Mehrheit
Passiv und Passiversatz Werden-Passiv (oder Vorgangspassiv) Alle vier Jahre wird in Deutschland ein neues Parlament gewählt. Die Partei wurde mit großer Mehrheit gewählt. Die Partei ist mit großer Mehrheit
Einführung in die Computerlinguistik. Morphologie II
 Einführung in die Computerlinguistik Morphologie II Hinrich Schütze & Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 30.11.2015 Schütze & Zangenfeind: Morphologie II 1
Einführung in die Computerlinguistik Morphologie II Hinrich Schütze & Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 30.11.2015 Schütze & Zangenfeind: Morphologie II 1
KL WS 03/04 - Anke Lüdeling. Gliederung. Polysemie. Systematische Polysemie
 KL WS 03/04 - Anke Lüdeling Arbeitsgruppe Miniprojekt 1: Lexikalische Semantik Kann man systematische Polysemie kontextuell (automatisch) bestimmen? Anne Urbschat Ruprecht v.waldenfels Jana Drescher Emil
KL WS 03/04 - Anke Lüdeling Arbeitsgruppe Miniprojekt 1: Lexikalische Semantik Kann man systematische Polysemie kontextuell (automatisch) bestimmen? Anne Urbschat Ruprecht v.waldenfels Jana Drescher Emil
Tiefenkasus und Kasusrahmen bei Fillmore
 Tiefenkasus und Kasusrahmen bei Fillmore Technische Universität Berlin Fachbereich Germanistische Linguistik Seminar: Wortfeld, Frame, Diskurs Dozent: Prof. Dr. Posner Referent: Christian Trautsch 0. Referatsgliederung
Tiefenkasus und Kasusrahmen bei Fillmore Technische Universität Berlin Fachbereich Germanistische Linguistik Seminar: Wortfeld, Frame, Diskurs Dozent: Prof. Dr. Posner Referent: Christian Trautsch 0. Referatsgliederung
Angewandte Linguistik und Computer
 forum ANGEWANDTE LINGUISTIK BAND 16 Angewandte Linguistik und Computer Kongreßbeiträge zur 18. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik, GAL e.v. H erausgegeben von Bernd Spillner Gunter
forum ANGEWANDTE LINGUISTIK BAND 16 Angewandte Linguistik und Computer Kongreßbeiträge zur 18. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik, GAL e.v. H erausgegeben von Bernd Spillner Gunter
Lösungsansätze Bestimmung der finiten Verben
 Gymbasis Deutsch: Grammatik Wortarten Verb: Bestimmung der finiten Verben Lösung 1 Lösungsansätze Bestimmung der finiten Verben Unterstreiche zuerst in den folgenden Sätzen die konjugierten Verben und
Gymbasis Deutsch: Grammatik Wortarten Verb: Bestimmung der finiten Verben Lösung 1 Lösungsansätze Bestimmung der finiten Verben Unterstreiche zuerst in den folgenden Sätzen die konjugierten Verben und
Stefan Lotze Seminar: Grundlagen der deutschen Grammatik (Satz I, Teil II) Winter 2017/18. Passiv (und nichtakkusativische Verben)
 1 Stefan Lotze Seminar: Grundlagen der deutschen Grammatik (Satz, Teil ) Winter 2017/18 Passiv (und nichtakkusativische erben) Theorie (Fragenkatalog) A B Welche oraussetzung muss ein erb erfüllen, um
1 Stefan Lotze Seminar: Grundlagen der deutschen Grammatik (Satz, Teil ) Winter 2017/18 Passiv (und nichtakkusativische erben) Theorie (Fragenkatalog) A B Welche oraussetzung muss ein erb erfüllen, um
Ivana Daskalovska. Willkommen zur Übung Einführung in die Computerlinguistik. Syntax. Sarah Bosch,
 Ivana Daskalovska Willkommen zur Übung Einführung in die Computerlinguistik Syntax Wiederholung Aufgabe 1 Was ist Syntax und womit beschäftigt sie sich? 3 Aufgabe 1 Was ist Syntax und womit beschäftigt
Ivana Daskalovska Willkommen zur Übung Einführung in die Computerlinguistik Syntax Wiederholung Aufgabe 1 Was ist Syntax und womit beschäftigt sie sich? 3 Aufgabe 1 Was ist Syntax und womit beschäftigt
HPSG. Referat zu dem Thema Kongruenz im Englischen Von Anja Nerstheimer
 HPSG Referat zu dem Thema Kongruenz im Englischen Von Anja Nerstheimer Gliederung Einleitung Kongruenz Allgemein Zwei Theorien der Kongruenz Probleme bei ableitungsbasierenden Kongruenztheorien Wie syntaktisch
HPSG Referat zu dem Thema Kongruenz im Englischen Von Anja Nerstheimer Gliederung Einleitung Kongruenz Allgemein Zwei Theorien der Kongruenz Probleme bei ableitungsbasierenden Kongruenztheorien Wie syntaktisch
Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen. Syntax IV. PD Dr. Alexandra Zepter
 Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen Syntax IV PD Dr. Alexandra Zepter Überblick Syntax Fokus auf linearer Ordnung: Sprachtypen, Topologisches Feldermodell Fokus auf hierarchischer Ordnung:
Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen Syntax IV PD Dr. Alexandra Zepter Überblick Syntax Fokus auf linearer Ordnung: Sprachtypen, Topologisches Feldermodell Fokus auf hierarchischer Ordnung:
Zur Struktur der Verbalphrase
 Zur Struktur der Verbalphrase Ein formales Kriterium zur Verbklassifikation: V ist ein intransitives Verb (ohne Objekte) schlafen, arbeiten, tanzen,... (1) Klaus-Jürgen schläft. V ist ein transitives Verb
Zur Struktur der Verbalphrase Ein formales Kriterium zur Verbklassifikation: V ist ein intransitives Verb (ohne Objekte) schlafen, arbeiten, tanzen,... (1) Klaus-Jürgen schläft. V ist ein transitives Verb
Funktionale-Grammatik
 Lexikalisch-Funktionale Funktionale-Grammatik Architektur der LFG K-Strukturen F-Strukturen Grammatische Funktionen Lexikon Prädikat-Argument-Strukturen Lexikonregeln Basiskomponente PS Regeln Lexikon
Lexikalisch-Funktionale Funktionale-Grammatik Architektur der LFG K-Strukturen F-Strukturen Grammatische Funktionen Lexikon Prädikat-Argument-Strukturen Lexikonregeln Basiskomponente PS Regeln Lexikon
Okzitanische und katalanische Verbprobleme
 A/548304 BRIGITTE SCHLIEBEN-LANGE Okzitanische und katalanische Verbprobleme Ein Beitrag zur funktionellen synchronischen Untersuchung des Verbalsystems der beiden Sprachen (Tempus und Aspekt) MAX NIEMEYER
A/548304 BRIGITTE SCHLIEBEN-LANGE Okzitanische und katalanische Verbprobleme Ein Beitrag zur funktionellen synchronischen Untersuchung des Verbalsystems der beiden Sprachen (Tempus und Aspekt) MAX NIEMEYER
Die Wortbildung des Deutschen. Wortbildungsmittel
 Die Wortbildung des Deutschen Wortbildungsmittel Voraussetzungen und Ziele der Wortbildungsanalyse Bildung von Wörtern folgt best. Wortbildungstypen Bildung nach Vorbild eines bereits bekannten Wortes
Die Wortbildung des Deutschen Wortbildungsmittel Voraussetzungen und Ziele der Wortbildungsanalyse Bildung von Wörtern folgt best. Wortbildungstypen Bildung nach Vorbild eines bereits bekannten Wortes
Satzglieder und Gliedteile. Duden
 Satzglieder und Gliedteile Duden 1.1-1.3 1. Valenz: Ergänzungen und Angaben - Verb (bzw. Prädikat) bestimmt den Satz syntaktisch und semantisch [Anna] stellte [rasch] [eine Kerze] [auf den Tisch]. - Neben
Satzglieder und Gliedteile Duden 1.1-1.3 1. Valenz: Ergänzungen und Angaben - Verb (bzw. Prädikat) bestimmt den Satz syntaktisch und semantisch [Anna] stellte [rasch] [eine Kerze] [auf den Tisch]. - Neben
Valenz und Satzaufbau. In: Handbuch Sprachliches Wissen, Bd. 4: Satz, Äußerung, Schema, hrsg. von Christa Dürscheid und Jan Georg Schneider
 Erscheint 2015: Valenz und Satzaufbau. In: Handbuch Sprachliches Wissen, Bd. 4: Satz, Äußerung, Schema, hrsg. von Christa Dürscheid und Jan Georg Schneider Wechselseitigkeit von Valenz und Konstruktion:
Erscheint 2015: Valenz und Satzaufbau. In: Handbuch Sprachliches Wissen, Bd. 4: Satz, Äußerung, Schema, hrsg. von Christa Dürscheid und Jan Georg Schneider Wechselseitigkeit von Valenz und Konstruktion:
Inhalt. Nomen. Artikelwörter. Pronomen. Seite
 Inhalt Seite 1 Nomen 1.01 Genus: maskulin, neutral, feminin 8 der Buchstabe, das Wort, die Sprache 1.02 Plural 10 der Fisch, die Fische 1.03 Kasus: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv 12 Ein Hund sieht
Inhalt Seite 1 Nomen 1.01 Genus: maskulin, neutral, feminin 8 der Buchstabe, das Wort, die Sprache 1.02 Plural 10 der Fisch, die Fische 1.03 Kasus: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv 12 Ein Hund sieht
Wortarten Merkblatt. Veränderbare Wortarten Unveränderbare Wortarten
 Wortarten Merkblatt Veränderbare Wortarten Deklinierbar (4 Fälle) Konjugierbar (Zeiten) Unveränderbare Wortarten Nomen Konjunktionen (und, weil,...) Artikel Verben Adverbien (heute, dort,...) Adjektive
Wortarten Merkblatt Veränderbare Wortarten Deklinierbar (4 Fälle) Konjugierbar (Zeiten) Unveränderbare Wortarten Nomen Konjunktionen (und, weil,...) Artikel Verben Adverbien (heute, dort,...) Adjektive
Semantik. Sebastian Löbner. Eine Einführung. Walter de Gruyter Berlin New York 2003
 Sebastian Löbner 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Semantik Eine Einführung wde G Walter de Gruyter
Sebastian Löbner 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Semantik Eine Einführung wde G Walter de Gruyter
Funktionsverbgefügemehr
 Ruhr-Universität Bochum Germanistisches Institut WS 2007/08 HS: Der Verbalkomplex im Deutschen Dozentin: Prof. Dr. Karin Pittner Referentinnen: Nadja Yildirim, Tanja Rybtschak Funktionsverbgefügemehr oder
Ruhr-Universität Bochum Germanistisches Institut WS 2007/08 HS: Der Verbalkomplex im Deutschen Dozentin: Prof. Dr. Karin Pittner Referentinnen: Nadja Yildirim, Tanja Rybtschak Funktionsverbgefügemehr oder
SUB Hamburg. Die Grammatik. Spanisch
 SUB Hamburg Die Grammatik. Spanisch 1. Das Nomen 1.1 Das Geschlecht des Nomens 1.1.1 Die Endung des Nomens und das grammatische Geschlecht 1.2 Die Pluralbildung 1.2.1 Die Pluralbildung der zusammengesetzten
SUB Hamburg Die Grammatik. Spanisch 1. Das Nomen 1.1 Das Geschlecht des Nomens 1.1.1 Die Endung des Nomens und das grammatische Geschlecht 1.2 Die Pluralbildung 1.2.1 Die Pluralbildung der zusammengesetzten
Grundlegendes zur Semantik 4. Januar 2005
 Linguistik Grundkurs Plenum Ruhr Universität Bochum Germanistisches Institut ********************************** Wolf Peter Klein Grundlegendes zur Semantik 4. Januar 2005 Wintersemester 04/05 Semantik
Linguistik Grundkurs Plenum Ruhr Universität Bochum Germanistisches Institut ********************************** Wolf Peter Klein Grundlegendes zur Semantik 4. Januar 2005 Wintersemester 04/05 Semantik
Wortarten Merkblatt. Veränderbare Wortarten Unveränderbare Wortarten
 Wortarten Merkblatt Veränderbare Wortarten Deklinierbar (4 Fälle) Konjugierbar (Zeiten) Unveränderbare Wortarten Nomen Konjunktionen (und, weil,...) Artikel Verben Adverbien (heute, dort,...) Adjektive
Wortarten Merkblatt Veränderbare Wortarten Deklinierbar (4 Fälle) Konjugierbar (Zeiten) Unveränderbare Wortarten Nomen Konjunktionen (und, weil,...) Artikel Verben Adverbien (heute, dort,...) Adjektive
Finding the Sources and Targets of Subjective Expressions
 Finding the Sources and Targets of Subjective Expressions Ruppenhofer, Josef Somasundaran, Swapna Wiebe, Janyce University of Pittsburgh Seminar: Selected Topic in Sentiment Analysis Referent: Simon Schmiedel
Finding the Sources and Targets of Subjective Expressions Ruppenhofer, Josef Somasundaran, Swapna Wiebe, Janyce University of Pittsburgh Seminar: Selected Topic in Sentiment Analysis Referent: Simon Schmiedel
Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen Syntax IV. PD Dr. Alexandra Zepter
 Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen Syntax IV PD Dr. Alexandra Zepter Überblick Syntax 1. Fokus auf linearer Ordnung: Sprachtypen, Topologisches Feldermodell 2. Fokus auf hierarchischer
Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen Syntax IV PD Dr. Alexandra Zepter Überblick Syntax 1. Fokus auf linearer Ordnung: Sprachtypen, Topologisches Feldermodell 2. Fokus auf hierarchischer
DER GROßE GRAMMATIK-CHECK Was Sie ab B1 wissen sollten! I. Verb
 DER GROßE GRAMMATIK-CHECK Was Sie ab B1 wissen sollten! I. Verb Verbarten Grundverben Modalverben Trennbare Verben Unregelmäßige Verben Reflexive Verben Verben mit Präposition sein - können dürfen wollen
DER GROßE GRAMMATIK-CHECK Was Sie ab B1 wissen sollten! I. Verb Verbarten Grundverben Modalverben Trennbare Verben Unregelmäßige Verben Reflexive Verben Verben mit Präposition sein - können dürfen wollen
Abkürzungen Einführung Übungsaufgaben... 13
 Inhalt Abkürzungen............................................. 10 1 Einführung............................................. 11 1.1 Übungsaufgaben..................................... 13 2 Syntaktische
Inhalt Abkürzungen............................................. 10 1 Einführung............................................. 11 1.1 Übungsaufgaben..................................... 13 2 Syntaktische
Adverbale und adverbialisierte Adjektive im Spanischen
 Martin Hummel W ' IIIIIIMI A2001 4847 Adverbale und adverbialisierte Adjektive im Spanischen Konstruktionen des Typs Losninos duermen tranquilos und Maria corre räpido Gunter Narr Verlag Tübingen Inhaltsverzeichnis
Martin Hummel W ' IIIIIIMI A2001 4847 Adverbale und adverbialisierte Adjektive im Spanischen Konstruktionen des Typs Losninos duermen tranquilos und Maria corre räpido Gunter Narr Verlag Tübingen Inhaltsverzeichnis
Am Anfang war das Wort!
 Am Anfang war das Wort! Was ist Morphologie? Der Begriff Morphologie wurde 1796 von Johann Wolfgang von Goethe in einer Tagebuchaufzeichnung für eine neue Wissenschaft geprägt,, die sich mit den Gestaltungsgesetzen
Am Anfang war das Wort! Was ist Morphologie? Der Begriff Morphologie wurde 1796 von Johann Wolfgang von Goethe in einer Tagebuchaufzeichnung für eine neue Wissenschaft geprägt,, die sich mit den Gestaltungsgesetzen
Einführung in die Linguistik Butt / Eulitz / Wiemer. Syntax I
 Einführung in die Linguistik Butt / Eulitz / Wiemer Syntax I Morphologische Merkmale Morphologie drückt u.a. Merkmale wie diese aus: Kasus: Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ Numerus: Singular, Plural,
Einführung in die Linguistik Butt / Eulitz / Wiemer Syntax I Morphologische Merkmale Morphologie drückt u.a. Merkmale wie diese aus: Kasus: Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ Numerus: Singular, Plural,
Nominale Prädikation oder Modus? -(t)u - Formen im Awetí
 Gliederung Nominale Prädikation oder Modus? -(t)u - Formen im Awetí Sebastian Drude Freie Universität Berlin Museu Paraense Emílio Goeldi DGfS-Tagung in Bielefeld, Februar 2006 1. Die Awetí und ihre Sprache
Gliederung Nominale Prädikation oder Modus? -(t)u - Formen im Awetí Sebastian Drude Freie Universität Berlin Museu Paraense Emílio Goeldi DGfS-Tagung in Bielefeld, Februar 2006 1. Die Awetí und ihre Sprache
A 2004/3423. Spanische Grammatik - kurz und schmerzlos. Von Begona Prieto Peral und Victoria Fülöp-Lucio. Langenscheidt
 A 2004/3423 Langenscheidt Spanische Grammatik - kurz und schmerzlos Von Begona Prieto Peral und Victoria Fülöp-Lucio Langenscheidt Berlin München Wien Zürich New York Vorwort 1 Das Substantiv und der Artikel
A 2004/3423 Langenscheidt Spanische Grammatik - kurz und schmerzlos Von Begona Prieto Peral und Victoria Fülöp-Lucio Langenscheidt Berlin München Wien Zürich New York Vorwort 1 Das Substantiv und der Artikel
Thematische Rollen. Randolf Altmeyer Proseminar Lexikalische Semantik WS 05/06 Prof. Pinkal
 Thematische Rollen Randolf Altmeyer Proseminar Lexikalische Semantik WS 05/06 Prof Pinkal Überblick Definitionen (Prädikat, Argument, Stelligkeit) Prädikate und natürliche Sprache Beziehungen zwischen
Thematische Rollen Randolf Altmeyer Proseminar Lexikalische Semantik WS 05/06 Prof Pinkal Überblick Definitionen (Prädikat, Argument, Stelligkeit) Prädikate und natürliche Sprache Beziehungen zwischen
Grundwissen im Fach Englisch in den Jahrgangsstufen 5 bis 10
 Grundwissen im Fach Englisch in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 5. Jahrgangsstufe die kommunikativen Fertigkeiten und sprachlichen Mittel zur ersten elementaren Sprachverwendung entsprechend der Stufe A1
Grundwissen im Fach Englisch in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 5. Jahrgangsstufe die kommunikativen Fertigkeiten und sprachlichen Mittel zur ersten elementaren Sprachverwendung entsprechend der Stufe A1
Syntax II. Das Topologische Feldermodell. Konstituententests Vorschau Konstituentenstruktur
 Syntax II Das Topologische Feldermodell Konstituententests Vorschau Konstituentenstruktur Topologische Felder Syntax befasst sich mit den Regeln, mit denen man Wörter zu grammatischen Sätzen kombinieren
Syntax II Das Topologische Feldermodell Konstituententests Vorschau Konstituentenstruktur Topologische Felder Syntax befasst sich mit den Regeln, mit denen man Wörter zu grammatischen Sätzen kombinieren
Inhalt. Einfache Sätze. 1 Ja/Nein-Fragen und Aussagen A1 Kochst du heute? Ja, klar! W-Fragen A1 Was machst du? Wie heißen Sie?
 Einfache Sätze 1 Ja/Nein-Fragen und Aussagen A1 Kochst du heute? Ja, klar! 10 2 W-Fragen A1 Was machst du? Wie heißen Sie? 12 3 Personalpronomen, Verben im Präsens A1 Er wartet ich komme! 14 4 Unregelmäßige
Einfache Sätze 1 Ja/Nein-Fragen und Aussagen A1 Kochst du heute? Ja, klar! 10 2 W-Fragen A1 Was machst du? Wie heißen Sie? 12 3 Personalpronomen, Verben im Präsens A1 Er wartet ich komme! 14 4 Unregelmäßige
IGA OLSZAK INTERCAMBIOIDIOMASONLINE GRAMMATIK: ADJEKTIVDEKLINATION
 WWW.INTERCAMBIOIDIOMASONLINE.COM IGA OLSZAK INTERCAMBIOIDIOMASONLINE GRAMMATIK: ADJEKTIVDEKLINATION Was wäre deine Antwort auf die Frage Was ist für dich in der deutschen Grammatik am schwierigsten? Sehr
WWW.INTERCAMBIOIDIOMASONLINE.COM IGA OLSZAK INTERCAMBIOIDIOMASONLINE GRAMMATIK: ADJEKTIVDEKLINATION Was wäre deine Antwort auf die Frage Was ist für dich in der deutschen Grammatik am schwierigsten? Sehr
Video-Thema Begleitmaterialien
 MÄNNER IM SPIELZEUGHIMMEL 1. Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche Substantive kann man nicht mit dem Wort Spiel(e) zu einem Kompositum verbinden? Welche stehen bei einer
MÄNNER IM SPIELZEUGHIMMEL 1. Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche Substantive kann man nicht mit dem Wort Spiel(e) zu einem Kompositum verbinden? Welche stehen bei einer
ABKÜRZUNGEN UND SYMBOLE 14 DIE EINZELNEN WORTKLASSEN 15
 ABKÜRZUNGEN UND SYMBOLE 14 DIE EINZELNEN WORTKLASSEN 15 VEREi 15 l l.i 1. 1..1 1.. 1..3 1.3.1.1.1.1..1..1.1...1..3.1..4.1..5...1....3..4 FORMENSYSTEM Konjugation Formenbildung der regelmäßigen Verben Präsens
ABKÜRZUNGEN UND SYMBOLE 14 DIE EINZELNEN WORTKLASSEN 15 VEREi 15 l l.i 1. 1..1 1.. 1..3 1.3.1.1.1.1..1..1.1...1..3.1..4.1..5...1....3..4 FORMENSYSTEM Konjugation Formenbildung der regelmäßigen Verben Präsens
Syntax II. Das Topologische Feldermodell Konstituententests Vorschau Konstituentenstruktur
 Syntax II Das Topologische Feldermodell Konstituententests Vorschau Konstituentenstruktur Topologische Felder Syntax befasst sich mit den Regeln, mit denen man Wörter zu grammatischen Sätzen kombinieren
Syntax II Das Topologische Feldermodell Konstituententests Vorschau Konstituentenstruktur Topologische Felder Syntax befasst sich mit den Regeln, mit denen man Wörter zu grammatischen Sätzen kombinieren
ADas Verb (1. Teil) (the verb) das Tätigkeitswort
 ADas Verb (1. Teil) (the verb) das Tätigkeitswort Die Zeiten des Verbs (the tenses of the verb) I Das Präsens (the present tense)... 9 1 Das einfache Präsens (die Formen) 9 2 Besondere Merkmale in der
ADas Verb (1. Teil) (the verb) das Tätigkeitswort Die Zeiten des Verbs (the tenses of the verb) I Das Präsens (the present tense)... 9 1 Das einfache Präsens (die Formen) 9 2 Besondere Merkmale in der
Die pragmatische Gretchenfrage und ihre Folgen
 Die pragmatische Gretchenfrage und ihre Folgen Johannes Dölling (Leipzig) Nun sag', wie hast du's mit der wörtlichen Bedeutung? Workshop zu Ehren von Manfred Bierwisch, Leipzig, 26.10.2005 1 Ein grundlegendes
Die pragmatische Gretchenfrage und ihre Folgen Johannes Dölling (Leipzig) Nun sag', wie hast du's mit der wörtlichen Bedeutung? Workshop zu Ehren von Manfred Bierwisch, Leipzig, 26.10.2005 1 Ein grundlegendes
Syntax III. Joost Kremers WS
 Syntax WS 2009 12.11.2009 Aufgaben Kapitel 3 Aufgabe 3.1 n Standard-G&B-Analysen enthält die das erb und das interne Argument, während das externe Argument im Grunde ein Argument des Satzes (P) ist und
Syntax WS 2009 12.11.2009 Aufgaben Kapitel 3 Aufgabe 3.1 n Standard-G&B-Analysen enthält die das erb und das interne Argument, während das externe Argument im Grunde ein Argument des Satzes (P) ist und
Relativsätze in der Spontansprache. Referentin: Fatiha Laaraichi
 Relativsätze in der Referentin: Fatiha Laaraichi Gliederung Syntax -Stellungsvarianten -Kontakt-/Distanzposition -Positionen im Topologischen Modell -Typische Strukturen/syntaktische Eigenschaften Semantik
Relativsätze in der Referentin: Fatiha Laaraichi Gliederung Syntax -Stellungsvarianten -Kontakt-/Distanzposition -Positionen im Topologischen Modell -Typische Strukturen/syntaktische Eigenschaften Semantik
. How Complex are Complex Predicates? K. Maiterth, A. Domberg. Seminar: Komplexe Verben im Germanischen Universität Leipzig Problem..
 How Complex are Complex Predicates? K Maiterth, A Domberg Seminar: Komplexe Verben im Germanischen Universität Leipzig 21052012 Inhalt 1 Verbcluster im Deutschen Komplexer Kopf VP-Komplementierung 2 Haiders
How Complex are Complex Predicates? K Maiterth, A Domberg Seminar: Komplexe Verben im Germanischen Universität Leipzig 21052012 Inhalt 1 Verbcluster im Deutschen Komplexer Kopf VP-Komplementierung 2 Haiders
Deutsche Wortbildung in Grundziigen
 Wolfgang Motsch Deutsche Wortbildung in Grundziigen 2., iiberarbeitete Auflage W DE G Walter de Gruyter Berlin New York INHALT Vorwort V Kapitel 1: Grundlagen 1. Der allgemeine Rahmen 1 2. Lexikoneintragungen
Wolfgang Motsch Deutsche Wortbildung in Grundziigen 2., iiberarbeitete Auflage W DE G Walter de Gruyter Berlin New York INHALT Vorwort V Kapitel 1: Grundlagen 1. Der allgemeine Rahmen 1 2. Lexikoneintragungen
Manual zur Identifikation von Funktionsverbgefügen und figurativen Ausdrücken in PP-Verb-Listen
 Manual zur Identifikation von Funktionsverbgefügen und ativen Ausdrücken in PP-Verb-Listen Brigitte Krenn, OFAI, brigitte@oefai.at 17. Mai 2004 1 Kollokative versus nicht kollokative Wortkombinationen
Manual zur Identifikation von Funktionsverbgefügen und ativen Ausdrücken in PP-Verb-Listen Brigitte Krenn, OFAI, brigitte@oefai.at 17. Mai 2004 1 Kollokative versus nicht kollokative Wortkombinationen
Der Oberdeutsche Präteritumschwund
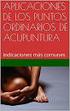 Germanistik Nadja Groß Der Oberdeutsche Präteritumschwund Zur Beobachtung einer sich verstärkenden Veränderung unseres Tempussystems Studienarbeit INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung... 1 2. Zwei Vergangenheits-Tempora:
Germanistik Nadja Groß Der Oberdeutsche Präteritumschwund Zur Beobachtung einer sich verstärkenden Veränderung unseres Tempussystems Studienarbeit INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung... 1 2. Zwei Vergangenheits-Tempora:
Das Passiv im Deutschen und Italienischen
 Das Passiv im Deutschen und Italienischen Inhaltsverzeichnis 1. Das Passiv im Deutschen 1.1 Unterschied zwischen dem Passivsatz und Aktivsatz 1.2 kurze Einleitung zum Passiv 1.3 Verwendung des Passivs
Das Passiv im Deutschen und Italienischen Inhaltsverzeichnis 1. Das Passiv im Deutschen 1.1 Unterschied zwischen dem Passivsatz und Aktivsatz 1.2 kurze Einleitung zum Passiv 1.3 Verwendung des Passivs
Wolfgang Schulze. Seminar: Kategorien II Kategorienverwandtschaft W. Schulze Sprachl. Zeichen des Präteritums
 Wolfgang Schulze Seminar: Kategorien II Kategorienverwandtschaft W. Schulze 2013 a. Ausgangspunkt: Der kategorielle Wert sprachlicher Zeichen: Signifié Signifiant KATEGORIE Sprachl. Zeichen einer ling.
Wolfgang Schulze Seminar: Kategorien II Kategorienverwandtschaft W. Schulze 2013 a. Ausgangspunkt: Der kategorielle Wert sprachlicher Zeichen: Signifié Signifiant KATEGORIE Sprachl. Zeichen einer ling.
Inhalt.
 Inhalt EINLEITUNG II TEIL A - THEORETISCHE ASPEKTE 13 GRAMMATIK 13 Allgemeines 13 Die sprachlichen Ebenen 15 MORPHOLOGIE 17 Grundbegriffe der Morphologie 17 Gliederung der Morpheme 18 Basis- (Grund-) oder
Inhalt EINLEITUNG II TEIL A - THEORETISCHE ASPEKTE 13 GRAMMATIK 13 Allgemeines 13 Die sprachlichen Ebenen 15 MORPHOLOGIE 17 Grundbegriffe der Morphologie 17 Gliederung der Morpheme 18 Basis- (Grund-) oder
Die Grammatikalisierung deutscher Präpositionen
 Claudio Di Meola 0 Die Grammatikalisierung deutscher Präpositionen STAÜFFENBURG VERLAG Inhalt Vorwort xi Einleitung 1 1. Theoretischer Rahmen und Forschungsstand 5 1.1. Grundannahmen der Grammatikalisierungsforschung
Claudio Di Meola 0 Die Grammatikalisierung deutscher Präpositionen STAÜFFENBURG VERLAG Inhalt Vorwort xi Einleitung 1 1. Theoretischer Rahmen und Forschungsstand 5 1.1. Grundannahmen der Grammatikalisierungsforschung
