Inklusion in Schule und Unterricht
|
|
|
- Laura Weiss
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Inklusion im pädagogischen Sinne zielt auf die Schaffung netzwerkartiger Strukturen in Schule und Gesellschaft ab, die zur Unterstützung der selbstbestimmten sozialen Teilhabe aller Menschen in allen gesellschaftlichen Bereichen beitragen und Tendenzen zum Ausschluss bestimmter Gruppen aus der Gesellschaft entschieden entgegentreten. (HEIMLICH, 14) Das Konzept der Integration konnte in der Vergangenheit nur einsetzen, wenn Kindern und Jugendlichen ein sonderpädagogischer Förderbedarf attestiert wurde. Der Vorteil dieses Systems ist sicher die klare Individuumszentrierung. Zum Nachteil gereichte der Integrationspraxis das Festhalten an einer weitgehend defizitorientierten Diagnostik. Es ist in der integrativen Praxis nicht gelungen, sich konsequent von einem schädigungsbezogenen Denken zu verabschieden und zur Förderung hin umzuorientieren. Noch immer steht in der Praxis der sonderpädagogischen Diagnostik die Zuweisung zum Förderort im Vordergrund und nicht die Entwicklung von individuellen Fördermaßnahmen. (HEIMLICH, 14f) Personelle, räumliche und sächliche Ausstattung konnten integrative Bildungsangebote nur erreichen, wenn sie eine möglichst große Zahl von Kindern und Jugendlichen mit dem Etikett sonderpädagogischer Förderbedarf behafteten. Die Integration blieb deshalb auch häufig auf einer institutionellen Ebene des bloßen Beieinanderseins stehen, ohne zu intensiven sozialen Austauschprozessen zu gelangen. (HEIMLICH, 14f) Das Konzept der Inklusion ist demgegenüber bis in die Gegenwart hinein in Deutschland noch weitgehend Zukunftsentwurf im Gegensatz zu vielen anderen Staaten der Welt Inklusive Bildungsangebote sollen als ein System für alle das gemeinsame Leben und Lernen für alle gewährleisten. Hier wird auf die Unterscheidung von Gruppen mit verschiedenen Kindern zugunsten heterogen zusammengesetzter Gruppen verzichtet. Kinder und Jugendliche in inklusiven Schulen sollen sich nicht nur sporadisch begegnen, sondern in intensive selbst gewählte und dauerhafte soziale Kontakte eintreten können (soziale Ebene) und so neben der institutionellen Ebene Inklusion auch persönlich erleben können (emotionale Ebene). (HEIMLICH, 15f) In der Konsequenz bedeutet dies nun, dass die Zuweisung von Ressourcen für das System inklusive Schule erfolgt. Inklusive Schulen entwickeln inklusive Bildungskonzeptionen im Sinne eines eigenständigen Schulprogramms bzw. profils. Darin versichern sie, dass sie alle Kinder und Jugendlichen eines Stadtteils aufnehmen auch mit Migrationshintergrund und mit sonderpädagogischem Förderbedarf. (HEIMLICH, 15f) Ein inklusives Bildungssystem zu entwickeln, bedeutet für die allgemeinen Schulen in Deutschland einen nachhaltigen Umgestaltungsprozess. Wenn Heterogenität in inklusiven Schulen bewusst gewollt ist und ausdrücklich begrüßt wird, dann sollten die Unterrichtskonzepte und die Schulorganisation insgesamt auf den Prüfstand gestellt werden. Eine konsequente Individualisierung des Bildungsangebotes bei gleichzeitiger Wahrung der gemeinsamen thematischen und inhaltlichen Schwerpunktsetzung auch im Sinne von Bildungsabschlüssen dürfte dabei eine der größten didaktisch-methodischen Herausforderungen darstellen. Inklusive Schulen erfordern jedoch zusätzlich einen Schulentwicklungsprozess, in dem alle Beteiligten (Lehrkräfte, Eltern und Schüler/-innen) miteinbezogen sind. (HEIMLICH, 16) Sonderpädagogischer Förderbedarf liegt dann vor, wenn die allgemeine Schule trotz zusätzlicher differenzierender Maßnahmen nicht in der Lage ist, auf die Lernbedürfnisse einzelner Schüler/-innen einzugehen und deshalb zusätzliche gezielte Maßnahmen zur Diagnostik, Intervention und Evaluation erforderlich sind. (HEIMLICH, 19) Moderne Sonderpädagogik ist aufgrund der Impulse, die aus der KMK-Empfehlung von 1994 hervorgegangen sind, gegenwärtig durch eine gezielte Diagnostik, Intervention und Evaluation bezogen auf die individuelle Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler gekennzeichnet. Sie betont dabei die Kompetenzen und Ressourcen von Kindern und Stuttgart (Kohlhammer) 2012 Auszüge von H.J.Knier
2 Jugendlichen und bezieht diese in die Förderung mit ein. Im Mittelpunkt der sonderpädagogischen Förderung stehen von daher der Dialog, die Kooperation mit allen Beteiligten und die interdisziplinäre Teamarbeit. Die Monopolisierung der Förderschulen ist dabei, zugunsten einer Pluralität von stationären und ambulanten Organisationsformen zu weichen, wobei die Inklusion in die allgemeine Schule basierend auf dem Prinzip der Subsidiarität Vorrang hat. Moderne Sonderpädagogik zeichnet sich im ökologischen Sinne durch eine konsequente Kind-Umfeld-Orientierung aus. Sie ist letztlich auf das Leitbild der gesellschaftlichen Integration/Inklusion ausgerichtet. (HEIMLICH, 20) Es ist schon jetzt absehbar, dass unter dem Leitbild der inklusiven Bildung sonderpädagogische Förderung noch stärker als bisher in die allgemeine Schule hineinwachsen wird. Der Förderort allgemeine Schule erhält unter inklusivem Aspekt absolute Priorität. Die Dynamik der weiteren Entwicklung wird zweifellos davon abhängen, inwieweit die Eltern über ein Wahlrecht bezogen auf den Förderort mit in den Prozess einbezogen werden. Auch gilt es, die pädagogischen und sonderpädagogischen Lehrkräfte rechtzeitig und umfassend auf die neue inklusive Aufgabe vorzubereiten. Damit ist langfristig auch eine Veränderung der Lehrerbildung angesprochen. Kurzfristig und im Sinne nächster Schritte steht allerdings die Fortbildung sowie die praxisnahe Beratung und Begleitung im Vordergrund. Entscheidend für die Entwicklung inklusiver Schulen wird der Support der Lehrkräfte sein. (HEIMLICH, 22) Die sonderpädagogische Förderung der Zukunft steht vor der Aufgabe, ihre institutionelle Seite neu zu entwickeln, da sie nicht mehr vom Förderort Förderschule abhängig ist. Unter der Voraussetzung, dass Institutionen nicht Gebäude aus Stein, sondern vielmehr geistige Gebilde sind, gilt es, eine neue institutionelle Gestalt der sonderpädagogischen Förderung zu entwickeln. Zur Zukunftsaufgabe wird es deshalb zählen, sonderpädagogische Förderung als Netzwerkstruktur mit dem Ziel der Unterstützung der Inklusion in der allgemeinen Schule neu zu denken. (HEIMLICH, 85) Auch unter dem Leitbild einer inklusiven Schule bleibt die sonderpädagogische Förderung ein unverzichtbarer Bestandteil des Bildungsangebotes. Förderzentren und mobile sonderpädagogische Förderung können die Arbeit in der inklusiven Schule im Rahmen eines flächendeckenden Modells wirksam unterstützen. Gemeinsam mit den festen sonderpädagogischen Förderangeboten in der allgemeinen Schule bilden sie regionale Fördernetzwerke, die als Unterstützungssystem für ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen wirken. (HEIMLICH, 104) Im Rahmen inklusiver Schulen wird sonderpädagogische Förderung zum integralen Merkmal des Bildungsangebotes und steht als Serviceleistung allen Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften zur Verfügung. Damit stehen sonderpädagogische Lehrkräfte vor der Aufgabe, ihr Arbeitsfeld komplett in die inklusive Schule zu verlegen. Förderzentren ohne Schüler/-innen können in diesem Fall weiterhin als Anlauf- und Koordinierungsstelle für den regionalen sonderpädagogischen Förderauftrag fungieren. (HEIMLICH, 104) Sonderpädagogische Förderung trägt aus systemischer Sicht in der inklusiven Schule zur Erhöhung der Problemlösekompetenz im System allgemeine Schule bei, um durch die Reintegration sonderpädagogischer Fachkompetenz individuelle Diagnose- und Förderangebote für alle Schüler/-innen bereithalten zu können. (HEIMLICH, 107) Sonderpädagogische Förderung trägt aus materialistischer Sicht in inklusiven Schulen zur Kooperation aller Beteiligten bei und unterstützt das gemeinsame Lernen am gemeinsamen Gegenstand als Kern jeglicher schulischer Integration. (HEIMLICH, 107) Sonderpädagogische Förderung trägt aus interaktionistischer Sicht dann zur Entwicklung inklusiver Schulen bei, wenn sie in allgemeinen Schulen für intensive soziale Beziehungen zwischen allen Schülerinnen und Schülern sorgt und gleichzeitig versucht, jede Form von Etikettierung und Stigmatisierung von vornherein zu verhindern. (HEIMLICH, 111) Stuttgart (Kohlhammer) 2012 Auszüge von H.J.Knier
3 Sonderpädagogische Förderung trägt aus ökologischer Sicht dazu bei, dass inklusive Bildung auf allen Ebenen des Schulsystems etabliert wird und begleitend dazu ein Unterstützungsnetzwerk ausgebildet wird. (HEIMLICH, 113) Das Eintreten für Inklusion ist verbunden mit einem Verzicht auf Zuordnung zu Behinderungen, ein Sachverhalt, der bereits in der Entstehungsphase inklusiver Modelle mit dem Begriff Dekategorisierung bezeichnet wurde. Der Verzicht auf Begriffe, die Defizite benennen, erschwert die Einforderung zusätzlicher Hilfen für spezielle Kinder. Dieser Umstand wurde mit dem Begriff Etikettierungs- Ressourcen-Dilemma bezeichnet (WOCKEN 1996). (BIEWER / FASCHING, 138) Das Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma spiegelt sich in drei thematischen Bereichen wider: bei der Identifizierung der Schüler; soll überhaupt die Zuschreibung eines besonderen Status erfolgen? beim Lehrplan; sollen die Schüler mit Behinderungen oder Lernschwierigkeiten nach dem Lehrplan der allgemeinen Schule oder nach einem besonderen Lehrplan unterrichtet werden? bei der schulischen Platzierung; wo ist die Grenze der Unterrichtung in allgemeinen Schulen. insbesondere bei Schüler/-innen mit schweren Behinderungen? (BIEWER / FASCHING, 138) Inklusion erfordert Individualisierung so weit wie möglich unter Berücksichtigung des sozialen Systems so weit wie nötig. Ein didaktisches Denken in Kategorien von Standardschülern, Standardklassen und Standardangeboten nützt dabei noch weniger als sonst (KAHLERT / HEIMLICH, 158) Hinzu kommt, dass die soziale Gemeinschaft Unterricht Kompromisse verlangt zwischen dem Wunsch nach möglichst differenzierter Erfassung und Berücksichtigung der Lernvoraussetzungen jedes einzelnen Kindes und dem Zwang, unter den Bedingungen knapper pädagogischer Ressourcen eine für alle zufriedenstellende und förderliche Lernumgebung zu gestalten: Zeit, Aufmerksamkeit für den einzelnen Schüler, Wahrnehmung von Lernschwierigkeiten und fortschritten sind nicht beliebig vermehrbar. (KAHLERT / HEIMLICH, 159) Die gewollte Einbettung individuellen Lernens in eine Lernumgebung, die der Einzelne mit anderen teilt, schränkt den Spielraum ein, der den subjektiv ausgeprägten Lernstilen und Bearbeitungsweisen eingeräumt werden kann. Differenzierungsangebote können diesen Spielraum ausweiten, aber die Organisationsform des Lernens in Gruppen bzw. in der Schulklasse macht es nicht möglich, individuellen Interessen, Lernstilen, Verarbeitungsweisen beliebig weit entgegen zu kommen. Nicht jede Aktivität, nicht jede Idee, nicht jede Inanspruchnahme von Zeit, pädagogischem Engagement, Zuwendung anderer, sachlicher Mittel etc. kann akzeptiert werden, wenn möglichst vielen die Chance gegeben werden soll, im Unterricht eine individuell förderliche Auseinandersetzung mit den jeweiligen Inhalten zu finden. (KAHLERT / HEIMLICH, 159) Diese Einschränkungen gelten auch für die Realisierung von Erwartungen an die Diagnostik. Selbst die versierteste Lehrkraft kann nicht mehr tun, als auf der Basis einer angemessenen Diagnose der Lernvoraussetzungen Lernangebote zu arrangieren, von denen sie möglichst gut begründbar annehmen kann, dass sie für die Bildungsentwicklung der Schülerinnen und Schüler förderlich sind. Allerdings lässt sich weder die Lernausgangslage noch das Lernen beliebig umfassend und genau erschließen. Ob man Kinder einzeln oder in Gruppen befragt, ihr Verhalten beobachtet, auswertet, was sie malen, erzählen oder aufschreiben, oder sie mit spezialisierten Instrumenten nach allen Regeln der diagnostischen Kunst untersucht nie erhält man Einblick in das, was tatsächlich gerade im lernenden Kind vor sich geht, sondern nur Einblick in das, was die jeweilige Beobachtungsweise hergibt. (KAHLERT / HEIMLICH, 159) Stuttgart (Kohlhammer) 2012 Auszüge von H.J.Knier
4 In der Regel verbinden wir im alltäglichen Sprachgebrauch mit dem Begriff der Förderung ein passives Geschehen im Sinne von Fremd-Förderung: jemand oder etwas wird gefördert oder befördert. Kritisiert wird daran die mangelnde Berücksichtigung des Rechts auf Selbstbestimmung, das selbstverständlich auch für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf gilt. In Vergessenheit geraten ist dabei das aktive Begriffsverständnis im Sinne eines Vorgangs der Selbst-Förderung. Kinder und Jugendliche setzen sich aber auch selbst Lernziele, strengen sich an, um diese zu erreichen, und überprüfen, ob sie das tatsächlich geschafft haben. Sie fördern sich also in gewisser Weise auch selbst. (KAHLERT / HEIMLICH, 163) Mit sonderpädagogischer Förderung ist nicht nur der Einsatz spezifischer Fördermaterialien in der Interaktion mit Kindern und Jugendlichen, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben, gemeint. Sonderpädagogische Förderung im weiteren Sinne umfasst sowohl die Diagnose als auch die Intervention und die Evaluation. Begleitend finden häufig kommunikative Prozesse mit allen Beteiligten im Rahmen von Beratung statt. Zu einem pädagogischen Handlungskonzept wird sonderpädagogische Förderung allerdings erst, wenn diese Einzelaspekte in einen systematischen Begründungszusammenhang hineingestellt werden. (KAHLERT / HEIMLICH, 164) Sonderpädagogische Förderung beginnt mit einer Phase der eingehenden Förderdiagnostik ausgehend von einem Lern- und Entwicklungsproblem. Wenn das Lernen schwierig wird, so ist es zunächst einmal erforderlich, genau abzuklären, worin das jeweilige Lernproblem besteht. Der Augenschein trügt häufig. Sonderpädagogische Förderdiagnostik richtet ihr Interesse von daher zuallererst auf eine möglichst genaue Abklärung der zugrunde liegenden Problemlage beim Kind. Dabei hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Probleme des Kindes nicht isoliert für sich betrachtet werden können, sondern stets in sein jeweiliges Umfeld hineinzustellen sind. Neben der erschwerten Lernsituation des Kindes gilt es ebenso, die häufig problematische Lebenssituation in den Blick zu nehmen. (KAHLERT / HEIMLICH, 164) Bezogen auf die sonderpädagogische Intervention im engeren Sinne kann zwischen direkten und indirekten Förderstrategien unterschieden werden. Direkte Förderung findet immer dann statt, wenn das jeweilige Lernproblem (z.b. im Lesen, Schreiben, Rechnen oder beim Sachwissen) unmittelbar zum Gegenstand der Förderung gemacht wird Darüber hinaus haben Heil- und Sonderpädagoginnen und pädagogen aber stets auch Interesse daran, mögliche Ursachen und Bedingungsfaktoren für Lernschwierigkeiten zu klären und hier mit der Förderung anzusetzen. Immer dann, wenn kognitive, senso-motorische, kommunikative, soziale und emotionale Voraussetzungen des Lernens gefördert werden, sprechen wir von indirekter Förderung. (KAHLERT / HEIMLICH, 164) Realisiert werden kann sonderpädagogische Intervention in sehr unterschiedlichen Formen. Sowohl im Klassenunterricht als auch in der Kleingruppen- und Einzelförderung können sonderpädagogische Aspekte berücksichtigt werden. Sonderpädagogische Intervention ist deshalb auch nicht zu reduzieren auf die Einzelfördersituation außerhalb des Klassenverbandes. Weder in Förderschulen bzw. Förderzentren noch in allgemeinen Schulen wird die Qualität sonderpädagogischer Förderung erst an der Einzelfördersituation ablesbar. (KAHLERT / HEIMLICH, 166) Evaluation sonderpädagogischer Intervention findet gegenwärtig vielfach noch im dialogischen Verfahren über Auswertungsgespräche der beteiligten sonderpädagogischen Fachkräfte in größeren zeitlichen Abständen im laufenden Interventionsprozess statt im besten Fall mit Eltern und Kindern (formative Evaluation). Der Einsatz von standardisierten Evaluationsinstrumenten (z.b. förderdiagnostische Tests) nach einem längeren Interventionsprozess dürfte demgegenüber noch die Ausnahme darstellen (summative Evaluation). (KAHLERT / HEIMLICH, 166) Stuttgart (Kohlhammer) 2012 Auszüge von H.J.Knier
5 Sonderpädagogische Förderung ist insgesamt auf Kooperation und Kommunikation zwischen allen Beteiligten gleich an welchem Förderort angewiesen. Ohne Beratung ist sonderpädagogische Förderung schlichtweg nicht mehr durchführbar. Dabei kommt es insbesondere darauf an, dass die Beteiligten sich auf Augenhöhe begegnen und in der jeweiligen Beratungs-situation als gleichberechtigte und aktive Teilnehmer/-innen betrachtet werden. Die Kommunikation soll so ausgelegt sein, dass ein Prozess des gegenseitigen Sichberatens stattfinden kann. Im Modell der kooperativen Beratung (MUTZECK 2008) kommt dieses Anliegen besonders gut zum Ausdruck. Auch Kinder und ihre Eltern sind dabei als kompetente Gesprächspartner/innen zu betrachten, die ihre eigenen Fähigkeiten zur Lösung des Problems der sonderpädagogischen Förderung einbringen. (KAHLERT / HEIMLICH, 166f) Darüber hinaus sind Sonderpädagogen/-innen im Rahmen ihrer Tätigkeit in der allgemeinen Schule aber auch mit der Beratung von Lehrkräften beschäftigt. Das kann bis zur Beratung eines ganzen Teams einer Schule oder der Schule als System reichen, wenn z.b. im Rahmen eines Schulentwicklungsprojektes der Umgang mit Aggression und Gewalt im Sinne eines Präventivprogrammes in der gesamten Schule geändert werden soll. In jedem Fall benötigen sonderpädagogische Lehrkräfte gegenwärtig gute professionelle Kompetenzen in der Beratung und Kommunikation mit unterschiedlichen Personengruppen. (KAHLERT / HEIMLICH, 167) Neben die Handlungsfähigkeit von Sonderpädagoginnen und pädagogen tritt nun im professionellen Zusammenhang stets auch die Fähigkeit, über ihr konkretes Tun zu reflektieren. Nachdenken über sonderpädagogische Förderung findet z.b. schon dann statt, wenn sich sonderpädagogische Lehrkräfte mit Eltern, Kindern und anderen Lehrkräften über die geplanten sonderpädagogischen Interventionen beraten. Die Beteiligten sind nicht nur daran interessiert zu erfahren, wie effektiv eine sonderpädagogische Intervention sein könnte, sondern wollen auch wissen, warum ausgerechnet diese Maßnahmen vorgeschlagen werden. Sonderpädagoginnen und pädagogen geraten in solchen Gesprächen rasch unter einen erhöhten Legitimationsdruck und müssen gelernt haben, ihr Handeln zu begründen. (KAHLERT / HEIMLICH, 167) Im materialistischen Paradigma sonderpädagogischer Förderung wird besonders die Entwicklungsorientierung betont. Im Anschluss an den russischen Psychologen Lev VYGOTSKIJ ( ) sprechen wir in diesem Zusammenhang von der Zone der nächsten Entwicklung. VYGOTSKIJ hat mit seinen Forschungen zur Entwicklung der Sprache von Kindern dazu beigetragen, dass wir heute den Entwicklungsstand eines Kindes als Basis sonderpädagogischer Intervention betrachten können ( Zone der aktuellen Entwicklung ). Davon ausgehend ist es mit Hilfe entwicklungspsychologischer Kenntnisse möglich, zukünftige Entwicklungsziele abzuleiten und in eine entwicklungsorientierte Förderung einzubringen. Sonderpädagogische Förderung bezieht sich seither in einem basalen Sinne auf die Förderung von zentralen Entwicklungsbereichen in sensorischer, kommunikativer, kognitiver, emotionaler und sozialer Hinsicht. (KAHLERT / HEIMLICH, 167f) Demgegenüber betont das interaktionistische Paradigma die Bedeutung der sozialen Beziehungen für die sonderpädagogische Förderung. Erst wenn wir in einen intensiven Dialog mit Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf eintreten, werden wir überhaupt eine Grundlage für Fördermaßnahmen entwickeln können. Ohne Vertrauen in eine verlässliche Bezugsperson sind auch noch so ausgeklügelte sonderpädagogische Interventionen zum Scheitern verurteilt. Zugleich werden aus dieser Betrachtungsweise heraus soziale Prozesse deutlich, die den Umgang mit Behinderung in der Gesellschaft verstehen lehren. Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf stehen nach wie vor in der großen Gefahr, gesellschaftlich ausgegrenzt und an den Rand gedrängt zu werden. Ihr Sonderstatus führt zu Etikettierung und Stigmatisierung und bleibt so nicht ohne Folgen für ihr Selbstbild. (KAHLERT / HEIMLICH, 168) Stuttgart (Kohlhammer) 2012 Auszüge von H.J.Knier
6 Schließlich lehrt das ökologische Paradigma sonderpädagogischer Förderung die Bedeutung des Umfelds für die Entstehung und Verfestigung von Behinderung. Behinderung wird geradezu als gestörte Integration in das Umfeld-System definiert und verweist so auf den Kind-Umfeld-Zusammenhang jeglicher sonderpädagogischer Förderung. Damit ist neben den vielfältigen sozialen Beziehungen auch die Qualität der räumlichmateriellen Umwelt von Kindern gemeint, nicht nur in der Familie und im Wohnumfeld, sondern auch in der Schule Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind angewiesen auf eine Lernumgebung, die sich durch sensorische Multifunktionalität auszeichnet und ihren individuellen Förderbedürfnissen so auf möglichst vielfältige Art zu entsprechen versucht. (KAHLERT / HEIMLICH, 168) Bei der sonderpädagogischen Förderplanung treten wir ein in einen Prozess der didaktischen Reflexion Nach der Ermittlung der Lern- und Entwicklungsausgangslage von Kindern gilt es, aus einem möglichen Spektrum von notwendigen Fördermaßnahmen diejenigen für die Intervention begründet auszuwählen, die zum gegebenen Zeitpunkt als besonders dringlich angesehen werden müssen. Hier ist in der Regel eine didaktische Reduktion erforderlich, weil Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf häufig einen Förderbedarf in mehreren Lern- und Entwicklungsbereichen aufweisen. Dieser kann jedoch meist nicht gleichzeitig angegangen werden, dass die Kinder und auch die Lehrkräfte völlig überfordern würde. Ein Auswahlkriterium dabei kann z.b. sein, dass die Lern- und Entwicklungsbereiche in den Vordergrund gestellt werden, die auch kurzfristig größere Erfolge erwarten lassen. (KAHLERT / HEIMLICH, 168f) Dahinter steht die Überlegung, dass Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf bereits mit Versagensängsten konfrontiert wurden und von daher ihre Lernmotivation vielfach erst wieder rekonstruiert werden muss. Diese Motivationsprobleme können bis zur Ablehnung schulischer Lernprozesse oder auch zur Meidung der Schule insgesamt führen. Eine vielversprechende Förderstrategie ist auch das Ansetzen an mindestens zwei Problembereichen, z.b. die Förderung des Sachwissens und der Lernmotivation, indem neben den Förderinhalten aus dem Lernbereich Sachunterricht durch handlungsorientierte Lernangebote und Möglichkeiten der individuellen Selbst- sowie Partnerkontrolle auch die Lernmotivation gezielt weiterentwickelt wird. (KAHLERT / HEIMLICH, 169) Auch die Ressourcen für sonderpädagogische Förderung in zeitlicher, räumlicher und personeller Hinsicht sind in der Planungsphase genau zu überprüfen, bevor der Förderprozess im Detail starten kann. Die Planung der sonderpädagogischen Förderung zählt zu den entscheidenden Qualitätsstandards, unabhängig davon, an welchem Förderort dies realisiert wird. (KAHLERT / HEIMLICH, 169) Zum Förderplan liegen inzwischen gut erprobte und praxiswirksame Handreichungen vor Als Basiskomponenten sollten in jedem Fall die konkreten Förderbereiche, die daraus abgeleiteten Fördermaßnahmen im Sinne einer begründeten Auswahl sowie die Organisation der Förderung und der geplante Förderverlauf dokumentiert sein. Im Gesamtverlauf der sonderpädagogische Förderung wird sich allenfalls zu Beginn ein ausführlicher Förderplan erstellen lassen, während zur Fortschreibung der Förderung nach der Zwischenevaluation auch Kurzformen eingesetzt werden können Für die Planung einzelner Fördermaßnahmen bieten sich unterschiedliche zeitliche Reichweiten an, die letztlich nur individuell ausgerichtet werden können. Die Didaktik der sonderpädagogischen Förderung überschreitet den ausschließlichen Bezug zur Unterrichtsebene Schulklasse, weil sie neben dem Klassenunterricht auch die Einzel- und Kleingruppenförderung umfasst. (KAHLERT / HEIMLICH, 169) In den letzten vier Jahrzehnten der Integrationsentwicklung hat sich in Deutschland gezeigt, dass die Qualität sonderpädagogischer Förderung auch in der allgemeinen Schule sichergestellt werden kann. Besonders in den Modellversuchen der 1980er Jahre wurde der gemeinsame Unterricht in der allgemeinen Schule auf Herz und Nieren geprüft. Stuttgart (Kohlhammer) 2012 Auszüge von H.J.Knier
7 Dabei zeigte sich im Ergebnis, dass alle Schüler/-innen in Bezug auf Toleranz und Umgang mit Unterschieden davon profitieren, sich die Schulleistungen der Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf teilweise sogar verbesserten und sich die der Schüler/-innen ohne sonderpädagogischem Förderbedarf jedenfalls nicht verschlechterten. Auch die Zufriedenheit der Eltern sowie der Lehrkräfte stieg in Verbindung mit den Erfahrungen, die sie mit der Integration sammeln konnten. (KAHLERT / HEIMLICH, 170) Für Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf ergibt sich in der allgemeinen Schule häufig das Problem, dass Lerninhalte zu früh oder gar ausschließlich auf der symbolischen Ebene dargeboten werden. Dies ist besonders zu Beginn der Grundschulzeit problematisch, weil Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Regel mit einem zweijährigen Entwicklungsrückstand eintreten und in kognitiver Hinsicht noch auf der Stufe der konkreten Operationen stehen Die didaktische Herausforderung des gemeinsamen Unterrichts besteht also besonders darin, Lerninhalte von der abstrakt-symbolischen Ebene auf eine anschaulich-handlungsorientierte Ebene zu transferieren. Sonderpädagogischen Förderung wirkt sich hier gleichsam implizit auf die Gestaltung des integrativen Unterrichts aus. Dies wirkt sich besonders bei den Unterrichtsprinzipien deutlich, die die innere Seite dieses Unterrichtskonzeptes ausmachen. (KAHLERT / HEIMLICH, 171) Mit Unterrichtsprinzipien sind hier allgemeine Handlungsorientierungen der Lehrkräfte gemeint, die in ihre konkrete Unterrichtsgestaltung einfließen Als hilfreich für den integrativen Unterricht haben sich auf der Schülerseite besonders Prinzipien wie Selbsttätigkeit, Handlungsorientierung, Lernen mit Stimulierung mehrerer Sinne und soziales Lernen erwiesen. Über die Berücksichtigung dieser Prinzipien wird ein Unterricht ermöglicht, in dem die Schüler/-innen aktiv Lernende sein sollen, vielfältige sinnliche Lernerfahrungen machen und dabei selbst gewählte soziale Kontakte knüpfen können. Der integrative Unterricht sollte also besonders umfassende Möglichkeiten für Schüler/-innen bieten, Lerngegenstände selbst zu konstruieren und selbst zu entdecken. (KAHLERT / HEIMLICH, 171) Demgegenüber ist auf der Inhaltsseite des integrativen Unterrichts auf Prinzipien wie Zielorientierung, Bedürfnis- und Situationsorientierung sowie Fächerverbindung zu achten. Aufgrund der heterogenen Lernbedürfnisse in integrativen Klassen ist es erforderlich, auch die Lernziele zu differenzieren und zu individualisieren. Hilfreich ist ebenfalls die Orientierung auf die lebensweltlichen Erfahrungen der Schüler/-innen und der Versuch, diese in den Unterricht einzubinden. Dabei wird nach allen vorliegenden Erfahrungen ein Unterricht entstehen, der über die traditionellen Fächergrenzen hinausragt und fächerverbindende Elemente stärker betont. In jedem Fall sind Lehrkräfte im integrativen Unterricht auch gefordert, ihre strukturelle sowie curriculare Kompetenz einzubringen und instruierende Unterrichtsphasen bereitzuhalten, gerade wenn es um neue Lerninhalte geht. Schüler/-innen mit gravierenden Lernschwierigkeiten profitieren von solchen Unterrichtsphasen besonders Auch sollten Phasen der Instruktion und Phasen der Konstruktion in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. (KAHLERT / HEIMLICH, 171f) Betrachten wir die äußere Seite des integrativen Unterrichts, so treten zunächst einmal zahlreiche schülerzentrierte Unterrichtsformen wie Freiarbeit, Wochenplan, Gesprächskreis und Stationenlernen in den Blickpunkt Gerade aufgrund der großen Heterogenität in integrativen Klassen ist es unabdingbar, die Lerntätigkeiten der Schüler/-innen so zu organisieren, dass möglichst individuelle Lernwege entstehen können und jeder Schüler bzw. jede Schülerin auf dem jeweiligen Entwicklungsniveau arbeiten kann. Gerade Freiarbeit und Wochenplan bieten sich an, um die notwendige Individualisierung und Differenzierung vornehmen zu können. Im Extremfall kann es hier so weit gehen, dass innerhalb einer Stunde jede Schülerin und jeder Schüler an einer anderen Aufgabe arbeitet. Die Gemeinsamkeit im integrativen Unterricht wird dann wiederum durch den Gesprächskreis mit allen Schüler/-innen und allen Lehrkräften oder durch die Arbeit an einem gemeinsamen Thema im Rahmen des Stationenlernens hergestellt. (KAHLERT / HEIMLICH, 172) Stuttgart (Kohlhammer) 2012 Auszüge von H.J.Knier
8 Aber der integrative Unterricht benötigt ebenso eher lehrerzentrierte Unterrichtsformen wie Lehrgänge, Übungsphasen sowie Einzel- und Kleingruppenförderung. In lehrgangsartigen Unterrichtsphasen werden neue Lerninhalte von der Lehrkraft in einer strukturierten und sachkompetenten Weise aufbereitet und präsentiert. Aus sonderpädagogischer Sicht gilt es dabei vor allem auf unterschiedliche Präsentationsformen zu achten, damit auch hier unterschiedliche Lernzugänge eröffnet werden. Von der Lehrkraft vorbereitete und kontrollierte Übungen dienen der Festigung und Sicherung eines Lerninhaltes, wobei insbesondere in diesem Bereich auf vielfältige und aktive Lernangebote zu achten ist. Gerade Übungsphasen sollten sich durch ein hohes Maß an Differenzierung auszeichnen. Bei spezifischen Förderangeboten können sonderpädagogische Lehrkräfte im integrativen Unterricht Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf auch aus dem Klassenverband herausnehmen und separat fördern. (KAHLERT / HEIMLICH, 171) Fassen wir die Erfahrungen mit dem integrativen Unterricht in Deutschland zusammen, so ergibt sich durchaus das Bild eines differenzierten und individualisierenden Unterrichtsgeschehens. Problematisch erscheint an diesem Konzept allerdings zunehmend, dass für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf wiederum besondere Lernwege, besondere Organisationsformen und besondere Förderangebote unterbreitet werden. Das damit verbundene Risiko der sozialen Ausgrenzung und Diskriminierung im Klassenverband darf nicht unterschätzt werden. Insofern ist es angezeigt, über Möglichkeiten und Weiterentwicklung des integrativen Unterrichts unter dem neuen Leitbild der Inklusion nachzudenken. (KAHLERT / HEIMLICH, 172f) Im Unterschied zum integrativen Unterricht versucht der inklusive Unterricht nun noch einen Schritt weiterzugehen und die Teilhabe aller Schüler/-innen in allen Unterrichtsphasen zu gewährleisten Als hilfreich erweist sich hier beispielsweise das Modell von Jerome S. BRUNER, der zwischen enaktiven, ikonischen und symbolischen Ebenen der Repräsentation von Unterrichtsinhalten unterscheidet. Der eine gemeinsame Lerninhalt kann sowohl handelnd als auch bildlich und mit Hilfe von abstrakten Zeichen wie Buchstaben oder Zahlen dargestellt werden. Die Schüler/-innen ohne sonderpädagogischem Förderbedarf sollen ebenfalls auf der enaktiven und der ikonischen Ebene lernen, damit sie den Lerninhalt möglichst von vielen Seiten erschließen können und eben nicht nur abstrakt-symbolisch. Für Schüler/-innen mit dem Förderbedarf geistige Entwicklung wird die symbolische Ebene in der Regel eine Überforderung darstellen. Sie können aber über die enaktive Ebene genauso beteiligt werden und sich im Rahmen der inklusiven Kleingruppenarbeit wiederum aktiv einbringen. (KAHLERT / HEIMLICH, 173f) Entscheidende Voraussetzung für einen inklusiven Unterricht ist eine veränderte Lernkultur, wie sie Horst RUMPF (2010) beschreibt. Nach seiner Auffassung ist die gegenwärtige Schule viel zu sehr auf einen Lernbegriff im Sinne von Wissenserwerb und Kompetenz ausgerichtet. Demgegenüber sei ein Lernen erforderlich, das unter die Haut geht, sinnlich erfahrbar wird und sich auf die Begegnung mit dem Fremden, Fragmentarischen und Widerständigen einlässt Inklusiver Unterricht darf von daher nicht nur auf Sprache und Denken abzielen, sondern steht vielmehr vor der Aufgabe, alle Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten von Schülerinnen und Schülern auszuschöpfen. Aus sonderpädagogischer Sicht sollten bei der inhaltlichen und methodischen Ausgestaltung stets die verschiedenen Entwicklungsbereiche berücksichtigt werden. Vor dem Hintergrund der modernen Entwicklungspsychologie ist dabei insbesondere an kognitive, kommunikative, sensomotorische, soziale und emotionale Aspekte zu denken. (KAHLERT / HEIMLICH, 174) Bei der Entwicklung eines inklusiven Bildungssystems im Sinne der VN-BRK kommt dem inklusionsorientierten Unterricht eine Schlüsselrolle zu. In vielen inklusionsorientiert arbeitenden Schulen ergeben sich derzeit bereits inklusive Momente im gemeinsamen Unterricht. Die darauf aufbauende Unterrichtsentwicklung zielt insbesondere auf einen deutlichen Ausbau der Differenzierung und Individualisierung in allen allgemeinen Schulen ab. Stuttgart (Kohlhammer) 2012 Auszüge von H.J.Knier
9 49 Sonderpädagogische Förderung wächst in diesem Entwicklungsprozess mehr und mehr in die allgemeine Schule hinein und findet im inklusiven Unterricht gleichsam implizit statt: im differenzierten Klassenunterricht mit der gesamten Lerngruppe, in der Freiarbeit und im Wochenplanunterricht, beim Stationenlernen, in Förderstunden und in der Einzel- sowie Kleingruppenförderung. (KAHLERT / HEIMLICH, 175) Immer wenn es um die Förderung basaler Kompetenzen im Sinne der kognitiven, kommunikativen, sensomotorischen, sozialen und emotionalen Entwicklungsbereiche geht, sind sonderpädagogische Lehrkräfte mit ihrer Diagnose-Förderkompetenz unverzichtbar. Sie wirken gleichsam als Botschafter/-innen der Individualisierung in den allgemeinen Schulen auf dem Weg zur Inklusion. (KAHLERT / HEIMLICH, 175) Stuttgart (Kohlhammer) 2012 Auszüge von H.J.Knier
Die Behindertenrechtskonvention. Sonderpädagogik Plenumsvortrag auf der Fachtagung der KMK am in Bremen
 Department für Pädagogik und Rehabilitation Lehrstuhl Lernbehindertenpädagogik, Prof. Dr. Ulrich Heimlich Die Behindertenrechtskonvention (BRK) und die Sonderpädagogik Plenumsvortrag auf der Fachtagung
Department für Pädagogik und Rehabilitation Lehrstuhl Lernbehindertenpädagogik, Prof. Dr. Ulrich Heimlich Die Behindertenrechtskonvention (BRK) und die Sonderpädagogik Plenumsvortrag auf der Fachtagung
Fallbasiertes Arbeiten in der Lehrerbildung
 Differenz als Gewinn inklusiv unterrichten in der Grundschule Fallbasiertes Arbeiten in der Lehrerbildung ALP Dillingen, 10.12.2012 Prof. Dr. Joachim Kahlert Direktor des Münchener Zentrums für Lehrerbildung
Differenz als Gewinn inklusiv unterrichten in der Grundschule Fallbasiertes Arbeiten in der Lehrerbildung ALP Dillingen, 10.12.2012 Prof. Dr. Joachim Kahlert Direktor des Münchener Zentrums für Lehrerbildung
Profilbildung inklusive Schule ein Leitfaden für die Praxis
 Profilbildung inklusive Schule ein Leitfaden für die Praxis Prof. Dr. Erhard Fischer Prof. Dr. Ulrich Heimlich Prof. Dr. Joachim Kahlert Prof. Dr. Reinhard Lelgemann Übersicht Einleitung Wissenschaftlicher
Profilbildung inklusive Schule ein Leitfaden für die Praxis Prof. Dr. Erhard Fischer Prof. Dr. Ulrich Heimlich Prof. Dr. Joachim Kahlert Prof. Dr. Reinhard Lelgemann Übersicht Einleitung Wissenschaftlicher
1.1. Inklusiver Unterricht Sonderpädagogische Unterstützung
 1-1 Inhalt 1. Individuelle Förderung und sonderpädagogische Unterstützung im Gemeinsamen Lernen... 1-2 1.1. Inklusiver Unterricht... 1-3 1.1.1 Begriffliches / Definitionen... 1-4 1.2 Sonderpädagogische
1-1 Inhalt 1. Individuelle Förderung und sonderpädagogische Unterstützung im Gemeinsamen Lernen... 1-2 1.1. Inklusiver Unterricht... 1-3 1.1.1 Begriffliches / Definitionen... 1-4 1.2 Sonderpädagogische
Inklusion an der Cäcilienschule Grundsätze, Ziele und Praxisvorstellungen Einführungsreferat zur Auftaktveranstaltung am
 Inklusion an der Cäcilienschule Grundsätze, Ziele und Praxisvorstellungen Einführungsreferat zur Auftaktveranstaltung am 16.09.2013 Ausgangsfragen! Was wird von uns im Rahmen der Inklusion verlangt?! Was
Inklusion an der Cäcilienschule Grundsätze, Ziele und Praxisvorstellungen Einführungsreferat zur Auftaktveranstaltung am 16.09.2013 Ausgangsfragen! Was wird von uns im Rahmen der Inklusion verlangt?! Was
Klausurthemen Pädagogik bei geistiger Behinderung. Sonderpädagogische Qualifikation: Didaktik
 Klausurthemen Pädagogik bei geistiger Behinderung Sonderpädagogische Qualifikation: Didaktik Frühjahr 90: 1. Geistige Behinderung, Sprache und Kommunikation als unterrichtliche Aufgabenstellung 2. Stellen
Klausurthemen Pädagogik bei geistiger Behinderung Sonderpädagogische Qualifikation: Didaktik Frühjahr 90: 1. Geistige Behinderung, Sprache und Kommunikation als unterrichtliche Aufgabenstellung 2. Stellen
lntegrativen Lerngruppe
 Wilhelm-Frede-Schule Gemei nsch afts h au ptsch u le Kleve-Rindern Konzept zur Einrichtung einer lntegrativen Lerngruppe in der Klasse 5 für das Schuljahr 2009 110 1. Merkmale einer integrativen Lerngruppe
Wilhelm-Frede-Schule Gemei nsch afts h au ptsch u le Kleve-Rindern Konzept zur Einrichtung einer lntegrativen Lerngruppe in der Klasse 5 für das Schuljahr 2009 110 1. Merkmale einer integrativen Lerngruppe
Partizip -Ein Überblick
 Partizip -Ein Überblick Inventur der Tätigkeiten 1. Partizipationsmuster identifizieren 2. Liste von Aktivitäten einer Unterrichtssituation darstellen 3. Partizipationsmuster der Peers - Was machen die
Partizip -Ein Überblick Inventur der Tätigkeiten 1. Partizipationsmuster identifizieren 2. Liste von Aktivitäten einer Unterrichtssituation darstellen 3. Partizipationsmuster der Peers - Was machen die
Fallbasiertes Arbeiten in der Lehrerbildung
 Inklusionsdidaktische Netze - gemeinsam lernen - Fallbasiertes Arbeiten in der Lehrerbildung München, 24.01.2013 Prof. Dr. Joachim Kahlert Direktor des Münchener Zentrums für Lehrerbildung der Ludwig-Maximilians-
Inklusionsdidaktische Netze - gemeinsam lernen - Fallbasiertes Arbeiten in der Lehrerbildung München, 24.01.2013 Prof. Dr. Joachim Kahlert Direktor des Münchener Zentrums für Lehrerbildung der Ludwig-Maximilians-
Inklusion auf dem Weg zum gemeinsamen Lernen
 Inklusion auf dem Weg zum gemeinsamen Lernen Ist-Zustand und Perspektiven inklusiver Beschulung im Regierungsbezirk Düsseldorf und Konsequenzen für die Lehrerausbildung Gliederung Stand der Inklusion heute
Inklusion auf dem Weg zum gemeinsamen Lernen Ist-Zustand und Perspektiven inklusiver Beschulung im Regierungsbezirk Düsseldorf und Konsequenzen für die Lehrerausbildung Gliederung Stand der Inklusion heute
Inklusiv orientierte Unterrichtsgestaltung und Aufgaben der Pädagogischen Diagnostik
 Reimer Kornmann www.ph heidelberg.de/wp/kornmann Inklusiv orientierte Unterrichtsgestaltung und Aufgaben der Pädagogischen Diagnostik Eine ausführliche Fassung des Vortrags mit detaillierten Beschreibungen
Reimer Kornmann www.ph heidelberg.de/wp/kornmann Inklusiv orientierte Unterrichtsgestaltung und Aufgaben der Pädagogischen Diagnostik Eine ausführliche Fassung des Vortrags mit detaillierten Beschreibungen
Ausgewählte Ergebnisse aus der Befragung der Lehrkräfte und Eltern im Schulversuch ERINA im Schuljahr 2012/2013
 Erziehungswissenschaftliche Fakultät WB ERINA Prof. Dr. Katrin Liebers, Christin Seifert (M. Ed.) Ausgewählte Ergebnisse aus der Befragung der Lehrkräfte und Eltern im Schulversuch ERINA im Schuljahr 2012/2013
Erziehungswissenschaftliche Fakultät WB ERINA Prof. Dr. Katrin Liebers, Christin Seifert (M. Ed.) Ausgewählte Ergebnisse aus der Befragung der Lehrkräfte und Eltern im Schulversuch ERINA im Schuljahr 2012/2013
Inklusion. Grundlagen SPS Wahlrecht FBZ BBS
 Was ist Inklusion? Grundlagen SPS Wahlrecht FBZ BBS Grundlagen UN-BRK (26.3.2009, Ratifizierung) Art. 24 gewährleisten ein inklusives Bildungssystem ermöglichen Teilhabe an der Bildung treffen angemessene
Was ist Inklusion? Grundlagen SPS Wahlrecht FBZ BBS Grundlagen UN-BRK (26.3.2009, Ratifizierung) Art. 24 gewährleisten ein inklusives Bildungssystem ermöglichen Teilhabe an der Bildung treffen angemessene
Förderkonzept der IGS Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr
 Förderkonzept der IGS Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr Integration ist ein Grundrecht im Zusammenleben der Menschen, das wir als Gemeinsamkeit aller zum Ausdruck bringen. Es ist ein Recht, auf das jeder
Förderkonzept der IGS Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr Integration ist ein Grundrecht im Zusammenleben der Menschen, das wir als Gemeinsamkeit aller zum Ausdruck bringen. Es ist ein Recht, auf das jeder
Referat Inklusion.
 Referat Inklusion angela.ehlers@bsb.hamburg.de 1 Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen Artikel 7 Wohl des Kindes Gleichberechtigter Genuss aller Menschenrechte
Referat Inklusion angela.ehlers@bsb.hamburg.de 1 Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen Artikel 7 Wohl des Kindes Gleichberechtigter Genuss aller Menschenrechte
Die entwicklungslogische Didaktik statt Aussonderung. Simon Valentin, Martin Teubner
 Die entwicklungslogische Didaktik statt Aussonderung Simon Valentin, Martin Teubner Inhalt Begriffsdefinition Exklusion Separation Integration Inklusion Zahlen zur Integration Georg Feuser Entwicklungslogische
Die entwicklungslogische Didaktik statt Aussonderung Simon Valentin, Martin Teubner Inhalt Begriffsdefinition Exklusion Separation Integration Inklusion Zahlen zur Integration Georg Feuser Entwicklungslogische
Gemeinsames Lernen an der Möhnesee-Schule
 Gemeinsames Lernen an der Möhnesee-Schule Inhaltsverzeichnis 1. Zielgruppe 2. Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Umsetzung des Gemeinsamen Lernens 3. Aufgaben der Förderschullehrer/-innen 4. Zielsetzung
Gemeinsames Lernen an der Möhnesee-Schule Inhaltsverzeichnis 1. Zielgruppe 2. Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Umsetzung des Gemeinsamen Lernens 3. Aufgaben der Förderschullehrer/-innen 4. Zielsetzung
Auswirkungen des Artikel 24 der UN- Behindertenrechtskonvention auf die Arbeit der Pädagogen an allgemeinen und Förderschulen - Ausgangslage BRK
 Auswirkungen des Artikel 24 der UN- Behindertenrechtskonvention auf die Arbeit der Pädagogen an allgemeinen und Förderschulen - Ausgangslage BRK - Ausgangslage in den Ländern - Entwicklungen in der Sonderpädagogik
Auswirkungen des Artikel 24 der UN- Behindertenrechtskonvention auf die Arbeit der Pädagogen an allgemeinen und Förderschulen - Ausgangslage BRK - Ausgangslage in den Ländern - Entwicklungen in der Sonderpädagogik
Fortbildung und Beratung auf dem Weg zur inklusiven Schule. Qualifizierung von Inklusionsberaterinnen und Inklusionsberatern
 Fortbildung und Beratung auf dem Weg zur inklusiven Schule Qualifizierung von Inklusionsberaterinnen und Inklusionsberatern Hinter - Gründe 2009 von der Bundesregierung unterzeichnete UN Behindertenrechtskonvention
Fortbildung und Beratung auf dem Weg zur inklusiven Schule Qualifizierung von Inklusionsberaterinnen und Inklusionsberatern Hinter - Gründe 2009 von der Bundesregierung unterzeichnete UN Behindertenrechtskonvention
Inklusion. durch eine Vielfalt schulischer Angebote in Bayern. Pädagogische und rechtliche Aspekte
 MR Erich Weigl Inklusion durch eine Vielfalt schulischer Angebote in Bayern Pädagogische und rechtliche Aspekte 16.03.2013 1 1. Zur Philosophie einer inklusiven Schule oder: Um was geht es? 2. Zum Bayerischen
MR Erich Weigl Inklusion durch eine Vielfalt schulischer Angebote in Bayern Pädagogische und rechtliche Aspekte 16.03.2013 1 1. Zur Philosophie einer inklusiven Schule oder: Um was geht es? 2. Zum Bayerischen
Konzept zur Einrichtung Integrativer Lerngruppen an der Sekundarschule Kleve zum Schuljahr 2012/2013
 Konzept zur Einrichtung Integrativer Lerngruppen an der Sekundarschule Kleve zum Schuljahr 2012/2013 1. Präambel Die Sekundarschule Kleve ist eine Schule für alle Kinder mit unterschiedlichen Biographien
Konzept zur Einrichtung Integrativer Lerngruppen an der Sekundarschule Kleve zum Schuljahr 2012/2013 1. Präambel Die Sekundarschule Kleve ist eine Schule für alle Kinder mit unterschiedlichen Biographien
Gemeinsames Lernen an der Sternenschule
 Gemeinsames Lernen an der Sternenschule Im Schuljahr 2011 / 2012 hat sich das Kollegium der Sternenschule gemeinsam auf den Weg zur inklusiven Schulentwicklung gemacht. Seitdem nehmen auch Kinder mit festgestelltem
Gemeinsames Lernen an der Sternenschule Im Schuljahr 2011 / 2012 hat sich das Kollegium der Sternenschule gemeinsam auf den Weg zur inklusiven Schulentwicklung gemacht. Seitdem nehmen auch Kinder mit festgestelltem
LVR V -Dez e er e n r at S ch c ulen e u nd Ju J gen e d Landes e jugen e damt
 Die offene Ganztagsschule Bildungsort für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf? Fragen und Gedanken von Dr. Karin Kleinen Die UN-Konvention vom 3. Mai 2008 begründet ein internationales Recht von
Die offene Ganztagsschule Bildungsort für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf? Fragen und Gedanken von Dr. Karin Kleinen Die UN-Konvention vom 3. Mai 2008 begründet ein internationales Recht von
Entwicklung der inklusiven Schule - Qualitätssicherung-
 Entwicklung der inklusiven Schule - Qualitätssicherung- Andrea Herrmann Bern 2017 Freie Hansestadt Bremen Die Senatorin für Kinder und Bildung Inklusive Schule kann gelingen Inklusive Haltung Unterricht
Entwicklung der inklusiven Schule - Qualitätssicherung- Andrea Herrmann Bern 2017 Freie Hansestadt Bremen Die Senatorin für Kinder und Bildung Inklusive Schule kann gelingen Inklusive Haltung Unterricht
Werner-Egk-Grundschule Augsburg-Oberhausen Schule mit dem Profil Inklusion
 12.02.2015 Werner-Egk-Grundschule Augsburg-Oberhausen Schule mit dem Profil Inklusion 1 Kinder dieser Welt ca. 350 Schülerinnen und Schüler haben individuelle Stärken und Schwächen ca. 70 % weisen Migrationshintergrund
12.02.2015 Werner-Egk-Grundschule Augsburg-Oberhausen Schule mit dem Profil Inklusion 1 Kinder dieser Welt ca. 350 Schülerinnen und Schüler haben individuelle Stärken und Schwächen ca. 70 % weisen Migrationshintergrund
Programmatischer Text
 Stand: 17.08.2012 Sektion 1 Inhaltverzeichnis Grundsätzliches 4 Anspruchsniveaus pädagogischer Diagnostik im Bereich Schule 4 Funktionen und Ziele pädagogischer Diagnostik 5 Bedeutung von Lernprozessdiagnostik
Stand: 17.08.2012 Sektion 1 Inhaltverzeichnis Grundsätzliches 4 Anspruchsniveaus pädagogischer Diagnostik im Bereich Schule 4 Funktionen und Ziele pädagogischer Diagnostik 5 Bedeutung von Lernprozessdiagnostik
Kindertageseinrichtungen auf dem Weg
 Vielfalt begegnen ein Haus für alle Kinder Kindertageseinrichtungen auf dem Weg von der Integration zur Inklusion Von der Integration zur Inklusion den Blickwinkel verändern 2 Von der Integration zur Inklusion
Vielfalt begegnen ein Haus für alle Kinder Kindertageseinrichtungen auf dem Weg von der Integration zur Inklusion Von der Integration zur Inklusion den Blickwinkel verändern 2 Von der Integration zur Inklusion
Ausbildungsstandards in der saarländischen Lehrerbildung
 Ausbildungsstandards in der saarländischen Lehrerbildung Inhalt 1: Standards zur Lehrerpersönlichkeit... 1 Kompetenzbereich 2: Lehren und Lernen / schülerorientiert unterrichten... 2 Kompetenz 2.1: Unterricht
Ausbildungsstandards in der saarländischen Lehrerbildung Inhalt 1: Standards zur Lehrerpersönlichkeit... 1 Kompetenzbereich 2: Lehren und Lernen / schülerorientiert unterrichten... 2 Kompetenz 2.1: Unterricht
Konzept zur inklusiven Förderung März 2016
 Konzept zur inklusiven Förderung März 2016 1. Anlass der Antragsstellung 1.1. Lernen unter einem Dach 1.2. Aktuelle Situation 2. Sonderpädagogische Förderung 2.1. Grundlagen der Sonderpädagogischen Förderung
Konzept zur inklusiven Förderung März 2016 1. Anlass der Antragsstellung 1.1. Lernen unter einem Dach 1.2. Aktuelle Situation 2. Sonderpädagogische Förderung 2.1. Grundlagen der Sonderpädagogischen Förderung
1. Ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, zwischen pädagogischer und. sonderpädagogischer Förderung zu unterscheiden und dadurch die
 1. Ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, zwischen pädagogischer und sonderpädagogischer Förderung zu unterscheiden und dadurch die zustehenden Förderzeiten zu differenzieren? Diese Unterscheidung führt tatsächlich
1. Ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, zwischen pädagogischer und sonderpädagogischer Förderung zu unterscheiden und dadurch die zustehenden Förderzeiten zu differenzieren? Diese Unterscheidung führt tatsächlich
Die Seminare im Überblick
 Die Seminare im Überblick Seminar 1: Teamarbeit in der Rehabilitation Mit Anderen zu kooperieren, in einem Team zusammenzuarbeiten ist nicht neu. Dennoch scheint in vielen Stellenanzeigen die Forderung
Die Seminare im Überblick Seminar 1: Teamarbeit in der Rehabilitation Mit Anderen zu kooperieren, in einem Team zusammenzuarbeiten ist nicht neu. Dennoch scheint in vielen Stellenanzeigen die Forderung
1. Rechtliche Grundlagen & Begriffe
 Lehren und Lernen im Kontext von Beeinträchtigungen des Modul Inhalte 1 1. Rechtliche Grundlagen & Begriffe rechtliche Grundlagen (UN-BRK; Kinderrechtskonvention; Schul-, Sozial-, Behindertenrecht) KMK-Empfehlungen
Lehren und Lernen im Kontext von Beeinträchtigungen des Modul Inhalte 1 1. Rechtliche Grundlagen & Begriffe rechtliche Grundlagen (UN-BRK; Kinderrechtskonvention; Schul-, Sozial-, Behindertenrecht) KMK-Empfehlungen
Ausbildungsstandards in der saarländischen Lehrerbildung
 Ausbildungsstandards in der saarländischen Lehrerbildung Inhalt Standards zur Lehrerpersönlichkeit... 1 Kompetenzbereich 1: Lehren und Lernen / schülerorientiert unterrichten... 2 Kompetenz 1.1: Unterricht
Ausbildungsstandards in der saarländischen Lehrerbildung Inhalt Standards zur Lehrerpersönlichkeit... 1 Kompetenzbereich 1: Lehren und Lernen / schülerorientiert unterrichten... 2 Kompetenz 1.1: Unterricht
Auf dem Weg zur inklusiven Schule
 Auf dem Weg zur inklusiven Schule Das Pilotprojekt des Staatlichen Schulamts Brandenburg an der Havel Beginn: Schuljahr 2010/2011 Grundlagen und erste Ergebnisse Michael Frey/ Staatliches Schulamt Brandenburg
Auf dem Weg zur inklusiven Schule Das Pilotprojekt des Staatlichen Schulamts Brandenburg an der Havel Beginn: Schuljahr 2010/2011 Grundlagen und erste Ergebnisse Michael Frey/ Staatliches Schulamt Brandenburg
Inklusion eine Herausforderung für jede Schule
 Inklusion eine Herausforderung für jede Schule Jeder Mensch ist so individuell wie sein Fingerabdruck Inklusion als Rechtsfrage Inklusion als Haltungsfrage Inklusion als Entwicklungsfrage Inklusion eine
Inklusion eine Herausforderung für jede Schule Jeder Mensch ist so individuell wie sein Fingerabdruck Inklusion als Rechtsfrage Inklusion als Haltungsfrage Inklusion als Entwicklungsfrage Inklusion eine
Diagnostik im Alltag. BPS Studienseminar für Gymnasien/TDS Daun 2017
 Diagnostik im Alltag BPS Studienseminar für Gymnasien/TDS Daun 2017 Aus den Standards für Lehrerbildung Lehrerinnen und Lehrer diagnostizieren Lernvoraussetzungen und Lernprozesse von Schülerinnen und
Diagnostik im Alltag BPS Studienseminar für Gymnasien/TDS Daun 2017 Aus den Standards für Lehrerbildung Lehrerinnen und Lehrer diagnostizieren Lernvoraussetzungen und Lernprozesse von Schülerinnen und
Berufs- und sonderpädagogisches Handeln und Lernen
 Die PS-BS setzt sich für alle Schüler folgende Ziele: erfolgreicher Ausbildungsabschluss erfolgreicher Schulabschluss positive Persönlichkeitsentwicklung Eintreten für unsere freiheitlich-demokratische
Die PS-BS setzt sich für alle Schüler folgende Ziele: erfolgreicher Ausbildungsabschluss erfolgreicher Schulabschluss positive Persönlichkeitsentwicklung Eintreten für unsere freiheitlich-demokratische
PORTFOLIO - REFLEXIONSBOGEN HANDLUNGSFELD 1: Unterricht gestalten und Lernprozesse nachhaltig anlegen
 PORTFOLIO - REFLEXIONSBOGEN HANDLUNGSFELD 1: Unterricht gestalten und Lernprozesse nachhaltig anlegen 1. Lehrerinnen und Lehrer planen Unterricht fach- und sachgerecht und führen ihn sachlich und fachlich
PORTFOLIO - REFLEXIONSBOGEN HANDLUNGSFELD 1: Unterricht gestalten und Lernprozesse nachhaltig anlegen 1. Lehrerinnen und Lehrer planen Unterricht fach- und sachgerecht und führen ihn sachlich und fachlich
Es gilt das gesprochene Wort. I. Begrüßung Geschichte des Unterrichts von Menschen mit Behinderung. Anrede
 Sperrfrist: 31.01.2012, 13:00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort Rede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Bernd Sibler, anlässlich der Informationsveranstaltung
Sperrfrist: 31.01.2012, 13:00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort Rede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Bernd Sibler, anlässlich der Informationsveranstaltung
Studienordnung für den Lehramtsstudiengang mit dem Abschluss Erste Staatsprüfung für das Lehramt Sonderpädagogik
 11/138 Universität Leipzig Erziehungswissenschaftliche Fakultät Studienordnung für den Lehramtsstudiengang mit dem Abschluss Erste Staatsprüfung für das Lehramt Sonderpädagogik Dritter Teil: Fächer Kapitel
11/138 Universität Leipzig Erziehungswissenschaftliche Fakultät Studienordnung für den Lehramtsstudiengang mit dem Abschluss Erste Staatsprüfung für das Lehramt Sonderpädagogik Dritter Teil: Fächer Kapitel
II A 2/ II D 6/ II A 2.2 /II D 6 Die Mario Dobe/ K.-Jürgen Heuel/ Christiane Winter-Witschurke/ Thurid Dietmann 08/2017
 II A 2/ II D 6/ II A 2.2 /II D 6 Die Mario Dobe/ K.-Jürgen Heuel/ Christiane Winter-Witschurke/ Thurid Dietmann 08/2017 Informationen über die Veränderungen in der Diagnostik in den sonderpädagogischen
II A 2/ II D 6/ II A 2.2 /II D 6 Die Mario Dobe/ K.-Jürgen Heuel/ Christiane Winter-Witschurke/ Thurid Dietmann 08/2017 Informationen über die Veränderungen in der Diagnostik in den sonderpädagogischen
Konzept zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit autistischem Verhalten an der IGS Helpsen
 Konzept zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit autistischem Verhalten an der IGS Helpsen Vorbemerkung Das vorliegende Konzept ist Teil des Schulkonzepts der IGS Helpsen und bezieht sich auf die
Konzept zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit autistischem Verhalten an der IGS Helpsen Vorbemerkung Das vorliegende Konzept ist Teil des Schulkonzepts der IGS Helpsen und bezieht sich auf die
Portfolio Praxiselemente Eignungs- und Orientierungspraktikum
 Portfolio Praxiselemente Eignungs- und Orientierungspraktikum Name:... Anschrift:...... Schule des Eignungs- und Orientierungspraktikums:...... Zeitraum:... Standard 1: über die Fähigkeit, die Komplexität
Portfolio Praxiselemente Eignungs- und Orientierungspraktikum Name:... Anschrift:...... Schule des Eignungs- und Orientierungspraktikums:...... Zeitraum:... Standard 1: über die Fähigkeit, die Komplexität
Mobiler Dienst Sprache
 Mobiler Dienst Sprache Förderzentrum Schwerpunkt Sprache Erhebung Schule Im Großen Freien, 2007 Rahmenbedingungen 45 % Lehrkräfte 2 U.-Std Std.. MD 25 % Lehrkräfte 4 U.-Std Std.. MD vorwiegend 3. 6. Std.
Mobiler Dienst Sprache Förderzentrum Schwerpunkt Sprache Erhebung Schule Im Großen Freien, 2007 Rahmenbedingungen 45 % Lehrkräfte 2 U.-Std Std.. MD 25 % Lehrkräfte 4 U.-Std Std.. MD vorwiegend 3. 6. Std.
Konzeptionelle Merkmale und Gestaltungselemente inklusiver Schulentwicklung
 Konzeptionelle Merkmale und Gestaltungselemente inklusiver Schulentwicklung Die inklusive Schulentwicklung gestaltet sich als ein umfassender Schulentwicklungsprozess an den Schulen der Primarstufe und
Konzeptionelle Merkmale und Gestaltungselemente inklusiver Schulentwicklung Die inklusive Schulentwicklung gestaltet sich als ein umfassender Schulentwicklungsprozess an den Schulen der Primarstufe und
Lernbiologische Axiome kooperativen Lernens: Lerninhalte werden behalten, wenn sie persönlich bedeutsam werden, wenn aktive Auseinandersetzung
 Lernbiologische Axiome kooperativen Lernens: Lerninhalte werden behalten, wenn sie persönlich bedeutsam werden, wenn aktive Auseinandersetzung erfolgt Auswirkungen kooperativen Lernens: zunehmende Leistungen
Lernbiologische Axiome kooperativen Lernens: Lerninhalte werden behalten, wenn sie persönlich bedeutsam werden, wenn aktive Auseinandersetzung erfolgt Auswirkungen kooperativen Lernens: zunehmende Leistungen
Qualitätsbereich 1: Ergebnisse der Schule. Qualitltsbereich 2: Lehren und Lernen - Unterricht. 1.3 Personale Kompetenzen. 2.1 Schulinternes Curriculum
 Europaschule Erkelenz Ergebnis der Qualitätsanalyse März 2018 Qualitätsbereich 1: Ergebnisse der Schule 1.3 Personale Kompetenzen 1.3.1 Die Schule fördert das Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schüler
Europaschule Erkelenz Ergebnis der Qualitätsanalyse März 2018 Qualitätsbereich 1: Ergebnisse der Schule 1.3 Personale Kompetenzen 1.3.1 Die Schule fördert das Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schüler
Einführung in di Theorie des Unterrichts
 Hanna Kiper / Wolfgang Mischke Einführung in di Theorie des Unterrichts Beltz Verlag Weinheim und Basel Inhaltsverzeichnis 5 Inhaltsverzeichnis Einführung 9 Zum Aufbau des Bandes 11 Unterricht aus der
Hanna Kiper / Wolfgang Mischke Einführung in di Theorie des Unterrichts Beltz Verlag Weinheim und Basel Inhaltsverzeichnis 5 Inhaltsverzeichnis Einführung 9 Zum Aufbau des Bandes 11 Unterricht aus der
Erfolgreiche Integration in die Regelschule. Irène Baeriswyl-Rouiller
 Erfolgreiche Integration in die Regelschule Irène Baeriswyl-Rouiller Ziele: n Begriffliches n Bedingungen einer integrativen Schule Kurzaufgabe (4er Gruppe) n Integration / Inklusion was bedeutet das für
Erfolgreiche Integration in die Regelschule Irène Baeriswyl-Rouiller Ziele: n Begriffliches n Bedingungen einer integrativen Schule Kurzaufgabe (4er Gruppe) n Integration / Inklusion was bedeutet das für
Albert-Schweitzer-Schule Sonderpädagogisches Förderzentrum Sonthofen. Leitbild
 Albert-Schweitzer-Schule Sonderpädagogisches Förderzentrum Sonthofen Leitbild "Die Zukunft liegt nicht darin, dass man an sie glaubt oder nicht an sie glaubt, sondern darin, dass man sie vorbereitet."
Albert-Schweitzer-Schule Sonderpädagogisches Förderzentrum Sonthofen Leitbild "Die Zukunft liegt nicht darin, dass man an sie glaubt oder nicht an sie glaubt, sondern darin, dass man sie vorbereitet."
Von der integrativen Kindertagesstätte in die integrative Grundschule. Fachtag Wie Inklusion gelingen kann in Gammertingen-Mariaberg
 Von der integrativen Kindertagesstätte in die integrative Grundschule Fachtag Wie Inklusion gelingen kann 19.10.2012 in Gammertingen-Mariaberg 1 Gliederung Vorbemerkungen Integration / Inklusion Von der
Von der integrativen Kindertagesstätte in die integrative Grundschule Fachtag Wie Inklusion gelingen kann 19.10.2012 in Gammertingen-Mariaberg 1 Gliederung Vorbemerkungen Integration / Inklusion Von der
Integrationskonzept der Realschule Auf der Heese (Stand: )
 Realschule Auf der Heese Welfenallee 11 29225 Celle Integrationskonzept der Realschule Auf der Heese (Stand: 16.01.2012) Das vorliegende Integrationskonzept der Realschule Auf der Heese wurde im Jahre
Realschule Auf der Heese Welfenallee 11 29225 Celle Integrationskonzept der Realschule Auf der Heese (Stand: 16.01.2012) Das vorliegende Integrationskonzept der Realschule Auf der Heese wurde im Jahre
Positionen. zum Förderschwerpunkt Unterricht kranker Schülerinnen und Schüler
 Positionen zum Förderschwerpunkt Unterricht kranker Schülerinnen und Schüler In allen Bundesländern sind durch Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften Regelungen getroffen, die sich auf den Auftrag und
Positionen zum Förderschwerpunkt Unterricht kranker Schülerinnen und Schüler In allen Bundesländern sind durch Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften Regelungen getroffen, die sich auf den Auftrag und
Förderorte für den Förderschwerpunkt Sehen
 Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung im Förderschwerpunkt Sehen (Text aus KMS vom 24.07.2007, Nr. IV.7-5 O 8204.1-4.66 967) Sonderpädagogische Förderung für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem
Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung im Förderschwerpunkt Sehen (Text aus KMS vom 24.07.2007, Nr. IV.7-5 O 8204.1-4.66 967) Sonderpädagogische Förderung für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem
Leitgedanken und pädagogische Grundsätze
 Leitgedanken und pädagogische Grundsätze Jede Schülerin und jeder Schüler fühlt sich angenommen! Jede Schülerin und jeder Schüler erlebt sich als kompetent! Jeder fühlt sich wertgeschätzt! Die Beziehung
Leitgedanken und pädagogische Grundsätze Jede Schülerin und jeder Schüler fühlt sich angenommen! Jede Schülerin und jeder Schüler erlebt sich als kompetent! Jeder fühlt sich wertgeschätzt! Die Beziehung
Die IGS Linden: eine Schule auf inklusivem Weg ein Erfahrungsbericht
 Die IGS Linden: eine Schule auf inklusivem Weg ein Erfahrungsbericht 1.1. Am Beispiel der Gewinner des Jakob Muth Preises: Was inklusive Schulen gemeinsam haben und was sie auszeichnet: Alle Kinder und
Die IGS Linden: eine Schule auf inklusivem Weg ein Erfahrungsbericht 1.1. Am Beispiel der Gewinner des Jakob Muth Preises: Was inklusive Schulen gemeinsam haben und was sie auszeichnet: Alle Kinder und
Einleitung: Inklusion und Sonderpädagogik 1
 Vorwort Seit 2009 ist die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (VN-BRK) nunmehr auch in Deutschland in Kraft. Alle Länder der Bundesrepublik Deutschland und alle staatlichen Gliederungen
Vorwort Seit 2009 ist die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (VN-BRK) nunmehr auch in Deutschland in Kraft. Alle Länder der Bundesrepublik Deutschland und alle staatlichen Gliederungen
Mit Kompetenzrastern dem Lernen auf der Spur
 Lernen im Fokus der Kompetenzorientierung. Beobachten Beschreiben Bewerten Begleiten. Mit Kompetenzrastern dem Lernen auf der Spur Bad Wildbad 19. März 2012 Das Projekt Beobachten-Beschreiben-Bewerten-Begleiten
Lernen im Fokus der Kompetenzorientierung. Beobachten Beschreiben Bewerten Begleiten. Mit Kompetenzrastern dem Lernen auf der Spur Bad Wildbad 19. März 2012 Das Projekt Beobachten-Beschreiben-Bewerten-Begleiten
Curriculum (Universität) - Musik
 Curriculum (Universität) - Musik Die Begleitung des Praxissemesters folgt einem Leitbild: Den Studierenden soll im Praxissemester ermöglicht werden, erste Sicherheiten in den Handlungsfeldern von Musiklehrenden
Curriculum (Universität) - Musik Die Begleitung des Praxissemesters folgt einem Leitbild: Den Studierenden soll im Praxissemester ermöglicht werden, erste Sicherheiten in den Handlungsfeldern von Musiklehrenden
14/16. Universität Leipzig Erziehungswissenschaftliche Fakultät. Vom 28. Januar 2015
 14/16 Universität Leipzig Erziehungswissenschaftliche Fakultät Erste Änderungssatzung zur Studienordnung für den Lehramtsstudiengang mit dem Abschluss Erste Staatsprüfung für das Lehramt Sonderpädagogik,
14/16 Universität Leipzig Erziehungswissenschaftliche Fakultät Erste Änderungssatzung zur Studienordnung für den Lehramtsstudiengang mit dem Abschluss Erste Staatsprüfung für das Lehramt Sonderpädagogik,
Im Mittelpunkt steht der Mensch
 UNSER LEITBILD Im Mittelpunkt steht der Mensch Die Maxime der Lebenshilfe im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns steht der Mensch steht stets im Vordergrund und ist Kernaussage unseres Leitbilds.
UNSER LEITBILD Im Mittelpunkt steht der Mensch Die Maxime der Lebenshilfe im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns steht der Mensch steht stets im Vordergrund und ist Kernaussage unseres Leitbilds.
Von der Individualisierung zur Inklusion (Vortrag beim MZL-Forum am in München)
 Department für Pädagogik und Rehabilitation Lehrstuhl Lernbehindertenpädagogik, Prof. Dr. Ulrich Heimlich Von der Individualisierung zur Inklusion (Vortrag beim MZL-Forum am 25.3.2014 in München) Individualisierung
Department für Pädagogik und Rehabilitation Lehrstuhl Lernbehindertenpädagogik, Prof. Dr. Ulrich Heimlich Von der Individualisierung zur Inklusion (Vortrag beim MZL-Forum am 25.3.2014 in München) Individualisierung
Benjamin Badstieber Universität zu Köln
 www.inklunet.de Benjamin Badstieber Universität zu Köln Lehrstuhl Prof. Dr. Kerstin Ziemen Pädagogik und Didaktik bei Menschen mit geistiger Behinderung Themenschwerpunkte des Lehrstuhls Inklusive Didaktik
www.inklunet.de Benjamin Badstieber Universität zu Köln Lehrstuhl Prof. Dr. Kerstin Ziemen Pädagogik und Didaktik bei Menschen mit geistiger Behinderung Themenschwerpunkte des Lehrstuhls Inklusive Didaktik
Leitbild der OS Plaffeien
 Leitbild der OS Plaffeien Schritte ins neue Jahrtausend Unsere Schule ist Bestandteil einer sich rasch entwickelnden Gesellschaft. Dadurch ist sie laufenden Veränderungs- und Entwicklungsprozessen unterworfen.
Leitbild der OS Plaffeien Schritte ins neue Jahrtausend Unsere Schule ist Bestandteil einer sich rasch entwickelnden Gesellschaft. Dadurch ist sie laufenden Veränderungs- und Entwicklungsprozessen unterworfen.
Warum wollen wir diesen beschwerlichen und aufwendigen Weg gehen?
 Inklusion scheint das Schlagwort des Jahres in der Ausbildung zu sein. Was bedeutet dieses Wort für uns? Alle Menschen sollen gleichberechtigt und selbstbestimmt am Leben und an der Gesellschaft teilhaben
Inklusion scheint das Schlagwort des Jahres in der Ausbildung zu sein. Was bedeutet dieses Wort für uns? Alle Menschen sollen gleichberechtigt und selbstbestimmt am Leben und an der Gesellschaft teilhaben
Exklusion. Separation. Integration. Inklusion
 Exklusion Separation Integration Inklusion Inklusion 1. Stimmt das Bild? Besteht die Gesellschaft nicht aus verschiedenen Subsystemen? 2. Eine Schule für alle? Wird hier das Modell Kindergarten / Grundschule
Exklusion Separation Integration Inklusion Inklusion 1. Stimmt das Bild? Besteht die Gesellschaft nicht aus verschiedenen Subsystemen? 2. Eine Schule für alle? Wird hier das Modell Kindergarten / Grundschule
Landeselterntag 2013 am in Speicher
 Landeselterntag 2013 am 09.11.2013 in Speicher Forum 5: Inklusion und ihre Rahmenbedingungen Sylvia Sund, Medard-Schule Trier und Theresia Görgen, Studienseminar Grundschulen Trier Übersicht 1. Schulgesetz
Landeselterntag 2013 am 09.11.2013 in Speicher Forum 5: Inklusion und ihre Rahmenbedingungen Sylvia Sund, Medard-Schule Trier und Theresia Görgen, Studienseminar Grundschulen Trier Übersicht 1. Schulgesetz
Unterrichten und Erziehen
 Teil 4: Praktische Kompetenzbereiche 1 und 2 Unterrichten und Erziehen Die Studierenden können die Lernvoraussetzungen der Lerngruppe wahrnehmen und erfahren den Unterricht insbesondere unter dem Blickwinkel
Teil 4: Praktische Kompetenzbereiche 1 und 2 Unterrichten und Erziehen Die Studierenden können die Lernvoraussetzungen der Lerngruppe wahrnehmen und erfahren den Unterricht insbesondere unter dem Blickwinkel
3.04 Gemeinsamer Unterricht für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf
 3.04 Gemeinsamer Unterricht für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf Konzept der Johannesschule Sundern Gemeinsamer Unterricht ist Schulalltag. Gemeinsamer Unterricht findet in allen Unterrichtsstunden
3.04 Gemeinsamer Unterricht für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf Konzept der Johannesschule Sundern Gemeinsamer Unterricht ist Schulalltag. Gemeinsamer Unterricht findet in allen Unterrichtsstunden
Die Berufsrolle der Schulischen Heilpädagogin / des Schulischen Heilpädagogen in der integrativen Schule. Präsentation gehalten von
 31. August bis 2. September 2009 6. Schweizer Heilpädagogik-Kongress an der Uni Tobler in Bern Horizonte öffnen Standardisierung und Differenzierung in der Heil- und Sonderpädagogik Die Berufsrolle der
31. August bis 2. September 2009 6. Schweizer Heilpädagogik-Kongress an der Uni Tobler in Bern Horizonte öffnen Standardisierung und Differenzierung in der Heil- und Sonderpädagogik Die Berufsrolle der
Schulische Heilpädagogik und Schulpsychologie Schnittpunkte und Desiderate VSKZ - Veranstaltung vom , Zürich, Prof. Dr.
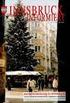 und Schulpsychologie Schnittpunkte und Desiderate VSKZ - Veranstaltung vom 23.11.06, Zürich, Prof. Dr. Josef Steppacher Studiengang Studiengang Psychomotorische Therapie Studiengang Logopädie SHP Pädagogik
und Schulpsychologie Schnittpunkte und Desiderate VSKZ - Veranstaltung vom 23.11.06, Zürich, Prof. Dr. Josef Steppacher Studiengang Studiengang Psychomotorische Therapie Studiengang Logopädie SHP Pädagogik
Inklusion in die Fachdidaktik? - Sport Entwicklung und Durchführung eines Begleitseminars zum Kernpraktikum für den inklusiven Sportunterricht
 Inklusion in die Fachdidaktik? - Sport Entwicklung und Durchführung eines Begleitseminars zum Kernpraktikum für den inklusiven Sportunterricht 2 Gliederung 1. Einleitung: Inklusion in die Sportdidaktik
Inklusion in die Fachdidaktik? - Sport Entwicklung und Durchführung eines Begleitseminars zum Kernpraktikum für den inklusiven Sportunterricht 2 Gliederung 1. Einleitung: Inklusion in die Sportdidaktik
Kompetenzen und beliefs von Förderschullehrern in inklusiven Settings
 Justus-Liebig-Universität Gießen Institut für Heil- und Sonderpädagogik Kompetenzen und beliefs von Förderschullehrern in inklusiven Settings Prof. Dr. Vera Moser Lea Schäfer Hubertus Redlich Sonderpädagogische
Justus-Liebig-Universität Gießen Institut für Heil- und Sonderpädagogik Kompetenzen und beliefs von Förderschullehrern in inklusiven Settings Prof. Dr. Vera Moser Lea Schäfer Hubertus Redlich Sonderpädagogische
LehrplanPLUS Realschule Ethik Klasse Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick. 1. Aufbau
 Realschule Ethik Klasse 5 10 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Das Fach Ethik dient der Erziehung der Schüler zu werteinsichtigem Urteilen und Handeln (Art. 47 Abs. 2 BayEUG). Die Schülerinnen
Realschule Ethik Klasse 5 10 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Das Fach Ethik dient der Erziehung der Schüler zu werteinsichtigem Urteilen und Handeln (Art. 47 Abs. 2 BayEUG). Die Schülerinnen
Lernen und Lehren im Kontext von Inklusion
 Eindrücke und Evaluation des ersten Zertifikatskurses des Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) Das wird nie was. Sie haben nur die Inhalte und für die interessiert
Eindrücke und Evaluation des ersten Zertifikatskurses des Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) Das wird nie was. Sie haben nur die Inhalte und für die interessiert
Sonderpädagogik in Bewegung
 Sonderpädagogik in Bewegung 21. Jhdt. Separation Integration I 20. Jhdt. E Separation Integration 19. Jhdt. Exklusion Separation 18. Jhdt. Exklusion Separation 17. Jhdt. Exklusion Separation 16. Jhdt.
Sonderpädagogik in Bewegung 21. Jhdt. Separation Integration I 20. Jhdt. E Separation Integration 19. Jhdt. Exklusion Separation 18. Jhdt. Exklusion Separation 17. Jhdt. Exklusion Separation 16. Jhdt.
5. Formen und Orte sonderpädagogischer Förderung. 5.1 Sonderpädagogische Förderung durch vorbeugende Maßnahmen
 5. Formen und Orte sonderpädagogischer Förderung 5. Formen und Orte sonderpädagogischer Förderung Die schulische Förderung im Förderschwerpunkt Lernen bezieht alle Schularten und Schulstufen ein. Dabei
5. Formen und Orte sonderpädagogischer Förderung 5. Formen und Orte sonderpädagogischer Förderung Die schulische Förderung im Förderschwerpunkt Lernen bezieht alle Schularten und Schulstufen ein. Dabei
Einführung in die Pädagogik bei Lernbeeinträchtigungen
 Rolf Werning Birgit Lütje-Klose Einführung in die Pädagogik bei Lernbeeinträchtigungen 4., überarbeitete Auflage Mit zahlreichen Übungsaufgaben Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. Rolf Werning,
Rolf Werning Birgit Lütje-Klose Einführung in die Pädagogik bei Lernbeeinträchtigungen 4., überarbeitete Auflage Mit zahlreichen Übungsaufgaben Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. Rolf Werning,
J wie jahrgangsübergreifendes Lernen (JüL) Elterninformationsabend am , Uhr
 J wie jahrgangsübergreifendes Lernen (JüL) Elterninformationsabend am 19.10. 2015, 19.30 Uhr Tagesordnung 2 Erfolgreich starten Die Schuleingangsphase der Grundschule Jahrgangsübergreifendes Lernen an
J wie jahrgangsübergreifendes Lernen (JüL) Elterninformationsabend am 19.10. 2015, 19.30 Uhr Tagesordnung 2 Erfolgreich starten Die Schuleingangsphase der Grundschule Jahrgangsübergreifendes Lernen an
Inklusionskonzept Grundschule Handorf
 Stand: 24.6.2013 Inklusionskonzept Grundschule Handorf 1. Rechtliche Grundlagen In der Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung wurden im Jahr 2008 grundlegende Rechte
Stand: 24.6.2013 Inklusionskonzept Grundschule Handorf 1. Rechtliche Grundlagen In der Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung wurden im Jahr 2008 grundlegende Rechte
Kooperationsvereinbarung
 Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs e.v. und dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport über die Bildungsarbeit der öffentlichen Musikschulen an Ganztagsschulen
Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs e.v. und dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport über die Bildungsarbeit der öffentlichen Musikschulen an Ganztagsschulen
Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst. durch eine Vielfalt schulischer Angebote in Bayern
 Inklusion durch eine Vielfalt schulischer Angebote in Bayern MR Erich Weigl Dr. Monika Eiber Pädagogische und rechtliche Aspekte 1 1. Zur Philosophie einer inklusiven Schule oder: Um was geht es? 2. Zur
Inklusion durch eine Vielfalt schulischer Angebote in Bayern MR Erich Weigl Dr. Monika Eiber Pädagogische und rechtliche Aspekte 1 1. Zur Philosophie einer inklusiven Schule oder: Um was geht es? 2. Zur
Einführung in die Päd ago gik bei Lernbeeinträchtigungen
 Rolf Werning Birgit Lütje-Klose Einführung in die Päd ago gik bei Lernbeeinträchtigungen 3., überabeitete Auflage Mit zahlreichen Übungsaufgaben Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. Rolf Werning,
Rolf Werning Birgit Lütje-Klose Einführung in die Päd ago gik bei Lernbeeinträchtigungen 3., überabeitete Auflage Mit zahlreichen Übungsaufgaben Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. Rolf Werning,
VERKEHRSERZIEHUNG BEI MENSCHEN MT GEISTIGER BEHINDERUNG
 4. VERKEHRSERZIEHUNG BEI MENSCHEN MT GEISTIGER BEHINDERUNG von Reinhilde Stöppler 1999 VERLAG JULIUS KLINKHARDT BAD HEILBRUNN / OBB. Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 13 2 Begründung der Verkehrserziehung
4. VERKEHRSERZIEHUNG BEI MENSCHEN MT GEISTIGER BEHINDERUNG von Reinhilde Stöppler 1999 VERLAG JULIUS KLINKHARDT BAD HEILBRUNN / OBB. Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 13 2 Begründung der Verkehrserziehung
Lern und Entwicklungsplanung. Dokumentation der Lernbiographie von Kindern mit Unterstützungsbedarf
 Lern und Entwicklungsplanung Dokumentation der Lernbiographie von Kindern mit Unterstützungsbedarf 1 Aufgaben und Ziele Zielgruppe der sonderpädagogischen Förderplanung sind Schülerinnen und Schüler mit
Lern und Entwicklungsplanung Dokumentation der Lernbiographie von Kindern mit Unterstützungsbedarf 1 Aufgaben und Ziele Zielgruppe der sonderpädagogischen Förderplanung sind Schülerinnen und Schüler mit
Merkmale guten Unterrichts (nach Peter POSCH)
 (nach Peter POSCH) Neues Wissen anbieten und Vorwissen beachten: Mit neuen Inhalten werden den Schüler/innen neue Lernerfahrungen zugänglich gemacht, es wird jedoch auch ihr Vorwissen respektiert, weil
(nach Peter POSCH) Neues Wissen anbieten und Vorwissen beachten: Mit neuen Inhalten werden den Schüler/innen neue Lernerfahrungen zugänglich gemacht, es wird jedoch auch ihr Vorwissen respektiert, weil
Die entwicklungslogische Didaktik nach Georg Feuser. Eine Präsentation von Lena Grates und Janek Müller
 Die entwicklungslogische Didaktik nach Georg Feuser Eine Präsentation von Lena Grates und Janek Müller Gliederung 1. Grundgedanken Feusers 1.1 Integrationsverständnis 1.2 Kooperationsverständnis 1.3 Der
Die entwicklungslogische Didaktik nach Georg Feuser Eine Präsentation von Lena Grates und Janek Müller Gliederung 1. Grundgedanken Feusers 1.1 Integrationsverständnis 1.2 Kooperationsverständnis 1.3 Der
Qualitätskriterien Evaluation von Unterrichtsmedien Globales Lernen & BNE
 Qualitätskriterien Evaluation von Unterrichtsmedien Globales Lernen & BNE (Stiftung Bildung und Entwicklung SBE 2012) Wir unterstützen Ihre Arbeit als Lehrperson mit geprüften Unterrichtsmaterialien zu
Qualitätskriterien Evaluation von Unterrichtsmedien Globales Lernen & BNE (Stiftung Bildung und Entwicklung SBE 2012) Wir unterstützen Ihre Arbeit als Lehrperson mit geprüften Unterrichtsmaterialien zu
Entwicklungslogische Didaktik nach G. Feuser. von Luisa Rönsch und Timo Vidal
 Entwicklungslogische Didaktik nach G. Feuser von Luisa Rönsch und Timo Vidal Gliederung Leitfragen L Behindertenrechtskonventionen T Biographie von Georg Feuser L Regel und Sonderpädagogik T Allgemeine
Entwicklungslogische Didaktik nach G. Feuser von Luisa Rönsch und Timo Vidal Gliederung Leitfragen L Behindertenrechtskonventionen T Biographie von Georg Feuser L Regel und Sonderpädagogik T Allgemeine
3. Transferforum. Fachforum: Eltern und Inklusion
 3. Transferforum Inklusion und Ganztagsschule Fachforum: Eltern und Inklusion Bremen, 22.März 2012 Mitglied im Inklusion - Ein Definitionsversuch Wesentliches Prinzip der inklusiven Pädagogik ist die Wertschätzung
3. Transferforum Inklusion und Ganztagsschule Fachforum: Eltern und Inklusion Bremen, 22.März 2012 Mitglied im Inklusion - Ein Definitionsversuch Wesentliches Prinzip der inklusiven Pädagogik ist die Wertschätzung
Carl-von-Linné-Schule Berlin
 Carl-von-Linné-Schule, Arbeitskreis 1: Leistung Carl-von-Linné-Schule Berlin Gliederung Arbeitskreis 1: Leistung 1. Zum Thema Leistung Herleitung : gesellschaftliche, bildungspolitische und pädagogische
Carl-von-Linné-Schule, Arbeitskreis 1: Leistung Carl-von-Linné-Schule Berlin Gliederung Arbeitskreis 1: Leistung 1. Zum Thema Leistung Herleitung : gesellschaftliche, bildungspolitische und pädagogische
Städtische Gemeinschaftsgrundschule. Die Brücke Sylvia Decker 1
 Städtische Gemeinschaftsgrundschule Die Brücke 08.02.2010 Sylvia Decker 1 Die Städtische Gemeinschaftsgrundschule Die Brücke ca. 340 Schülerinnen und Schüler 70 % mit Migrationshintergrund. überwiegend
Städtische Gemeinschaftsgrundschule Die Brücke 08.02.2010 Sylvia Decker 1 Die Städtische Gemeinschaftsgrundschule Die Brücke ca. 340 Schülerinnen und Schüler 70 % mit Migrationshintergrund. überwiegend
ZfsL Bocholt Seminar Grundschule Ausbildungsprogramm Kernseminar VD 17 Mai - November 2017
 ZfsL Bocholt Seminar Grundschule Ausbildungsprogramm Kernseminar VD 17 Mai - November 2017 Unterricht kompetenzorientiert und sprachbildend für alle Schüler*innen planen, gestalten sowie reflektierend
ZfsL Bocholt Seminar Grundschule Ausbildungsprogramm Kernseminar VD 17 Mai - November 2017 Unterricht kompetenzorientiert und sprachbildend für alle Schüler*innen planen, gestalten sowie reflektierend
Diagnostik im Alltag. BPS Studienseminar für Gymnasien/TDS Daun 2018
 Diagnostik im Alltag BPS Studienseminar für Gymnasien/TDS Daun 2018 Aus den Standards für Lehrerbildung Lehrerinnen und Lehrer diagnostizieren Lernvoraussetzungen und Lernprozesse von Schülerinnen und
Diagnostik im Alltag BPS Studienseminar für Gymnasien/TDS Daun 2018 Aus den Standards für Lehrerbildung Lehrerinnen und Lehrer diagnostizieren Lernvoraussetzungen und Lernprozesse von Schülerinnen und
Portfolio Praxiselemente
 Portfolio Praxiselemente Name, Vorname Anschrift Matrikelnummer Schule des Eignungspraktikums Schule des Orientierungspraktikums Schule des Berufsfeldpraktikums Schule des Praxissemesters Schule des Vorbereitungsdienstes
Portfolio Praxiselemente Name, Vorname Anschrift Matrikelnummer Schule des Eignungspraktikums Schule des Orientierungspraktikums Schule des Berufsfeldpraktikums Schule des Praxissemesters Schule des Vorbereitungsdienstes
Förderpädagogisches Basiswissen für Lehrerinnen und Lehrer an Realschulen plus
 Az.: 31.6.5 Ausbildung am Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen plus Trier Informationen zur Seminareinheit Förderpädagogisches Basiswissen für Lehrerinnen und Lehrer an Realschulen
Az.: 31.6.5 Ausbildung am Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen plus Trier Informationen zur Seminareinheit Förderpädagogisches Basiswissen für Lehrerinnen und Lehrer an Realschulen
Handlungsfeld 1: Unterricht gestalten und Lernprozesse nachhaltig anlegen
 Handlungsfeld 1: Unterricht gestalten und Lernprozesse nachhaltig anlegen Unterricht schülerorientiert planen (die Lehr- und Lernausgangslage ermitteln, Erkenntnisse der Entwicklungs- und Lernpsychologie
Handlungsfeld 1: Unterricht gestalten und Lernprozesse nachhaltig anlegen Unterricht schülerorientiert planen (die Lehr- und Lernausgangslage ermitteln, Erkenntnisse der Entwicklungs- und Lernpsychologie
Umsetzung der inklusiven Bildung. Dr. Angela Ehlers Behörde für Schule und Berufsbildung, Freie und Hansestadt Hamburg
 Umsetzung der inklusiven Bildung Dr. Angela Ehlers Behörde für Schule und Berufsbildung, Freie und Hansestadt Hamburg angela.ehlers@bsb.hamburg.de 1 Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte
Umsetzung der inklusiven Bildung Dr. Angela Ehlers Behörde für Schule und Berufsbildung, Freie und Hansestadt Hamburg angela.ehlers@bsb.hamburg.de 1 Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte
Inklusion in der Kommune: empirische Ergebnisse einer Studie zur Qualität des Gemeinsamen Unterrichts in der Stadt Jena
 Inklusion in der Kommune: empirische Ergebnisse einer Studie zur Qualität des Gemeinsamen Unterrichts in der Stadt Jena Stefanie Czempiel, Bärbel Kracke, Ada Sasse und Sabine Sommer Weimar, 5.4.2014 Überblick
Inklusion in der Kommune: empirische Ergebnisse einer Studie zur Qualität des Gemeinsamen Unterrichts in der Stadt Jena Stefanie Czempiel, Bärbel Kracke, Ada Sasse und Sabine Sommer Weimar, 5.4.2014 Überblick
Sonderpädagogische Förderung in der Grundschule. am Beispiel der Region Hannover Nordwest
 Sonderpädagogische Förderung in der Grundschule am Beispiel der Region Hannover Nordwest Struktur der sonderpädagogischen Förderung (außerhalb der Förderschule) sollen Prävention Diagnostik Förderung Beratung
Sonderpädagogische Förderung in der Grundschule am Beispiel der Region Hannover Nordwest Struktur der sonderpädagogischen Förderung (außerhalb der Förderschule) sollen Prävention Diagnostik Förderung Beratung
