Dieter Goretzki Spektroskopie mit Prisma und Foto-CD
|
|
|
- Karola Biermann
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Dieter Goretzki Spektroskopie mit Prisma und Foto-CD Artikel erschienen im Journal für Astronomie Nr. 6, Vereinszeitschrift der Vereinigung der Sternfreunde e.v. (VdS). Bereitgestellt durch die VdS-Fachgruppe Spektroskopie. Referenz: D. Goretzki, VdS-Journal Nr. 6 (2001) 83ff Diese Datei ist nur für Ihren persönlichen Bedarf bestimmt. Änderungen sowie die Vervielfältigung auf einem anderen physischen oder virtuellen Datenträger sind untersagt!
2 FACHGRUPPE > KLEINPLANETEN/SPEKTROSKOPIE 83 Beobachtungshinweise: Trojaner des Jupiters von Jens Kandler Die Trojaner des Planeten Jupiter befinden sich in der gleichen Umlaufbahn wie der Gasriese. Diese Kleinplaneten haben also die gleiche Entfernung zur Sonne bzw. die gleiche Umlaufzeit wie Jupiter. Man unterscheidet zwei Gruppen von Trojanern, welche sich in den Lagrangepunkten L4 und L5 befinden. Von der Sonne aus gesehen eilen die Mitglieder der Achillesgruppe (L4) dem Jupiter in einem Winkelabstand von 60 Grad voraus. Die Kleinplaneten der Patroclusgruppe (L5) folgen dem Jupiter im gleichen Winkelabstand. In den Jahren 1906 bis 1937 entdeckten die Astronomen Reimuth, Wolf und Kopff an der Sternwarte Heidelberg die ersten 12 Trojaner. Ab 1950 wurden auch andere Sternwarten fündig. In den Jahren 1960 bis 1977 suchte man am Mt. Palomar Observatorium gezielt nach Trojanern. Ab 1996 fand man durch den Einsatz von automatischen Teleskopen sehr viele Trojaner. Inzwischen sind 853 Trojaner des Planeten Jupiter bekannt. In der Tabelle 1 sind Trojaner des Jupiter Tabelle 1: Helle Trojaner des Jupiters. aufgeführt, die im Herbst 2001 heller als 15,6 Größenklassen werden. Aktuelle Bahnelemente und Ephemeriden dieser Kleinplaneten finden Sie im Internet unter: MPEph/MPEph.html. Ihre Beobachtungsberichte und Aufnahmen können Sie an die Redaktion schicken. Asteroid JJJJ MM DD Entfernung zur Erde in AE Vmax in mag (4348) Poulydamas ,748 15,6 (617) Patroclus ,682 14,5 (3451) Mentor ,139 15,1 (1172) Aneas ,367 15,4 Spektroskopie mit Prisma und Foto-CD von Dieter Goretzki Für den Einsteiger in die Spektroskopie stellt sich nach den ersten erfolgreichen Versuchen der fotografischen Aufnahme von Sternspektren recht bald die Frage, wie sich aus den vorhandenen Spektren physikalisch-chemische Aussagen über das Objekt ableiten lassen können. Als erster Schritt ist die qualitative Analyse der beobachtbaren Elemente in Form der auftretenden Absorptionslinien möglich. Neben der Inspektion der Spektren mit bloßem Auge und der Zuordnung ausgeprägter Linien mittels Vergleichsspektren wird alsbald die Identifikation schwacher Linien von Interesse sein. Dieser Artikel beschreibt meine ersten Erfahrungen mit der fotografischen Erfassung von Spektren heller Sterne und deren qualitativer Auswertung. Dabei wurden die Fotos auf eine KODAK-Foto-CD übertragen, so dass eine digitale Verarbeitung möglich wurde. Dieses Verfahren stellt in einfacher Art und Abb. 1: Aufbau meines Objektivprismenspektrographen. Ein Prisma befindet sich vor dem Objektiv der Fotokamera. Das Teleskop dient der kontrollierten Verbreiterung der Spektren. Weise die Möglichkeit einer Auswertung von Spektren ohne die Benutzung eines Fotometers oder einer CCD-Kamera zur Verfügung, was gerade auch für den Anfänger von Interesse ist. Die digitale Auswertung erfolgte an einem handelsüblichen Computer unter MS- Windows mittels Bildverarbeitungs- (hier PaintShopPro) und Tabellenkalkulationsprogrammen (hier MS-EXCEL), die allgemein verfügbar sind. Aufnahme der Spektren Als Aufnahmeinstrument habe ich einen Objektivprismenspektrographen verwendet. Er besteht aus einem herkömmlichen Fotoapparat mit einem 300-mm-APO-Objektiv (f/d = 5,6 und 2x-Konverter). Vor dem Objektiv befindet sich ein Prisma aus F2-Glas mit 60 mm Basislänge und 30 brechendem Winkel [1]. Als Leitrohr und Podest verwende ich ein 4"-SCT von Meade. Die komplett montierte Anordnung ist in Abb. 1 zu sehen. Die Spektren wurden mit der sog. Pendelmethode aufgenommen. Zunächst wird der Spektralfaden, d.h. das dispergiert abgebildete Licht des
3 84 FACHGRUPPE > SPEKTROSKOPIE Sterns, senkrecht zur scheinbaren Bewegungsrichtung des Sternes justiert. Dann belichtet man bei ausgeschalteter Nachführung den Film. Die Bewegung des Sternes führt nun zu einer Verbreiterung des Spektrums senkrecht zum Spektralfaden, was zu einem ansehnlichen Spektrum führt. Diesen Vorgang kann man nun (beliebig) oft wiederholen und damit die gleichen Stellen des Filmmaterials mehrmals belichten, indem man den Stern immer wieder kontrolliert zurückholt. Diesen Vorgang habe ich mittels eines Messokulares gut steuern können. Abb. 2a zeigt eine Aufnahme von Wega (α Lyr, A 0 V) auf TP 2415, die mit der Pendelmethode aufgenommen wurde. Hier sind deutlich die dominanten Linien der Balmer-Serie des Wasserstoffs erkenntlich. Generell sind frühe Sterne (Spektralklassen B, A, F) sehr gut für den Einstieg in die Spektralanalyse geeignet, da sie deutlich zuordenbare Absorptionslinien enthalten. In Abb. 2b ist das Spektrum von Rigel (β Ori, B8 I) abgebildet, das auf NEO- PAN 400 mit 4 Durchläufen abgebildet und dann auf Foto-CD übertragen wurde. Die Größe des Spektrums auf dem Film betrug ca. 1 x 14 mm 2. Man erkennt deutlich die Überbelichtung auf der langwelligen Seite und die Unterbelichtung auf der kurzwelligen Seite des Spektrums. Im mittleren Bereich sind die Absorptionslinien der Balmerserie aber gut zu erkennen. Weitere Linien lassen sich zumindest erahnen. An dieser Aufnahme wird nun exemplarisch eine Auswertung vorgenommen. Bildverarbeitung Unabhängig vom digitalen Format liegt ein Bild als n x m - Matrix vor. Die einzelnen Elemente der Matrix (die Bildpunkte oder Pixel) bei der Foto-CD enthalten die Grauwerte von 0 bis 255 (8- Bit Dynamikumfang). Dabei wird das Bild von 24 x 36 mm 2 in 2048 x 3072 quadratische Pixel aufgelöst, so dass ein Pixel etwa 12 x 12 µm 2 groß ist. Mit einer herkömmlichen Bildbearbeitung werden nun diese Grauwerte verändert oder die ganze Matrix verschoben bzw. gedreht. Die dabei erreichbaren Effekte können das Aussehen zwar verbessern, sind aber für analytische Zwecke nur bedingt einsetzbar und liefern manchmal auch Artefakte. Abb. 3a zeigt ein im mittleren Spektralbereich durch Kontrastvariation angepasstes Bild von Abb. 2 (oben): Rohaufnahmen der (a) Wega (Typ: A0 V, Filmmaterial: TP2415) und des (b) Rigel (B8 I, Neopan 400). Das rote (langwellige) Ende der Spektren ist rechts. Bei Wega dominiert die ausgeprägte Absorption des Wasserstoffs (Balmer-Serie). Abb. 3 (unten): Spektrum des Rigel. (a) Kontrastvariation. Schwächere Linien im mittleren Bereich werden deutlicher. (b) Hochpassfilterung. Rigel. Dadurch konnten schwächere Linien subjektiv besser sichtbar gemacht werden. Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass nur das besser sichtbar gemacht wird, was schon auf der ursprünglichen Aufnahme vorhanden war. Aus dem überbelichteten Teil der Aufnahme kann auch das beste Programm keine Informationen gewinnen. Gleichzeitig erkennt man, dass der Hintergrund viel deutlicher wird (Körnung) das Signal-zu-Rausch- Verhältnis (S/N) hat sich nicht verbessert. Eine Kontraststeigerung entspricht nur einer Verstärkung von Information und Rauschen gleichermaßen. Nun könnte man zunächst das Bild glätten und dann erst verstärken. Aber auch diese Vorgehensweise führt nicht weiter, da durch das Glätten die schwachen Linien weggemittelt werden. Interessante Möglichkeiten bieten Hochbzw. Tiefpassfilter. Abb. 3b zeigt ein derart hochpassgefiltertes Spektrum. Außerdem kann man die Bilder künstlich vergrößern, z. B. durch Pixelvervielfältigung. Allerdings ist man aufgrund beschränkter Tabellengrößen begrenzt, wenn man eine weitere Auswertung z. B. mit MS-EXCEL anstrebt. Manchmal ist es zusätzlich erforderlich, das Bild zu drehen, um die Absorptionslinien senkrecht zu stellen. Das nun vorbereitete Spektrum kann man ausschneiden und in eine Tabellenform überführen, mit der man weitere Verarbeitungschritte durchführt. So ist z. B. eine Mittelung der Pixelspalten dann einfach im Tabellenkalkulationsprogramm möglich, was zu einem besseren S/N-Verhältnis führt. Konvertierung und Normierung Zunächst muss das bearbeitet Spektrum in eine Form gebracht werden, dass es von MS-EXCEL eingelesen werden kann. Dazu wird es aus dem Bildbearbeitungsprogramm im RAW-Format abgespeichert und die hexadezimalen Helligkeitswerte ($00-$FF) unter Beachtung von Zeilen und Spalten in ganze Zahlen ( ) umgewandelt. Dies wird durch ein kleines PASCAL-Programm verwirklicht [2]. Diese Software gebe ich gern an Interessierte weiter. Nachdem das so konvertierte Bild in MS-EXCEL eingelesen ist, kann daraus ein Linien-Scan errechnet werden, indem die Helligkeitswerte jeder einzelnen Spalte gemittelt werden. Die anschließende Auswertung erfolgt mit dem Programm MK/MK32 [3] für MS-DOS. Diese Software stellt alle speziell für die Stellarspektroskopie notwendigen Auswerteschritte bereit. Da die Bestimmung der Linien-Schwerpunkte mit MK/MK32 erfolgen soll, sei noch anzumerken, dass eine zusätzliche Spalte mit der Tabellenkalkulation zu erzeugen ist, in der das Spektrum invers dargestellt wird, da MK/MK32 nur in dieser Form korrekte Werte liefert. In
4 FACHGRUPPE > SPEKTROSKOPIE 85 Abb. 4 und 5 sind die Ergebnisse zweier unterschiedlich bearbeiteter Spektren von Rigel dargestellt. Deutlich ist zu erkennen, dass die Filterung durch den Hochpass nur das Rauschen verstärkt hat, ohne zusätzliche Informationen zu liefern. Beide Spektren wurden mit Hilfe von MK/MK32 normiert [4], d.h. der kontinuierliche Anteil des Spektrums wird auf einen konstanten Wert gebracht. Wellenlängenkalibration Der nächste Schritt ist die Kalibrierung der Messkurve mit der Wellenlänge λ, es muss also die Funktion λ = f(pixelnummer) bestimmt werden. Da bei meiner Anordnung die Verwendung einer Vergleichslichtquelle unmöglich ist, muss am Spektrum selbst kalibriert werden. Am besten eignen sich dazu die Balmer-Linien des Wasserstoffs. Dazu habe ich alternativ zwei Methoden benutzt, ein Ausgleichspolynom und die Formel nach Hartmann [5]. Für beide Verfahren ist es notwendig, die Linienschwerpunkte zu bestimmen. Dies geschieht entweder durch scharfes Hinsehen in der EXCEL-Tabelle oder durch MK/MK32. Ausgleichspolynom Bei dieser Methode werden die Pixelwerte der entsprechenden Linienschwerpunkte und die entsprechenden Wellenlängen durch ein Polynom n-ten Grades nach Gauß approximiert. Der Grad des Polynoms sollte allerdings nicht höher als 3 bis 4 gewählt werden, da sonst der gewünschte ausgleichende Abb. 4: Linienscan (Rigel) mit Mittelung über mehrere Spektrumspalten. Anschließende Normierung. Details im Text. Abb. 5: Linienscan eines hochpassgefilterten Spektrums. Manche Linien treten deutlicher hervor, andere (z.b. H11) sind unterdrückt.
5 86 FACHGRUPPE > SPEKTROSKOPIE Effekt von Messfehlern verloren geht. Die Berechnung selbst kann in EXCEL durchgeführt werden. Ein Nachteil dieser Methode ist, dass die Abweichungen außerhalb der terminalen Stützstellen schnell sehr groß werden. Formel nach Hartmann Diese rein empirische Formel für ein Prismenspektralapparat enthält drei zunächst unbekannte Konstanten, die aus drei bekannten Positionen von Absorptionslinien zu berechnen sind: λ λ 0 = κ (ϕ ϕ 0 ) a Linie Pixel λ (Å) Ausgleichspolynom Formel nach Hartmann Literatur λ (Å) Differenz λ (Å) Differenz berechnet λ (Å) berechnet λ (Å) Hβ 1778, , ,75 0, ,37 0,04 Hγ 1189, , ,45 0, ,28 0,19 Hδ 821, , ,93 0, ,88 0,14 Hε 580, , ,82 0, ,13 0,06 H8 416, , ,34 0, ,09 0,04 H10 213, , ,24 0, ,08 0,18 H11 147, , ,12 0, ,37 0,26 Mittlere Abweichung 0,4 0,2 Tabelle 1: Vergleich der Ausgleichsrechnungen mit einem Polynom 3. Grades und der Formel nach Hartmann anhand der Referenzlinien. Die Subpixelangaben ergeben sich aus der Schwerpunktsbestimmung in MK/MK32. Linie Pixel λ (Å) Linien Literatur Abweichung Berechnet λ (Å) λ (Å) , ,9 HeI 5015,7 1, , ,1 HeI 4921,9 0, , ,4 MgII 4481,1 0, , ,5 HeI 4471,7 0, , ,5 HeI 4387,9 0, , ,0 HeI 4143,8 0, , ,3 SiII 4130,9 0, , ,4 HeI 4026,3 0, , ,9 CaII (K) 3933,7 0,2 Tabelle 2: Bestimmung der unbekannten Linien und Vergleich zu den Literaturangaben. λ 0, κ, ϕ 0 sind die zunächst unbekannte Konstanten. λ ist die Wellenlänge und ϕ die Pixelnummer. Der Exponent α kann in erster Näherung eins gesetzt werden. Es werden also drei Gleichungen mit drei Unbekannten aufgestellt, die elementar gelöst werden können. Bei der Auswertung benutze ich ein iteratives Verfahren (Solver in MS-EXCEL). Zunächst werden elementar aus drei bekannten Wellenlängen die drei Konstanten überschlägig ermittelt. Dann wird mit Hilfe des Solvers eine Approximation über alle bekannten Wellenlängen durchgeführt. Beide Verfahren werden nun am Beispiel des Rigel demonstriert. Zunächst wird mit den bekannten Balmer- Linien die unbekannte Funktion λ = f(pixel) ermittelt und dann die mit den Nummern in Abb. 4 bezeichneten Absorptionslinien zugeordnet. Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse, die mit Hilfe eines Ausgleichspolynoms 3. Grades und der Formel nach Hartmann erhalten wurden. Die rückgerechneten Abweichungen mit der optimierten Formel nach Hartmann sind geringer als die Ergebnisse mit dem Polynom. Danach ist eine Zuordnung der unbekannten Absorptionslinien mit einer Unsicherheit von etwa ±0,2 Å zu erwarten. Das mit einem so einfachen Equipment eine derartige Präzision erreichbar ist, wird umso erstaunlicher, da die Auflösung des ursprünglichen Bildes bei nur etwa 2 Å/ Pixel liegt. Der Trick besteht in der Schwerpunktsbestimmung der Linien im Subpixelbereich durch MK/MK32. Die Zuordnung der Linien in Abb. 4 zeigt Tabelle 2. Wie man sieht, überschreiten die Abweichungen innerhalb der terminalen Stützstellen nicht den Wert von 0,4 Å, was ungefähr den Erwartungen entspricht. Je weiter man sich aber davon entfernt (Linien 1 und 2 in Tab. 2), um so größer werden die Abweichungen. Die Zuordnung der einzelnen Linien erhält man über den Vergleich mit Spektren aus der Literatur [6] oder mit Hilfe der einschlägigen NASA-Kataloge [7]. Zusammenfassung und Ausblick Der Autor hofft, mit diesem Beitrag zu zeigen, dass eine Spektralanalyse von hellen Sternen auch mit einfachen Amateurmitteln möglich ist und zu interessanten Ergebnissen führt. Eine konkrete Auswertung wurde aufgezeigt und diskutiert, die es erlaubt, auch schwache Absorptionslinien zu identifizieren. Die Behandlung am Computer erlaubt eine hohe Genauigkeit bei der Bestimmung der Linien. Die so kalibrierten Daten können nun einer weiteren Bearbeitung unterzogen werden, z.b. einer Äquivalentbreitenbestimmung. Literaturhinweise [1] Bezugsquelle: LINOS Photonics GmbH, Göttingen, [2] D. Goretzki, Rundbrief der FG Spektroskopie 17, 13 (1999) [3] Software von Richard O. Gray, Appalachian State University, ftp://am.appstate.edu/pub/prog/grayro; Daten müssen als ASCII-Liste mit Zahlenangaben der Gestalt x.xex vorliegen. [4] J.-M. Will, Rundbrief der FG Spektroskopie 17, 22 (1999); Einführungsschrift der FG Spektroskopie, 2000 [5] D. Goretzki, Rundbrief der FG Spektroskopie 19, 5 (1999), dort weitere Literatur [6] James B. Kaler, Sterne und ihre Spektren, Spektrum, Akad. Verlag, Heidelberg, 1994 [7] ftp://adc.gsfc.nasa.gov/pub/adc/archives/catalogs/
P r o t o k o l l: P r a k t i s c h e A s t r o n o m i e
 Praktische Astronomie Sommersemester 08 Klaus Reitberger csaf8510@uibk.ac.at 0516683 P r o t o k o l l: P r a k t i s c h e A s t r o n o m i e von Klaus Reitberger 1 1 Zusammenfassung Ein Teil der Vorlesung
Praktische Astronomie Sommersemester 08 Klaus Reitberger csaf8510@uibk.ac.at 0516683 P r o t o k o l l: P r a k t i s c h e A s t r o n o m i e von Klaus Reitberger 1 1 Zusammenfassung Ein Teil der Vorlesung
Deflektometrie Ein Messverfahren für spiegelnde Oberflächen
 Deflektometrie Ein Messverfahren für spiegelnde Oberflächen Dr. Alexander Zimmermann FORWISS Universität Passau Institut für Softwaresysteme in technischen Anwendungen der Informatik 19. Oktober 2017 Gliederung
Deflektometrie Ein Messverfahren für spiegelnde Oberflächen Dr. Alexander Zimmermann FORWISS Universität Passau Institut für Softwaresysteme in technischen Anwendungen der Informatik 19. Oktober 2017 Gliederung
Distributed Algorithms. Image and Video Processing
 Chapter 7 High Dynamic Range (HDR) Distributed Algorithms for Quelle: wikipedia.org 2 1 High Dynamic Range bezeichnet ein hohes Kontrastverhältnis in einem Bild Kontrastverhältnis bei digitalem Bild: 1.000:1
Chapter 7 High Dynamic Range (HDR) Distributed Algorithms for Quelle: wikipedia.org 2 1 High Dynamic Range bezeichnet ein hohes Kontrastverhältnis in einem Bild Kontrastverhältnis bei digitalem Bild: 1.000:1
Dieter Goretzki, Versuche zur Bestimmung der Spektralklasse von Sternen
 Dieter Goretzki, Versuche zur Bestimmung der Spektralklasse von Sternen Artikel erschienen im Journal für Astronomie Nr. 13, Schwerpunkt Spektroskopie Vereinszeitschrift der Vereinigung der Sternfreunde
Dieter Goretzki, Versuche zur Bestimmung der Spektralklasse von Sternen Artikel erschienen im Journal für Astronomie Nr. 13, Schwerpunkt Spektroskopie Vereinszeitschrift der Vereinigung der Sternfreunde
Bestimmung des Abstandes zum Asteroiden Apophis (Faulkes Telescope Project)
 Grundkurs Astronomie 28.1.2014 Bestimmung des Abstandes zum Asteroiden Apophis (Faulkes Telescope Project) Notiere zu jeder Aufgabe eigene Lösungen. Formuliere in ganzen Sätzen und schreibe vollständige
Grundkurs Astronomie 28.1.2014 Bestimmung des Abstandes zum Asteroiden Apophis (Faulkes Telescope Project) Notiere zu jeder Aufgabe eigene Lösungen. Formuliere in ganzen Sätzen und schreibe vollständige
Physikalisches Praktikum
 Physikalisches Praktikum MI2AB Prof. Ruckelshausen Versuch 3.2: Wellenlängenbestimmung mit dem Gitter- und Prismenspektrometer Inhaltsverzeichnis 1. Theorie Seite 1 2. Versuchsdurchführung Seite 2 2.1
Physikalisches Praktikum MI2AB Prof. Ruckelshausen Versuch 3.2: Wellenlängenbestimmung mit dem Gitter- und Prismenspektrometer Inhaltsverzeichnis 1. Theorie Seite 1 2. Versuchsdurchführung Seite 2 2.1
Versuch C: Auflösungsvermögen Einleitung
 Versuch C: svermögen Einleitung Das AV wird üblicherweise in Linienpaaren pro mm (Lp/mm) angegeben und ist diejenige Anzahl von Linienpaaren, bei der ein normalsichtiges Auge keinen Kontrastunterschied
Versuch C: svermögen Einleitung Das AV wird üblicherweise in Linienpaaren pro mm (Lp/mm) angegeben und ist diejenige Anzahl von Linienpaaren, bei der ein normalsichtiges Auge keinen Kontrastunterschied
Doppler-Effekt und Bahngeschwindigkeit der Erde
 Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Doppler-Effekt und Bahngeschwindigkeit der Erde 1 Einleitung Nimmt man im Laufe eines Jahres
Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Doppler-Effekt und Bahngeschwindigkeit der Erde 1 Einleitung Nimmt man im Laufe eines Jahres
Kalibration einer CCD-Kamera oder DSLR-Kamera zur Messung der Helligkeit des Himmelshintergrundes
 Kalibration einer CCD-Kamera oder DSLR-Kamera zur Messung der Helligkeit des Himmelshintergrundes Thomas Waltinger Zur Beurteilung der Helligkeit des Nachthimmels werden in letzter Zeit immer häufiger
Kalibration einer CCD-Kamera oder DSLR-Kamera zur Messung der Helligkeit des Himmelshintergrundes Thomas Waltinger Zur Beurteilung der Helligkeit des Nachthimmels werden in letzter Zeit immer häufiger
Praktikum Physik. Protokoll zum Versuch: Beugung. Durchgeführt am Gruppe X. Name 1 und Name 2
 Praktikum Physik Protokoll zum Versuch: Beugung Durchgeführt am 01.12.2011 Gruppe X Name 1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuer: Wir bestätigen hiermit, dass wir das Protokoll
Praktikum Physik Protokoll zum Versuch: Beugung Durchgeführt am 01.12.2011 Gruppe X Name 1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuer: Wir bestätigen hiermit, dass wir das Protokoll
Tutorium Mathematik II, M Lösungen
 Tutorium Mathematik II, M Lösungen März 03 *Aufgabe Bestimmen Sie durch Hauptachsentransformation Lage und Typ der Kegelschnitte (a) 3x + 4x x + 3x 4x = 0, (b) 3x + 4x x + 3x 4x 6 = 0, (c) 3x + 4x x +
Tutorium Mathematik II, M Lösungen März 03 *Aufgabe Bestimmen Sie durch Hauptachsentransformation Lage und Typ der Kegelschnitte (a) 3x + 4x x + 3x 4x = 0, (b) 3x + 4x x + 3x 4x 6 = 0, (c) 3x + 4x x +
Eigenbewegung und Parallaxe von Barnards Pfeilstern
 Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Eigenbewegung und Parallaxe von Barnards Pfeilstern 1 Einleitung Der Parallaxeneffekt ist jedem,
Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Eigenbewegung und Parallaxe von Barnards Pfeilstern 1 Einleitung Der Parallaxeneffekt ist jedem,
Messung der Astronomischen Einheit nach Ole Römer
 Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Messung der Astronomischen Einheit nach Ole Römer (mit Lösungen) 1 Einleitung Misst man um die
Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Messung der Astronomischen Einheit nach Ole Römer (mit Lösungen) 1 Einleitung Misst man um die
Spektren von Himmelskörpern
 Spektren von Himmelskörpern Inkohärente Lichtquellen Tobias Schulte 25.05.2016 1 Gliederung Schwarzkörperstrahlung Spektrum der Sonne Spektralklassen Hertzsprung Russell Diagramm Scheinbare und absolute
Spektren von Himmelskörpern Inkohärente Lichtquellen Tobias Schulte 25.05.2016 1 Gliederung Schwarzkörperstrahlung Spektrum der Sonne Spektralklassen Hertzsprung Russell Diagramm Scheinbare und absolute
Physikalisches Grundpraktikum Technische Universität Chemnitz
 Physikalisches Grundpraktikum Technische Universität Chemnitz Protokoll «A3 - Atomspektren - BALMER-Serie» Martin Wolf Betreuer: DP Emmrich Mitarbeiter: Martin Helfrich
Physikalisches Grundpraktikum Technische Universität Chemnitz Protokoll «A3 - Atomspektren - BALMER-Serie» Martin Wolf Betreuer: DP Emmrich Mitarbeiter: Martin Helfrich
3. Analyse der Kamerabewegung Video - Inhaltsanalyse
 3. Analyse der Kamerabewegung Video - Inhaltsanalyse Stephan Kopf Bewegungen in Videos Objektbewegungen (object motion) Kameraoperationen bzw. Kamerabewegungen (camera motion) Semantische Informationen
3. Analyse der Kamerabewegung Video - Inhaltsanalyse Stephan Kopf Bewegungen in Videos Objektbewegungen (object motion) Kameraoperationen bzw. Kamerabewegungen (camera motion) Semantische Informationen
Eine einfache Methode zur Bestimmung des Bahnradius eines Planetoiden
 Eine einfache Methode zur Bestimmung des Bahnradius eines Planetoiden Von Eckhardt Schön Erfurt Mit 1 Abbildung Die Bewegung der Planeten und Kleinkörper des Sonnensystems verläuft scheinbar zweidimensional
Eine einfache Methode zur Bestimmung des Bahnradius eines Planetoiden Von Eckhardt Schön Erfurt Mit 1 Abbildung Die Bewegung der Planeten und Kleinkörper des Sonnensystems verläuft scheinbar zweidimensional
Bildwinkel & Auflösung
 Whitepaper HD-Kameraserie 4500/4900 Bildwinkel & Auflösung Deutsch Rev. 1.0.0 / 2010-10-13 1 Zusammenfassung Dallmeier HD-Kameras der Serie 4500 / 4900 liefern Bilder in hoher Qualität bei Auflösungen
Whitepaper HD-Kameraserie 4500/4900 Bildwinkel & Auflösung Deutsch Rev. 1.0.0 / 2010-10-13 1 Zusammenfassung Dallmeier HD-Kameras der Serie 4500 / 4900 liefern Bilder in hoher Qualität bei Auflösungen
Entdeckungsmethoden für Exoplaneten
 Entdeckungsmethoden für Exoplaneten Wiederholung: Warum ist die Entdeckung extrasolarer Planeten so schwierig? Sterne sind sehr weit entfernt (nächster Stern Proxima Centauri, 4.3 * 9.5 *10^12 km) Der
Entdeckungsmethoden für Exoplaneten Wiederholung: Warum ist die Entdeckung extrasolarer Planeten so schwierig? Sterne sind sehr weit entfernt (nächster Stern Proxima Centauri, 4.3 * 9.5 *10^12 km) Der
Grundlegende Fakten über Lupen
 Grundlegende Fakten über Lupen Inhaltsverzeichnis Grundlegende Fakten über Lupen 2 1. Wählen Sie die passende Vergrößerungsstärke für Ihre Zwecke 2 2. Die Vergrößerungsstärke ändert sich mit den Anwendungsbedingungen
Grundlegende Fakten über Lupen Inhaltsverzeichnis Grundlegende Fakten über Lupen 2 1. Wählen Sie die passende Vergrößerungsstärke für Ihre Zwecke 2 2. Die Vergrößerungsstärke ändert sich mit den Anwendungsbedingungen
Physik 4, Übung 4, Prof. Förster
 Physik 4, Übung 4, Prof. Förster Christoph Hansen Emailkontakt Dieser Text ist unter dieser Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Falls
Physik 4, Übung 4, Prof. Förster Christoph Hansen Emailkontakt Dieser Text ist unter dieser Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Falls
Histogramm Mit dem Histogramm zu besseren Bildern?!
 Seite 1 Mit dem zu besseren Bildern?! Eine Einführung in die funktion von Digitalkameras - 13. Eppsteiner Fototage - Seite 2 - Begriffserklärung - Ein (Säulendiagramm) ist die grafische Darstellung der
Seite 1 Mit dem zu besseren Bildern?! Eine Einführung in die funktion von Digitalkameras - 13. Eppsteiner Fototage - Seite 2 - Begriffserklärung - Ein (Säulendiagramm) ist die grafische Darstellung der
Gitter. Schriftliche VORbereitung:
 D06a In diesem Versuch untersuchen Sie die physikalischen Eigenschaften eines optischen s. Zu diesen za hlen insbesondere die konstante und das Auflo sungsvermo gen. Schriftliche VORbereitung: Wie entsteht
D06a In diesem Versuch untersuchen Sie die physikalischen Eigenschaften eines optischen s. Zu diesen za hlen insbesondere die konstante und das Auflo sungsvermo gen. Schriftliche VORbereitung: Wie entsteht
Messung der Astronomischen Einheit durch Spektroskopie der Sonne
 Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Messung der Astronomischen Einheit durch Spektroskopie der Sonne (mit Lösungen) 1 Einleitung
Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Messung der Astronomischen Einheit durch Spektroskopie der Sonne (mit Lösungen) 1 Einleitung
Versuch 3: Beugung am Spalt und Kreisblende
 Versuch 3: Beugung am Spalt und Kreisblende Dieser Versuch soll der Einführung der allgemeinen Beugungstheorie dienen. Beugungsphänomene werden in verschiedenen Erscheinungsformen zunächst nur beobachtet.
Versuch 3: Beugung am Spalt und Kreisblende Dieser Versuch soll der Einführung der allgemeinen Beugungstheorie dienen. Beugungsphänomene werden in verschiedenen Erscheinungsformen zunächst nur beobachtet.
Der Tanz der Jupiter-Monde
 T.H. Der Tanz der Jupiter-Monde V1.1 Thomas Hebbeker 27.10.2012 Motivation Messung der Bahndaten der 4 Galileischen Jupitermonde Umlaufzeiten, Bahnradien Überprüfung des III. Keplerschen Gesetzes Berechnung
T.H. Der Tanz der Jupiter-Monde V1.1 Thomas Hebbeker 27.10.2012 Motivation Messung der Bahndaten der 4 Galileischen Jupitermonde Umlaufzeiten, Bahnradien Überprüfung des III. Keplerschen Gesetzes Berechnung
T.Hebbeker T.H. V1.0. Der Tanz der Jupiter-Monde. oder. Auf den Spuren Ole Rømers
 T.H. Der Tanz der Jupiter-Monde V1.0 oder Auf den Spuren Ole Rømers Thomas Hebbeker 25.06.2012 Motivation Messung der Bahndaten der 4 Galileischen Jupitermonde Umlaufzeiten, Bahnradien Überprüfung des
T.H. Der Tanz der Jupiter-Monde V1.0 oder Auf den Spuren Ole Rømers Thomas Hebbeker 25.06.2012 Motivation Messung der Bahndaten der 4 Galileischen Jupitermonde Umlaufzeiten, Bahnradien Überprüfung des
Messung der Astronomischen Einheit nach Ole Römer
 Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Messung der Astronomischen Einheit nach Ole Römer Einleitung Misst man um die Zeit der Jupiteropposition
Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Messung der Astronomischen Einheit nach Ole Römer Einleitung Misst man um die Zeit der Jupiteropposition
4. Segmentierung von Objekten Video - Inhaltsanalyse
 4. Segmentierung von Objekten Video - Inhaltsanalyse Stephan Kopf Inhalt Vorgehensweise Berechnung der Kamerabewegungen zwischen beliebigen Bildern Transformation eines Bildes Hintergrundbilder / Panoramabilder
4. Segmentierung von Objekten Video - Inhaltsanalyse Stephan Kopf Inhalt Vorgehensweise Berechnung der Kamerabewegungen zwischen beliebigen Bildern Transformation eines Bildes Hintergrundbilder / Panoramabilder
Auch wenn einige unter Ihnen vielleicht noch nie eine konventionelle Kamera benutzt
 36 mm 35 mm Kleinbild 135 24x36 Nennformat 24 x 36 mm Diarahmen: 23 x 35 mm 24 mm 1 Auch wenn einige unter Ihnen vielleicht noch nie eine konventionelle Kamera benutzt haben, in der man einen Film einlegt,
36 mm 35 mm Kleinbild 135 24x36 Nennformat 24 x 36 mm Diarahmen: 23 x 35 mm 24 mm 1 Auch wenn einige unter Ihnen vielleicht noch nie eine konventionelle Kamera benutzt haben, in der man einen Film einlegt,
9. GV: Atom- und Molekülspektren
 Physik Praktikum I: WS 2005/06 Protokoll zum Praktikum Dienstag, 25.10.05 9. GV: Atom- und Molekülspektren Protokollanten Jörg Mönnich Anton Friesen - Veranstalter Andreas Branding - 1 - Theorie Während
Physik Praktikum I: WS 2005/06 Protokoll zum Praktikum Dienstag, 25.10.05 9. GV: Atom- und Molekülspektren Protokollanten Jörg Mönnich Anton Friesen - Veranstalter Andreas Branding - 1 - Theorie Während
Lösungsvorschlag zur Modulprüfung Numerische Methoden Sommersemester 2016
 Institut für Analysis Prof Dr Michael Plum Lösungsvorschlag zur Modulprüfung Numerische Methoden Sommersemester 0 0090 Aufgabe Punkte: Betrachten Sie das lineare Gleichungssystem Ax = b mit A = 0 und b
Institut für Analysis Prof Dr Michael Plum Lösungsvorschlag zur Modulprüfung Numerische Methoden Sommersemester 0 0090 Aufgabe Punkte: Betrachten Sie das lineare Gleichungssystem Ax = b mit A = 0 und b
Astronomische Einheit. σ SB = W m 2 K 4 G= m 3 kg 1 s 2 M = kg M = kg c= km s 1. a=d/(1 e)=3.
 Einführung in die Astronomie I Wintersemester 2007/2008 Beispielklausur Musterlösung Allgemeine Regeln Die Bearbeitungszeit der Klausur beträgt eine Stunde (60 Minuten). Außer eines Taschenrechners sind
Einführung in die Astronomie I Wintersemester 2007/2008 Beispielklausur Musterlösung Allgemeine Regeln Die Bearbeitungszeit der Klausur beträgt eine Stunde (60 Minuten). Außer eines Taschenrechners sind
Eigenbewegung und Parallaxe von Barnards Pfeilstern (mit Lösungen)
 Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Eigenbewegung und Parallaxe von Barnards Pfeilstern (mit Lösungen) 1 Einleitung Der Parallaxeneffekt
Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Eigenbewegung und Parallaxe von Barnards Pfeilstern (mit Lösungen) 1 Einleitung Der Parallaxeneffekt
5 Interpolation und Approximation
 5 Interpolation und Approximation Problemstellung: Es soll eine Funktion f(x) approximiert werden, von der die Funktionswerte nur an diskreten Stellen bekannt sind. 5. Das Interpolationspolynom y y = P(x)
5 Interpolation und Approximation Problemstellung: Es soll eine Funktion f(x) approximiert werden, von der die Funktionswerte nur an diskreten Stellen bekannt sind. 5. Das Interpolationspolynom y y = P(x)
1.2 Schwingungen von gekoppelten Pendeln
 0 1. Schwingungen von gekoppelten Pendeln Aufgaben In diesem Experiment werden die Schwingungen von zwei Pendeln untersucht, die durch eine Feder miteinander gekoppelt sind. Für verschiedene Kopplungsstärken
0 1. Schwingungen von gekoppelten Pendeln Aufgaben In diesem Experiment werden die Schwingungen von zwei Pendeln untersucht, die durch eine Feder miteinander gekoppelt sind. Für verschiedene Kopplungsstärken
Lösung: a) b = 3, 08 m c) nein
 Phy GK13 Physik, BGL Aufgabe 1, Gitter 1 Senkrecht auf ein optisches Strichgitter mit 100 äquidistanten Spalten je 1 cm Gitterbreite fällt grünes monochromatisches Licht der Wellenlänge λ = 544 nm. Unter
Phy GK13 Physik, BGL Aufgabe 1, Gitter 1 Senkrecht auf ein optisches Strichgitter mit 100 äquidistanten Spalten je 1 cm Gitterbreite fällt grünes monochromatisches Licht der Wellenlänge λ = 544 nm. Unter
Pretalk. Eine kurze Einführung in die Astrofotografie. Zum Einstieg ein paar ausgewählte Aufnahmen von mir
 Pretalk Eine kurze Einführung in die Astrofotografie Zum Einstieg ein paar ausgewählte Aufnahmen von mir Cool, was brauch ich dafür denn alles? Herausforderung: Verdammt, da war doch was! Die Erde
Pretalk Eine kurze Einführung in die Astrofotografie Zum Einstieg ein paar ausgewählte Aufnahmen von mir Cool, was brauch ich dafür denn alles? Herausforderung: Verdammt, da war doch was! Die Erde
Dipl. - Ing. Frank Pitz Faustformeln für die Astronomie
 Vor ein paar Jahren hatte ich mal ein Experiment gemacht. Ich baute mir ein Regressionsanalyseprogramm in QuickBasic und fragte mich, ob es eine echte funktionelle Formel für Mondorbitale um Planeten gibt.
Vor ein paar Jahren hatte ich mal ein Experiment gemacht. Ich baute mir ein Regressionsanalyseprogramm in QuickBasic und fragte mich, ob es eine echte funktionelle Formel für Mondorbitale um Planeten gibt.
SOLINGEN. Spektralklassifikation. ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Regionalwettbewerb Jugend forscht. Benedikt Schneider
 ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Regionalwettbewerb Jugend forscht SOLINGEN Spektralklassifikation Benedikt Schneider Schule: Carl-Fuhlrott Gymnasium Wuppertal Jugend forscht 2012 Carl-Fuhlrott-Gymnasium
ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Regionalwettbewerb Jugend forscht SOLINGEN Spektralklassifikation Benedikt Schneider Schule: Carl-Fuhlrott Gymnasium Wuppertal Jugend forscht 2012 Carl-Fuhlrott-Gymnasium
Einige Anmerkungen zu den Algolsternen GSC (Brh V18), V375 Peg (Brh V29) und V1635 Ori (Brh V36)
 Einige Anmerkungen zu den Algolsternen GSC 0490-4680 (Brh V18), V375 Peg (Brh V29) und V1635 Ori (Brh V36) Klaus Bernhard Abstract: CCD observations and ASAS-3 data of the EA variables GSC 0490-4680 (Brh
Einige Anmerkungen zu den Algolsternen GSC 0490-4680 (Brh V18), V375 Peg (Brh V29) und V1635 Ori (Brh V36) Klaus Bernhard Abstract: CCD observations and ASAS-3 data of the EA variables GSC 0490-4680 (Brh
Ferienkurs Experimentalphysik 3
 Ferienkurs Experimentalphysik 3 Wintersemester 2014/2015 Thomas Maier, Alexander Wolf Lösung Probeklausur Aufgabe 1: Lichtleiter Ein Lichtleiter mit dem Brechungsindex n G = 1, 3 sei hufeisenförmig gebogen
Ferienkurs Experimentalphysik 3 Wintersemester 2014/2015 Thomas Maier, Alexander Wolf Lösung Probeklausur Aufgabe 1: Lichtleiter Ein Lichtleiter mit dem Brechungsindex n G = 1, 3 sei hufeisenförmig gebogen
Michelson-Interferometer (Anleitung MIFAnalyse mit Matlab)
 Physikalisches Praktikum II Michelson-Interferometer (Anleitung MIFAnalyse mit Matlab) Die Software MIFAnalyse dient zur Auswertung von Interferogrammen im Rahmen des PHB4 Praktikumsversuches Michelson-Interferometer
Physikalisches Praktikum II Michelson-Interferometer (Anleitung MIFAnalyse mit Matlab) Die Software MIFAnalyse dient zur Auswertung von Interferogrammen im Rahmen des PHB4 Praktikumsversuches Michelson-Interferometer
Auf Mondjagd im Sonnensystem
 Auf Mondjagd im Sonnensystem Grenzerfahrungen mit der WebCam - welche Monde im Sonnensystem können mit der TouCam Pro und einem 8-Zoll-Newton beobachtet werden? Ein Bericht von Roland Bähr Die Monde der
Auf Mondjagd im Sonnensystem Grenzerfahrungen mit der WebCam - welche Monde im Sonnensystem können mit der TouCam Pro und einem 8-Zoll-Newton beobachtet werden? Ein Bericht von Roland Bähr Die Monde der
Periodensystem, elektromagnetische Spektren, Atombau, Orbitale
 Periodensystem, elektromagnetische Spektren, Atombau, Orbitale Als Mendelejew sein Periodensystem aufstellte waren die Edelgase sowie einige andere Elemente noch nicht entdeck (gelb unterlegt). Trotzdem
Periodensystem, elektromagnetische Spektren, Atombau, Orbitale Als Mendelejew sein Periodensystem aufstellte waren die Edelgase sowie einige andere Elemente noch nicht entdeck (gelb unterlegt). Trotzdem
1 Singulärwertzerlegung und Pseudoinverse
 Singulärwertzerlegung und Pseudoinverse Singulärwertzerlegung A sei eine Matrix mit n Spalten und m Zeilen. Zunächst sei n m. Bilde B = A A. Dies ist eine n n-matrix. Berechne die Eigenwerte von B. Diese
Singulärwertzerlegung und Pseudoinverse Singulärwertzerlegung A sei eine Matrix mit n Spalten und m Zeilen. Zunächst sei n m. Bilde B = A A. Dies ist eine n n-matrix. Berechne die Eigenwerte von B. Diese
Übung: Computergrafik 1
 Prof. Dr. Andreas Butz Prof. Dr. Ing. Axel Hoppe Dipl.-Medieninf. Dominikus Baur Dipl.-Medieninf. Sebastian Boring Übung: Computergrafik 1 Fouriertransformation Organisatorisches Neue Abgabefrist für Blatt
Prof. Dr. Andreas Butz Prof. Dr. Ing. Axel Hoppe Dipl.-Medieninf. Dominikus Baur Dipl.-Medieninf. Sebastian Boring Übung: Computergrafik 1 Fouriertransformation Organisatorisches Neue Abgabefrist für Blatt
U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen. Die Mondentfernung. (mit Lösungen)
 Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen 1 Einleitung Die Mondentfernung (mit Lösungen) Als Aristarch versuchte, die Sonnenentfernung
Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen 1 Einleitung Die Mondentfernung (mit Lösungen) Als Aristarch versuchte, die Sonnenentfernung
Bei den Planetenwegen, die man durchwandern kann, sind die Dinge des Sonnensystems 1 Milliarde mal verkleinert dargestellt.
 Distanzen und Grössen im Planetenweg Arbeitsblatt 1 Bei den Planetenwegen, die man durchwandern kann, sind die Dinge des Sonnensystems 1 Milliarde mal verkleinert dargestellt. Anders gesagt: Der Massstab
Distanzen und Grössen im Planetenweg Arbeitsblatt 1 Bei den Planetenwegen, die man durchwandern kann, sind die Dinge des Sonnensystems 1 Milliarde mal verkleinert dargestellt. Anders gesagt: Der Massstab
3.3 Absenkungsverlauf
 3.3 Absenkungsverlauf 3.3.1 Aufgabe 3.3.1.1 Verzögerungsfunktion Der Absenkungsverlauf des Grundwassers auf Grund einer Entnahme aus einem Brunnen (z.b. durch einen so genannten Pumpversuch) kann in erster
3.3 Absenkungsverlauf 3.3.1 Aufgabe 3.3.1.1 Verzögerungsfunktion Der Absenkungsverlauf des Grundwassers auf Grund einer Entnahme aus einem Brunnen (z.b. durch einen so genannten Pumpversuch) kann in erster
TIVITA Tissue. » High Performance Hyperspectral Imaging Kontinuierliche Echtzeit VIS/NIR Hyperspektrale Kamera. » Datenblatt
 » High Performance Hyperspectral Imaging Kontinuierliche Echtzeit VIS/NIR Hyperspektrale Kamera» Datenblatt www.diaspective-vision.com 1 NICHTINVASIVE ERFASSUNG VON GEWEBEOXYGENIERUNG, NIR-PERFUSION, GEWEBE-
» High Performance Hyperspectral Imaging Kontinuierliche Echtzeit VIS/NIR Hyperspektrale Kamera» Datenblatt www.diaspective-vision.com 1 NICHTINVASIVE ERFASSUNG VON GEWEBEOXYGENIERUNG, NIR-PERFUSION, GEWEBE-
Inhalte. Mathematische Grundlagen. Koordinatensysteme Ebene und räumliche Koordinatentransformationen Zentralperspektive
 Inhalte Mathematische Grundlagen Koordinatensysteme Ebene und räumliche Koordinatentransformationen Zentralperspektive HS BO Lab. für Photogrammetrie: Koordinatensysteme Koordinatensysteme Ein kartesisches
Inhalte Mathematische Grundlagen Koordinatensysteme Ebene und räumliche Koordinatentransformationen Zentralperspektive HS BO Lab. für Photogrammetrie: Koordinatensysteme Koordinatensysteme Ein kartesisches
C 6 der unbekannte Korrekturfaktor?
 C 6 der unbekannte Korrekturfaktor? am Beispiel eines Linienlaser mit Bewertung nach DIN EN 60825-1 Bestimmung von C6 Kerkhoff.Thomas@bgetem.de // Stand: 2012-09 Beispiel eines Linienlasers Seite 2 Vor
C 6 der unbekannte Korrekturfaktor? am Beispiel eines Linienlaser mit Bewertung nach DIN EN 60825-1 Bestimmung von C6 Kerkhoff.Thomas@bgetem.de // Stand: 2012-09 Beispiel eines Linienlasers Seite 2 Vor
Bildwinkel & Auflösung
 Whitepaper HD-Kameras Bildwinkel & Auflösung Box-Kameras DF4510HD DF4910HD DF4910HD-DN DF4920HD-DN Dome-Kameras DDF4510HDV DDF4910HDV DDF4910HDV-DN DDF4820HDV-DN DDF4920HDV-DN IR-Kameras DF4910HD-DN/IR
Whitepaper HD-Kameras Bildwinkel & Auflösung Box-Kameras DF4510HD DF4910HD DF4910HD-DN DF4920HD-DN Dome-Kameras DDF4510HDV DDF4910HDV DDF4910HDV-DN DDF4820HDV-DN DDF4920HDV-DN IR-Kameras DF4910HD-DN/IR
Grundlagen der Bildbearbeitung
 Grundlagen der Bildbearbeitung Voraussetzungen zur Bildbearbeitung Eingabegeräte Scanner Digitale Kameras Ausgabegeräte Speichermedien Index Voraussetzungen zur Bildbearbeitung Um Bilder auf elektronischem
Grundlagen der Bildbearbeitung Voraussetzungen zur Bildbearbeitung Eingabegeräte Scanner Digitale Kameras Ausgabegeräte Speichermedien Index Voraussetzungen zur Bildbearbeitung Um Bilder auf elektronischem
SPEKTRALANALYSE. entwickelt um 1860 von: GUSTAV ROBERT KIRCHHOFF ( ; dt. Physiker) + ROBERT WILHELM BUNSEN ( ; dt.
 SPEKTRALANALYSE = Gruppe von Untersuchungsmethoden, bei denen das Energiespektrum einer Probe untersucht wird. Man kann daraus schließen, welche Stoffe am Zustandekommen des Spektrums beteiligt waren.
SPEKTRALANALYSE = Gruppe von Untersuchungsmethoden, bei denen das Energiespektrum einer Probe untersucht wird. Man kann daraus schließen, welche Stoffe am Zustandekommen des Spektrums beteiligt waren.
In diesem Beitrag sollen die einzelnen Möglichkeiten detaillierter erläutert und bei Notwendigkeit mit einem Beispiel hinterlegt werden.
 Inhalte einfügen Das Menü Inhalte einfügen bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten kopierte Elemente wieder in ein Tabellenblatt einzufügen. Dabei kann im Gegensatz zum normalen Einfügen darauf geachtet
Inhalte einfügen Das Menü Inhalte einfügen bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten kopierte Elemente wieder in ein Tabellenblatt einzufügen. Dabei kann im Gegensatz zum normalen Einfügen darauf geachtet
Kombinierte Übungen zur Spektroskopie Beispiele für die Bearbeitung
 Im folgenden soll gezeigt werden, daß es großen Spaß macht, spektroskopische Probleme zu lösen. Es gibt kein automatisches Lösungsschema, sondern höchstens Strategien, wie beim "Puzzle Lösen"; häufig hilft
Im folgenden soll gezeigt werden, daß es großen Spaß macht, spektroskopische Probleme zu lösen. Es gibt kein automatisches Lösungsschema, sondern höchstens Strategien, wie beim "Puzzle Lösen"; häufig hilft
numerische Berechnungen von Wurzeln
 numerische Berechnungen von Wurzeln. a) Berechne x = 7 mit dem Newtonverfahren und dem Startwert x = 4. Mache die Probe nach jedem Iterationsschritt. b) h sei eine kleine Zahl, d.h. h. Wir suchen einen
numerische Berechnungen von Wurzeln. a) Berechne x = 7 mit dem Newtonverfahren und dem Startwert x = 4. Mache die Probe nach jedem Iterationsschritt. b) h sei eine kleine Zahl, d.h. h. Wir suchen einen
Thema: Spektroskopische Untersuchung von Strahlung mit Gittern
 Thema: Spektroskopische Untersuchung von Strahlung mit Gittern Gegenstand der Aufgaben ist die spektroskopische Untersuchung von sichtbarem Licht, Mikrowellenund Röntgenstrahlung mithilfe geeigneter Gitter.
Thema: Spektroskopische Untersuchung von Strahlung mit Gittern Gegenstand der Aufgaben ist die spektroskopische Untersuchung von sichtbarem Licht, Mikrowellenund Röntgenstrahlung mithilfe geeigneter Gitter.
Versuch O02: Fernrohr, Mikroskop und Teleobjektiv
 Versuch O02: Fernrohr, Mikroskop und Teleobjektiv 5. März 2014 I Lernziele Strahlengang beim Refraktor ( Linsenfernrohr ) Strahlengang beim Mikroskop Strahlengang beim Teleobjektiv sowie Einblick in dessen
Versuch O02: Fernrohr, Mikroskop und Teleobjektiv 5. März 2014 I Lernziele Strahlengang beim Refraktor ( Linsenfernrohr ) Strahlengang beim Mikroskop Strahlengang beim Teleobjektiv sowie Einblick in dessen
Ph 16/01 G_Online-Ergänzung
 Ph 16/01 G_Online-Ergänzung S. I S. I + II S. II PHYSIK KAI MÜLLER Online-Ergänzung 1 Spektralanalyse für den Hausgebrauch Material Lichtquelle ( Energiesparlampe, LED-Lampe, Kerze (Vorsicht: nichts anbrennen!),
Ph 16/01 G_Online-Ergänzung S. I S. I + II S. II PHYSIK KAI MÜLLER Online-Ergänzung 1 Spektralanalyse für den Hausgebrauch Material Lichtquelle ( Energiesparlampe, LED-Lampe, Kerze (Vorsicht: nichts anbrennen!),
Verwendungszweck elektronischer Kameras
 Verwendungszweck elektronischer Kameras - Erfassung von Objekten durch optische Abbildung (= zweidimensionale Helligkeitsverteilung) und Umwandlung in elektrische Signale. Anschließend Digitalisierung
Verwendungszweck elektronischer Kameras - Erfassung von Objekten durch optische Abbildung (= zweidimensionale Helligkeitsverteilung) und Umwandlung in elektrische Signale. Anschließend Digitalisierung
PP Physikalisches Pendel
 PP Physikalisches Pendel Blockpraktikum Frühjahr 2007 (Gruppe 2) 25. April 2007 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 2 2 Theoretische Grundlagen 2 2.1 Ungedämpftes physikalisches Pendel.......... 2 2.2 Dämpfung
PP Physikalisches Pendel Blockpraktikum Frühjahr 2007 (Gruppe 2) 25. April 2007 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 2 2 Theoretische Grundlagen 2 2.1 Ungedämpftes physikalisches Pendel.......... 2 2.2 Dämpfung
Mathematik Name: Klassenarbeit Nr. 2 Klasse 9a Punkte: /30 Note: Schnitt:
 Aufgabe 1: [4P] Erkläre mit zwei Skizzen, vier Formeln und ein paar Worten die jeweils zwei Varianten der beiden Strahlensätze. Lösung 1: Es gibt viele Arten, die beiden Strahlensätze zu erklären, etwa:
Aufgabe 1: [4P] Erkläre mit zwei Skizzen, vier Formeln und ein paar Worten die jeweils zwei Varianten der beiden Strahlensätze. Lösung 1: Es gibt viele Arten, die beiden Strahlensätze zu erklären, etwa:
Das Wasserstoffatom Energiestufen im Atom
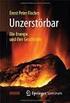 11. 3. Das Wasserstoffatom 11.3.1 Energiestufen im Atom Vorwissen: Hg und Na-Dampflampe liefern ein charakteristisches Spektrum, das entweder mit einem Gitter- oder einem Prismenspektralapparat betrachtet
11. 3. Das Wasserstoffatom 11.3.1 Energiestufen im Atom Vorwissen: Hg und Na-Dampflampe liefern ein charakteristisches Spektrum, das entweder mit einem Gitter- oder einem Prismenspektralapparat betrachtet
Praktikum I PP Physikalisches Pendel
 Praktikum I PP Physikalisches Pendel Hanno Rein Betreuer: Heiko Eitel 16. November 2003 1 Ziel der Versuchsreihe In der Physik lassen sich viele Vorgänge mit Hilfe von Schwingungen beschreiben. Die klassische
Praktikum I PP Physikalisches Pendel Hanno Rein Betreuer: Heiko Eitel 16. November 2003 1 Ziel der Versuchsreihe In der Physik lassen sich viele Vorgänge mit Hilfe von Schwingungen beschreiben. Die klassische
Übungsblatt
 Übungsblatt 3 3.5.27 ) Die folgenden vier Matrizen bilden eine Darstellung der Gruppe C 4 : E =, A =, B =, C = Zeigen Sie einige Gruppeneigenschaften: a) Abgeschlossenheit: Berechnen Sie alle möglichen
Übungsblatt 3 3.5.27 ) Die folgenden vier Matrizen bilden eine Darstellung der Gruppe C 4 : E =, A =, B =, C = Zeigen Sie einige Gruppeneigenschaften: a) Abgeschlossenheit: Berechnen Sie alle möglichen
D-INFK Lineare Algebra HS 2014 Roman Glebov Marc Pollefeys. Serie 13
 D-INFK Lineare Algebra HS 2014 Roman Glebov Marc Pollefeys Serie 13 1. Um einen Tisch sitzen 7 Zwerge. Vor jedem steht ein Becher mit Milch. Einer der Zwerge verteilt seine Milch gleichmässig auf alle
D-INFK Lineare Algebra HS 2014 Roman Glebov Marc Pollefeys Serie 13 1. Um einen Tisch sitzen 7 Zwerge. Vor jedem steht ein Becher mit Milch. Einer der Zwerge verteilt seine Milch gleichmässig auf alle
Übungen zur Experimentalphysik 3
 Übungen zur Experimentalphysik 3 Prof. Dr. L. Oberauer Wintersemester 200/20 8. Übungsblatt - 3.Dezember 200 Musterlösung Franziska Konitzer (franziska.konitzer@tum.de) Aufgabe ( ) (7 Punkte) Gegeben sei
Übungen zur Experimentalphysik 3 Prof. Dr. L. Oberauer Wintersemester 200/20 8. Übungsblatt - 3.Dezember 200 Musterlösung Franziska Konitzer (franziska.konitzer@tum.de) Aufgabe ( ) (7 Punkte) Gegeben sei
5. Die gelbe Doppellinie der Na-Spektrallampe ist mit dem Gitter (1. und 2. Ordnung) zu messen und mit dem Prisma zu beobachten.
 Universität Potsdam Institut für Physik und Astronomie Grundpraktikum O Gitter/Prisma Geräte, bei denen man von der spektralen Zerlegung des Lichts (durch Gitter bzw. Prismen) Gebrauch macht, heißen (Gitter-
Universität Potsdam Institut für Physik und Astronomie Grundpraktikum O Gitter/Prisma Geräte, bei denen man von der spektralen Zerlegung des Lichts (durch Gitter bzw. Prismen) Gebrauch macht, heißen (Gitter-
Sonne, Mond und der Ennser Stadtturm - Bestimmung der Größe und Entfernung von Objekten mit Hilfe von Digitalfotos
 THEMA DES PROJEKTS: Sonne, Mond und der Ennser Stadtturm - Bestimmung der Größe und Entfernung von Objekten mit Hilfe von Digitalfotos TEILNEHMER: 8 SchülerInnen der 4AR, 4BR des BRG Enns (Jahrgang 2014/15)
THEMA DES PROJEKTS: Sonne, Mond und der Ennser Stadtturm - Bestimmung der Größe und Entfernung von Objekten mit Hilfe von Digitalfotos TEILNEHMER: 8 SchülerInnen der 4AR, 4BR des BRG Enns (Jahrgang 2014/15)
Club Apollo 13, 14. Wettbewerb Aufgabe 1.
 Club Apollo 13, 14. Wettbewerb Aufgabe 1. (1) a) Grundlagenteil: Basteln und Experimentieren Wir haben den Versuchsaufbau entsprechend der Versuchsanleitung aufgebaut. Den Aufbau sowie die Phase des Bauens
Club Apollo 13, 14. Wettbewerb Aufgabe 1. (1) a) Grundlagenteil: Basteln und Experimentieren Wir haben den Versuchsaufbau entsprechend der Versuchsanleitung aufgebaut. Den Aufbau sowie die Phase des Bauens
Wir sollen erarbeiten, wie man die Entfernung zu einem Stern bestimmen kann.
 Expertengruppenarbeit Parallaxe Das ist unsere Aufgabe: Wir sollen erarbeiten, wie man die Entfernung zu einem Stern bestimmen kann. Konkret ist Folgendes zu tun: Lesen Sie die Informationstexte und bearbeiten
Expertengruppenarbeit Parallaxe Das ist unsere Aufgabe: Wir sollen erarbeiten, wie man die Entfernung zu einem Stern bestimmen kann. Konkret ist Folgendes zu tun: Lesen Sie die Informationstexte und bearbeiten
Dados / Gitterspektrograph. Dr. Michael König, Sternwarte Heppenheim
 Dados / Gitterspektrograph Dr. Michael König, 17.12.2014 Sternwarte Heppenheim Dados / Gitterspektrograph Dados Erste Arbeiten Messung von Spektren (Vspec) Dados Gitterspektrograph / Baader Planetarium
Dados / Gitterspektrograph Dr. Michael König, 17.12.2014 Sternwarte Heppenheim Dados / Gitterspektrograph Dados Erste Arbeiten Messung von Spektren (Vspec) Dados Gitterspektrograph / Baader Planetarium
Dispersion von Prismen (O2)
 Dispersion von Prismen (O) Ziel des Versuches Für drei Prismen aus verschiedenen Glassorten soll durch die Methode der Minimalablenkung die Dispersion, d. h. die Abhängigkeit der Brechungsindizes von der
Dispersion von Prismen (O) Ziel des Versuches Für drei Prismen aus verschiedenen Glassorten soll durch die Methode der Minimalablenkung die Dispersion, d. h. die Abhängigkeit der Brechungsindizes von der
Bildkontrolle mit Hilfe des Histogramms
 Bildkontrolle mit Hilfe des Histogramms Mit Hilfe des Kamera-Histogramms lässt sich direkt nach der Aufnahme prüfen ob die Belichtung richtig war oder ob Korrekturen vorgenommen werden müssen. Die meisten
Bildkontrolle mit Hilfe des Histogramms Mit Hilfe des Kamera-Histogramms lässt sich direkt nach der Aufnahme prüfen ob die Belichtung richtig war oder ob Korrekturen vorgenommen werden müssen. Die meisten
Mathematische Grundlagen der dynamischen Simulation
 Mathematische Grundlagen der dynamischen Simulation Dynamische Systeme sind Systeme, die sich verändern. Es geht dabei um eine zeitliche Entwicklung und wie immer in der Informatik betrachten wir dabei
Mathematische Grundlagen der dynamischen Simulation Dynamische Systeme sind Systeme, die sich verändern. Es geht dabei um eine zeitliche Entwicklung und wie immer in der Informatik betrachten wir dabei
HDR-Bilder in der Naturfotografie Was ist das? Wozu ist das gut? Wonsheim, 17. November 2007
 HDR-Bilder in der Naturfotografie Was ist das? Wozu ist das gut? Wonsheim, 17. November 2007 Gliederung Einführung was ist HDR? verschiedene Möglichkeiten für DRI Belichtungskombination HDR Diskussion
HDR-Bilder in der Naturfotografie Was ist das? Wozu ist das gut? Wonsheim, 17. November 2007 Gliederung Einführung was ist HDR? verschiedene Möglichkeiten für DRI Belichtungskombination HDR Diskussion
PANORAMA-FOTOGRAFIE. Tutorial 1: Die optimale Aufnahme von Jürgen Winkels
 PANORAMA-FOTOGRAFIE Tutorial 1: Die optimale Aufnahme von Jürgen Winkels AGENDA 1. Was ist Panorama-Fotografie? 2. Optimale Kameraeinstellungen 3. Optimale Aufnahme (Komposition) 4. Techniktrick für Nerds
PANORAMA-FOTOGRAFIE Tutorial 1: Die optimale Aufnahme von Jürgen Winkels AGENDA 1. Was ist Panorama-Fotografie? 2. Optimale Kameraeinstellungen 3. Optimale Aufnahme (Komposition) 4. Techniktrick für Nerds
Messung der Fixsternparallaxe des Sterns Ross 248
 Messung der Fixsternparallaxe des Sterns Ross 248 Erwin Schwab und Rainer Kresken Starkenburg-Sternwarte Heppenheim Auf der Starkenburg-Sternwarte Heppenheim haben sich in den Jahren 1999 bis 2002 mehrere
Messung der Fixsternparallaxe des Sterns Ross 248 Erwin Schwab und Rainer Kresken Starkenburg-Sternwarte Heppenheim Auf der Starkenburg-Sternwarte Heppenheim haben sich in den Jahren 1999 bis 2002 mehrere
Lineares Gleichungssystem - Vertiefung
 Lineares Gleichungssystem - Vertiefung Die Lösung Linearer Gleichungssysteme ist das "Gauß'sche Eliminationsverfahren" gut geeignet - schon erklärt unter Z02. Alternativ kann mit einem Matrixformalismus
Lineares Gleichungssystem - Vertiefung Die Lösung Linearer Gleichungssysteme ist das "Gauß'sche Eliminationsverfahren" gut geeignet - schon erklärt unter Z02. Alternativ kann mit einem Matrixformalismus
Physikalisches Praktikum 3
 Datum: 0.10.04 Physikalisches Praktikum 3 Versuch: Betreuer: Goniometer und Prisma Dr. Enenkel Aufgaben: 1. Ein Goniometer ist zu justieren.. Der Brechungsindex n eines gegebenen Prismas ist für 4 markante
Datum: 0.10.04 Physikalisches Praktikum 3 Versuch: Betreuer: Goniometer und Prisma Dr. Enenkel Aufgaben: 1. Ein Goniometer ist zu justieren.. Der Brechungsindex n eines gegebenen Prismas ist für 4 markante
2. Gauß-Integration. Prof. Dr. Wandinger 4. Scheibenelemente FEM 4.2-1
 Die analytische Integration der Steifigkeitsmatrix für das Rechteckelement ist recht mühsam. Für Polynome gibt es eine einfachere Methode zur Berechnung von Integralen, ohne dass die Stammfunktion benötigt
Die analytische Integration der Steifigkeitsmatrix für das Rechteckelement ist recht mühsam. Für Polynome gibt es eine einfachere Methode zur Berechnung von Integralen, ohne dass die Stammfunktion benötigt
Analytische Lösung algebraischer Gleichungen dritten und vierten Grades
 Analytische Lösung algebraischer Gleichungen dritten und vierten Grades Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 1 2 Gleichungen dritten Grades 3 3 Gleichungen vierten Grades 7 1 Einführung In diesem Skript werden
Analytische Lösung algebraischer Gleichungen dritten und vierten Grades Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 1 2 Gleichungen dritten Grades 3 3 Gleichungen vierten Grades 7 1 Einführung In diesem Skript werden
Reduktion, Bearbeitung und Auswertung von Sternspektren
 Reduktion, Bearbeitung und Auswertung von Sternspektren Teil 1: Spektrenbearbeitung und Spektrenreduktion Teil 2: Auswertung von Sternspektren Moderation: Ernst Pollmann Internationale Arbeitsgemeinschaft
Reduktion, Bearbeitung und Auswertung von Sternspektren Teil 1: Spektrenbearbeitung und Spektrenreduktion Teil 2: Auswertung von Sternspektren Moderation: Ernst Pollmann Internationale Arbeitsgemeinschaft
No Dark, no Flat, no...?
 Korrekturbilder für Astrofotos No Dark, no Flat, no...? Immer wieder tauchen in den Foren und auch in persönlichen Anfragen von Sternfreunden die Fragen auf: 1. Brauche ich Darks? 2. Brauche ich Darks,
Korrekturbilder für Astrofotos No Dark, no Flat, no...? Immer wieder tauchen in den Foren und auch in persönlichen Anfragen von Sternfreunden die Fragen auf: 1. Brauche ich Darks? 2. Brauche ich Darks,
Drehbare Sternkarten
 Drehbare Sternkarten Ein Computerprogramm von Udo Backhaus (ASTRONOMIE+Raumfahrt 30 (1993) 17) Drehbare Sternkarten sind, insbesondere für Anfänger, ein einfaches und vielseitiges Hilfsmittel, um mit dem
Drehbare Sternkarten Ein Computerprogramm von Udo Backhaus (ASTRONOMIE+Raumfahrt 30 (1993) 17) Drehbare Sternkarten sind, insbesondere für Anfänger, ein einfaches und vielseitiges Hilfsmittel, um mit dem
Digitale Bildverarbeitung (DBV)
 Digitale Bildverarbeitung (DBV) Prof. Dr. Ing. Heinz Jürgen Przybilla Labor für Photogrammetrie Email: heinz juergen.przybilla@hs bochum.de Tel. 0234 32 10517 Sprechstunde: Montags 13 14 Uhr und nach Vereinbarung
Digitale Bildverarbeitung (DBV) Prof. Dr. Ing. Heinz Jürgen Przybilla Labor für Photogrammetrie Email: heinz juergen.przybilla@hs bochum.de Tel. 0234 32 10517 Sprechstunde: Montags 13 14 Uhr und nach Vereinbarung
3 Lineare Gleichungssysteme
 Lineare Gleichungssysteme Wir wissen bereits, dass ein lineares Gleichungssystem genau dann eindeutig lösbar ist, wenn die zugehörige Matrix regulär ist. In diesem Kapitel lernen wir unterschiedliche Verfahren
Lineare Gleichungssysteme Wir wissen bereits, dass ein lineares Gleichungssystem genau dann eindeutig lösbar ist, wenn die zugehörige Matrix regulär ist. In diesem Kapitel lernen wir unterschiedliche Verfahren
Beste Bildqualität mit 6 Megapixeln!
 1 von 7 02.11.2007 11:07 Die Flut der kleinen Pixel oder der Fluch der kleinen Pixel? Freitag, den 31. August 2007 Beste Bildqualität mit 6 Megapixeln! Der beste Kompromiss für eine Kompaktkamera ist ein
1 von 7 02.11.2007 11:07 Die Flut der kleinen Pixel oder der Fluch der kleinen Pixel? Freitag, den 31. August 2007 Beste Bildqualität mit 6 Megapixeln! Der beste Kompromiss für eine Kompaktkamera ist ein
Thema: Spektroskopische Untersuchung von Strahlung mit Gittern
 Thema: Spektroskopische Untersuchung von Strahlung mit Gittern Gegenstand der Aufgabe ist die spektroskopische Untersuchung von sichtbarem Licht, Mikrowellenund Röntgenstrahlung mithilfe geeigneter Gitter.
Thema: Spektroskopische Untersuchung von Strahlung mit Gittern Gegenstand der Aufgabe ist die spektroskopische Untersuchung von sichtbarem Licht, Mikrowellenund Röntgenstrahlung mithilfe geeigneter Gitter.
www.lichtathlet.de Crashkurs Fotografie
 www.lichtathlet.de Crashkurs Fotografie Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Vorraussetzung 3. Die wichtigsten Funktionen 4. Blende 5. Belichtungszeit 6. ISO-Empfindlichkeit 7. Brennweite 8. Fokus und Schärfentiefe
www.lichtathlet.de Crashkurs Fotografie Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Vorraussetzung 3. Die wichtigsten Funktionen 4. Blende 5. Belichtungszeit 6. ISO-Empfindlichkeit 7. Brennweite 8. Fokus und Schärfentiefe
Morphing. von Tim Sternberg. Im Rahmen des Seminars Manipulation und Verarbeitung digitaler Bilder
 von Tim Sternberg Im Rahmen des Seminars Manipulation und Verarbeitung digitaler Bilder Einleitung Mit Morphing wird der fließende Übergang eines Bildes in ein anderes bezeichnet. Zwei digitale Bilder
von Tim Sternberg Im Rahmen des Seminars Manipulation und Verarbeitung digitaler Bilder Einleitung Mit Morphing wird der fließende Übergang eines Bildes in ein anderes bezeichnet. Zwei digitale Bilder
Einsatz der CCD-Kamera zur Kometenbeobachtung
 Einsatz der CCD-Kamera zur Kometenbeobachtung Dokumentation dynamischer Vorgänge bei hellen Kometen Copyright 2002 Sternwarte Harpoint Übersicht Unterschied zur chemischen Fotografie Instrumentelle Ausstattung
Einsatz der CCD-Kamera zur Kometenbeobachtung Dokumentation dynamischer Vorgänge bei hellen Kometen Copyright 2002 Sternwarte Harpoint Übersicht Unterschied zur chemischen Fotografie Instrumentelle Ausstattung
Migration und Emulation Angewandte Magie?
 Migration und Emulation Angewandte Magie? Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen funk@sub.uni-goettingen.de Kurze Einführung in die Thematik Digitale Langzeitarchivierung Digitale
Migration und Emulation Angewandte Magie? Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen funk@sub.uni-goettingen.de Kurze Einführung in die Thematik Digitale Langzeitarchivierung Digitale
Allgemeine Regeln. Nützliche Konstanten. Frage 1: Sonnensystem. Einführung in die Astronomie i. Sommersemester 2011 Beispielklausur Musterlösung
 Einführung in die Astronomie i Sommersemester 2011 Beispielklausur Musterlösung Allgemeine Regeln Die Bearbeitungszeit der Klausur beträgt eine Stunde (60 Minuten). Außer eines Taschenrechners sind keine
Einführung in die Astronomie i Sommersemester 2011 Beispielklausur Musterlösung Allgemeine Regeln Die Bearbeitungszeit der Klausur beträgt eine Stunde (60 Minuten). Außer eines Taschenrechners sind keine
A2.3 Lineare Gleichungssysteme
 A2.3 Lineare Gleichungssysteme Schnittpunkte von Graphen Bereits weiter oben wurden die Schnittpunkte von Funktionsgraphen mit den Koordinatenachsen besprochen. Wenn sich zwei Geraden schneiden, dann müssen
A2.3 Lineare Gleichungssysteme Schnittpunkte von Graphen Bereits weiter oben wurden die Schnittpunkte von Funktionsgraphen mit den Koordinatenachsen besprochen. Wenn sich zwei Geraden schneiden, dann müssen
Urknall und Entwicklung des Universums
 Urknall und Entwicklung des Universums Thomas Hebbeker RWTH Aachen University Dies Academicus 11.06.2008 Grundlegende Beobachtungen Das Big-Bang Modell Die Entwicklung des Universums 1.0 Blick ins Universum:
Urknall und Entwicklung des Universums Thomas Hebbeker RWTH Aachen University Dies Academicus 11.06.2008 Grundlegende Beobachtungen Das Big-Bang Modell Die Entwicklung des Universums 1.0 Blick ins Universum:
Periode und Amplitude der Radialgeschwindigkeitsvariation des Cepheiden Polaris
 Periode und Amplitude der Radialgeschwindigkeitsvariation des Cepheiden Polaris 1. Einführung (v. Roland Bücke, Hamburg) Polaris (α Ursa Minor) gehört nicht nur aufgrund seiner exponierten Position nahe
Periode und Amplitude der Radialgeschwindigkeitsvariation des Cepheiden Polaris 1. Einführung (v. Roland Bücke, Hamburg) Polaris (α Ursa Minor) gehört nicht nur aufgrund seiner exponierten Position nahe
