Abbildung 1: Themenpfad Religiöse Vielfalt in Bonn. Darstellung: S. Franzen, auf Basis einer Karte der Kartographischen Abteilung des Geographischen
|
|
|
- Arthur Kohl
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Abbildung 1: Themenpfad Religiöse Vielfalt in Bonn. Darstellung: S. Franzen, auf Basis einer Karte der Kartographischen Abteilung des Geographischen Instituts der Universität Bonn 1
2 Inhalt Einleitung (Franzen)... 3 Römisch-Katholische Kirche in Bonn (Fuhrmann)... 4 Evangelische Kirche in Bonn (Franzen)... 8 Judentum in Bonn (Fuhrmann) Islam in Bonn (Vera-Duarte) Standort 0: Alte Evangelische Kirche Oberkassel (Franzen) Standort 1: Heilig-Kreuz-Kirche in Limperich (Fuhrmann) Standort 2: Agia-Trias-Kirche, Orthodoxe Kirchen (Franzen) Standort 3: Nachfolge-Christi-Kirche (Franzen) Standort 4: Kindertagesstätte Heilig-Kreuz Standort 5: Kardinal-Frings-Gymnasium Standort 6: St. Josef-Kirche (Fuhrmann) Standort 7: Synagogenplatz (Fuhrmann) Standort 8: Verwaltung und Kirche der Evangelischen Gemeinde Bonn-Beuel (Franzen) Standort 9: Denkmal ehemaliger Synagoge (Fuhrmann) Standort 10: Freie Evangelische Gemeinde (Vera Duarte) Standort 11: Xhamia Mëshira Gemeinde (Vera Duarte) Standort 12: Stiftskirche (Fuhrmann) Standort 13: Bonner Moscheengmeinschaft Bonn Camii (Vera Duarte) Standort 14: Bonner Münster (Fuhrmann) Standort 15: Schlosskirche (Franzen) Standort 16: Kreuzkirche (Franzen) Standort 17: Collegium Albertinum (Fuhrmann) Standort 18: Haus der Evangelischen Kirche (Franzen) Standort 19: Synagoge Tempelstraße (Fuhrmann) Literatur
3 Einleitung (Franzen) Auf den ersten Blick mag es antiquiert erscheinen, im 21. Jahrhundert ein Projekt zum Themenkomplex Religion aufzusetzen, hat doch beispielsweise in die Wissenschaft die Säkularisierungsthese breiten Einzug gehalten, welche einen kontinuierlichen Bedeutungsverlust des Religiösen prophezeit und dieser auch in der gesellschaftlich Bedeutungsverlust scheinbar immer mehr zum Tragen kommt. Gerade aus dieser Situation heraus ergeben sich jedoch Gründe genug, einen genauen Blick auf Religion zu werfen. Denn Religion ist kein isoliertes Konzept, sondern integriert in vielfältige gesellschaftliche Interaktionen und eben jene verändernden Prozesse, denen sie sich ausgesetzt sieht machen sie zu einem lohnenden Ziel (auch) geographischer Forschung. Räumlicher Kontext für das Projekt bildet die Bundesstadt Bonn im Rheinland. Dabei bleibt der Themenpfad nicht nur auf eine Gebiet innerhalbe der Stadt beschränkt, sondern es werden verschiedene Bezirke mit einbezogen: Der Beginn liegt in Limperich, weiter führt der Pfad über Beuel, durch die Innenstadt, ums schließlich in der Gronau zu enden. Es war ein zentrales Anliegen, Bereich mit verschiedener Bau- und Nutzungsstruktur einzubeziehen, um der Zielsetzung eine Themenpfades zur religiösen Vielfalt gerecht zu werden. Themenpfade bieten die Möglichkeit, Erholungsfunktionen mit Aspekten der Bildung zu verbinden. Verstärkt treten sie in der Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit der Wochenendausflugskultur der Gesellschaft in den Jahrzenten nach dem sogenannten Wirtschaftswunder in den 1950er-Jahren des 20.Jahrhuderts auf. Themenpfade markieren in diesem Kontext für den Versuch, auf leichte und angenehme Weise Wissen direkt vor Ort zu vermitteln, ohne dabei belehrend oder verschult zu wirken. Nicht überraschend treten sie vermehrt in Naturschutzgebieten oder anderen Zonen des besonderen Schutzes der Umwelt auf (Naturparks, Nationalparks, etc.), denn dort lassen sich beispielsweise Pflanzenarten direkt dem Besucher vor Augen führen und es ist unter anderem wesentlich einfacher ein Bewusstsein für den Wert und den Schutz des Gesehen und Erfahrenen zu aktivieren. Beispiele für aktuelle Themenpfad-Konzepte im Kontext von Natur und Umwelt sind das Lehr-, Erlebnis- und Themenpfade-Handbuch, herausgegeben vom Naturpark Südschwarzwald oder von der Staatlichen Naturschutzverwaltung Baden-Württemberg herausgegeben: Auf neuen Pfaden durch den Kaiserstuhl (sieh auch Literaturverzeichnis). Doch auch für die Präsentation kultureller Güter biete sich ein Themenpfad an. Das 3
4 vorliegende Projekt möchte nicht nur Sakralbauten präsentieren, sondern einen allgemeinen Überblick über die religiösen Einrichtungen in Bonn in ihrer Vielfalt ermöglichen. Dabei ist es auch von Bedeutung, dass der Themenpfad beschreitende sich ein Bild der Religion in Bonn schafft und dieses mit seinen bisherigen Erfahrungen und Eindrücken abgleicht. Ein hervorragendes Projekt, in dem bereits ein Themenpfadkonzept in Bonn dargestellt wird, ist in dem Buch Lieber Leser, willst du mich begleiten... Ein historischer Stadtspaziergang durch den Bonner Norden. Von Sabine HARLING aus dem Jahr 2007 beschrieben, dieses dient in gewisser Weise als Vorbild uns Inspirationsquelle für den neuen Themenpfad zur Religiösen Vielfalt in Bonn. Eine Möglichkeit aktiv über die Rolle von Religion nachzudenken, wäre beispielsweise die Kennedy-Brücke zwischen der Bonner-Innenstadt und Bonn-Beuel. Dort ist es möglich, ein Blick auf die Silhouette der beiden Rheinseiten zu werfen und sich zu fragen, was für eine Rolle Kirchtürme, im Vergleich zu anderen hohen oder anderweitig markanten Gebäuden spielen. Über diese theoretische Reflexion hinaus, besteht die Möglichkeit, sich über die überragende Bedeutung von Brücken bewusst zu werden, welche nicht nur eine enorm wichtige Infrastruktur darstellen, sondern auch ein theologisches Symbol, welches in der aktuellen Situation in Deutschland, wo es viel Verständnis, aber auch eines Unverständnis für andere Religionen und andere Glauben gibt, zentral ist. Brücken bauen zu anderen Religionen ist gut möglich, indem man sich über diese eine Eindruck verschafft und eben dies ist mit dem vorliegend Themenpfad im räumliche Kontext der Rheinischen Großstadt Bonn sehr gut möglich. Viel Freude am Ausprobieren! Römisch-Katholische Kirche in Bonn (Fuhrmann) Vom Christentum und Katholizismus in Bonn Geschichte: Bonn so vermutet man wurde bereits ein Jahrzehnt vor der Geburt Christi gegründet. Der Stiefsohn von Kaiser Augustus kam mit Soldaten an den Rhein. Unter ihnen könnten auch schon die ersten Christen gewesen sein. Sicher ist, dass ab Mitte des 3. Jahrhunderts die ersten christlichen Gemeinden in Bonn gegründet wurden (HERO, 2008, S.53). 4
5 Die Stadt wuchs im Mittelalter und immer mehr Kirchen entstanden. Als der Erzbischof von Köln Siegfried von Westerburg die Schlacht von Worringen im Jahre 1288 gegen den Herzog von Brabant verlor und sich sein Machtgebiet im Norden verkleinerte, besuchte er immer häufiger die Stadt Bonn. Dadurch wuchs Bonns Bedeutung als religiöses Zentrum (HERO, 2008, S. 54). Gegen Ende des Mittelalters kamen auftretende säkulare Konflikte zwischen Stadt und Geistlichen (HERO, 2008, S. 54). Der Reformationsgedanke schwappte jedoch nicht nach Bonn, was auch der in Bonn ansässigen Orden zu verdanken war. Die im Tridentinischen Konzil Mitte des 16. Jahrhunderts entschiedenen katholischen Reformen wurden auch in Bonn aufgenommen. Dadurch wurden Priesterseminare eingeführt und Schulen eingerichtet. Daraus lässt sich schließen, dass Bonn eine fast rein christliche und später katholische Stadt war (HERO, 2008, S. 54). Dies änderte sich erst mit dem Einmarsch und der Besetzung französischen Revolutionstruppen im Jahre Die Katholische Kirche wurde komplett umgekrempelt. Die Verwaltungsinstitutionen, die von der Kirche ausgingen, wurden verstaatlicht, darunter fielen alle kirchlichen Bildungsstätten und Sozialeinrichtungen. Darüber hinaus wurden die Bonner Pfarreien neu strukturiert. Die Katholische Kirche verlor ihre Vormachtstellung in Bonn, da im Jahre 1802 die Protestanten Religionsfreiheiten zugesprochen bekamen (HERO, 2008, S. 54). Mit dem Wiener Kongress 1815 fiel Bonn an das protestantische Preußen. Dennoch stellte die Katholiken in Bonn weiterhin die Mehrheit der Bevölkerung und konnte somit die Stadt weiter prägen. Gegen Mitte und Ende des 19. Jahrhunderts richtete sich der Katholizismus im Kaiserreich neu aus. Es wurden katholische Vereine gegründet und Missionen ausgerufen. Die 1870 gegründete Zentrumspartei war eine Partei mit den Interessen der katholischen Kirche und katholischen Werten (HERO, 2008, S. 55). Im Jahr 1925 waren 80,6% der Bonner Bevölkerung Römisch-Katholisch (STATISTIKSTELLE DER BUNDESSTADT BONN, 2004). In der Zeit der Nationalsozialisten wurde versucht, das hegemoniale katholische Milieu zu domestizieren, indem beispielsweise katholische Bildungsinstitutionen verstaatlicht wurden, die Fronleichnamsprozession unterbrochen wurde und Publikationen der Kirchenzeitung untersagt wurden (HERO, 2008, S. 55). Die Herrschaft unter den Nationalsozialisten hatte Auswirkungen bis in die 1970er Jahre, da viele katholische Organisationen von dem Regime aufgelöst wurden und es Jahrzehnte dauerte bis 5
6 katholischen Vereine, Organisationen und die Seelsorge wieder aufgebaut und neu gegründet waren. 100 Anteil der Katholischen Bevölkerung in Bonn in % Abbildung 2: Anteil der Katholischen Bevölkerung in Bonn (STATISTIKSTELLE DER BUNDESSTADT BONN, 2004) Dennoch hat sich die Zahl der Katholiken im Zeitraum von 1925 bis heute mehr als halbiert. Im Jahre 2004 gab es noch Einwohner Bonns die angaben, Römisch-Katholischen Glaubens zu sein. Das entspricht 41,9% der Gesamtbevölkerung (STATISTIKSTELLE DER BUNDESSTADT BONN, 2004) sank die Zahl der Katholiken um 6000, was die Prozentzahl auf 39,2% fallen ließ (STATISTIKSTELLE DER BUNDESSTADT BONN, 2011). Die erhobenen Zahlen der Statistikstelle Bonns von Dezember 2015 zeichnen den Trend der Abnahme weiter auf. Die Zahl der Katholiken sank erneut, diesmal um auf Mitglieder, was nun 36,3% der Bonner Gesamtbevölkerung entspricht (STATISTIKSTELLE DER BUNDESSTADT BONN, 2016). Die Stadtteile mit dem höchsten Anteil an Katholiken in Bonn sind Buschdorf, Dransdorf, Lessenich/Meßdorf, Pützchen/Bechlinghoven, Li-Kü-Ra und Holtdorf & Ennert (in der untenstehenden Karte mit schwarzen Pfeilen und der Prozentzahl gekennzeichnet). Die Bonner Stadtteile mit dem geringsten Anteil an Katholiken sind folgende (mit einem orangen 6
7 Pfeil gekennzeichnete) Regionen: Neu-Plittersdorf, Mehlem-Rheinaue, Heiderhof, Medinghoven und Brüser Berg (STATISTIKSTELLE DER BUNDESSTADT BONN, 2004). Abbildung: Stadtteile Bonns mit dem höchsten (schwarze Pfeile) und niedrigsten (orange Pfeile) Anteil der katholischen Bevölkerung In Bonn gibt es 44 Gemeinden, die in fünf Dekanate gegliedert sind (PASSAVANTI, 1989, S. IXff). Darüber hinaus gibt es unzähligen katholischen Einrichtungen, Institutionen und Seelsorgebereiche, wie Gemeindezentren, Kindergärten, Schulen, Büchereien, Seniorenheime und katholische Krankenhäuser (HERO, 2008, S. 56f). 7
8 Evangelische Kirche in Bonn (Franzen) Das katholische Rheinland ist eine oft formulierte Phrase, welche auf die dominante Rolle der römisch-katholischen im Rheinland und somit auch in der Bundesstadt Bonn hinweist. Einer der Gründe für diese Ansicht liegt wohl in der jahrhundertelangen politischen und religiösen Potenz des Erzbistums Köln, welches Landesherr über bedeutende Teile des Rheinlands war und auch heute zu den mächtigsten Bistümern Deutschlands gehört. Doch es stellt sich die Frage, ob die These des katholischen Primats im Rheinland auch einer wissenschaftlichen Betrachtung standhält. Aus diesen Überlegungen heraus bildet die Frage Protestanten im Rheinland neue Diaspora oder traditioneller Bestandteil gewissermaßen den Leitsatz für die Untersuchung und Darstellung der protestantischen Einrichtungen, welche auf dem Themenpfad zu finden sind. Die insgesamt Standorte symbolisieren jeweils einen Zeitschabschnitt der Geschichte der Protestanten im Rheinland (siehe Abbildung). Abbildung 3: Übersicht über die Standorte des Themenpfads und ihre historisch-thematische Zuordnung. Eigene Darstellung. 8
9 Bezirk mit hohem Anteil an Mitgliedern der EKiR Bezirk mit niedrigem Anteil an Mitgliedern der EKiR Abbildung 4: Übersicht über die fünf statistischen Bezirke mit dem höchsten prozentualen Abteil an Mitgliedern der Evangelischen Kirche im Rheinland und der fünf statistischen 9
10 Bezirke mit dem niedrigsten Anteil an Mitgliedern der evangelische Kirche des Rheinland in der Bundesstadt Bonn: Karten- und Datengrundlage: Statistikstelle der Bundesstadt Bonn, Eigene Bearbeitung. Judentum in Bonn (Fuhrmann) Mit Beginn der Kreuzzüge im Hochmittelalter werden Juden verfolgt und gezielt getötet. Im Zuge dessen flüchteten im 12. Jahrhundert Menschen jüdischen Glaubens von Neuss nach Bonn ins Siebengebirge, um Schutz vor Mörderbanden zu finden. Der Kölner Bischof Arnold gewährt den Flüchtenden Zutritt auf der Wolkenburg, welche östlich vom Drachenfels gelegen ist. Im Gegenzug mussten die Schutzsuchenden ihr sämtliches Hab und Gut abgeben (RAUHUT-BRUNGS, 2001, S.61). Mit dem Ausbruch der Pest im Jahr 1349 kommt es erneut zu Morden an der jüdischen Bevölkerung in und um Bonn. Ein Jahr später wird vom Kölner Erzbischof entschieden, dass der Besitz der Getöteten unter den Städten Köln und Bonn aufgeteilt wird (RAUHUT-BRUNGS, 2001, S. 61). Gegen Ende des Spätmittelalters siedeln sich immer mehr Juden in Bonn an und es entsteht ein Zentrum jüdischer Gelehrsamkeit (RAUHUT-BRUNGS, 2001, S. 62). Ein Grund dafür ist, dass im Jahre 1425 alle Juden, die in Köln leben, vertrieben werden. Auch bringen die nach Bonn umsiedelnden Juden Geld und Vermögen mit, was der jüdischen Gemeinschaft zu Gute kommt (RAUHUT-BURNGS, 2001, S.63f). Um 1600 wird die Jüdische Bruderschaft für Wohltätigkeit gegründet, was zeigt, dass die jüdische Gemeinde einen großen Wert auf soziales Engagement legte und die Gemeinde in sich organisiert war und aufeinander aufpasste (RAUHUT-BURNGS, 2001, S. 64f). Die Zahl der jüdischen Bevölkerung in Bonn beträgt im Jahre (LEVY, 1929, S.7). In der Mitte des 19. Jahrhunderts kamen weitere gemeinnützige Organisationen hinzu, beispielsweise der Israelistische Armen Verein, der Israelische Frauenverein und der Verein zur Ausübung der Wohltätigkeit (HÖROLDT, 1989a, S.372). Zu Zeiten des Deutschen Kaiserreichs ging es der jüdischen Bevölkerung in Bonn finanziell besser als der deutschen Durchschnittsbevölkerung. Ein entscheidender Faktor war, dass im Jahre 1871 das Gesetz betreffend die Gleichstellung der Konfessionen in bürgerlicher und staatsbürgerlicher Beziehung in Kraft trat und somit die jüdische Bevölkerung die gleichen Rechte bekam, wie 10
11 die Katholiken und Protestanten (HÖROLDT, 1989a, S.372). Die Gleichstellung hatte allerdings auch zur Folge, dass sich die Jüdische Bevölkerung Bonns, die in einer Synagogengemeine (auch Special Gemeinde Bonn ) zusammengefasst war, in zwei Lager spaltete und schließlich zerfiel. Zum einen gab es die fortschrittlichen Israeliten, die sehr wohlhabend waren und in der Stadt Bonn lebten (HÖROLDT, 1989a, S. 373). Die Mehrheit dieser zugehörigen Juden passte sich immer mehr der deutschen Bevölkerung an und übernahm teilweise christliche Formen in ihren Gottesdienst, wie beispielsweise Orgelmusik (HÖROLDT, 1989a, S. 372; HARLING, 2007, S. 9). Dem zweiten Lager gehörten Orthodoxe Juden an, die sehr Traditionsbewusst lebten. Diese Juden waren ärmere Leute, die in den Umlandgemeinden lebten (HÖROLDT, 1989a, S. 372f). Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam es im Deutschen Kaiserreich erneut zu vermehrten Antisemitismus. Die jüdische Bevölkerung der Stadt Bonn blieb davon gänzlich verschont, was mit dem Assimilationsbesteben der fortschrittlichen Israeliten erklärt werden kann (HÖROLDT, 1989a, S. 373). Darüber hinaus wurden Juden in der Gesellschaft immer mehr aufgenommen. Das verdankt die jüdische Gemeinde ins Besondere dem Rabbiner Dr. Ludwig Philippson, der 1862 nach Bonn zog und die jüdische Gemeinde Bonns weiter in das öffentliche Leben integrierte. Ab 1870 wurden an der Bonner Universität gleich mehrere höhere Posten und Professuren mit Juden bekleidet. Ein Beispiel ist Alfred Philippson, Sohn des Rabbiners Ludwig Philippson, der ab 1899 eine Professur für Geographie innehielt (HÖROLDT, 1989a, S. 374). Die orthodoxen Juden in den Umlandgemeinden (Bad Godesberg, Beuel, Mehlem und Poppelsdorf) führten ein stilleres Leben und hielten an ihren Traditionen und Bräuchen fest. In jedem dieser Stadtteile gab es Synagogen, die jedoch im Vergleich zur Bonner Synagoge am Rhein schmuckloser und kleiner waren (HÖROLDT, 1989a, S. 375). In der Zeit des Nationalsozialismus und der systematischen Vernichtung des jüdischen Glaubens in ganz Deutschland wurden alle Bonner Synagogen zerstört und die Bevölkerung getötet oder in Konzentrationslager deportiert. Im Jahre 1933 zählte die jüdische Gemeinde Bonns 1269 Mitglieder, sechs Jahre später, zu Beginn des zweiten Weltkrieges hatte die Gemeinde noch 639 Mitglieder jüdischen Glaubens (RAUHUT-BRUNGS, 2001, S. 46, 48). 11
12 Juden in Bonn Zwei Jahre nach Ende des zweiten Weltkriegs kehren einige wenige Überlebende des Holocaust nach Bonn zurück und lassen die jüdische Gemeinde Bonns wieder aufleben, allen voran Siegfried Leopold (RAUHUT-BRUNGS, 2009a, S.21). In den 50er Jahren wurde das Grundstück, auf dem die Bonner Synagoge einst stand, der jüdischen Gemeinde zurück gegeben. Diese verkaufte das Grundstück jedoch weiter und erwarb ein neues Grundstück am Rhein in der heutigen Tempelstraße, wo Ende der 50er Jahre eine neue Synagoge gebaut wurde (RAUHUT-BRUNGS, 2009a, S. 21; RAUHUT-BRUNGS, 2009b, S. 5). Diese wird im weiteren Stadtrundgang noch besichtigt. Die Zahl der jüdischen Bevölkerung ist in den letzten sechs Jahrzehnten wieder angewachsen. Im Jahre 2004 gab es laut der Statistikstelle Bonns 1023 Juden in Bonn, davon sind jedoch 90% Ausländer. Der Großteil dieser Juden immigrierte in den 90er Jahren von der Sowjetunion nach Deutschland als sogenannte Kontingetflüchtlinge. (STATISTIKSTELLE DER BUNDESSTADT BONN, 2004) Anzahl der Juden in Bonn Jahr Abbildung 5: Entwicklung der Mitgliederzahlen der Menschen jüdischen Glaubens in Bonn 12
13 Abbildung 6: Stadtteile mit den meisten Einwohnern jüdischen Glaubens (absolute Zahlen) Lokal gesehen leben die meisten Juden im Stadtteil Auerberg (108 Juden, was einem Anteil von 10% entspricht). Darüber hinaus gibt es noch drei weitere Stadtteile, in denen mehr als 40 Menschen jüdischen Glaubens leben: Neu-Tannenbusch, Neu-Plittersdorf und 13
14 Medinghoven. Diese Stadtteile sind in der obigen Karte mit Pfeilen und den absoluten Zahlen gekennzeichnet. Islam in Bonn (Vera-Duarte) Der Islam bildet hierzulande mit etwa 4 Millionen Angehörigen, nach dem Christentum die zweitgrößte Religion. Wie es im Christentum verschiedene Religionsrichtungen und Konfessionen gibt, so praktizieren auch die Anhänger des Islams ihre Religion innerhalb verschiedener Gemeinden und entlang mehrerer Strömungen. Die daraus resultierende Pluralität der muslimischen Landschaft wird unter anderem durch die Vielfalt der Moscheegemeinden und die dahinter stehenden Organisationen bzw. Verbände deutlich. Insgesamt ist eine Tendenz der Zunahme an Moscheeneubauten zu verzeichnen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es sich oftmals um Gemeinden handelt, die bereits seit geraumer Zeit in den jeweiligen Kommunen bestehen und beispielsweise aufgrund von Raumknappheit den Wunsch nach einem neuen Moscheestandort äußern. Hinsichtlich der geographischen Verteilung von Muslimen ist ein klares Muster zu erkennen. Muslime sind in geringer Zahl in den östlichen Bundesländern zu finden, wohingegen in Nordrhein-Westfalen ein Drittel von ihnen lebt. Hierbei stechen besonders Ballungsgebiete heraus, in denen die Großzahl der Muslime vorzufinden ist. In Bonn ist beispielsweise jeder neunte Einwohner muslimischen Glaubens (Schöningh). Im Folgenden werden die Entwicklung des Islams in Bonn sowie Moscheestandorte vorgestellt. Aus der Statistikstelle der Bundesstadt Bonn geht hervor, dass im Jahr 2010 rund Einwohner muslimischen Glaubens waren. Bei einer Einwohnerzahl von rund entspricht dies etwa 9,1 Prozent der Bonner Bevölkerung. Innerhalb von fünf Jahren konnte ein Anstieg auf 9,4 Prozent (Stand:2015) verzeichnet werden. Aus heutiger Sicht lässt sich sagen, dass weiterhin eine steigende Tendenz zu erwarten ist. Wie in der unteren Abbildung zu sehen ist, konzentriert sich ein Großteil der muslimischen Bevölkerung in Bonn überwiegend in sozial schwächeren Gegenden. Besonders hervorzuheben sind hierbei Neu- Tannenbusch, Medinghoven und Lannesdorf. Wohingegen beispielweise rechtsrheinisch im Stadtbezirk Beuel (Stand 2015: 5,8%) vergleichsweise ein geringer Anteil an Muslimen ansässig ist (Bundesstadt Bonn, Statistikstelle). 14
15 Abbildung 7: Stadtteile mit den meisten Muslimen (Stand:2015) Insgesamt sind zehn Moscheen in Bonn eingetragen, drei von diesen werden im Folgenden vorgestellt. Standort 0: Alte Evangelische Kirche Oberkassel (Franzen) Die Alte Kirche in Oberkassel ist einer der wenigen Orte auf dem Gebiet der Bundesstadt Bonn, der an die Protestanten vor der Errichtung der Rheinprovinz des Königreichs Preußen im Jahre 1822 erinnert. Sie liegt nicht direkt am üblichen Themenpfad, soll aber aufgrund ihres repräsentativen Charakters für die Frühzeit des Bonner Protestantismus nicht fehlen und kann als kleine Exkursion abseits des eigentlichen Themenpfades gesehen werden. Wie bereits in der Einführung zum Protestantismus in Bonn dargelegt, hält sich bis heute der Terminus das katholische Rheinland. Es wird in eine Reihe mit anderen katholischen Kernlanden wie beispielsweise Oberbayern gesetzt und in der Tat sind die frühneuzeitlichen Protestanten im Rheinland und im speziellen in Bonn kein sehr präsentes Phänomen, was 15
16 wohl auch in der relativ dünnen Quellenlage und dem daraus resultierenden geringen Wissen über sie begründet liegt. Zentraler Satz für die frühneuzeitlichen Entwicklung in der Religionspolitik, einem der zentralen Element innerhalb der Politik des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation ist Cuius regio, eius religio als Resultat der Verhandlungen, welchem zum Augsburger Religionsfrieden von 1555 zwischen Lutheranisch- Protestantischen und Römisch-Katholischen Fürsten führte. Hier wurde festgelegt, dass der jeweilige Landesherr die Religion eines Territoriums und damit seiner Untertanen bestimmen durfte. Das Kurfürstentum Köln blieb immer Römisch-Katholisch, auch wenn die zwei Versuche die Reformation einzuführen (1. Versuch durch Hermann von Wied in den 1540er Jahren und 2. Versuch durch Gebhard von Waldburg-Trauchburg ab 1580, welcher schließlich im Truchsessischen Krieg endete) an der Katholischen Dominanz im Rheinland kratzten. Trotzdem wurde ab dem Jahr 1683 eine Evangelische Kirche auf dem Boden heutigen Bonner Stadtgebiets errichtet. Dies liegt darin begründet, dass Oberkassel, der Standort der Alten Evangelischen Kirche, nicht auf Gebiet des Kurfürstentums Köln, sondern des Herzogtums Berg lag, welches wie viele andere Territorien des weltlichen Adel sehr zur Annahme der Reformation neigte als die die durch geistlichen Fürsten beherrschten Territorien. So konnte sich in Oberkassel eine reformierte Gemeinde halten, welche wohl in ihrem Glauben den Lehren von Johannes Calvin und Huldrych Zwingli folgte. Leider ist nicht rekonstruierbar, ob vor allem die Niederländische Reformierte Schule, welche beispielsweise über Exilanten im Rheinland aktiv war oder eher die Pfälzer Reformierte Schule im südlich vom Rheinland auf die Gemeinde eingewirkt hat. Beweis der religiösen Vitalität ist ein Taufprotokoll aus dem Jahr 1782 (beglaubigt 1805), welches sich im Stadtarchiv der Bundesstadt Bonn findet. 16
17 Abbildung 8: Alte Evangelische Kirche Oberkassel. Blick von Süden. Eigene Aufnahme. Abbildung 9: Grabsteine an der Südwand der Alten Evangelischen Kirche Oberkassel. Eigene Aufnahme. 17
18 Abbildung 10: Portal der Alten Evangelischen Kirche Oberkassel mit Inschrift. Eigene Aufnahme. 18
19 Abbildung 11: Taufprotokoll der Reformierten Gemeinde Oberkassel aus dem Jahr. Aufbewahrungsort ist das Stadtarchiv Bonn, dort hat das Dokument die Archivsignatur SN Standort 1: Heilig-Kreuz-Kirche in Limperich (Fuhrmann) Das Dorf Limperich besaß bis nach dem 2. Weltkrieg keine eigene Gemeinde aufgrund der geringen Bevölkerung. Mit dem rapiden Bevölkerungszuwachs in den 50er Jahren auf über 1600 Einwohner, wurde in Köln beim Generalvikariat um eine eigene Gemeinde gebeten. Im Jahre 1958 wurde dem Antrag zugestimmt (HERBERG, 2011, S.313; PASSAVANTI, 1989, S. 199). Vier Jahre später wurde eine Notkirche errichtet und im Jahre 1968 die eigentliche Kirche eingeweiht. Darüber hinaus wurden außerdem ein Gemeindezentrum mit Pfarrsaal, Bibliothek, Gästezimmern, eine Sakristei, der Glockenturm und ein Kloster für den Männer-Orden der Kreuzherrenritter gebaut 2013, S. 5). (HANSMANN, 19
20 Abbildung 12: Grundriss der Pfarrei Heilig Kreuz, (HANSMANN, 2013, S.5) Das Kloster ist auf bitte des Kardinals Frings hin angelegt worden. Die Mönche dieses Ordens haben ihren Schwerpunkt in der Seelsorge (HANSMANN, 2013, S.2). Auf Grund von Nachwuchsmangel zog der Orden 2004 aus dem Kloster aus (HERBERG, 2011, S. 314). Vier Jahre später zog ein neuer Frauen Orden in die Klosteranlage ein. Der Orden Cuzadas de Santa Maria ist ein sehr moderner Orden, in dem die Nonnen einer Arbeit nachgehen, keine Nonnentracht tragen, jedoch nach fünf Jahren ihr Gelübde ablegen. Auch dieser Orden beruft sich ganz auf die Seelsorge in der Gemeinde (HANSMANN, 2013, S. 2; ELBERN, ). Des Weiteren wurde das Kardinal-Frings-Gymnasium (Punkt 5) 1964 gegründet und gehört auch zur Pfarrei Heilig Kreuz (HERBERG, 2011, S. 314). Die Kirche dient der Schule als Schulkirche für wöchentliche Gottesdienste wurde in 400 Meter Entfernung der Kirche eine Kindertagesstätte (Punkt 4) errichtet, die zur Pfarrei Heilig Kreuz gehört. Somit ist in den 60er bis Anfang der 70er Jahre ein komplett neues, katholisch-religiöses Zentrum in Limperich entstanden. Die Kirche ist damit eines der neuesten sakralen Bauten in Deutschland (HANSMANN, 2013, S. 2). Der Architekt hat mit Absicht die Kirche aus Ziegeln und Naturstein gebaut, um die Schönheit der einfachen Materialien zu präsentieren (HANSMANN, 2013, S.9). Die Architektur der Kirchengemeinde soll den Gemeindemitgliedern in ihrer Ganzheit aus Leib, Geist und Seele dienen und den Menschen ein Gefühl von Geborgenheit geben (HANSMANN, 2013, S.4). Hinzu kommt, dass der gesamt Gebäudekomplex in diesen Ziegeln gebaut ist und sowohl eckige als auch runde Komponenten gebaut wurden. Der Altar ist auf einer Erhebung im Zentrum der Kirche gebaut worden. Der Kirchenraum ist sehr modern und auf das notwendigste eingerichtet, um die Gemeinde nicht von dem Altargeschehen abzulenken (HANSMANN, 2013, S. 16f). 20
21 Abbildung 13: Kirchenraum von Heilig-Kreuz (Quelle: HANSMANN, 2013, S. 10) 21
22 Standort 2: Agia-Trias-Kirche, Orthodoxe Kirchen (Franzen) Laut den im Jahr 2004 erhobenen Daten lebten zum Stichtag Mitglieder (entspricht 0,7% der damaligen Gesamtbevölkerung) einer Orthodoxen Kirche auf dem Gebiet der Bundesstadt Bonn (STATISTIKSTELLE DER BUNDESSTADT BONN 2004, Seite). Orthodox ist ein Begriff, der Erklärung bedarf, denn er wird nicht nur für die Kirchen des Byzantinischen Christlichen Ritus verwendet, um die es im Folgenden gehen soll, sondern auch auf besonders konservative, auf den althergebrachten Grundsätzen pochende Gruppierungen innerhalb einer Religionsgemeinschaft bezogen, so zum Beispiel bei orthodoxen Juden. Die orthodoxen Kirchen hingegen umfassen das gesamte Spektrum, von liberalen bis konservativen Elementen unter dem Dachbegriff der Orthodoxie. Herausgebildet hat sich diese, drittgrößte Großgruppe (hinter den Römisch-Katholischen und Protestantischen Christen) des Christentums im Byzantinischen Reich (Ostrom), während in ( West -) Rom die Römisch-Katholische Kirche ihren Ursprung fand. Das Jahr der Trennung der beiden Kirche lässt sich auf 1054, das sogenannte große morgenländische Schisma datieren, welches Ergebnis eines schon vorher stattgefundenen Entfremdungsprozesses der westlichen und östlichen Theologie und ihrer dahinterliegenden Sakralkultur war. Diesem byzantinischen Ritus folgen nicht nur Römisch-Katholische und Protestantische Christen nicht, sondern auch die sogenannten Orientalisch-Orthodoxen Kirchen. Diese haben, im Gegensatz zu den Orthodoxen Kirchen des byzantinischen Ritus und den Römisch- Katholischen Kirchen (auch den Evangelischen-Protestantischen Kirchen) die Beschlüsse der Sieben Ökumenischen Konzilen (1. Konzil:, 7. Konzil) nicht angenommen, die meisten von ihnen kooperieren jedoch eng mit den Orthodoxen Kirchen des byzantinischen Ritus, andere akzeptieren sogar das Primat des Papstes und sind mit der Römisch-Katholischen Kirche uniert. Unter den orientalisch-orthodoxen Kirchen finden sich einige der ältesten Christlichen Gemeinschaften der Welt, Beispiele sind die auch Nestorianer genannte Assyrische Kirche des Ostens oder die in vorwiegend in Ägypten lebenden Kopten. Sogar in Indien finden sich Orientalisch-Orthodoxe Kirchen (bisweilen auch als Thomaschristen bezeichnet). In Bonn sind auch orientalisch-orthodoxe Kirchen vertreten, allerdings nicht mit einem ausschließlich von ihnen genutzten Kirchenbau. 22
23 Die Kirche Agia Trias (Heilige Dreifaltigkeit) befindet sich in Bonn-Limperich, unweit der Heilig-Kreuz-Kirche (Standort 1) und der Nachfolge Christi-Kirche (Standort 3). Sie gehört zum Exarchat von Zentraleuropa des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel. Dem Patriarchat von Konstantinopel obliegt traditionell der Ehrenvorsitz innerhalb der in vollständig unabhängige Einzelkirchen aufgeteilten byzantinischen Orthodoxie, die Rolle des Ökumenischen Patriarchen ist jedoch nicht mit der des Römisch-Katholischen Papstes zu vergleichen. Die Metropolie kann zum einen als Anlaufstelle für Orthodoxe Christen verstanden werden, zu anderen auch als Ort der Begegnung mit anderen Christlichen Konfessionen oder anderen Religionen, welche sonst nicht oder nur wenig mit der Orthodoxie in Verbindung kommen. Die Einwanderung von Griechen im Rahmen der Gastarbeiteranwerbung der Bundesrepublik Deutschland führte die Notwendigkeit von Kircheninfrastruktur im Ausland vor Augen, woraufhin in Bonn, der damaligen Bundeshauptstadt, 1978 ein repräsentatives Kirchengebäude fertiggestellt wurde ( Besonders sehenswert ist der Innenraum der Kirche, welcher komplett im Stile griechischer Kirchenmalerei ausgestaltet ist. Die Metropolie publiziert auch Zeitschriften, welche über das aktuelle Glaubensleben in den Gemeinde informieren und ist darüber hinaus aktiv in der akademischen Lehre, so werden unter anderem am Alt- Katholischen Seminar de Universität Bonn Veranstaltungen in Orthodoxer Theologie angeboten. Hinzu kommen noch kulturelle Angebote, wie beispielsweise Folklorekurse, welche in der weiträumigen Anlage in Limperich Platz finden ist für die Orthodoxie insgesamt ein bedeutsames Jahr, denn mit dem großen Panorthodoxen Konzil 2016 auf Kreta stehen bedeutende Entscheidungen für die Zukunft bevor. 23
24 Abbildung 14: Hinweisschild auf die Trägerschaft des Ökumenischen Patriarchats an der Metropolie in Bonn-Limperich. Eigene Aufnahme. Abbildung 15: Agia-Trias-Kirche in Bonn-Limperich. Blick von Süden. Eigene Aufnahme. 24
25 Standort 3: Nachfolge-Christi-Kirche (Franzen) Mit der Stunde null genannten Situation in Deutschland unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das Maß der Zerstörung ersichtlich, welche neuen verheerende Kriegsjahre in Deutschland angerichtet hatten. Doch nicht nur die materiellen Schäden, auch die institutionellen Schäden waren für die Evangelischen Kirchen eine große Herausforderung. So musste eine grundlegende Neuorientierung stattfinden, verbunden jedoch auch gelichzeitig mit einer Reflexion über die Zeit der letzten Jahrzehnte. Hervorzuheben ist Widerstand der sogenannten Bekennenden Kirche, welche sich gegen das Nationalsozialistische Regime gestellt hatte und welche unter anderem mit der Barmer Theologischen Erklärung auch bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung der Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg nehmen konnte. Diese Veränderungen in der Theologie und im Verständnis der Evangelischen Kirche(n) spielegelt sich auch in den Sakralbauten wieder: Ein gutes Beispiel hierfür ist die Nachfolge-Christi-Kirche in Bonn-Limperich. Das Gebäude erscheint auf den ersten Blick unauffällig, doch gerade die gewählte Schlichet ist ein Hinweis auf die neue Kirchenbauweise, welche in Bonn, aufgrund der besonderen Geschichte mit verstärkten Auftreten von Protestanten erst am dem 19. Jahrhundert und folglich einer Vielzahl moderner Kirchenbauten, an vielen Stellen beobachtet werden können (dem interessierten Leser seien hier die Evangelische Kirche auf dem Venusberg und die Friedenskirche in Kessenich/Dottendorf ans Herz gelegt. Ein wichtiges Merkmal de Nachfolge Christi-Kirche ist die Betonung von anderen Gebäuden neben dem eigentlichen Kirchenbau: Durch die räumliche Separierung des Glockenturms erfolgt eine Weitung des kompletten Areals, welche auch aus einem Kindergarten besteht. Bemerkenswert sind die Bleiglas- Fenster der Kirche des Künstlers Hermann (Herm) Dienz welche verschiedene Motive, wie eine Taube, den Heiligen Geist symbolisierend, darstellen ( 25
26 Abbildung 16: Nachfolge-Christi-Kirche in Limperich von Süden. Eigene Aufnahme 26
27 Abbildung 17: Glockenturm (mit Basketball-Korb) der Nachfolge Christi-Kirche in Limperich. Im Hintergrund der Evangelische Kindergarten. Eigene Aufnahme. Standort 4: Kindertagesstätte Heilig-Kreuz Siehe Standort 1 Standort 5: Kardinal-Frings-Gymnasium Siehe Standort 1 27
28 Standort 6: St. Josef-Kirche (Fuhrmann) Die in Beuel gelegene Josef-Kirche wurde im Jahre 1880 gebaut. Bis zu diesem Zeitpunkt besaß Beuel keine eigene Kirche und gehörte zur Gemeinde St. Peter in Vilich. Da die Zahl der Einwohner Beuels in der Mitte des 19. Jahrhunderts jedoch stark gestiegen war, wollten die Beueler ihre eigene Kirche mit Pfarrgemeinde haben (HERBERG, 2011, S.255). Nachdem die Kirche fertig gestellt wurde, wurde der Wunsch nach einer eigenständigen Gemeinde und einem Pfarrer den Beuelern zunächst jedoch weiterhin verwehrt. Priester aus den Umlandgemeinden hielten die Messen in dem errichteten Gotteshaus. Erst dreizehn Jahre später wurde St. Josef eine eigene Gemeinde (HERBERG, 2011, S. 256). Der heilige Josef ist im Übrigen der Patron der Arbeit (PASSAVANTI, 1989, S. 185). Die Kirche wurde Anfang des 20. Jahrhunderts erweitert. Steht man vor dem Hauptportal und schaut nach rechts sieht man das St.- Josefs-Hospital Beuel. Dieses wurde im Jahre 1906 eingeweiht und liegt noch heute in der Trägerschaft der Gemeinnützigen Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe. Die ersten Franziskanerinnen kamen 1891 nach Beuel und kümmerten sich zu jener Zeit besonders um die Kranken in dem Stadtteil (HERBERG, 2011, S.256). Abbildung 18: St. Josef (eigene Aufnahme) Die Kirche ist im Stil der Neugotik gebaut. Interessant ist, dass das Baumaterial fast ausschließlich aus der Region kommt. So kommen beispielsweise die Feldbrandziegel aus 28
29 Beuel oder die Basaltsteine aus Oberkassel (HERBERG, 2011, S. 258). Zu der Orginialeinrichtung gehören heute noch zwei Beichtstühle, mehrere Bänke, der Taufbrunnen, die Orgelbrüstung und der Korb der Kanzel. Die anderen Einrichtungsgegenstände sind alle neuer, vieles wurde in den zwei Weltkriegen zerstört (HERBERG, 2011, S. 258f). Standort 7: Synagogenplatz (Fuhrmann) Hier stand einst die Synagoge der Israelitischen Gemeinde Beuel. Im Jahre 1903 wurde diese aus gelbem Backstein errichtet und eingeweiht. 35 Jahre später stand die Synagoge am Morgen der Reichskristallnacht in Flammen. SS- und SA-Mitgliedern hatten diese zuvor in Brand gesteckt. Im Jahre 1965 wurde die Bronzetafel als Erinnerungs- und Mahnmal aufgestellt, um der Opfer zu gedenken. Eine Erweiterung der Gedenkstätte folgte in den 90er Jahren, indem die Künstlerin Ruth Levine mit Backsteinen der ehemaligen Synagoge einen Davidstern um das Denkmal baute (JÜDISCHE-GEMEINDEN.DE). Standort 8: Verwaltung und Kirche der Evangelischen Gemeinde Bonn-Beuel (Franzen) In Bonn-Beuel, der Statistik des Jahres 2015 nach der Bezirk der Bundesstadt mit dem prozentual höchsten Anteil an Bewohner mit Mitgliedschaft in der römisch-katholischen Kirche (40,4%, Quelle: Statistikstelle der Bundesstadt Bonn 2015) befindet sich ein kleines protestantisches Zentrum inmitten dieses Stadtteils von Bonn. Es gibt nicht nur eine Kirche aus der Zeit der Jahrhundertwende vom 19. Zum 20. Jahrhundert, sondern auch Gebäude der Verwaltung des Kirchenkrieses. An diesem Standort soll folglich auf die Struktur der Evangelischen Kirche im Rheinland eingegangen werden. Die Evangelisch Kirche im Rheinland (abgekürzt EKiR) ist ein Produkt der Verwaltungsneugelied4erung des Rheinland durch Preußen nach dem Wiener Kongress 1814/15. Die sogenannte Rheinprovinz, welche ein Gebiet vom Niederrhein bis zum Saarland umfasste, wurde 1822 eingerichtet und bildet bis heute den territorialen Rahmen der EKiR, der zweitgrößten (nach absoluter Mitgliederanzahl) von 20 Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) (STABSSTELLE STRATEGISCHES CONTROLLING DER EVANGELISCHEN KIRCHE IM RHEINLAND O.J.). Aus dieser Territorialen Ordnung heraus ist auch zu verstehen, warum die Exklave von Wetzlar und Braunfels zur EKIR zählt, welche im heutigen Bundesland Hessen befindet: Sie kamen 29
30 ebenfalls nach dem Wiener Kongress zu Preußen. Heute erstreckt sich die EKIR über vier Bundesländer: Nordrhein-Westfalen (westlicher Teil, während der östliche Teil zur Evangelischen Kirche in Westfalen oder im äußerster Osten zur Lippischen Landeskirche gehört), Rheinland-Pfalz (alle Gebiete bis auf die Pfalz, die zur Evangelischen Kirche dürr Pfalz zählt und der Osten des Bundeslandes, sowie Rheinhessen, welche zur Kirche von Hessen und Nassau zählen), Hessen (nur die beiden Exklaven Wetzlar und Braunfels, der Rest des Bundeslandes zählt entweder zur Evangelischen Kirche in Kurhessen-Waldeck oder zur Evangelischen Kichre in Hessen und Nassau) und das Saarland (nahezu vollständig bis auf kleine Gebiete im Ostsaarland, welche zur Evangelischen Kirche der Pfalz zählen). Die Evangelisch Kirche im Rheinland gliedert sich in insgesamt 38 Kirchenkreise (STABSSTELLE STRATEGISCHES CONTROLLING DER EVANGELISCHEN KIRCHE IM RHEINLAND O.J.), wobei drei Kirchenkreise (zum Teil) auf Bonner Stadtgebiet liegen: Der Kirchenkreis Bonn mit der Innenstadt und überwiegend nördlichen Stadtteilen von Bonn, sowie dem Vorgebirge; der Kirchenkreis Bad Godesberg-Voreifel mit den südlichen Stadtteilen und auch Gebieten außerhalb der Stadtgrenze bis hin zur Grenze von Rheinland-Pfalz und der Kirchenkreis an Rhein und Sieg mit allen Stadtteilen östlich des Rheins und Nicht-Stadtgebieten von Bonn bis nach Siegburg. Unter den Kirchenkreisen stehen die einzelnen Gemeinden, wie beispielsweise die Gemeinde Bonn-Beuel, die sich wiederum in die Pfarrbezirke Beuel-Mitte, Beuel-Süd, Beuel- Ost und Beuel-Ost unterteilt. Die Leitung einer Gemeinde übernimmt ein gewähltes Presbyterium, auf Ebene der Kirchenkreise macht dies eine Kreissynode und auf oberster Ebene der Landeskirche schließlich eine Landessynode (vgl. REFERAT FÜR PRESSE-, RUNDFUNK- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT DER EVANGELISCHEN KIRCHENKREISE AN SIEG UND RHEIN, BAD GODESBERG UND BONN 1995, Seite 48). 30
31 Abbildung 19: Übersichtsklarte über das Gebiet der EKiR mit ihren Kirchenkreisen. Quelle: abgerufen am ) (zuletzt 31
32 Abbildung 20: Übersicht über die 20 Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Quelle: (zuletzt abgerufen am ) 32
33 Abbildung 21: Evangelische Versöhnungskirche in Bonn-Beuel. Eigene Aufnahme. Standort 9: Denkmal ehemaliger Synagoge (Fuhrmann) Im Jahre 1716 folgt eine Umquartierung der Bonner Juden in ein Ghetto, welches 1798 wieder aufgelöst wurde (RAUHUT-BRUNGS, 2001, S. 65; HARLING, 2007, S. 9). Der Standort ist die linke Rheinseite, nördlich der heutigen Kennedybrücke. Durch die Ende des 19. Jahrhunderts aufkommenden Meinungsverschiedenheit der liberalen Juden und der orthodoxen Juden hinsichtlich der Gottesdienstgestaltung (kurz nachdem das Gleichstellungsgesetz der Religionen in Kraft gesetzt wurde), pochten die fortschrittliche jüdische Bevölkerung auf eine Trennung des Zusammenschluss der bestehenden Synagogengemeinde (auch Special Gemeinde Bonn ) aus dem Jahre 1854 (HARLING, 2007, S. 9). Hinzu kam, dass die liberalen, wohlhabenden Juden eine neue große Synagoge erbauen wollten, was wiederum nicht von den ärmeren orthodoxen Juden unterstützt wurde, die kleine Synagogen in ihren jeweiligen Stadtteilen und Umlandgemeinden hatten (HARLING, 33
34 2007, S. 9). Die Synagogengemeine wurde somit 1875 auf Anfrage der Bonner liberalen Juden an die Regierung in Köln von dieser aufgelöst (HARLING, 2007, S.9). Knappe vier Jahre später wurde die neue Synagoge am Rand des ehemaligen jüdischen Ghettos am Rhein am eingeweiht (RAUHUT-BRUNGS, 2001, S.48f; HARLING, 2007, S. 9). Die Straße, in der die Synagoge stand, wurde Tempelstraße genannt (die heutige Tempelstraße in Gronau wurde nach dieser Straße benannt). Abbildung 22: Die Synagoge am Rhein (Quelle: Zur Einweihung lud die jüdische Bevölkerung Gäste aller Religion, Politiker (Bürgermeister, Landrat und Rektor der Universität) und sogar den deutsche Kronprinz Friedrich III ein. Allerdings konnte letzterer an der Zeremonie nicht teilnehmen, da er auf dem Weg nach Bonn in einen Unfall geriet (RAUHUT-BRUNGS, 2001, S.48f; RAUHUT-BRUNGS, 2009a, S.8). Im Bonner Stadtarchiv kann eine Originale Einladung (Seite 34) zur Einweihungsfeier der neuen Synagoge eingesehen werden. Der Adressat ist vermutlich ein Bürger mit hohem sozialem Ansehen oder ein Adeliger, da die Person mit Hochwohlgeborener angeredet wird. 34
35 Abbildung 23: Einladung zur Einweihungsfeier (Bonner Stadtarchiv, PR-32568) Ein Gemeindehaus befand sich ebenfalls in der Tempelstraße, welches jedoch Anfang des 20. Jahrhunderts in einem so schlechten Zustand ist, dass entschieden wird den Gebäudekomplex abzureißen und ein neues Gemeindehaus zu errichten. Die neue Villa wird im Jahre 1910 fertiggestellt. In diesem ist Platz für Verwaltungszimmer, den Armenrat, Aufbewahrungsräume, Schlafräume für den Synagogendiener und weitere Zimmer (RAUHUT- 35
36 BRUNGS, 2009a, S. 11f). Das Gemeindehaus wird auch genutzt, um Feste zu feiern, wie den 100. Geburtstag des bereits 1889 verstorbenen Rabbiners Ludwig Philippson im Jahre 1911; auch das 25-jährige und das 50-jährige Bestehen der Synagoge am Rhein wird hier im großen Rahmen gefeiert (RAUHUT-BRUNGS, 2009a, S. 12). Am Morgen des 10. November 1938 wurde die Synagoge von der Gestapo gestürmt, wertvolle Artefakte entfernt und mitgenommen und anschließend angezündet. Kurz darauf erteilt die Gestapo der jüdischen Gemeinde den Befehl, die zerstörte und ausgebrannte Synagoge abzureißen, was Kosten von Reichsmark verursachte. Da die noch Hinterbliebene jüdische Bevölkerung diese Summe nicht aufbringen konnte, musste das Grundstück an die Stadt Bonn verkauft werden (HARLING, 2007, S. 11f). Diese wiederum baute im Jahre 1942 eine Kindertagesstätte auf die Ruinen. Im Jahre 1953 bekam die jüdische Gemeinde das Grundstück auf dem die Synagoge stand zurück. Zwei Jahre später verkaufte die Gemeinde das Grundstück erneut an die Stadt für Deutsche Mark. Mit dem Geld erwarb sie ein Grundstück in der Wörthstraße (heute Tempelstraße genannt), auf dem drei Jahre später eine neue Synagoge gebaut wurde (HARLING, 2007, S. 12). Mehr dazu bei Punkt 19. Ein Teil der Ostmauer der zerstörten Synagoge am Rhein sind heute Teil des Mahnmals. In dem Gemäuer lässt sich der Davidstern erkennen. Der aus Beton gegossene Davidstern auf der Promenade vervollständigt die Gedenkstätte, an der jedes Jahr am 9. November eine Gedenkfeier für die Juden, die dem Nationalsozialismus zum Opfer gefallen sind, gedacht wird (HARLING, 2007, S. 8, 13). Standort 10: Freie Evangelische Gemeinde (Vera Duarte) Freie evangelische Gemeinde 36
37 Abbildung 24: Freie Evangelische Gemeinde, Altbau. Innenraum. Eigene Aufnahme Abbildung 25: Freie Evangelische Gemeinde, Quelle: (zuletzt aufgerufen: ) Abbildung26: Freie Evangelische Gemeinde, Neubau Eigene Aufnahme In Bonn befinden sich insgesamt 18 freikirchliche Einrichtungen. Die wohl bekannteste und größte ist die freie evangelische Gemeinde, in der Hatschiergasse 12 bzw. 19 gelegen. Die freie evangelische Gemeinde wurde bereits 1853 gegründet und verzeichnete vor allem in der zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts einen rasanten Anstieg. Lag die Anzahl der Mitglieder in den 1970er Jahren noch bei etwa 40, sind es heute hingegen rund 550 an der Zahl. Die Gemeinde gilt als größter Bund freier evangelischer Kirchen in Deutschland. Über 750 Besucher besuchen wöchentlich den Gottesdienst. Die Gemeinde ist bestehend aus einem Altbau und dem im Jahr 2007 eröffneten Neubau. Der Kostenfaktor lag hierbei bei etwa 5 Millionen Euro. Wie bei allen freikirchlichen Einrichtungen, werden auch bei der frei evangelischen Gemeinde die gesamte spirituelle & diakonische Arbeit, Gehälter der hauptamtlichen Mitarbeiter, Kosten für Baumaßnahmen und Unterhalt des Gemeindezentrums ausschließlich aus Spenden von Mitgliedern und Freunden finanziert. Durchschnittlich spendet jedes Mitglied 1200 Euro im Jahr. Besonders beachtlich ist neben der Sicherstellung der religiösen Infrastruktur in Form einer Gebetsstätte die Vielfalt an 37
38 Dienstleistungsangeboten. Insgesamt können 27 verschiedene Angebote wahrgenommen werden. Dazu zählt beispielsweise ein Nachmittagsbibelkreis, bei dem die Möglichkeit besteht biblische Erkenntnisse zu vertiefen und den religiösen Glauben zu stärken. Aber auch die Betreuung von Flüchtlingskindern oder Deutschkurse, um im Rahmen der Flüchtlingsarbeit eine barrierefreie Integration in die deutsche Gesellschaft ermöglichen zu können. Abbildung 27: Angebote der frei evangelischen Kirche. Quelle: (zuletzt aufgerufen: ) Neben der frei evangelischen Gemeinde, nutzen die Äthiopisch Evangelische Gemeinde Bonn, arabische freie evangelische Gemeinde, Christliche Gebärdensprachliche Gemeinschaft und koreanische Kirchengemeinschaft die Räumlichkeiten vor Ort. Standort 11: Xhamia Mëshira Gemeinde (Vera Duarte) Abbildung 28: Xhamia Meshira Gemeinde. Eigene Aufnahme Abbildung 29: Xhamia Meshira Gemeinde Symbol Eigene Aufnahme Die Xhamia Mëshira Gemeinde befindet sich in der Theaterstraße 12, in der Bonner Nordstadt gelegen. Es handelt sich hierbei um die erste und gleichzeitig einzige albanischmuslimische Einrichtung im Bonner Raum. Eröffnet wurde diese Moschee im Jahr Im 38
39 Vergleich zu diversen anderen Moscheestandorten, handelt es sich bei dieser Einrichtung um eine freie Moschee ohne jeglichen dahinter stehenden Dachverband. Die für eine Moschee charakteristischen Merkmale wie dem Minarett und Adhan (Gebetsruf) liegen hierbei nicht vor. Die Sprachen der Chutba (Freitagsgebet) sind Albanisch, Arabisch und Deutsch. Al-Muhajirin Moschee Abbildung 30: Al-Muhajirin Mosche, Außenbereich Quelle: Abbildung 31: Al Muhajirin Moschee, Innenbereich (zuletzt aufrufbar: ) (zuletzt aufrufbar: ) Die Al-Muhajirin Moschee befindet sich in der Brühler Straße 28 und ist die größte und repräsentativste Moschee in Bonn. Tagtäglich ist hier ein großer Ansturm von Muslimen zu beobachten. Der Gebetssaal bietet etwa 400 Männern Platz, Frauen hingegen dürfen auf einer Empore beten, die 200 Personen fasst. Eröffnet wurde die Al-Muhajirin Moschee Ende Sprachen der Chutba sind Arabisch und Deutsch. Geführt wird die Moschee vom Verband Al-Muhajirin. Abbildung 32: Mihrab & Minbar Quelle: 39
40 (zuletzt aufrufbar: ) Standort 12: Stiftskirche (Fuhrmann) Die Stiftskirche, eigentlich St. Johann Baptist und Petrus genannt, ist Bonns älteste Pfarrkirche (Herberg, 2011, S. 21). Hier stand bereits im 4. Jahrhundert die Dietkirche, was so viel wie Kirche des Volkes bedeutet. Erstmals wurde St. Johann Baptist und Petrus im Jahre 795 urkundlich erwähnt. Mit dem Bau der Stadtmauer um 1200 lag die Kirche außerhalb der befestigten Stadt. Im Jahre 1616 wurde St. Johann Baptist und Petrus eine Stiftskirche mit Geistlichen, Kanonissen, Vikaren und dem ansässigen Pfarrer (HERBERG, 2011, S. 21). Keine 200 Jahre später im Jahre wurde der Stift von den Franzosen, die Bonn besetzten, aufgehoben (HERBERG, 2011, S. 22; PASSAVANTI, 1989, S. 18). Dafür überstand die Kirche als einziges katholisches Gotteshaus vollkommen unbeschadet die französische Herrschaft in Bonn. Da die Kirche in mehreren Bauabschnitten erweitert wurde, kann man gotische Formen aber auch barocke Formen in der Kirche erkennen (HERBERG, 2011, S.23). Der Taufstein, reichlich dekoriert mit barocken Abbildung 33: Informationstafel (eigene Aufnahme) 40
41 Formen, ist ein romanischer Basaltstein aus dem Jahre Der für die Kirche wertvollste Gegenstand ist die Dietkirchenmadonna, eine aus Nussbaum- und Eichenholz gefertigte Maria Statue auf deren Armen Jesus liegt. Diese Madonnenfigur wurde zu Beginn des 14. Jahrhunderts in Köln gefertigt (PASSAVANTI, 1989, S. 21). Standort 13: Bonner Moscheengmeinschaft Bonn Camii (Vera Duarte) Abbildung 34: Bonn Camii. Eigene Aufnahme Abbildung 35: Bonn Camii, Eingangsbereich. Eigene Aufnahme Die Bonner Moscheengemeinschaft, auch Bonn Camii genannt, befindet sich in der Maxstraße 60, ebenfalls in der Bonner Nordstadt gelegen. Auch an diesem Standort sind die charakteristischen Merkmale einer Moschee wie dem Minarett und Adhan nicht vorhanden. Sprachen der Chutba sind Türkisch, Arabisch und Deutsch. Dieser Moscheestandort ist dem Dachverband der Islamische Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG) angehörend. Abbildung 36: IGMG Logo. Quelle: (zuletzt aufgerufen: ) 41
42 Es handelt sich sich um einen von insgesamt in Deutschland sechs ansässigen sunnitischtürkischen Verbänden, denen Moscheegemeinden angeschlossen sind. Diese bieten neben der Sicherstellung einer religiösen Infrastruktur, zusätzlich noch kulturelle, soziale, pädagogische, sportliche und teils wirtschaftliche Dienstleistungen an. Neben der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG), gehört die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.v. (DITIB) zu einen der wohl bekanntesten Dachverbände. Die Wurzeln der IGMG liegen in den 1970er Jahren entstand in Köln die Türkische Union Europa e.v. Nach einer Umstrukturierung wurde 1992 in Bonn die IGMG als Verein eingetragen, aus dem anschließend 1995 der europaweit tätige Dachverband hervorging (Schöningh). Der heutige Sitz der IGMG befindet sich in Kerpen, in unmittelbarer Nähe zu Köln bzw. Bonn. Standort 14: Bonner Münster (Fuhrmann) Die als Münster bekannteste und größte Kirche Bonns heißt eigentlich St. Martin Münsterkirche und ist eine Basilika. Im 3. Jahrhundert stand hier einst eine Totenkultstätte der siedelnden Römer. Im 6. Jahrhundert wurde darüber die erste Kirche eine Saalkirche - gebaut (HERBERG, 2011, S. 40). Im Mittelalter kam es an diesem Ort zu Grabungen, wobei man mehrere Gebeine ausgrub, von denen man zwei als Cassius und Florentinus meinte zu erkennen. Diese beiden waren - so besagt es die Überlieferung - christliche Soldaten, die den Märtyrertod im 3. Jahrhundert fanden (HERBERG, 2011, S.40). Noch heute sind Cassius und Florentinus die Schutzpatrone der Stadt Bonn und zudem heilig gesprochen. Die beiden Köpfe, die vor dem Münster liegen, sollen die beiden darstellen und an ihren Tod erinnern. 42
43 Abbildung 37: Die beiden Köpfe der Stadtpatrone (eigene Aufnahme) Im 8. Jahrhundert kam es zu einer Erweiterung und Vergrößerung des Kirchenbaus, auf Grund der in den vorherigen Jahrzehnten gestiegenen Zahl des Klerus. Um 1000 nach Christus kommt es zu einer Verlagerung des Bonner Zentrums von dem heutigen Stadtteil Castell zum Münster, die zu diesem Zeitpunkt Cassiuskirche heißt und ein Stift ist (HERBERG, 2011, S. 40). Im 12. Jahrhundert erlebt der Stift eine Blütezeit, da dieser sich durch Schenkungen vergrößert und so an Macht gewinnt (HERBERG, 2011, S.40f). Im 12. und 13. Jahrhundert wird die Kirche erneut erweitert, aber auch andere Gebäude des Stifts werden vergrößert. Ein Beispiel ist der an der Südseite der Kirche gebaute Kreuzgang, der bis heute der am besten erhaltene Kreuzgang im Rheinland ist (HERBERG, 2011, S. 41). Ende des 16. Jahrhunderts wird Bonn Residenzstadt der Kölner Erzbischöfe und Kurfürsten und gewinnt dadurch an Bedeutung, was auch dem Stift zu Gute kommt. Mit dem Einmarsch und der Besetzung der französischen Soldaten endet die Macht des Stifts. Tatsächlich wird der Stift aufgelöst und Gottesdienste in die Stiftskirche verlegt (HERBERG, 2011, S. 42). Damit steht die heutige Münsterkirche leer und wird an die Pfarre St. Martin angeschlossen. Im Jahre 1860 wird der St.-Martin-Bauverein gegründet, der die Kirche nach jahrzehntelanger Stagnation restauriert. Die Bauarbeiten gehen bis in das 20. Jahrhundert rein (HERBERG, 2011, S. 46). Im Zweiten Weltkrieg wird das Münster zerbombt und bis in die 80er Jahre wieder aufgebaut und restauriert. Standort 15: Schlosskirche (Franzen) Die Schlosskapelle ist ein architektonisches Kleinod im Gesamtkunstwerk des Kurfürstlichen Residenzschlosses in Bonn, dem heutigen Hauptgebäude der Rheinischen Friedrich- Wilhelms-Universität Bonn. Vor der massiven politischen und territorialen Umwälzungen der Französischen Revolution und der Napoleonischen Zeit war sie Hofkirche des Kurfürsten von Köln und seines Hofstaats. Mit dem Reichsdeputationshauptschluss von 1803 wurden die geistlichen Herrschaften, so auch das Kurfürstentum Köln mit dem Erzbischof an der Spitze, aufgehoben und folglich stand das riesige, repräsentative Schloss ohne seine angediente Aufgabe. Mit der Errichtung der Rheinprovinz und der Eingliederung des Rheinlands mit Bonn in diese, übergab der damalige Preußische König Friedrich Wilhelm III. die 43
44 Schlosskirche an die aufkeimende Evangelische Gemeinde, welche im bis dahin nahezu ausschließlich Römisch-Katholischen Rheinland, bis auf die Ausnahme Oberkassel (siehe Standort 0) in der Frühen Neuzeit in der Kurkölnischen Residenzstadt keinen Fuß fassen konnte. Mit der Gründung der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn im Jahre 1818 wurde war die Kirche nicht nur die erste Evangelische Kirche auf Bonner Kerngebiet, sondern auch die zentrale Kirche der Universität, in der beispielsweise der Universitätsprediger predigte. Diese Funktion hat sie bis heute behalten. Darüber hinaus bietet sie einen eindrucksvollen Raum für musikalische Veranstaltungen (schon Beethoven übte an der Orgel der Schlosskirche) (GERHARDT & WÜSTER 2016, Seite 72) oder auch für Hochzeiten. Architektonisch greift die Schlosskirche zum einen die Pracht der Kurfürstlichen Residenz auf, zum anderen zeigt sie Elemente Protestantischer Schlichtheit, was auch in der nicht vollständigen Wiederherstellung aller Zierdetails nach dem verheeren Schlossbrand im Jahr 1777 und den Zerstörungen des zweiten Weltkriegs liegt. Die Überführung einer Hofkirche von einer Konfession in eine andere ist übrigens kein Einzelfall: Ähnliches passierte auch im protestantischen Bayreuth, wo die dortige Hofkirche, über Jahrhunderte Kirche des protestantischen Geschlechts Brandenburg-Bayreuth nach dem Wiener Kongress an das Katholische Bayern fiel und damit eine katholische Kirche wurde, 44
45 Abbildung 38: Infokasten zur Schlosskirche in der Universität. Eigene Aufnahme. 45
46 Abbildung 39: Blick in die Universitätskirche. Quelle: Universität Bonn (2004), Link: (zuletzt abgerufen am ) 46
47 Standort 16: Kreuzkirche (Franzen) Bei der Kreuzkirche handelt es sich um das erste neugebaute protestantische Gotteshaus auf dem Bonner Stadtgebiet des ehemaligen Herrschaftsgebiets des ehemaligen Kurfürstentums Köln. Nachdem die Schlosskirche (siehe Standort 15) nicht mehr den Bedürfnissen der rasch wachsenden Gemeinde gerecht werden konnte und überdies der Wunsch bestand als Protestanten sichtbar in der Stadt repräsentiert zu sein, wurde der Entschluss gefasst, eine neue Kirche errichten zu lassen. Begünstigt wurde das Vorhaben durch die nicht unerheblichen finanziellen Mittel, die der Gemeinde zur Verfügung standen. Diese finanzielle Potenz liegt in der besonderen Sozialstruktur begründet, welche die Bonner Gemeinde aufwies: Sie bestand aus überwiegend wohlsituierten Beamten, welche entweder in der neuaufgebauten Verwaltungsstruktur ihre Arbeit fanden oder denen Bonn mit seinem milden Klima als Alterssitz zugewiesen wurde. Die Errichtung begann im Jahr 1866; es handelt sich bis heute um das größte Protestantische Kirchengebäude am gesamten Mittelrhein (GERHARDT & WÜSTER 2016, Klappentext). Die Kirche liegt zentral in Bonn am Kaiserplatz, allerdings außerhalb der Innenstadt, welche von Katholischen Kirchtürmen überragt wird. Trotzdem markiert sie wie kein anderes Gebäude in Bonn die Ankunft der Protestanten im Rheinland und in Bonn und ihren Willen ihren Glauben in der bis dahin ausschließlich Römisch-Katholischen dominierten Stadtgesellschaft auszuleben. Wenig später (um das Jahr 1900) folgte mit der Lutherkirche ein weiteres, repräsentatives Evangelisches Gotteshaus. Doch neben diesen Zeiten des Aufbruchs, gibt es auch dunklere Kapitel in der Geschichte der Kreuzkirche: Während der Bombardierung Bonn im Zweiten Weltkrieg bot die Kreuzkirche mit im Keller gelegenen Räumen Schutz vor dem Bombenhagel. Es waren allerdings schwere Zerstörungen an der Kirche zu verzeichnen, was eine Renovierung mit einigen Umgestaltungen vorwegnahm. Architektonisch steht die Kirche zwischen protestantischer Schlichtheit und Repräsentativität als zentrale Kirche der Protestanten in Bonn und der nahen Umgebung, so sind viele der Zierformen an der Außenfassade nur angedeutet. Im Rahmen des Projekts Offene Kirche kann die Kirche besichtigt werden, im Innenraum gibt es Informationen zum Gebäude es besteht zudem die Möglichkeit für den Erhalt der Kirche zu spenden. Neue Wege wurden an der Kreuzkirche mit der Errichtung des Kirchenpavillons eingeschlagen, welcher die moderne Gesellschaft und Kirche zusammenführen soll und 47
48 hierbei eine Vorreiterrolle in vielerlei Hinsicht, beispielsweise in der Vermittlung zwischen Urbanität des 21. Jahrhunderts und traditioneller Sakralbausubstanz, einnimmt (GERHARDT & WÜSTER 2016, Seite 120). Abbildung 40: Innenraum der Kreuzkirche. Eigene Aufnahme. 48
49 Abbildung 41: Moderner Kirchenpavillon auf dem Vorplatz der Kreuzkirche. Eigene Aufnahme. Standort 17: Collegium Albertinum (Fuhrmann) Das Collegium Albertinum dient als Wohnheim für die angehenden Priester, die an der Bonner Universität Theologie studieren (POTTING, ). Im Jahre 2012 lebten hier etwa 30 Theologiestudenten (POTTING, ). Das Gebäude, welches auf einer ehemaligen römischen Siedlung gebaut wurde, wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts im neugotischen Stil fertiggestellt (ERZBISTUM-KOELN.DE). Noch heute kann man Überbleibsel einer römischen Thermenanlage sehen (ERZBISTUM- KOELN.DE). Neben den Schlafzimmern der angehenden Priester befinden sich Gemeinschaftsräume, eine Kneipe, ein Speisesaal, eine Aula und eine Kapelle. Beten, leben, studieren ist das Lebensmotte der Studenten, damit Seele, Körper und Geist wachsen (ERZBISTUM- KOELN.DE). 49
50 Abbildung: Wappen des Collegiums (eigene Aufnahme) Der Hauptverantwortliche für die Priesterausbildung im Collegium Albertinum ist kein geringerer als der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki persönlich (ERZBISTUM- KOELN.DE). Standort 18: Haus der Evangelischen Kirche (Franzen) Direkt angrenzend an die Universitäts- und Landesbibliothek und unweit des Collegium Albertinum (siehe Standort 17) befindet sich das Haus der Evangelischen Kirche. Der gestufte Bau erscheint auf den ersten Blick unauffällig, verglichen mit der hohen Backsteinfassade des nahen Collegium Albertinum. Und doch ist der auf den ersten Blick wenig beeindruckende Gebäude nicht unbedeutend für die Protestantischen Gemeinden in Bonn. Im Rahmen des Themenpfades steht das Haus der Evangelischen Kirche für die Nicht- Sakralgebäude, welche eine wichtige Stellung innerhalb des Systems Kirche und im speziellen Evangelische Kirche im Rheinland haben. Denn die Institution Kirche besteht keinesfalls nur aus Sakralbauten oder Gebäuden für karitative Zwecke, wie beispielsweise Kindergärten oder Pflegeheime, sondern auch Verwaltungsgebäuden und Bauten für weitere Verwendungen. Das Haus der Evangelischen Kirche ist ein Mehrzweckbau in zentraler Lage, welcher zum einen Verwaltungsinstitution den der Evangelischen Kirchenkreise aufnimmt, aber zum anderen auch Ort für Konferenzen, Tagungen usw. sein kann. Darüber hinaus bietet er die Möglichkeit einer Plattform für kulturelle Aktivitäten, wie Ausstellungen und auch der Vermietung an Dritte, zum Beispiel als Beherbergung für Hochzeiten oder andere Festivitäten. 50
51 Abbildung 42: Haus der Evangelischen Kirche. Blick von der Stadtseite. Links im Hintergrund ist ein Teil des Collegium Albertinum zu erkennen. Eigene Aufnahme. 51
52 Abbildung 43: Hinweis auf den Sitz des Schulreferats der Bonner Evangelischen Kirchenkreise im Haus der Evangelischen Kirche. Eigene Aufnahme. Standort 19: Synagoge Tempelstraße (Fuhrmann) Auf dem im Jahre 1955 von der jüdischen Gemeinde gekauften Grundstück in der ehemaligen Wörthstraße wurde 1958 der Grundstein für den Bau einer neuen Synagoge gelegt. Fertiggestellt wird diese nach nur einem Jahr Bauzeit und im Anschluss mit großen Feierlichkeiten eingeweiht (RAUHUT-BRUNGS, 2009a, S. 21; RAUHUT-BRUNGS, 2009b, S. 5). In diesem Gebäude wird architektonisch die vergangenen Jahrhunderte verarbeitet. Zusätzlich soll die Synagoge den Bruch, der die jüdische Bevölkerung gegen Ende des 19. Jahrhunderts durchzog, überwinden, denn diese Gemeinde soll als Einheitsgemeinde fungieren und sowohl orthodoxe als auch liberale Juden verbinden (RAUHUT-BRUNGS, 2009b, S.6). Die Wörthgstraße in der die Synagoge gebaut wurde, heißt heute Tempelstraße. Diesen Straßennamen zierte bereits die im Nationalsozialismus zerstörte Synagoge am Rhein. Für das Gemeindeleben wurde zusätzlich ein Clubraum geplant und verwirklicht, in dem Veranstaltungen stattfinden (RAUHUT-BRUNGS, 2009b, S.6f). In der Synagoge haben 80 Männer 52
53 und 40 Frauen Platz. Im Keller gibt es Wirtschaftsräume und heute einen Unterrichtsraum für Kinder und junge Erwachsene (RAUHUT-BRUNGS, 2009b, S.7). Abbildung 44: der Gebetsraum in der heutigen Tempelstraße (Quelle: sch_c9c _978x1304xin.jpeg) 53
Die christlichen Konfessionen
 Jesus steht am Übergang vom Alten Testament zum Neuen Testament. Altes Testament Neues Testament Abraham Jesus Wir Zunächst Mission in den jüdischen Gemeinden Zunächst Mission in den jüdischen Gemeinden
Jesus steht am Übergang vom Alten Testament zum Neuen Testament. Altes Testament Neues Testament Abraham Jesus Wir Zunächst Mission in den jüdischen Gemeinden Zunächst Mission in den jüdischen Gemeinden
Kirchenmitglieder, Kirchenaustritte, Kirchensteuern und Kirchgeld*
 * In absoluten Zahlen, Evangelische und Katholische Kirche, 2009 und 2010 in Mio. Euro * Istaufkommen in Mio. Euro 5.000 5.000 4.500 4.903 4.794 Kirchensteuern** Kirchgeld 28 28 4.500 4.000 3.500 3.000
* In absoluten Zahlen, Evangelische und Katholische Kirche, 2009 und 2010 in Mio. Euro * Istaufkommen in Mio. Euro 5.000 5.000 4.500 4.903 4.794 Kirchensteuern** Kirchgeld 28 28 4.500 4.000 3.500 3.000
Wiederkehr der Religion? Christentum und Kirche in der modernen Gesellschaft
 Karl Gabriel WS 2006/2007 Wiederkehr der Religion? Christentum und Kirche in der modernen Gesellschaft III.Christentum und Kirche in Deutschland und Westeuropa: Die These der Entkirchlichung 1. Einleitung
Karl Gabriel WS 2006/2007 Wiederkehr der Religion? Christentum und Kirche in der modernen Gesellschaft III.Christentum und Kirche in Deutschland und Westeuropa: Die These der Entkirchlichung 1. Einleitung
Weihbischof Wilhelm Zimmermann. Ansprache im Gottesdienst der Antiochenisch-Orthodoxen Gemeinde Hl. Josef von Damaskus
 Weihbischof Wilhelm Zimmermann Ansprache im Gottesdienst der Antiochenisch-Orthodoxen Gemeinde Hl. Josef von Damaskus in der Kirche St. Ludgerus, Essen-Rüttenscheid Sonntag, 19. Juni 2016 Sehr geehrter,
Weihbischof Wilhelm Zimmermann Ansprache im Gottesdienst der Antiochenisch-Orthodoxen Gemeinde Hl. Josef von Damaskus in der Kirche St. Ludgerus, Essen-Rüttenscheid Sonntag, 19. Juni 2016 Sehr geehrter,
Erklärt in leichter Sprache
 Erklärt in leichter Sprache 2 SYNODE IM BISTUM TRIER 1 Die Kirche in der Welt von heute: Wie soll unsere Kirche sein Vor über 2000 Jahren hat Jesus Christus die Kirche gegründet. Die Kirche gibt es also
Erklärt in leichter Sprache 2 SYNODE IM BISTUM TRIER 1 Die Kirche in der Welt von heute: Wie soll unsere Kirche sein Vor über 2000 Jahren hat Jesus Christus die Kirche gegründet. Die Kirche gibt es also
seit dem 1. Juli 2014 hat der Seelsorgebereich Neusser Süden keinen leitenden
 Sperrfrist bis 18. Mai 2016 An alle Gemeindemitglieder der Pfarreien in den Seelsorgebereichen Neusser Süden und Rund um die Erftmündung sowie die Pastoralen Dienste und die kirchlichen Angestellten Köln,
Sperrfrist bis 18. Mai 2016 An alle Gemeindemitglieder der Pfarreien in den Seelsorgebereichen Neusser Süden und Rund um die Erftmündung sowie die Pastoralen Dienste und die kirchlichen Angestellten Köln,
als Fragestellungen grundlegende Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Verständnis Gottes in Judentum, Christentum und Islam erläutern (IF 5),
 Jahrgangsstufe 6: Unterrichtsvorhaben 1, Der Glaube an den einen Gott in Judentum, Christentum und Islam Der Glaube Religionen und Der Glaube an Gott in den an den einen Gott in Weltanschauungen im Dialog
Jahrgangsstufe 6: Unterrichtsvorhaben 1, Der Glaube an den einen Gott in Judentum, Christentum und Islam Der Glaube Religionen und Der Glaube an Gott in den an den einen Gott in Weltanschauungen im Dialog
Thomas-Akademie Jüdische und christliche Leseweisen der Bibel im Dialog Kurt Kardinal Koch EINLADUNG
 Theologische Fakultät EINLADUNG Thomas-Akademie 2016 Jüdische und christliche Leseweisen der Bibel im Dialog Kurt Kardinal Koch MITTWOCH, 16. MÄRZ 2016, 18.15 UHR UNIVERSITÄT LUZERN, FROHBURGSTRASSE 3,
Theologische Fakultät EINLADUNG Thomas-Akademie 2016 Jüdische und christliche Leseweisen der Bibel im Dialog Kurt Kardinal Koch MITTWOCH, 16. MÄRZ 2016, 18.15 UHR UNIVERSITÄT LUZERN, FROHBURGSTRASSE 3,
2. Der Dreißigjährige Krieg:
 2. Der Dreißigjährige Krieg: 1618 1648 Seit der Reformation brachen immer wieder Streitereien zwischen Katholiken und Protestanten aus. Jede Konfession behauptete von sich, die einzig richtige zu sein.
2. Der Dreißigjährige Krieg: 1618 1648 Seit der Reformation brachen immer wieder Streitereien zwischen Katholiken und Protestanten aus. Jede Konfession behauptete von sich, die einzig richtige zu sein.
Religionen oder viele Wege führen zu Gott
 Religionen oder viele Wege führen zu Gott Menschen haben viele Fragen: Woher kommt mein Leben? Warum lebe gerade ich? Was kommt nach dem Tod? Häufig gibt den Menschen ihre Religion Antwort auf diese Fragen
Religionen oder viele Wege führen zu Gott Menschen haben viele Fragen: Woher kommt mein Leben? Warum lebe gerade ich? Was kommt nach dem Tod? Häufig gibt den Menschen ihre Religion Antwort auf diese Fragen
Die Evangelische Kirche im Rheinland
 Die Evangelische Kirche im Rheinland Eine kurzer Überblick 54. ordentliche Landessynode Bad Neuenahr 09. bis 14. Januar 2005 Dr. Matthias Schreiber Die rheinische Kirche ist eine von 23 Gliedkirchen der
Die Evangelische Kirche im Rheinland Eine kurzer Überblick 54. ordentliche Landessynode Bad Neuenahr 09. bis 14. Januar 2005 Dr. Matthias Schreiber Die rheinische Kirche ist eine von 23 Gliedkirchen der
ON! Reihe Religion und Ethik DVD Institution Katholische Kirche Arbeitsmaterialien Seite 1
 DVD Institution Katholische Kirche Arbeitsmaterialien Seite 1 Was ist eine Kirche? Einstieg Zum Einstieg in das Thema Kirche und Religion wird der Begriff KIRCHE an die Tafel geschrieben. Die Schüler gehen
DVD Institution Katholische Kirche Arbeitsmaterialien Seite 1 Was ist eine Kirche? Einstieg Zum Einstieg in das Thema Kirche und Religion wird der Begriff KIRCHE an die Tafel geschrieben. Die Schüler gehen
Die evangelischen Kirchen lehnen die Volksinitiative «Gegen den Bau von Minaretten» ab.
 Die evangelischen Kirchen lehnen die Volksinitiative «Gegen den Bau von Minaretten» ab. 6 Argumente sek feps Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund Das Minarett-Verbot löst keine Probleme. Es schafft
Die evangelischen Kirchen lehnen die Volksinitiative «Gegen den Bau von Minaretten» ab. 6 Argumente sek feps Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund Das Minarett-Verbot löst keine Probleme. Es schafft
Christentum. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Christentum 1
 Christentum Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Ingrid Lorenz Christentum 1 Das Christentum hat heute auf der Welt ungefähr zwei Milliarden Anhänger. Sie nennen
Christentum Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Ingrid Lorenz Christentum 1 Das Christentum hat heute auf der Welt ungefähr zwei Milliarden Anhänger. Sie nennen
Die Bedeutung der napoleonischen Befreiungskriege für das lange 19. Jahrhundert
 Die Bedeutung der napoleonischen Befreiungskriege für das lange 19. Jahrhundert Im Laufe seiner Eroberungskriege, verbreitete Napoleon, bewusst oder unbewusst, den, von der französischen Revolution erfundenen,
Die Bedeutung der napoleonischen Befreiungskriege für das lange 19. Jahrhundert Im Laufe seiner Eroberungskriege, verbreitete Napoleon, bewusst oder unbewusst, den, von der französischen Revolution erfundenen,
Geschichte des jüdischen Volkes
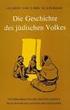 Geschichte des jüdischen Volkes Von den Anfängen bis zur Gegenwart Unter Mitwirkung von Haim Hillel Ben-Sasson, Shmuel Ettinger s Abraham Malamat, Hayim Tadmor, Menahem Stern, Shmuel Safrai herausgegeben
Geschichte des jüdischen Volkes Von den Anfängen bis zur Gegenwart Unter Mitwirkung von Haim Hillel Ben-Sasson, Shmuel Ettinger s Abraham Malamat, Hayim Tadmor, Menahem Stern, Shmuel Safrai herausgegeben
Kirchenmitgliederzahlen am
 zahlen am 31.12.2010 November 2011 Allgemeine Vorbemerkungen zu allen Tabellen Wenn in den einzelnen Tabellenfeldern keine Zahlen eingetragen sind, so bedeutet: - = nichts vorhanden 0 = mehr als nichts,
zahlen am 31.12.2010 November 2011 Allgemeine Vorbemerkungen zu allen Tabellen Wenn in den einzelnen Tabellenfeldern keine Zahlen eingetragen sind, so bedeutet: - = nichts vorhanden 0 = mehr als nichts,
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Kreuzworträtsel Religion. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Sekundarstufe Angelika Hofmann 5 Kreuzworträtsel Das Christentum 1. Christen,
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Sekundarstufe Angelika Hofmann 5 Kreuzworträtsel Das Christentum 1. Christen,
5.2 Kirche am Ort: Leben in Pfarrei und Bistum
 5.2 Kirche am Ort: Leben in Pfarrei und Bistum Meine Pfarrgemeinde: gehört zur Erzdiözese (Erzbistum): München und Freising Leitung: Kardinal Reinhard Marx (Bischof) Aufgaben in der Pfarrgemeinde: Pfarrer:
5.2 Kirche am Ort: Leben in Pfarrei und Bistum Meine Pfarrgemeinde: gehört zur Erzdiözese (Erzbistum): München und Freising Leitung: Kardinal Reinhard Marx (Bischof) Aufgaben in der Pfarrgemeinde: Pfarrer:
News Diözesanrat Newsletter des Diözesanrates der Katholiken im Erzbistum Köln ( )
 News Diözesanrat 16-01 Newsletter des Diözesanrates der Katholiken im Erzbistum Köln (10.03.2016) Die News Diözesanrat 16-01 als PDF- Datei: http://www.dioezesanrat.de/aktuelles/allgemeine-meldungen.html
News Diözesanrat 16-01 Newsletter des Diözesanrates der Katholiken im Erzbistum Köln (10.03.2016) Die News Diözesanrat 16-01 als PDF- Datei: http://www.dioezesanrat.de/aktuelles/allgemeine-meldungen.html
2. Reformation und Dreißigjähriger Krieg
 THEMA 2 Reformation und Dreißigjähriger Krieg 24 Die Ausbreitung der Reformation LERNZIELE Voraussetzung der Ausbreitung der Reformation kennenlernen Die entstehende Glaubensspaltung in Deutschland anhand
THEMA 2 Reformation und Dreißigjähriger Krieg 24 Die Ausbreitung der Reformation LERNZIELE Voraussetzung der Ausbreitung der Reformation kennenlernen Die entstehende Glaubensspaltung in Deutschland anhand
Gotteshäuser Christentum Judentum Islam. Heilige Schriften
 Gotteshäuser Christentum Judentum Islam Kirche Synagoge Moschee Heilige Schriften Christentum Judentum Islam Die Bibel Im Alten Testament findest du unteranderem die Schöpfungsgeschichte. Im Neuen Testament
Gotteshäuser Christentum Judentum Islam Kirche Synagoge Moschee Heilige Schriften Christentum Judentum Islam Die Bibel Im Alten Testament findest du unteranderem die Schöpfungsgeschichte. Im Neuen Testament
Die Ökumene heute und ökumenische Zielvorstellungen in evangelischer Sicht. Prof. Dr. Hans-Peter Großhans
 Die Ökumene heute und ökumenische Zielvorstellungen in evangelischer Sicht Prof. Dr. Hans-Peter Großhans I. Vielfalt der Kirchen und ihre Einheit Der neutestamentliche Kanon begründet als solcher nicht
Die Ökumene heute und ökumenische Zielvorstellungen in evangelischer Sicht Prof. Dr. Hans-Peter Großhans I. Vielfalt der Kirchen und ihre Einheit Der neutestamentliche Kanon begründet als solcher nicht
Reformationstag Martin Luther
 Reformationstag Martin Luther Denkt ihr etwa, am 31. Oktober ist bloß Halloween? Da ist nämlich auch Reformationstag! Dieser Tag ist sehr wichtig für alle evangelischen Christen also auch für uns. An einem
Reformationstag Martin Luther Denkt ihr etwa, am 31. Oktober ist bloß Halloween? Da ist nämlich auch Reformationstag! Dieser Tag ist sehr wichtig für alle evangelischen Christen also auch für uns. An einem
Christentum, Judentum Hinduismus, Islam
 Christentum, Judentum Hinduismus, Islam Christentum Judentum Das Christentum ist vor ca. 2000 Jahren durch Jesus Christus aus dem Judentum entstanden. Jesus war zuerst Jude. Das Judentum ist die älteste
Christentum, Judentum Hinduismus, Islam Christentum Judentum Das Christentum ist vor ca. 2000 Jahren durch Jesus Christus aus dem Judentum entstanden. Jesus war zuerst Jude. Das Judentum ist die älteste
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Die 16 Bundesländer. Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de DOWNLOAD Jens Eggert Downloadauszug aus dem Originaltitel: Name: Datum: 21
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de DOWNLOAD Jens Eggert Downloadauszug aus dem Originaltitel: Name: Datum: 21
Bewahrt die Hamburger Hauptkirchen!
 Bewahrt die Hamburger Hauptkirchen! Ob von der Alster oder vom Hafen aus, das Ensemble der fünf Hauptkirchen verleiht Hamburg aus jeder Perspektive einen unverwechselbaren Charakter. Ihre Türme prägen
Bewahrt die Hamburger Hauptkirchen! Ob von der Alster oder vom Hafen aus, das Ensemble der fünf Hauptkirchen verleiht Hamburg aus jeder Perspektive einen unverwechselbaren Charakter. Ihre Türme prägen
Willkommen! In unserer Kirche
 Willkommen! In unserer Kirche Eine kleine Orientierungshilfe im katholischen Gotteshaus * Herzlich willkommen in Gottes Haus. Dies ist ein Ort des Gebetes. * * * Wenn Sie glauben können, beten Sie. Wenn
Willkommen! In unserer Kirche Eine kleine Orientierungshilfe im katholischen Gotteshaus * Herzlich willkommen in Gottes Haus. Dies ist ein Ort des Gebetes. * * * Wenn Sie glauben können, beten Sie. Wenn
DEUTSCHLAND AUF EINEN BLICK. Landeskunde Deutschlands
 DEUTSCHLAND AUF EINEN BLICK Landeskunde Deutschlands Staat demokratischer parlamentarischer Bundesstaat seit 1949 Geschichte der deutschen Einheit 1871 1914 1918 1919 1933 1933 1945 1949 1990 1990 Geschichte
DEUTSCHLAND AUF EINEN BLICK Landeskunde Deutschlands Staat demokratischer parlamentarischer Bundesstaat seit 1949 Geschichte der deutschen Einheit 1871 1914 1918 1919 1933 1933 1945 1949 1990 1990 Geschichte
PRAG EXKURSION. Universität Potsdam Institut für Religionswissenschaft Am Neuen Palais Potsdam
 Universität Potsdam Institut für Religionswissenschaft Am Neuen Palais 10 14469 Potsdam Vorlesung: Dozent: Jüdische Kunst überblicken Dr.phil. Michael M.Heinzmann MA Wi/Se 2012/13 Veranstaltung: Prag-Exkursion
Universität Potsdam Institut für Religionswissenschaft Am Neuen Palais 10 14469 Potsdam Vorlesung: Dozent: Jüdische Kunst überblicken Dr.phil. Michael M.Heinzmann MA Wi/Se 2012/13 Veranstaltung: Prag-Exkursion
05c / Muslime in der Schweiz. Herkunft der Muslime in der Schweiz. Kosovo. Republik. Landesflagge Religiöse Bezüge: Keine
 Herkunft der Muslime in der Schweiz Republik Landesflagge Religiöse Bezüge: Keine Herkunft der Muslime in der Schweiz Gesamtbevölkerung der Schweiz ca. 7.8 Mio. Personen Ausländer in der Schweiz ca. 1.7
Herkunft der Muslime in der Schweiz Republik Landesflagge Religiöse Bezüge: Keine Herkunft der Muslime in der Schweiz Gesamtbevölkerung der Schweiz ca. 7.8 Mio. Personen Ausländer in der Schweiz ca. 1.7
Josef Sinkovits / Ulrich Winkler (Hg.) Weltkirche und Weltreligionen
 Josef Sinkovits / Ulrich Winkler (Hg.) Weltkirche und Weltreligionen Salzburger Theologische Studien interkulturell 3 herausgegeben von Theologie interkulturell und Studium der Religionen Katholisch-Theologische
Josef Sinkovits / Ulrich Winkler (Hg.) Weltkirche und Weltreligionen Salzburger Theologische Studien interkulturell 3 herausgegeben von Theologie interkulturell und Studium der Religionen Katholisch-Theologische
Ernst Klett Schulbuchverlag Leipzig
 Asmut Brückmann Rolf Brütting Peter Gautschi Edith Hambach Uwe Horst Georg Langen Peter Offergeid Michael Sauer Volker Scherer Franz-Josef Wallmeier Ernst Klett Schulbuchverlag Leipzig Leipzig Stuttgart
Asmut Brückmann Rolf Brütting Peter Gautschi Edith Hambach Uwe Horst Georg Langen Peter Offergeid Michael Sauer Volker Scherer Franz-Josef Wallmeier Ernst Klett Schulbuchverlag Leipzig Leipzig Stuttgart
Bevölkerung nach demografischen Strukturmerkmalen
 BEVÖLKERUNG 80.219.695 Personen 5,0 8,4 11,1 6,0 11,8 16,6 20,4 11,3 9,3 unter 5 6 bis 14 15 bis 24 25 bis 29 30 bis 39 40 bis 49 50 bis 64 65 bis 74 75 und älter 51,2 48,8 Frauen Männer 92,3 7,7 Deutsche
BEVÖLKERUNG 80.219.695 Personen 5,0 8,4 11,1 6,0 11,8 16,6 20,4 11,3 9,3 unter 5 6 bis 14 15 bis 24 25 bis 29 30 bis 39 40 bis 49 50 bis 64 65 bis 74 75 und älter 51,2 48,8 Frauen Männer 92,3 7,7 Deutsche
5.Klasse Übergreifende Kompetenzen Personale Kompetenz Kommunikative. Religiöse. Methodenkompetenz
 - Schulspezifisches Fachcurriculum Ev. Religion, Klassenstufen 5 und 6, Max Planck Gymnasium Böblingen 5.Klasse Übergreifende en Personale Kommunikative Soziale Religiöse Die Schülerinnen und Schüler können
- Schulspezifisches Fachcurriculum Ev. Religion, Klassenstufen 5 und 6, Max Planck Gymnasium Böblingen 5.Klasse Übergreifende en Personale Kommunikative Soziale Religiöse Die Schülerinnen und Schüler können
Schulinternes Curriculum Geschichte, Jahrgang 7
 Wilhelm-Gymnasium Fachgruppe Geschichte Schulinternes Curriculum Jg. 7 Seite 1 von 5 Schulinternes Curriculum Geschichte, Jahrgang 7 Hoch- und Spätmittelalter / Renaissance, Humanismus, Entdeckungsreisen
Wilhelm-Gymnasium Fachgruppe Geschichte Schulinternes Curriculum Jg. 7 Seite 1 von 5 Schulinternes Curriculum Geschichte, Jahrgang 7 Hoch- und Spätmittelalter / Renaissance, Humanismus, Entdeckungsreisen
Religion und Glaube. Materialien zur Politischen Bildung von Kindern und Jugendlichen.
 Religion und Glaube Materialien zur Politischen Bildung von Kindern und Jugendlichen www.demokratiewebstatt.at Mehr Information auf: www.demokratiewebstatt.at Religion & Glaube ist das dasselbe? Das Wort
Religion und Glaube Materialien zur Politischen Bildung von Kindern und Jugendlichen www.demokratiewebstatt.at Mehr Information auf: www.demokratiewebstatt.at Religion & Glaube ist das dasselbe? Das Wort
Verlauf Material Klausuren Glossar Literatur. Streit um Macht und Religion eine Unterrichts - einheit zum Dreißigjährigen Krieg
 Reihe 10 S 1 Verlauf Material Streit um Macht und Religion eine Unterrichts - einheit zum Dreißigjährigen Krieg Silke Bagus, Nohra OT Ulla Von einer Defenestration berichtet sogar schon das Alte Testament.
Reihe 10 S 1 Verlauf Material Streit um Macht und Religion eine Unterrichts - einheit zum Dreißigjährigen Krieg Silke Bagus, Nohra OT Ulla Von einer Defenestration berichtet sogar schon das Alte Testament.
Die Aufgaben der evangelischen Friedenskirche in Köln-Mülheim
 Die Aufgaben der evangelischen Friedenskirche in Köln-Mülheim Was tut die Kirche für die Gesellschaft? Die evangelische Kirche trägt zur Förderung der Gesellschaft bei, indem sie eigene Institutionen betreibt,
Die Aufgaben der evangelischen Friedenskirche in Köln-Mülheim Was tut die Kirche für die Gesellschaft? Die evangelische Kirche trägt zur Förderung der Gesellschaft bei, indem sie eigene Institutionen betreibt,
Der demografische und gesellschaftliche Wandel und seine Auswirkungen in den Seelsorgefachbereichen
 Quelle: Giorgione (1478 1510) Die drei Philosophen, 1508/1509, online verfügbar unter: http://www.kunsthistorischesmuseum.at/nocache/de/global/bilddatenbankdruckversion/?aid=8&print=1&packageid=2582&chash=11eaf5a2c0be43ea816176254516526f&print=1
Quelle: Giorgione (1478 1510) Die drei Philosophen, 1508/1509, online verfügbar unter: http://www.kunsthistorischesmuseum.at/nocache/de/global/bilddatenbankdruckversion/?aid=8&print=1&packageid=2582&chash=11eaf5a2c0be43ea816176254516526f&print=1
Das Schicksal der Juden in Polen: Vernichtung und Hilfe
 Das Schicksal der Juden in Polen: Vernichtung und Hilfe Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs lebten rund 3,3 Millionen Juden in Polen. Nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939
Das Schicksal der Juden in Polen: Vernichtung und Hilfe Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs lebten rund 3,3 Millionen Juden in Polen. Nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939
2. Reformation und Macht, Thron und Altar. Widerständigkeit und Selbstbehauptung
 1517 2017 Reformationsjubiläum in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 2. Reformation und Macht, Thron und Altar Widerständigkeit und Selbstbehauptung Widerständigkeit und
1517 2017 Reformationsjubiläum in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 2. Reformation und Macht, Thron und Altar Widerständigkeit und Selbstbehauptung Widerständigkeit und
Die Evangelische Allianz in Deutschland. Können Christen und Muslime gemeinsam beten?
 Die Evangelische Allianz in Deutschland Können Christen und Muslime gemeinsam beten? Können Christen und Muslime gemeinsam beten? Über diese Frage hätte man vor einigen Jahren noch gelächelt. Ein gemeinsames
Die Evangelische Allianz in Deutschland Können Christen und Muslime gemeinsam beten? Können Christen und Muslime gemeinsam beten? Über diese Frage hätte man vor einigen Jahren noch gelächelt. Ein gemeinsames
zu gegenwärtigen Vorurteilen unter Anleitung Projekte zu religiös relevanten Themen durchführen (HK
 Jahrgangsstufe 6: Unterrichtsvorhaben I, Kinder Abrahams Judentum, Christentum, Islam Kinder Abrahams Judentum, Christentum, Islam Weltreligionen und andere Wege der Sinn- und Heilssuche (IF 6) Grundzüge
Jahrgangsstufe 6: Unterrichtsvorhaben I, Kinder Abrahams Judentum, Christentum, Islam Kinder Abrahams Judentum, Christentum, Islam Weltreligionen und andere Wege der Sinn- und Heilssuche (IF 6) Grundzüge
VORANSICHT. Ein Fenstersturz mit Folgen: der Dreißigjährige Krieg
 IV Frühe Neuzeit Beitrag 7 Der Dreißigjährige Krieg 1 von 32 Ein Fenstersturz mit Folgen: der Dreißigjährige Krieg Silke Bagus, Nohra OT Ulla Dreißig Jahre Krieg was aber steckt dahinter? In der vorliegenden
IV Frühe Neuzeit Beitrag 7 Der Dreißigjährige Krieg 1 von 32 Ein Fenstersturz mit Folgen: der Dreißigjährige Krieg Silke Bagus, Nohra OT Ulla Dreißig Jahre Krieg was aber steckt dahinter? In der vorliegenden
Programm der Apostolischen Reise von Papst Benedikt XVI. nach Deutschland 22. - 25. September 2011
 PAPSTBESUCH 2011 Programm der Apostolischen Reise von Papst Benedikt XVI. nach Deutschland 22. - 25. September 2011 Die 21. Auslandsreise führt Papst Benedikt XVI. in das Erzbistum Berlin, in das Bistum
PAPSTBESUCH 2011 Programm der Apostolischen Reise von Papst Benedikt XVI. nach Deutschland 22. - 25. September 2011 Die 21. Auslandsreise führt Papst Benedikt XVI. in das Erzbistum Berlin, in das Bistum
Klasse 7 Leitthema Jona 1. Halbjahr, 1. Quartal. Didaktisch-methodische Zugriffe
 Klasse 7 Leitthema Jona 1. Halbjahr, 1. Quartal W3: Situationen beschreiben, in denen existenzielle Fragen des Lebens auftreten De1: Grundformen religiöser und biblischer Sprache sowie individueller und
Klasse 7 Leitthema Jona 1. Halbjahr, 1. Quartal W3: Situationen beschreiben, in denen existenzielle Fragen des Lebens auftreten De1: Grundformen religiöser und biblischer Sprache sowie individueller und
Das Berliner Fest der Kirchen. Aus Freude am Glauben. 15. September Unter einem Himmel
 Das Berliner Fest der Kirchen Aus Freude am Glauben 15. September 2012 Unter einem Himmel Impressum Veranstalter: Ökumenischer Rat Berlin-Brandenburg (ÖRBB) Gierkeplatz 2-4, 10585 Berlin Fotos: Seite 3,
Das Berliner Fest der Kirchen Aus Freude am Glauben 15. September 2012 Unter einem Himmel Impressum Veranstalter: Ökumenischer Rat Berlin-Brandenburg (ÖRBB) Gierkeplatz 2-4, 10585 Berlin Fotos: Seite 3,
Orthodoxie und orthodoxe Spiritualität in Rumänien
 Orthodoxie und orthodoxe Spiritualität in Rumänien Studienreise des Lehrstuhls für Ökumenische Theologie und Orientalische Kirchen- und Missionsgeschichte an der Theologischen Fakultät der Georg-August-Universität
Orthodoxie und orthodoxe Spiritualität in Rumänien Studienreise des Lehrstuhls für Ökumenische Theologie und Orientalische Kirchen- und Missionsgeschichte an der Theologischen Fakultät der Georg-August-Universität
Orte in der Bibel. Jerusalem St. Jakobus. [oibje01009]
![Orte in der Bibel. Jerusalem St. Jakobus. [oibje01009] Orte in der Bibel. Jerusalem St. Jakobus. [oibje01009]](/thumbs/52/29028959.jpg) Orte in der Bibel Jerusalem St. Jakobus 1 St. Jakobus - Jakobuskirche Die Jakobuskirche im armenischen Viertel von Jerusalem ist die Kirche des armenischen orthodoxen Patriarchen von Jerusalem. Die Kirche
Orte in der Bibel Jerusalem St. Jakobus 1 St. Jakobus - Jakobuskirche Die Jakobuskirche im armenischen Viertel von Jerusalem ist die Kirche des armenischen orthodoxen Patriarchen von Jerusalem. Die Kirche
Kreis der Aktiven. Perspektiven zur ehrenamtlichen Gemeindearbeit
 Perspektiven zur ehrenamtlichen Gemeindearbeit Präsentation - Strukturwandel im Bistum Fulda - Bistumsstrategie 2014 - Perspektiven für Herz Mariä Strukturwandel im Bistum Fulda Strukturwandel im Bistum
Perspektiven zur ehrenamtlichen Gemeindearbeit Präsentation - Strukturwandel im Bistum Fulda - Bistumsstrategie 2014 - Perspektiven für Herz Mariä Strukturwandel im Bistum Fulda Strukturwandel im Bistum
Das Zweite Vatikanische Konzil. Verlauf Ergebnisse Bedeutung
 Das Zweite Vatikanische Konzil Verlauf Ergebnisse Bedeutung Was ist ein Konzil? Lat. concilium, Versammlung. Kirchenversammlung aller rechtmäßigen Bischöfe der katholischen Kirche unter Vorsitz des Papstes
Das Zweite Vatikanische Konzil Verlauf Ergebnisse Bedeutung Was ist ein Konzil? Lat. concilium, Versammlung. Kirchenversammlung aller rechtmäßigen Bischöfe der katholischen Kirche unter Vorsitz des Papstes
Leichtes Wörterbuch zu Glaube, Kirche, Behinderung
 Leichtes Wörterbuch zu Glaube, Kirche, Behinderung In diesem kleinen Wörterbuch werden schwierige Wörter erklärt. Die schwierigen Wörter kommen auf der Internetseite des Referates Seelsorge für Menschen
Leichtes Wörterbuch zu Glaube, Kirche, Behinderung In diesem kleinen Wörterbuch werden schwierige Wörter erklärt. Die schwierigen Wörter kommen auf der Internetseite des Referates Seelsorge für Menschen
Junge Theologen im >Dritten Reich<
 Wolfgang Scherffig Junge Theologen im >Dritten Reich< Dokumente, Briefe, Erfahrungen Band 1 Es begann mit einem Nein! 1933-1935 Mit einem Geleitwort von Helmut GoUwitzer Neukirchener Inhalt Helmut GoUwitzer,
Wolfgang Scherffig Junge Theologen im >Dritten Reich< Dokumente, Briefe, Erfahrungen Band 1 Es begann mit einem Nein! 1933-1935 Mit einem Geleitwort von Helmut GoUwitzer Neukirchener Inhalt Helmut GoUwitzer,
Präsenzseminar: Staat und Religion in Deutschland
 Präsenzseminar: Staat und Religion in Deutschland 25. bis 27. April 2014, FernUniversität in Hagen Staat und Religion in Deutschland 1 Inhalt Das Verhältnis von Staat und Religion hat sich in Deutschland
Präsenzseminar: Staat und Religion in Deutschland 25. bis 27. April 2014, FernUniversität in Hagen Staat und Religion in Deutschland 1 Inhalt Das Verhältnis von Staat und Religion hat sich in Deutschland
Curriculum EVANGELISCHE RELIGION Sekundarstufe I. Genoveva-Gymnasium Köln Lehrplan SEK1 G8 Evangelische Religion Seite 1
 Curriculum EVANGELISCHE RELIGION Sekundarstufe I Klasse Themen/ Leitlinien Inhalte Methodische Hinweise Miteinander leben/ Freundschaft Sich kennen lernen Partnerinterview Merkmale einer guten Freundschaft
Curriculum EVANGELISCHE RELIGION Sekundarstufe I Klasse Themen/ Leitlinien Inhalte Methodische Hinweise Miteinander leben/ Freundschaft Sich kennen lernen Partnerinterview Merkmale einer guten Freundschaft
Arbeitsblatt Vergleich Judentum Christentum Islam Lösungsvorschläge. 1. Fülle die Tabelle mit den unten stehenden Begriffen aus!
 Arbeitsblatt Vergleich Judentum Christentum Islam Lösungsvorschläge 1. Fülle die Tabelle mit den unten stehenden Begriffen aus! Judentum Christentum Islam Heiliges Buch Thora Bibel Koran Gebetshaus Synagoge
Arbeitsblatt Vergleich Judentum Christentum Islam Lösungsvorschläge 1. Fülle die Tabelle mit den unten stehenden Begriffen aus! Judentum Christentum Islam Heiliges Buch Thora Bibel Koran Gebetshaus Synagoge
Grußwort von Ortsvorsteher Hans Beser zum 50-jährigen Jubiläum der Christuskirche Ergenzingen am 16. Juni 2012
 Grußwort von Ortsvorsteher Hans Beser zum 50-jährigen Jubiläum der Christuskirche Ergenzingen am 16. Juni 2012 Sehr geehrte Frau Dekanin Kling de Lazer, sehr geehrte Herren Pfarrer Reiner und Huber, sehr
Grußwort von Ortsvorsteher Hans Beser zum 50-jährigen Jubiläum der Christuskirche Ergenzingen am 16. Juni 2012 Sehr geehrte Frau Dekanin Kling de Lazer, sehr geehrte Herren Pfarrer Reiner und Huber, sehr
Leben aus der Freude des Evangeliums
 Leben aus der Freude des Evangeliums Ein biblischer Glaubenskurs für Gruppen und Einzelpersonen Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. Papst Franziskus,
Leben aus der Freude des Evangeliums Ein biblischer Glaubenskurs für Gruppen und Einzelpersonen Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. Papst Franziskus,
Lehrplan Katholische Religionslehre. Leitmotiv 5/6: Miteinander unterwegs von Gott geführt
 Klasse 5 Leitmotiv 5/6: Miteinander unterwegs von Gott geführt Bereiche Sprache der Religion Altes Testament Kirche und ihr Glaube Ethik/ Anthropologie Religion und Konfession Zielsetzungen/Perspektiven
Klasse 5 Leitmotiv 5/6: Miteinander unterwegs von Gott geführt Bereiche Sprache der Religion Altes Testament Kirche und ihr Glaube Ethik/ Anthropologie Religion und Konfession Zielsetzungen/Perspektiven
Manifest. für eine. Muslimische Akademie in Deutschland
 Manifest für eine Muslimische Akademie in Deutschland 1. Ausgangssituation In der Bundesrepublik Deutschland gibt es ein breit gefächertes, differenziertes Netz von Institutionen der Erwachsenen- und Jugendbildung,
Manifest für eine Muslimische Akademie in Deutschland 1. Ausgangssituation In der Bundesrepublik Deutschland gibt es ein breit gefächertes, differenziertes Netz von Institutionen der Erwachsenen- und Jugendbildung,
Zur Geschichte der Propaganda-Postkarte
 Geschichte im Postkartenbild Band 1 Otto May Zur Geschichte der Propaganda-Postkarte franzbecker Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation
Geschichte im Postkartenbild Band 1 Otto May Zur Geschichte der Propaganda-Postkarte franzbecker Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation
2. Kurzbericht: Pflegestatistik 1999
 Statistisches Bundesamt Zweigstelle Bonn 2. Kurzbericht: Pflegestatistik 1999 - Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung - Ländervergleich: Pflegebedürftige Bonn, im Oktober 2001 2. Kurzbericht: Pflegestatistik
Statistisches Bundesamt Zweigstelle Bonn 2. Kurzbericht: Pflegestatistik 1999 - Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung - Ländervergleich: Pflegebedürftige Bonn, im Oktober 2001 2. Kurzbericht: Pflegestatistik
LANGE NACHT DER KIRCHEN Unterlagen und Tipps aus der Pfarre Waidhofen/Thaya zum Programmpunkt Rätselralley für Kinder (2014)
 Ulrike Bayer Wir haben nach dem Motto Ich seh ich seh was du nicht siehst! die Kinder raten und suchen lassen. An Hand der Merkmale der Statuen und Besonderheiten in unserer Pfarrkirche haben wir unser
Ulrike Bayer Wir haben nach dem Motto Ich seh ich seh was du nicht siehst! die Kinder raten und suchen lassen. An Hand der Merkmale der Statuen und Besonderheiten in unserer Pfarrkirche haben wir unser
Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft
 Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft Teilband 29 Karl Lehmann Gemeinde Franz-Xaver Kaufmann / Heinrich Fries / Wolfhart Pannenberg / Axel Frhr. von Campenhausen / Peter Krämer Kirche Heinrich Fries
Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft Teilband 29 Karl Lehmann Gemeinde Franz-Xaver Kaufmann / Heinrich Fries / Wolfhart Pannenberg / Axel Frhr. von Campenhausen / Peter Krämer Kirche Heinrich Fries
Predigt zum Interview-Buch mit Papst Benedikt Letzte Gespräche Thema: Kirchensteuer
 Predigt zum Interview-Buch mit Papst Benedikt Letzte Gespräche Thema: Kirchensteuer 1 Liebe Schwestern und Brüder, 1. Letzte Gespräche An diesem Freitag erschien in Deutschland ein Interview-Buch mit unserem
Predigt zum Interview-Buch mit Papst Benedikt Letzte Gespräche Thema: Kirchensteuer 1 Liebe Schwestern und Brüder, 1. Letzte Gespräche An diesem Freitag erschien in Deutschland ein Interview-Buch mit unserem
Es erfüllt mich mit Stolz und mit Freude, Ihnen aus Anlass des
 Grußwort des Präsidenten des Sächsischen Landtags, Dr. Matthias Rößler, zum Festakt anlässlich des 10. Jahrestages der Weihe in der Neuen Synagoge Dresden am 13. November 2011 Sehr geehrte Frau Dr. Goldenbogen,
Grußwort des Präsidenten des Sächsischen Landtags, Dr. Matthias Rößler, zum Festakt anlässlich des 10. Jahrestages der Weihe in der Neuen Synagoge Dresden am 13. November 2011 Sehr geehrte Frau Dr. Goldenbogen,
Was soll und möchte ich mit meinem Leben machen? Was ist mir dabei wichtig? Was bedeutet es (mir) Christ zu sein?
 Jahrgang 5 Themen im katholischen Religionsunterricht Klasse 5 Wir fragen danach, an wen wir glauben (das Gottesbild im Wandel der Zeit), wie wir diesen Glauben ausüben (das Sprechen von und mit Gott),
Jahrgang 5 Themen im katholischen Religionsunterricht Klasse 5 Wir fragen danach, an wen wir glauben (das Gottesbild im Wandel der Zeit), wie wir diesen Glauben ausüben (das Sprechen von und mit Gott),
Beschlussvorlage des Ausschusses für öffentliche Verantwortung (III)
 LS 2014 P21 Flüchtlingsproblematik an den EU-Außengrenzen (Drucksache 32) und Anträge der Kreissynoden Krefeld-Viersen und Moers betr. Flüchtlingsproblematik an den EU-Außengrenzen (Drucksache 12 Nr. 25
LS 2014 P21 Flüchtlingsproblematik an den EU-Außengrenzen (Drucksache 32) und Anträge der Kreissynoden Krefeld-Viersen und Moers betr. Flüchtlingsproblematik an den EU-Außengrenzen (Drucksache 12 Nr. 25
Festgottesdienst zur Einweihung des neuen evangelischen Gemeindehauses am (18. Sonntag nach Trinitatis) in der Stiftskirche
 Festgottesdienst zur Einweihung des neuen evangelischen Gemeindehauses am 25.09.2016 (18. Sonntag nach Trinitatis) in der Stiftskirche zu Windecken. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe
Festgottesdienst zur Einweihung des neuen evangelischen Gemeindehauses am 25.09.2016 (18. Sonntag nach Trinitatis) in der Stiftskirche zu Windecken. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe
Wo einst die Schtetl waren... - Auf den Spuren jüdischen Lebens in Ostpolen -
 Wo einst die Schtetl waren... - Auf den Spuren jüdischen Lebens in Ostpolen - unter diesem Motto veranstaltete Zeichen der Hoffnung vom 13. 21. Aug. 2006 eine Studienfahrt nach Polen. Die 19 Teilnehmenden
Wo einst die Schtetl waren... - Auf den Spuren jüdischen Lebens in Ostpolen - unter diesem Motto veranstaltete Zeichen der Hoffnung vom 13. 21. Aug. 2006 eine Studienfahrt nach Polen. Die 19 Teilnehmenden
2017 weiter-sehen Initiativen zum Reformationsgedächtnis 2017 in der Erzdiözese München und Freising DR. F. SCHUPPE 1
 2017 weiter-sehen Initiativen zum Reformationsgedächtnis 2017 in der Erzdiözese München und Freising DR. F. SCHUPPE 1 Es stimmt hoffnungsvoll, dass mit dem 500. Jahrestag der Reformation erstmals ein Reformationsgedenken
2017 weiter-sehen Initiativen zum Reformationsgedächtnis 2017 in der Erzdiözese München und Freising DR. F. SCHUPPE 1 Es stimmt hoffnungsvoll, dass mit dem 500. Jahrestag der Reformation erstmals ein Reformationsgedenken
Neues Kirchliches Finanzwesen
 Neues Kirchliches Finanzwesen Was ist NKF? Das Neue Kirchliche Finanzwesen denkt von den Zielen her. Die Ziele bestimmen die Maßnahmen. Wie viel Geld, Zeit der Mitarbeitenden und andere Ressourcen kann
Neues Kirchliches Finanzwesen Was ist NKF? Das Neue Kirchliche Finanzwesen denkt von den Zielen her. Die Ziele bestimmen die Maßnahmen. Wie viel Geld, Zeit der Mitarbeitenden und andere Ressourcen kann
Joachim Schmiedl. Kirchengeschichte des Jahrhunderts (M17-2) Vorlesung SS 2011 Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar
 Joachim Schmiedl Kirchengeschichte des 19.-21. Jahrhunderts (M17-2) Vorlesung SS 2011 Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar 1 Die Neuordnung der katholischen Kirche nach der Säkularisation...
Joachim Schmiedl Kirchengeschichte des 19.-21. Jahrhunderts (M17-2) Vorlesung SS 2011 Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar 1 Die Neuordnung der katholischen Kirche nach der Säkularisation...
3. Materialien zum Arbeiten, Lesen, Ausdrucken 3.1 I. Kompetenzen und Inhalte des Bildungsplans sowie Zuordnung der Themen
 3. Materialien zum Arbeiten, Lesen, Ausdrucken 3.1 I. Kompetenzen und Inhalte des Bildungsplans sowie Zuordnung der Themen Von Gerhard Ziener in Zusammenarbeit mit Klaus J. Kienzler Vorbemerkung: Die DVD
3. Materialien zum Arbeiten, Lesen, Ausdrucken 3.1 I. Kompetenzen und Inhalte des Bildungsplans sowie Zuordnung der Themen Von Gerhard Ziener in Zusammenarbeit mit Klaus J. Kienzler Vorbemerkung: Die DVD
Fach: Evangelische Religion Jahrgangsstufe: 5 Inhalt: Ich und die anderen
 Fach: Evangelische Religion Jahrgangsstufe: 5 Inhalt: Ich und die anderen Leitperspektive Inhaltsfeld Kompetenzen/ Abstufungen Inhaltsbezogene Kompetenzen* Zeit Fächerübergreifend/ - verbindend Eigene
Fach: Evangelische Religion Jahrgangsstufe: 5 Inhalt: Ich und die anderen Leitperspektive Inhaltsfeld Kompetenzen/ Abstufungen Inhaltsbezogene Kompetenzen* Zeit Fächerübergreifend/ - verbindend Eigene
Wechselseitige Taufanerkennung Geschichte und Bedeutung
 Wechselseitige Taufanerkennung Geschichte und Bedeutung Deshalb erkennen wir jede nach dem Auftrag Jesu im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes mit der Zeichenhandlung des Untertauchens
Wechselseitige Taufanerkennung Geschichte und Bedeutung Deshalb erkennen wir jede nach dem Auftrag Jesu im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes mit der Zeichenhandlung des Untertauchens
Austrittszahlen
 Austrittszahlen 2012-2013 - 2014 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 138.195 2012 2013 evang. Landeskirchen 118.235 175.953 266.450 2014 (Erz-)Bistümer 1.717 217.611 Quellen: Angaben der Landeskirchen
Austrittszahlen 2012-2013 - 2014 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 138.195 2012 2013 evang. Landeskirchen 118.235 175.953 266.450 2014 (Erz-)Bistümer 1.717 217.611 Quellen: Angaben der Landeskirchen
Erste Ergebnisse der Erhebung zur Sprache, Religion und Kultur 2014, Teil Religion
 Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Statistik BFS Medienmitteilung Sperrfrist: 22.04.2016, 9:15 1 Bevölkerung Nr. 0350-1604-30 Erste Ergebnisse der Erhebung zur Sprache, Religion und
Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Statistik BFS Medienmitteilung Sperrfrist: 22.04.2016, 9:15 1 Bevölkerung Nr. 0350-1604-30 Erste Ergebnisse der Erhebung zur Sprache, Religion und
Geschichte der Diakonie in Deutschland
 Geschichte der Diakonie in Deutschland Bearbeitet von Dr. Georg-Hinrich Hammer 1. Auflage 2013. Taschenbuch. 384 S. Paperback ISBN 978 3 17 022999 0 Format (B x L): 15,5 x 23,2 cm Gewicht: 563 g Weitere
Geschichte der Diakonie in Deutschland Bearbeitet von Dr. Georg-Hinrich Hammer 1. Auflage 2013. Taschenbuch. 384 S. Paperback ISBN 978 3 17 022999 0 Format (B x L): 15,5 x 23,2 cm Gewicht: 563 g Weitere
Rede für Herrn Bürgermeister Kessler zur Kranzniederlegung am jüdischen Mahnmal am 09. November 2010 um Uhr
 1 Rede für Herrn Bürgermeister Kessler zur Kranzniederlegung am jüdischen Mahnmal am 09. November 2010 um 11.00 Uhr Sehr gehrte Frau Wagner-Redding, meine Damen und Herren, wir gedenken heute der Pogrom-Nacht
1 Rede für Herrn Bürgermeister Kessler zur Kranzniederlegung am jüdischen Mahnmal am 09. November 2010 um 11.00 Uhr Sehr gehrte Frau Wagner-Redding, meine Damen und Herren, wir gedenken heute der Pogrom-Nacht
Eröffnung Huttererpark Jakob Hutter ( ) Innsbruck Franz Greiter Promenade 16. Oktober 2015
 Eröffnung Huttererpark Jakob Hutter (1500 1536) Innsbruck Franz Greiter Promenade 16. Oktober 2015 Die Güter der Gerechtigkeit, der Wahrheit, der Schönheit... brauchen Zeit, Beständigkeit, Gedächtnis,
Eröffnung Huttererpark Jakob Hutter (1500 1536) Innsbruck Franz Greiter Promenade 16. Oktober 2015 Die Güter der Gerechtigkeit, der Wahrheit, der Schönheit... brauchen Zeit, Beständigkeit, Gedächtnis,
ON! DVD Religion und Ethik Die Evangelische Kirche Arbeitsmaterialien Seite 1. Aufbau und Organisation der Evangelischen Kirche
 ON! DVD Religion und Ethik Die Evangelische Kirche Arbeitsmaterialien Seite 1 Aufbau und Organisation der Evangelischen Kirche Einstieg Zu Beginn der Einheit wird die Folie Nachgefragt aufgelegt und die
ON! DVD Religion und Ethik Die Evangelische Kirche Arbeitsmaterialien Seite 1 Aufbau und Organisation der Evangelischen Kirche Einstieg Zu Beginn der Einheit wird die Folie Nachgefragt aufgelegt und die
Lebensformen im Hoch- und Spätmittelalter. Erkenntnisgewinnung durch Methoden. nehmen punktuelle Vergleiche zwischen damals und heute vor
 Klasse 7 Lebensformen im Hoch- und Spätmittelalter beschreiben das Dorf als Lebensort der großen Mehrheit der Menschen im Mittelalter. stellen das Kloster als Ort vertiefter Frömmigkeit und kultureller,
Klasse 7 Lebensformen im Hoch- und Spätmittelalter beschreiben das Dorf als Lebensort der großen Mehrheit der Menschen im Mittelalter. stellen das Kloster als Ort vertiefter Frömmigkeit und kultureller,
Kern- und Schulcurriculum katholische Religion Klasse 5/6. Stand Schuljahr 2009/10
 Kern- und Schulcurriculum katholische Religion Klasse 5/6 Stand Schuljahr 2009/10 Themenfelder DIE BIBEL Biblische Texte erzählen von Erfahrungen der Menschen mit Gott Bibelkunde Die Bibel: das heilige
Kern- und Schulcurriculum katholische Religion Klasse 5/6 Stand Schuljahr 2009/10 Themenfelder DIE BIBEL Biblische Texte erzählen von Erfahrungen der Menschen mit Gott Bibelkunde Die Bibel: das heilige
Metropolregionen in Deutschland
 12 Kapitel 2 Vorbemerkung 2005 wurde von der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) die Zahl der Metropolregionen von sieben auf elf erhöht. Bei Metropolregionen handelt es sich um Verdichtungsräume,
12 Kapitel 2 Vorbemerkung 2005 wurde von der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) die Zahl der Metropolregionen von sieben auf elf erhöht. Bei Metropolregionen handelt es sich um Verdichtungsräume,
Predigt im Pontifikalamt aus Anlass der Übergabe der Nikolaus-Reliquie am Donnerstag, 6. Dezember 2007 in der Pfarrei St. Nikolaus, Mainz-Mombach
 Predigt im Pontifikalamt aus Anlass der Übergabe der Nikolaus-Reliquie am Donnerstag, 6. Dezember 2007 in der Pfarrei St. Nikolaus, Mainz-Mombach Es gilt das gesprochene Wort! Wünschen lernen Es ist wieder
Predigt im Pontifikalamt aus Anlass der Übergabe der Nikolaus-Reliquie am Donnerstag, 6. Dezember 2007 in der Pfarrei St. Nikolaus, Mainz-Mombach Es gilt das gesprochene Wort! Wünschen lernen Es ist wieder
Evangelische Kirche. in Deutschland. Kirchenmitgliederzahlen Stand 31.12.2012
 Evangelische Kirche in Deutschland Kirchenmitgliederzahlen Stand 31.12.2012 Februar 2014 Allgemeine Bemerkungen zu allen Tabellen Wenn in den einzelnen Tabellenfeldern keine Zahlen eingetragen sind, so
Evangelische Kirche in Deutschland Kirchenmitgliederzahlen Stand 31.12.2012 Februar 2014 Allgemeine Bemerkungen zu allen Tabellen Wenn in den einzelnen Tabellenfeldern keine Zahlen eingetragen sind, so
Kinder in Tagesbetreuung
 Nach Betreuungsumfang und Alter der Kinder, in absoluten Zahlen, 01. März 2011* 900.000 800.000 855.645 180.049 Westdeutschland : 2.381.585 Ostdeutschland : 864.860 6 bis 11 700.000 634.330 Westdeutschland
Nach Betreuungsumfang und Alter der Kinder, in absoluten Zahlen, 01. März 2011* 900.000 800.000 855.645 180.049 Westdeutschland : 2.381.585 Ostdeutschland : 864.860 6 bis 11 700.000 634.330 Westdeutschland
Zusammenleben in der Klasse, in der Familie, mit Freunden. Gott traut uns etwas zu. Wir sind aufeinander angewiesen
 Wochen Anzahl der Schulstunden Dimensionen Themenfelder Thema in Kursbuch Religion Elementar 5/6 Methoden (in Auswahl) Mensch können die Gleichwertigkeit von Mädchen und Jungen biblisch begründen und Konsequenzen
Wochen Anzahl der Schulstunden Dimensionen Themenfelder Thema in Kursbuch Religion Elementar 5/6 Methoden (in Auswahl) Mensch können die Gleichwertigkeit von Mädchen und Jungen biblisch begründen und Konsequenzen
Weite wirkt Reformation und die Eine Welt. Vorschau Veranstaltungen 2016
 Weite wirkt Reformation und die Eine Welt Vorschau Veranstaltungen 2016 Highlights im Themenjahr Weite wirkt Reformation und die Eine Welt in Westfalen Das Reformationsjubiläum 2017 erinnert an den Thesenanschlag
Weite wirkt Reformation und die Eine Welt Vorschau Veranstaltungen 2016 Highlights im Themenjahr Weite wirkt Reformation und die Eine Welt in Westfalen Das Reformationsjubiläum 2017 erinnert an den Thesenanschlag
Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre (G8)
 Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre (G8) Klasse 5 Gott suchen - Gott erfahren Die Bibel Urkunde des Glaubens (Von Gott erzählen) Die Bibel (k)ein Buch wie jedes andere Zweifel und Glaube
Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre (G8) Klasse 5 Gott suchen - Gott erfahren Die Bibel Urkunde des Glaubens (Von Gott erzählen) Die Bibel (k)ein Buch wie jedes andere Zweifel und Glaube
Kölner Statistische Nachrichten - 1/2015 Seite 7 Statistisches Jahrbuch 2015, 92. Jahrgang. Kapitel 0: Stadtgebiet und Flächennutzung
 Kölner Statistische Nachrichten - 1/2015 Seite 7 Kapitel 0: Stadtgebiet und Flächennutzung Kölner Statistische Nachrichten - 1/2015 Seite 8 Nr. Titel Seite Verzeichnis der Tabellen Überblick 9 001 Historische
Kölner Statistische Nachrichten - 1/2015 Seite 7 Kapitel 0: Stadtgebiet und Flächennutzung Kölner Statistische Nachrichten - 1/2015 Seite 8 Nr. Titel Seite Verzeichnis der Tabellen Überblick 9 001 Historische
Bedeutung und Entwicklung deutsch-türkischer- Städtepartnerschaften in Nordrhein- Westfalen
 Bedeutung und Entwicklung deutsch-türkischer- Städtepartnerschaften in Nordrhein- Westfalen Städtepartnerschaften Städtepartnerschaften Förmlich, zeitlich und sachlich nicht begrenzte Städtepartnerschaft,
Bedeutung und Entwicklung deutsch-türkischer- Städtepartnerschaften in Nordrhein- Westfalen Städtepartnerschaften Städtepartnerschaften Förmlich, zeitlich und sachlich nicht begrenzte Städtepartnerschaft,
Begrüßungsworte des Herrn Bundespräsidenten anlässlich. 50.Jahre Österreichische Superiorenkonferenz. am 23. November 2009 im Spiegelsaal
 Begrüßungsworte des Herrn Bundespräsidenten anlässlich 50.Jahre Österreichische Superiorenkonferenz am 23. November 2009 im Spiegelsaal Exzellenz! Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Verehrte Ordensobere!
Begrüßungsworte des Herrn Bundespräsidenten anlässlich 50.Jahre Österreichische Superiorenkonferenz am 23. November 2009 im Spiegelsaal Exzellenz! Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Verehrte Ordensobere!
Blick vom Kirchturm auf die im Jahre 1900 errichtete Villa Stern am Ostwall. (Foto: Stadtarchiv Attendorn, Fotosammlung)
 Erinnerungsstätte Rathaus Attendorn Tafel: Die Verfolgung der Juden Blick vom Kirchturm auf die im Jahre 1900 errichtete Villa Stern am Ostwall. (Foto: Stadtarchiv Attendorn, Fotosammlung) In der Wasserstraße
Erinnerungsstätte Rathaus Attendorn Tafel: Die Verfolgung der Juden Blick vom Kirchturm auf die im Jahre 1900 errichtete Villa Stern am Ostwall. (Foto: Stadtarchiv Attendorn, Fotosammlung) In der Wasserstraße
Aus: Inge Auerbacher, Ich bin ein Stern, 1990, Weinheim Basel: Beltz & Gelberg
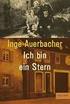 Inge Auerbacher wächst als Kind einer jüdischen Familie in einem schwäbischen Dorf auf. Sie ist sieben, als sie 1942 mit ihren Eltern in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert wird. Inge Auerbacher
Inge Auerbacher wächst als Kind einer jüdischen Familie in einem schwäbischen Dorf auf. Sie ist sieben, als sie 1942 mit ihren Eltern in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert wird. Inge Auerbacher
Zunächst gehörte die Filiale Wallersheim, wie die Pfarrgemeinde seinerzeit genannt wurde, zu Büdesheim.
 Pfarrkirche St. Nikolaus in Wallersheim Rede des Ortsbürgermeisters Josef Hoffmann zur 150 - Jahr - Feier am 04.07.2010 Liebe Christengemeinde Liebe Gäste Die alte Kirche, an manchen Stellen in früheren
Pfarrkirche St. Nikolaus in Wallersheim Rede des Ortsbürgermeisters Josef Hoffmann zur 150 - Jahr - Feier am 04.07.2010 Liebe Christengemeinde Liebe Gäste Die alte Kirche, an manchen Stellen in früheren
