Landschaftsqualitätsbeiträge Kanton Luzern
|
|
|
- Inken Stein
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Landwirtschaft und Wald (lawa) Abteilung Lan dwirtschaft Centralstrasse 33 Postfach 6210 Sursee Telefon Telefax Landschaftsqualitätsbeiträge Kanton Luzern Projektperimeter Sursee Projektgesuch im Rahmen von Art. 63 Direktzahlungsverordnung (DZV) Sursee, 28. April 2016
2 Impressum Bild Titelseite: Nutzungsmosaik im Projektperimeter Sursee Kontakt Kanton: Dr. Franz Stadelmann Dienststelle Landwirtschaft und Wald (lawa) Centralstrasse Sursee Kontakt Trägerschaft: Rebecca Stecher Dienststelle Landwirtschaft und Wald (lawa) Centralstrasse Sursee
3 Autoren / Redaktion: Überkantonaler Teil Begleitgruppe KOLAS Zentralschweiz Agrofutura, 5070 Frick Kantonaler Teil Luzern Dienststelle Landwirtschaft und Wald, Abt. Landwirtschaft o Stecher Rebecca, Projektleiterin Biodiversität / Landschaftsqualität o Dr. Stadelmann Franz, Fachleiter Natürliche Ressourcen
4 Verwendete Abkürzungen: a Are(n) AP Agrarpolitik ARE Bundesamt für Raumentwicklung BAFU Bundesamt für Umwelt BD Biodiversität BFF Biodiversitätsförderflächen BFS Bundesamt für Statistik BLN Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung BLW Bundesamt für Landwirtschaft BBZN Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung BZ Bergzone DZV Direktzahlungsverordnung FF Fruchtfolge FLS Fonds Landschaft Schweiz FMI Bundesinventar der Flachmoore von nationaler Bedeutung ha Hektare(n) HMI Bundesinventar der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung HZ Hügelzone IANB Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung INR Inventar der Naturobjekte von regionaler Bedeutung ISOS Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz IVS Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz JBG Bundesinventar der eidgenössischen Jagdbanngebiete KOLAS-Z Konferenz der Landwirtschaftsämter der Zentralschweiz lawa Dienststelle Landwirtschaft und Wald LAWIS Landwirtschaftliches Informationssystem LBV Luzerner Bäuerinnen und Bauernverband LN Landwirtschaftliche Nutzfläche LQB Landschaftsqualitätsbeiträge LQ Landschaftsqualität LRI Lebensrauminventar LUCAT Luzerner Geodaten Katalog LwA Landwirtschaftsamt MLI Bundesinventar der Moorlandschaften von besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung NHG Natur- und Heimatschutzgesetz NST Normalstoss oa offene Ackerfläche ÖLN Ökologischer Leistungsnachweis rawi Dienststelle Raum und Wirtschaft REP Regionale Entwicklungspläne SM Silomais TWW Bundesinventar der Trockenwiesen und weiden von nationaler Bedeutung TZ Talzone UBE UNESCO Biosphäre Entlebuch VP Vernetzungsprojekt WSL Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WZVV Bundesinventar der Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler und nationaler Bedeutung ZCH Zentralschweiz LQ-Projekt Perimeter Sursee 4 / 68
5 Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeine Angaben zum Projekt Initiative Projektorganisation Projektorganisation während der Erarbeitung des Projekts Landschaftsqualität Zentralschweiz Projektorganisation im vorliegenden Landschaftsqualitätsprojekt Sursee Projektperimeter Sursee Projektablauf und Beteiligungsverfahren Beteiligung in Form von kantonalen Arbeitsgruppen Grad der Beteiligung Landschaftsanalyse Grundlagen Analyse Beschreibung der Landschaftstypen: Landschaftsvision und Landschaftsziele Massnahmen und Umsetzungsziele Massnahmenkonzept und Beitragsverteilung Massnahmenkonzept Beitragsverteilung und Umsetzungsziele Kosten und Finanzierung Planung und Umsetzung Umsetzungskontrolle, Evaluation Anhang LQ-Projekt Perimeter Sursee 5 / 68
6 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Überblick über die Projektorganisation während der Erarbeitung des Projekts Landschaftsqualität Zentralschweiz Abbildung 2: LQ-Projektperimeter Sursee mit Landschaftstypen Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Übersicht wichtiger Kennzahlen zum Projektperimeter Sursee mit prozentualem Anteil am gesamten Kanton Tabelle 2: Übersicht der Massnahmen mit den zugehörigen Landschaftszielen. Die Massnahmen sind den Landschaftstypen des Projektperimeters zugeteilt Tabelle 3: Schätzung der Kosten, die im Zusammenhang mit dem vorliegenden LQ-Projekt anfallen Tabelle 4: Planungs- und Umsetzungsschritte der ersten LQ-Projektphase bis Tabelle 5: Kürzungen bei unvollständiger oder Nicht-Erfüllung der Voraussetzungen und Auflagen Zusatztabelle 6: Quantitative Schätzung der Umsetzungsziele und Kosten der LQ-Massnahmen im vorliegenden Perimeter für die Jahre 2014, 2017 und LQ-Projekt Perimeter Sursee 6 / 68
7 1 Allgemeine Angaben zum Projekt 1.1 Initiative Die Zentralschweizer Fraktion der Konferenz der Landwirtschaftsämter der Schweiz (KOLAS-Z bestehend aus den Kantonen Luzern, Ob- und Nidwalden, Uri, Schwyz und Zug) hat im Herbst 2012 beschlossen, die Erarbeitung der Landschaftsqualitäts-Projekte gemeinsam anzugehen. Grundlage für diesen Entscheid war die Feststellung, dass in den Zentralschweizer Kantonen ähnliche Landschaften vorherrschen und sich einheitliche Landschaftsräume oft über die Kantonsgrenzen hinweg ausdehnen. Unter diesen Voraussetzungen erschien es sinnvoll, ein gemeinsames Grundgerüst für die Ausarbeitung der Landschaftsqualitätsprojekte zu erarbeiten. Ziel und Zweck bestand darin, die Landschaftsräume, Landschaftsziele, einen Massnahmenkatalog, ein Beitragssystem sowie die Art der Kontrolle und das administrative Vorgehen gemeinsam zu definieren. 1.2 Projektorganisation Projektorganisation während der Erarbeitung des Projekts Landschaftsqualität Zentralschweiz Die KOLAS-Z (Leiter der Landwirtschaftsämter der Zentralschweizer Kantone) wählte Bruno Aeschbacher, Landwirtschaftsamt Kanton Zug, für die Leitung des Projekts Landschaftsqualität Zentralschweiz. Es wurde ausserdem eine Begleitgruppe bestimmt, welche aus je einem Vertreter pro Kanton (entweder aus der Landwirtschaft oder Fachstelle Naturschutz) und einem Bauernverband-Vertreter besteht. Neben dieser Begleitgruppe wurden kantonale Arbeitsgruppen gebildet und in den Erarbeitungsprozess mit einbezogen. Abbildung 1 gibt einen Überblick über die Projektorganisation, welche nachfolgend genauer beschrieben wird. Abbildung 1: Überblick über die Projektorganisation während der Erarbeitung des Projekts Landschaftsqualität Zentralschweiz. LQ-Projekt Perimeter Sursee 7 / 68
8 Die KOLAS-Z hat während des Erarbeitungsprozesses verschiedene Aufgaben wahrgenommen. Dazu gehörten zu Beginn die Wahl des Projektleiters und der Begleitgruppe sowie die Beauftragung des externen Büros Agrofutura AG für das Coaching der Begleitgruppe. Danach war sie zuständig für die Information der Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz Zentralschweiz (VDK-Z) und die Kommunikation in der Öffentlichkeit. Ausserdem entschied sie über die Ausscheidung der Projektperimeter, die Typologie der Landschaftsräume, die Landschaftsziele, die Massnahmenblätter, das Beitragssystem bzw. einen Beitrag pro Massnahme, über ein Kontrollsystem und ein Kürzungsschema sowie über die Grundzüge der administrativen Umsetzung. Der Projektleiter, Bruno Aeschbacher, führte die Begleitgruppe und die Zusammenarbeit mit dem externen Büro Agrofutura AG und sorgte für die Einhaltung des Terminplans und den Informationsfluss zu den kantonalen Landwirtschaftsämtern sowie den kantonalen Arbeitsgruppen. Er erstattete der KOLAS-Z regelmässig Bericht und holte von ihr die nötigen Entscheide ein. Die Begleitgruppe ist aus folgenden Vertretern der beteiligten Kantone zusammengesetzt: ZG: Bruno Aeschbacher (Landwirtschaftsamt) -> Projektleiter LU: Franz Stadelmann (lawa) NW: Felix Omlin (Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz) OW: Niklaus Ettlin (Amt Landwirtschaft und Umwelt) SZ: Armin Meyer (Amt für Landwirtschaft) UR: Thomas Ziegler (Fachstelle Natur- und Heimatschutz) Zentralschweizer Bauernbund: Franz Philipp Die Begleitgruppe erarbeitete zusammen mit dem externen Büro Agrofutura AG und in regelmässigem Austausch mit den Kantonalen Arbeitsgruppen folgende Themen: Abgrenzung und Beschreibung von Landschaftstypen und -zielen Massnahmenkatalog: detaillierte Beschreibung und Anforderungen jeder Massnahme Beitragskonzept, bzw. Beitrag pro Massnahme Überlegungen zur Kontrolle Grundzüge der administrativen Umsetzung Das externe Büro unterstützte die Arbeiten in der Begleitgruppe, stellte den Wissenstransfer aus den Landschaftsqualitäts-Pilotprojekten sicher und erbrachte die fachliche Unterstützung. Ausserdem war das externe Büro zuständig für die Aufarbeitung der Vorschläge aus Begleitgruppe, sowie die detaillierte Beschreibung der Massnahmen und die Herleitung der Beiträge pro Massnahme. Schliesslich fasste das externe Büro die Unterlagen zu einem Bericht zusammen, der als Vorlage für die definitive Erarbeitung der einzelnen LQ-Projekte in den Kantonen dient. Jolanda Krummenacher, Michael Ryf, Manfred Lüthy und Severin Dietschi haben an diesem Auftrag mitgearbeitet. Die kantonalen Landwirtschaftsämter waren zuständig für die Bestimmung und die Führung der kantonalen Arbeitsgruppen, sorgten für den Einbezug der Öffentlichkeit und die Information der Landwirte im Rahmen der Vorgaben der KOLAS-Z. Sie erarbeiteten die rechtlichen Grundlagen für die Umsetzung von Landschaftsqualitäts-Projekten, veranlassten, dass die nötigen Finanzmittel bereitgestellt wurden (sowohl für die Erarbeitung als auch für die Umsetzung von Landschaftsqualitätsprojekten), schafften die Voraussetzungen für die Administration der Landschaftsqualitäts- Projekte und der Landschaftsqualitäts-Beiträge, definierten die Projektperimeter, bauten die Trägerschaften für die Landschaftsqualitätsprojekte auf und reichten die Landschaftsqualitätsprojekte beim BLW (Bundesamt für Landwirtschaft) ein. Die kantonalen Arbeitsgruppen arbeiteten die vorhandenen Grundlagen auf und ergänzten diese falls notwendig. Sie waren in regelmässigem Austausch mit dem Begleitgruppenvertreter bei der Erarbeitung der Landschaftstypen, der Landschaftsziele und wurden bei der Auswahl und Beschreibung der Massnahmen mit einbezogen. Dabei konnten die Vertreter der relevanten Akteure zu den Vorschlägen der Begleitgruppe Stellung nehmen und brachten eigene Anliegen ein. Die LQ-Projekt Perimeter Sursee 8 / 68
9 kantonalen Arbeitsgruppen dokumentierten ihre Arbeiten und stellten sie für die weitere Bearbeitung der Begleitgruppe zur Verfügung. Der Lead bei der Erarbeitung der Landschaftsqualität-Projekte in der Zentralschweiz liegt klar bei der Landwirtschaft. Trotzdem war es ein Anliegen, sich mit den kantonalen Fachstelen für Naturund Landschaftsschutz auszutauschen. Dies wurde einerseits durch die Zusammensetzung der Begleitgruppe mit zwei Vertretern des Naturschutzes und andererseits durch eine Sitzung mit den Amtsleitern der kantonalen Fachstellen Naturschutz (KBNL-Z) sichergestellt. Von den ursprünglich über 80 Massnahmen-Ideen aus den kantonalen Arbeitsgruppen wurden 45 für die weitere Präzisierung ausgewählt. 24 davon wurden für die definitive Ausarbeitung priorisiert (Anforderungen, Details zur Umsetzung und Herleitung des Beitrags). Die zurückgestellten ca. 20 Massnahmen werden im Jahr 2014 von der Begleitgruppe in Zusammenarbeit mit den kantonalen Arbeitsgruppen weiter bearbeitet. Die Projektorganisation auf Stufe Zentralschweiz bleibt auch im Jahr 2014 bestehen Projektorganisation im vorliegenden Landschaftsqualitätsprojekt Sursee Trägerschaft Für die Projekteinreichung übernimmt der Kanton Luzern die Rolle der Trägerschaft. Spätestens ab dem 2. Projektjahr wird für den Projektperimeter Sursee unter der Leitung des Kantons eine regionale Trägerschaft aufgebaut, welche die Verantwortung über die Umsetzung des Projektes übernimmt. Mögliche regionale Trägerschaften sind insbesondere der Regionale Entwicklungsträger Region Sursee Mittelland und der Luzerner Bäuerinnen und Bauernverband. Hierbei wird versucht die vorhandenen Synergien bestmöglich zu nutzen um die gemeinsame Basis für die Übergabe der Trägerschaft zu gewährleisten. Die kantonale Trägerschaft setzt sich für die Startphase aus der Landschaftsfachperson (Rebecca Stecher) und einem Projektleiter zusammen. Die Landschaftsfachperson pflegt einen regelmässigen Informationsaustausch mit der Abteilung Natur, Jagd und Fischerei (NJF) der Dienststelle Landwirtschaft und Wald (lawa) und der Abteilung Raumentwicklung der Dienststelle für Raum und Wirtschaft (rawi). Der Projektleiter, resp. Perimeterverantwortliche, ist ein Mitarbeiter des Fachbereichs Natürliche Ressourcen der Abteilung Landwirtschaft, lawa. Aufgabe des Projektleiters ist es die Landschaftsqualitätsprojekte in den Regionen zu starten. Gleichzeitig zeichnet er sich verantwortlich, dass zukünftig Synergien zwischen den LQB Massnahmen und den BFF-Elementen, im Besonderen der Vernetzung geschaffen werden. Der kantonalen Trägerschaft steht eine Begleitgruppe zur Seite, welche aus der aktuellen Arbeitsgruppe rekrutiert wird. Dabei setzt sich die Begleitgruppe aus Vertretern von kantonalen Fachstellen, regionalen Vereinen, Vernetzungsprojekten und Landwirten zusammen und soll einen möglichst reibungslosen Übergang der Projekte an regionale Trägerschaften ermöglichen. Lawa stellt die Koordination zwischen den unterschiedlichen Förderprojekten sicher. Insbesondere die einmaligen LQ-Massnahmen auf Gesuch sind auf Doppelzahlungen zu prüfen. Durch die Zirkulation dieser Gesuche innerhalb der zuständigen Dienststellen und Fachbereichen (Landwirtschaft, NJF und Wald) werden Doppelfinanzierungen zwischen anderen Projekten und den LQ- Massnahmen ausgeschlossen. Folgende LQ-Massnahmen sind hinsichtlich einer Doppelfinanzierung mit besonderer Sorgfalt zu behandeln: Naturnahe Kleingewässer, Heckenaufwertungen, Offenhaltung/Entbuschungen, Baumpflanzungen, Instandhaltung Bewirtschaftungswege. Eine zusätzliche Massnahme um Doppelfinanzierungen bei Baumpflanzungen entgegenzuwirken, ist die bei einer Kontrolle vorzuweisende Kaufquittung. Bewirtschafter Die Landwirte melden sich für die Massnahmen der Landschaftsqualität im Rahmen der Strukturdatenerhebung an. Sie bestätigen die Einhaltung der Grundanforderungen für LQ-Beiträge und wählen zusätzlich die LQ-Massnahmen auf ihrem Betrieb aus. Die Auszahlung der entsprechenden Abgeltungen erfolgt mit den Direktzahlungen, wobei nur Bewirtschafter, welche die Grundanforderungen gemäss DZV erfüllen beitragsberechtigt sind. LQ-Projekt Perimeter Sursee 9 / 68
10 1.3 Projektperimeter Sursee Im Folgenden wird der Projektperimeter mit wichtigen Kennzahlen (kantonale Daten: Stand 2013; Daten BFS: Stand 2012) beschrieben. Die Daten zur Fläche der Projektperimeter sind vom Luzerner Geodaten Katalog (LUCAT). Die Daten zur Bevölkerung und zu den Nutztierbeständen sind vom Bundesamt für Statistik. Die Angaben zur Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe, zur bewirtschafteten Landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN), zu den Normalstössen (NST) der Sömmerungsgebiete, zur Anzahl Hochstammobstbäume, Anzahl Hecken und zur offenen Ackerfläche sind dem Landwirtschaftlichen Informationssystem (Lawis) entnommen. Das Projektgebiet Sursee umfasst eine Fläche von 280 km 2. Das Gebiet weist zwei der sechs Landschaftstypen des Kantons Luzern auf. Vorwiegend ist es geprägt von der Moränenlandschaft des Mittellandes. Im nördlichen Teil befindet sich zudem der Landschaftstyp stark geformte Hügellandschaft. Abbildung 2: LQ-Projektperimeter Sursee mit Landschaftstypen. LQ-Projekt Perimeter Sursee 10 / 68
11 Der Ausstrahlungsbereich der Metropolregion Zürich und der Hauptstadtregion Bern umfassen gleichermassen den Projektperimeter Sursee. Ein Schwerpunkt der Region liegt deshalb bei der Stärkung der regionalen ÖV-Politik. Neben dem öffentlichen Verkehr wird auch die regionale Wirtschaft gefördert, indem verschiedenste Netzwerke weiter ausgebaut werden. Ein weiterer Schwerpunkt der Region liegt beim Freizeit- und Agrotourismus, dessen Potenzial verstärkt ausgeschöpft werden soll. Tabelle 1: Übersicht wichtiger Kennzahlen zum Projektperimeter Sursee mit prozentualem Anteil am gesamten Kanton. Landwirtschaftliche Kennzahlen absolut relativ Fläche Projektgebiet [ha] 28' % Ständige Wohnbevölkerung [Anz. Pers.] 65' % Anz. Ganzjahresbetriebe 1' % Anz. Sömmerungsbetriebe 0 0 % bewirtschaftete LN [ha] 18' % NST der Sömmerungsgebiete 0 0 % Anz. Rinder der Betriebe 35' % Anz. Schweine der Betriebe 149' % Anz. Ziegen und Schafe der Betriebe 4' % Anzahl Hochstamm-Obstbäume auf LN 78' % Fläche Hecken auf LN [a] 13' % Offene Ackerfläche [a] 560' % Eine detaillierte Beschreibung der Landschaftstypen des Projektperimeters Sursee befindet sich unter Kapitel 4. LQ-Projekt Perimeter Sursee 11 / 68
12 2 Projektablauf und Beteiligungsverfahren 2.1 Beteiligung in Form von kantonalen Arbeitsgruppen Um den Ansprüchen der Bevölkerung und den regionalen Besonderheiten im Bereich Landschaftsqualität Rechnung zu tragen, wurden im Zentralschweizer LQ-Projekt kantonale Arbeitsgruppen geschaffen. In der Arbeitsgruppe Luzern waren insgesamt 11 Personen vertreten: Landwirtinnen und Landwirte: Alle Landwirte der Arbeitsgruppe nehmen an einem Vernetzungsprojekt teil und halten teilweise noch die Funktion eines Landwirtschaftsbeauftragten inne. Die Landwirte haben Anliegen aus ihrem beruflichen wie auch sozialen Umfeld aufgenommen und in die Arbeitsgruppe eingebracht. Die Auswahl der Landwirte erfolgte in Absprache mit dem Luzerner Bäuerinnen und Bauernverband (LBV). Simon Küng Landwirt aus Ruswil, Projektperimeter Sursee. Simon Küng führt einen für die Projektgebiete Sursee, Willisau und Hochdorf grossen aber relativ typischen Betrieb mit einer Fläche von 32 ha, rund 50 Mutterkühen und 280 Mastschweinen. Der Anteil des ökologischen Ausgleichs an der LN ist mit rund 14 % hoch. André Zemp Landwirt aus Eschenbach, Projektperimeter Hochdorf. André Zemp führt einen eher kleinen Talbetrieb mit einer Fläche von 12 ha. Er betreibt vor allem Rindermast mit rund 50 Tieren und hält 13'500 Mastpoulets in einer Tierhaltungsgemeinschaft. Der Anteil des ökologischen Ausgleichs an der LN ist mit 47 % sehr hoch. Pius Schmid Landwirt aus Flühli, Projektperimeter Entlebuch. Pius Schmid führt einen Ganzjahresbetrieb und einen Sömmerungsbetrieb. Die Fläche des Ganzjahresbetriebes ist mit 45 ha sehr gross. Der Anteil des ökologischen Ausgleichs an der LN ist mit rund 24 % hoch. Die Bestossung seiner Alp, wo er einen Teil seiner Mutterkühe und Rinder sömmert, beträgt 29.5 Stösse. Er bringt insbesondere die Anliegen der Landwirte im Berg- und Alpgebiet in die Projekte Landschaftsqualität ein. Pius Schmid ist zudem Landwirtschaftsbeauftragter der Gemeinde Flühli. Personen aus der landwirtschaftlichen Beratung: Alois Blum Berater des BBZN Schüpfheim. Sein Spezialgebiet ist die Biodiversität. Insbesondere berät er Landwirte bei der Neuansaat von Blumenwiesen, beim Punktesystem IP-Suisse, beim Eintritt in Vernetzungsprojekte oder bei einer gesamtbetrieblichen ökologischen Optimierung. Isabelle Falconi Lehrerin und Beraterin am BBZN Hohenrain. Ihre Spezialgebiete sind Ackerbau, Ökologie und Biodiversität. Vertreter/innen der Naturschutzorganisationen: Samuel Ehrenbold Geschäftsführer Pro Natura Luzern Andrea Klieber (Stv.) Fachmitarbeiterin Geschäftsstelle Projekte Vertreter/innen der betroffenen Fachstellen des Kantons: Franz Stadelmann Leiter der Arbeitsgruppe Landschaftsqualität Luzern und Fachleiter Natürliche Ressourcen, Abteilung Landwirtschaft (lawa). LQ-Projekt Perimeter Sursee 12 / 68
13 Otto Barmettler Mitarbeiter des Fachbereichs Natürliche Ressourcen (lawa), Fachperson Vernetzungsprojekte und Projektleiter Biodiversität Region Entlebuch. Rebecca Stecher Mitarbeiterin des Fachbereichs Natürliche Ressourcen (lawa), Fachperson Landschaftsqualität und Projektleiterin Biodiversität Region Sursee. Peter Kull Fachleiter Lebensräume, Abteilung Natur, Jagd und Fischerei (lawa). Ueli Frey Fachleiter Waldbiodiversität, Abteilung Wald (lawa). Damit wurde der Austausch von vorhandenem Wissen, Erfahrungen und Erwartungen unterschiedlicher Akteure während der ganzen Erarbeitung des Projekts sichergestellt. Die kantonalen Arbeitsgruppen trafen sich ca. alle 6 Wochen zu Sitzungen, die vom Begleitgruppenmitglied moderiert und geleitet wurden. Die Ergebnisse und Änderungsvorschläge aus den Sitzungen der kantonalen Arbeitsgruppen wurden via Begleitgruppenmitglieder in die KOLAS-Z Begleitgruppe eingebracht. Unter Berücksichtigung der Anliegen und Wünsche der kantonalen Arbeitsgruppen arbeitete die Begleitgruppe an den Dokumenten weiter und spielte diese zur Vernehmlassung an die kantonalen Arbeitsgruppen zurück. Dieser Prozess stellte den laufenden Austausch zwischen der Basis und der KOLAS-Z sicher (Bottom-up). Die Beteiligung der verschiedenen Akteure über die kantonalen Arbeitsgruppen erfolgte in folgender Intensität: Information: Ab Januar 2013 wurden die kantonalen Arbeitsgruppen von der KOLAS-Z via Begleitgruppenmitglied über die Ziele, Organisation und die Möglichkeit der Mitwirkung im Zentralschweizer LQ- Projekt informiert. Konsultation/Mitwirkung: In den Treffen der kantonalen Arbeitsgruppen wurden die von der Begleitgruppe erarbeiteten Dokumente (insbesondere Landschaftstypen, -ziele, Massnahmen und Beiträge) vorgestellt und zusammen mit den Vertretern der Arbeitsgruppen diskutiert und entsprechend deren Erwartungen, Wünschen und Bedürfnissen angepasst. Damit erhielten die relevanten Akteure die Gelegenheit, zu den Zielen und Massnahmen Stellung zu nehmen und diese aktiv mitzugestalten. Information der Landwirte in den Projektperimetern: Die Abteilung Landwirtschaft hat Ende November 2013 fünf Informationsveranstaltungen zur AP in den 5 Projektperimetern durchgeführt. Über 2'000 Bäuerinnen und Bauern haben diese Informationsveranstaltungen besucht. An diesen Veranstaltungen wurde auch über die Grundlagen der Landschaftsqualitätsprojekte informiert. Zusätzlich wurde an der Fachmesse Suisse-Tier vom 22. bis 24. November 2013 ein Informationsstand mit zusätzlichen Angaben zu den LQ- Beiträgen betreut. Dieser Informationsstand führte zu einem regen Austausch mit interessierten Landwirten wie auch anderen Personen. Die detaillierte Information für die Landwirte erfolgt nach Einreichung und Genehmigung des Projektes durch das BLW. Diese Informationen dienen den Landwirten als Grundlage für die Anmeldung einzelner Massnahmen bei der Strukturdatenerhebung anfangs Mai. 2.2 Grad der Beteiligung Um den qualitativen Fragen der Landschaftsentwicklung Rechnung zu tragen ist eine Beteiligung der Akteure und der Bevölkerung notwendig. Die oben beschriebene Beteiligung über die kantonalen Arbeitsgruppen kann als Stellvertreterprinzip angesehen werden. Im Kapitel 3 werden Grundlagen aufgeführt, die Aussagen betreffend Landschaftsentwicklung und -ziele enthalten. Diese stützen sich auf mehr oder weniger breit angelegte Beteiligungsverfahren. Bei der Erarbeitung der LQ-Projekt Perimeter Sursee 13 / 68
14 Landschaftsziele und den daraus abgeleiteten Massnahmen wurden die Aussagen über Zielvorstellungen aus diesen Beteiligungsverfahren berücksichtigt. Aus diesem Grund wurde im Zentralschweizer LQ-Projekt auf ein zusätzliches, breit abgestütztes Beteiligungsverfahren mit der ganzen Bevölkerung verzichtet. LQ-Projekt Perimeter Sursee 14 / 68
15 3 Landschaftsanalyse 3.1 Grundlagen Bei der Erarbeitung des Projekts Landschaftsqualität Zentralschweiz haben die 6 beteiligten Kantone ihre bestehenden Grundlagen zum Thema Landschaft gesichtet und analysiert. Die darin enthaltenen Beschreibungen der Landschaft inkl. der regionsspezifischen Besonderheiten, sowie die konsultativ erarbeiteten Konzepte mit den daraus resultierenden regionalen Landschaftszielen wurden mitberücksichtigt. Ausserdem wurden mit dieser Analyse die Möglichkeiten betreffend Koordination des Landschaftsqualitätsprojekts mit anderen laufenden Projekten erfasst und geprüft (insbesondere mit Vernetzungsprojekten). Die für die Landschaftsentwicklung des Projektgebietes relevanten Grundlagen, Konzepte und Pläne sind im Folgenden pro Kanton zusammengestellt und wurden in der Erarbeitung der Landschaftstypen und ziele berücksichtigt. Aussagen über die Mitwirkung, die im Rahmen der aufgeführten Grundlagen durchgeführt wurden, sind grau hinterlegt. Kanton Luzern: Gesetzliche Grundlagen und Inventare Internationale und nationale Ebene Mitwirkung: Die Festlegung der Inventare von nationaler Bedeutung erfolgt in der Regel zusammen mit den Behörden (Kanton, Gemeinden) jedoch ohne die Mitwirkung der betroffenen Bewirtschafter und Eigentümer Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) (VBLN SR vom 10. August 1977, Stand am 1. Juli 2010) o 1318 Wauwilermoos - Hagimoos - Mauensee Projekt Neubeschreibung BLN (in Bearbeitung) Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung (IANB) (Amphibienlaichgebiete-Verordnung; AlgV SR vom 15. Juni 2011, Stand am 1. Februar 2010) o 124 ha Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) (Art. 5 NHG SR 451 vom 1. Juli 1966, Stand am 1. Juni 2013) o 9 Objekte Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) (VIVS SR vom 14. April 2010, Stand am 1. Juli 2010) Regionale und lokale Ebene Kantonaler Richtplan o Kantonaler Richtplan 2009 LQ-Projekt Perimeter Sursee 15 / 68
16 Der kantonale Richtplan ist ein wichtiges, behördenverbindliches Führungs- und Koordinationsinstrument für den Kantonsrat sowie die Regierung und entfaltet auch Wirkung auf die Regionen und die Gemeinden. Er zeigt die künftige räumliche Entwicklung des ganzen Kantons auf in den Themenbereichen Raumstruktur, Siedlung, Mobilität, Landschaft sowie Ver- und Entsorgung und besteht aus einem Richtplantext sowie der Richtplankarte. Eine Hauptaufgabe des Richtplanes ist es ökologisch und landschaftlich wertvolle Gebiete zu erhalten und aufzuwerten. Mitwirkung: Die Überarbeitung und Anpassung des kantonalen Richtplans erfolgt in Rücksprache mit den Gemeinden sowie mit den regionalen Entwicklungsträgern. Im Weiteren ist der Entwurf öffentlich aufgelegt, was die Mitsprache jedes einzelnen Bürgers ermöglicht. Kantonale Schutzverordnungen Mitwirkung: Die kantonalen Schutzverordnungen werden unter Einbezug aller interessierten Kreise partizipativ erarbeitet. Die erarbeitete Verordnung wird anschliessend öffentlich aufgelegt, was die Mitsprache jedes einzelnen Bürgers ermöglicht. Auch besteht nach Verabschiedung durch den Regierungsrat eine Beschwerdemöglichkeit. o Verordnung zum Schutz der Weiherlandschaft Ostergau in den Gemeinden Willisau und Grosswangen vom 15. Februar 2011 (SRL 713) o Verordnung zum Schutz der Weiherlandschaft Hagimoos in den Gemeinden Ettiswil und Mauensee vom 10. Juni 2003 (SRL 71b) o Verordnung zum Schutz des Mauensees und seiner Ufer vom 28. Mai 1962 (SRL 711b) o Verordnung zum Schutz des Sempachersees und seiner Ufer vom 14. Februar 2003 (SRL 711c) o Verordnung zum Schutz des Soppensees und seiner Umgebung vom 12. Juli 1968 (SRL 711e) Kantonale Massnahmenschwerpunkte Natur und Landschaft. Die 12 Landschaften des Kantons Luzern Inventar der Naturobjekte von regionaler Bedeutung (INR) o 69 Objekte Kommunale Schutzverordnungen Mitwirkung: Die kommunalen Schutzverordnungen werden unter Einbezug aller interessierten Kreise partizipativ erarbeitet. Die erarbeitete Verordnung wird anschliessend öffentlich aufgelegt, was die Mitsprache jedes einzelnen Bürgers ermöglicht. Auch besteht nach Verabschiedung durch die Gemeinde eine Beschwerdemöglichkeit. Nutzungspläne der Gemeinden Mitwirkung: Die Nutzungspläne werden unter Einbezug der interessierten Kreise partizipativ erarbeitet. Die kantonale Vorprüfung stellt sicher, dass die kommunalen Planungen mit den übergeordneten Vorgaben übereinstimmen. Die erarbeiteten Pläne werden anschliessend öffentlich aufgelegt, was die Mitsprache jedes einzelnen Bürgers ermöglicht. Naturschutzleitpläne der Gemeinden Mitwirkung: Die Naturschutzleitpläne werden unter Einbezug der interessierten Kreise partizipativ erarbeitet. Die erarbeiteten Pläne werden anschliessend öffentlich aufgelegt, was die Mitsprache jedes einzelnen Bürgers ermöglicht. LQ-Projekt Perimeter Sursee 16 / 68
17 Vernetzungsprojekte Mitwirkung: Die Perimeter der Vernetzungsprojekte decken in der Regel eine oder mehrere Gemeinden ab. Die Trägerschaft von Vernetzungsprojekten setzt sich aus Vertretern der Behörde, der Landwirtschaft, des Naturschutzes, der Forstwirtschaft, der Jagd und weiteren interessierten Kreisen zusammen. Die Trägerschaft ist zusammen mit einem Ökobüro für die Ausarbeitung des Projektes zuständig, wobei eine kantonale Überprüfung das Einhalten der übergeordneten Vorgaben sicherstellt. Im Weiteren begleitet die Trägerschaft die Vernetzungsprojekte bei der Umsetzung und Weiterentwicklung. Regionale Entwicklungspläne (REP) o REP Region Sursee-Mittelland Der Regionale Entwicklungsplan der Region Sursee-Mittelland entwickelt seine Ziele für den Grossteil des Projektperimeters Sursee. Mitwirkung: Die Regionalen Entwicklungspläne werden mit Delegierten von mehreren Gemeinden einer bestimmten Region ausgearbeitet. Die Vertretung der Interessen der Mitgliedsgemeinden wird durch die Verbandsleitung und die Arbeitsgruppenmitglieder gesichert. Aus den vorhandenen Grundlagen des Projektperimeters Sursee (siehe oben) wurden sämtliche landschaftsrelevanten Ziele für die Erarbeitung der Landschaftsziele in den einzelnen Landschaftstypen berücksichtigt und soweit als möglich übernommen bzw. wo nötig verallgemeinert. 3.2 Analyse Die oben dargestellten Grundlagen wurden in der kantonalen Arbeitsgruppe und in der Begleitgruppe gesichtet und analysiert. Insbesondere die Vertreter interessierter Kreise erhielten damit die Möglichkeit folgende Themen zu diskutieren: IST-Zustand der Landschaft: Qualitäten: berühmte Seenlandschaft im Zentrum der Schweiz; Feuchtbiotope; Vernetzungsfunktionen der Lebensräume; historische Verkehrswege; Moränenlandschaft mit vielfältigen natürlichen und naturnahen Lebensräumen mit Bächen, Seen, Wäldern, Wiesen und Weiden; traditionell bewirtschaftete Kulturlandschaft mit vielen Strukturen wie Hecken, Feldgehölze, alleinstehenden Bäume. Defizite/Mängel: Siedlungsdruck durch attraktive Lage zwischen Luzern, Zürich und Bern; tendenziell ausgeräumte Landschaft entlang von Siedlungsachsen; intensive Nutzung bis an die Siedlungsgrenze; Defizit landschaftlicher Strukturen an Siedlungsachsen. Interessenkonflikte: Landwirtschaft-Siedlung; Landwirtschaft-Natur- und Landschaftsschutz; Gewässerraum-Landwirtschaft. Wertvorstellungen: die standortgerechte landwirtschaftliche Nutzung wird als wertvoll betrachtet; die prägende Seelandschaft hat einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert. Soll-Zustand der Landschaft: Wünsche/Anliegen: die vielfältige Landschaft soll erhalten bleiben; die Mehrarbeit in strukturreichen Landschaften ist abzugelten; das Projekt Landschaftsqualität soll sich weiterentwickeln können. Erwartungen: Dynamik der Entwicklung der Landschaft muss möglich bleiben; kein starres System. Bedürfnisse: die Bedürfnisse der Landwirtschaft sind in den Betrachtungen zu berücksichtigen; ohne die Landwirtschaft verliert die Landschaft. LQ-Projekt Perimeter Sursee 17 / 68
18 Visionen: die standortgerechte landwirtschaftliche Nutzung und die attraktive Landschaft kann erhalten und punktuell aufgewertet werden. Die Mitglieder der kantonalen Arbeitsgruppen decken ein breites Spektrum an Interessen und Bedürfnissen ab. Die Zusammensetzung der Interessensvertreter in den kantonalen Arbeitsgruppen sind im Abschnitt 2.1. aufgelistet. Die kantonalen Arbeitsgruppen und die Begleitgruppe fassten die Grundlagen (materielle und Wahrnehmungsdimension) zusammen und erarbeiteten daraus zehn Landschaftstypen mit entsprechenden Landschaftszielen. Auf eine eigene, ausführliche Landschaftsanalyse wurde in diesem Projekt verzichtet, da die landschaftsrelevanten Grundlagen direkt in die Beschreibung der Landschaftstypen und deren Landschaftsziele einflossen. Im folgenden Kapitel 4 sind die unterschiedlichen Landschaftstypen beschrieben. Für den Projektperimeter Sursee sind lediglich die Landschaftstypen 3 Moränenlandschaft des Mittellandes und 4 Stark geformte Hügellandschaft relevant. Aus dem IST- und SOLL-Zustand ergeben sich Landschaftsziele, welche im folgenden Kapitel 4 in den unterschiedlichen Landschaftstypen als Wirkungsziele aufgeführt sind. LQ-Projekt Perimeter Sursee 18 / 68
19 4 Beschreibung der Landschaftstypen: Landschaftsvision und Landschaftsziele Die Einteilung der unterschiedlichen Landschaftstypen basiert im Wesentlichen auf der Grundlage der Landschaftstypologie der Schweiz (Bundesamt für Raumentwicklung (ARE), 2011). Mehrere ARE-Landschaftstypen wurden aufgrund ihrer Ähnlichkeiten zu einem LQ-Landschaftstyp zusammengefasst. Die Landschaftstypen werden nicht an politische Einheiten gebunden, sondern dehnen sich überkantonal entlang ihrer landschaftlichen Charakteristik aus. Das Sömmerungsgebiet wird nicht als eigener Landschaftstyp geführt, sondern wird als überlagernde Nutzung in den Landschaftstypen geführt. Die Beschreibung der Landschaftstypen erfolgt entlang folgender Aspekte: Allgemeine Beschreibung Merkmale Topographie Siedlung und Infrastruktur Landwirtschaft Vegetation und Landschaftsstruktur Landschaftsziele Leitsatz/Vision Wirkungsziele Die Leitsätze, Visionen und Landschaftsziele sind auf die Grundlagenanalyse (siehe Abschnitt 3.1/3.2) abgestützt und beschreiben eine ideale Landschaftsentwicklung. Für die Erarbeitung der Landschaftsziele und deren Entwicklungspotential wurden die in der Analyse festgestellten Stärken und Defizite berücksichtigt und in einem mehrfachen Vernehmlassungsverfahren zwischen den kantonalen Arbeitsgruppen und der Begleitgruppe verabschiedet. In der Zentralschweiz wurden folgende 10 Landschaftstypen unterschieden: 1. Siedlungsgebiet 2. Flusslandschaft 3. Moränenlandschaft des Mittellandes 4. Stark geformte Hügellandschaft 5. Berglandschaft des Mittellandes 6. Moorgeprägte Landschaft 7. Tallandschaft der Nordalpen 8. Berglandschaft der Nordalpen 9. Urserntal 10. Alpenlandschaft Im Kanton Luzern kommen insgesamt sechs der 10 Landschaftstypen vor. Nachfolgend werden die Landschaftstypen des Projektperimeters Sursee beschrieben. LQ-Projekt Perimeter Sursee 19 / 68
20 Landschaftstyp 3: Moränenlandschaft des Mittellandes Beschreibung Landschaftstypologie Schweiz, BAFU, Typ 8, 10 und 13: Hügellandschaft des Mittellandes mit Dörfern und Weilern, die landwirtschaftlich vorwiegend für den Futterbau und regional für Obstbau genutzt wird. Vor allem in Agglomerationsnähe findet eine starke, teilweise zerstreute Siedlungsausdehnung statt. Die intensive landwirtschaftliche Nutzung der ehemaligen Schwemm- und Schotterebenen ist durch grossflächige Gewässerkorrektionen und Meliorationen ermöglicht worden. Der Waldanteil ist gering, ebenso der Anteil naturnaher Flächen. Die für die Tallandschaft charakteristischen Flüsse sind meist begradigt und wenig naturnah. Katalog Kulturlandschaften, Stiftung LS: Graslandschaft mit Hecke und Einzelbäumen, Cham Obstwiesenlandschaften (S. 18), Agrarlandschaften mit hoher Struktur- und Nutzungsvielfalt (S. 24), Agrarlandschaften mit grossräumig einheitlichen Nutzungsmustern (S. 26), Siedlungslandschaften des ländlichen Raumes (S. 41) Merkmale Topographie: Die klar erkennbaren Schotter- und Schwemmflächen mit geringer Hangneigung (Talebenen) heben sich von den angrenzenden Flanken der Hügelzüge ab. Diese weitläufige, vielfältige Tal- und Hügellandschaft mit glazialen Formen ist für die Zentralschweiz von ausgeprägtem Charakter. Siedlung und Infrastruktur: Verbreitet sind Dörfer verschiedener Strukturformen wie Haufenoder Reihendörfer und Weiler. Der Anteil an Bauten ausserhalb der Bauzone ist relativ gross. Angrenzend an Agglomerationen findet eine zerstreute Siedlungsausdehnung statt. Landwirtschaft: LU: Dominierende Produktionsformen: Futterbau, Ackerbau, Milchproduktion, Mutterkuhhaltung, Hochstamm-Obstbau und Schweinehaltung Intensität der Landwirtschaft: intensiv Landwirtschaftliche Besonderheiten: meist sehr hohe Diversifizierung der Betriebe Vorhandene Landschaftseinheiten: Wiesen, Weiden, Hochstamm-Obstgärten, offenes Ackerland Landschaftstypische Merkmale: sehr grosse Strukturvielfalt, Nutzungsmosaik Vegetation und Landschaftsstruktur: Aufgrund der glazialen Formenvielfalt und der mosaikartigen Landnutzung ergibt sich eine sehr abwechslungsreiche Landschaft. An grösseren Rücken (Lindenberg) oder in Grundmoränengebieten mit Drumlins ist die Fliessrichtung der letzten Vergletscherung noch erkennbar. Prägende anthropogene, lineare und geometrische Elemente sind begradigte Gewässerläufe und Entwässerungen, Verkehrsinfrastrukturen aller Kategorien, dichtes landwirtschaftliches Erschliessungsnetz, ausgedehnte Parzellen, grosse, kubische Wirtschaftsgebäude und Silos. LQ-Projekt Perimeter Sursee 20 / 68
21 Landschafts-Ziele Leitsatz, Vision, Landschaftsziel Diese eiszeitlich geprägte, weiträumige Tal- und Hügellandschaft ist in der Zentralschweiz einzigartig. Weiden, Wiesen, Hecken, Hochstamm-Obstbäume, Ackerfelder, offene Gewässer und gestufte Waldränder tragen zur landschaftlichen Vielfalt bei. Die Akteure gestalten die Landschaft bewusst so, dass deren Qualitäten erhalten und verbessert werden. Eine Vielzahl an historischen Wegen erschliesst die Landschaft für Erholungssuchende. Entlang dieser Wege sind landschaftsrelevante Aufwertungen zu fördern. An Siedlungsrändern und entlang der Langsamverkehrswege sollen Massnahmen zur Aufwertungen der Landschaft und Besucherlenkung vorgenommen werden. Wirkungsziele Aus der Landschafts-Vision können folgende Wirkungsziele abgeleitet werden: Hochstamm-Obstgärten als typisches Landschaftselement fördern und aufwerten Markante Einzelbäume in eiszeitlich geprägter Landschaft erhalten und fördern Extensivierung und landschaftsprägende Elemente entlang der Langsamverkehrswege fördern Nutzungsmosaik sowie Strukturvielfalt erhalten und fördern Intensive, ausgeräumte Landschaften mit naturnahen Elemente (Hecken, Blumenwiesen, Säume, ) und mit einer vielfältigen Fruchtfolge bereichern Aufwertung von Gewässerräumen durch naturnahe Gestaltung und extensive landwirtschaftliche Nutzung Erarbeitung und Förderung von Lösungsansätzen zur Reduktion der Konflikte zwischen Landwirtschaft und Erholungsuchenden Das Image der Landwirtschaft im Naherholungsgebiet ist zu fördern (Zugänglichkeit und Besucherlenkung, Direktvermarktung) Förderung einer abwechslungsreichen, vielfältigen Landwirtschaft LQ-Projekt Perimeter Sursee 21 / 68
22 Landschaftstyp 4: Stark geformte Hügellandschaft Beschreibung Landschaftstypologie Schweiz, BAFU, Typ 14: Stark geformte Hügellandschaft des Mittellandes mit Gräben, Eggen und steilen Hängen. Streusiedlungen, abgelegene Einzelhöfe, einzelne Gasthäuser und Ausflugsrestaurants prägen die Siedlungsstruktur. Die Landnutzung bildet ein Mosaik von Wäldern, Wiesen und Weiden. Die Landwirtschaft konzentriert sich insbesondere auf Futterbau und Heimweiden. Katalog Kulturlandschaften, Stiftung LS: Siedlungslandschaften des ländlichen Raumes (S. 41), Mosaiklandschaften mit Wald-Offenland-Muster (S. 53) Ebene durchsetzt mit Hügelzügen, Wauwil Merkmale Topographie: Ausgeprägte Hügel mit Gräben und Eggen oder kleinräumig stark verzweigtes Tal- /Hügelsystem. Stellenweise stark ausgeprägtes und feinmaschiges Gewässernetz. Siedlung und Infrastruktur: Das Siedlungsbild wird geprägt durch Streusiedlungen und allein stehende, zum Teil abgelegene Einzelhöfe; in Tallagen vereinzelt auch Weiler und kleinere Dörfer. An markanten Orten finden sich Gaststätten. Der Anteil an Bauten ausserhalb der Bauzone ist sehr gross. Landwirtschaft: LU: Dominierende Produktionsformen: Gemischte Betriebe mit Futterbaunutzung (Hauptsächlich Milchproduktion) teilweise mit Schweineproduktion und im Talgebiet mit Ackerbau kombiniert Intensität der Landwirtschaft: mittel-intensiv (Hanglagen) bis intensiv (Tallagen) Landwirtschaftliche Besonderheiten: z.b. traditionelle Tierrassen, Kulturen, Bräuche, Produkte Vorhandene Landschaftseinheiten: Wiesen, Weiden, Wälder, offenes Ackerland, Streue Obstbau Landschaftstypische Merkmale: z.b. Stark Futterbau geprägtes Nutzungsmosaik von Hecken und Wäldern durchzogen, Einzelbäume Vegetation und Landschaftsstruktur: Aufgrund des kleinräumig stark ausgeprägten Reliefs und des mosaikartigen Landnutzungsmusters ergibt sich eine sehr vielfältige Landschaft. Die einzelnen Teilgebiete unterscheiden sich insbesondere in der Struktur der Hügellandschaft. Landschafts-Ziele Leitsatz, Vision, Landschaftsziel In dieser stark strukturierten Tal- und Hügellandschaft soll die Vielfalt an Nutzungsformen und somit das reichhaltige Mosaik aufrechterhalten bleiben. Die enge Verzahnung von Futterbau, Ackerbau, Waldrändern, Hecken und offenen Wiesenbächen bilden einen attraktiven Raum für Erholungssuchende. LQ-Projekt Perimeter Sursee 22 / 68
23 Wirkungsziele Aus der Landschafts-Vision können folgende Wirkungsziele abgeleitet werden: vielfältiges Mosaik unterschiedlicher Nutzungen und Nutzungsintensitäten erhalten Erhaltung und Förderung einer hohen Strukturvielfalt Förderung von traditionellen Bewirtschaftungsformen Intensive, ausgeräumte Landschaften mit naturnahen Elementen (Hecken, Blumenwiesen, Säume etc.) und mit einer vielfältigen Fruchtfolge bereichern Aufrechterhaltung der engen Verzahnung von Flur und Wald Förderung von an die Landschaft angepassten Tierrassen Erarbeitung und Förderung von Lösungsansätzen zur Reduktion der Konflikte zwischen Landwirtschaft und Erholungsuchenden LQ-Projekt Perimeter Sursee 23 / 68
24 4 Stark geformte Hügellandschaft 3 Moränelandschaft des Mittellandes 5 Massnahmen und Umsetzungsziele Auf der Basis der für jeden Landschaftstyp erarbeiteten Landschaftsziele wurden in den kantonalen Arbeitsgruppen Ideen und Wünsche von Massnahmen gesammelt und diskutiert. Die Landschaftsziele dienten dabei als Orientierungshilfe, um jeder Massnahme ein Landschaftsziel zuzuordnen. Die Massnahmenvorschläge aus den kantonalen Arbeitsgruppen wurden in der Begleitgruppe zusammengetragen, gruppiert und den entsprechenden Landschaftszielen zugeordnet. Dabei haben sich folgende Kategorien von Landschaftszielen herausgebildet: Imagepflege Landwirtschaft / Dienstleistungen / Naherholungsangebote Nutzungsmosaik / traditionelle Bewirtschaftung Offenhaltung / Verzahnung Wald Flur strukturierte Landschaft / landschaftsprägende Einzelobjekte Synergie Landschaftsqualität mit Biodiversitätsförderung Optimieren der Umsetzung von Massnahmen Die Vorschläge der Massnahmen aus den kantonalen Arbeitsgruppen wurden von der Begleitgruppe geprüft, sortiert und gewichtet. Neben den Massnahmen, die in allen Landschaftstypen umgesetzt werden können, wurden regionsspezifische Besonderheiten für die Ausarbeitung und Präzisierung weiterverfolgt und bildeten damit die Kategorie der Landschaftstyp-spezifischen Massnahmen. Von den ursprünglich über 80 Massnahmen-Ideen aus den kantonalen Arbeitsgruppen wurden 45 für die weitere Präzisierung ausgewählt. 22 davon wurden für die definitive Ausarbeitung priorisiert (Anforderungen, Details zur Umsetzung und Herleitung des Beitrags). Die zurückgestellten ca. 20 Massnahmen werden im Jahr 2014 von der Begleitgruppe weiter bearbeitet und zu gegebener Zeit dem BLW zur Prüfung vorgelegt. Damit wird in der Startphase 2014 den Zentralschweizer Betrieben ein Grundstock an LQ-Massnahmen angeboten, der zu einem späteren Zeitpunkt mit weiteren Massnahmen ergänzt wird. Die Auswahl der Massnahmen wurde in einem mehrfachen Vernehmlassungsverfahren zwischen den kantonalen Arbeitsgruppen und der Begleitgruppe verabschiedet und von der KOLAS-Z genehmigt. Untenstehend sind die Massnahmen und das zugehörige Landschaftsziel dargestellt. Ebenfalls zeigt die Tabelle, welchen Landschaftstypen die Massnahmen zugeteilt sind. Tabelle 2: Übersicht der Massnahmen mit den zugehörigen Landschaftszielen. Die Massnahmen sind den Landschaftstypen des Projektperimeters zugeteilt. LQ-Massnahmen korrespondierendes Landschaftsziel X X G1 Beratung in Anspruch nehmen Grundanforderung: Optimierung der Umsetzung von Massnahmen X X G2 Keine Siloballen oder geordnete Siloballen- Lagerung Grundanforderung: Imagepflege Landwirtschaft / Dienstleistungen / Naherholungsangebote X X G3 Ordnung auf dem Betrieb halten Grundanforderung: Imagepflege Landwirtschaft / Dienstleistungen / Naherholungsangebote X X A1 Naturnahe Wege pflegen Imagepflege Landwirtschaft / Dienstleistungen / Naherholungsangebote X X A2 Durchgehendes Wegnetz pflegen und durch Weiden führende Wanderwege abzäunen Imagepflege Landwirtschaft / Dienstleistungen / Naherholungsangebote LQ-Projekt Perimeter Sursee 24 / 68
25 X X A4 Kulturelle Werte zeigen Imagepflege Landwirtschaft / Dienstleistungen / Naherholungsangebote X X A5 Steinmauern pflegen Imagepflege Landwirtschaft / Dienstleistungen / Naherholungsangebote X X A6 Landwirtschaftliche Gebäude traditionell nutzen Nutzungsmosaik / traditionelle Bewirtschaftung X X A7 Traditionelle Abgrenzungen pflegen bzw. neu erstellen Nutzungsmosaik / traditionelle Bewirtschaftung X X A8 Holzbrunnen, Stein- und Betontröge unterhalten Nutzungsmosaik / traditionelle Bewirtschaftung X X A9 Einzelbäume erhalten bzw. neu pflanzen strukturierte Landschaft / landschaftsprägende Einzelobjekte X X A10 Naturnahe Kleingewässer pflegen bzw. neu anlegen strukturierte Landschaft / landschaftsprägende Einzelobjekte X X L1 Siedlungsnahe Biodiversitätsförderflächen (BFF) Imagepflege Landwirtschaft / Dienstleistungen / Naherholungsangebote L2 Tristen erstellen Nutzungsmosaik / traditionelle Bewirtschaftung X X L3 Zeitlich gestaffelte Futterbaunutzung Nutzungsmosaik / traditionelle Bewirtschaftung X X L4 Kleinstrukturen und Kleinrelief erhalten Nutzungsmosaik / traditionelle Bewirtschaftung X L5 Wässermatten pflegen Nutzungsmosaik / traditionelle Bewirtschaftung L6 Wildheuflächen nutzen Nutzungsmosaik / traditionelle Bewirtschaftung X X L7 Verschiedene Ackerkulturen anbauen Nutzungsmosaik / traditionelle Bewirtschaftung L8 Offenhaltung von landwirtschaftlich genutzten Flächen Offenhaltung / Verzahnung Wald - Flur X X L9 Hecken pflegen, aufwerten bzw. neu pflanzen strukturierte Landschaft / landschaftsprägende Einzelobjekte X X L10 Hochstamm-Obstbäume pflegen bzw. neu pflanzen strukturierte Landschaft / landschaftsprägende Einzelobjekte Im Folgenden werden die Massnahmen auf Massnahmenblättern nach folgendem Muster beschrieben: - Bezeichnung der Massnahme - korrespondierendes Landschaftsziel - Beschreibung - Anforderungen - Umsetzungsziel - Details zur Umsetzung - Beitrag (inkl. Herleitung) - Kontrolle LQ-Projekt Perimeter Sursee 25 / 68
26 G1 Beratung in Anspruch nehmen Korrespondierendes Landschaftsziel: Optimieren der Umsetzung von Massnahmen Massnahme: Einzelbetriebliche Beratung / Gruppenberatung Typ: Grundanforderung Zugelassene Landschaftstypen im Kanton Luzern: alle Beschreibung: Beim Einstieg wie auch bei der Weiterentwicklung der LQB sind Beratungen wichtig, damit das Know-How des/der Bewirtschafter/-in vergrössert wird. Die Beratung kann mit der Beratung im Vernetzungsprojekt koordiniert werden. Die Beratung kann durch kantonale Verwaltung oder Trägerschaften LQ organisiert werden. Mindestanforderungen für Beratungen werden durch lawa vorgegeben. Anforderungen: Innerhalb der Projektdauer von 8 Jahren bzw. bis zum Ende einer Projektperiode findet mind. einmal eine Beratung durch eine kompetente Fachperson statt. Der Bewirtschafter trägt die unmittelbaren Kosten für die Beratung selber. Umsetzungsziel: Diese Anforderung muss von allen teilnehmenden Betrieben erfüllt sein. Details zur Umsetzung: Beitrag wird im ersten Jahr bei Einstieg ins Projekt ausbezahlt, auch wenn die Grundanforderung ev. erst später erfüllt wird. Beitrag: Für die Erfüllung der Grundanforderung 1 Beratung (zwingend) wird kein Beitrag ausgezahlt. Grundanforderung 2 Keine Siloballen oder geordnete Siloballen-Lagerung (zwingend): Die Grünlandfläche pro Betrieb liegt im Durchschnitt bei ca. 10 bis 15 ha. Ein jährlicher Beitrag von Fr pro ha Grünlandfläche ergibt jährlich Fr bis pro Betrieb. Grundanforderung 3 Ordnung auf dem Betrieb halten (zwingend): Angenommen wird ein spezieller Arbeitsaufwand von 1 Arbeitstag jährlich (8 Std. x Fr = 224.-). Grundbeitrag: Die Grundanforderungen 1-3 müssen zwingend erfüllt sein. Daraus ergeben sich aufgrund der oben stehenden Berechnungen jährliche Beiträge für die drei zu erfüllenden Massnahmen von Fr bis pro Betrieb. Bei Erfüllung von G1-3: Jährlicher Grundbeitrag von max. Fr pro Betrieb Damit der Grundbeitrag ausgelöst werden kann, müssen zusätzlich drei frei wählbare Massnahmen der Kategorie A und/oder L erfüllt werden. Grundbeitrag kann von einem Bewirtschafter mit einem Sömmerungs- und einem Ganzjahresbetrieb zweimal ausgelöst werden. Kontrolle: Kontrolle durch Kanton. Administrative Überprüfung. LQ-Projekt Perimeter Sursee 26 / 68
27 G2 Keine Siloballen oder geordnete Siloballen-Lagerung Korrespondierendes Landschaftsziel: Imagepflege Landwirtschaft / Dienstleistungen / Naherholungsangebote Massnahme: Keine Siloballen oder geordnete Siloballen-Lagerung Typ: Grundanforderung Zugelassene Landschaftstypen im Kanton Luzern: alle Beschreibung: Siloballen können als störend in der Landschaft empfunden werden. Deshalb werden jene Betriebe unterstützt, welche keine Siloballen haben oder diese diskret und geordnet lagern. Die Lagerung von Siloballen soll im Feld wie auf dem Hofareal einen ordentlichen Eindruck hinterlassen und ein positives Image der Landwirtschaft fördern. Lagerplätze von Siloballen an Hauptverkehrsachsen (verkehrsreiche Strassen, Bahnlinien) sollen vermieden werden. Anforderungen: Vorschriftsgemässe Lagerung: Siloballen müssen gesetzeskonform gelagert werden, d. h. nicht im Wald oder in Pufferstreifen (am Waldrand, an Hecken, Feld- und Ufergehölzen, an Gewässern), usw. Ordentliche und diskrete Lagerung: Siloballen sollen möglichst konzentriert und geordnet (in Reihen oder gut gestapelt) gelagert werden. Die Standorte und die Grösse (Länge und Höhe) der Reihen oder Stapel sind so zu wählen, dass sie in der Landschaft möglichst nicht auffallen (gut platziert innerhalb des Hofareals oder bei anderen Gebäuden, nicht auf dem offenen Feld, nicht entlang naturnaher Strukturen). Das Nutzen von bestehenden Bäumen und Gehölzen als Sichtschutz oder entsprechende Neupflanzungen können empfohlen werden. Folienreste sowie verdorbene Silage und angebrochene Siloballen müssen zu jedem Zeitpunkt ordentlich entsorgt sein. Im Sömmerungsgebiet dürfen keine Siloballen gelagert werden. Diese Einschränkung gilt nicht für Landwirtschaftliche Nutzflächen innerhalb des Sömmerungsgebiets. Umsetzungsziel: Diese Anforderung muss von allen teilnehmenden Betrieben erfüllt sein. Details zur Umsetzung: Beitrag: Grundbeitrag für Erfüllung der Grundanforderungen sowie drei frei wählbaren Massnahmen der Kategorie A und L. Grundbeitrag kann von einem Bewirtschafter mit einem Sömmerungs- und einem Ganzjahresbetrieb zweimal ausgelöst werden. Herleitung und Beitragshöhe siehe Massnahme G1: Beratung in Anspruch nehmen. Kontrolle: Kontrolle durch Kanton oder beauftragte Organisation. Stichprobenkontrollen aller Silolagerplätze auf dem Betrieb. Bemerkungen: Betriebe ohne Siloballen erfüllen diese Grundanforderung automatisch. LQ-Projekt Perimeter Sursee 27 / 68
Gemeinsam für die Zukunft der Landschaft
 Gemeinsam für die Zukunft der Landschaft Nachhaltige Landschaftsentwicklung im Kanton Zürich Editorial Bild: HSR Landschaft geht uns alle an! Sei es, weil wir in ihr arbeiten, uns darin erholen, darin
Gemeinsam für die Zukunft der Landschaft Nachhaltige Landschaftsentwicklung im Kanton Zürich Editorial Bild: HSR Landschaft geht uns alle an! Sei es, weil wir in ihr arbeiten, uns darin erholen, darin
DEPARTEMENT FÜR VÖLKSWIRTSCHAFT, ENERGIE UND RAUMENTWICKLUNG
 DEPARTEMENT FÜR VÖLKSWIRTSCHAFT, ENERGIE UND RAUMENTWICKLUNG Weisung zur kantonalen Politik im Bereich der Biodiversität, Landschaftsqualität sowie Nutzung und Erhaltung der natürlichen Ressourcen in der
DEPARTEMENT FÜR VÖLKSWIRTSCHAFT, ENERGIE UND RAUMENTWICKLUNG Weisung zur kantonalen Politik im Bereich der Biodiversität, Landschaftsqualität sowie Nutzung und Erhaltung der natürlichen Ressourcen in der
forum.landschaft UPDATE LANDSCHAFTSQUALITÄTSPROJEKTE forum.landschaft 19.11.2015 1
 forum.landschaft UPDATE LANDSCHAFTSQUALITÄTSPROJEKTE 1 LANDSCHAFTSPARK BINNTAL REGIONALER NATURPARK VON NATIONALER BEDEUTUNG 2 REGIONALER NATURPARK BINNTAL ÜBERDURCHSCHNITTLICH HOHE NATUR- UND KULTURWERTE
forum.landschaft UPDATE LANDSCHAFTSQUALITÄTSPROJEKTE 1 LANDSCHAFTSPARK BINNTAL REGIONALER NATURPARK VON NATIONALER BEDEUTUNG 2 REGIONALER NATURPARK BINNTAL ÜBERDURCHSCHNITTLICH HOHE NATUR- UND KULTURWERTE
Infoveranstaltung Landschaftsqualitätsbeiträge 26.8.2014, Gipf-Oberfrick. 3.9.2014, Schinznach
 Infoveranstaltung Landschaftsqualitätsbeiträge 26.8.2014, Gipf-Oberfrick 3.9.2014, Schinznach 1. Begrüssung 2. LQ-Projekte im Rahmen der AP 14/17 3. Organisation, Trägerschaft, Rollenverteilung 4. LQ-Projekt:
Infoveranstaltung Landschaftsqualitätsbeiträge 26.8.2014, Gipf-Oberfrick 3.9.2014, Schinznach 1. Begrüssung 2. LQ-Projekte im Rahmen der AP 14/17 3. Organisation, Trägerschaft, Rollenverteilung 4. LQ-Projekt:
im Sinne von Artikel 10 der Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen (LBV; SR 910.91)
 Landwirtschaft und Wald (lawa) Centralstrasse 33 Postfach 6210 Sursee Telefon 041 925 10 00 Telefax 041 925 10 09 lawa@lu.ch www.lawa.lu.ch GESUCH Anerkennung einer Betriebsgemeinschaft im Sinne von Artikel
Landwirtschaft und Wald (lawa) Centralstrasse 33 Postfach 6210 Sursee Telefon 041 925 10 00 Telefax 041 925 10 09 lawa@lu.ch www.lawa.lu.ch GESUCH Anerkennung einer Betriebsgemeinschaft im Sinne von Artikel
Die Personengesellschaft gilt ab: Datum:...
 Landwirtschaft und Wald (lawa) Abteilung Landwirtschaft Centralstrasse 33 Postfach 6210 Sursee Telefon 041 925 10 00 Telefax 041 925 10 09 lawa@lu.ch www.lawa.lu.ch ÜBERPRÜFUNG Direktzahlungsberechtigung
Landwirtschaft und Wald (lawa) Abteilung Landwirtschaft Centralstrasse 33 Postfach 6210 Sursee Telefon 041 925 10 00 Telefax 041 925 10 09 lawa@lu.ch www.lawa.lu.ch ÜBERPRÜFUNG Direktzahlungsberechtigung
Regionaler Massnahmenpool für ökologische Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen: Vorgehensvorschlag und Programm für die Startphase
 1 seeland.biel/bienne Regionaler Massnahmenpool für ökologische Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen: Vorgehensvorschlag und Programm für die Von der Begleitgruppe am 18. März 2015 und vom Leitungsgremium
1 seeland.biel/bienne Regionaler Massnahmenpool für ökologische Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen: Vorgehensvorschlag und Programm für die Von der Begleitgruppe am 18. März 2015 und vom Leitungsgremium
Landschaftsqualitätsprojekt Zürich Unterland der Bezirke Bülach, Dielsdorf, Dietikon und Stadt Zürich
 Kanton Zürich Landschaftsqualitätsprojekt Zürich Unterland der Bezirke Bülach, Dielsdorf, Dietikon und Stadt Zürich Projektbericht Teil 1 (Trägerschaft) Ort/Datum: Dübendorf, 10.3.2015 Landschaftsqualitätsprojekt
Kanton Zürich Landschaftsqualitätsprojekt Zürich Unterland der Bezirke Bülach, Dielsdorf, Dietikon und Stadt Zürich Projektbericht Teil 1 (Trägerschaft) Ort/Datum: Dübendorf, 10.3.2015 Landschaftsqualitätsprojekt
Beschluss und Genehmigung Bild 19 REP Seetal
 REP Seetal Der Regionale Entwicklungsplan Seetal in 19 Bildern. Am 19. August 2008 vom Regierungsrat des Kantons Luzern genehmigt Ergänzung Bild 19 am 21. Mai 2013 vom Vorstand RPVS zu Handen der Delegiertenversammlung
REP Seetal Der Regionale Entwicklungsplan Seetal in 19 Bildern. Am 19. August 2008 vom Regierungsrat des Kantons Luzern genehmigt Ergänzung Bild 19 am 21. Mai 2013 vom Vorstand RPVS zu Handen der Delegiertenversammlung
Kick-off ÖREK 2011. Grundzüge der Raumordnung 1996
 Kick-off ÖREK 2011 RAUMKONZEPT SCHWEIZ Dr. Fritz Wegelin, Bern 1 Grundzüge der Raumordnung 1996 Vom Bund erarbeitet Nach Anhörung der Kantone und weiterer interessierter Kreise (Vernehmlassung) stark überarbeitet
Kick-off ÖREK 2011 RAUMKONZEPT SCHWEIZ Dr. Fritz Wegelin, Bern 1 Grundzüge der Raumordnung 1996 Vom Bund erarbeitet Nach Anhörung der Kantone und weiterer interessierter Kreise (Vernehmlassung) stark überarbeitet
AUFTRAGGEBER: Kanton Glarus Abteilung Landwirtschaft 8750 Glarus POTENTIALABSCHÄTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DER AP 2014-17 IM KANTON GLARUS
 AUFTRAGGEBER: Kanton Glarus Abteilung Landwirtschaft 8750 Glarus POTENTIALABSCHÄTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DER AP 2014-17 IM KANTON GLARUS BERICHT VOM 20. JUNI 2012 Inhalt INHALT Inhalt... 1 Abkürzungsverzeichnis...
AUFTRAGGEBER: Kanton Glarus Abteilung Landwirtschaft 8750 Glarus POTENTIALABSCHÄTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DER AP 2014-17 IM KANTON GLARUS BERICHT VOM 20. JUNI 2012 Inhalt INHALT Inhalt... 1 Abkürzungsverzeichnis...
Länge linearer Landschaftselemente
 Länge linearer Landschaftselemente Der Indikator «Länge linearer Landschaftselemente ()» weist aus, wie sich die Landschaftselemente Hecken, Waldränder und offene Bachläufe in ihrer Länge verändern. Lineare
Länge linearer Landschaftselemente Der Indikator «Länge linearer Landschaftselemente ()» weist aus, wie sich die Landschaftselemente Hecken, Waldränder und offene Bachläufe in ihrer Länge verändern. Lineare
Informationsanlass 4. November 2014 Regionaler Richtplan Windenergie
 Informationsanlass 4. November 2014 Regionaler Richtplan Windenergie Jörg Zumstein, Präsident Kommission Raumplanung Jos Aeschbacher, Leiter Fachbereich Raumplanung Thomas Frei, Sigmaplan AG Inhalte 1.
Informationsanlass 4. November 2014 Regionaler Richtplan Windenergie Jörg Zumstein, Präsident Kommission Raumplanung Jos Aeschbacher, Leiter Fachbereich Raumplanung Thomas Frei, Sigmaplan AG Inhalte 1.
Überblick: Direktzahlungen an Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetriebe. Bern, Januar 2015
 Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Bundesamt für Landwirtschaft BLW Direktionsbereich Direktzahlungen und ländliche Entwicklung Bern, Januar 2015 Überblick: Direktzahlungen
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Bundesamt für Landwirtschaft BLW Direktionsbereich Direktzahlungen und ländliche Entwicklung Bern, Januar 2015 Überblick: Direktzahlungen
Vom Nutzen der Wildblumen
 Vom Nutzen der Wildblumen Katja Jacot Agroscope ART 8046 Zürich Kurs 11.212 Ökologische Ausgleichsflächen haben viele Funktionen! BÖA Jahrestagung 2011 Strickhof Wülflingen, 23. März 2011 1 Eidgenössisches
Vom Nutzen der Wildblumen Katja Jacot Agroscope ART 8046 Zürich Kurs 11.212 Ökologische Ausgleichsflächen haben viele Funktionen! BÖA Jahrestagung 2011 Strickhof Wülflingen, 23. März 2011 1 Eidgenössisches
Richtlinie für Vernetzungsprojekte im Kanton Glarus
 Volkswirtschaft und Inneres Landwirtschaft Zwinglistrasse 6 8750 Glarus Richtlinie für Vernetzungsprojekte im Kanton Glarus auf der Grundlage der Direktzahlungsverordnung (DZV, SR 910.13) Gültigkeit: ab
Volkswirtschaft und Inneres Landwirtschaft Zwinglistrasse 6 8750 Glarus Richtlinie für Vernetzungsprojekte im Kanton Glarus auf der Grundlage der Direktzahlungsverordnung (DZV, SR 910.13) Gültigkeit: ab
Das Kantonale Bauinventar als Instrument
 Das Kantonale Bauinventar als Instrument für Bauherrn, Planer und Behörden 1 Was sind Baudenkmäler Schloss Heidegg Rathausturm Luzern Aufgaben der Denkmalpflege > erfassen Invenatarisation: kant. Bauinventar
Das Kantonale Bauinventar als Instrument für Bauherrn, Planer und Behörden 1 Was sind Baudenkmäler Schloss Heidegg Rathausturm Luzern Aufgaben der Denkmalpflege > erfassen Invenatarisation: kant. Bauinventar
Verordnung über die Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler und nationaler Bedeutung (WZVV)
 Verordnung über die Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler und nationaler Bedeutung (WZVV) Änderung vom Entwurf vom 17. Juli 2014 Der Schweizerische Bundesrat, verordnet: I Die Verordnung vom
Verordnung über die Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler und nationaler Bedeutung (WZVV) Änderung vom Entwurf vom 17. Juli 2014 Der Schweizerische Bundesrat, verordnet: I Die Verordnung vom
Alpwirtschaft in der Schweiz Status quo
 Verbundprojekt AlpFUTUR Zukunft der Sömmerungsweiden in der Schweiz Projet intégré AlpFUTUR Avenir des pâturages d estivage en Suisse Progetto collettivo AlpFUTUR Il futuro dei pascoli d estivazione della
Verbundprojekt AlpFUTUR Zukunft der Sömmerungsweiden in der Schweiz Projet intégré AlpFUTUR Avenir des pâturages d estivage en Suisse Progetto collettivo AlpFUTUR Il futuro dei pascoli d estivazione della
Leitbild Malans. Wohnen und leben in den Bündner Reben
 Leitbild Malans Wohnen und leben in den Bündner Reben Gemeinde Malans: Zukunftsperspektiven Richtziele Malans mit seinen natürlichen Schönheiten, Wein und Kultur ist eine liebens- und lebenswerte Gemeinde.
Leitbild Malans Wohnen und leben in den Bündner Reben Gemeinde Malans: Zukunftsperspektiven Richtziele Malans mit seinen natürlichen Schönheiten, Wein und Kultur ist eine liebens- und lebenswerte Gemeinde.
Autobahnzubringer Obfelden/Ottenbach
 Kanton Zürich Baudirektion Informationsveranstaltung vom Dienstag, 21. Oktober 2014 1 Thomas Maag stv. Leiter Kommunikation Baudirektion Kanton Zürich 2 Was wir für Sie vorbereitet haben Einführung durch
Kanton Zürich Baudirektion Informationsveranstaltung vom Dienstag, 21. Oktober 2014 1 Thomas Maag stv. Leiter Kommunikation Baudirektion Kanton Zürich 2 Was wir für Sie vorbereitet haben Einführung durch
Ländliche Infrastrukturen in der Schweiz: Zukunftsperspektiven
 Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Bundesamt für Landwirtschaft BLW Direktionsbereich Direktzahlungen und Ländliche Entwicklung Lebensader Infrastruktur im Ländlichen
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Bundesamt für Landwirtschaft BLW Direktionsbereich Direktzahlungen und Ländliche Entwicklung Lebensader Infrastruktur im Ländlichen
Landschaftsqualitätsprojekt Mittelthurgau
 Ö+L Ökologie und Landschaft GmbH Litzibuch 8966 Oberwil-Lieli Tel. 056 641 11 55, Fax 071 353 67 62 www.agraroekologie.ch Landschaftsqualitätsprojekt Mittelthurgau Verwendete Abkürzungen a: Are BFF: Biodiversitätsförderfläche
Ö+L Ökologie und Landschaft GmbH Litzibuch 8966 Oberwil-Lieli Tel. 056 641 11 55, Fax 071 353 67 62 www.agraroekologie.ch Landschaftsqualitätsprojekt Mittelthurgau Verwendete Abkürzungen a: Are BFF: Biodiversitätsförderfläche
MANDATSVORSCHLAG DER AD HOC ARBEITSGRUPPE FUR DIE VORBEREITUNG DES
 MANDATSVORSCHLAG DER AD HOC ARBEITSGRUPPE FUR DIE VORBEREITUNG DES 6. Alpenzustandsberichts 2016 zum Thema Greening the Economy in the Alpine Region für den Zeitraum 2015-2016 1. Einsetzung der Arbeitsgruppe/Plattform
MANDATSVORSCHLAG DER AD HOC ARBEITSGRUPPE FUR DIE VORBEREITUNG DES 6. Alpenzustandsberichts 2016 zum Thema Greening the Economy in the Alpine Region für den Zeitraum 2015-2016 1. Einsetzung der Arbeitsgruppe/Plattform
Kommunal laufen national planen
 1 Kommunal laufen national planen Fußgänger-Masterplan auch für Deutschland? Erfahrungen aus der Schweiz Die wichtigsten Handlungsfelder auf Bundesebene: kurzer Rück- und Ausblick Thomas Schweizer, Fussverkehr
1 Kommunal laufen national planen Fußgänger-Masterplan auch für Deutschland? Erfahrungen aus der Schweiz Die wichtigsten Handlungsfelder auf Bundesebene: kurzer Rück- und Ausblick Thomas Schweizer, Fussverkehr
Strategie Wasserkraft und Matrix Interessenabwägung von Schutz und Nutzen
 Baudepartement Strategie Wasserkraft und Matrix Interessenabwägung von Schutz und Nutzen Gesetzliche Rahmenbedingungen und Grundlagen Fachtagung/GV ISKB/ADUR,, Stellv. Sektionsleiter, AFU, Energie und
Baudepartement Strategie Wasserkraft und Matrix Interessenabwägung von Schutz und Nutzen Gesetzliche Rahmenbedingungen und Grundlagen Fachtagung/GV ISKB/ADUR,, Stellv. Sektionsleiter, AFU, Energie und
Stand der Arbeiten ÖREB-Kataster auf Stufe Bund und Kanton Zürich
 Amt für Raumentwicklung AV-Tagung, 21. September 2012 Stand der Arbeiten ÖREB-Kataster auf Stufe Bund und Kanton Zürich Jakob Günthardt, Leiter GIS-Zentrum Agenda 1. Stand der Arbeiten auf Stufe Bund 2.
Amt für Raumentwicklung AV-Tagung, 21. September 2012 Stand der Arbeiten ÖREB-Kataster auf Stufe Bund und Kanton Zürich Jakob Günthardt, Leiter GIS-Zentrum Agenda 1. Stand der Arbeiten auf Stufe Bund 2.
KANTON ZUG VORLAGE NR. 1174.2 (Laufnummer 11481)
 KANTON ZUG VORLAGE NR. 1174.2 (Laufnummer 11481) INTERPELLATION DER CVP-FRAKTION BETREFFEND UMSETZUNG DES TEILRICHTPLANES VERKEHR (KANTONSSTRASSEN DER 1. PRIORITÄT) (VORLAGE NR. 1174.1-11296) ANTWORT DES
KANTON ZUG VORLAGE NR. 1174.2 (Laufnummer 11481) INTERPELLATION DER CVP-FRAKTION BETREFFEND UMSETZUNG DES TEILRICHTPLANES VERKEHR (KANTONSSTRASSEN DER 1. PRIORITÄT) (VORLAGE NR. 1174.1-11296) ANTWORT DES
Ernährungsfläche der Agglomeration Basel Ein Versuch der Visualisierung
 Archived at http://orgprints.org/29315/ Ernährungsfläche der Agglomeration Basel Ein Versuch der Visualisierung Durch Bild ersetzen, Farbe des Balkens frei wählbar sinnvollerweise wie bei Poster (Grösse
Archived at http://orgprints.org/29315/ Ernährungsfläche der Agglomeration Basel Ein Versuch der Visualisierung Durch Bild ersetzen, Farbe des Balkens frei wählbar sinnvollerweise wie bei Poster (Grösse
Bericht. Stadtbauamt, Fachbereich Stadtentwicklung, Jurastrasse 22, 4901 Langenthal Telefon 062 916 21 11, Telefax 062 923 21 76, www.langenthal.
 Erfassung und Auswertung von Daten für Aussagen über eine nachhaltige Gestaltung und Nutzung des Stadtraums als Grundlage für die Siedlungsrichtplanung Bericht Datum: 4. Februar 2013 Bearbeiter: Tina Hurni,
Erfassung und Auswertung von Daten für Aussagen über eine nachhaltige Gestaltung und Nutzung des Stadtraums als Grundlage für die Siedlungsrichtplanung Bericht Datum: 4. Februar 2013 Bearbeiter: Tina Hurni,
Impressum. Herausgeber Verband Thurgauer Landwirtschaft
 Broschüre Landschaftsqualitätsprojekt Hinterthurgau-Immenberg Massnahmen & Ausgabe vom 5. März 2015 Impressum Herausgeber Verband Thurgauer Landwirtschaft Redaktion und Projektbearbeitung Andreas Hafer,
Broschüre Landschaftsqualitätsprojekt Hinterthurgau-Immenberg Massnahmen & Ausgabe vom 5. März 2015 Impressum Herausgeber Verband Thurgauer Landwirtschaft Redaktion und Projektbearbeitung Andreas Hafer,
Konzept der Fachgruppe für Arbeit mit Mädchen (FAM)
 Konzept der Fachgruppe für Arbeit mit Mädchen (FAM) okaj zürich Kantonale Kinder- und Jugendförderung Zentralstrasse 156 8003 Zürich Tel 044 366 50 10 Fax 044 366 50 15 www.okaj.ch info@okaj.ch Zürich,
Konzept der Fachgruppe für Arbeit mit Mädchen (FAM) okaj zürich Kantonale Kinder- und Jugendförderung Zentralstrasse 156 8003 Zürich Tel 044 366 50 10 Fax 044 366 50 15 www.okaj.ch info@okaj.ch Zürich,
Personalentwicklung an Zürcher Mittelschulen
 Bildungsdirektion Kanton Zürich Mittelschul- und Berufsbildungsamt Personalentwicklung an Zürcher Mittelschulen Grundlagen und Vorgehensweisen zur Personalentwicklung an Zürcher Mittelschulen Gesamtkonzept
Bildungsdirektion Kanton Zürich Mittelschul- und Berufsbildungsamt Personalentwicklung an Zürcher Mittelschulen Grundlagen und Vorgehensweisen zur Personalentwicklung an Zürcher Mittelschulen Gesamtkonzept
Änderungen des Kulturlandplans im Zuge der Modernen Melioration Sins-Reussegg
 Vertiefungblock Wintersemester 2006/2007 Änderungen des Kulturlandplans im Zuge der Modernen Melioration Sins-Reussegg Autoren: Aynur Demir, Christian Oberli Leitung: Prof.Dr. Willy Schmid und Gustav Nussbaumer,
Vertiefungblock Wintersemester 2006/2007 Änderungen des Kulturlandplans im Zuge der Modernen Melioration Sins-Reussegg Autoren: Aynur Demir, Christian Oberli Leitung: Prof.Dr. Willy Schmid und Gustav Nussbaumer,
Projekt. Evaline. Anleitung Stufe Kanton. Anleitung. Massnahmen- & Ressourcenplanung in den Gremien. Version 1.0
 Projekt Evaline Stufe Kanton Massnahmen- & Ressourcenplanung in den Gremien Version 1.0 Jungwacht Blauring Kanton Luzern St. Karliquai 12. 6004 Luzern www.jublaluzern.ch Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung...
Projekt Evaline Stufe Kanton Massnahmen- & Ressourcenplanung in den Gremien Version 1.0 Jungwacht Blauring Kanton Luzern St. Karliquai 12. 6004 Luzern www.jublaluzern.ch Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung...
Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung: Bilanz nach zwölf Jahren (Stand 1. Februar 2015)
 Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung: Bilanz nach zwölf Jahren (Stand 1. Februar 2015) Insgesamt konnten in den 12 Jahren seit Inkrafttreten des Bundesgesetzes 2 676 Gesuche bewilligt werden.
Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung: Bilanz nach zwölf Jahren (Stand 1. Februar 2015) Insgesamt konnten in den 12 Jahren seit Inkrafttreten des Bundesgesetzes 2 676 Gesuche bewilligt werden.
Teilrevision Ortsplanung Zug: Projektorganisation und -ablauf
 S t a d t r a t Grosser Gemeinderat, Vorlage Nr. 1793 Teilrevision Ortsplanung Zug: Projektorganisation und -ablauf Bericht des Stadtrates vom 6. April 2004 Das Wichtigste im Überblick Die gültige Ortsplanung
S t a d t r a t Grosser Gemeinderat, Vorlage Nr. 1793 Teilrevision Ortsplanung Zug: Projektorganisation und -ablauf Bericht des Stadtrates vom 6. April 2004 Das Wichtigste im Überblick Die gültige Ortsplanung
Kurzfassung: Tiefbahnhof Luzern
 Verkehr und Infrastruktur (vif) Arsenalstrasse 43 6010 Kriens Telefon 041 318 12 12 Telefax 041 311 20 22 vif@lu.ch www.vif.lu.ch Kurzfassung: Tiefbahnhof Luzern Teil I: Angebotsvergleich 19. Mai 2010
Verkehr und Infrastruktur (vif) Arsenalstrasse 43 6010 Kriens Telefon 041 318 12 12 Telefax 041 311 20 22 vif@lu.ch www.vif.lu.ch Kurzfassung: Tiefbahnhof Luzern Teil I: Angebotsvergleich 19. Mai 2010
Für die Umsetzung von IF 2011 ist ein entsprechender Meilensteinplan erstellt.
 AB Stadt Luzern Volksschule Umsetzung IF 1 ung Für die Umsetzung von IF 2011 ist ein entsprechender Meilensteinplan erstellt. 1.1 Umsetzung und Zielgruppen Die Umsetzung eines Projekts dieser Dimension
AB Stadt Luzern Volksschule Umsetzung IF 1 ung Für die Umsetzung von IF 2011 ist ein entsprechender Meilensteinplan erstellt. 1.1 Umsetzung und Zielgruppen Die Umsetzung eines Projekts dieser Dimension
Bericht an den Einwohnerrat. Sachkommission SVU. Reg. Nr. 10-0104.102 Nr. 06-10.164.2 / 06-10.165.2. Vorgehen der Kommission
 Sachkommission SVU Reg. Nr. 10-0104.102 Nr. 06-10.164.2 / 06-10.165.2 Eine Investition in die Zukunft des Moostals; Kauf des nicht erschlossenen Baulands durch die Einwohnergemeinde (Vorlage Nr. 06-10.164)
Sachkommission SVU Reg. Nr. 10-0104.102 Nr. 06-10.164.2 / 06-10.165.2 Eine Investition in die Zukunft des Moostals; Kauf des nicht erschlossenen Baulands durch die Einwohnergemeinde (Vorlage Nr. 06-10.164)
11. Sitzung vom 18. Juni 2012 INHALTSVERZEICHNIS
 GEMEINDERAT 11. Sitzung vom 18. Juni 2012 INHALTSVERZEICHNIS Geschäfte Beschlüsse Vernetzungsprojekt Phase 2/Überarbeitung und Übernahme in Amtl. Vermessung Entwurf Vereinb. zur Zusammenarbeit zw. Gemeinden/Kt.
GEMEINDERAT 11. Sitzung vom 18. Juni 2012 INHALTSVERZEICHNIS Geschäfte Beschlüsse Vernetzungsprojekt Phase 2/Überarbeitung und Übernahme in Amtl. Vermessung Entwurf Vereinb. zur Zusammenarbeit zw. Gemeinden/Kt.
Katalog Unterstützungsleistungen zur Umsetzung Kantonales Kinder- und Jugendleitbild
 Katalog Unterstützungsleistungen zur Umsetzung Kantonales Kinder- und Jugendleitbild Im Rahmen der Umsetzung des Kantonalen Kinder- und Jugendleitbildes (2014-2020) unterstützt der Kanton Luzern Gemeinden,
Katalog Unterstützungsleistungen zur Umsetzung Kantonales Kinder- und Jugendleitbild Im Rahmen der Umsetzung des Kantonalen Kinder- und Jugendleitbildes (2014-2020) unterstützt der Kanton Luzern Gemeinden,
Sehr geehrter Herr Landratspräsident Sehr geehrte Damen und Herren. Verpflichtungskredite
 Nr. 484 R-270-21 Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 26. August an den Landrat über Verpflichtungs und über den zweiten Nachtrag zum Kantonsvoranschlag für das Jahr Sehr geehrter Herr Landratspräsident
Nr. 484 R-270-21 Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 26. August an den Landrat über Verpflichtungs und über den zweiten Nachtrag zum Kantonsvoranschlag für das Jahr Sehr geehrter Herr Landratspräsident
Perspektiven ohne Siedlungswachstum
 Perspektiven ohne Siedlungswachstum Qualitatives Wachstum für die Natur- und Kulturlandschaft im Kanton Zürich Gemeindeforum 2014 Dr. Stefan Lüthi Zürich, 18. November 2014 1 Vielfalt im Metropolitanraum
Perspektiven ohne Siedlungswachstum Qualitatives Wachstum für die Natur- und Kulturlandschaft im Kanton Zürich Gemeindeforum 2014 Dr. Stefan Lüthi Zürich, 18. November 2014 1 Vielfalt im Metropolitanraum
Gemeinde Habsburg Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland
 Gemeinde Gesamtrevision Siedlung und Kulturland 1 Agenda Vorstellung Grundlagen / Vorarbeiten zur der Planungskommission Verfahren Zeitplan Kreditantrag 2 Vorstellung Stefan Giess, dipl. Ing. FH in Raumplanung
Gemeinde Gesamtrevision Siedlung und Kulturland 1 Agenda Vorstellung Grundlagen / Vorarbeiten zur der Planungskommission Verfahren Zeitplan Kreditantrag 2 Vorstellung Stefan Giess, dipl. Ing. FH in Raumplanung
Projekt Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK Bern-Mittelland, 2. Generation (RGSK BM II)
 Traktandum Nr. 8 Gremium Datum Regionalversammlung 26. Juni 2014 Titel Kommissionen Verkehr und Raumplanung: Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK Bern-Mittelland / Agglomerationsprogramm;
Traktandum Nr. 8 Gremium Datum Regionalversammlung 26. Juni 2014 Titel Kommissionen Verkehr und Raumplanung: Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept RGSK Bern-Mittelland / Agglomerationsprogramm;
M. Siedlungsrand Charakterisierung, Analyse und Massnahmen
 Siedlungsrand Charakterisierung M. Siedlungsrand Charakterisierung, Analyse und Massnahmen Charakterisierung Definition: Der Siedlungsrand ist der Ort, wo die Siedlung und die Landschaft aufeinandertreffen.
Siedlungsrand Charakterisierung M. Siedlungsrand Charakterisierung, Analyse und Massnahmen Charakterisierung Definition: Der Siedlungsrand ist der Ort, wo die Siedlung und die Landschaft aufeinandertreffen.
geoforum.bl Systematische Raumbeobachtung im Kanton Basel-Landschaft
 Liestal, 20. Mai 2010 geoforum.bl Systematische Raumbeobachtung im Kanton Basel-Landschaft Rüdiger Hof 1 Systematische Raumbeobachtung BL Gliederung: Fachlicher Hintergrund Raumbeobachtung Indikatorenbasierte
Liestal, 20. Mai 2010 geoforum.bl Systematische Raumbeobachtung im Kanton Basel-Landschaft Rüdiger Hof 1 Systematische Raumbeobachtung BL Gliederung: Fachlicher Hintergrund Raumbeobachtung Indikatorenbasierte
Beschlussesantrag an die Gemeindeversammlung vom 12. Mai 2015
 Geschäft 5 Vollmacht und Objektkredit für das Bauprojekt Rutschung Hintergraben im Gesamtbetrag von Fr. 2'100'000.00, abzüglich Beiträge Dritter 1. Ausgangslage Im Gebiet Hintergraben in der Gemeinde Sarnen,
Geschäft 5 Vollmacht und Objektkredit für das Bauprojekt Rutschung Hintergraben im Gesamtbetrag von Fr. 2'100'000.00, abzüglich Beiträge Dritter 1. Ausgangslage Im Gebiet Hintergraben in der Gemeinde Sarnen,
Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg Kleiner Werder 5c 39114 Magdeburg Telefon: 03 91-5 35-0 www.wna-magdeburg.de info@wna-md.wsd.de
 Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg Kleiner Werder 5c 39114 Magdeburg Telefon: 03 91-5 35-0 www.wna-magdeburg.de info@wna-md.wsd.de Impressum Herausgeber: Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg Stand: Oktober
Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg Kleiner Werder 5c 39114 Magdeburg Telefon: 03 91-5 35-0 www.wna-magdeburg.de info@wna-md.wsd.de Impressum Herausgeber: Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg Stand: Oktober
Ortsplanungsrevision: Erweiterung des Auftrags und Erteilung eines Zusatzkredits von CHF 300'000.-
 60 DER GEMEINDERAT VON BINNINGEN AN DEN EINWOHNERRAT Ortsplanungsrevision: Erweiterung des Auftrags und Erteilung eines Zusatzkredits von CHF 300'000.- Kurzinformation: Im April 1999 hat der Einwohnerrat
60 DER GEMEINDERAT VON BINNINGEN AN DEN EINWOHNERRAT Ortsplanungsrevision: Erweiterung des Auftrags und Erteilung eines Zusatzkredits von CHF 300'000.- Kurzinformation: Im April 1999 hat der Einwohnerrat
KANTON ZUG VORLAGE NR. 1507.1 (Laufnummer 12301) KANTONSRATSBESCHLUSS
 KANTON ZUG VORLAGE NR. 1507.1 (Laufnummer 12301) KANTONSRATSBESCHLUSS BETREFFEND VERLÄNGERUNG DER LAUFZEIT DES RAHMENKREDITS ZUR ABGELTUNG DINGLICHER RECHTE BEI MASSNAHMEN FÜR DEN NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ
KANTON ZUG VORLAGE NR. 1507.1 (Laufnummer 12301) KANTONSRATSBESCHLUSS BETREFFEND VERLÄNGERUNG DER LAUFZEIT DES RAHMENKREDITS ZUR ABGELTUNG DINGLICHER RECHTE BEI MASSNAHMEN FÜR DEN NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ
Hinschauen und Handeln Frühintervention in Gemeinden. Pilotphase 2006 / 2007 Kurzbeschrieb
 Hinschauen und Handeln Frühintervention in Gemeinden Pilotphase 2006 / 2007 Kurzbeschrieb 1. Die kommunale Strategie zur Frühintervention Was bedeutet Frühintervention? Frühintervention bedeutet die frühzeitige,
Hinschauen und Handeln Frühintervention in Gemeinden Pilotphase 2006 / 2007 Kurzbeschrieb 1. Die kommunale Strategie zur Frühintervention Was bedeutet Frühintervention? Frühintervention bedeutet die frühzeitige,
Landwirtschaft verstehen
 13.202 Landwirtschaft verstehen Von Kühen, Kartoffeln und saftigem Gras Infos für Nicht-Spezialisten Datum und Ort Erster Kurstag: Dienstag, 28. Mai 2013; Maja und Martin Hübscher Liebensberg 42-44, 8543
13.202 Landwirtschaft verstehen Von Kühen, Kartoffeln und saftigem Gras Infos für Nicht-Spezialisten Datum und Ort Erster Kurstag: Dienstag, 28. Mai 2013; Maja und Martin Hübscher Liebensberg 42-44, 8543
Indikatorenbasierte Bewertung der Freiraumentwicklung
 Indikatorenbasierte Bewertung der Freiraumentwicklung 1. Zielstellung Gliederung 2. Bestehende Ansätze zu Freiraumindikatoren 3. Gedanke und Vorschläge zur Weiterentwicklung Landschaft; Schutzgebiete Unzerschnittene
Indikatorenbasierte Bewertung der Freiraumentwicklung 1. Zielstellung Gliederung 2. Bestehende Ansätze zu Freiraumindikatoren 3. Gedanke und Vorschläge zur Weiterentwicklung Landschaft; Schutzgebiete Unzerschnittene
Erschliessungsprogramm
 Gemeinde Fahrwangen Kanton Aargau Revision Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland Erschliessungsprogramm 5600 Lenzburg 6280 Hochdorf 4665 Oftringen 5734 Reinach 5703 Seon 5034 Suhr Sägestrasse 6a Bellevuestr.
Gemeinde Fahrwangen Kanton Aargau Revision Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland Erschliessungsprogramm 5600 Lenzburg 6280 Hochdorf 4665 Oftringen 5734 Reinach 5703 Seon 5034 Suhr Sägestrasse 6a Bellevuestr.
Gemeinde Glarus: Organigramm Projekt Parkierungskonzept und Programm öffentliches Forum
 Gemeinde Glarus: Organigramm Projekt Parkierungskonzept und Programm öffentliches Forum Die Gemeinde Glarus erarbeitet ein Parkierungskonzept mit etappierter Umsetzung konkreter Massnahmen. Das Konzept
Gemeinde Glarus: Organigramm Projekt Parkierungskonzept und Programm öffentliches Forum Die Gemeinde Glarus erarbeitet ein Parkierungskonzept mit etappierter Umsetzung konkreter Massnahmen. Das Konzept
Regierungsratsbeschluss vom 26. Januar 2015
 Regierungsratsbeschluss vom 26. Januar 2015 Nr. 2015/132 Ausgestaltung und Umsetzung des Förderbereichs Erstinformation und Integra - tionsförderbedarf des kantonalen sprogrammes 2014 2017 Einsatz einer
Regierungsratsbeschluss vom 26. Januar 2015 Nr. 2015/132 Ausgestaltung und Umsetzung des Förderbereichs Erstinformation und Integra - tionsförderbedarf des kantonalen sprogrammes 2014 2017 Einsatz einer
Landschaft in den Alpen
 Landschaft in den Alpen Was erwarten Sie von ihr? Eine Umfrage des Instituts für Ökologie der Universität Innsbruck im Rahmen des Interreg-IV-Projektes «Kultur.Land.(Wirt)schaft Strategien für die Kulturlandschaft
Landschaft in den Alpen Was erwarten Sie von ihr? Eine Umfrage des Instituts für Ökologie der Universität Innsbruck im Rahmen des Interreg-IV-Projektes «Kultur.Land.(Wirt)schaft Strategien für die Kulturlandschaft
Gemeinsame Agrarpolitik der EU
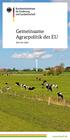 Gemeinsame Agrarpolitik der EU 2014 bis 2020 www.bmel.de Liebe Leserinnen und Leser, die Landwirtschaft ist eine starke Branche, die unser täglich Brot sichert und den ländlichen Raum attraktiv gestaltet.
Gemeinsame Agrarpolitik der EU 2014 bis 2020 www.bmel.de Liebe Leserinnen und Leser, die Landwirtschaft ist eine starke Branche, die unser täglich Brot sichert und den ländlichen Raum attraktiv gestaltet.
Neue Einblicke in die Rietlandschaft
 Martina Hingis Peter Schmidheinys Erben Huwa, Familie Hans Huber Familie Stadler/Tschan, Altstätten HAUPTSPONSOREN CO-SPONSOREN Interessenten für eine Mitgliedschaft beim Verein Pro Riet Rheintal bzw.
Martina Hingis Peter Schmidheinys Erben Huwa, Familie Hans Huber Familie Stadler/Tschan, Altstätten HAUPTSPONSOREN CO-SPONSOREN Interessenten für eine Mitgliedschaft beim Verein Pro Riet Rheintal bzw.
Qualitätskonzept. Primarschule Altnau
 Qualitätskonzept Primarschule Altnau Gültig ab 1. August 2015 Vernehmlassung bei Schulbehörde, Schulberatung und Schulaufsicht April/Mai 2015 Genehmigt durch die Schulbehörde am 8. Juni 2015 Primarschule
Qualitätskonzept Primarschule Altnau Gültig ab 1. August 2015 Vernehmlassung bei Schulbehörde, Schulberatung und Schulaufsicht April/Mai 2015 Genehmigt durch die Schulbehörde am 8. Juni 2015 Primarschule
Spezifische Hinweise zu den Anforderungen und Standards der Cross Compliance
 CROSS COMPLIANCE Boden Wasser Landschaft Biodiversität Kennzeichnung und Registrierung von Tieren Lebensmittelsicherheit Tierschutz Pflanzenschutzmittel AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA
CROSS COMPLIANCE Boden Wasser Landschaft Biodiversität Kennzeichnung und Registrierung von Tieren Lebensmittelsicherheit Tierschutz Pflanzenschutzmittel AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA
Vereinbarung über den Schutz und die Pflege des Weltkulturerbes Stiftsbezirk St.Gallen
 Vereinbarung über den Schutz und die Pflege des Weltkulturerbes Stiftsbezirk St.Gallen Die Regierung des Kantons St.Gallen, der Administrationsrat des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen
Vereinbarung über den Schutz und die Pflege des Weltkulturerbes Stiftsbezirk St.Gallen Die Regierung des Kantons St.Gallen, der Administrationsrat des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen
Regionale Gewerbezone Schams
 Regionale Gewerbezone Schams Projektorganisation Strategische Steuergruppe: Fritz Bräsecke, Gemeindepräsident Ferrera Andrea Clopath, Gemeindepräsident Zillis-Reischen Silvio Clopath, Gemeindepräsident
Regionale Gewerbezone Schams Projektorganisation Strategische Steuergruppe: Fritz Bräsecke, Gemeindepräsident Ferrera Andrea Clopath, Gemeindepräsident Zillis-Reischen Silvio Clopath, Gemeindepräsident
Landwirtschaftliche Drainagen der Schweiz: quo vadis?
 Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD Bundesamt für Landwirtschaft BLW Landwirtschaftliche Drainagen der Schweiz: quo vadis? Jan Béguin, Fachbereich Meliorationen Referenz/Aktenzeichen: 2010-04-01/265
Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD Bundesamt für Landwirtschaft BLW Landwirtschaftliche Drainagen der Schweiz: quo vadis? Jan Béguin, Fachbereich Meliorationen Referenz/Aktenzeichen: 2010-04-01/265
Schutz der Umgebung von Denkmälern
 Eidgenössisches Departement des Innern EDI Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege EKD Schutz der Umgebung von Denkmälern Grundsatzpapier Referenz/Aktenzeichen 362.64 1. Ziel Jedes Denkmal steht in
Eidgenössisches Departement des Innern EDI Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege EKD Schutz der Umgebung von Denkmälern Grundsatzpapier Referenz/Aktenzeichen 362.64 1. Ziel Jedes Denkmal steht in
Gemeinde Obersiggenthal
 Gemeinde Obersiggenthal Natur- und Heimatschutzprogramm - - 2016 Stand: 6. November Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 1 2. Grundsätze / Leitbild des kommunalen Natur- und Heimatschutzes der Gemeinde
Gemeinde Obersiggenthal Natur- und Heimatschutzprogramm - - 2016 Stand: 6. November Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 1 2. Grundsätze / Leitbild des kommunalen Natur- und Heimatschutzes der Gemeinde
Partnerinformation Nationale Strategie Prävention nichtübertragbarer Krankheiten
 Bern, 28. November 2013 Partnerinformation Nationale Strategie Prävention nichtübertragbarer Krankheiten Sehr geehrte Damen und Herren Liebe Kolleginnen und Kollegen Wir freuen uns, Sie hiermit erstmals
Bern, 28. November 2013 Partnerinformation Nationale Strategie Prävention nichtübertragbarer Krankheiten Sehr geehrte Damen und Herren Liebe Kolleginnen und Kollegen Wir freuen uns, Sie hiermit erstmals
S t e c k b r i e f. Kneipen Säle Vereinslokale. Lebensmittelgeschäfte Bäcker Metzger Post Bank
 S t e c k b r i e f 1. Bewerbung von: Gemeinde: a) Ort b) Ortsgruppe c) Stadtteil (Unzutreffendes streichen) Wieso diese Kombination? 2. Einwohnerzahlen 3. Bevölkerungsstruktur (in Prozent) Einwohner 1900
S t e c k b r i e f 1. Bewerbung von: Gemeinde: a) Ort b) Ortsgruppe c) Stadtteil (Unzutreffendes streichen) Wieso diese Kombination? 2. Einwohnerzahlen 3. Bevölkerungsstruktur (in Prozent) Einwohner 1900
Teil 2: Strategieprozess
 Teil 2: Strategieprozess Schwyz, April 2011 1 Inhalt 1. Ausgangslage 2. Zeitplan 3. Zusammenfassung der landwirtschaftl. Strukturanalyse im Kt. Schwyz Stärken / Schwächen Chancen / Gefahren Fazit und Herausforderungen
Teil 2: Strategieprozess Schwyz, April 2011 1 Inhalt 1. Ausgangslage 2. Zeitplan 3. Zusammenfassung der landwirtschaftl. Strukturanalyse im Kt. Schwyz Stärken / Schwächen Chancen / Gefahren Fazit und Herausforderungen
Vertrag. 1 Vertragspartner. 2 Aufgaben. 3 Controlling. III / Nr. 100b
 III / Nr. 100b Vertrag Vertragszweck Dieser Vertrag regelt die Bestandesübergabe und -übernahme der Medien, die zukünftig am Pädagogischen Medienzentrum ausgeliehen werden. Der Vertrag regelt im Weiteren
III / Nr. 100b Vertrag Vertragszweck Dieser Vertrag regelt die Bestandesübergabe und -übernahme der Medien, die zukünftig am Pädagogischen Medienzentrum ausgeliehen werden. Der Vertrag regelt im Weiteren
Wirtschaftsraum Thun WRT Referat von:
 Wirtschaftsraum Thun WRT Referat von: Philippe Haeberli Leiter Abteilung Stadtmarketing Thun Einleitung : Volkswirtschaftliche Daten Die Wirtschaftsregionen des Kantons Bern Berner Jura Biel- Seeland Oberaargau
Wirtschaftsraum Thun WRT Referat von: Philippe Haeberli Leiter Abteilung Stadtmarketing Thun Einleitung : Volkswirtschaftliche Daten Die Wirtschaftsregionen des Kantons Bern Berner Jura Biel- Seeland Oberaargau
Informationsveranstaltung Pilotprojekt Lehrort 10. Dezember 14. André Pfanner / Barbara Schmid
 Informationsveranstaltung Pilotprojekt Lehrort 10. Dezember 14 André Pfanner / Barbara Schmid Ausgangslage Im 2013 wurde im Rahmen eines Vorprojekts Grundlagen zur Umsetzung des Lehrortprinzips im Kanton
Informationsveranstaltung Pilotprojekt Lehrort 10. Dezember 14 André Pfanner / Barbara Schmid Ausgangslage Im 2013 wurde im Rahmen eines Vorprojekts Grundlagen zur Umsetzung des Lehrortprinzips im Kanton
passepartout-ch Nationales Zentrum für Kinder und Jugendförderung, Moosseedorf Konzept Moosseedorf, Januar 2004 markus.gander@infoklick.
 Nationales Zentrum für Kinder und Jugendförderung, Moosseedorf Konzept Moosseedorf, Januar 2004 Markus Gander Geschäftsführer INFOKLICK markus.gander@infoklick.ch Vinzenz Miescher Projektleiter vinzenz.miescher@infoklick.ch
Nationales Zentrum für Kinder und Jugendförderung, Moosseedorf Konzept Moosseedorf, Januar 2004 Markus Gander Geschäftsführer INFOKLICK markus.gander@infoklick.ch Vinzenz Miescher Projektleiter vinzenz.miescher@infoklick.ch
Naturinventar. Wozu dient ein Naturinventar? Warum ein Naturinventar?
 Naturinventar Das kommunale Naturinventar erfasst die Lebensräume von lokaler Bedeutung: u.a. Obstgärten, Hecken, Solitärbäume, Extensivwiesen, Bachläufe, wertvolle Waldgebiete. Warum ein Naturinventar?
Naturinventar Das kommunale Naturinventar erfasst die Lebensräume von lokaler Bedeutung: u.a. Obstgärten, Hecken, Solitärbäume, Extensivwiesen, Bachläufe, wertvolle Waldgebiete. Warum ein Naturinventar?
Bundesamt für Umwelt BAFU Aktionsplan Strategie Biodiversität Schweiz
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Aktionsplan Strategie Biodiversität Schweiz 3. Naturschutz-Kafi SL&K, 15. Februar 2013 Strategie
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Aktionsplan Strategie Biodiversität Schweiz 3. Naturschutz-Kafi SL&K, 15. Februar 2013 Strategie
Schönste Landschaften an historischen Wegen
 Besonders wertvolle Flächen erhalten den Kulturlandschaftspreis Schönste Landschaften an historischen Wegen Gemeinsam mit den Tourismusorganisationen vergibt die Regionalkonferenz Oberland Ost dieser Tage
Besonders wertvolle Flächen erhalten den Kulturlandschaftspreis Schönste Landschaften an historischen Wegen Gemeinsam mit den Tourismusorganisationen vergibt die Regionalkonferenz Oberland Ost dieser Tage
Perspektivenkonferenz 2007
 Perspektivenkonferenz 2007 Leitbild Gemeinde Weßling Dokumentation 16. Juli, Freizeitheim Hochstadt IDENTITÄT & IMAGE Coaching AG Büro Augsburg Bei St. Ursula 12 86150 Augsburg Tel. 08 21 / 319 67 52 Fax
Perspektivenkonferenz 2007 Leitbild Gemeinde Weßling Dokumentation 16. Juli, Freizeitheim Hochstadt IDENTITÄT & IMAGE Coaching AG Büro Augsburg Bei St. Ursula 12 86150 Augsburg Tel. 08 21 / 319 67 52 Fax
Mobilität Thurgau BTS / OLS
 Mobilität Thurgau BTS / OLS Linienführung BTS im Raum Oberaach Informationsveranstaltung Amriswil, 19. Juni 2013 Linienführung BTS im Raum Oberaach Herzlich willkommen 2 1 Ablauf Einleitung Präsentation
Mobilität Thurgau BTS / OLS Linienführung BTS im Raum Oberaach Informationsveranstaltung Amriswil, 19. Juni 2013 Linienführung BTS im Raum Oberaach Herzlich willkommen 2 1 Ablauf Einleitung Präsentation
European Energy Award. Kommunale Energiearbeit optimieren und erfolgreich umsetzen.
 European Energy Award. Kommunale Energiearbeit optimieren und erfolgreich umsetzen. Qualitätsmanagement. Ermittlung von Energiekennzahlen Wie lässt sich kommunale Energiearbeit optimieren und erfolgreich
European Energy Award. Kommunale Energiearbeit optimieren und erfolgreich umsetzen. Qualitätsmanagement. Ermittlung von Energiekennzahlen Wie lässt sich kommunale Energiearbeit optimieren und erfolgreich
Gesetz über den Natur- und Heimatschutz im Kanton Schaffhausen
 45.00 Gesetz über den Natur- und Heimatschutz im Kanton Schaffhausen vom. Februar 968 Der Grosse Rat des Kantons Schaffhausen beschliesst als Gesetz: I. Allgemeines Art. ) Schützenswerte Landschaften,
45.00 Gesetz über den Natur- und Heimatschutz im Kanton Schaffhausen vom. Februar 968 Der Grosse Rat des Kantons Schaffhausen beschliesst als Gesetz: I. Allgemeines Art. ) Schützenswerte Landschaften,
Zusammenarbeit im E-Government
 egov Meeting 18. November 2014 Zusammenarbeit im E-Government Herzlich willkommen Zusammenarbeit im E-Government Programm E-Government im Kanton Aargau, Zusammenarbeit Luzern Marco Bürli Leiter E-Gov-Projekte,
egov Meeting 18. November 2014 Zusammenarbeit im E-Government Herzlich willkommen Zusammenarbeit im E-Government Programm E-Government im Kanton Aargau, Zusammenarbeit Luzern Marco Bürli Leiter E-Gov-Projekte,
Protokoll der 8. Sitzung des Arbeitskreises 02.07.2009
 Themen: Gebäude & Siedlung, Diskussion von Gestaltungsvorschlägen für den Dorfplatz und den Bereich Ortseinfahrt / Mühlenteich Gebäude & Siedlung Die Gebäude- und Freiraumsituation in Schorborn wurde anhand
Themen: Gebäude & Siedlung, Diskussion von Gestaltungsvorschlägen für den Dorfplatz und den Bereich Ortseinfahrt / Mühlenteich Gebäude & Siedlung Die Gebäude- und Freiraumsituation in Schorborn wurde anhand
2 Raumkonzept Uri. Raum- und Zentrenstruktur 2.1. Querverweis Die im Raumkonzept verwendeten
 2 Raumkonzept Uri Der Kanton Uri ist geprägt durch die besondere Schönheit der alpinen Landschaft zwischen Gotthardmassiv und Vierwaldstättersee. Wertvolle Natur- und Kulturlandschaften mit der Land- und
2 Raumkonzept Uri Der Kanton Uri ist geprägt durch die besondere Schönheit der alpinen Landschaft zwischen Gotthardmassiv und Vierwaldstättersee. Wertvolle Natur- und Kulturlandschaften mit der Land- und
Industriebrachen-Plattform Schweiz www.areale.ch
 Industriebrachen-Plattform Schweiz www.areale.ch Die nationale Internetadresse für die Umnutzung von Industriebrachen www.areale.ch 1 Industriebrachen nutzen Eine Idee macht Boden gut Vorwort Gérard Poffet
Industriebrachen-Plattform Schweiz www.areale.ch Die nationale Internetadresse für die Umnutzung von Industriebrachen www.areale.ch 1 Industriebrachen nutzen Eine Idee macht Boden gut Vorwort Gérard Poffet
Verein Safier Ställe. Zwischenbilanz 2011 24.01.11, Peter Luder
 Zwischenbilanz 2011 24.01.11, Peter Luder Seit der Ausschreibung der 1. Etappe des Projekts Safier Ställe im Herbst 2003 sind sieben Jahre vergangen. In dieser Zeit wurden 28 Dächer saniert, eine Schindelwerkstatt
Zwischenbilanz 2011 24.01.11, Peter Luder Seit der Ausschreibung der 1. Etappe des Projekts Safier Ställe im Herbst 2003 sind sieben Jahre vergangen. In dieser Zeit wurden 28 Dächer saniert, eine Schindelwerkstatt
egov Meeting Objekt.lu Objektwesen Luzern 18. November 2014, 16.00-17.30 Uhr Regierungsgebäude, Kantonsratssaal Raum und Wirtschaft
 egov Meeting 18. November 2014, 16.00-17.30 Uhr Regierungsgebäude, Kantonsratssaal Objekt.lu Objektwesen Luzern objekt.lu 15' Ausgangslage: Domänen ech-129 Bewertung zu Risikoabschätzung + Prävention Versicherung
egov Meeting 18. November 2014, 16.00-17.30 Uhr Regierungsgebäude, Kantonsratssaal Objekt.lu Objektwesen Luzern objekt.lu 15' Ausgangslage: Domänen ech-129 Bewertung zu Risikoabschätzung + Prävention Versicherung
Steuerung E-Government Luzern
 Steuerung E-Government Luzern 19. September 2014, 10.00-12.00 Uhr Finanzdepartement, Sitzungszimmer 101 Informationen zu den Projekten objekt.lu - Objektwesen Luzern ebage + - Elektronischen Baubewilligungsverfahren
Steuerung E-Government Luzern 19. September 2014, 10.00-12.00 Uhr Finanzdepartement, Sitzungszimmer 101 Informationen zu den Projekten objekt.lu - Objektwesen Luzern ebage + - Elektronischen Baubewilligungsverfahren
Einwohnergemeinde Ostermundigen. Änderung Baureglement MITWIRKUNG_VORPRÜFUNG
 MITWIRKUNG_VORPRÜFUNG Einwohnergemeinde Ostermundigen Die (BauR) besteht aus: Ergänzung mit Art. 11a Anpassung im Art. 42 Ziffer 5 weitere Unterlagen: Erläuterungsbericht 12. Januar 2016 ecoptima Spitalgasse
MITWIRKUNG_VORPRÜFUNG Einwohnergemeinde Ostermundigen Die (BauR) besteht aus: Ergänzung mit Art. 11a Anpassung im Art. 42 Ziffer 5 weitere Unterlagen: Erläuterungsbericht 12. Januar 2016 ecoptima Spitalgasse
nach Einsicht in Bericht und Vorlage des Regierungsrates, auf Antrag einer Spezialkommission,
 Gesetz über das E-Government (Vom. April 009) Der Kantonsrat des Kantons Schwyz, nach Einsicht in Bericht und Vorlage des Regierungsrates, auf Antrag einer Spezialkommission, beschliesst: I. Allgemeine
Gesetz über das E-Government (Vom. April 009) Der Kantonsrat des Kantons Schwyz, nach Einsicht in Bericht und Vorlage des Regierungsrates, auf Antrag einer Spezialkommission, beschliesst: I. Allgemeine
Konzept Windenergie Kanton Luzern
 Region Luzern West idee seetal AG Region Sursee-Mittelland LuzernPlus Konzept Windenergie Kanton Luzern Teilprojekt und Erweiterung NRP-Projekt Luzern Energie Windenergieanlage Feldmoos, Entlebuch ( www.erlebnisenergie.ch)
Region Luzern West idee seetal AG Region Sursee-Mittelland LuzernPlus Konzept Windenergie Kanton Luzern Teilprojekt und Erweiterung NRP-Projekt Luzern Energie Windenergieanlage Feldmoos, Entlebuch ( www.erlebnisenergie.ch)
Rahmenlehrplan (RLP) animatorisches Profil HF
 Rahmenlehrplan (RLP) animatorisches Profil HF Ein Projekt zur Schaffung eines neuen Berufstitels HF im Bereich Soziales 1. Hintergrund SAVOIRSOCIAL lehnte den im 2008 eingereichten Rahmenlehrplan (RLP)
Rahmenlehrplan (RLP) animatorisches Profil HF Ein Projekt zur Schaffung eines neuen Berufstitels HF im Bereich Soziales 1. Hintergrund SAVOIRSOCIAL lehnte den im 2008 eingereichten Rahmenlehrplan (RLP)
Planänderungsverfahren. ( Deckblattverfahren ) zum. Planfeststellungsverfahren. zum Bau und Betrieb der. Gashochdruckleitung Burghausen - Finsing
 Planänderungsverfahren ( Deckblattverfahren ) zum Planfeststellungsverfahren zum Bau und Betrieb der Gashochdruckleitung Burghausen - Finsing DN 1200, MOP 100 bar Gemeinde Moosinning Gemeinde Markt Isen
Planänderungsverfahren ( Deckblattverfahren ) zum Planfeststellungsverfahren zum Bau und Betrieb der Gashochdruckleitung Burghausen - Finsing DN 1200, MOP 100 bar Gemeinde Moosinning Gemeinde Markt Isen
Anlagen zur Nutzung der Windenergie. Bewilligungsverfahren und Beurteilungskriterien. Wegleitung. Amt für Gemeinden und Raumordnung März 2008
 Ÿ Anlagen zur Nutzung der Windenergie Bewilligungsverfahren und Beurteilungskriterien Wegleitung Amt für Gemeinden und Raumordnung März 2008 Anlagen zur Nutzung der Windenergie Bewilligungsverfahren und
Ÿ Anlagen zur Nutzung der Windenergie Bewilligungsverfahren und Beurteilungskriterien Wegleitung Amt für Gemeinden und Raumordnung März 2008 Anlagen zur Nutzung der Windenergie Bewilligungsverfahren und
Botschaft des Regierungsrates an den Kantonsrat B 123. zum Entwurf eines Kantonsratsbeschlusses
 Botschaft des Regierungsrates an den Kantonsrat B 123 zum Entwurf eines Kantonsratsbeschlusses über die Genehmigung der Abrechnung über den Ausbau der linksufrigen Zuflüsse zur Kleinen Emme entlang der
Botschaft des Regierungsrates an den Kantonsrat B 123 zum Entwurf eines Kantonsratsbeschlusses über die Genehmigung der Abrechnung über den Ausbau der linksufrigen Zuflüsse zur Kleinen Emme entlang der
Windkraftanlagen E 1.3
 Richtplan Kanton Aargau E 1.3 1 Windkraftanlagen E 1.3 Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag Das 2007 revidierte Energiegesetz des Bundes (EnG) schreibt vor, die durchschnittliche Jahreserzeugung
Richtplan Kanton Aargau E 1.3 1 Windkraftanlagen E 1.3 Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag Das 2007 revidierte Energiegesetz des Bundes (EnG) schreibt vor, die durchschnittliche Jahreserzeugung
Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich
 Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich KR-Nr. 31/2005 Sitzung vom 30. März 2005 472. Interpellation (SIL-Verfahren) Kantonsrat Martin Mossdorf, Bülach, Kantonsrätin Ursula Moor-
Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich KR-Nr. 31/2005 Sitzung vom 30. März 2005 472. Interpellation (SIL-Verfahren) Kantonsrat Martin Mossdorf, Bülach, Kantonsrätin Ursula Moor-
DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT. 6. Oktober 2014 PFLICHTENHEFT EREIGNISDOKUMENTATION HOCHWASSER. 1. Einleitung
 DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT Abteilung Landschaft und Gewässer Wasserbau 6. Oktober 2014 PFLICHTENHEFT EREIGNISDOKUMENTATION HOCHWASSER 1. Einleitung Eine ausführliche Ereignisdokumentation wird
DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT Abteilung Landschaft und Gewässer Wasserbau 6. Oktober 2014 PFLICHTENHEFT EREIGNISDOKUMENTATION HOCHWASSER 1. Einleitung Eine ausführliche Ereignisdokumentation wird
Dokumentation der Sonderschau «Unser Wald. Nutzen für Alle.» im Rahmen der Luga 2011
 Dokumentation der Sonderschau «Unser Wald. Nutzen für Alle.» im Rahmen der Luga 2011 Geländeplan Luga 2011 B a u s t e l l e Z e n t r a l b a h n Tribüne Sonderschau «Unser Wald. Nutzen für Alle.» Arena
Dokumentation der Sonderschau «Unser Wald. Nutzen für Alle.» im Rahmen der Luga 2011 Geländeplan Luga 2011 B a u s t e l l e Z e n t r a l b a h n Tribüne Sonderschau «Unser Wald. Nutzen für Alle.» Arena
