Der "gute Wille" zur Verstandigung (Gadamer) und das "Hinterfragen" (Nietzsche).
|
|
|
- Karl Maier
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Der "gute Wille" zur Verstandigung (Gadamer) und das "Hinterfragen" (Nietzsche). - Zwei diametral entgegengesetzte Positionen philosophischer Hermeneutik- EBERHARD SCHEIFFELE 1 In der Geschichte der philosophischen Hermeneutik scheint sich ein bestimmtes historisches Schema" herausgebildet zu haben, demgemass " ihre "teleologisch aufeinander bezogenen Stufen oder Phasen" die Namen Schleiermacher, Dilthey, Heidegger und Gadamer bezeichnen.1) Nietzsches auslegende Denk-und Schreibweise wird noch heute starker in der franzosischen als in der deutschsprachigen Forschung beachtet.2) Der Frage, weshalb er auf die deutsche Hermeneutik-Diskussion so lange kaum eine Wirkung ausgeubt hat, konnen wir hier nicht nachgehen. Richtungsweisend ist sicher Diltheys abschatziges Urteil geworden. Zwar nannte der ihn den "tiefsten Philosophen der Gegenwart".3) Doch waren es wohl Vorbemerkung Diese Arbeit versteht sich als Fortsetzung meiner Aufsatze: 'Questioning Back behind One's "Own" From the Perspective of the Foreign' (erscheint demnachst in: Graham Parkes (Hg.), Nietzsche and Asian Thought) und 'Das Eigene vom Fremden her hinterfragen' (wird in den 'Akten des VIII. Internationalen Germanistenkongresses Tokyo 1990' veroffentlicht). Manches dort Ausgefuhrte wird in diesem Aufsatz zusammengefasst. An einigen Stellen liessen sich Uberschneidungen nicht vermeiden. Manchmal habe ich auch-der besseren Verstandlichkeit wegen-ausfuhrungen der beiden anderen Arbeiten wortlich wiederholt. Nietzrches Schriften werden zitiert nach: Friedrich Nietzsche, Kritische Studienausgabe in 15 Banden, hg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Berlin Stellenangabc im Text: Bandzahl, Seitenzahl (in Klammern). 1) Ernst Behler, Derrida-Nietzsche Nietzsche-Derrida, Munchen u.a. 1988, S ) Ebd, S. 89ff. ; ferner: Rudolf E. Kunzli, Nietzsche und die Semiologie: Neue Ansatze in der franzosischen Nietzsche-Interpretation. In: Nietzsche-Studien Bd 5 (1976), S ; Alfredo Guzzoni (Hg.), 90 Jahre philosophischer Nietzsche-Rezeption, Meisenheim/Konigstein ) Wilhelm Dilthey, GS VIII, 229.
2 86 EBERHARD SCHEIFFELE Nietzsches schroffe Ablehnung der Konzeption vom einfuhlenden Ver stehen,begriffe wie Ubermensch e und Ewige Wiederkunft', vor allem aber seine Verquickung des Verstehensproblems mit der gwerthfrage h (VI, 278), die ihm Diltheys Vorwurf eines gruckzug(s) von der Erkenntnis auf geni ale,fragmentarisch sich aussernde Subjektivitat h eintrugen.4) Und Gadamer? Er betont zwar, durch Nietzsche habe der Begriff der Interpretation eine,weit tiefere und allgemeinere Bedeutung h erlangt.5) Aber in ewahrheit und Methode f, das man immerhin das gklassische Grundbuch der modernen Hermeneutik h genannt hat, 6) erwahnt er ihn nur am Rand, ohne these Zurucksetzung eines Philosophen, durch den doch der Interpretationsbegriff erst, wie er selbst sagt, eine so grundle gendebedeutung erlangt hat, naher zu begrunden. Wir werden sehen, dass Nietzsches hermeneutische Position und die Gadamers grundverschieden sind, auch wenn sie an der Oberflache manches gemeinsam haben. Gada merselbst muss von der Unvertraglichkeit beider Konzeptionen etwas gespurt haben, da er von Nietzsches gverzweifelte(m) Extremismus h spricht. 7) Die Situation hat sich allerdings seit den 70er Jahren sehr geandert. Ohne Ubertreibung kann man sagen, dass Nietzsches Beitrag zu einer philosophischen Hermeneutik, ja seine heutige Aktualitat erst entdeckt werden musste. 8) Zunachst fand man bei ihm Anklange an die theologische und die 4) Dilthey, GS IV, ) Hans Georg Gadamer, Vernunft im Zeitalter der Wissenschaft 1976, S. 93., Frankfurt a.m. 6) Walter SchulZ, Anmerkungen zur Hermeneutik Gadamers. In: Hermeneutik und Dialektik, hg. von Rudiger Bubner u.a., Bd I, Tubingen 1970, S ; S S. auch: Johann Figl, Interpretation als philosophisches Prinzip, Friedrich Nietzsches universale Theorie der Auslegung im spaten Nachlass, Berlin New York 1982, S. 3f. 7) Gadamer, Wahrheit und Methode, Grundzuge einer philosophischen Hermeneutik, 2. Aufl., Tubingen 1965, S ) Einige der umfangreicheren Arbeiten seien hier nur genannt: Heinz Rottges, Nietzsche und die Dialektik der Auflarung, Berlin New York 1972; Ruediger H. Grimm, Nietzsche's Theory of Knowledge, Berlin New York 1977; Friedrich Kaulbach, Nietzsches Idee einer Experimentalphilosophie, Koln Wien 1980; Figl, Interpretation als philoso phischesprinzip (s. Anm. 6): Figl, Dialektik der Gewalt. Nietzsches hermeneutische Religionsphilosophie, Dusseldorf 1984; Behler, Derrida-Nietzsche Nietzsche-Derrida (s. Anm. 1); Gunter Abel, Nietzsche, Die Dynamik des Willens zur Macht und die ewige Wiederkehr, Berlin New York Zur Einschatzung Nietzsches in der Hermeneutik- Diskussion bis Gadamer s. Figl, Interpretation als philosophisches Prinzip, S. 2ff.
3 Der ggute Wille h zur Verstandigung (Gadamer) und das ghinterfragen h (Nietzsche) 87 philologische Hermeneutik, was bei dem Pastorensohn, dem Pforta-Schuler u nd dem dann in klassischer Philologie ausgebildeten Gelehrten nicht u berrascht. Von grosserem Gewicht ist die Tatsache, dass Nietzsche Errungenschaften der philosophischen Hermeneutik unseres Jahrhunderts vor weggenommenhat. Er ubertrug den Text-Begriff ja nicht nur auf die Ge schichte(v, 56). Was ihn zu der Einsicht in die grundsatzliche Unab schliessbarkeit des Interpretierens gefuhrt hat, war der Gedanke, galles Dasein (sei) essentiell ein auslegendes Dasein h; daher schliesse die gwelt h gun endliche Interpretationen in sich h (III, 626f.). So verdienstvoll der Nachweis auch ist, erst Nietzsche habe der Philo logiefur die Philosophie gihren Begriff der Deutung, Auslegung entlehnt h,9) ja er habe mit seinem gversuch einer neuen Auslegung alles Geschehens h (XI, 619) das Gebiet der Hermeneutik uber die Bereiche der Kulturwis senschaften,der Anthropologic und sogar der Wissenschaften vom Or ganischenhinaus erweitert und sie, lange vor Heidegger, ontologisch fun diert10),so ist doch auch damit erst seine Vorlaufer-Rolle festgestellt und nur wenig ausgesagt uber die Bedeutung seiner hermeneutischen Position fur die heute aktuelle Auseinandersetzung. 2 Die Welt, die wir vorfinden, ist fur Nietzsche gkein Thatbestand, son derneine Ausdichtung und Rundung uber einer mageren Summe von Beobachtungen h (XII, 114). Wir glegen h sie gaus h heisst dann immer schon: wir glegen h sic uns gzurecht h (V, 28). Das geschieht nicht aus Willkiir and schon gar nicht in der theoretischen Absicht, zu erkennen, was eist, f sondern aus dem gbedurfnis h nach gverstandigung h heraus, nach g Berechnung h. Das Unbekannte soll gzurechtgemacht h, zum gahnlichen, Gleichen h gausgedichtet h werden. 11) gwir haben uns eine Welt zurecht gemacht, in der wir leben konnen h (III, 477). Wie es schon in einer fruhen Nachlassschrift heisst, mochte der Mensch durch ein gbewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen h einer Welt, die ean 9) Paul Ricoeur, Die Interpretation, Ein Versuch uber Freud, Frankfurt a. M. 1974, S ) So Figl, Interpretation als philosophisches Prinzip, S. 45ff., 55f., v.a. Teil 2 des Buches. Dem widerspricht Abel, ebd, S. 171, 173, 183. Uber die, ggenaue f Wahrnehmung in der anorganischen Welt h s. Figl, ebd, S. 107f. 11) NietZsche, Der Wille zur Macht, Versuch einer Umwertung aller Werte, hg. von Peter Gast, Stuttgart 1964, Nr. 515.
4 88 EBERHARD SCHEIFFELE sich eohne Zweck sei, Sinn verleihen und ihr somit das Beunruhigende der Fremdheit nehmen (I, 880). Damit fuhrt Nietzsche den Antrieb alles Erkennens sowie alles Glaubens und Schatzens auf den ginstinkt der Furcht h zuriick. g(...) etwas Fremdes soll auf etwas Bekanntes zuruckgefuhrt werden (...). h So sei gunter Be durfniss nach Erkennen (...) eben dies Bedurfniss nach Bekanntem, der Wille, unter allem Fremden, Ungewohnlichen, Fragwurdigen Etzvas auf zudecken,das uns nicht mehr beunruhig(e) h (III, 594).12) Hier fallt die Gleichsetzung von ebedurfnis f und ewille f auf. Spater sagt Nietzsche g Wille zur Macht h dazu. Demnach ist es dem Willen nicht nur darum zu tun, sich sozusagen reaktiv vor dem Bedrohlich-Fremden zu schutzen, sondern darum, dieses sich gleich zu machen, sich einzuverleiben und so die eigene Macht zu steigern: gin Wahrheit ist Interpretation ein Mittel selbst, um uber etivas Herr Zu werden h (XII, 140). 13) Das Bedurfnis nach Sicherheit, nach gberechenbarkeit h (XI, 209) als der Wille, durch Aneignung des Unbekannten Herr zu werden, hat Nietzsche bekanntlich immer erneut aufzuspuren versucht, in der gwelt-auslegung und-zurechtlegung h (V, 28) des Mythos, der Religion (III, 589), der Moral (V, 293f.), der Psychologie (XII, 427f.), der Historie (III, 404), der Physik (V, 28), der Logik (III, 471; V, 30f.), der Erkenntnis uberhaupt (XII, 315). Wo der Mensch vermeine gthatsachen h zu erklaren, interpre tiereer immer gnur Interpretationen h (XII, 315). 14) So ist fur Nietzsche g das Perspektivische h die ggrundbedingung h des Erkennens wie galles Lebens h Uberhaupt (V, 12). Sein fruher Gedanke, die gplastische Kraft h eines gmenschen, eines Volkes, einer Cultur h entscheide daru ber, ob sie fahig seien, gvergan genesund Fremdes umzubilden und einzuverleibe h (I, 251), kehrt also spater wieder unter der Direktive des Leitbegriffes Wille zur Macht e. Nietzsche sieht schliesslich in diesem gumbilden h, diesem geinverleiben h den Grundtrieb des Organischen uberhaupt, ja auch des Anorganischen 12) Vgl. III, 72; V, 328. Diesen Gedanken haben Horkheimer und Adorno in edialek tikder Aufklarung f ubernommen und weiterentwickelt. 13) NietZscbe bringt im Zarathustra beide Momente auf den Begriff: gwerthe legte erst der Mensch in die Dinge, sich zu erhalten h (Moment des Erhaltens); er gschuf h ihnen g Menschen-Sinn h als der gschdtzende h, gschaffende h (Moment des Sichanverwandelns) (IV, 75). 14) Mit seinem Versuch einer gdekonstruktion des Logozentrismus h schliesst Derrida hier an NietZsche an. Jacques Derrida, L'ecriture et la difference, Paris 1967, S. 411f. Vgl. KiinZli, ebd, S. 274f.
5 Der ggute Wille h zur Verstandigung (Gadamer) und das ghinterfragen h (Nietzsche) 89 (XI, 560f.). Das ggleichsetzen h sei tatsachlich ein ggleichmachen h und dieses in allem gdenken, Urtheilen, Wahrnehmen als Vergleichen h gdas selbe,was die Einverleibung der angeeigneten Materie in die Amobe (sei) h (XII, 209). Da aber gjeder spezifische Korper (danach) streb (e) h, sich das Unbekannte eauslegend f anzueignen, stosse er gfortwahrend auf gleiche Bestrebungen anderer Korper h (XIII, 373f.). Und da er den Willen habe, sich die Welt gerrathba(r) h zu machen (XII, 385), musse er die eigene g Erratbarkeit h notwendig verhindern: gder Starkere wehrt (...) ab von sich h (XI, 560). Es ist also nicht nur Koketterie oder der krampfhafte Versuch des Ver einsamten,aus der Not der Isolation die Tugend der Uberlegenheit zu machen, wenn Nietzsche so oft die gewollte Fremdartigkeit, ja Unzugang lichkeitseines eigenen Denkens herausstreicht. 15) Ein Interpretations- Begriff, der sich auf die Konzeption des Willens zur Macht grundet, fuhrt notwendigerweise zu einer Hermeneutik, die sich dem Zu Verstehenden hermetisch verschliesst, um ja nicht selbst zu dessen interpretandum zu werden. 3 Eine derart hermetische Hermeneutik musste aber recht verstiegen wirken and ware fur die heutige Diskussion kaum von besonderem Gewicht, deutete man diese gunerratbarkeit h des Interpreten so, als sollte hier eine feste eigene Position gegenuber interpretatorischen Eingriffen von aussen abgesichert werden. Das ware ein arges Missverstandnis. Denn eine solch feste Position des Eigenen gibt es fur Nietzsche nicht. Wenn er sich selbst den gprinzen Vogelfrei h nennt, sein ggeistige(s) Nomadenthum h betont (II, 469), so ist das, wie ich denke, ernstzunehmen. Wie wir sahen, deutet er zwar ginterpretation h als die Aneignung des Fremden, als gein Mittel (...), um uber etwas Herr Zu werden h (XII, 140). Andererseits hat es NietZ sche aber auch immer wieder unternommen, das galte, Altbekannte, von Jedermann Gesehene und Uebersehene h (II, 465) fremdzumachen, indem er es gerade von dessen jeweils fremden Gegenpositionen aus kritisch anvisiert hat. 16) In diesem zweiten Fall ist es gerade das Eigene, das ausgelegt wird, und zwar von 15) S. etwa VI, 1,298; III, 622f., 633f., 403; V, 43; II, 627; II, 407; VIII, 25; XI, ) Damit sind hier der Position des je eeigenen f entgegengesetzte Positionen gemeint (etwa: Griechentum/Christentum). Vgl. Wolfgang Muller-Lauter, Nietzsche, Seine Philosophic der Gegensatze und die Gegensatze seiner Philosophic, Berlin New York 1971, S. 16: gvon der Methode der Ableitung eines Sachverhalts aus dem ihm entge gengesetztenmacht Nietzsche bekanntlich reichen Gebrauch. h
6 90 EBERHARD SCHEIFFELE einer fremden, also dem Eigenen eben nicht geinverleibten h, Position aus. Nun ist es Nietzsche dabei weniger darum zu tun, dern Fremden als solchem gerechtzuwerden, als vielmehr darum, das Eigene vom Fremden her gneu h zu sehen (II, 465), das eselbstverstdndliche f als befremdlich er scheinenzu lassen, indem man es ghinterfragt h (III, 301). Nicht jene seien g die eigentlich originalen Kopfe h, die etwas Neues zuerst, sondern die, welche das eselbstverstandliche f und daher gerade gubersehene h Eigene anders sahen (II, 465). Damit ist ein Grundproblem der Hermeneutik auf den Begriff gebracht. Schon hier zeichnet sich eine Gegenposition zu der Gadamers ab: statt einer Wahrung und Erweiterung des guberlieferungsgeschehens h17) des sen ghinterfragen h; statt einer ghorizontverschmelzung h gerade das g Umstellen h von Perspektiven (VI, 266).18) Und schon jetzt wird eine gewisse Nahe der Nietzscheschen egenealogie f sowohl zu Derridas edekonstruktion f19) wie zu Foucaults earchdologie f erkennbar. Z. B. sagt Foucault: gich versuche tatsachlich, mich ausserhalb der Kultur, der wir angehoren, zu stellen, um ihre formalen Bedingungen zu analysieren, um gewissermassen ihre Kritik zu bewerkstelligen (...). h20) 4 Nietzsches Versuche, die eigene Kultur gneu h, und das heisst: kritisch g hinterfragend h zu sehen, lassen sich hauptsachlich in vier Gruppen ein teilen.1. Das Eigene wird mit einem seiner fruheren und als hoher einge schatzten,inzwischen fremd gewordenen Zustande konfrontiert, etwa die deutsche Kultur der eigenen Zeit mit der der Goethezeit. 21) 2. Das Eigene als Identitatsmuster edeutsche Kultur f wird mit den Massen des ubergeord netenidentitatsmusters eeuropdische Kultur' gemessen und erscheint so in seiner Beschrankung und Beschranktheit. 22) 3. Das nur vermeintlich 17) Gadamer, ebd, S. 277ff. 18) Ebd, S. 289f. Auf diesen Gegensatz wird schon hingewiesen in: Hartmut Schroter, Historische Theorie und geschichtliches Handeln, Mittenwald 1982, S. 242ff. 19) S. dazu: Behler, ebd, S. 162; Jacques Derrida, Positionen, ubers. von Dorothea Schmidt u. a., hg. von Peter Engelmann, Graz Wien 1986, S. 38, 44.; Michel Foucault, Das Denken des Aussen; Nietzsche, die Genealogie, die Historie. In: F., von der Subversion des Wissens, hg. and ubertragen von Walter Seitter, Frankfurt a. M. 1987, S ) Foucault, Gesprach mit Paolo Caruso. In: F., ebd, S. 7-27; S ) S. etwa VI, 289; I, 159f.; VIII, 297; I, 897, ) S. etwa VI, 250, 361; XII, 485.
7 Der ggute Wille h zur Verstandigung (Gadamer) und das ghinterfragen h (Nietzsche) 91 Eigene, tatsachlich fundamental Fremde des Griechentums wird dem ei genenidentitatsmuster echristliches Europa f direkt als positives Gegen bild,mittelbar als Vorbild entgegengehalten. 23) 4. Das Eigene als kulturelle Gesamtform eeuropaische Kultur f wird von anderen kulturellen Gesamt formenwie der des Islam oder der des Buddhismus her in seiner tatsach lichenbefremdlichkeit gezeigt. 24) Obwohl Nietzsche dabei das Fremde gewohnlich hoher bewertet, gilt sein Interesse doch meist dem von diesem her kritisierten Eigenen. 25) Selten trifft man bei ihm Bemerkungen uber eine fremde Kultur ohne diesen Ruck bezugan. 26) Er hat diesen Reflexionsvorgang in einem Bild so veran schaulicht: man blickt vom gocean h, auf den man sich hinauswagte, auf die eigene Kiiste zuruck und g(...) uberschaut (...) wohl zum ersten Male ihre gesammte Gestaltung und hat, wenn man sich ihr wieder nahert, den Vortheil, sie besser im Ganzen zu verstehen, als Die, welche sie nie verlassen haben h (II, 349). An Bildbegriffen dieser Art27) lasst sich die Bedeutung des ghinter fragenden hverstehens insofern ziemlich deutlich ablesen, als sie die Ge richtetheitdieses Sehens, seine Ausgangs-, Bezugs- und Zielpunkte, ein deutigbezeichnen. Wir wollen es versuchen. Das ist, wie mir scheint, jeden fallsbesser, als krampfhaft die Nietzsches unsystematischer Denkmethode implizite Hermeneutik systematisch explizit machen zu wollen. 28) Im Zusammenhang der Raum-Relationen in solchen Bildern, wie Perspektive, Blick von ausserhalb, Ferne und DistanZ, stellt sich wie von selber heraus, was mit dem ghinterfragen h im einzelnen gemeint ist. Demnach ist zur gum kehrunggewohnter Werthschatzungen und werthgeschatzter Gewohn- 23) S. etwa III, 151; VI, 249; III, 352; II, 473; VI, 310, 247. S. dazu: Schroter, ebd, S. 39f. 24) S. etwa VI, 249; XIII, 364f., 97, 163; XI, 16; III, 485, 489; VII, 373; VI, 186f. 25) S. die ausfuhrliche Darstellung in: Scheiffele, Questioning Back Behind One's g Own h from the Perspective of the Foreign, Abschn. II-V. 26) Wie sehr das trotz Nietzsches Behauptung gilt, er sei ggcgen verschiedene Cul turen hgerecht wie kaum ein anderer (VIII, 373), zeigt ein Vergleich mit Jacob Burck hardtsgeschichtswerk, wo dieser Ruckbezug moglichst vermieden wird. 27) Damit sind Metaphern gemeint, die nicht fur Begriffe stehen, sondern selbst Begriffscharakter haben. 28) Da NietZsches Denken vorwiegend perspektivistisch verfahrt, liesse sich aus dem Geflecht zahlloser perspektivischer Uberschneidungen gewiss nur gexaltsam so etwas wie eine ehermeneutische Position f herausschneiden. Diese Gewaltsamkeit wird vermieden, wenn man sich an die esprache f seiner Metaphern halt. Zur Problematik eines gstreng begrifflichen Zugriffs h s. Abel, ebd, S. VII.
8 92 EBERHARD SCHEIFFELE heiten h eine Umkehrung der Blickrichtung, eine gverschiedenheit des Blicks h, unerlasslich (II, 13). Die sei aber nur von einem Standort ausserhalb moglich (III, 632), aus ferner Weite (Meer-Metapher; II, 349) und von grosser Hohe aus (Berg-Metapher; III, 388). Nur aus der Distanz werde man der Propor tionendes Eigenen ansichtig (III, 632), zeige es sich gim Ganzen h, in seiner g gesammten Gestaltung h (II, 349). Distanz ist dabei nicht nur blosse Ent ferntheit.fur Nietzsche bewirkt sie ein Gefuhl der Uberlegenheit: gpathos der Distanz h (VI, 218). Nach all dem wird das Eigene nicht bloss gfrontal h befragt.29) Der Blick wendet sich auf es Zuriick, der Seite des Eigenen zu, die es demjenigen, der es gnie verlassen h hat (II, 349), gerade abwendet. Zugleich sieht man es aber auch gfrontal h. Es ist nun einmal das eeigene f. Als ein solches Zugleich-Sehen deute ich den Bildbegriff gdoppe1blick h (VI, 328). 5 Das ehinterfragen f kann als Schliisselbegriff NietZschescher Hermeneutik gelten. Denn zum einen beschreibt, was der Aphorismus dieses Titels als Verhal tendem Einzelnen gegenuber anrat (III, 301), sehr genau Nietzsches sub versivesvorgehen im allgemeinen, jenes gbohre(n), Grabe(n), Unter grabe(n) h(iii, 11), und er hat ja haufig Ausdru cke fur eben diesen Sachver haltverwendet (etwa in II, 247; VI, 226). Zum anderen: in der Forschung wird immer wieder auf seine Methode des Hinterfragens hingewiesen, und zwar ohne direkten Bezug auf gerade diese eine Stelle, also offenbar ohne durch Nietzsche selbst auf diesen Bildbegriff gestossen zu sein. 30) Der Eindruck, hier werde standig etwas hinterfragt, muss sich den Forschern buchstablich aufgedrangt haben. In der Logik Nietzschescher Bildbegriffe, vor allem der des ehinter fragens f lassen sich also folgende Grundzuge seiner Hermeneutik erken nenund voneinander abheben. 1. Nur wenn man aus dem Gesichtskreis des Eigenen heraustritt und 29) Karl Markus Michel, Der Grundwortschatz des wissenschaftlichen Gesamtarbei tersseit der szientifischen Wende. In: Jurgen Habermas, Stichworte zur geistigen Situa tionder Zeit f, 2 Bde, Frankfurt a. M. 1979, Bd 2, S ; S ) So verwendet Figl das Wort ' ehinterfragen f, ohne es als spezifisch Nietzscheschen Begriff zu kennzeichnen (Interpretation als philosophisches Prinzip, S. 29). S. dazu ferner: Figl, Hermeneutische Voraussetzungen der philologischen Kritik. In: Nietzsche-Studien, Bd 13 (1984), S ; S. 116; Reinhart Maurer, Nietzsche und die Kritische Theorie. In: Nietzsche-Studien Bd 10/11 (1981/82), S ; S. 38; Gadamer, Vernunft im Zeitalter der Wissenschaft, S. 93.
9 Der ggute Wille h zur Verstandigung (Gadamer) und das ghinterfragen h (Nietzsche) 93 aus der Ferne auf es Zuruckblickt, ist es in seiner Struktur zu erkennen (II, 349). 2. Die Seite des Eigenen, deren man aus der Distanz ansichtig wind, kann man, wenn man es gnie verlassen h hat, deshalb nicht wahrneh men,weil sie gerade das ist, was das Eigene von sich aus nicht zeigt: das unbewusst oder absichtlich Verdeckte, das zur Gewohnheit Gewor dene, g(e)ingefleischte h (V, 41, 205), das gzurecht (G)efalscht(e) h (II, 14). 3. Da man auch in der Ferne dem Eigenen gewissermassen enaturwuchsig f verbunden bleibt, ist man des gdoppelblicks h fahig: wie das Eigene sich zeigt und was es-bewusst oder naiv-verbirgt, kommt Zugleich in den Blick. 4. Dieses Zugleich-Sehen ermoglicht es, das Eigene zu werten, zu gschat zen h(iv, 75): als was es sich von sich aus zeigt, kann auf das hin, was es. g verbergen f gsoll h, ghinterfragt h werden (III, 301). 5. Ein solches Hinterfragen des Eigenen hat nicht nur die Weite der- Distanz (Meer-Metapher: Dimension der HoriZontalen), sondern auch die grossere Hohe (Berg-Metapher: Dimension der Vertikalen) der jeweils. eingenommenen fremden Position zur Voraussetzung. 6. Dementsprechend taucht in Nietzsches hermeneutischer Metaphorik e Perspektive f weit haufiger auf als ehorizont f. In Perspektiven sehen heisst: von je einem vertikal unterschiedlichen Ort aus sehen. Das ehin terfragendeverstehen f ist demnach grundsatzlich nicht dialogisch konzi piert,sondern von vornherein kritisch31) und steht damit in diametralem Gegensatz zum Verstehensbegriff Gadamers, der nicht von ungefahr eine Vorliebe fur die HoriZont-Metapher hat: im dialogischen Mitein anderstehen die Dialog-Partner gewissermassen auf derselben Ebene, auf der von gkontinuitat h und gtradition h.32) 7. Aus Nietzsches Bildlogik wird auch erklarlich, weshalb er meist an dem Fremden, in oder auf dem er jeweils Stellung bezieht, nicht haupt sachlichinteressiert ist; blickt er doch gewohnlich vom Fremden her auf das Eigene Zuruck. 33) 31) Hier zeigt sich cine gewisse Nahe zu Friedrich Schlegels Konzeption eines krili schen ebesser-verstehens f. S. dazu: Schlegel, Uber Lessing. In: Sch., Kritische Schriften, hg. von Wolfdietrich Rasch, Miinchen o. J., S ; S. 228, 227, 225. Ferner: Sch., KA 16, S ) Gadamer, Wahrheit und Methode, S ) Diese Reihe von egrundzugen f ist-mit leichten Abanderungen-aus der ersten in der evorbemerkung f genannten Arbeit ubernommen.
10 94 EBERHARD SCHEIFFELE Mit Hilfe des nach Nietzsches hermeneutischer Bildbegrifflichkeit ent worfenengrundrisses34) werden wir nun seine hermeneutische Position mit einer anderen vergleichen, um ihr Besonderes durch Abhebung noch genauer zu kennzeichnen. Meine Studie ist nicht historisch, sondern typo logischausgerichtet. Das gestattet es uns, Nietzsches Konzept- eun historisch f-mit dem Gadamers zu konfrontieren. Wir wahlen dieses Beispiel, wei sick schon in unseren bisherigen Ausfuhrungen der Vergleich mehrere Male wie von selbst aufgedrangt hat, vor allem aber, veil Gada mersklarer und uberschaubarer Entwurf in der heutigen Hermeneutik- Diskussion zu den bekanntesten und meisterorterten gehort. Die Kon frontation35)beider Konzepte, des diskursiv-explizit ausgerichteten von Gadamer und des bildhaft-pragnanten von Nietzsche, wird uberdies erhel len,wie wichtig Nietzsche auch fur die heute aktuelle Auseinandersetzung u ber Moglichkeiten und Grenzen des Verstehens geworden ist. 6 Nur in einem sehr allgemeinen Sinn kann man von Gemeinsamkeiten beider Positionen sprechen. Auch Nietzsche sieht die evorstruktur f alles Auslegens und Verstehens (XII, 194). Auch fur ihn gilt: gsein, das ver standenwerden kann, ist Sprache h36) (XII, 193f.). Beide begrunden die Hermeneutik ontologisch. 37) Und fur beide ist der Interpretationsvorgang grundsatzlich unabschliessbar (III, 627). Doch gerade da, wo dem Anschein nach grosste Nahe besteht, tritt der Unterschied besonders krass hervor. g Wer verstehen will, muss (...) fragend hinter das Gesagte zuruck gehen h38)-: diese Aussage scheint dem Bild des Hinterfragens genau zu entsprechen. Doch meint Gadamer selbstverstandlich etwas ganz anderes damit. Sein Entwurf orientiert sich, wie schon angedeutet wurde, ent scheidendam Dialogischen. Hinter das Gesagte zuruckzugehen, bedeutet dann eben nicht, dem, der es gesagt hat, von vornherein eine unbewusste oder beabsichtigte Tauschung zu unterstellen, sondern, ihm zunachst ein malden gvorgriff der Vollkommenheit h zuzubilligen. 39) Derjenige, wel- 34) Ich wollte kein esystem f aus Nietzsches meist aphoristischen Ausfuhrungen herausfiltern, nur einige wichtige Aspekte, die in der elogik f der Bilder liegen, benennen. 35) Aus den bisherigen Ausfuhrungen ist bereits klargeworden, dass hier nur ein konfrontativer Vergleich moglich sein wird. 36) Gadamer, Wahrheit und Methode, S ) S. Anm ) Gadamer, ebd, S ) Ebd, S. 277f.
11 Der ggute Wille h zur Verstandigung (Gadamer) und das ghinterfragen h (Nietzsche) 95 cher spricht, und der, welcher zuhort, haben beide den ggute(n) Willen h zur Verstandigung: gwer den Mund auftut, mochte verstanden werden h; u nd wer verstehen will, gist nicht darauf aus, Recht zu behalten und will deshalb die Schwachen des anderen aufspuren; man versucht vielmehr, den anderen so stark wie moglich zu machen, so dass seine Aussage etwas Einleuchtendes bekommt h.40) Was Gadamer hier verneint, ist es aber gerade, was Nietzsche mit dem ghinterfragen h ausdrucklich bezweckt. Von seinem Standort aus lehnt er die Vorstellung eines interpres und inter pretandumgegemeinsamen Horizonts, der gvertraulichkeit h des gdu and Du h (II, 307), radikal ab. Zutiefst misstraut er jenem gguten Willen h zur Verstandigung. Ganz im Sinn Nietzsches stellt Derrida diesen gguten Willen h zur Verstandigung in Frage.41) Gadamers guniversalitatsanspruch h der Her meneutikstiess bekanntlich bei Habermas schon fruher auf Widerspruch.42) Dieser Anspruch gerate im Fall gsystematisch verzerrter Kommunika tion h an seine unausweichliche Grenze.43) Sieht Gadamer diesen Fall als durchaus untypisch an, als Ausnahme44), so ist er fur Nietzsche gerade die Regel. Nach ihm gehoren ja zum gperspektivischen h notwendig die gver schiebung,verzerrung und scheinbare Teleologie der Horizonte h (II, 20). Demnach ware jedes Interpretieren und jedes Interpretandum eo ipso g systematisch verzerrt h.so gesehn, musste er auch Apels und Habermas f er egulatives Prinzip f eines repressionsfreien gallgemeinen und unbegrenzten Gesprachs h45) als illusionar ansehen: g(...) alles Leben ruht auf Schein, Kunst, Tauschung, Optik, Nothwendigkeit des Perspektivischen und des Irrthums h (I, 18). Fur Gadamer hat auch das evberlieferungsgeschehen f dialogischen Charakter.46) Nach Nietzsche, der auch die egeschichte f zu den Fiktionen zahlt (III, 404; XI, 505), konnte es gar keine solche kontinuierliche ger weiterungeines Zusammenhangs h geben, sondern nur dessen gdiskon- 40) Gadamer, Und dennoch: Macht des guten Willens. In: Philippe Forget (Hg.), Text u nd Interpretation, Deutsch-franzosische Debatte, Munchen 1984, S ; S ) Derrida, Guter Wille zur Macht (I). In: Forget (Hg.), ebd, S ) Habermas, Der Universalitatsanspruch der Hermeneutik. In: Hermeneutik und Dialektik, Bd I, S ; S. 82ff. 43) Ebd. 44) Gadamer, Text und Interpretation. In: Forget (Hg.), ebd, S ; S ) Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns I, 3. Aufl., Frankfurt a. M. 1985, S ) Gadamer, Wahrheit und Methode, S. 279, 286.
12 96 EBERHARD SCHEIFFELE tinuierliche Umstrukturierung h.47) Nach all dem, was wir uber hinter fragendesverstehen ausgefuhrt haben, ware vor allem die Konzeption Hori- ZontverschmelZung48) etwas Fiktives. Setzt diese doch die Annahme des e tragenden Grundes f des eigenen TraditionsZusammenhangs voraus, wahrend man nach Nietzsche das Eigene nur gneu h sehen kann, wenn man aus diesem Zusammenhang gerade heraustritt. 7 Die Grundverschiedenheit der beiden Standorte erklart sich hauptsach lichaus der sehr unterschiedlichen Art, wie der eine und wie der andere uber die Natur des Menschen und damit uber Reflexion und Sprache den ken.wir konnen diesen Sachverhalt hier nicht erortern. Auch nicht die Frage: Welcher Zusammenhang besteht denn zwischen der von uns so genannten hermetischen Hermeneutik, nach der Interpretation ein gmittel h ist, gh err h uber das Andere zu werden (XII, 140), und dem andren Konzept (oder nur der Riickseite des gleichen?), nach dem es gilt, das Fremde dem Eignen gerade nicht einzuverleiben, sondern, ganz im Gegenteil, dieses von jenem her zu hinterfragen? Sind es Zwei Herrneneutiken, die sich wechselseitig ausschliessen? Sind es Zwei Seiten derselben Sache? Gilt das letztere, so ist zu fragen: gis he not claiming, in effect, that the statement ethere is no truth f is a true statement? g49) Lage dann also der Fall oder besser: die Falle der e Paradoxie des Liigners f vor? Fur Nietzsche gibt es ja gar keine gwahre Welt h, ist jedes gfur-wahr-halten nothwendig falsch h, ein perspektivischer Schein, dessen Herkunft in uns liegt (insofern wir eine engere, verkurzte, vereinfachte Welt fortwahrend nothig haben) h (XII, 354). Musste es, ware das Fremdmachen des Eigenen vom Fremden her wirklich nur die Ruck seiteeines Aneignens des Fremden durch das Eigene, nicht jene Paradoxie bezeichnen? Denn dann hiesse eauslegen f: das Interpretieren ghinterfragt h das Vorgegebene als gzurechtgelegtes h, gzurechtgefdlschtes h, als Schein, u nd hat eben damit selbst den Charakter gzurecht falschenden h perspek tivischenscheins. Grundsatzliche Fragen dieser Art konnen wir hier also nur stellen, erortern nicht. Wie mir scheint, gibt darauf auch Giinter Abels ausgetuf- 47) Derrida, ebd, S ) Zu meiner Kritik dieses Begriffes s. Scheiffele, Wege und Aporien dcr, Rezeptions asthetik f. In: Neue Rundschau 90 (1979), S ; S. 526ff. 49) Grimm, ebd, S. 43. Heidegger halt diesen alten Einwand gegen Nietzsches Vorge hennicht fur stichhaltig in: Nietzsche, 2 Bde, Pfullingen 1961, S. 501 ff.
13 Der ggute Wille h zur Verstandigung (Gadamer) und das ghinterfragen h (Nietzsche) 97 telter Begriff des gfunfstelligen h ginterpretationszirkels h keine Antwort, insofern dieser Nietzsches Interpretations-Begriff ausschliesslich von der Konzeption ewille zur Macht f her erklart und somit jenes Interprelieren als Fremdmachen des Eigenen vom-eben nicht geinverleibten h-fremden her gar nicht in den Blick bekommt.50) Jedenfalls: gerade das hinterfragende Verstehen, ist es, dem Nietzsches gseltsame, bedenkenswerte, aber auch bedenkliche Wiederkehr h im ggigantischen kulturellen Synkretismus h unserer Zeit51) vor alien Dingen zuzuschreiben ist. Auch wenn man bisher nicht explizit von einer Hermeneutik des Hinterfragens bei ihm gesprochen hat, so ist dock der Sache nach ihr Einfluss auf die derzeitig weltweite Grund satzdiskussionuber Moglichkeiten und vor allem Grenzen des Verstehens u nd Erkennens unubersehbar. Hatte er wirklich relativistisch-unverbindlich g alles gesagt und das Gegenteil von allem h52), so wurden sich Vertreter der Tiefenhermeneutik, der Kritischen Theorie, des Neostrukturalismus, der epostmoderne f, der edekonstruktion f gewiss nicht so haufig auf ihn berufen. 50) Abel, ebd, S. 133, 172, 173ff., 255. Auch Figl fuhrt diesen Interpretations-Begriff letztlich auf den Begriff des Willens zur Macht zuruck (Interpretation als philosophisches Prinzip, S. 110). 51) Mazzino Montinari, Nietzsche lesen, Berlin New York 1982, S ) Giorgio Colli, Nach Nietzsche, Frankfurt a. M. 1980, S. 209.
Seminar Klassische Texte der Neuzeit und der Gegenwart Prof. Dr. Gianfranco Soldati. René Descartes Meditationen Erste Untersuchung
 Seminar Klassische Texte der Neuzeit und der Gegenwart Prof. Dr. Gianfranco Soldati René Descartes Meditationen Erste Untersuchung INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG 3 1.1 PROBLEMSTELLUNG 3 1.2 ZIELSETZUNG
Seminar Klassische Texte der Neuzeit und der Gegenwart Prof. Dr. Gianfranco Soldati René Descartes Meditationen Erste Untersuchung INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG 3 1.1 PROBLEMSTELLUNG 3 1.2 ZIELSETZUNG
I. Einleitung: Kann der Gottesglaube vernünftig sein?
 I. Einleitung: Kann der Gottesglaube vernünftig sein? In seiner Hausmitteilung vom 20. 12. 1997 schreibt Der Spiegel: «Unbestreitbar bleibt, daß die großen Kirchen in einer Zeit, in der alle Welt den Verlust
I. Einleitung: Kann der Gottesglaube vernünftig sein? In seiner Hausmitteilung vom 20. 12. 1997 schreibt Der Spiegel: «Unbestreitbar bleibt, daß die großen Kirchen in einer Zeit, in der alle Welt den Verlust
Die Zeit und Veränderung nach Aristoteles
 Lieferung 4 Hilfsgerüst zum Thema: Die Zeit und Veränderung nach Aristoteles 1. Anfang der Untersuchung: Anzweiflung Aristoteles: Es reiht sich an das bisher Versprochene, über die Zeit zu handeln. Zuerst
Lieferung 4 Hilfsgerüst zum Thema: Die Zeit und Veränderung nach Aristoteles 1. Anfang der Untersuchung: Anzweiflung Aristoteles: Es reiht sich an das bisher Versprochene, über die Zeit zu handeln. Zuerst
Zitate und Literaturangaben
 Zitate und Literaturangaben Regeln und Verfahren (nach amerikanischem Harvard-Standard) - Johannes Fromme - Das wörtliche (direkte) Zitat (1) Wortgetreu aus anderen Veröffentlichungen übernommene Passagen
Zitate und Literaturangaben Regeln und Verfahren (nach amerikanischem Harvard-Standard) - Johannes Fromme - Das wörtliche (direkte) Zitat (1) Wortgetreu aus anderen Veröffentlichungen übernommene Passagen
Diese 36 Fragen reichen, um sich zu verlieben
 Diese 36 Fragen reichen, um sich zu verlieben Wie verliebt er oder sie sich bloß in mich? Während Singles diese Frage wieder und wieder bei gemeinsamen Rotweinabenden zu ergründen versuchen, haben Wissenschaftler
Diese 36 Fragen reichen, um sich zu verlieben Wie verliebt er oder sie sich bloß in mich? Während Singles diese Frage wieder und wieder bei gemeinsamen Rotweinabenden zu ergründen versuchen, haben Wissenschaftler
 I. II. I. II. III. IV. I. II. III. I. II. III. IV. I. II. III. IV. V. I. II. III. IV. V. VI. I. II. I. II. III. I. II. I. II. I. II. I. II. III. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
I. II. I. II. III. IV. I. II. III. I. II. III. IV. I. II. III. IV. V. I. II. III. IV. V. VI. I. II. I. II. III. I. II. I. II. I. II. I. II. III. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
1. Einführung: Zum allgemeinen Verhältnis von Medizin und Selbsttötung
 Michael Nagenborg Medizin in der Antike Struktur 1. Einführung: Zum allgemeinen Verhältnis von Medizin und Selbsttötung 2. Die antike Medizin 2.1 Allgemein 2.2 Psychiatrische Erkrankungen 3. Schluss und
Michael Nagenborg Medizin in der Antike Struktur 1. Einführung: Zum allgemeinen Verhältnis von Medizin und Selbsttötung 2. Die antike Medizin 2.1 Allgemein 2.2 Psychiatrische Erkrankungen 3. Schluss und
Einführung in die Erziehungswissenschaft. Bildungstheorien. Vorlesungsplan. Einführende Bemerkungen, riskante Definitionen
 SoSe 06 Prof. Dr. Gerhard de Haan Vorlesungsplan Einführung in die Erziehungswissenschaft Bildungstheorien 1. (20.04.06) Organisatorisches / Einführung: Wissensgesellschaft 2. (27.04.06) Anthropologie
SoSe 06 Prof. Dr. Gerhard de Haan Vorlesungsplan Einführung in die Erziehungswissenschaft Bildungstheorien 1. (20.04.06) Organisatorisches / Einführung: Wissensgesellschaft 2. (27.04.06) Anthropologie
Interkulturelle Kompetenz - Beruflich in Tschechien -
 Interkulturelle Kompetenz - Beruflich in Tschechien - Verfasser Markus Eidam Markus Eidam & Partner Interkulturelle Trainings, Organisationsentwicklung, Weiterbildung Reichenhainer Straße 2 09111 Chemnitz
Interkulturelle Kompetenz - Beruflich in Tschechien - Verfasser Markus Eidam Markus Eidam & Partner Interkulturelle Trainings, Organisationsentwicklung, Weiterbildung Reichenhainer Straße 2 09111 Chemnitz
Friedrich Nietzsche Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten (Universitätsvorträge)
 Friedrich Nietzsche Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten (Universitätsvorträge) Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Institut für Bildungswissenschaft Seminar: Bildung des Bürgers Dozent: Dr. Gerstner
Friedrich Nietzsche Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten (Universitätsvorträge) Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Institut für Bildungswissenschaft Seminar: Bildung des Bürgers Dozent: Dr. Gerstner
Uwe Meyer Universität Osnabrück Seminar Der Sinn des Lebens (WS 2003/04) Karl R. Popper: Hat die Weltgeschichte einen Sinn?
 Karl R. Popper: Hat die Weltgeschichte einen Sinn? * 28.07.1902 in Wien Frühe Auseinandersetzung mit Marx, Freud und Einsteins Relativitätstheorie; um 1918 als Sozialist politisch aktiv, dann kritische
Karl R. Popper: Hat die Weltgeschichte einen Sinn? * 28.07.1902 in Wien Frühe Auseinandersetzung mit Marx, Freud und Einsteins Relativitätstheorie; um 1918 als Sozialist politisch aktiv, dann kritische
Schreiben. Prof. Dr. Fred Karl. Veranstaltung Wissenschaftliches Arbeiten
 Schreiben Prof Dr Fred Karl Veranstaltung Wissenschaftliches Arbeiten Schreiben Ihre Gedanken zusammenhängend, nachvollziehbar und verständlich zu Papier zu bringen Schreiben 1 Strukturieren 2 Rohfassung
Schreiben Prof Dr Fred Karl Veranstaltung Wissenschaftliches Arbeiten Schreiben Ihre Gedanken zusammenhängend, nachvollziehbar und verständlich zu Papier zu bringen Schreiben 1 Strukturieren 2 Rohfassung
6. ÜBERBLICK ÜBER DIE ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFT
 26 6. ÜBERBLICK ÜBER DIE ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFT 6.1. GESCHICHTE DER ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFT Die Übersetzungswissenschaft ist eine sehr junge akademische Disziplin und wurde erst Anfang der 60er Jahre
26 6. ÜBERBLICK ÜBER DIE ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFT 6.1. GESCHICHTE DER ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFT Die Übersetzungswissenschaft ist eine sehr junge akademische Disziplin und wurde erst Anfang der 60er Jahre
Jeder. und jedem. Robert Pawelke-Klaer
 Robert Pawelke-Klaer Jeder und jedem Immer wieder taucht in den ökonomischen Debatten der Grundsatz auf: Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Leider wird dieser Grundsatz oft
Robert Pawelke-Klaer Jeder und jedem Immer wieder taucht in den ökonomischen Debatten der Grundsatz auf: Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Leider wird dieser Grundsatz oft
Glücklich. Heute, morgen und für immer
 Kurt Tepperwein Glücklich Heute, morgen und für immer Teil 1 Wissen macht glücklich die Theorie Sind Sie glücklich? Ihr persönlicher momentaner Glücks-Ist-Zustand Zum Glück gehört, dass man irgendwann
Kurt Tepperwein Glücklich Heute, morgen und für immer Teil 1 Wissen macht glücklich die Theorie Sind Sie glücklich? Ihr persönlicher momentaner Glücks-Ist-Zustand Zum Glück gehört, dass man irgendwann
Die Sinnfrage Wofür überhaupt leben?
 Die Sinnfrage Wofür überhaupt leben? Radiokolleg Gestaltung: Ulrike Schmitzer Sendedatum: 18. 21. März 2013 Länge: 4 Teile, je ca. 23 Minuten Aktivitäten 1) Umfrage zum Thema Lebenssinn / Gruppenarbeit
Die Sinnfrage Wofür überhaupt leben? Radiokolleg Gestaltung: Ulrike Schmitzer Sendedatum: 18. 21. März 2013 Länge: 4 Teile, je ca. 23 Minuten Aktivitäten 1) Umfrage zum Thema Lebenssinn / Gruppenarbeit
Curriculum Religion. Klasse 5 / 6
 Wesentliches Ziel des Religionsunterrichts am Ebert-Gymnasium ist, dass sich Schülerinnen und Schüler aus der Perspektive des eigenen Glaubens bzw. der eigenen Weltanschauung mit anderen religiösen und
Wesentliches Ziel des Religionsunterrichts am Ebert-Gymnasium ist, dass sich Schülerinnen und Schüler aus der Perspektive des eigenen Glaubens bzw. der eigenen Weltanschauung mit anderen religiösen und
dieses Buch hier ist für mich das wertvollste aller theologischen Bücher, die bei mir zuhause in meinen Bücherregalen stehen:
 Predigt zu Joh 2, 13-25 und zur Predigtreihe Gott und Gold wieviel ist genug? Liebe Gemeinde, dieses Buch hier ist für mich das wertvollste aller theologischen Bücher, die bei mir zuhause in meinen Bücherregalen
Predigt zu Joh 2, 13-25 und zur Predigtreihe Gott und Gold wieviel ist genug? Liebe Gemeinde, dieses Buch hier ist für mich das wertvollste aller theologischen Bücher, die bei mir zuhause in meinen Bücherregalen
Tanz auf dem Diamanten
 Tanz auf dem Diamanten Seite - 1 - I. Fallbeispiel Person A hat vor einiger Zeit eine neue Stelle angetreten, weil sie sich davon bessere Karrierechancen versprach. Beeinflusst wurde diese Entscheidung
Tanz auf dem Diamanten Seite - 1 - I. Fallbeispiel Person A hat vor einiger Zeit eine neue Stelle angetreten, weil sie sich davon bessere Karrierechancen versprach. Beeinflusst wurde diese Entscheidung
STÉPHANE ETRILLARD FAIR ZUM ZIEL. Strategien für souveräne und überzeugende Kommunikation. Verlag. »Soft Skills kompakt« Junfermann
 STÉPHANE ETRILLARD FAIR ZUM ZIEL Strategien für souveräne und überzeugende Kommunikation»Soft Skills kompakt«verlag Junfermann Ihr Kommunikationsstil zeigt, wer Sie sind 19 in guter Absicht sehr schnell
STÉPHANE ETRILLARD FAIR ZUM ZIEL Strategien für souveräne und überzeugende Kommunikation»Soft Skills kompakt«verlag Junfermann Ihr Kommunikationsstil zeigt, wer Sie sind 19 in guter Absicht sehr schnell
Soziale Kommunikation. Vorlesung Johannes-Gutenberg-Universität Mainz Sommersemester 2011 PD Dr. phil. habil. Udo Thiedeke. Kommunikationsprobleme
 Vorlesung Johannes-Gutenberg-Universität Mainz Sommersemester 2011 PD Dr. phil. habil. Udo Thiedeke Kommunikationsprobleme 1) Was ist Kommunikation? 2) Vom Austausch zur Unterscheidung 3) Zusammenfassung
Vorlesung Johannes-Gutenberg-Universität Mainz Sommersemester 2011 PD Dr. phil. habil. Udo Thiedeke Kommunikationsprobleme 1) Was ist Kommunikation? 2) Vom Austausch zur Unterscheidung 3) Zusammenfassung
Ausgabe 03/2012 Deutschland 7,90 EUR Österreich 7,90 EUR Schweiz 13,90 CHF
 Ausgabe 03/2012 Deutschland 7,90 EUR Österreich 7,90 EUR Schweiz 13,90 CHF 03 Editorial 06 Prolog 08 Parallaxe No Risk, No Wissen 14 Ökonomische Theorien Was ich schon immer über die Börse wissen wollte
Ausgabe 03/2012 Deutschland 7,90 EUR Österreich 7,90 EUR Schweiz 13,90 CHF 03 Editorial 06 Prolog 08 Parallaxe No Risk, No Wissen 14 Ökonomische Theorien Was ich schon immer über die Börse wissen wollte
20 Internationale Unternehmenskulturen und Interkulturalität
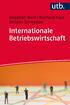 20 Internationale Unternehmenskulturen und Interkulturalität Artefakte Auf der obersten Ebene befinden sich die Artefakte. Darunter fasst man jene Phänomene, die unmittelbar sicht-, hör- oder fühlbar sind.
20 Internationale Unternehmenskulturen und Interkulturalität Artefakte Auf der obersten Ebene befinden sich die Artefakte. Darunter fasst man jene Phänomene, die unmittelbar sicht-, hör- oder fühlbar sind.
Es könnte einen bösen Gott geben
 Es könnte einen bösen Gott geben Der Philosoph Daniel Dennett spricht im Interview über gläubige Menschen, ungläubige Priester und wie man auf Mohammed-Karikaturen reagieren sollte. Herr Dennett, Sie sind
Es könnte einen bösen Gott geben Der Philosoph Daniel Dennett spricht im Interview über gläubige Menschen, ungläubige Priester und wie man auf Mohammed-Karikaturen reagieren sollte. Herr Dennett, Sie sind
Stellungnahme zur Bedeutung der Grundlagenforschung und ihrer Förderung. Wien, im November 2010
 Stellungnahme zur Bedeutung der Grundlagenforschung und ihrer Förderung Wien, im November 2010 Stellungnahme zur Bedeutung der Grundlagenforschung und ihrer Förderung Grundlagenforschung wird nach dem
Stellungnahme zur Bedeutung der Grundlagenforschung und ihrer Förderung Wien, im November 2010 Stellungnahme zur Bedeutung der Grundlagenforschung und ihrer Förderung Grundlagenforschung wird nach dem
Von der Metaethik zur Moralphilosophie: R. M. Hare Der praktische Schluss/Prinzipien Überblick zum 26.10.2009
 TU Dortmund, Wintersemester 2009/10 Institut für Philosophie und Politikwissenschaft C. Beisbart Von der Metaethik zur Moralphilosophie: R. M. Hare Der praktische Schluss/Prinzipien Überblick zum 26.10.2009
TU Dortmund, Wintersemester 2009/10 Institut für Philosophie und Politikwissenschaft C. Beisbart Von der Metaethik zur Moralphilosophie: R. M. Hare Der praktische Schluss/Prinzipien Überblick zum 26.10.2009
Um zu einer sinnerfüllten Existenz zu gelangen bedarf es der Erfüllung von drei vorangehenden Bedingungen (Grundmotivationen 1 )
 In der Existenzanalyse und Logotherapie geht es um ein Ganzwerden des Menschen um zu einer erfüllten Existenz zu gelangen. Die Existenzanalyse hat das Ziel, den Menschen zu befähigen, mit innerer Zustimmung
In der Existenzanalyse und Logotherapie geht es um ein Ganzwerden des Menschen um zu einer erfüllten Existenz zu gelangen. Die Existenzanalyse hat das Ziel, den Menschen zu befähigen, mit innerer Zustimmung
predigt am 5.1. 2014, zu römer 16,25-27
 predigt am 5.1. 2014, zu römer 16,25-27 25 ehre aber sei ihm, der euch zu stärken vermag im sinne meines evangeliums und der botschaft von jesus christus. so entspricht es der offenbarung des geheimnisses,
predigt am 5.1. 2014, zu römer 16,25-27 25 ehre aber sei ihm, der euch zu stärken vermag im sinne meines evangeliums und der botschaft von jesus christus. so entspricht es der offenbarung des geheimnisses,
Verena Bachmann Mondknoten
 Verena Bachmann Mondknoten Verena Bachmann Mondknoten So nützen Sie Ihre Entwicklungschancen im Horoskop KAILASH Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet
Verena Bachmann Mondknoten Verena Bachmann Mondknoten So nützen Sie Ihre Entwicklungschancen im Horoskop KAILASH Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet
GESTALT-THEORIE HERKUNFT GRUNDGEDANKE GESTALTQUALITÄTEN
 - Juliane Bragulla - GESTALT-THEORIE - unter der Bezeichnung Gestaltpsychologie bekannt - ist überdisziplinäre Theorie, die die menschliche Organisation der Wahrnehmung zum Gegenstand hat - versucht zu
- Juliane Bragulla - GESTALT-THEORIE - unter der Bezeichnung Gestaltpsychologie bekannt - ist überdisziplinäre Theorie, die die menschliche Organisation der Wahrnehmung zum Gegenstand hat - versucht zu
Seminararbeit. Unterschiede zwischen der Grammatik-Übersetzungs-Methode und der Kommunikativen Methode
 Seminararbeit Unterschiede zwischen der Grammatik-Übersetzungs-Methode und der Kommunikativen Methode 06112150 Chihiro Negami 1. Einleitung In dieser Arbeit schreibe ich über Unterschiede zwischen der
Seminararbeit Unterschiede zwischen der Grammatik-Übersetzungs-Methode und der Kommunikativen Methode 06112150 Chihiro Negami 1. Einleitung In dieser Arbeit schreibe ich über Unterschiede zwischen der
DNotI. Dokumentnummer: 9u18_06 letzte Aktualisierung: 20.12.2006. OLG Frankfurt, 20.12.2006-9 U 18/06 BGB 495, 13, 355, 765
 DNotI Deutsches Notarinstitut Dokumentnummer: 9u18_06 letzte Aktualisierung: 20.12.2006 OLG Frankfurt, 20.12.2006-9 U 18/06 BGB 495, 13, 355, 765 Keine Anwendung der Verbraucherschutzvorschriften des Verbraucher-darlehens
DNotI Deutsches Notarinstitut Dokumentnummer: 9u18_06 letzte Aktualisierung: 20.12.2006 OLG Frankfurt, 20.12.2006-9 U 18/06 BGB 495, 13, 355, 765 Keine Anwendung der Verbraucherschutzvorschriften des Verbraucher-darlehens
Berufsethik und Berufskunde für Pflegeberufe
 Eleonore Kemetmüller (Hg.) Berufsethik und Berufskunde für Pflegeberufe 5., aktualisierte und erweiterte Auflage maudrich Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 Autoren 6 I Philosophische Grundlagen 11 1 Denkansätze
Eleonore Kemetmüller (Hg.) Berufsethik und Berufskunde für Pflegeberufe 5., aktualisierte und erweiterte Auflage maudrich Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 Autoren 6 I Philosophische Grundlagen 11 1 Denkansätze
PROGRAMM PHAENO MENO LOGIE // UND // META PHYSIK KRITIK TAGUNG # 22./23.11 2013 UNIVERSITÆT FREIBURG
 PROGRAMM PHAENO MENO LOGIE // UND // META PHYSIK KRITIK TAGUNG # 22./23.11 2013 UNIVERSITÆT FREIBURG »WEG VON DEN BLOßEN WORTEN [ ] ZU DEN SACHEN SELBST« FREITAG 22. NOV Raum 2 Universitätsstraße 5 12.00
PROGRAMM PHAENO MENO LOGIE // UND // META PHYSIK KRITIK TAGUNG # 22./23.11 2013 UNIVERSITÆT FREIBURG »WEG VON DEN BLOßEN WORTEN [ ] ZU DEN SACHEN SELBST« FREITAG 22. NOV Raum 2 Universitätsstraße 5 12.00
Predigt Mt 5,1-3 am 5.1.14
 Predigt Mt 5,1-3 am 5.1.14 Zu Beginn des Jahres ist es ganz gut, auf einen Berg zu steigen und überblick zu gewinnen. Über unser bisheriges Leben und wohin es führen könnte. Da taucht oft die Suche nach
Predigt Mt 5,1-3 am 5.1.14 Zu Beginn des Jahres ist es ganz gut, auf einen Berg zu steigen und überblick zu gewinnen. Über unser bisheriges Leben und wohin es führen könnte. Da taucht oft die Suche nach
Fragen- und Fragetechnik
 Fragen- und Fragetechnik (Armando Frei in http://webmusic.pcdr.ch/feedback/frame_kommunikation.htm) Fragen- und Fragetechnik Kommunikation ist ein sehr komplexer und situationsspezifischer Vorgang. Rhetorische
Fragen- und Fragetechnik (Armando Frei in http://webmusic.pcdr.ch/feedback/frame_kommunikation.htm) Fragen- und Fragetechnik Kommunikation ist ein sehr komplexer und situationsspezifischer Vorgang. Rhetorische
Übersetzt von Udo Lorenzen 1
 Kapitel 1: Des Dao Gestalt Das Dao, das gesprochen werden kann, ist nicht das beständige Dao, der Name, den man nennen könnte, ist kein beständiger Name. Ohne Namen (nennt man es) Ursprung von Himmel und
Kapitel 1: Des Dao Gestalt Das Dao, das gesprochen werden kann, ist nicht das beständige Dao, der Name, den man nennen könnte, ist kein beständiger Name. Ohne Namen (nennt man es) Ursprung von Himmel und
Gibt es verschiedene Arten unendlich? Dieter Wolke
 Gibt es verschiedene Arten unendlich? Dieter Wolke 1 Zuerst zum Gebrauch des Wortes unendlich Es wird in der Mathematik in zwei unterschiedlichen Bedeutungen benutzt Erstens im Zusammenhang mit Funktionen
Gibt es verschiedene Arten unendlich? Dieter Wolke 1 Zuerst zum Gebrauch des Wortes unendlich Es wird in der Mathematik in zwei unterschiedlichen Bedeutungen benutzt Erstens im Zusammenhang mit Funktionen
Kant, Kritik der Urteilskraft
 Universität Dortmund, Sommersemester 2007 Institut für Philosophie C. Beisbart Kant, Kritik der Urteilskraft Kant über das Schöne. Kommentierende Hinweise (I) Textgrundlage: KU, 1 5. 1 Der Zusammenhang
Universität Dortmund, Sommersemester 2007 Institut für Philosophie C. Beisbart Kant, Kritik der Urteilskraft Kant über das Schöne. Kommentierende Hinweise (I) Textgrundlage: KU, 1 5. 1 Der Zusammenhang
Über die Leistungen und die Bedeutung von Bibliotheken brauche ich in dieser Runde keine Worte zu verlieren - das hieße, Eulen nach Athen zu tragen.
 IFLA-Konferenz Free Access and Digital Divide Herausforderungen für Wissenschaft und Gesellschaft im digitalen Zeitalter Sehr geehrter Herr Staatsminister, verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten
IFLA-Konferenz Free Access and Digital Divide Herausforderungen für Wissenschaft und Gesellschaft im digitalen Zeitalter Sehr geehrter Herr Staatsminister, verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten
Womit beschäftigt sich Soziologie? (1) Verschiedene Antworten:
 (1) Verschiedene Antworten: Soziale Tatsachen Emile Durkheim Interaktion (soziale Wechselwirkungen Georg Simmel) (soziales) Handeln Max Weber Gruppen Strukturen Soziale Systeme Fazit: Mikro- und Makro-Ebene
(1) Verschiedene Antworten: Soziale Tatsachen Emile Durkheim Interaktion (soziale Wechselwirkungen Georg Simmel) (soziales) Handeln Max Weber Gruppen Strukturen Soziale Systeme Fazit: Mikro- und Makro-Ebene
DIE PARAKONSISTENZ DEUTSCHER GRAMMATIKEN 1
 In: Grucza, F. (Hrsg.): Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Band 15. Frankfurt am Main etc.: Lang, 2012, 173-178. ANDRÁS KERTÉSZ
In: Grucza, F. (Hrsg.): Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Band 15. Frankfurt am Main etc.: Lang, 2012, 173-178. ANDRÁS KERTÉSZ
Rhetorik als philosophisch-humanistische Tradition und ihre Bedeutung in der Philosophischen Praxis
 Detlef Staude Rhetorik als philosophisch-humanistische Tradition und ihre Bedeutung in der Philosophischen Praxis R hetorik hat sich in der Antike als Gegenpol zur Philosophie entwickelt oder wurde als
Detlef Staude Rhetorik als philosophisch-humanistische Tradition und ihre Bedeutung in der Philosophischen Praxis R hetorik hat sich in der Antike als Gegenpol zur Philosophie entwickelt oder wurde als
Richtlinien für die Zitierweise am Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren AIFB
 Richtlinien für die Zitierweise am Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren AIFB Inhaltsverzeichnis 1. Hinweise zur Zitierweise und zum Literaturverzeichnis... 2 1.1. Allgemeine
Richtlinien für die Zitierweise am Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren AIFB Inhaltsverzeichnis 1. Hinweise zur Zitierweise und zum Literaturverzeichnis... 2 1.1. Allgemeine
Berufsbildung ist Allgemeinbildung Allgemeinbildung ist Berufsbildung
 Andreas Schelten Berufsbildung ist Allgemeinbildung Allgemeinbildung ist Berufsbildung In: Die berufsbildende Schule 57(2005)6, S. 127 128 Die Auseinandersetzung zwischen Allgemeinbildung und Berufsbildung
Andreas Schelten Berufsbildung ist Allgemeinbildung Allgemeinbildung ist Berufsbildung In: Die berufsbildende Schule 57(2005)6, S. 127 128 Die Auseinandersetzung zwischen Allgemeinbildung und Berufsbildung
Was ist wissenschaftlich?
 1 Niklas Lenhard-Schramm (Westfälische Wilhelms Universität Münster) Was ist wissenschaftlich? Was ist wissenschaftlich? Eine Auseinandersetzung mit dieser Frage ist lohnenswert für jeden, der wissenschaftliches
1 Niklas Lenhard-Schramm (Westfälische Wilhelms Universität Münster) Was ist wissenschaftlich? Was ist wissenschaftlich? Eine Auseinandersetzung mit dieser Frage ist lohnenswert für jeden, der wissenschaftliches
PD Dr. Matthias Wunsch. Publikationen. A. Monographien
 PD Dr. Matthias Wunsch Publikationen A. Monographien - Fragen nach dem Menschen. Philosophische Anthropologie, Daseinsontologie und Kulturphilosophie (Habilitationsschrift, Veröffentlichung in Vorbereitung).
PD Dr. Matthias Wunsch Publikationen A. Monographien - Fragen nach dem Menschen. Philosophische Anthropologie, Daseinsontologie und Kulturphilosophie (Habilitationsschrift, Veröffentlichung in Vorbereitung).
Interpretationskurs: Das menschliche Wissen Zweifel und Sicherheit (Descartes; Übersicht zur Sitzung am 24.10.2011)
 TU Dortmund, Wintersemester 2011/12 Institut für Philosophie und Politikwissenschaft C. Beisbart Interpretationskurs: Das menschliche Wissen Zweifel und Sicherheit (Descartes; Übersicht zur Sitzung am
TU Dortmund, Wintersemester 2011/12 Institut für Philosophie und Politikwissenschaft C. Beisbart Interpretationskurs: Das menschliche Wissen Zweifel und Sicherheit (Descartes; Übersicht zur Sitzung am
Ein und dieselbe Taufe
 1 Ein und dieselbe Taufe Eph. 4,5 Nach V. 3 geht es um die Einheit des Geistes. In diesem Zusammenhang nennt Paulus sieben Aspekte der geistlichen Einheit: Ein [geistlicher] Leib Ein Geist Eine Hoffnung
1 Ein und dieselbe Taufe Eph. 4,5 Nach V. 3 geht es um die Einheit des Geistes. In diesem Zusammenhang nennt Paulus sieben Aspekte der geistlichen Einheit: Ein [geistlicher] Leib Ein Geist Eine Hoffnung
Workshop Brillante Momente
 5. AMD-Kongress für Theologinnen und Theologen Dortmund 24.-27.Sept. 2012 Workshop Brillante Momente Veränderungspotentiale erschließen Referent: Hans-Joachim Güttler Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung
5. AMD-Kongress für Theologinnen und Theologen Dortmund 24.-27.Sept. 2012 Workshop Brillante Momente Veränderungspotentiale erschließen Referent: Hans-Joachim Güttler Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung
 Das Kindesnamensrecht nach 1616 ff BGB Im Hinblick auf die Frage, welchen Namen ein Kind erhält, kommt es grundlegend auf die Frage an, ob die Eltern im Zeitpunkt der Geburt des Kindes einen gemeinsamen
Das Kindesnamensrecht nach 1616 ff BGB Im Hinblick auf die Frage, welchen Namen ein Kind erhält, kommt es grundlegend auf die Frage an, ob die Eltern im Zeitpunkt der Geburt des Kindes einen gemeinsamen
Phrasensammlung für wissenschaftliches Arbeiten
 Phrasensammlung für wissenschaftliches Arbeiten Einleitung In diesem Aufsatz/dieser Abhandlung/dieser Arbeit werde ich... untersuchen/ermitteln/bewerten/analysieren... Um diese Frage zu beantworten, beginnen
Phrasensammlung für wissenschaftliches Arbeiten Einleitung In diesem Aufsatz/dieser Abhandlung/dieser Arbeit werde ich... untersuchen/ermitteln/bewerten/analysieren... Um diese Frage zu beantworten, beginnen
Führungskräfteentwicklungsprogramms für einen Automobilzuliefererunternehmen mit über 240 Führungskräften.
 1 2 3 Konzeptionierung und Durchführung eines Traineeprogramms für den zweitgrößten Energieversorger Bayerns. Konzeptionierung und Durchführung eines Führungskräfteentwicklungsprogramms für einen Automobilzuliefererunternehmen
1 2 3 Konzeptionierung und Durchführung eines Traineeprogramms für den zweitgrößten Energieversorger Bayerns. Konzeptionierung und Durchführung eines Führungskräfteentwicklungsprogramms für einen Automobilzuliefererunternehmen
Vertriebssignale. living performance
 Vertriebssignale Vertriebsmitarbeiter haben 2009 den Kampf ums Geschäft an vorderster Front geführt. Im Herbst befragte Krauthammer zusammen mit der Groupe ESC Clermont Graduate School of Management Vertriebsmitarbeiter
Vertriebssignale Vertriebsmitarbeiter haben 2009 den Kampf ums Geschäft an vorderster Front geführt. Im Herbst befragte Krauthammer zusammen mit der Groupe ESC Clermont Graduate School of Management Vertriebsmitarbeiter
Inhalt VorWort... VorWort 2... Kapitel I: AufLösung Nr.1... Kapitel II: AufLösung als Nr.2...10 Kapitel III: SchaM gegen und durch die Normen...
 Inhalt VorWort... VorWort 2... Kapitel I: AufLösung Nr.1... Kapitel II: AufLösung als Nr.2...10 Kapitel III: SchaM gegen und durch die Normen...18 Kapitel IV: Wahre Wahre Sehr Wahre WahrHeit...22 Kapitel
Inhalt VorWort... VorWort 2... Kapitel I: AufLösung Nr.1... Kapitel II: AufLösung als Nr.2...10 Kapitel III: SchaM gegen und durch die Normen...18 Kapitel IV: Wahre Wahre Sehr Wahre WahrHeit...22 Kapitel
Wissen und seine Rolle im und vor dem Übersetzungsprozess. Arbeit mit Hilfstexten
 Michal Dvorecký Wissen und seine Rolle im und vor dem Übersetzungsprozess. Arbeit mit Hilfstexten Aufgabe 1 Wissen und seine Rolle im und vor dem Übersetzungsprozess. Aufgabe zur Bewusstmachung der unterschiedlichen
Michal Dvorecký Wissen und seine Rolle im und vor dem Übersetzungsprozess. Arbeit mit Hilfstexten Aufgabe 1 Wissen und seine Rolle im und vor dem Übersetzungsprozess. Aufgabe zur Bewusstmachung der unterschiedlichen
WETTBEWERB. Wettbewerbsvorgaben. Landschaften fürs Leben Gestern, heute, morgen
 Wettbewerbsvorgaben Für alle Schulklassen der folgenden Stufen: 3. 4. Klasse (5. 6. Stufe gemäss Harmos) 5. 6. Klasse (7. 8. Stufe gemäss Harmos) Inhalt 1. 1. Der Wettbewerb Worum geht es? S. 3 1.1 Was
Wettbewerbsvorgaben Für alle Schulklassen der folgenden Stufen: 3. 4. Klasse (5. 6. Stufe gemäss Harmos) 5. 6. Klasse (7. 8. Stufe gemäss Harmos) Inhalt 1. 1. Der Wettbewerb Worum geht es? S. 3 1.1 Was
Chefs am Limit. 5 Coaching-Wege aus Burnout und Jobkrisen. von Gerhard Nagel. 1. Auflage. Hanser München 2010
 Chefs am Limit 5 Coaching-Wege aus Burnout und Jobkrisen von Gerhard Nagel 1. Auflage Hanser München 2010 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 446 42347 3 Zu Inhaltsverzeichnis schnell
Chefs am Limit 5 Coaching-Wege aus Burnout und Jobkrisen von Gerhard Nagel 1. Auflage Hanser München 2010 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 446 42347 3 Zu Inhaltsverzeichnis schnell
Ein Beitrag von mir mit dem Titel Der Fragekompass im Buch Coaching-Tools 2 von Christopher Rauen erschienen 2007, Verlag managerseminare Verlags GmbH
 Ein Beitrag von mir mit dem Titel Der Fragekompass im Buch Coaching-Tools 2 von Christopher Rauen erschienen 2007, Verlag managerseminare Verlags GmbH Name des Coaching-Tools: Der Fragekompass Kurzbeschreibung:
Ein Beitrag von mir mit dem Titel Der Fragekompass im Buch Coaching-Tools 2 von Christopher Rauen erschienen 2007, Verlag managerseminare Verlags GmbH Name des Coaching-Tools: Der Fragekompass Kurzbeschreibung:
Das Denken in komplexen Systemen und seine philosophische Relevanz für eine Integrative Wissenschaft
 Das Denken in komplexen Systemen und seine philosophische Relevanz für eine Integrative Wissenschaft Yoshiaki IKEDA 1 Heute möchte ich die philosophische Relevanz der Wissenschaft von komplexen Systemen
Das Denken in komplexen Systemen und seine philosophische Relevanz für eine Integrative Wissenschaft Yoshiaki IKEDA 1 Heute möchte ich die philosophische Relevanz der Wissenschaft von komplexen Systemen
Kann ein flächendeckender Ausbau der Windkraft zur Glättung der Einspeisung führen?
 Kann ein flächendeckender Ausbau der Windkraft zur Glättung der Einspeisung führen? Dr. - Ing. Detlef Ahlborn 22. Februar 2015 Zusammenfassung In zahllosen Studien wird behauptet, ein flächendeckender
Kann ein flächendeckender Ausbau der Windkraft zur Glättung der Einspeisung führen? Dr. - Ing. Detlef Ahlborn 22. Februar 2015 Zusammenfassung In zahllosen Studien wird behauptet, ein flächendeckender
Wissenschaftstheorie
 Wissenschaftstheorie 2. Vorlesung: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Perspektiven Andreas Georg Scherer Prof. Dr. Andreas Georg Scherer, Lehrstuhl für Grundlagen der BWL und Theorien der Unternehmung,
Wissenschaftstheorie 2. Vorlesung: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Perspektiven Andreas Georg Scherer Prof. Dr. Andreas Georg Scherer, Lehrstuhl für Grundlagen der BWL und Theorien der Unternehmung,
Ist Gott eine Person?
 Lieferung 10 Hilfsgerüst zum Thema: Ist Gott eine Person? 1. Schwierigkeiten mit dem Begriff Person Karl Rahner: Die Aussage, daß Gott Person, daß er ein persönlicher Gott sei, gehört zu den grundlegenden
Lieferung 10 Hilfsgerüst zum Thema: Ist Gott eine Person? 1. Schwierigkeiten mit dem Begriff Person Karl Rahner: Die Aussage, daß Gott Person, daß er ein persönlicher Gott sei, gehört zu den grundlegenden
Zur Rekonstruktion von Interkulturalität
 Zur Rekonstruktion von Interkulturalität Koole & ten Thije (2001) ten Thije (2002) 1 Copyright bei Dr. Kristin Bührig, Hamburg 2004. Alle Rechte vorbehalten. Zu beziehen auf: www.pragmatiknetz.de Zweck
Zur Rekonstruktion von Interkulturalität Koole & ten Thije (2001) ten Thije (2002) 1 Copyright bei Dr. Kristin Bührig, Hamburg 2004. Alle Rechte vorbehalten. Zu beziehen auf: www.pragmatiknetz.de Zweck
Das ABC der positiven Lebenseinstellung
 Hans-Arved Willberg Das ABC der positiven Lebenseinstellung Endlich Schluss mit finsteren Gedanken! Die Bibelstellen sind zitiert nach der Lutherbibel, revidierter Text 1984, durchgesehene Ausgabe in neuer
Hans-Arved Willberg Das ABC der positiven Lebenseinstellung Endlich Schluss mit finsteren Gedanken! Die Bibelstellen sind zitiert nach der Lutherbibel, revidierter Text 1984, durchgesehene Ausgabe in neuer
Buchbesprechung: Als mein Vater ein Busch wurde und ich meinen Namen verlor. Joke van Leuween (2012).
 Buchbesprechung: Als mein Vater ein Busch wurde und ich meinen Namen verlor. Joke van Leuween (2012). Zentrales Thema des Flucht- bzw. Etappenromans ist der Krieg, der Verlust der Muttersprache und geliebter
Buchbesprechung: Als mein Vater ein Busch wurde und ich meinen Namen verlor. Joke van Leuween (2012). Zentrales Thema des Flucht- bzw. Etappenromans ist der Krieg, der Verlust der Muttersprache und geliebter
Leibniz. (G.W.F. Hegel)
 Leibniz 3. Der einzige Gedanke den die Philosophie mitbringt, ist aber der einfache Gedanke der Vernunft, dass die Vernunft die Welt beherrsche, dass es also auch in der Weltgeschichte vernünftig zugegangen
Leibniz 3. Der einzige Gedanke den die Philosophie mitbringt, ist aber der einfache Gedanke der Vernunft, dass die Vernunft die Welt beherrsche, dass es also auch in der Weltgeschichte vernünftig zugegangen
Der Wert eines Unternehmens wird in der Praxis nicht anhand einheitlicher Kriterien definiert.
 Executive Summary Unterschiedliche Definitionen des Unternehmenswertes Der Wert eines Unternehmens wird in der Praxis nicht anhand einheitlicher Kriterien definiert. Bei inhabergeführten Unternehmen wird
Executive Summary Unterschiedliche Definitionen des Unternehmenswertes Der Wert eines Unternehmens wird in der Praxis nicht anhand einheitlicher Kriterien definiert. Bei inhabergeführten Unternehmen wird
Präsente Vergangenheit erinnerte Zukunft
 Präsente Vergangenheit erinnerte Zukunft Zeit und Geschichte im Alten Testament Semester-Eröffnung für Gasthörende am 30. März 2010 an der CvO Universität Oldenburg Prof. Dr. Kim Strübind 1. Bibel und
Präsente Vergangenheit erinnerte Zukunft Zeit und Geschichte im Alten Testament Semester-Eröffnung für Gasthörende am 30. März 2010 an der CvO Universität Oldenburg Prof. Dr. Kim Strübind 1. Bibel und
In der deutschsprachigen Hundeszene (ein unpassendes Wort, weil sich die Hunde ja nicht an den Diskussionen beteiligen können) herrscht heute ein
 Einleitung Hunde sind faszinierende Lebewesen. Ich glaube, es gibt kein anderes Tier, das derart viele Aufgaben und vor allem Ansprüche des Menschen erfüllt und erfüllen muss wie der Hund. Sie müssen für
Einleitung Hunde sind faszinierende Lebewesen. Ich glaube, es gibt kein anderes Tier, das derart viele Aufgaben und vor allem Ansprüche des Menschen erfüllt und erfüllen muss wie der Hund. Sie müssen für
WESEN UND WIRKEN DES HEILIGEN GEISTES
 WESEN UND WIRKEN DES HEILIGEN GEISTES 1 Einleitung Der christliche Glaube bekennt sich zum Heiligen Geist als die dritte Person der Gottheit, nämlich»gott-heiliger Geist«. Der Heilige Geist ist wesensgleich
WESEN UND WIRKEN DES HEILIGEN GEISTES 1 Einleitung Der christliche Glaube bekennt sich zum Heiligen Geist als die dritte Person der Gottheit, nämlich»gott-heiliger Geist«. Der Heilige Geist ist wesensgleich
Sternstunden chinesischer Kultur und ihre Gegenwärtigkeit. Ein Symposium aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Deutschen China-Gesellschaft
 Sternstunden chinesischer Kultur und ihre Gegenwärtigkeit Ein Symposium aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Deutschen China-Gesellschaft Jubiläen können auch Sinn haben. Vor allem als fraglose Anlässe,
Sternstunden chinesischer Kultur und ihre Gegenwärtigkeit Ein Symposium aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Deutschen China-Gesellschaft Jubiläen können auch Sinn haben. Vor allem als fraglose Anlässe,
8. Grammatikentwicklung und kognitive Entwicklung- Die kognitive Entwicklung des Kleinkindes II. Domänenspezifische Fähigkeiten
 8. Grammatikentwicklung und kognitive Entwicklung- Die kognitive Entwicklung des Kleinkindes II Domänenspezifische Fähigkeiten Die kognitive Entwicklung des Kleinkindes II: Domänenspezifische Fähigkeiten
8. Grammatikentwicklung und kognitive Entwicklung- Die kognitive Entwicklung des Kleinkindes II Domänenspezifische Fähigkeiten Die kognitive Entwicklung des Kleinkindes II: Domänenspezifische Fähigkeiten
Marktforschung. Prof. Dr. Fritz Unger. Oktober 2015
 Prof. Dr. Fritz Unger Marktforschung Oktober 2015 MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION IM FERNSTUDIENGANG BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE Modul 1 Marketing 1.1 Marketing als marktorientierte Unternehmensführung
Prof. Dr. Fritz Unger Marktforschung Oktober 2015 MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION IM FERNSTUDIENGANG BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE Modul 1 Marketing 1.1 Marketing als marktorientierte Unternehmensführung
Die neue Mitarbeiterführung
 Beck kompakt Die neue Mitarbeiterführung Führen als Coach von Dr. Stefan Hölscher 1. Auflage Verlag C.H. Beck München 2015 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 406 67415 0 Zu Inhaltsverzeichnis
Beck kompakt Die neue Mitarbeiterführung Führen als Coach von Dr. Stefan Hölscher 1. Auflage Verlag C.H. Beck München 2015 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 406 67415 0 Zu Inhaltsverzeichnis
PENN A DU Die Pennsylvania Deutschen. Aus einem Interview für eine lokale Radiostation im Pennsylvania Dutch County
 PENN A DU Die Pennsylvania Deutschen Aus einem Interview für eine lokale Radiostation im Pennsylvania Dutch County - Herr Brintrup, Sie sind hier in Philadelphia nicht nur zu Besuch, sondern Sie haben
PENN A DU Die Pennsylvania Deutschen Aus einem Interview für eine lokale Radiostation im Pennsylvania Dutch County - Herr Brintrup, Sie sind hier in Philadelphia nicht nur zu Besuch, sondern Sie haben
Krank gesund; glücklich unglücklich; niedergeschlagen froh?
 Krank gesund; glücklich unglücklich; niedergeschlagen froh? Stimmungen schwanken Seit Jahren macht sich im Gesundheitsbereich ein interessantes Phänomen bemerkbar es werden immer neue Krankheitsbilder
Krank gesund; glücklich unglücklich; niedergeschlagen froh? Stimmungen schwanken Seit Jahren macht sich im Gesundheitsbereich ein interessantes Phänomen bemerkbar es werden immer neue Krankheitsbilder
Predigt, 01.01.2011 Hochfest der Gottesmutter Maria/Neujahr Texte: Num 6,22-27; Lk 2,16-21
 Predigt, 01.01.2011 Hochfest der Gottesmutter Maria/Neujahr Texte: Num 6,22-27; Lk 2,16-21 (in St. Stephanus, 11.00 Uhr) Womit beginnt man das Neue Jahr? Manche mit Kopfschmerzen (warum auch immer), wir
Predigt, 01.01.2011 Hochfest der Gottesmutter Maria/Neujahr Texte: Num 6,22-27; Lk 2,16-21 (in St. Stephanus, 11.00 Uhr) Womit beginnt man das Neue Jahr? Manche mit Kopfschmerzen (warum auch immer), wir
Ein Projekt zur früh ansetzenden Demokratieerziehung und Vorurteilsprävention durch soziale Partizipation 1/23
 Ein Projekt zur früh ansetzenden Demokratieerziehung und Vorurteilsprävention durch soziale Partizipation 1/23 Erziehungspartnerschaft aber wie? 2/23 Ablauf 1 Erziehungspartnerschaft Was ist das? 2 Gespräch
Ein Projekt zur früh ansetzenden Demokratieerziehung und Vorurteilsprävention durch soziale Partizipation 1/23 Erziehungspartnerschaft aber wie? 2/23 Ablauf 1 Erziehungspartnerschaft Was ist das? 2 Gespräch
un-üb-er-sichtlich! Welche konzeptionellen Antworten hat die Politische Bildung auf die Herausforderungen des Alltags?
 Vortrag im Rahmen der Veranstaltung: un-üb-er-sichtlich! Welche konzeptionellen Antworten hat die Politische Bildung auf die Herausforderungen des Alltags? Die Idee diese Veranstaltung mit der Überschrift
Vortrag im Rahmen der Veranstaltung: un-üb-er-sichtlich! Welche konzeptionellen Antworten hat die Politische Bildung auf die Herausforderungen des Alltags? Die Idee diese Veranstaltung mit der Überschrift
8 Der gesellschaftlich geprägte Mensch
 8 Der gesellschaftlich geprägte Mensch Der Mensch hat aber von Natur aus einen so großen Hang zur Freiheit, dass, wenn er erst eine Zeit lang an sie gewöhnt ist, er ihr alles aufopfert. Eben daher muss
8 Der gesellschaftlich geprägte Mensch Der Mensch hat aber von Natur aus einen so großen Hang zur Freiheit, dass, wenn er erst eine Zeit lang an sie gewöhnt ist, er ihr alles aufopfert. Eben daher muss
Die hohe Kunst des (Day-)Tradens
 Jochen Steffens und Torsten Ewert Die hohe Kunst des (Day-)Tradens Revolutionieren Sie Ihr Trading mit der Target-Trend-Methode 13 Erster Teil: Eine neue Sicht auf die Börse 15 Prolog Traden ist eine»kunst«,
Jochen Steffens und Torsten Ewert Die hohe Kunst des (Day-)Tradens Revolutionieren Sie Ihr Trading mit der Target-Trend-Methode 13 Erster Teil: Eine neue Sicht auf die Börse 15 Prolog Traden ist eine»kunst«,
Handwerkszeug Gedichtinterpretation 1
 Handwerkszeug Gedichtinterpretation 1 Aufbau einer Gedichtinterpretation I. Einleitung: 1. Gedichttitel, Autor, Aussage zu Entstehungszeit oder Dichter 2. Gedichtart 3. Epoche (falls bekannt) 4. Themenstellung
Handwerkszeug Gedichtinterpretation 1 Aufbau einer Gedichtinterpretation I. Einleitung: 1. Gedichttitel, Autor, Aussage zu Entstehungszeit oder Dichter 2. Gedichtart 3. Epoche (falls bekannt) 4. Themenstellung
2 4 S T U N D E N M I T T E N A U S D E M G E S C H E H E N E G A L I E B R E D N O S
 24 STUNDEN M I T T E N A U S D E M G E S C H E H E N S O N D E R B E I L A G E 2 3 ü b e r l e b e n u n d g e l e b t w e r d e n S E I N E N A L L T A G W I E D E R t e x t a n n a r e p p l e 4 5 24
24 STUNDEN M I T T E N A U S D E M G E S C H E H E N S O N D E R B E I L A G E 2 3 ü b e r l e b e n u n d g e l e b t w e r d e n S E I N E N A L L T A G W I E D E R t e x t a n n a r e p p l e 4 5 24
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe 6
 Unterrichtsvorhaben A Die Zeit Jesu kennen lernen Die Botschaft Jesu in seiner Zeit und Umwelt (IF4); Bibel Aufbau, Inhalte, Gestalten (IF 3) identifizieren und erläutern den Symbolcharakter religiöser
Unterrichtsvorhaben A Die Zeit Jesu kennen lernen Die Botschaft Jesu in seiner Zeit und Umwelt (IF4); Bibel Aufbau, Inhalte, Gestalten (IF 3) identifizieren und erläutern den Symbolcharakter religiöser
Führung- & Kommunikation- Hochschule Anhalt, Fachbereich Wirtschaftsrecht
 http:/// 1. Motivationsgespräch - Schatz, sag mal was ist los? warum vergisst du andauernd deine Socken im Bad? Phase 1: Was ist zurzeit los mit Ihnen? Mein Eindruck ist, Sie sind zurzeit nicht wie sonst
http:/// 1. Motivationsgespräch - Schatz, sag mal was ist los? warum vergisst du andauernd deine Socken im Bad? Phase 1: Was ist zurzeit los mit Ihnen? Mein Eindruck ist, Sie sind zurzeit nicht wie sonst
Persönlich wirksam sein
 Persönlich wirksam sein Wolfgang Reiber Martinskirchstraße 74 60529 Frankfurt am Main Telefon 069 / 9 39 96 77-0 Telefax 069 / 9 39 96 77-9 www.metrionconsulting.de E-mail info@metrionconsulting.de Der
Persönlich wirksam sein Wolfgang Reiber Martinskirchstraße 74 60529 Frankfurt am Main Telefon 069 / 9 39 96 77-0 Telefax 069 / 9 39 96 77-9 www.metrionconsulting.de E-mail info@metrionconsulting.de Der
Phänomene der Semantik: Konditionalsätze (Handout 8) Janneke Huitink - Cécile Meier Sommersemester 2009
 Phänomene der Semantik: Konditionalsätze (Handout 8) Janneke Huitink - Cécile Meier Sommersemester 2009 1. Arten von Konditionalsätzen Konditionalsätze drücken aus, dass ein Ereignis nur unter einer bestimmten
Phänomene der Semantik: Konditionalsätze (Handout 8) Janneke Huitink - Cécile Meier Sommersemester 2009 1. Arten von Konditionalsätzen Konditionalsätze drücken aus, dass ein Ereignis nur unter einer bestimmten
Per spec tives imp PersPectives MANAGeMeNt JOUrNAL eur 40 innovationslogiken Der ZUKUNFt 03 einzigartigkeit im MANAGeMeNt 3 2011/12 1
 Per spec tives imp perspectives MANAGEMENT JOURNAL EUR 40 INNOVATIONSLOGIKEN DER ZUKUNFT 03 2011/12 1 EINZ I GARTIGKEIT IM MANAGEMENT 3 Output Input IMP Perspectives 124 Roche: Die Innovationskünstler
Per spec tives imp perspectives MANAGEMENT JOURNAL EUR 40 INNOVATIONSLOGIKEN DER ZUKUNFT 03 2011/12 1 EINZ I GARTIGKEIT IM MANAGEMENT 3 Output Input IMP Perspectives 124 Roche: Die Innovationskünstler
Es gilt das gesprochene Wort. Anrede
 Sperrfrist: 28. November 2007, 13.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort Statement des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Karl Freller, anlässlich des Pressegesprächs
Sperrfrist: 28. November 2007, 13.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort Statement des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Karl Freller, anlässlich des Pressegesprächs
Beobachtung der Wirklichkeit
 Holm von Egidy Beobachtung der Wirklichkeit Differenztheorie und die zwei Wahrheiten in der buddhistischen Madhyamika-Philosophie 2007 Der Verlag für Systemische Forschung im Internet: www.systemische-forschung.de
Holm von Egidy Beobachtung der Wirklichkeit Differenztheorie und die zwei Wahrheiten in der buddhistischen Madhyamika-Philosophie 2007 Der Verlag für Systemische Forschung im Internet: www.systemische-forschung.de
barrierefreie Kommunikation
 Ratgeber barrierefreie Kommunikation Informationen einfach und verständlich gestalten Einleitung Barrierefreie Kommunikation Wozu? Jeder hat das Recht auf Information. Mit der Ratifizierung der UN-Konvention
Ratgeber barrierefreie Kommunikation Informationen einfach und verständlich gestalten Einleitung Barrierefreie Kommunikation Wozu? Jeder hat das Recht auf Information. Mit der Ratifizierung der UN-Konvention
Theo IJzermans Coen Dirkx. Wieder. Ärger. im Büro? Mit Emotionen am Arbeitsplatz konstruktiv umgehen
 Theo IJzermans Coen Dirkx Wieder Ärger im Büro? Mit Emotionen am Arbeitsplatz konstruktiv umgehen Inhaltsverzeichnis 1 Wie wir unseren eigenen Stress produzieren... 9 2 Wir fühlen, was wir denken... 13
Theo IJzermans Coen Dirkx Wieder Ärger im Büro? Mit Emotionen am Arbeitsplatz konstruktiv umgehen Inhaltsverzeichnis 1 Wie wir unseren eigenen Stress produzieren... 9 2 Wir fühlen, was wir denken... 13
Das Neue Testament 6.Klasse
 Das Neue Testament 6.Klasse 1 Erstbegegnung...durch dick und dünn... Gruppenarbeit - Auswertung: Umfangvergleich AT / NT und Evangelien, grobe Einteilung => Gruppenarbeitsblatt 2 Die Entstehung des NT
Das Neue Testament 6.Klasse 1 Erstbegegnung...durch dick und dünn... Gruppenarbeit - Auswertung: Umfangvergleich AT / NT und Evangelien, grobe Einteilung => Gruppenarbeitsblatt 2 Die Entstehung des NT
Rudolf Steiner EINSICHTIGER WILLE TUT NOT
 Rudolf Steiner EINSICHTIGER WILLE TUT NOT Erstveröffentlichung in: Die Dreigliederung des sozialen Organismus, I. Jg. 1919/20, Heft 35, März 1920 (GA 24, S. 148-152) Als im Dezember 1916 die Mittelmächte
Rudolf Steiner EINSICHTIGER WILLE TUT NOT Erstveröffentlichung in: Die Dreigliederung des sozialen Organismus, I. Jg. 1919/20, Heft 35, März 1920 (GA 24, S. 148-152) Als im Dezember 1916 die Mittelmächte
Mit Leichtigkeit zum Ziel
 Mit Leichtigkeit zum Ziel Mutig dem eigenen Weg folgen Ulrike Bergmann Einführung Stellen Sie sich vor, Sie könnten alles auf der Welt haben, tun oder sein. Wüssten Sie, was das wäre? Oder überfordert
Mit Leichtigkeit zum Ziel Mutig dem eigenen Weg folgen Ulrike Bergmann Einführung Stellen Sie sich vor, Sie könnten alles auf der Welt haben, tun oder sein. Wüssten Sie, was das wäre? Oder überfordert
Warum Üben großer Mist ist
 Warum Üben großer Mist ist Kennst Du das? Dein Kind kommt aus der Schule. Der Ranzen fliegt in irgendeine Ecke. Das Gesicht drückt Frust aus. Schule ist doof! Und dann sitzt ihr beim Mittagessen. Und die
Warum Üben großer Mist ist Kennst Du das? Dein Kind kommt aus der Schule. Der Ranzen fliegt in irgendeine Ecke. Das Gesicht drückt Frust aus. Schule ist doof! Und dann sitzt ihr beim Mittagessen. Und die
