Erfassen der Vor- und Rückfussbewegungen im Gehen und Laufen
|
|
|
- Christoph Krämer
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Erfassen Originalartikel der Vor- und Rückfussbewegungen im Gehen und Laufen 43 Renate List 1, Stephanie Unternährer 1, Thomas Ukelo 1, Peter Wolf 2, Alex Stacoff 1 1 Institut für Biomechanik, ETH Hönggerberg, Zürich 2 Sensory-Motor Systems Lab, ETH Zürich, Zürich Erfassen der Vor- und Rückfussbewegungen im Gehen und Laufen Zusammenfassung Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist aufzuzeigen, wie Relativbewegungen (i) zwischen Vorfuss und Rückfuss sowie (ii) zwischen Rückfuss und Unterschenkel im Gehen und Laufen erfasst werden können. Dazu wird ein 2-segmentiges Fussmodell (Vorfuss und Rückfuss) mit insgesamt neun Markern vorgestellt. Die Resultate zeigen eine deutliche Verbesserung gegenüber älteren 1-segmentigen Modellen und erlauben ein genaueres Beschreiben der Bewegungsübertragung zwischen Rückfuss und Unterschenkel. Das 2-segmentige Fussmodell lässt erhebliche Plantarflexion zwischen Vor- und Rückfuss beim Abstoss im Gehen und Laufen erkennen, was einer Deformation des Fusses gleichkommt, womit die Hebelwirkung beim Abstossen gegenüber einem ideal rigiden Fuss reduziert wird. Diese Arbeit bildet eine Grundlage zu einer besseren dreidimensionalen Beschreibung der Kinematik der unteren Extremitäten im Gehen und Laufen. Abstract The goal of the present work is to show how relative movements between (i) forefoot and rearfoot, and between (ii) rearfoot and lower leg can be measured and described during activities such as walking and running. For that purpose a 2-segment foot model is proposed (forefoot and rearfoot) composing of 9 markers to capture the foot movements. The results show considerable improvements of the 2-segment model compared to previous 1-segment models. This new model is particularly suited to demonstrate movement coupling between the rearfoot and the lower leg. Furthermore, the results with the new model show a remarkable plantarflexion between forefoot and rearfoot during take-off in walking and running. This movement can be considered as a deformation which reduces the leverage in comparison to an ideally rigid foot. This work constitutes a basis for improved three-dimensional description of the kinematics of the lower extremities during walking and running. Schweizerische Zeitschrift für «Sportmedizin und Sporttraumatologie» 56 (2), 43 49, 2008 Einleitung Mittels der instrumentierten Ganganalyse können Bewegungen einzelner Körpersegmente im Gehen und Laufen in drei Dimensionen erfasst werden (siehe in diesem Heft: Bachmann et al., 2008; Kramers-de Quervain et al., 2008). Dabei sind besonders der Fuss als Ganzes und die Sprunggelenke im Speziellen von Interesse, weil durch den Einfluss der Bodenreaktionskraft die Ferse beim Auftreffen zu einer schnellen Bewegung nach medial (Eversion des Rückfusses) gezwungen wird. Das nächste Segment, der Unterschenkel, reagiert mit einer Innenrotation, wie Inman et al. (1978) (Abb. 1) mit mehreren Modellen verdeutlicht haben. Diese Bewegungsübertragung zwischen Rückfuss und Unterschenkel ist später von verschiedenen Autoren in vitro (Hintermann, 1994) und in vivo (Stacoff et al., 2000) beschrieben worden. Bei Läufern wird die Auswirkung einer erhöhten Tibiainnenrotation mit dem Auftreten des patellofemoralen Schmerzsyndroms in Verbindung gebracht (siehe in diesem Heft: Husa et al., 2008). Richtet sich das Interesse im Speziellen auf den Fuss, so sind Bewegungen zwischen Vor- und Rückfuss hauptsächlich im Chopart- und im Lisfranc-Gelenk auszumachen (Abb. 2). Das Chopart- Gelenk setzt sich aus dem talo-navikularen und dem calcaneocuboiden Gelenk zusammen, das Lisfranc-Gelenk bezeichnet die Linie, an der die drei Cuneiformi sowie der Cuboid mit den Metatarsalen artikulieren. Bei einer Relativbewegung zwischen Vor- und Rückfuss verwringt sich der Fuss hinsichtlich seiner Längsachse, was auch als Torsion definiert wird (Stacoff et al., 1991; Steindler, 1977). Die Torsion hat zwei Richtungen, abhängig davon, ob der Fussinnenrand des Vorfusses gegenüber dem Rückfuss angehoben wird (d.h. eine Inversion des Vorfusses) oder der Fussaussenrand des Vorfusses gegenüber dem Rückfuss (d.h. eine Eversion des Vorfusses) angehoben wird (Hepp et al., 2004). Noch bis vor wenigen Jahren konnten solche Bewegungen beim Gehen und Laufen nicht erfasst werden, das heisst, der Fuss musste als ein einziges Segment modelliert werden. Mittlerweile sind die zur Verfügung stehenden opto-elektronischen Messsysteme so gut entwickelt, dass die Hautmarker in kleinerer Distanz zueinander immer noch aufgelöst werden können und somit der Fuss in mehrere Segmente unterteilt werden kann. Abbildung 1: Einfaches Modell der Bewegungsübertragung zwischen Rückfuss und Unterschenkel nach Inman et al. (1978).
2 44 Abbildung 2: Gelenkslinien des Chopart-Gelenkes (proximal) und des Lisfranc-Gelenkes (distal). Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist aufzuzeigen, wie anhand verbesserter Messsysteme und Messmethoden die Relativbewegungen (i) zwischen Vorfuss und Rückfuss sowie (ii) zwischen Rückfuss und Unterschenkel erfasst werden können. Damit soll die Grundlage zu einer genaueren 3D-Beschreibung der Kinematik der unteren Extremitäten beim Gehen und Laufen gelegt werden. Material und Methode List R. et al. Kinematische Fussmodelle Kinematisch werden Bewegungen einzelner Körperteile (Segmente) erfasst und beschrieben (siehe in diesem Heft: Bachmann et al., 2008). Dabei wird ein Segment jeweils als starr betrachtet und durch mindestens drei nicht kollineare Punkte definiert. Somit werden, um die Bewegung der Segmente (z.b. des Rückfusses) in 3D beschreiben zu können, an Vorfuss, Rückfuss und Unterschenkel je mindestens drei Hautmarker an definierten Stellen befestigt. Mathematisch entstehen daraus sogenannte Modelle, die es ermöglichen, zwischen den Segmenten die Bewegungen relativ zueinander zu berechnen. Mit diesem Vorgehen lassen sich die Einflüsse von Schuheinlagen oder Schuhsohlen, aber auch die Unterschiede zwischen normalen und pathologischen Bewegungsabläufen beschreiben. Am Fuss stellt sich nun das Problem, dass Bewegungen zwischen fast allen der rund 25 Fussknochen möglich sind. Das ist messtechnisch nur dann zu realisieren, wenn jeder Knochen mit einer eigenen Knochenschraube versehen würde. Bei Arndt et al. (2007) sind zu diesem Zweck in sieben Fussknochen Schrauben gesetzt worden (Abb. 3h). Nichtinvasive Fragestellungen zwingen einen jedoch, mehrere Fussknochen zu einem Segment zusammenzuführen, um den engen Platzverhältnissen für das Anbringen der Marker gerecht zu werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Bewegungen innerhalb eines Segments möglichst klein ausfallen (Stacoff et al., 2007). Je nach Fragestellung entstanden so in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Fussmodellen, die unterschiedliche Markerpositionen beinhalten. Sie alle weisen Vor- und Nachteile auf, die hier kurz beschrieben werden: Abbildungen 3a und 3b weisen 7 Marker auf, die zwei Segmente beschreiben können, wobei insbesondere der Rückfuss besser erfasst werden müsste (es stehen nur 2 3 Marker zur Verfügung); Abbildung 3c erfasst noch die Grosszehe, allerdings nur in zwei Dimensionen; Abbildung 3d erfasst mit 9 Markern drei Segmente dreidimensional, wobei je vier Marker die Genauigkeit erhöhen würden (Capozzo et al., 1997); Abbildung 3e verwendet 11 Marker für drei Segmente, die Grosszehe wiederum nur zweidimensional; Abbildung 3f braucht 10 Marker und errechnet drei zusätzliche für drei Segmente, dies ist wohl die technisch schwierigste Lösung aller gezeigten Vorschläge; Abbildung 3g verwendet 10 Marker für 3 Segmente, wovon zwei nicht dreidimensional dargestellt werden können; Abbildung 3h verwendet an jeder Knochenschraube drei Marker, wobei der Nachteil im invasiven Vorgehen liegt. Ein weiteres Modell wird in diesem Heft vorgestellt (Wyss et al., 2008). Entwicklung des 2-segmentigen Fussmodells Das in dieser Arbeit verwendete 2-segmentige Fussmodell besteht aus insgesamt neun Hautmarkern, wobei Vorfuss- sowie Rückfusssegment aus sogenannten Clustern mit 5 respektive 4 Markern (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Abbildung 3: Bisher gebräuchliche Markersets des Fusses: (a) Wu et al. (2000); (b) Hunt et al. (2001); (c) Rattanaprasert et al. (1999); (d) Myers et al. (2001); (e) Stebbins et al. (2006); (f) Leardini et al. (2007); (g) Simon et al. (2006); (h) Arndt et al. (2007); (i) Markerset der vorliegenden Studie. Offene Kreise geben Marker an, die sich auf der hinteren Seite befinden oder die berechnet werden (z.b. bei Leardini et al., Abb. f).
3 Erfassen der Vor- und Rückfussbewegungen im Gehen und Laufen (a) (b) 45 bestehen. Zusammen mit dem Cluster des Unterschenkelsegments, bestehend aus 6 Markern, kann somit die Bewegung zwischen Vorfuss und Rückfuss sowie zwischen Rückfuss und Unterschenkel beschrieben werden. Die Cluster wurden aufgrund folgender Überlegungen konzipiert (Abb. 4 und 5 und Tab. 1, 2 und 3): (i) Sichtbarkeit der Marker: Alle neun Marker sollten während des gesamten Gangzyklus von mindestens zwei Kameras erfasst werden können. (ii) Räumliche Verteilung: Die Distanz zwischen den einzelnen Markern eines Clusters sowie die Distanz jedes Markers zur Verbindungslinie der anderen Marker sollte möglichst gross sein. Es kann einerseits verhindert werden, dass die Marker innerhalb eines Clusters auf einer Linie liegen, und andererseits wird ein möglichst grosser durchschnittlicher Clusterradius angestrebt (Soderkvist et al., 1993). (iii) Anzahl Marker: Mindestens 4 Marker pro Segment, da die Erhöhung der Anzahl Marker von den minimalen 3 auf 4 oder 5 Marker pro Cluster die Genauigkeit in der Beschreibung der Bewegung eines Segments verbessert (Challis, 1995). (iv) Die Marker sollten an Körperstellen positioniert werden, an denen während des Gehens und Laufens möglichst wenig Hautbewegungen stattfinden. Das Vorfusssegment umfasst fünf Hautmarker, die alle auf den Metatarsalknochen lokalisiert sind (Metatarsale 1 und 5 jeweils an Kopf und Basis, auf Metatarsale 2 nur am Kopf (Abb. 4, Tab. 1). Für das Rückfusssegment werden vier Hautmarker auf dem Fersenbein befestigt; zwei davon posterior, je einer medial und lateral unterhalb der Malleolen (Abb. 4, Tab. 2). Aufgrund der massiven Hautbewegungsartefakte, verursacht durch diverse Sehnen, die über den Rückfuss verlaufen, sowie der sehr begrenzten Platzverhältnisse wurde auf dem Talus kein Marker platziert. Ohne Marker blieb ferner das Navikulare, weil dieser Knochen zwischen dem Chopart- und Lisfranc-Gelenk liegt und somit weder das Vorfuss- noch das Rückfusssegment repräsentiert. Der Unterschenkel wurde mit 6 Markern bestückt, die Anordnung erfolgte aufgrund der oben genannten 4 Kriterien. Der posteriore Teil des Unterschenkels wurde aufgrund der grossen Muskelbäuche nicht bestückt; auf der proximalen Seite zeigen der Kopf der Fibula sowie die Tuberositas tibiae wenig Hautbewegungsartefakte, ebenso auf der distalen Seite die beiden Malleoli sowie anterior die Mitte der Tibia. Der sechste Marker wurde auf 30% der Höhe des Unterschenkels lateral platziert, da distal weniger Hautbewegungsartefakte auftreten als proximal (Manal et al., 2000) (Abb. 5, Tab. 3). Die verwendeten reflektierenden Marker haben einen Durchmesser von 9 mm und sind zusätzlich auf einem Plastikfüsschen angebracht, wodurch die Sichtbarkeit und das Haften der Marker erhöht werden. Die Markerpositionen werden vorgängig mit einem Stift markiert, sodass im Falle eines Verlustes der jeweilige Marker wieder an derselben Stelle angebracht werden kann. Zusätzlich zum 2-segmentigen Fussmodell wurde ein 1-segmentiges Fussmodell aus allen neun am Fuss befestigten Markern definiert. Dadurch werden das 2-segmentige und das 1-segmentige Fussmodell gleichzeitig erfasst und ihre Kinematik kann direkt miteinander verglichen werden. Vorfuss Bezeichnung Position FB (First Basis) Basis der Metatarsale 1 FM (First Metatarsal) Kopf der Metatarsale 1 TO (Toe) Kopf der Metatarsale 2 VB (Fifth Basis) Basis der Metatarsale 5 VM (Fifth Metatarsal) Kopf der Metatarsale 5 Tabelle 1: Bezeichnung und Position der Marker am Vorfuss. Abbildung 4: Kinematisches Modell der vorliegenden Studie mit fünf Markern am Vorfuss und vier am Rückfuss: (a) Ansicht antero-medial, (b) antero-lateral. Rückfuss (Calcaneus) Bezeichnung HL (Heel Low) HH (Heel High) MC (Medialer Calcaneus) LC (Lateraler Calcaneus) Position Calcaneus posterior oberhalb des Fettpolsters Ansatz der Achillessehne Mediale Seite des Calcaneus unterhalb des Malleolus medialis Laterale Seite des Calcaneus unterhalb des Malleolus lateralis Tabelle 2: Bezeichnung und Position der Marker am Rückfuss. (a) (b) (c) Abbildung 5: Unterschenkelmodell mit 6 Markern: (a) Ansicht lateral, (b) anterior und (c) posterior. Unterschenkel Bezeichnung TT (Tuberositas tibiae) HF (Head of Fibula) MT (Mid Tibia) LF (Low Fibula) LM (Lateral malleolus) MM (Medial malleolus) Position Auf der Tuberositas tibiae Kopf der Fibula Auf Tibia bei 50% Unterschenkellänge Auf Fibula bei 30% Unterschenkellänge (von unten) Malleolus lateralis Malleolus medialis Tabelle 3: Bezeichnung und Position der Marker am Unterschenkel.
4 46 List R. et al. Probanden und Messmethode Angaben zu den Probanden: Alter: (31.1 ± 4.6), Grösse: (170.9 ± 8.6), Gewicht: (62.2 ± 8.6), Laufleistung: (31.9 ± 8.5); Frauen: 7, Männer: 5. Es wurden gesunde Probanden (n = 12) gemessen, die den folgenden Kriterien entsprachen: keine gesundheitlichen Beschwerden, Alter zwischen 18 und 50 Jahren, Laufpensum 30 km/woche (männlich) bzw. 20 km/woche (weiblich). Für die Messung hatten die Probanden bei selbstgewählter Geschwindigkeit rund 8 m Anlauf bis zum Messvolumen, dann 5 m durch dieses hindurch und rund 5 m Auslauf. Akzeptiert wurde nur Fersenlauf. Je Testbedingung wurden 10 gültige Versuche angestrebt; ungültige Versuche (z.b. Übertritt) wurden von der Analyse ausgeschlossen. Für die 3D-Bewegungsanalyse wurde das opto-elektronische Messsystem von VICON verwendet (MX40 System, Oxford Metrix, Oxford UK), das in diesem Heft bei Bachmann et al. (2008) beschrieben ist. (a) (b) Auswertung Für diese Untersuchung interessierte der Vergleich zwischen dem 1-segmentigen und dem 2-segmentigen Fussmodell. Berechnet wurden einerseits beim 1-segmentigen Fussmodell die Relativbewegungen zwischen den Segmenten «Ganzer Fuss» und Unterschenkel, andererseits beim 2-segmentigen Fussmodell die Relativbewegungen zwischen Rückfuss und Unterschenkel sowie zwischen Vorfuss und Rückfuss. Die Auswertung erfolgte in Matlab (Mathworks, Natick, Massachusetts) in Anlehnung an Dettwyler (2005) und List (2005; 2006) nach den folgenden Prinzipien: i) Orientierung und Position eines Segments: Eine Aufnahme in stehender, aufrechter Position (= anatomische Neutralstellung) diente zur Definition der Position und Orientierung des Referenzclusters jedes Segments. Die sich bewegenden Segmente im Gehen oder Laufen wurden dann relativ zum Referenzsystem beschrieben. Mittels eines analytischen Verfahrens wurden Position und Orientierung des Segments relativ zu seinem Referenzcluster im Sinne einer optimalen Lösung ermittelt, dabei wurden jeweils eine Orientierungsmatrix Q und eine Translationsmatrix T bestimmt. ii) Relativbewegung zwischen zwei Segmenten: Die Relativbewegung (Orientierungsmatrix Q rel und Translationsmatrix T rel ) zwischen einem distalen (mit Q d,t d ) und einem proximalen Segment (mit Q p,t p ) wurde dann wie folgt berechnet: Q rel = Q p T *Q d und T rel = Q p T *(T d T p ) Aus der Orientierungsmatrix Q rel können dann der Drehwinkel ß sowie die Drehachse u abgeleitet werden. iii) Beschreibung der Relativbewegung mittels klinischer Terminologie: Eine Möglichkeit, um Gelenksrotationen in klinischer Terminologie beschreiben zu können, ist mittels einer Projektion des Drehzeigers θ = ßu auf die einzelnen Achsen (e1, e2, e3) des Gelenkskoordinatensystems. Die Gelenkskoordinatensysteme sind orthogonale, rechtshändige Koordinatensysteme, definiert im Referenzsystem des jeweiligen proximalen Segments. Mit diesem Vorgehen können dreidimensionale Bewegungen zwischen den Segmenten kinematisch beschrieben werden (siehe Tab. 4). 1. Das Vorfuss-Rückfuss-Koordinatensystem (siehe Abb. 6a): Als führende Achse wird die Longitudinalachse des Fusses bestimmt (e f3 ). Diese wird gebildet durch die Verbindung des unteren Fersenmarkers (HL) und des Markers auf dem Kopf des Metatarsale zwei (TO). Die medio-laterale Achse steht senkrecht zu dieser Longitudinalachse und liegt gleichzeitig in der Ebene parallel zum Boden, das heisst, sie ist senkrecht zur z-achse des Laborkoordinatensystems (e f2 ). Die dritte Achse liegt senkrecht auf den beiden anderen und ist somit senkrecht zum Boden (e f1 ). 2. Das Fussgelenkskoordinatensystem (siehe Abb. 6b): Als führende Achse wird die longitudinale Achse des Unterschenkels bestimmt, welche sich durch die Verbindung des Knie- Abbildung 6: Gelenkskoordinatensysteme: (a) Vorfuss-Rückfuss-Koordinatensystem, (b) Fussgelenkskoordinatensystem. Relativbewegung Rotationsachsen positive Richtung Vorfuss relativ zu Rückfuss: Rückfuss/Fuss relativ zu Unterschenkel: negative Richtung ef1 Adduktion Abduktion ef2 Dorsalflexion Plantarflexion ef3 Inversion Eversion ea1 Innenrotation Aussenrotation ea2 Dorsalflexion Plantarflexion ea3 Inversion Eversion Tabelle 4: Richtungsdefinitionen der mittels klinischer Terminologie beschriebenen Gelenksrotationen (List, 2005). gelenkszentrums und des Fussgelenkzentrums ergibt (e a1 ). Die medio-laterale Achse steht senkrecht zu dieser Longitudinalachse und liegt gleichzeitig in der Ebene definiert durch den lateralen Malleolus, den medialen Malleolus und das Kniegelenkszentrum (e a2 ). Die dritte Achse steht senkrecht zu den anderen zwei Achsen (e a3 ). Das Fussgelenkszentrum sowie das Kniegelenkszentrum wurden anhand spezifischer Bewegungen (Basic Motion Tasks) zu funktionellen Zentren bestimmt (siehe in diesem Heft: Bachmann et al., 2008). Resultate Beim Vergleich der Gelenkskinematik des 1-segmentigen mit jener des 2-segmentigen Fussmodells fällt auf, dass die Kurven eine sehr ähnliche Charakteristik zeigen (Abb. 7). Jedoch liefert bei genauerer Betrachtung das 1-segmentige Fussmodell in allen Ebenen signifikant grössere Bewegungsumfänge als das
5 Erfassen der Vor- und Rückfussbewegungen im Gehen und Laufen 47 (a) (b) Abbildung 7: Gelenksrotationen am Fussgelenk beim Laufen, Mittelwert und Standardabweichung über 12 Probanden: a) Relativbewegung zwischen «Ganzem Fuss» und Unterschenkel (1-segmentig), b) Relativbewegung zwischen Rückfuss und Unterschenkel (2-segmentig). Abbildung 8: Gelenksrotationen des Vorfusses relativ zum Rückfuss beim Laufen, Mittelwert und Standardabweichung über 12 Probanden (2-segmentig). 2-segmentige Fussmodell, mit Ausnahme der Inversionsbewegung (Tab. 5). Die Rotationen des Vorfusssegments relativ zum Rückfusssegment zeigen eine klare Charakteristik (Abb. 8) mit Bewegungsumfängen (Mittelwert der 12 Probanden, linker und rechter Fuss zusammengenommen) in der Sagittalebene von 38, in der Transversalebene von 18 sowie in der Frontalebene von 11 (Tab. 6). Die Torsionsbewegung (Eversion-Inversion des Vorfusses) findet somit im Fersenlauf in der Grössenordnung von etwa 11 statt. Diskussion Das 1-segmentige Fussmodell betrachtet den «Ganzen Fuss» als rigide. Somit wird jegliche Bewegung, die eigentlich zwischen Vor- und Rückfuss stattfindet, vernachlässigt. Diese Vernachlässigung einer erheblich stattfindenden Deformation des Fusses (siehe Vorfuss- zu Rückfussbewegung, Abb. 8 und Tab. 6) beeinflusst die Beschreibung der Kinematik am Fussgelenk und führt zu einer Überschätzung der effektiv aufgetretenen Bewegung (Abb. 7, Tab. 5). Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass ein getrenntes Erfassen von Vorfuss und Rückfuss im Laufen dreidimensional möglich ist; die Zielsetzung der Arbeit konnte somit erreicht werden. Das 2-segmentige Modell hat sich in der Zwischenzeit Laufen 2-segmentiges Fussmodell Rückfuss relativ Unterschenkel 1-segmentiges Fussmodell Ganzer Fuss relativ Unterschenkel 0 50% Standphase links rechts links rechts Dorsalflexion [ ] Aussenrotation [ ] Eversion [ ] 17.3 ± ± ± ± * ± * ± * ± * ± * ± * ± % Standphase links rechts links rechts Plantarflexion [ ] Innenrotation [ ] Inversion [ ] 33.2 ± ± ± ± ± * ± * ± ± * ± * ± * ± 2.2 Tabelle 5: Mittelwerte und Standardabweichung des Bewegungsausmasses der Gelenksrotationen am Fussgelenk während der Standphase des Laufens, gemittelt über 12 Probanden. Vergleich 1-segmentig zu 2-segmentig. * = signifikant mit p < 0.05.
6 48 Laufen 2-segmentiges Fussmodell Vorfuss relativ Rückfuss 0 50% Standphase links rechts % Standphase links rechts Dorsalflexion [ ] 13.5 ± 2.9 Abduktion [ ] 5.6 ± 1.8 Eversion [ ] ± Plantarflexion [ ] 23.7 ± 4.4 Adduktion [ ] 12.2 ± 2.2 Inversion [ ] ± ± 1.6 Tabelle 6: Mittelwert und Standardabweichung des Bewegungsausmasses der Gelenksrotationen zwischen Vorfuss und Rückfuss während der Standphase des Laufens, gemittelt über 12 Probanden, analysiert mit dem 2-segmentigen Fussmodell. auch bei Untersuchungen im Gehen bewährt. Die kinematischen Auswirkungen des 2-segmentigen Markersets im Vergleich zu einem 1-segmentigen Modell zeigen signifikante Unterschiede auf, was durch die erhebliche Relativbewegung zwischen Vor- und Rückfuss erklärt wird. Diese Relativbewegung kann anhand jüngster invasiver Arbeiten mit Knochenschrauben (Arndt et al., 2007; Lundgren et al., 2008) noch konkreter einzelnen Gelenken wie folgt zugeordnet werden: Im Gehen und Laufen finden in der Sagittalebene etwa zu gleichen Teilen im Chopart- und Lisfranc-Gelenk Relativbewegungen statt, jedoch mit einer ausgeprägten Dorsi-Plantarflexion zwischen Cuboid und Metatarsale fünf. Bewegungen in der Frontalebene werden vornehmlich im talo-navikularen Gelenk realisiert, hierbei rotiert der Komplex Calcaneus-Cuboid-Navikular mehr oder weniger als Einheit um den Taluskopf, wie es auch schon Fick (1911) beschrieben hat. Bewegungen zwischen Vor- und Rückfuss in der Transversalebene sind sowohl im talo-navikularen als auch im Gelenk zwischen Cuboid und Metatarsale fünf ausgeprägt. Die Bewegungen finden also sowohl im Chopart- als auch im Lisfranc- Gelenk statt, wodurch sich die Wahl der Vor-/Rückfuss-Marker bestätigt (kein Marker im Mittelfussbereich). Weiter weisen diese Resultate der Vor- und Rückfussbewegungen (siehe Tab. 6) darauf hin, dass über die Abstossphase des Fusses im Gehen und Laufen bisher zu stark vereinfachende Annahmen gemacht wurden. Als eine der wichtigen Funktionen des menschlichen Fusses gilt die rigide Hebelwirkung beim Abstossen (Inman et al., 1978; Segesser et al., 1983). Darunter wird verstanden, dass bei angehobener Ferse zwischen Fussballen und oberem Sprunggelenk ein Hebelarm entsteht, der mit zunehmender Rigidität eine grössere Wirkung zeigt. In Abbildung 8 ist jedoch zu erkennen, dass im Abstoss eine erhebliche Relativbewegung in Richtung Plantarflexion zwischen Vor- und Rückfuss auftritt. Der Fuss ist somit weniger rigide als bisher angenommen. Für zukünftige Arbeiten wäre es interessant zu verfolgen, ob unterschiedliche Fusstypen sich durch unterschiedliche Relativbewegungen charakterisieren lassen und damit unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, im Abstoss Kräfte auf den Unterschenkel zu übertragen. Relativbewegungen zwischen Rück-, Mittel- und Vorfuss sind zurzeit nur mit Bone-pin-Messungen möglich (Arndt et al., 2007). Der invasive Charakter derartiger Studien lässt es jedoch nicht zu, mit grösseren Probandengruppen zu arbeiten. Daher ist es sinnvoll, die in der Ganganalyse verwendeten Methoden mit externen Markern bestmöglich zu optimieren. Dabei ergeben sich zwei Probleme: (i) der Fehler verursacht durch die Hautbewegung und (ii) der Fehler verursacht durch das Zusammenlegen mehrerer Gelenke zu einem Segment. Zu (i) braucht es eine Untersuchung, die gleichzeitig mit Bone-pin-Markern und Hautmarkern arbeitet, was bisher nicht befriedigend realisiert werden konnte. Zu (ii) wurde hier ein 2-segmentiges Fussmodell vorgestellt, wobei weiterführende Arbeiten zum Ziel haben müssten, den Fuss in noch mehr Segmente zu unterteilen. Schlussbemerkungen List R. et al. In dieser Arbeit wurde ein 2-segmentiges Fussmodell (Segmente Vorfuss und Rückfuss) mit insgesamt neun Markern für kinematische Betrachtungen im Gehen und Laufen vorgestellt. Die Resultate zeigen eine deutliche Verbesserung gegenüber älteren 1-segmentigen Modellen und verdeutlichen die Bewegung zwischen Vor- und Rückfuss. Das 2-segmentige Fussmodell lässt erhebliche Plantarflexion beim Abstoss im Gehen und Laufen erkennen, was einer Deformation des Fusses gleichkommt, womit die Hebelwirkung beim Abstossen gegenüber einem ideal rigiden Fuss reduziert wird. Die Entwicklung von Fussmodellen ist damit aber keineswegs abgeschlossen. Vielmehr werden Messsysteme und Messmethoden künftig noch mehr Segmente erfassbar machen, um die Funktion des menschlichen Fusses in der Bewegung besser zu verstehen. Danksagung Die Autoren möchten sich für die finanzielle Unterstützung der Eidgenössischen Sportkommission (ESK) für dieses Projekt bedanken. Korrespondenzadresse: Renate List, Institut für Biomechanik, ETH Hönggerberg HCI E 451, 8093 Zürich Literaturverzeichnis Arndt A., Wolf P., Liu A., Nester C., Stacoff A., Jones R., Lundgren P., Lundberg A. (2007): Intrinsic foot kinematics measured in vivo during the stance phase of slow running. J. Biomech. 40: Bachmann C., Gerber H., Stacoff A. (2008): Labormessmethoden und ausgewählte Beispiele zur instrumentierten Ganganalyse. Sportmedizin und Sporttraumatologie 56. Capozzo A., Capello A., Della Croce U., Pensalfini F. (1997): Surfacemarker cluster design criteria for 3-D bone movement reconstruction. IEEE Transactions on Biomedical Engineering 44: Challis J.H. (1995): A procedure for determining rigid body transformation parameters. J. Biomech. 28: Dettwyler M. (2005): Biomechanische Untersuchungen und Modellierungen am menschlichen oberen Sprunggelenk im Hinblick auf Arthroplastiken. ETH Zürich, Zürich. Fick R. (1911): Handbuch der Anatomie und Mechanik der Gelenke. Gustav Fischer Verlag, Jena. Hepp W.R., Debrunner H.U. (2004): Orthopädisches Diagnostikum. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York. Hintermann B. (1994): Die mechanische Kopplung der Sprunggelenke. Habilitationsschrift der Universität Basel. Hunt A.E., Smith R.M., Torode M., Keenan A.M. (2001): Inter-segment foot motion and ground reaction forces over the stance phase of walking. Clin. Biomech. (Bristol, Avon) 16: Husa J., Isenegger U., Ukelo T., Stacoff A., Stüssi E. (2008): Gemeinsamkeiten und geschlechtsspezifische Unterschiede in der Kinematik zwischen Sportlern mit und ohne Patellofemorales Schmerzsyndrom (PFPS). Sportmedizin und Sporttraumatologie 56. Inman V.T., Mann R.A. (1978): Biomechanics of the foot and ankle. DuVries Surgery of the Foot, Edited by Mann, R.A. Mosby, Saint Louis Kramers-de Quervain I., Stüssi E., Stacoff A. (2008): Ganganalyse beim Gehen und Laufen. Sportmedizin und Sporttraumatologie 56. Leardini A., Benedetti M.G., Berti L., Bettinelli D., Nativo R., Giannini S. (2007): Rear-foot, mid-foot and fore-foot motion during the stance phase of gait. Gait Posture 25: List R. (2005): A Hybrid Marker Set for future basic research and instrumented gait analysis at the Laboratory for Biomechanics. Diploma Thesis Dipl. Natw. ETH Zürich. List R., Unternährer S., Stacoff A., Ukelo T., Stüssi E. (2006): Twosegment foot kinematics during running. In 5th World Congress of Biomechanics. Munich.
7 Erfassen der Vor- und Rückfussbewegungen im Gehen und Laufen 49 Lundgren P., Nester C., Liu A., Arndt A., Jones R., Stacoff A., Wolf P., Lundberg A. (2008): Invasive in vivo measurement of rear, mid and forefoot motion during walking. Gait and Posture, in press. Manal K., McClay I., Stanhope S., Richards J., Galinat B. (2000): Comparison of surface mounted markers and attachment methods in estimating tibial rotations during walking: an in vivo study. Gait & Posture 11: Myers K.A., Wang M., Marks R.M., Harris G.F. (2001): Validation of a multi-segment foot and ankle kinematic model for pediatric gait. IEEE Trans. Neural. Syst. Rehabil. Eng Rattanaprasert U., Smith R., Sullivan M., Gilleard W. (1999): Threedimensional kinematics of the forefoot, rearfoot, and leg without the function of tibialis posterior in comparison with normals during stance phase of walking. Clin. Biomech. (Bristol, Avon) 14: Segesser B., Stacoff A. (1983): The loading of the ankle from a biomechanical point of view. Medizin und Sport 23: Simon J., Doederlein L., McIntosh A.S., Metaxiotis D., Bock H.G., Wolf S.I. (2006): The Heidelberg foot measurement method: development, description and assessment. Gait Posture 23: Soderkvist I., Wedin P.A. (1993): Determining the movements of the skeleton using well-configured markers. J. Biomech. 26: Stacoff A., Kälin X., Stüssi E. (1991): The effects of shoes on the torsion and rearfoot motion in running. Med. Sci. Sports Exerc. 23: Stacoff A., Nigg B.M., Reinschmidt C., van den Bogert A.J., Lundberg A., Stüssi E., Denoth J. (2000): Movement coupling at the ankle during the stance phase of running. Foot Ankle Int. 21: Stacoff A., Wolf P., Arndt A., Liu A., Nester C., Jones R., Lundgren P., Stüssi E., Lundberg A. (2007): Possible functional units of the human foot. Invited Paper «Foot and Ankle Session». In: Program and Abstracts of the XXI Congress, International Society of Biomechanics, Taipei, Taiwan. Stebbins J., Harrington M., Thompson N., Zavatsky A., Theologis T. (2006): Repeatability of a model for measuring multi-segment foot kinematics in children. Gait Posture 23: Steindler A. (1977): Kinesiology of the human body. Thomas, Springfield, USA Wu W.L., Su F.C., Cheng Y.M., Huang P.J., Chou Y.L., Chou C.K. (2000): Gait analysis after ankle arthrodesis. Gait Posture 11: Wyss C., Stacoff A. (2008): Die Anwendung der Ganganalyse in der Fusschirurgie. Sportmedizin und Sporttraumatologie 56.
Kontroll- und Übungsfragen Teil II zur Kursreihe Manuelle Therapie (Stand )
 Kontroll- und Übungsfragen Teil II zur Kursreihe Manuelle Therapie (Stand 09.01.2012) Gelenkmechanik: Richtung des Gleitens der Gelenkflächen Anmerkungen: Die hier beschriebenen Richtungen des Gleitens
Kontroll- und Übungsfragen Teil II zur Kursreihe Manuelle Therapie (Stand 09.01.2012) Gelenkmechanik: Richtung des Gleitens der Gelenkflächen Anmerkungen: Die hier beschriebenen Richtungen des Gleitens
Gemeinsamkeiten und geschlechtsspezifische Unterschiede in der Kinematik zwischen Sportlern mit und ohne Patellofemorales Schmerzsyndrom (PFPS)
 Originalartikel Husa J. et al. Johanna Husa,, Ueli Isenegger, Thomas Ukelo, Alex Stacoff, Edgar Stüssi Institut für Biomechanik, ETH Zürich Institut der Biomedizin, Universität von Kuopio, Finnland Gemeinsamkeiten
Originalartikel Husa J. et al. Johanna Husa,, Ueli Isenegger, Thomas Ukelo, Alex Stacoff, Edgar Stüssi Institut für Biomechanik, ETH Zürich Institut der Biomedizin, Universität von Kuopio, Finnland Gemeinsamkeiten
Therapie der Tibialis posteriorsehnenruptur
 Therapie der Tibialis posteriorsehnenruptur H.-J. Trnka FUSSZENTRUM AN DER WIENER PRIVATKLINIK www.fussforum fussforum.at Die Tibialis posterior Sehne Erste Beschreibung 1969 Kettelkamp DD, Alexander
Therapie der Tibialis posteriorsehnenruptur H.-J. Trnka FUSSZENTRUM AN DER WIENER PRIVATKLINIK www.fussforum fussforum.at Die Tibialis posterior Sehne Erste Beschreibung 1969 Kettelkamp DD, Alexander
Biomechanische Evaluation der functionellen Eigenschaften
 Biomechanische Evaluation der functionellen Eigenschaften der ACTIVE TENSE Kleidung* G.-P. Brüggemann, S. Willwacher & K. Fischer Institut für Biomechanik und Orthopädie Deutsche Sporthochschule Köln *eine
Biomechanische Evaluation der functionellen Eigenschaften der ACTIVE TENSE Kleidung* G.-P. Brüggemann, S. Willwacher & K. Fischer Institut für Biomechanik und Orthopädie Deutsche Sporthochschule Köln *eine
Inhaltsverzeichnis. A. Allgemeine Anatomie
 Inhaltsverzeichnis A. Allgemeine Anatomie A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 Allgemeine Ausdrücke, Richtungen im Raum Allgemeine Ausdrücke, Bewegungen, Ebenen Knochenentwicklung Enchondrale
Inhaltsverzeichnis A. Allgemeine Anatomie A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 Allgemeine Ausdrücke, Richtungen im Raum Allgemeine Ausdrücke, Bewegungen, Ebenen Knochenentwicklung Enchondrale
Funktionelle Anatomie Biomechanik Fuss
 Funktionelle Anatomie Biomechanik Fuss Dr.U.Böhni (Stein am Rhein) Zentrum für interdisziplinare Therapie des Bewegungsapparates ZeniT Schaffhausen (Schweiz) Fussskelett: zweiarmiger Hebel Horizontal fibulare
Funktionelle Anatomie Biomechanik Fuss Dr.U.Böhni (Stein am Rhein) Zentrum für interdisziplinare Therapie des Bewegungsapparates ZeniT Schaffhausen (Schweiz) Fussskelett: zweiarmiger Hebel Horizontal fibulare
Funktionelle Anatomie
 Funktionelle Anatomie des menschlichen Bewegungsapparates Bei den Zeichenvorlagen handelt es sich zum Teil um modifizierte Abbildungen aus verschiedenen Lehrbüchern. Sie dürfen deshalb nur zur Mitarbeit
Funktionelle Anatomie des menschlichen Bewegungsapparates Bei den Zeichenvorlagen handelt es sich zum Teil um modifizierte Abbildungen aus verschiedenen Lehrbüchern. Sie dürfen deshalb nur zur Mitarbeit
3D Bewegungsanalysen und Fussdruckmessungen
 3D Bewegungsanalysen und Fussdruckmessungen Domenico Gurzi Bewegungsanalytiker Lehrbeauftragter für den Arbeitsbereich Sport- und Bewegungsmedizin der Hochschule Fresenius. Head of Sports Biomechanics
3D Bewegungsanalysen und Fussdruckmessungen Domenico Gurzi Bewegungsanalytiker Lehrbeauftragter für den Arbeitsbereich Sport- und Bewegungsmedizin der Hochschule Fresenius. Head of Sports Biomechanics
LEITFADEN - GRUNDLAGEN DER BEWEGUNGSANALYSE
 LEITFADEN - GRUNDLAGEN DER BEWEGUNGSANALYSE Autoren: Roland Aller, Ulrike Hausen 2015 WWW.KNSU.DE Seite 1 Übersicht Leitfaden zum Powerpoint-Vortrag Bewegungsanalyse o Was ist die Bewegungsanalyse? o Anwendungsgebiete
LEITFADEN - GRUNDLAGEN DER BEWEGUNGSANALYSE Autoren: Roland Aller, Ulrike Hausen 2015 WWW.KNSU.DE Seite 1 Übersicht Leitfaden zum Powerpoint-Vortrag Bewegungsanalyse o Was ist die Bewegungsanalyse? o Anwendungsgebiete
Mittelpunkt des Sprunggelenks
 IDEAL Technologien IDEAL HEEL Fördert die korrekte Ausrichtung und reduziert Hebelarme Ideal Heel führt dazu, dass sich der Bodenkontakt und Kraftansatzpunkt weiter nach vorn verlagert. Der Läufer landet
IDEAL Technologien IDEAL HEEL Fördert die korrekte Ausrichtung und reduziert Hebelarme Ideal Heel führt dazu, dass sich der Bodenkontakt und Kraftansatzpunkt weiter nach vorn verlagert. Der Läufer landet
Gangparameter von verschiedenen Schuhen
 Gangparameter von verschiedenen Schuhen Kinetik & Kinematik Patrick Hiltpold Aline Mühl Dr. Renate List Dr. Dr. Silvio Lorenzetti Vergleich der Bewegungen & Kräfte von: Barfuss - MBT - kyboot - Joya -
Gangparameter von verschiedenen Schuhen Kinetik & Kinematik Patrick Hiltpold Aline Mühl Dr. Renate List Dr. Dr. Silvio Lorenzetti Vergleich der Bewegungen & Kräfte von: Barfuss - MBT - kyboot - Joya -
Rotation. Versuch: Inhaltsverzeichnis. Fachrichtung Physik. Erstellt: U. Escher A. Schwab Aktualisiert: am 29. 03. 2010. Physikalisches Grundpraktikum
 Fachrichtung Physik Physikalisches Grundpraktikum Versuch: RO Erstellt: U. Escher A. Schwab Aktualisiert: am 29. 03. 2010 Rotation Inhaltsverzeichnis 1 Aufgabenstellung 2 2 Allgemeine Grundlagen 2 2.1
Fachrichtung Physik Physikalisches Grundpraktikum Versuch: RO Erstellt: U. Escher A. Schwab Aktualisiert: am 29. 03. 2010 Rotation Inhaltsverzeichnis 1 Aufgabenstellung 2 2 Allgemeine Grundlagen 2 2.1
DIE MENSCHLICHE MUSKULATUR
 DIE MENSCHLICHE MUSKULATUR UNTERE EXTREMITÄT 1. m. iliopsoas: Hüftbeuger 2. m. glutaeus maximus: Gesäßmuskel 3. Abduktoren 4. Adduktoren: Schenkelanzieher 5. m. quadrizeps: vierköpfiger Beinstrecker 6.
DIE MENSCHLICHE MUSKULATUR UNTERE EXTREMITÄT 1. m. iliopsoas: Hüftbeuger 2. m. glutaeus maximus: Gesäßmuskel 3. Abduktoren 4. Adduktoren: Schenkelanzieher 5. m. quadrizeps: vierköpfiger Beinstrecker 6.
Sportanatomie WS 04/05
 Sportanatomie WS 04/05 Hörsaal Hessing-Stiftung Zeit: Die. 17:15 bis 18:45 Dozent: Priv.Doz. Dr.med.Naumann Fr.Dr.med.Bleuel Hr.Dr.med.Weiss Vorlesung WS 2004/5 Datum Thema 19.10. Systematische Anatomie
Sportanatomie WS 04/05 Hörsaal Hessing-Stiftung Zeit: Die. 17:15 bis 18:45 Dozent: Priv.Doz. Dr.med.Naumann Fr.Dr.med.Bleuel Hr.Dr.med.Weiss Vorlesung WS 2004/5 Datum Thema 19.10. Systematische Anatomie
Veröffentlichungen in Kongressbänden und Fachzeitschriften (peer review):
 Publikationsliste Florian Kreuzpointner Kongressvorträge: Kreuzpointner, F. (2013). A symmetrical juvenile idiopathic ankle joint arthritis alters the plantar pressure distribution while normal walking.
Publikationsliste Florian Kreuzpointner Kongressvorträge: Kreuzpointner, F. (2013). A symmetrical juvenile idiopathic ankle joint arthritis alters the plantar pressure distribution while normal walking.
Rund um den Fuss. Ruth Altermatt Rheumatologie im Silberturm St. Gallen
 Rund um den Fuss Ruth Altermatt Rheumatologie im Silberturm St. Gallen AGENDA Einleitung Fuss in der RA Fuss bei Spondylarthropathie (SpA) Knöchelschmerz Lateral Medial Take Home Fussabdruck Lucy (3.6
Rund um den Fuss Ruth Altermatt Rheumatologie im Silberturm St. Gallen AGENDA Einleitung Fuss in der RA Fuss bei Spondylarthropathie (SpA) Knöchelschmerz Lateral Medial Take Home Fussabdruck Lucy (3.6
Biomechanik im Sporttheorieunterricht
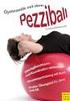 Betrifft 22 DR. MARTIN HILLEBRECHT Biomechanik im Sporttheorieunterricht - Grafische Schwerpunktbestimmung - 1. EINLEITUNG Im ersten Teil diese Artikels (vgl. Betrifft Sport 4/ 98) wurden zwei Verfahren
Betrifft 22 DR. MARTIN HILLEBRECHT Biomechanik im Sporttheorieunterricht - Grafische Schwerpunktbestimmung - 1. EINLEITUNG Im ersten Teil diese Artikels (vgl. Betrifft Sport 4/ 98) wurden zwei Verfahren
Gangparameter von verschiedenen Schuhen
 Gangparameter von verschiedenen Schuhen Kinetik & Kinematik Patrick Hiltpold Aline Mühl Dr. Renate List Dr. Dr. Silvio Lorenzetti 1 Zusammenfassung Einleitung: Während das Gehen die wichtigste alltägliche
Gangparameter von verschiedenen Schuhen Kinetik & Kinematik Patrick Hiltpold Aline Mühl Dr. Renate List Dr. Dr. Silvio Lorenzetti 1 Zusammenfassung Einleitung: Während das Gehen die wichtigste alltägliche
Obere Extremität l Schultergürtel
 Funktionelle Anatomie des menschlichen Bewegungsapparates Obere Extremität l Schultergürtel FS 05 Fabian Hambücher, deutscher Kunstturner PD Dr. Amrein Muskeln der oberen Extremität Übersicht Schultergürtel
Funktionelle Anatomie des menschlichen Bewegungsapparates Obere Extremität l Schultergürtel FS 05 Fabian Hambücher, deutscher Kunstturner PD Dr. Amrein Muskeln der oberen Extremität Übersicht Schultergürtel
Grundbegriffe der Biomechanik des Fußes
 Grundbegriffe der Biomechanik des Fußes 1 1 Grundbegriffe der Biomechanik des Fußes 1.1 Die Hauptebenen und Bewegungsachsen der Fußgelenke Durch die Hauptebenen kann die Lage eines Körpers (hier des Fußes)
Grundbegriffe der Biomechanik des Fußes 1 1 Grundbegriffe der Biomechanik des Fußes 1.1 Die Hauptebenen und Bewegungsachsen der Fußgelenke Durch die Hauptebenen kann die Lage eines Körpers (hier des Fußes)
ANATOMIE DES BEWEGUNGSAPPARATS
 ANATOMIE DES BEWEGUNGSAPPARATS Philipp Hausser GluckerSchule DER FUß UND DIE FUßGELENKE 1 Fähigkeiten des Fußes: Sensorische Erfassung Aufnehmen von Kräften Kräfte abfedern, weich machen und sich an die
ANATOMIE DES BEWEGUNGSAPPARATS Philipp Hausser GluckerSchule DER FUß UND DIE FUßGELENKE 1 Fähigkeiten des Fußes: Sensorische Erfassung Aufnehmen von Kräften Kräfte abfedern, weich machen und sich an die
Challenges for the future between extern and intern evaluation
 Evaluation of schools in switzerland Challenges for the future between extern and intern evaluation Michael Frais Schulentwicklung in the Kanton Zürich between internal evaluation and external evaluation
Evaluation of schools in switzerland Challenges for the future between extern and intern evaluation Michael Frais Schulentwicklung in the Kanton Zürich between internal evaluation and external evaluation
7.6. Prüfungsaufgaben zu Normalenformen
 7.6. Prüfungsaufgaben zu Normalenformen Aufgabe () Gegeben sind die Gerade g: x a + r u mit r R und die Ebene E: ( x p ) n. a) Welche geometrische Bedeutung haben die Vektoren a und u bzw. p und n? Veranschaulichen
7.6. Prüfungsaufgaben zu Normalenformen Aufgabe () Gegeben sind die Gerade g: x a + r u mit r R und die Ebene E: ( x p ) n. a) Welche geometrische Bedeutung haben die Vektoren a und u bzw. p und n? Veranschaulichen
Ways and methods to secure customer satisfaction at the example of a building subcontractor
 Abstract The thesis on hand deals with customer satisfaction at the example of a building subcontractor. Due to the problems in the building branch, it is nowadays necessary to act customer oriented. Customer
Abstract The thesis on hand deals with customer satisfaction at the example of a building subcontractor. Due to the problems in the building branch, it is nowadays necessary to act customer oriented. Customer
Ganganalyse beim Gehen und Laufen
 Ganganalyse Originalartikel beim Gehen und Laufen 35 Inès A. Kramers-de Quervain 1,2, Edgar Stüssi 1, Alex Stacoff 1 1 Institut für Biomechanik, ETH Zürich 2 Schulthess Klinik Zürich Ganganalyse beim Gehen
Ganganalyse Originalartikel beim Gehen und Laufen 35 Inès A. Kramers-de Quervain 1,2, Edgar Stüssi 1, Alex Stacoff 1 1 Institut für Biomechanik, ETH Zürich 2 Schulthess Klinik Zürich Ganganalyse beim Gehen
Körperhaltung, Körperspannung, Drehungen. ÖRRV Übungsleiterausbildung MMag. Roman Palmstingl
 Körperhaltung, Körperspannung, Drehungen ÖRRV Übungsleiterausbildung MMag. Roman Palmstingl 14.4.2013 Körperhaltung Wozu? Ausgangsposition für Bewegung Verfeinern und Optimieren der Bewegung Bewegungsharmonie
Körperhaltung, Körperspannung, Drehungen ÖRRV Übungsleiterausbildung MMag. Roman Palmstingl 14.4.2013 Körperhaltung Wozu? Ausgangsposition für Bewegung Verfeinern und Optimieren der Bewegung Bewegungsharmonie
Bevölkerungswachstum und Armutsminderung in. Entwicklungsländern. Das Fallbeispiel Philippinen
 Bevölkerungswachstum und Armutsminderung in Entwicklungsländern. Das Fallbeispiel Philippinen DISSERTATION am Fachbereich Politische Wissenschaft der Freien Universität Berlin Verfasser: Christian H. Jahn
Bevölkerungswachstum und Armutsminderung in Entwicklungsländern. Das Fallbeispiel Philippinen DISSERTATION am Fachbereich Politische Wissenschaft der Freien Universität Berlin Verfasser: Christian H. Jahn
JOINT KINEMATICS OF UNCONSTRAINED ANKLE ARTHROPLASTIES
 DISS. ETH NO. 18404 JOINT KINEMATICS OF UNCONSTRAINED ANKLE ARTHROPLASTIES A dissertation submitted to ETH ZURICH for the degree of Doctor of Sciences presented by RENATE BARBARA LIST Dipl. Natw. ETH born
DISS. ETH NO. 18404 JOINT KINEMATICS OF UNCONSTRAINED ANKLE ARTHROPLASTIES A dissertation submitted to ETH ZURICH for the degree of Doctor of Sciences presented by RENATE BARBARA LIST Dipl. Natw. ETH born
Campus Innenstadt LMU München
 Neue Implantate zur Versorgung von komplexen Sprunggelenksfrakturen Erste klinische Erfahrungen Markus Regauer Standardversorgung von Sprunggelenksfrakturen Kleinfragment-Titan-Implantate Standardversorgung
Neue Implantate zur Versorgung von komplexen Sprunggelenksfrakturen Erste klinische Erfahrungen Markus Regauer Standardversorgung von Sprunggelenksfrakturen Kleinfragment-Titan-Implantate Standardversorgung
Bei näherer Betrachtung des Diagramms Nr. 3 fällt folgendes auf:
 18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
Die häufigen Fussprobleme. Dr. med. Linas Jankauskas Facharzt FMH für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates OKL
 Die häufigen Fussprobleme Dr. med. Linas Jankauskas Facharzt FMH für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates OKL Fuss als kompliziertes Gebilde 26 Knochen 33 Gelenke 114 Bänder
Die häufigen Fussprobleme Dr. med. Linas Jankauskas Facharzt FMH für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates OKL Fuss als kompliziertes Gebilde 26 Knochen 33 Gelenke 114 Bänder
Campus Innenstadt LMU München
 Frakturen des proximalen Metatarsale V Neue Klassifikation und Behandlungsempfehlungen basierend auf der aktuellen Evidenz H. Polzer & W.C. Prall Geschichte Jones (1902) Ann Surg 35:697 Epidemiologie Die
Frakturen des proximalen Metatarsale V Neue Klassifikation und Behandlungsempfehlungen basierend auf der aktuellen Evidenz H. Polzer & W.C. Prall Geschichte Jones (1902) Ann Surg 35:697 Epidemiologie Die
BORT Helix S. USG-Bandage. BORT. Das Plus an Ihrer Seite. Torsionsunterstützende Aktiv-Bandage
 BORT Helix S SPIRALDYNAMIK USG-Bandage Torsionsunterstützende Aktiv-Bandage Funktionell unterstützende Zügelung bei Knick-, Senk- und Spreizfußbeschwerden sowie Zehendeformitäten Unterstützung der Rückfuß-Torsion
BORT Helix S SPIRALDYNAMIK USG-Bandage Torsionsunterstützende Aktiv-Bandage Funktionell unterstützende Zügelung bei Knick-, Senk- und Spreizfußbeschwerden sowie Zehendeformitäten Unterstützung der Rückfuß-Torsion
BORT Helix S. -Bandage. BORT. Das Plus an Ihrer Seite. Torsionsunterstützende Aktiv-Bandage
 BORT Helix S Spiraldynamik -Bandage Torsionsunterstützende Aktiv-Bandage Funktionell unterstützende Zügelung bei Knick-, Senk- und Spreizfußbeschwerden sowie Zehendeformitäten Unterstützung der Rückfuß-Torsion
BORT Helix S Spiraldynamik -Bandage Torsionsunterstützende Aktiv-Bandage Funktionell unterstützende Zügelung bei Knick-, Senk- und Spreizfußbeschwerden sowie Zehendeformitäten Unterstützung der Rückfuß-Torsion
Anatomie und Biomechanik der Gliedmaßen
 Anatomie und Biomechanik der Gliedmaßen Knöcherne Topographie Vorderbein Schulterblatt Schulter- / Buggelenk Ellbogen Schulterblatt Schultergelenk Ellbogen Röhrbein Hufgelenk Vorderfußwurzelgelenk Carpus
Anatomie und Biomechanik der Gliedmaßen Knöcherne Topographie Vorderbein Schulterblatt Schulter- / Buggelenk Ellbogen Schulterblatt Schultergelenk Ellbogen Röhrbein Hufgelenk Vorderfußwurzelgelenk Carpus
Personenidentifikation anhand von biologischer Bewegung strukturelle und kinematische Parameter
 Westhoff & Troje 3 CORD WESTHOFF & NIKOLAUS F. TROJE Personenidentifikation anhand von biologischer Bewegung strukturelle und kinematische Parameter Einleitung Die Untersuchung biologischer Bewegung wurde
Westhoff & Troje 3 CORD WESTHOFF & NIKOLAUS F. TROJE Personenidentifikation anhand von biologischer Bewegung strukturelle und kinematische Parameter Einleitung Die Untersuchung biologischer Bewegung wurde
Kapitel 2 Klinische Untersuchung von Fuß und Sprunggelenk
 Kapitel 2 Klinische Untersuchung von Fuß und Sprunggelenk Allgemeines: Folgender Untersuchungsalgorithmus hat sich bewährt: 1. Patienten beobachten 2. Anamnese 3. Klinik (inklusive Gangbild) 4. Schuhe,
Kapitel 2 Klinische Untersuchung von Fuß und Sprunggelenk Allgemeines: Folgender Untersuchungsalgorithmus hat sich bewährt: 1. Patienten beobachten 2. Anamnese 3. Klinik (inklusive Gangbild) 4. Schuhe,
3.3.1 Referenzwerte für Fruchtwasser-Schätzvolumina ( SSW)
 50 3.3 Das Fruchtwasser-Schätzvolumen in der 21.-24.SSW und seine Bedeutung für das fetale Schätzgewicht in der 21.-24.SSW und für das Geburtsgewicht bei Geburt in der 36.-43.SSW 3.3.1 Referenzwerte für
50 3.3 Das Fruchtwasser-Schätzvolumen in der 21.-24.SSW und seine Bedeutung für das fetale Schätzgewicht in der 21.-24.SSW und für das Geburtsgewicht bei Geburt in der 36.-43.SSW 3.3.1 Referenzwerte für
Biomechanik. Was ist denn das??? Copyright by Birgit Naberfeld & Sascha Kühnel
 Biomechanik Was ist denn das??? Was ist Biomechanik Seite 2 Was ist Biomechanik? Definitionen: "Die Biomechanik des Sports ist die Wissenschaft von der mechanischen Beschreibung und Erklärung der Erscheinungen
Biomechanik Was ist denn das??? Was ist Biomechanik Seite 2 Was ist Biomechanik? Definitionen: "Die Biomechanik des Sports ist die Wissenschaft von der mechanischen Beschreibung und Erklärung der Erscheinungen
Publikationsliste. Zeitschriften/Journale. Originalarbeiten
 Publikationsliste Prof. Dr. Bernhard Elsner, MPH Stand: 09.10.2014 IF = Science Citation Impact Factor 2012 * = Diese Publikation resultiert aus der Doktorarbeit. Zeitschriften/Journale Originalarbeiten
Publikationsliste Prof. Dr. Bernhard Elsner, MPH Stand: 09.10.2014 IF = Science Citation Impact Factor 2012 * = Diese Publikation resultiert aus der Doktorarbeit. Zeitschriften/Journale Originalarbeiten
Gehen und Spastizität. Prof. Reinald Brunner Neuroorthopädie Universitätskinderspital Basel (UKBB)
 Gehen und Spastizität Prof. Reinald Brunner Neuroorthopädie Universitätskinderspital Basel (UKBB) Stehen und Gehen Was hält uns aufrecht? funktionelle Anatomie Beugestellung und Haltearbeit externes Beugemoment
Gehen und Spastizität Prof. Reinald Brunner Neuroorthopädie Universitätskinderspital Basel (UKBB) Stehen und Gehen Was hält uns aufrecht? funktionelle Anatomie Beugestellung und Haltearbeit externes Beugemoment
Evaluation geschlechtsspezifischer Differenzen der Biomechanik des Laufens bei verschiedenen Geschwindigkeiten (AZ /10)
 45 Evaluation geschlechtsspezifischer Differenzen der Biomechanik des Laufens bei verschiedenen Geschwindigkeiten (AZ 070122/10) Dominic Gehring & Albert Gollhofer (Projektleiter) Universität Freiburg,
45 Evaluation geschlechtsspezifischer Differenzen der Biomechanik des Laufens bei verschiedenen Geschwindigkeiten (AZ 070122/10) Dominic Gehring & Albert Gollhofer (Projektleiter) Universität Freiburg,
Betriebsarten-Umschalter Common mode / Differential mode switch
 Betriebsarten-Umschalter Common mode / Differential mode switch Beschreibung: Der Betriebsarten-Umschalter CMDM 87 erweitert die Messmöglichkeiten zweier V-Netznachbildungen um die einer T- und Delta-Netznachbildung.
Betriebsarten-Umschalter Common mode / Differential mode switch Beschreibung: Der Betriebsarten-Umschalter CMDM 87 erweitert die Messmöglichkeiten zweier V-Netznachbildungen um die einer T- und Delta-Netznachbildung.
Ahamed Bilal Asaf Ali (Autor) Design Rules for Permanent Magnet Synchronous Machine with Tooth Coil Winding Arrangement
 Ahamed Bilal Asaf Ali (Autor) Design Rules for Permanent Magnet Synchronous Machine with Tooth Coil Winding Arrangement https://cuvillier.de/de/shop/publications/6738 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin
Ahamed Bilal Asaf Ali (Autor) Design Rules for Permanent Magnet Synchronous Machine with Tooth Coil Winding Arrangement https://cuvillier.de/de/shop/publications/6738 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin
Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf GesmbH
 ?W( C," /O OEFZS BER. No. 4130 ME-233/81 DEZEMBER 1981 Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf GesmbH Vergleichende Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit von HTR-Brennelement Matrixgraphiten Karl Wal
?W( C," /O OEFZS BER. No. 4130 ME-233/81 DEZEMBER 1981 Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf GesmbH Vergleichende Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit von HTR-Brennelement Matrixgraphiten Karl Wal
Die Dokumentation kann auf einem angeschlossenen Sartorius Messwertdrucker erfolgen.
 Q-App: USP V2 Bestimmung des Arbeitsbereiches von Waagen gem. USP Kapitel 41. Determination of the operating range of balances acc. USP Chapter 41. Beschreibung Diese Q-App ist zur Bestimmung des Arbeitsbereiches
Q-App: USP V2 Bestimmung des Arbeitsbereiches von Waagen gem. USP Kapitel 41. Determination of the operating range of balances acc. USP Chapter 41. Beschreibung Diese Q-App ist zur Bestimmung des Arbeitsbereiches
2.4 Stoßprozesse. entweder nicht interessiert o- der keine Möglichkeit hat, sie zu untersuchen oder zu beeinflussen.
 - 52-2.4 Stoßprozesse 2.4.1 Definition und Motivation Unter einem Stoß versteht man eine zeitlich begrenzte Wechselwirkung zwischen zwei oder mehr Systemen, wobei man sich für die Einzelheiten der Wechselwirkung
- 52-2.4 Stoßprozesse 2.4.1 Definition und Motivation Unter einem Stoß versteht man eine zeitlich begrenzte Wechselwirkung zwischen zwei oder mehr Systemen, wobei man sich für die Einzelheiten der Wechselwirkung
EbM-Splitter 10 Sensitivität und Spezifität: Auswirkung der Wahl des Trennpunktes
 Sensitivität und Spezifität: Auswirkung der Wahl des Trennpunktes Seite - 1 - EbM-Splitter 10 Sensitivität und Spezifität: Auswirkung der Wahl des Trennpunktes Im vorigen EbM-Splitter [4] wurde auf die
Sensitivität und Spezifität: Auswirkung der Wahl des Trennpunktes Seite - 1 - EbM-Splitter 10 Sensitivität und Spezifität: Auswirkung der Wahl des Trennpunktes Im vorigen EbM-Splitter [4] wurde auf die
Anthropometrische Grundlagen für die Optimierung der Sitzposition im Radsport
 133 Anthropometrische Grundlagen für die Optimierung der Sitzposition im Radsport Björn Stapelfeldt (Projektleiter) & Malte Wangerin Universität Freiburg, Institut für Sport und Sportwissenschaft Problem
133 Anthropometrische Grundlagen für die Optimierung der Sitzposition im Radsport Björn Stapelfeldt (Projektleiter) & Malte Wangerin Universität Freiburg, Institut für Sport und Sportwissenschaft Problem
Indikationsgruppen. Fraktur Behandlungspfad 3 obere Extremität S22.2 Fraktur des Sternums
 Indikationsgruppen ICD Schlüssel Klartext Fraktur Behandlungspfad 3 obere Extremität S22.2 Fraktur des Sternums S22.3- Rippenfraktur S22.31 Fraktur der ersten Rippe S22.32 Fraktur einer sonstigen Rippe
Indikationsgruppen ICD Schlüssel Klartext Fraktur Behandlungspfad 3 obere Extremität S22.2 Fraktur des Sternums S22.3- Rippenfraktur S22.31 Fraktur der ersten Rippe S22.32 Fraktur einer sonstigen Rippe
Einleitung 2. 1 Koordinatensysteme 2. 2 Lineare Abbildungen 4. 3 Literaturverzeichnis 7
 Sonja Hunscha - Koordinatensysteme 1 Inhalt Einleitung 2 1 Koordinatensysteme 2 1.1 Kartesisches Koordinatensystem 2 1.2 Polarkoordinaten 3 1.3 Zusammenhang zwischen kartesischen und Polarkoordinaten 3
Sonja Hunscha - Koordinatensysteme 1 Inhalt Einleitung 2 1 Koordinatensysteme 2 1.1 Kartesisches Koordinatensystem 2 1.2 Polarkoordinaten 3 1.3 Zusammenhang zwischen kartesischen und Polarkoordinaten 3
New X-ray optics for biomedical diagnostics
 New X-ray optics for biomedical diagnostics Franz Pfeiffer, Julia Herzen Technical University Munich, Physics-Department, Chair for Biomedical Physics (E17) Jürgen Mohr, Johannes Kenntner Karlsruhe Institute
New X-ray optics for biomedical diagnostics Franz Pfeiffer, Julia Herzen Technical University Munich, Physics-Department, Chair for Biomedical Physics (E17) Jürgen Mohr, Johannes Kenntner Karlsruhe Institute
Kapitel 3. Minkowski-Raum. 3.1 Raumzeitlicher Abstand
 Kapitel 3 Minkowski-Raum Die Galilei-Transformation lässt zeitliche Abstände und Längen unverändert. Als Länge wird dabei der räumliche Abstand zwischen zwei gleichzeitigen Ereignissen verstanden. Solche
Kapitel 3 Minkowski-Raum Die Galilei-Transformation lässt zeitliche Abstände und Längen unverändert. Als Länge wird dabei der räumliche Abstand zwischen zwei gleichzeitigen Ereignissen verstanden. Solche
In einem kartesischen Koordinatensystem ist der Körper ABCDPQRS mit A(28 0 0),
 IQB-Aufgabe Analytische Geometrie I In einem kartesischen Koordinatensystem ist der Körper ABCDPQRS mit A(28 0 0), B(28 10 0), C(0 10 0), D(0 0 0) und P(20 0 6) gegeben. Der Körper ist ein schiefes Prisma,
IQB-Aufgabe Analytische Geometrie I In einem kartesischen Koordinatensystem ist der Körper ABCDPQRS mit A(28 0 0), B(28 10 0), C(0 10 0), D(0 0 0) und P(20 0 6) gegeben. Der Körper ist ein schiefes Prisma,
Einführung: Biomechanik von Sportverletzungen
 Einführung: Biomechanik von Sportverletzungen Teil 2 PD Dr. Kai-Uwe Schmitt AGU Zürich Arbeitsgruppe für Unfallmechanik www.agu.ch Anatomie Knochen [Nigg & Herzog, 1999] Knochen mechanische Eigenschaften
Einführung: Biomechanik von Sportverletzungen Teil 2 PD Dr. Kai-Uwe Schmitt AGU Zürich Arbeitsgruppe für Unfallmechanik www.agu.ch Anatomie Knochen [Nigg & Herzog, 1999] Knochen mechanische Eigenschaften
Companion Technologie
 Companion Technologie Emotionen erkennen, verstehen und kai.bielenberg@haw-hamburg.de Agenda 1. Einleitung a. Was war nochmal Companion Technologie? b. Teilbereiche c. Warum Emotionen? 2. Ansätze a. Facial
Companion Technologie Emotionen erkennen, verstehen und kai.bielenberg@haw-hamburg.de Agenda 1. Einleitung a. Was war nochmal Companion Technologie? b. Teilbereiche c. Warum Emotionen? 2. Ansätze a. Facial
Schubladentest. Fall 1: DIAGNOSEN, DIE NICHT OFFENSICHTLICH SIND UND GESUCHT WERDEN MÜSSEN. Diagnosen, die man suchen muss.
 DIAGNOSEN, DIE NICHT OFFENSICHTLICH SIND UND GESUCHT WERDEN MÜSSEN Dr. med. Marc Merian Facharzt für Orthopädie und Traumatologie des Bewegungsapparates ACGME Fellowship Trained Foot and Ankle Surgeon
DIAGNOSEN, DIE NICHT OFFENSICHTLICH SIND UND GESUCHT WERDEN MÜSSEN Dr. med. Marc Merian Facharzt für Orthopädie und Traumatologie des Bewegungsapparates ACGME Fellowship Trained Foot and Ankle Surgeon
Fachbereich Geowissenschaften. Layoutbeispiel einer Bachelorarbeit
 Fachbereich Geowissenschaften Institut für Meteorologie Layoutbeispiel einer Bachelorarbeit Bachelorarbeit von Max Mustermann Gutachter: Prof. Dr. Ulrich Cubasch Prof. Dr. Uwe Ulbrich 14. Januar 2011 Zusammenfassung
Fachbereich Geowissenschaften Institut für Meteorologie Layoutbeispiel einer Bachelorarbeit Bachelorarbeit von Max Mustermann Gutachter: Prof. Dr. Ulrich Cubasch Prof. Dr. Uwe Ulbrich 14. Januar 2011 Zusammenfassung
Kinesiologisches Taping
 w w w. a c a d e m y o f s p o r t s. d e w w w. c a m p u s. a c a d e m y o f s p o r t s. d e Kinesiologisches Taping L E SEPROBE online-campus Auf dem Online Campus der Academy of Sports erleben Sie
w w w. a c a d e m y o f s p o r t s. d e w w w. c a m p u s. a c a d e m y o f s p o r t s. d e Kinesiologisches Taping L E SEPROBE online-campus Auf dem Online Campus der Academy of Sports erleben Sie
Vergleich der Gelenkbelastung der unteren Extremitäten zwischen den Bewegungsformen Nordic Walking, Walking und Laufen mittels Inverser Dynamik
 Kleindienst FI 1, Michel KJ 1, Stief F 2, 4, Wedel F 2, Campe S 3, Krabbe B 1 Vergleich der Gelenkbelastung der unteren Extremitäten zwischen den Bewegungsformen Nordic Walking, Walking und mittels Inverser
Kleindienst FI 1, Michel KJ 1, Stief F 2, 4, Wedel F 2, Campe S 3, Krabbe B 1 Vergleich der Gelenkbelastung der unteren Extremitäten zwischen den Bewegungsformen Nordic Walking, Walking und mittels Inverser
2D - Strömungssimulation einer dreiblättrigen Vertikalachs-Windkraftanlage
 2D - Strömungssimulation einer dreiblättrigen Vertikalachs-Windkraftanlage Inhalt: 1 Einleitung 3 2 Technische Daten 4 3 Geometrie unter PRO Engineer 5 4 Vernetzung der Geometrie 9 5 Simulation des stationären
2D - Strömungssimulation einer dreiblättrigen Vertikalachs-Windkraftanlage Inhalt: 1 Einleitung 3 2 Technische Daten 4 3 Geometrie unter PRO Engineer 5 4 Vernetzung der Geometrie 9 5 Simulation des stationären
4 Ligamentanlagen. 4.1.1 Kollateralbänder des Knies 79 4.1.2 Patellarsehne 81 4.1.3 Achillessehne 83 4.1.4 Außenbänder des Sprunggelenks 85
 Ligamentanlagen.1 Bänder und Sehnen 79.1.1 Kollateralbänder des Knies 79.1.2 Patellarsehne 81.1.3 Achillessehne 83.1. Außenbänder des Sprunggelenks 85.2 Ligamentanlagen Sonderform Spacetape 87.2.1 Spacetape
Ligamentanlagen.1 Bänder und Sehnen 79.1.1 Kollateralbänder des Knies 79.1.2 Patellarsehne 81.1.3 Achillessehne 83.1. Außenbänder des Sprunggelenks 85.2 Ligamentanlagen Sonderform Spacetape 87.2.1 Spacetape
Alles Muskelschmerzen?
 Alles Muskelschmerzen? Wahrheit und Fiktion über die Facettgelenke Courtesy Prof. van Kleef Folie 1 Flexible anatomy of lumbar Z- joints Courtesy Prof. Filler Münster Folie 2 Wahrheit und Fiktion über
Alles Muskelschmerzen? Wahrheit und Fiktion über die Facettgelenke Courtesy Prof. van Kleef Folie 1 Flexible anatomy of lumbar Z- joints Courtesy Prof. Filler Münster Folie 2 Wahrheit und Fiktion über
Untersuchung der SARO-Einlegesohle bei VW im Werk Wolfsburg. - Abschlußbericht -
 Untersuchung der SARO-Einlegesohle bei VW im Werk Wolfsburg - Abschlußbericht - Eberhard-Karls-Universität Tübingen Medizinische Klinik & Polyklinik, Abtlg. Sportmedizin Institut für Sportwissenschaft,
Untersuchung der SARO-Einlegesohle bei VW im Werk Wolfsburg - Abschlußbericht - Eberhard-Karls-Universität Tübingen Medizinische Klinik & Polyklinik, Abtlg. Sportmedizin Institut für Sportwissenschaft,
Messprotokoll: Gelenkmessungen der Wirbelsäule (Neutral-Null-Methode)
 Messprotokoll: Gelenkmessungen der Wirbelsäule (Neutral-Null-Methode) Halswirbelsäule: Flexion/Extension (Abb. 4) Lateralflexion (Abb. 5) Rotation (Abb. 6) Brustwirbel-/Lendenwirbelsäule: Flexion Extension
Messprotokoll: Gelenkmessungen der Wirbelsäule (Neutral-Null-Methode) Halswirbelsäule: Flexion/Extension (Abb. 4) Lateralflexion (Abb. 5) Rotation (Abb. 6) Brustwirbel-/Lendenwirbelsäule: Flexion Extension
PRO SCAN WASSERANALYSE PER SMARTPHONE WATER ANALYSIS BY SMARTPHONE ANALYSE DE L EAU PAR SMARTPHONE
 N02 WASSERANALYSE PER SMARTPHONE WATER ANALYSIS BY SMARTPHONE ANALYSE DE L EAU PAR SMARTPHONE NO 2 NO 3 ph Cl 2 CO 2 ANALYSE DIAGNOSE LÖSUNG ANALYSIS DIAGNOSIS SOLUTION THE NEW GENERATION ph KH GH N03
N02 WASSERANALYSE PER SMARTPHONE WATER ANALYSIS BY SMARTPHONE ANALYSE DE L EAU PAR SMARTPHONE NO 2 NO 3 ph Cl 2 CO 2 ANALYSE DIAGNOSE LÖSUNG ANALYSIS DIAGNOSIS SOLUTION THE NEW GENERATION ph KH GH N03
Rechnen mit Vektoren. 1. Vektoren im Koordinatensystem Freie Vektoren in der Ebene
 Rechnen mit 1. im Koordinatensystem 1.1. Freie in der Ebene 1) Definition Ein Vektor... Zwei sind gleich, wenn... 2) Das ebene Koordinatensystem Wir legen den Koordinatenursprung fest, ferner zwei zueinander
Rechnen mit 1. im Koordinatensystem 1.1. Freie in der Ebene 1) Definition Ein Vektor... Zwei sind gleich, wenn... 2) Das ebene Koordinatensystem Wir legen den Koordinatenursprung fest, ferner zwei zueinander
POST MARKET CLINICAL FOLLOW UP
 POST MARKET CLINICAL FOLLOW UP (MEDDEV 2.12-2 May 2004) Dr. med. Christian Schübel 2007/47/EG Änderungen Klin. Bewertung Historie: CETF Report (2000) Qualität der klinischen Daten zu schlecht Zu wenige
POST MARKET CLINICAL FOLLOW UP (MEDDEV 2.12-2 May 2004) Dr. med. Christian Schübel 2007/47/EG Änderungen Klin. Bewertung Historie: CETF Report (2000) Qualität der klinischen Daten zu schlecht Zu wenige
Julia Bühlmeier, Benjamin Haar & Wilfried Alt (Projektleiter) Universität Stuttgart Institut für Sportwissenschaft
 19 Fußball interdisziplinär: Zur Optimierung der Prävention, Rehabilitation und Wiederverletzungsprophylaxe von Verletzungen im Fußball Biomechanische Aspekte 1 Problem Julia Bühlmeier, Benjamin Haar &
19 Fußball interdisziplinär: Zur Optimierung der Prävention, Rehabilitation und Wiederverletzungsprophylaxe von Verletzungen im Fußball Biomechanische Aspekte 1 Problem Julia Bühlmeier, Benjamin Haar &
Spezielle Messung der Beweglichkeit
 13 2 Spezielle Messung der Beweglichkeit Georg von Salis-Soglio 2.1 Wirbelsäule 15 2.1.1 Halswirbelsäule (HWS) 15 2.1.2 Brust- und Lendenwirbelsäule (BWS, LWS) 17 2.2 Obere Extremitäten 22 2.2.1 Schultergelenk/Schultergürtel
13 2 Spezielle Messung der Beweglichkeit Georg von Salis-Soglio 2.1 Wirbelsäule 15 2.1.1 Halswirbelsäule (HWS) 15 2.1.2 Brust- und Lendenwirbelsäule (BWS, LWS) 17 2.2 Obere Extremitäten 22 2.2.1 Schultergelenk/Schultergürtel
ABC-one Studie 2010 Regionale Fettverbrennung
 ABC-one Studie 2010 Regionale Fettverbrennung 1. Einleitung Ziel der Studie war, es die Wirkung der Geräte Slim Belly und Slim Back&Legs auf die regionale Fettverbrennung zu testen und die Effizienz der
ABC-one Studie 2010 Regionale Fettverbrennung 1. Einleitung Ziel der Studie war, es die Wirkung der Geräte Slim Belly und Slim Back&Legs auf die regionale Fettverbrennung zu testen und die Effizienz der
Wirtschaftsrechnen. Leseprobe
 Wirtschaftsrechnen Kapitel 1 Darstellung von Größen 1.1 Größen im Koordinatensystem 1.2 Diagramme und Ihre Verwendung 1.2.1 Säulendiagramm 1.2.2 Balkendiagramm 1.2.3 Punktdiagramm (Streudiagramm) 1.2.4
Wirtschaftsrechnen Kapitel 1 Darstellung von Größen 1.1 Größen im Koordinatensystem 1.2 Diagramme und Ihre Verwendung 1.2.1 Säulendiagramm 1.2.2 Balkendiagramm 1.2.3 Punktdiagramm (Streudiagramm) 1.2.4
Das Skelett des Menschen.Aufbau, Knochenformen und Knochenkrankheiten
 Naturwissenschaft Anja Burmester Das Skelett des Menschen.Aufbau, Knochenformen und Knochenkrankheiten Ein Überblick Referat / Aufsatz (Schule) Das Skelett Ich habe mir das Thema Skelett ausgesucht, weil
Naturwissenschaft Anja Burmester Das Skelett des Menschen.Aufbau, Knochenformen und Knochenkrankheiten Ein Überblick Referat / Aufsatz (Schule) Das Skelett Ich habe mir das Thema Skelett ausgesucht, weil
Tauchen mit Übergewicht (Adipositas)
 Tauchen mit Übergewicht (Adipositas) Dr. med. Bernd Winkler Universitätsklinikum Ulm Klinik für Anästhesiologie Sektion Notfallmedizin Adipositas - Einteilung 27.02.2012 Tauchen bei Adipositas 2 Adipositas
Tauchen mit Übergewicht (Adipositas) Dr. med. Bernd Winkler Universitätsklinikum Ulm Klinik für Anästhesiologie Sektion Notfallmedizin Adipositas - Einteilung 27.02.2012 Tauchen bei Adipositas 2 Adipositas
Biomechanik. Läuferspezifisch
 Biomechanik Läuferspezifisch Grundlagen der Biomechanik (Sportmechanik) Was ist Biomechanik / Sportmechanik? o Unter Biomechanik versteht man die Mechanik des menschlichen Körpers beim Sporttreiben. o
Biomechanik Läuferspezifisch Grundlagen der Biomechanik (Sportmechanik) Was ist Biomechanik / Sportmechanik? o Unter Biomechanik versteht man die Mechanik des menschlichen Körpers beim Sporttreiben. o
Endposition Beine gespreizt, Füße zusammen
 1 Dehnung Oberschenkel Vorderseite Bauchlage 1129 Ausgangsposition Bauchlage, Kniegelenk des zu dehnenden Beins gebeugt, seitengleiche Hand fixiert den Unterschenkel oberhalb Sprunggelenk, alternativ Schlaufe/Handtuch
1 Dehnung Oberschenkel Vorderseite Bauchlage 1129 Ausgangsposition Bauchlage, Kniegelenk des zu dehnenden Beins gebeugt, seitengleiche Hand fixiert den Unterschenkel oberhalb Sprunggelenk, alternativ Schlaufe/Handtuch
Chemical heat storage using Na-leach
 Hilfe2 Materials Science & Technology Chemical heat storage using Na-leach Robert Weber Empa, Material Science and Technology Building Technologies Laboratory CH 8600 Dübendorf Folie 1 Hilfe2 Diese Folie
Hilfe2 Materials Science & Technology Chemical heat storage using Na-leach Robert Weber Empa, Material Science and Technology Building Technologies Laboratory CH 8600 Dübendorf Folie 1 Hilfe2 Diese Folie
Statistics, Data Analysis, and Simulation SS 2015
 Mainz, May 12, 2015 Statistics, Data Analysis, and Simulation SS 2015 08.128.730 Statistik, Datenanalyse und Simulation Dr. Michael O. Distler Dr. Michael O. Distler
Mainz, May 12, 2015 Statistics, Data Analysis, and Simulation SS 2015 08.128.730 Statistik, Datenanalyse und Simulation Dr. Michael O. Distler Dr. Michael O. Distler
Navigation - Klinische Ergebnisse
 AE-Kurs Knie Ofterschwang Pleser M, Wörsdörfer O. Klinikum Fulda gag A. Gesamtergebnisse Fulda B. Navitrack TM -Multicenterstudie (Teilergebnisse Fulda) C. Ergebnisse: randomisierte Studie zum Einfluss
AE-Kurs Knie Ofterschwang Pleser M, Wörsdörfer O. Klinikum Fulda gag A. Gesamtergebnisse Fulda B. Navitrack TM -Multicenterstudie (Teilergebnisse Fulda) C. Ergebnisse: randomisierte Studie zum Einfluss
Ziele der Baclofenmedikation 20% Abb.1 Aufteilung der Zielsetzungen Copyright 2010 alkohol-und-baclofen-forum. Alle Rechte vorbehalten.
 Auswertung der Umfrage Wirkung der Baclofen-Medikation bei Alkoholabhängigkeit, Angst und Depressionen und in der Nikotinreduktion vom 24. Januar 2010 im Alkohol-und Baclofen-Forum Am 15.1.2010 heben wir
Auswertung der Umfrage Wirkung der Baclofen-Medikation bei Alkoholabhängigkeit, Angst und Depressionen und in der Nikotinreduktion vom 24. Januar 2010 im Alkohol-und Baclofen-Forum Am 15.1.2010 heben wir
3D Echtzeit Ganganalyse auf Laufband und Gehstrecke
 3D Echtzeit Ganganalyse auf Laufband und Gehstrecke zebris Medical GmbH Max-Eyth-Weg 43 88316 Isny im Allgäu zebris Medical GmbH Release 04/2006 Tel.: 07562 / 9726-0 Fax: 07562 / 9726-50 E-mail: zebris@zebris.de
3D Echtzeit Ganganalyse auf Laufband und Gehstrecke zebris Medical GmbH Max-Eyth-Weg 43 88316 Isny im Allgäu zebris Medical GmbH Release 04/2006 Tel.: 07562 / 9726-0 Fax: 07562 / 9726-50 E-mail: zebris@zebris.de
Valgisierung der Beinachse bei Läuferinnen
 ORIGINALIA Valgisierung der Beinachse bei Läuferinnen Krauss I 1, Grau S 1, Maiwald C 3, Janssen P 1, Mauch M 2, Horstmann T 1 Vermehrte Valgisierung der Beinachse bei gesunden Läuferinnen Increased lower
ORIGINALIA Valgisierung der Beinachse bei Läuferinnen Krauss I 1, Grau S 1, Maiwald C 3, Janssen P 1, Mauch M 2, Horstmann T 1 Vermehrte Valgisierung der Beinachse bei gesunden Läuferinnen Increased lower
Forschungszentrum Karlsruhe. FE-Analyse einer Patientinauflage
 Forschungszentrum Karlsruhe Technik und Umwelt Wissenschaftliche Berichte FZKA 6451 FE-Analyse einer Patientinauflage H. Fischer, A. Grünhagen Institut für Medizintechnik und Biophysik Arbeitsschwerpunkt
Forschungszentrum Karlsruhe Technik und Umwelt Wissenschaftliche Berichte FZKA 6451 FE-Analyse einer Patientinauflage H. Fischer, A. Grünhagen Institut für Medizintechnik und Biophysik Arbeitsschwerpunkt
Qun Wang (Autor) Coupled Hydro-Mechanical Analysis of the Geological Barrier Integrity Associated with CO2 Storage
 Qun Wang (Autor) Coupled Hydro-Mechanical Analysis of the Geological Barrier Integrity Associated with CO2 Storage https://cuvillier.de/de/shop/publications/7328 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin
Qun Wang (Autor) Coupled Hydro-Mechanical Analysis of the Geological Barrier Integrity Associated with CO2 Storage https://cuvillier.de/de/shop/publications/7328 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin
Sitzposition im Handbike: Auswirkung auf die Schulterbelastung und die Effizienz
 Sitzposition im Handbike: Auswirkung auf die Schulterbelastung und die Effizienz Ursina Arnet, MSc Stefan van Drongelen, PhD Swiss Paraplegic Research, Nottwil, Switzerland Luc van der Woude, PhD Center
Sitzposition im Handbike: Auswirkung auf die Schulterbelastung und die Effizienz Ursina Arnet, MSc Stefan van Drongelen, PhD Swiss Paraplegic Research, Nottwil, Switzerland Luc van der Woude, PhD Center
Proposal for Belt Anchorage Points
 Proposal for Belt Anchorage Points Heiko Johannsen Johannes Holtz Page 1 NPACS Belt Anchorage Points Positions acquired based on car measurements Front seats In most rear position Rear seats Upper Fwd
Proposal for Belt Anchorage Points Heiko Johannsen Johannes Holtz Page 1 NPACS Belt Anchorage Points Positions acquired based on car measurements Front seats In most rear position Rear seats Upper Fwd
2 Abbildungskonventionen und Schallkopfführung 19
 2 Abbildungskonventionen und Schallkopfführung 19 19 2 Abbildungskonventionen und Schallkopfführung Edda Klotz 2.1 Orientierung auf einem Ultraschallbild 20 2.2 Abbildungskonventionen 21 2.3 Schallkopfführung
2 Abbildungskonventionen und Schallkopfführung 19 19 2 Abbildungskonventionen und Schallkopfführung Edda Klotz 2.1 Orientierung auf einem Ultraschallbild 20 2.2 Abbildungskonventionen 21 2.3 Schallkopfführung
Betritt den virtuellen Showroom Enter the virtual showroom
 Genium Scan für App Scan for App Scan den QR-Code für die App Scan QR-Code for App Starte die App Start App Bewege das Handy/Tablet über das Bild auf der Vorderseite Move your mobile device over the picture
Genium Scan für App Scan for App Scan den QR-Code für die App Scan QR-Code for App Starte die App Start App Bewege das Handy/Tablet über das Bild auf der Vorderseite Move your mobile device over the picture
Europäisches Patentamt 1 1 1 1 European Patent Office Office europeen des brevets (11) EP 0 943 581 A2
 (19) (12) Europäisches Patentamt 1 1 1 1 European Patent Office Office europeen des brevets (11) EP 0 943 581 A2 EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG (43) Veröffentlichungstag: igstag: (51) int. Cl.6: B66F 3/00
(19) (12) Europäisches Patentamt 1 1 1 1 European Patent Office Office europeen des brevets (11) EP 0 943 581 A2 EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG (43) Veröffentlichungstag: igstag: (51) int. Cl.6: B66F 3/00
Verbesserung des Tuberkulose-Screenings bei Patienten mit rheumatischen Erkrankungen vor Beginn einer Therapie mit TNFα-Blockern
 Rheumatologie / Klinische Immunologie Prof. Dr. H.P. Tony (Leiter des Schwerpunktes) Prof. Dr. med. Ch. Kneitz Medizinische Poliklinik Klinikstr. 6-8 97070 Würzburg Abstract: 1 / 10 Verbesserung des Tuberkulose-Screenings
Rheumatologie / Klinische Immunologie Prof. Dr. H.P. Tony (Leiter des Schwerpunktes) Prof. Dr. med. Ch. Kneitz Medizinische Poliklinik Klinikstr. 6-8 97070 Würzburg Abstract: 1 / 10 Verbesserung des Tuberkulose-Screenings
Inhalt. 1 Einleitung... 1 Ralf Stüvermann. 2 Hubfreie/hubarme Mobilisation der Wirbelsäule... 7 Irene Spirgi-Gantert VII
 VII Inhalt 1 Einleitung..................... 1 Ralf Stüvermann 1.1 Bewegung und Belastung................. 2 1.2 Die Funktionelle Bewegungslehre........... 2 1.2.1 Die drei Behandlungstechniken der Funktionellen
VII Inhalt 1 Einleitung..................... 1 Ralf Stüvermann 1.1 Bewegung und Belastung................. 2 1.2 Die Funktionelle Bewegungslehre........... 2 1.2.1 Die drei Behandlungstechniken der Funktionellen
Orthetische Versorgung der oberen Extremität bei neuromuskulären Erkrankungen Technische Orthopädie Lübeck Jens Becker GmbH
 Orthetische Versorgung der oberen Extremität bei neuromuskulären Erkrankungen Spastische Lähmungen Formen: Unilateral Bilateral Differenzierte Betrachtung unter Berücksichtigung der Funktionskontrolle
Orthetische Versorgung der oberen Extremität bei neuromuskulären Erkrankungen Spastische Lähmungen Formen: Unilateral Bilateral Differenzierte Betrachtung unter Berücksichtigung der Funktionskontrolle
Injektionsregionen. von André Gutbrod
 Injektionsregionen von André Gutbrod Orthopädische Gemeinschaftspraxis Dr. med. Suham M. Abid - Dr. med. André K. Gutbrod - Dr. med. Frank J. Siegler Fachärzte für Orthopädie Tagesklinik für Schmerztherapie
Injektionsregionen von André Gutbrod Orthopädische Gemeinschaftspraxis Dr. med. Suham M. Abid - Dr. med. André K. Gutbrod - Dr. med. Frank J. Siegler Fachärzte für Orthopädie Tagesklinik für Schmerztherapie
Dynamic Hybrid Simulation
 Dynamic Hybrid Simulation Comparison of different approaches in HEV-modeling GT-SUITE Conference 12. September 2012, Frankfurt/Main Institut für Verbrennungsmotoren und Kraftfahrwesen Universität Stuttgart
Dynamic Hybrid Simulation Comparison of different approaches in HEV-modeling GT-SUITE Conference 12. September 2012, Frankfurt/Main Institut für Verbrennungsmotoren und Kraftfahrwesen Universität Stuttgart
Determining Vibro-Acoustic Effects in Multidomain Systems using a Custom Simscape Gear Library
 Determining Vibro-Acoustic Effects in Multidomain Systems using a Custom Simscape Gear Library Tim Dackermann, Rolando Dölling Robert Bosch GmbH Lars Hedrich Goethe-University Ffm 1 Power Noise transmission
Determining Vibro-Acoustic Effects in Multidomain Systems using a Custom Simscape Gear Library Tim Dackermann, Rolando Dölling Robert Bosch GmbH Lars Hedrich Goethe-University Ffm 1 Power Noise transmission
Physikprotokoll: Fehlerrechnung. Martin Henning / Torben Zech / Abdurrahman Namdar / Juni 2006
 Physikprotokoll: Fehlerrechnung Martin Henning / 736150 Torben Zech / 7388450 Abdurrahman Namdar / 739068 1. Juni 2006 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 2 Vorbereitungen 3 3 Messungen und Auswertungen
Physikprotokoll: Fehlerrechnung Martin Henning / 736150 Torben Zech / 7388450 Abdurrahman Namdar / 739068 1. Juni 2006 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 2 Vorbereitungen 3 3 Messungen und Auswertungen
Orthopädischer Untersuchungskurs (Praktikum) Obere Extremität. Dr. med. O. Steimer, Dr. med. M.Kusma. Orthopädische Universitäts- und Poliklinik
 Orthopädischer Untersuchungskurs (Praktikum) Obere Extremität Dr. med. O. Steimer, Dr. med. M.Kusma Orthopädische Universitäts- und Poliklinik Direktor Prof. Dr. med. D. Kohn Schulter - Anatomie Schulter
Orthopädischer Untersuchungskurs (Praktikum) Obere Extremität Dr. med. O. Steimer, Dr. med. M.Kusma Orthopädische Universitäts- und Poliklinik Direktor Prof. Dr. med. D. Kohn Schulter - Anatomie Schulter
SCALE: Selective Control Assessment of the Lower Extremity Untersuchung der selektiven Kontrolle der unteren Extremität SCALE Auswertungsformular
 SCALE: Selective Control Assessment of the Lower Extremity Untersuchung der selektiven Kontrolle der unteren Extremität SCALE Auswertungsformular Datum: ID: Alter: GMFCS Level: Diagnose: Spastische Diplegie
SCALE: Selective Control Assessment of the Lower Extremity Untersuchung der selektiven Kontrolle der unteren Extremität SCALE Auswertungsformular Datum: ID: Alter: GMFCS Level: Diagnose: Spastische Diplegie
Untersuchung zur Kratz- und Auflagenbeständigkeit von direkt bebilderten Druckplatten beim Offsetdruck
 Untersuchung zur Kratz- und Auflagenbeständigkeit von direkt bebilderten Druckplatten beim Offsetdruck Kapitelnummer Stichwort 3.3.2 (Langfassung) Druckmessung beim Tragen von Druckplattenpaketen Aufbau
Untersuchung zur Kratz- und Auflagenbeständigkeit von direkt bebilderten Druckplatten beim Offsetdruck Kapitelnummer Stichwort 3.3.2 (Langfassung) Druckmessung beim Tragen von Druckplattenpaketen Aufbau
Scenario Building Workshop - Interplay of problem framings
 Transdiciplinary Conference Inter- and Transdisciplinary Problem Framing, ETH Zürich, 27-28 November 2008 Scenario Building Workshop - Interplay of problem framings PD Dr. Rolf Meyer*, Dr. Martin Knapp*,
Transdiciplinary Conference Inter- and Transdisciplinary Problem Framing, ETH Zürich, 27-28 November 2008 Scenario Building Workshop - Interplay of problem framings PD Dr. Rolf Meyer*, Dr. Martin Knapp*,
