Ende des 19. Jahrhunderts: Große Fortschritte in der analytischen Chemie und damit nicht zuletzt auch in der LM- bzw. Weinanalytik
|
|
|
- Lena Hartmann
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Weinanalytik Reduzierende Zucker Schweflige Säure (SO 2 ) Chromatographie (GC, HPLC) Historie: Wein und Fälschung ( Weinpanscherei ) Wein war früher nicht allzu lange haltbar -> Verlängerung der Haltbarkeit durch Zusätze, von denen manche sich als giftig erwiesen Weinfälschungen waren - trotz Androhung drakonischer Strafen- aufgrund fehlender Kontrollmöglichkeiten an der Tagesordnung (s.u.) Du sollst den Wein Deines Nachbarn nicht verzaubern (Phönizier, ca v.chr. ) Durch so viele giftige Zusätze wird der Wein gezwungen zu munden, und wir wundern uns dann, daß er schädlich ist (Plinius d.ä., ca. 70 n.chr.) 1120, Soester Stadtrecht: Wer faulen Wein mit gutem Wein mischt, der hat, wenn er überführt wird, sein Leben verwirkt 1532: Halsgerichtsordung (Kaiser Karl V): Hohe Strafen für Lebensmittelfälscher 1700: Württemberg: Verbot der Verwendung von Bleizusätzen in Wein unter Androhung der Todesstrafe 1985: Österreich, Deutschland: Diethylenglycol in Wein Historische Entwicklung der Weinanalytik am Beispiel Blei in Wein Bleiacetat: Konservierungsmittel und Geschmacksverbesserer (süß-schmeckend). Verwendung seit der Römerzeit Folgen: schleichende Vergiftung, Koliken, Schädigung des ZNS Appelle, Gesetze und Androhung von Strafen erwiesen sich aufgrund der fehlenden Nachweismöglichkeiten als wirkungslos Bereits vor Jahrhunderten: Einfache Tests (Farbreaktionen): Pb 2+ +H 2 S PbS (schwarz) + 2 H + Ende des 19. Jahrhunderts: Große Fortschritte in der analytischen Chemie und damit nicht zuletzt auch in der LM- bzw. Weinanalytik Entwicklung der Lebensmittel- / Weinanalytik: primär zum Schutz vor Gesundheitsschäden / Tod ausserdem: Schutz vor Irreführung und Täuschung später: auch zur Rohstoff-/Produktionskontrolle (Hersteller) Weinanalytik: Von der Traube bis zum Wein Traubenreife, Ernte Traubenannahme Weinherstellung (Fermentation) BSA, Reifung (Weinkeller) Abfüllung Weinberg Trauben Most Fermentation Jungwein Wein Bestimmung der wichtigsten Parameter zur Ermittlung des optimalen Erntezeitpunkts Beurteilung des Reifegrades und des Gesundheitszustandes der Trauben Kontinuierliche Überwachung der Weinherstellung während des gesamten Prozesses -> fundierte Datengrundlage um ggf. in den Prozess eingreifen zu können (Korrekturmaßnahmen) Unterstützung zum Erreichen der Qualitätsziele Bestätigung subjektiver Beobachtungen durch objektive Messwerte Sicherstellen, daß der Wein den auf dem Etikett angegebenen Spezifikationen entspricht
2 Anforderungen an ein ideales Analysenverfahren Schnelligkeit (kurze Analysendauer; hoher Probendurchsatz) Serielle vs parallele Analyse (Bsp: HPLC, GC <-> DC) Simultane Analyse mehrerer unterschiedlicher Inhaltsstoffe/ Parameter Robust Gute Reproduzierbarkeit der Ergebnisse Hohe Nachweisempfindlichkeit (niedrige Nachweisgrenze) Praxistauglichkeit Vor-Ort-Analytik (Weinberg), Betriebskontrolle (Weinkeller), LM-Überwachung? Minimale Probenvorbereitung Geringe Investitionskosten Niedrige Verbrauchs- und Unterhaltskosten Einfache Bedienung, kein speziell geschultes Personal nötig Automatisierbar Umweltschonend (kein Anfall toxischer Chemikalien) In der Praxis erfüllt kein einzelnes Analysenverfahren all diese Forderungen -> entscheidend ist letztlich die Fragestellung (z.b. nur orientierende Werte) -> in der Praxis: Oft nur so genau wie nötig, nicht so genau wie möglich! Die wesentlichen Inhaltsstoffe des Weins Hauptbestandteile: Wasser (Ethanol) Zucker Glycerol nichtflüchtige Säuren Mineralstoffe (Asche) N-haltige Verbindungen Minorbestandteile Methanol, höhere Alkohole Aldehyde, Ketone Aromastoffe flüchtige Säuren Gerbstoffe (Polyphenole) Farbstoffe Schwefeldioxid Entnahme, Vorbereitung und Lagerung der Proben Durchschnittsprobe (auf gute Durchmischung achten). Bei Flaschengärung: gewissse Heterogenität der chemischen Zusammensetzung Sofern keine Originalflaschen verfügbar: Neutrales Probengefäss bzw. neutraler Probenschlauch (geruchs- und geschmackfrei!) frische Probe (-> erst kurz vor der Untersuchung ziehen) volles Probengefäss (zur Verhinderung von Oxidationen) exakte Beschriftung (z.b. Herkunft, Rebsorte, Jahrgang etc.) Lagerung: am besten bei ca. 10 C (nicht im Kühlschrank!) - bei zu kalter Lagerung: Ausfall von Weinstein - bei zu warmer Lagerung: Aktivität von Mikroorganismen zunächst organoleptische Untersuchung durchführen (Sensorik) dann ggf. mikroskopische Untersuchung anschliessend chemische Analysen Empfehlungen zur Weinanalytik (SLMB) Übliche Untersuchung Sinnenprüfung (Degustation) Mikroskopische Untersuchung Dichtebestimmung bestimmung Bestimmung des Extrakts/TM Bestimmung der reduzierenden Zucker Bestimmung der titrierbaren Säuren Bestimmung der flüchtigen Säuren ph-wert Bestimmung Bestimmung der schwefligen Säure Aschebestimmung Zusätzlich bei Verdacht auf Verfälschungen/Täuschungen, Fehler, Rückstände, Verunreinigungen Zusatz von - Wasser - Farbstoffen - Alkohol - Glycerol - Diethylenglycol übermässige Zuckerung Verwendung unzulässiger Hilfsstoffe Zusatz von Konservierungsmitteln Zu hoher Gehalt an Fe, Cu, SO 2-4,Cl - Anwesenheit biogener Amine
3 Aktuelle Weinanalytik Kleinbetriebe Klassische, meist nass-chemische Analysenverfahren, z.b. ph-wert, Oechsle des Mostes, Gesamtsäure, freie schweflige Säure, Alkohol etc. Größere Kellereien, Genossenschaften, Handelsketten Automatisierte spektroskopische (NIR, FTIR) und enzymatische Verfahren Schnelle und praxistaugliche Methoden zur Produktionskontrolle von der Rohware (Traube) bis hin zum fertigen Wein Spezialisierte Laboratorien Erweiterung der Analytik auf zusätzliche Parameter, z.b. Schwermetalle, Mykotoxine, Pflanzenschutzmittel und andere Kontaminantien, Verfälschungen; Aromastoffanalytik Weinanalytik in Kleinbetrieben Bestimmung des Mostgewichtes (rel. Dichte) Bestimmung der Gesamtsäure Bestimmung der freien schwefligen Säure Sensorische Beurteilung von Most und Wein Mostuntersuchung - Mostgewicht, Gesamtsäure, Sensorik Gärkontrolle - Mostgewicht, Sensorik Jungweinanalytik - Bedarf an freier schwefliger Säure - Bedarf an Behandlungs- und Schönungsmitteln - Sensorik Weinanalytik - Alkohol, Sensorik Weinanalytik Reduzierende Zucker Schweflige Säure (SO 2 ) Chromatographie Dichte 20 C, relative Dichte 20 C/20 C, Mostgewicht ( Oechsle) Dichte (20 C) = Masse des Körpers Volumen des Körpers bei 20 C Beispiel: Dichte (20 C) von Wasser = 0,998 g/cm 3 Relative Dichte (20 C/20 C) = Dichte (20 C) des Getränks Dichte (20 C) von Wasser Als Verhältniszahl ist D 20/20 eine dimensionslose Größe Unvergorener Most: > 1,0. Wein: eventuell < 1,0 (Alhohol!)
4 Mostgewicht in Oechslegraden ( Oe) Die relative Dichte von Traubenmosten wird bevorzugt als Mostgewicht in Oechslegraden ( Oe) angegeben (Bezugstemperatur: 20 C; Rundung auf zwei Dezimalen) Mostgewicht, in Oe = (D 20/20-1) x 1000 Bei den Oechslegraden handelt es sich also um eine Abkürzung des Werts der Dichte des Mosts. Bei einer Dichte des Mosts von z.b beträgt das Mostgewicht 80 Oe, bei einer Dichte von entsprechend 107 Oe (jeweils auf zwei Dezimalen gerundete Werte) Ausschlaggebend ist v.a der Gehalt an Zucker: Je mehr Zucker im Most enthalten ten ist, desto größer ist das Mostgewicht. Aber auch Säure erhöht das Mostgewicht Typische Traubenmoste besitzen Mostgewichte von Oe, Auslese-Moste von Oe, und Trockenbeerenauslesen bis zu 250 Oe. Ungefähre Zusammensetzung von Traubenmost: Wasser 75-85% Zucker 12-25% (Glucose und Fructose) Säuren % (Wein-, Äpfel-, Bernsteinsäure) N-Verbindungen % Mineralstoffe 0.3% Die Verwendung der Oechslegrade bietet eine Reihe von Vorteilen: Da die Dichte des Mostes vor allem vom Zucker bestimmt wird, kann man mit Hilfe des Mostgewichts den Zuckergehalt im Most nach folgender Gleichung abschätzen: Zuckergehalt (%) = 1 / 4 M( Oe)-3 Beispiel: Ein Most der Dichte g/ml (= 100 Oe) enthält [( 1 / 4 x100)-3]=(25-3) = 22 % Zucker (= 22 g/100 ml) Für den zu erwartenden Alkoholgehalt gilt die besonders einfache Beziehung Alkoholgehalt (g/l Wein) = M ( Oe) Diese Beziehung ergibt sich aus der Stöchiometrie der Gärungsreaktion, da die Masse des Alkohols knapp der Hälfte der Masse des vergorenen Zuckers entspricht Ein Most mit 100 Oe ergibt also einen Wein, der 100 g Alkohol/Liter enthält. Unter Berücksichtigung der Dichte des Alkohols (0.790 g/ml) ergibt sich folglich ein Alkohol-Gehalt von ca Vol % Es handelt sich hierbei nur um Schätzwerte, die jedoch ausreichend genau sind, damit der Winzer die Qualität seines Weins sowie den Zeitpunkt der Weinlese bestimmen kann. Bestimmung der relativen Dichte und des Mostgewichts Zur Bestimmung der relativen Dichte bzw. des Mostgewichtes werden folgende Geräte bzw. Verfahren eingesetzt: Pyknometer Biegeschwinger Aräometer (Spindel) Refraktometer (zur Mostgewichtsbestimmung) - Referenzmethode ist das pyknometrische Verfahren; jedoch sehr zeitaufwändig - Die Biegeschwingermethode ist sehr präzise, rasch und einfach durchzuführen, erfordert aber eine kostspielige Messapparatur - Aräometer sind weniger genau, die Messung ist jedoch sehr einfach und schnell durchzuführen. Ähnliches gilt für Refraktometer. Bestimmung des Gewichtsverhältnisses 20 C/20 C mit dem Pyknometer (Referenzmethode) Prinzip: Die Bestimmung erfolgt durch Wägung eines genau bekannten Volumens der zu untersuchenden Flüssigkeit sowie des gleichen Volumens Wasser bei 20 C. Probenvorbereitung: Kohlensäurehaltige Getränke durch kräftiges Schütteln entgasen, trübe Getränke durch ein Faltenfilter filtrieren Masse des leeren, sauberen, zuvor bei 103 C getrockneten Pyknometers auf der Analysenwaage auf 4 Dezimalen genau bestimmen = Leerwert Bestimmung des Wasserwerts : Pyknometer mit frisch abgekochtem destilliertem Wasser füllen, 30 min bei 20.0 C thermostatisieren, genau auf die Marke einstellen, abtrocknen und wiegen. Masse des mit Wasser gefüllten Pyknometers - Leerwert = Wasserwert Bestimmung des Flüssigkeitwerts : Prinzipiell wie Wasserwert- Bestimmung, nur dass anstelle des Wassers die zu untersuchende Flüssigkeit verwendet wird. Gewichtsverhältnis 20 C/20 C = Flüssigkeitswert / Wasserwert
5 Bestimmung des relativen Dichte mit dem Biegeschwinger Prinzip: Die zu untersuchende Lösung wird in ein an den offenen Enden eingespanntes U-Rohr eingefüllt, welches -auf elektronischem Weg angeregt- mit seiner Eigenfrequenz schwingt. Aus der gemessenen Schwingungsdauer kann D 20/20 berechnet werden. Probenvorbereitung: Suspendierte Teilchen sowie gelöste Kohlensäure können die Messung verfälschen. Getränk gegebenenfalls filtrieren bzw. entgasen Luftwert ermitteln: Schwingungsdauer des mit Luft gefüllten, trockenen Messrohres bei 20 C bestimmen Wasserwert ermitteln: Schwingungsdauer des mit CO 2 - freiem, bidest. H 2 O gefüllten Messrohres bei 20 C bestimmen Messung: Messrohr mit der vorbehandelten Probenlösung spülen und anschliessend füllen. Schwingungsdauer bei 20 C bestimmen Relative Dichte berechnen bzw. direkt am Gerät ablesen Bestimmung des relativen Dichte mit dem Aräometer Prinzip: Ein Aräometer (Senkspindel) ist ein durch Bleischrot beschwerter zylindrischer Glaskörper mit einem verjüngten zylindrischen Stängel und darin enthaltener Skala. Nach Einbringen in die zu untersuchende Flüssigkeit taucht das Aräometer soweit ein, bis das Gewicht der verdrängten Flüssigkeit dem Gewicht des Aräometers entspricht. Je geringer die Dichte der Flüssigkeit, desto tiefer taucht das Aräometer ein. Probenvorbereitung: Feststoffanteile sowie gelöste Kohlensäure durch kräftiges Schütteln bzw. Filtration entfernen. Lösung auf 20 C temperieren. Messung: Einen sauberen, passenden Standzylinder mit der vorbehandelten Untersuchungslösung bis zum Rand füllen Aräometer langsam eintauchen und loslassen, sobald es schwimmt; eventuell anhaftende Gasblasen entfernen Nach 1-2 min Messwert sowie Temperatur ablesen Mögliche Messfehler: Temperatur (falls < 20 C -> zu hoher Messwert) Gärung -> zu niedriger Wert (Alkohol!) CO 2, Luft: bewirken Auftrieb -> zu hoher Wert Bestimmung des Mostgewichtes mit dem Refraktometer Refraktometer sind Messgeräte, mit denen die optische Brechzahl n eines Stoffes bestimmt wird Die Abhängigkeit der Brechzahl von der Konzentration gelöster Substanzen wird bei unvergorenen Getränken zur einfachen Ermittlung des Mostgewichts bzw. Extraktgehalts herangezogen Häufig bestimmt man nicht die Brechzahl selbst, sondern anhand entsprechender Mess-Skalen Oechsle oder Brix (= Massenanteil Saccharose) Die Brechzahl hängt weiterhin von der Temperatur und der Wellenlänge des Lichts ab. Normalerweise wird bei 20 C und der Natrium-D-Linie (589 nm) gemessen Die Messungen können entweder mit Präzisionsrefraktometern vom Abbé-Typ oder, bei leicht verminderter Genauigkeit, mit Hand-Refraktometern vorgenommen werden Handrefraktometer eignen sich besonders gut zur Ermittlung des Mostgewichtes bzw. der Oechsle- Grade -> weit verbreiteter Einsatz bei Winzern Moderne Geräte weisen meist mehrere Skalen auf: - % Massengehalt (= Brix) - Oechsle-Skala - KMW-Skala (Kloster Neuburger Mostwaage) Messung mit dem Handrefraktometer 2-3 Tropfen des zu untersuchenden Mostes auf das Prisma aufbringen und Deckel schliessen Prisma gegen eine Lichtquelle halten und durch das Okular das Mostgewicht (Oechsle) ablesen (Grenzlinie hell/dunkel). Bei einer von 20 C abweichenden Temperatur -> Korrektur vornehmen Messgenauigkeit: ca. ± 1 Oechsle Wichtig: regelmässige Kontrolle der Null-Linie. Dest. Wasser hat eine Brechzahl von bzw. den Massengehalt 0%. Mit Flüssigkeiten bekannter Brechzahl kann das Gerät überprüft bzw. kalibriert werden
6 Anmerkungen zu (Hand)-Refraktometern Die Bezugstemperatur beträgt 20.0 C. Für exakte Bestimmungen müssen sowohl das Refraktometer als auch die Probelösung diese Temperatur aufweisen Andernfalls muss eine Temperaturkorrektur vorgenommen werden. Moderne Refraktometer besitzen eine elektronische Temperaturkorrektur Umrechnungstabellen für verschiedene Skalen ( Oe, Brix etc): siehe z.b. Die zu untersuchende Lösung sollte möglichst klar sein -> Stark trübe Proben zentrifugieren oder filtrieren Bei Traubenreife-Bestimmungen: Beeren von verschiedenen Weinstöcken für die Herstellung des Presssaftes verwenden (Durchschnittsprobe!) Messfehler Falsche Temperatur (< 20 C -> zu hoher Messwert) Gärung -> zu niedriger Messwert Weinanalytik Reduzierende Zucker Schweflige Säure (SO 2 ) Chromatographie Bestimmung des Extrakts (Trockensubstanz) Unter Extrakt versteht man die Gesamtheit der in Most oder Wein gelösten Substanzen, die sich beim Entfernen des wässrig-alkoholischen Anteils nicht verflüchtigen (d.h. v.a. Zucker sowie nichtflüchtige Säuren, Glycerol, N-Verbindungen etc.; Angabe in g/l) Der Extraktgehalt kann auf unterschiedliche Art bestimmt werden, z.b.: Direkte Bestimmung durch Abdampfen des wässrig-alkoholischen Anteils des Weins und Wägung des Rückstands (Referenzmethode) Indirekte Bestimmung durch Messung der relativen Dichte in der alkoholfreien Probe bzw. im mit Wasser auf das ursprüngliche Volumen ergänzten Destillationsrückstand Indirekte Bestimmung durch Refraktionsmessung in alkoholfreien Getränken und Ermittlung des Gehaltes anhand entsprechender Mess-Skalen oder Tabellen Die direkte Methode ist umständlich und zeitintensiv und wird daher in der Praxis nur selten durchgeführt. Meist wird die indirekte Bestimmung über die Dichte oder die Refraktionsmessung eingesetzt Der Extraktgehalt deutscher Weissweine beträgt g/l; bei Rotwein liegt er etwas höher, bei ausländischen Süssweinen zwischen 30 und 40 g/l Zur Qualitätsbeurteilung ist der zuckerfreie Extrakt von grösserer Bedeutung, da der Zuckergehalt leicht manipulierbar ist Zuckerfreier Extrakt = (Gesamtextrakt g/l - Gesamtzucker g/l + 1,0) Bestimmung des Extrakts durch Messung der Dichte Prinzip: Der Extrakt wird aus der Dichte des Getränks ermittelt. Vorhandener Alkohol muss durch Destillation zuvor entfernt und das Getränk anschliessend mit dest. Wasser auf sein ursprüngliches Volumen aufgefüllt werden Durchführung Enthält das Getränk < 0,7% vol Alkohol, so kann die Dichte direkt bestimmt und der Extraktgehalt aus einer Tabelle entnommen werden Bei höherem Alkoholgehalt: ml des Getränks in eine Alkohol-Destillationsapparatur überführen und destillieren (Überhitzung vermeiden!) Nach dem Abkühlen den Destillationsrückstand unter dreimaligem Nachspülen in einen 100 ml Messkolben überführen, bis zur Marke auffüllen und die Dichte mittels Pyknometer oder Biegeschwinger bestimmen
7 Weinanalytik (Reduzierende) Zucker Schweflige Säure (SO 2 ) Chromatographie Nachweis und Bestimmung der Zucker Die in Most und Wein hauptsächlich vorkommenden Zucker sind die Fructose und Glucose. Beide liegen in etwa gleichen Mengen vor, in vollständig vergorenen Weinen allerdings nur noch in geringer Konzentration (<< 0.5%) Daneben kommen in Wein noch Pentosen (z.b. Arabinose) in Mengen < 1 g/l vor Nachweis der einzelnen Zuckerarten: meist mittels DC Die Bestimmung der reduzierenden Zucker beruht auf der Eigenschaft der Glucose und Fructose, Cu 2+ -Verbindungen (blaue Farbe) in der Hitze zu Cu + (braune Farbe) zu reduzieren Entsprechend dem Gehalt an reduzierenden Zuckern fällt Cu 2 O aus. Die überschüssigen Cu 2+ -Ionen werden iodometrisch erfasst, und aus dem Verbrauch an Titrationslösung kann der Zuckergehalt des Getränks berechnet werden Saccharose als nicht-reduzierenden Zucker muss vor der Bestimmung hydrolytisch gespalten werden ( Inversion ) Alternative Zuckerbestimmungsverfahren: enzymatisch oder mittels HPLC Dünnschichtchromatographischer Nachweis der Zuckerarten Prinzip Nach Klärung des Getränks (z.b. mit Bleiacetat- Lösung) werden die wichtigsten Zuckerarten dünnschichtchromatographisch auf Kieselgel- Platten getrennt (Fliessmittel: Acetonitril-Wasser ) und mit einem Diphenylamin enthaltenden Nachweisreagenz sichtbar gemacht Vergleichslösungen: Glucose, Fructose, Saccharose etc. Auftragevolumina: Trockerer Wein ca. 5 l; süsser Wein (10-fach verdünnt): 1 l DC-Platten nach dem Entwickeln trocknen (Fön), mit Nachweisreagenz besprühen und auf 120 C erwärmen (Trockenschrank) -> rotblau-violette Flecken Zuckerart Farbe Rf-Wert Fructose ziegelrot 0,28 Glucose graublau 0.25 Saccharose braunviolett 0,16 Bestimmung der reduzierenden Zucker nach Luff-Schoorl Prinzip Reduzierende Zucker in Most oder Wein werden nach Klärung mit Carrez- Lösung mit Luff scher Lösung (Cu 2+ -Ionen im alkalischen Milieu) im Überschuss in der Siedehitze umgesetzt. Die reduzierenden Zucker reagieren mit den Cu 2+ -Ionen und werden dabei oxidiert, während Cu 2+ zu Cu + reduziert wird: 2Cu 2+ Cu 2 O Iodometrische Bestimmung des Überschusses an Cu 2+ -Ionen: Ansäuern und Zugabe von Kalium-Iodid -> Reduktion der überschüssigen Cu 2+ -Ionen zu schwerlöslichem Kupferiodid, bei gleichzeitiger Oxidation von Iodid zu Iod: 2Cu 2+ +4I - 2CuI 2 2CuI +I 2 Titration des entstandenen Iods mit einer Natriumthiosulfat-Maßlösung mit Stärke als Indikator bis zum Verschwinden der blauen Farbe: I 2 +2S 2 O 3 2-2I - +S 4 O 6 2- Anmerkung: Die Reaktion der Cu-Ionen mit den Zuckern verläuft nicht streng stöchiometrisch. Nach Berücksichtigung eines Reagenzien-Leerwertes kann jedoch anhand einer empirisch erstellten Tabelle die der verbrauchten Titrationslösung entsprechende Zuckermenge berechnet werden.
8 Bestimmung der reduzierenden Zucker nach Rebelein Prinzip: Die reduzierenden Zucker werden mit alkalischer Kupfersulfat-Lösung oxidiert, wobei das zweiwertige Kupfer zum einwertigen Kupfer reduziert wird. Nach Zusatz von Kaliumiodid entsteht eine dem nicht verbrauchten Kupfersulfat äquivalente Menge Iod, welches mit Natriumthiosulfat-Maßlösung zurücktitriert werden kann (vgl. Methode Luff-Schoorl). Die Bestimmung eventuell enthaltener Saccharose erfolgt nach Inversion durch Kochen mit verdünnter Schwefelsäure. Vorteile Aufgrund angepasster Konzentrationsund Erhitzungsbedingungen verläuft die Reaktion stöchiometrisch. Sie ist von der Erhitzungsdauer unabhängig und ist dem Zuckergehalt linear proportional! Schnelle und preisgünstige Methode, mit welcher nach kurzer Einarbeitungszeit reproduzierbare und hinreichend genaue Ergebnisse erhalten werden Reagenzien als Fertiglösungen im Fachhandel erhältlich -> ideal für kleine Laboratorien und Serienanalysen Enzymatische Zuckerbestimmung UV-spektrometrische Tests zur Bestimmung von Glucose, Fructose und Saccharose Vorteile: hochspezifisch; Erfassung einzelner Zuckerarten in Gemischen Nachteil: ungeeignet für Vor-Ort-Analytik Prinzip: D-Glucose + ATP HK Glucose-6-phosphat + ADP Glucose-6-phosphat + NADP + G6P-DH D-Gluconat-6-phosphat + NADPH + H + Die gebildete NADPH-Menge ist der Glucosekonzentration proportional DaNADPH im UV-Spektrum gegenüber NADP + eine zusätzliche Absorptionsbande mit einem Maximum bei 340 nm aufweist, kann aus deren Zunahme der Glucosegehalt berechnet werden Der Saccharosegehalt ergibt sich aus der Differenz der Glucosemessungen vor und nach enzymatischer Hydrolyse (Invertase) Fructose wird ebenfalls durch Hexokinase phosphoryliert; das entstehende Fructose-6-phosphat wird durch Phosphoglucoisomerase (PGI) in Glucose-6-phosphat umgewandelt und analog bestimmt Weinanalytik Reduzierende Zucker Schweflige Säure (SO 2 ) Chromatographie Alkoholbestimmung Der Ethanolgehalt des Weins kann je nach Herkunft, Jahrgang und Sorte sehr stark variieren ( g/l); bei Gehalten > 144 g/l kann man davon ausgehen, dass Ethanol zugesetzt wurde. Bestimmungsmethoden: aus der Dichte des Destillates (mittels Pyknometer, Aräometer oder Biegeschwinger) titrimetrisch (Oxidation des im Destillat enthaltenen Ethanols) enzymatisch gaschromatographisch (GC) Weitere Alkohole entstehen als Gärungsnebenprodukte und sollten nur in geringen Mengen im Wein vorkommen: Methanol: aus Pektinen; Gehalt mg/l Bestimmung: mittels GC Glycerol; Aus den Zuckern der Traube; Gehalt 6-10 g/l; verleiht dem Wein einen abgerundeten Geschmack; daher manchmal (unerlaubterweise) dem Wein zugesetzt Bestimmung: meist enzymatisch 2,3-Butandiol (aus Diacetyl); mg/l Bestimmung: mittels GC Höhere Alkohole: Propanol, Butanol, Amylalkohol (Fuselöl) dürfen nur in geringen Mengen vorkommen (< 150 mg/l) Bestimmung: mittels GC
9 Ethanolbestimmung nach Destillation (I) Prinzip: Bestimmung der Dichte eines extraktfreien, auf das Ausgangsvolumen verdünnten Destillats, wobei der Einfluss vorhandener Begleitstoffe (Methanol, höhere Alkohole, Ester) vernachlässigt werden kann. Für genaue Bestimmungen erfolgt die Dichtemessung pyknometrisch (Referenzmethode) oder mit dem Biegeschwinger; für Routinemessungen genügt ein Aräometer. Der entsprechende Alkoholgehalt wird einer Tabelle entnommen. Durchführung ml des Weins in einen Destillierkolben überführen und mit 1N NaOH neutralisieren Siedesteinchen und Anti-Schaummittel zusetzen und den Kolben gasdicht an die Apparatur anschliessen Vorlage (Messkolben) in Eis/Wasser-Gemisch stellen langsam (!) unter guter Kühlung (!) ca. 80 ml in den 100 ml Messkolben überdestillieren Messkolben mit dest. Wasser bis knapp unter die Marke auffüllen und Kolbeninhalt gut mischen Kolbeninhalt auf 20.0 C temperieren, mit dest. Wasser auffüllen und Diche des rückverdünnten Destillats mit dem Pyknometer bestimmen gehalt aus Tabelle ablesen Alkoholbestimmung mit dem Aräometer nach Destillation (II) Prinzip: Bestimmung der Volumenprozente des in einen Messkolben überdestillierten Alkohols mittels Aräometer ( Alkoholometer ) Durchführung Destillation ml des auf 20 C temperierten Weins in einen Destillationskolben überführen, mit 10 ml Kalkmilch (120 g CaO/L) neutralisieren, Siedesteinchen und Silikonentschäumer zusetzen Vorlage: 250 ml Messkolben (welcher 10 ml Wasser enthält) langsam ca. 200 ml überdestillieren, umschütteln und bis kurz unter die Marke mit destillertem Wasser auffüllen Messkolben mit Destillat auf 20 C temperieren und genau auf die Marke auffüllen Messung der Alkoholkonzentration Destillat in einen Standzylinder füllen und Aräometer einbringen nach ca. 1-2 min Temperatur und Alkoholprozente ablesen; bei einer von 20 C abweichenden Temperatur: Korrektur vornehmen Schnellbestimmung des Ethanolgehalts mittels Wasserdampfdestillation und Biegeschwinger Prinzip: Bestimmung des Alkoholgehalts mittels Biegeschwinger nach vollautomatischer Wasserdampfdestillation Durchführung 25.0 ml des auf 20 C temperierten Weins in einen 250 ml Kjeldahlkolben pipettieren, neutralisieren und Silikonentschäumer zusetzen Vorlage: 50 ml Messkölbchen Destillation < 2 min bei 116 C Messkolben mit Destillat auf 20 C temperieren und auf 50.0 ml auffüllen Dichte des Destillats mit Biegeschwinger bestimmen und daraus den Alkoholgehalt berechnen (Messzeit: ca. 2 min) Vorteile gegenüber der Referenz-Methode: deutlich schneller (5min) wesentlich einfacher handhabbar Nachteil: relativ teure Apparaturen Chemisches Verfahren der Alkoholbestimmung nach Rebelein Prinzip: Der im Getränk enthaltene Alkohol wird in eine saure Kaliumdichromat-Lösung überdestilliert, wobei eine quantitative Oxidation zu Essigsäure erfolgt. Das überschüssige Oxidationsmittel wird anschliessend iodometrisch bestimmt (Titration mit des aus Kaliumiodid entstandenen Iods mit Natriumthiosulfat-Maßlösung; deren Konzentration ist so gewählt, dass an der Bürette der Alkoholgehalt der Flüssigkeit direkt abgelesen werden kann) 2K 2 Cr 2 O 7 +8H 2 SO 4 +3CH 3 CH2OH 2 Cr 2 (SO 4 ) 3 +2K 2 SO 4 +3 CH 3 OOH+11H 2 O Essigsäure stört die Bestimmung nicht, während bei einer einfachen Alkoholdestillationsmethode ohne vorherige Neutralisation die ins Destillat übergehenden flüchtigen Säuren miterfasst werden. Alcotest-Röhchen: Ethanol wird durch Kaliumdichromat zu Essigsäure oxidiert. Das gelbe Kaliumdichromat (Oxidationsstufe Cr(VI)) wird dabei zum grünen Chrom(III)sulfat reduziert.
10 Weinanalytik Reduzierende Zucker Schweflige Säure (SO 2 ) Chromatographie Bestimmung der titrierbaren Gesamtsäure Die titrierbare Gesamtsäure (auch Gesamtsäure oder Säure ) von Most und Wein setzt sich hauptsächlich aus organischen Säuren zusammen, überwiegend Wein-, Äpfel- und Milchsäure. Frucht- und Beerenwein enthalten v.a. Citronensäure Bestimmung: Entkohlensäuerten Most oder Wein mit Lauge bekannter Konzentration auf den Neutralpunkt (ph 7.0) titrieren (ph-indikator; besser: ph-elektrode) Entfernung des Kohlendioxids (CO 2 ) durch Schütteln in der Kälte unter vermindertem Druck (Saugflasche, Wasserstrahlpumpe). Alternativ: abgemessene Probe zum Sieden erhitzen und vor der Titration auf 20 C abkühlen Berechnung als Weinsäure, bei Fruchtweinen als Citronensäure, in Frankreich als Schwefelsäure Umrechnungsfaktoren: 1.0 g Weinsäure ~ 0.9 g Äpfelsäure ~ 1.2 g Milchsäure ~ 0.85 g Citronensäure ~ 0.65 g Schwefelsäure Der ph-wert des Weins sollte betragen Titrimetrische Gesamtsäurebestimmung mit Blaulauge Visuelle Endpunktsbestimmung (blaue Farbe der Lauge verschwindet nicht mehr) Prinzip: Durch Titration mit einer mit Indikator (Bromthymolblau) versehenen 1/3- normalen Natronlauge wird eine mit einer Pipette abgemessene Menge Getränk auf den Neutralpunkt gebracht. Aus der verbrauchten Laugenmenge kann der Säuregehalt berechnet werden. Durchführung Mit einer Pipette 25.0 ml entkohlensäuertes Getränk in einen 200 ml Erlenmeyerkolben oder Becherglas geben Aus der Bürette unter Umschwenken Blaulauge zulaufen lassen, bis gegen Ende der Titration die Farbe von gelb über grün nach blaugrün umschlägt Die verbrauchten ml Blaulauge entsprechen g/l Gesamtsäure (berechnet als Weinsäure) Gehalt an Gesamtsäure in Weinen: 5-10 g/l (berechnet als Weinsäure) Störung durch Rotweinfarbstoffe! In diesem Fall Verfahren mit ph-meter anwenden Gesamtsäurebestimmung mit dem ph-meter Prinzip: Zu einer einer Pipette abgemessenen entkohlensäuerten Untersuchungsprobe, in welche die Elektrode eines ph-meters eintaucht, lässt man unter ständigem Rühren (Magnetrührer) aus einer Bürette eine Lauge bekannter Konzentration zulaufen. Aus dem Laugenverbrauch bis zum Erreichen des Äquivalenzpunktes (ph 7.0) errechnet sich die Gesamtsäure Durchführung ph-meter vor der Bestimmung mit Pufferlösung kalibrieren 25.0 ml entkohlensäuertes Getränk in ein Becherglas mit Magnetrührstäbchen pipetieren ph Elektrode eintauchen und Magnetrührer einschalten Titration bis zum Äquivalenzpunkt (ph 7.0) mit 1/3-normaler NaOH Aus dem Laugenverbrauch die Gesamtsäure als Weinsäure (g/l) berechnen: 1.0 ml Lauge entsprechen 1.0 g/l Gesamtsäure
11 Weinanalytik Reduzierende Zucker Schweflige Säure (SO 2 ) Chromatographie Bestimmung der flüchtigen Säure Die Summe der bei der Destillation von Most oder Wein übergehenden Säuren bezeichnet man als flüchtige Säure. Sie wird bei der alkoholischen Gärung in kleinen Mengen gebildet und besteht hauptsächlich aus Essigsäure (normalerweise g/l; sollte 0.8 g/l nicht überschreiten) Schweflige Säure geht bei der Wasserdampfdestillation ebenfalls mit über und muss bei genauen Bestimmungen von der ermittelten flüchtigen Säure subtrahiert werden Kohlensäure ist vor der Wasserdampfdestillation zu entfernen (Wasserstrahlvakuum) Durchführung Zu untersuchende Flüssigkeit im Wasserstrahlvakuum entgasen und 5.0 ml in den Destillierkolben pipettieren Im Wasserdampfstrom ca. 60 ml in die Vorlage destillieren Destillat bis zum beginnenden Sieden erhitzen, abkühlen, mit einigen Tropfen Phenolphthalein versetzen und mit 0.01 N NaOH bis zur schwachen Rosafärbung titrieren Berechnung Verbrauchte ml 0.01 N NaOH x 0.12 = flüchtige Säure in g/l Beispiel: NaOH-Verbrauch 3.5 ml ~ 0.42 g/l flüchtige Säure Wasserdampf- Destillations- Apparatur Weinanalytik Reduzierende Zucker Schweflige Säure (SO 2 ) Chromatographie Nachweis und Bestimmung der organischen Säuren im Most: vor allem Wein- und Äpfelsäure im Wein: v.a. Wein-, Äpfel- und Citronensäure; weiterhin als Produkte der Gärung sowie des biologischen Säureabbaus (BSA): Milchsäure, Bernsteinsäure, Kohlensäure sowie geringe Mengen an Essigsäure. Der ph Wert des Weins sollte zwischen 2.8 und 3.8 liegen Nachweis des biologischen Säureabbaus (BSA) Nach der Gärung enthalten Weine i.a. 3-8 g/l Äpfelsäure. Im Verlauf des BSAs wird Äpfelsäure (= Dicarbonsäure) durch Milchsäurebakterien in Milchsäure (= Monocarbonsäure) umgewandelt -> Verminderung der Gesamtsäure und Erhöhung des ph-werts des Weins Der biologische Säureabbau kann durch oenologische Verfahren gestoppt werden, sobald die gewünschte Gesamtsäure erreicht ist, um einem Säuremangel der Weine entgegenzuwirken Zur Verfolgung des biologischen Säureabbaus hat die Bestimmung der Äpfelund Milchsäure wesentliche Bedeutung Bestimmung der verschiedenen Säuren des Weins Verhältnis Äpfelsäure/Milchsäure: semiquantitativ mittels DC quantitative Bestimmung: photometrisch, enzymatisch, oder mittels HPLC
12 Dünnschichtchromatographische Bestimmung des Verhältnisses Äpfelsäure /Milchsäure Das Verhältnis Äpfelsäure/Milchsäure gibt Hinweise auf den Fortschritt des biologischen Säureabbaus im Wein (Umwandlung Malat in Lactat) Prinzip Freisetzung der im Wein vorhandenen Säuen mittels Kationenaustauscher; anschliessend DC-Trennung DC-Trennung Fliessmittel: 2 g/l Bromphenolblau in Propanol-2 / H 2 O(8+1)oder Methanol/1-Propanol/H 2 O (38/38/24) Stationäre Phase: mit Cellulose beschichtete Aluoder Kunststoff-Folie (ohne Fluoreszenz-Indikator) Die Säureflecken sind bereits während der Entwicklung gelb auf blauem Hintergrund sichtbar R f -Werte:Milchsäure > Äpfelsäure > Weinsäure Auswertung: Weine, bei denen der Säureabbau noch nicht stattgefunden hat, weisen einen starken Äpfelsäurefleck und einen schwachen Milchsäurefleck auf (vgl. Bahn 5). Nach dem Säureabbau fehlt der Äpfelsäurefleck, während derjenige der Milchsäure stark ausgeprägt erscheint (vgl. Bahn 7) 1-3: Wein-, Äpfel-, Milchsäure 4: Gemisch aus (1-3) 5: Wein ohne BSA 6: Wein mitten im BSA 7: Wein nach BSA Photometrische Bestimmung der organischen Säuren (I) Neben der enzymatischen Bestimmung der organischen Säuren gibt es die Möglichkeit, diese Säuren mit Hilfe spezifischer Reaktionen zu farbigen Verbindungen umzusetzten, deren Extinktion im Photometer bestimmt wird. Photometrische Messverfahren: Farbige Lösungen absorbieren Licht bestimmter Wellenlänge. Die Abnahme der Lichtintensität (= Extinktion) kann mit einer Photozelle sehr genau gemessen werden und ist ein Maß für die Konzentration der Messlösung. Zur Aufstellung einer Kalibrierkurve stellt man aus einer Lösung bekannter Konzentration (Stammlösung) Verdünnungen her und misst nach Umsetzung mit dem Farbreagenz deren Extinktion. Photometer Photometrische Bestimmung der organischen Säuren (II) Weinsäure bildet mit Ammoniumvanadat einen orangefarbenen Komplex; Messung der Extinktion bei 530 nm Milchsäure wird nach Abtrennung an einer Anionenaustauscher-Säule mit Cersulfat decarboxyliert und oxidiert. Der entstehende Acetaldehyd wird nach Reaktion mit Nitroprussidnatrium und Piperidin bei 570 nm bestimmt. Äpfelsäure reagiert nach Abtrennung an einer Anionentauscher-Säule mit Chromotropsäure und konz. Schwfelsäure zu einer gelb gefärbten Verbindung (in Anwesenheit von Milch- bzw. Weinsäure: gelbviolett). Photometrische Messung bei 420 nm Extinktion Konzentration Bestimmung der Äpfelsäure Kalibrierkurve Enzymatische Bestimmung der organischen Säuren Die enzymatische Bestimmung der organischen Säuren erfolgt prinzipiell ähnlich wie die Bestimmung der Zucker oder des Alkohols (d.h. UV-Test) Enzymatische Bestmmung der Äpfelsäure L-Malat wird durch das Enzym L-Malat- Dehydrogenase (L-MDH) durch NAD + zu Oxalacetat oxidiert Verschiebung des Gleichgewichts dieser Reaktion auf die Seite der Endprodukte durch Umsetzung des gebildeten Oxalacetats mit L-Glutamat in Gegenwart des Enzyms Glutamat-Oxalacetat-Transaminase (GOT) zu L-Aspartat und -Ketoglutarat Photometrische Messung der Extinktionszunahme bei = 340 nm Die gebildete NADH-Menge ist der ursprünglich vorhandenen L-Malat-Menge äquivalent
13 Weinanalytik Reduzierende Zucker Gesamte / freie schweflige Säure (SO 2 ) Chromatographie Gesamte und freie schweflige Säure Einer der wichtigsten dem Wein zugesetzten Inhaltsstoffe ist SO 2, welches im Endprodukt frei als schweflige Säure, oder gebunden (v.a. an Acetaldehyd) vorliegt. Vom organoleptischen Standpunkt ist es erwünscht, dass Wein freie schweflige Säure enthält, damit Acetaldehyd vollständig gebunden wird. Weisswein enthält normalerweise mehr schweflige Säure als Rotwein. SO 2 dient zur Hemmung von Mikroorganismen (z.b. Essigsäurebakterien) und hat reduzierende Wirkung auf verschiedene Weininhaltsstoffe, wodurch geschmacklich nachteilige Veränderungen verhindert werden. Ausserdem wird die enzymatische Oxidation von Polyphenolen vermieden. Die antiseptischen Eigenschaften sind v.a. auf das freie SO 2 zurückzuführen, während das gebundene SO 2 praktisch keine antimikrobielle Aktivität aufweist. Zum Abschluss der aloholischen Gärung müssen die Gehalte an freier und gesamter schwefliger Säure genügend niedrig sein (< 10 mg/l freies SO 2 ; < 80 mg/l gesamtes SO 2 ), um den spontanen biologischen Säureabbau nicht zu verzögern. Sobald dieser beendet ist, wird dem Wein SO 2 zugesetzt, um die Entwicklung von Mikroorganismen zu unterbinden, die Bildung unerwünschter Verbindungen zu verhindern und der Oxidation des Weins vorzubeugen. Es existiert eine Reihe von Verfahren zur Bestimmung der freien und gesamten schwefligen Säure (z.t. gebrauchsfertige Reagenzien- und Gerätekombinationen) Gesetzlich zulässige Höchstmengen an Gesamt-Sulfit in Wein 1 % Dissoziationsformen von SO 2 in Abhängigkeit vom ph-wert der Lösung (rosa: im Wein vorherrschende Verhältnisse) Bestimmung der freien schwefligen Säure Prinzip: Iodlösung wird von schwefliger Säure zu farblosem Iodid reduziert, welches mit Stärke keine blaue Einschlussverbindung mehr bildet. Die Bestimmung beruht darauf, dass Wein neben der schwefligen Säure nahezu keine anderen mit Iod reagierenden Substanzen enthält (Ausnahme: evtl. Ascorbinsäure und Reduktone) Durchführung: Zu analysierendes Getränk (25.0 ml) in Titrationsgefäss pipettieren Stärkelösung (2 ml) zugeben und mit 25 %-iger Schwefelsäure (10 ml) ansäuern. Nicht schütteln, da sonst SO 2 -Verluste! Sofort mit n/128 Jodid-Jodatlösung bis zur ca. 10 Sekunden andauernden Blaufärbung titrieren Bestimmung bei Zimmertemperatur (20 C) und schnell durchführen! Das Gleichgewicht zwischen freier und gebundener schwefliger Säure ist temperaturabhängig -> Bei niedriger Temperatur liegt weniger, bei höherer Temperatur mehr schweflige Säure vor. Maßgebend ist der SO 2 -Gehalt bei 20 C! Bei stark gefärbten Rotweinen: Anstelle der Stärkelösung (Indikator) den Äquivalenzpunkt elektrometrisch (Pt-Elektrode) ermitteln Berechnung: Verbrauchte n/128 Iodid-Iodat-lösung x 10 = freies SO 2 (mg/ml) Achtung: Ascorbinsäure und andere Reduktone reagieren ebenfalls mit Iod und täuschen einen höheren SO 2 -Gehalt vor. Bei Anwesenheit von Ascorbinsäure: freies SO 2 durch Zugabe von Glyoxal binden. Bei anschliessender Titration mit Iod-Lösung werden nur Ascorbinsäure und andere Reduktone erfasst. Diesen Wert subtrahieren.
14 Bestimmung der gesamten schwefligen Säure Prinzip: Zur Bestimmung muss die gebundene schweflige Säure freigesetzt werden, entweder durch Zugabe von Lauge (Direktverfahren; liefert aber nur orientierende Werte) oder in der Hitze durch Destillation (Referenzmethode) Destillationsverfahren nach Rebelein SO 2 nach Zusatz von Methanol und H 2 SO 4 nach aus der Untersuchungslösung in ein alkalisches Oxidationsgemisch (Kaliumiodat) überdestillieren Der auf Zimmertemperatur abgekühlten Flüssigkeit Stärkelösung zufügen und mit Schwefelsäure ansäuern Das überschüssige Oxidationsmittel mit Natriumthiosulfat-Maßlösung zurücktitrieren (-> die zunächst tiefblaue Farbe der Lösung verschwindet) SO 2 -Gehalt kann direkt an der Bürette abgelesen werden (in mg/l) Apparatur nach Rebelein zur Bestimmung der gesamten schwefligen Säure Bestimmung der schwefligen Säure mit Teststäbchen Zur Aufhellung des Rotweins mit Aktivkohlepapier filtrieren Weinanalytik Reduzierende Zucker Schweflige Säure (SO 2 ) Chromatographie Bestimmung der Asche (Mineralstoffe) Unter Asche versteht man die Gesamtheit der nach Verbrennung des Abdampfrückstandes zurückbleibenden Mineralstoffe des Getränks. Die Verbrennung ist so durchzuführen, dass die Kationen (ausser Ammonium) erhalten bleiben Übliche Aschegehalte in Wein: g/l. Hauptbestandteil der Asche ist Kalium (50-50%); daneben Mg und Na Bei der Vergärung sinkt der Aschegehalt aufgrund des Mineralstoffbedarfs der Hefe sowie durch Ausfall von Weinstein. Der Aschegehalt kann auch durch Kellerbehandlungsmittel oder Ionenaustauscherbehandlung beeinflusst werden Bestimmung: Schalenmethode (Referenzverfahren) Platinschale ausglühen und nach dem Erkalten im Exsikkator auf 0.1 mg genau wiegen 25.0 ml des Getränks in die Platinschale geben, mittels Oberflächenverdampfer eindampfen, über der Bunsenbrennerflamme langsam verkohlen und dann im Muffelofen bei 525 C ca. 6-8 h veraschen Nach vollständiger Veraschung Platinschale im Exsikkator erkalten lassen und anschliessend rasch auf 0.1 mg genau wiegen Berechnung: Asche (g/l) = 40 x (Masse der Schale nach der Veraschung Masse der Schale vor der Veraschung)
15 : Instrumentelle Verfahren, enzymatische Analytik und Schnellmethoden NIR-Spektroskopie Chromatographie (GC, HPLC) Enzymatische Analytik Biochemische und Molekularbiologische Verfahren Einsatz von Analysenautomaten Hohe Nachweisempfindlichkeit, Spezifität und Schnelligkeit Simultanmessung (parallel; gleichzeitige Bestimmung mehrerer Parameter) Erstellung von typischen Weinprofilen, Echtheitsprüfung etc. Schadstoff-, Fremdstoffanalytik Schnellmethoden in Weinanalytik: Reflectoquant-System Prinzip: Teststäbchen ( Dip-Stick ), basierend auf enzymatischer oder chemischer Messmethodik (Farbreaktion). Anschliessende Messung des an dem Teststäbchen reflektierten Lichtes mit Hilfe eines Remissionsphotometers Bestimmung der Konzentration bestimmter Weininhaltsstoffe anhand der Intensitätsunterschiede zwischen emittiertem und reflektiertem Licht Vorteile: Schnell (10 min); niedrige Analysen- und Anschaffungskosten; ideal für vor-ort-analysen für Kellereitechniker und Oenologen zur schnellen Ermittlung wichtiger Parameter Testkits (gebrauchsfertige Reagenzien) für ph-wert, Gesamtsäure, Wein-, Äpfel- und Milchsäure, freie schweflige Säure, Gesamtzucker, Glucose, Ascorbinsäure, Alkohol etc. Messgenauigkeit: +/- 10 Prozent Einsatzbereich: Rohstoffuntersuchung, Prozesskontrolle, Produktkontrolle, Einhaltung von Grenzwerten, Reinigung und Desinfektion etc. Zu beachten: Messtemperatur (20 C) Entgasen bei Gesamtsäurebestimmung exakte Verdünnungen! Rotweine ggf. entfärben Vollautomatisierte enzymatische Messgeräte für schnelle Wein- und Mostanalysen auf Basis von -ph-messungen Prinzip: Die Umsetzung von Enzymen und Substraten ist mit ph-änderungen verbunden, wobei die Produktion oder Verbrauch von H + für die Konzentration des zu bestimmenden Analytes in der Probe typisch ist ->Messung der ph-werte vor und nach der Umsetzung mittels Kapillarglaselektroden. Aus dieser ph-wert-differenz wird die Substratkonzentration ermittelt keine Probenvorbereitung, d.h. direkte Analyse von naturtrüben oder stark gefärbten flüssigen Proben wie z.b. Moste oder Frucht- und Gemüsesäfte; Schwebstoffe bis 0,3 mm Durchmesser stören dabei die Messung nicht Sehr schnell: Messdauer Sekunden, je nach Parameter Gaschromatographische Bestimmung der Alkohole (I) Prinzip Direkte Bestimmung der Alkohole (Methanol, Ethanol, höhere Alkohole) mittels Gas-Chromatographie auf gepackter Säule unter Verwendung eines internen oder externen Standards (bei Kapillarsäulen: nur interner Standard) Geräte/Materialien GC mit FID und Integrator, i.d. 2 mm gepackte Säule, 2 m Länge stationäre Phase: Chromosorb 102 GC-Parameter Trägergas: N 2, 25 ml/min Temperaturprogramm 100 -> 240 C Einspritzmenge: 2-4 l interner Standard: Dioxan Gepackte Säule Kalillarsäule
16 Gaschromatographische Alkoholbestimmung (II) Probenvorbereitung Trübe Proben filtrieren oder zentrifugieren (besser: Destillat verwenden) Externe Standards: wässrige Lösungen von Methanol, Ethanol, Propanol etc. (Verdünnungreihe) Methode mit internem Standard: 10 ml der Probelösung mit 1 m einer wässrigen Dioxanlösung (5 g/l) Auswertung Kalibrierung anhand einer Verdünnungsreihe; Berechnung der Regressionsgerade zwischen der Fläche der Peaks und der Einspritzmenge Gas-Chromatographische Trennung der Alkohole (externer (Standard) Peakfläche Hinweis Wein enthält geringe Mengen Methanol aus der Hydrolyse des Pektins der Trauben. Weisswein (->Trauben wenig mazeriert): < 150 mg/l; Rotwein: < 300 mg/l Höhere Alkohole: Gäungsnebenprodukte Einspritzmenge Kalibrierkurve Hochleistungs-Flüssigchromatographische Bestimmung der organischen Säuren, Zuckerarten und Alkohole (I) Prinzip: Mit Hilfe von Ionenaustauschern werden die Zucker und Alkohole von den organischen Säuren des Weins getrennt. Die anfallenden Fraktionen werden anschliessend mittels HPLC analysiert HPLC-Anlage Prinzipieller Aufbau einer HPLC-Anlage Hochleistungs-Flüssigchromatographische Bestimmung der organischen Säuren, Zuckerarten und Alkohole (II) Durchführung Geräte und Materialien HPLC mit Refraktionsindex- (RI) und UV-Detektor mit Integrationssystem HPLC-Säule z.b. Bio-Rad HPX-87 Festphasenextraktionsröhrchen C18 Chromatographie Fliessmittel: Schwefelsäure, 0.01 mol/l Fluss: 0.6 ml/min Ofentemperatur: 65 C Analysendauer 25 min je Fraktion IR-Detektor UV-Detektor, 215 nm Auswertung Externer Standard, Kalibrierkurve, Berechnung: über Peakflächen oder Peakhöhen HPLC-Trennung organischer Säuren Fourier-Transformations Infrarot (FTIR) - Spektroskopie Prinzip der FTIR-Messung IR-Spektrometer messen die Durchlässigkeit einer Probe für Infrarot (IR)-Strahlung Ältere IR-Geräte: Polychromatisches Licht einer IR-Lampe wird mittels Prisma oder Gitter zunächst in einzelne Wellenlängen zerlegt; diese passieren zeitlich nacheinander die Probe -Technik: Polychromatische IR-Strahlung wird auf zwei ungleich langen Wegen durch die Probe zum Detektor geführt; hierbei entsteht ein Interferogramm (Wellenmuster), welches die gesamte Information des IR-Spektrums enthält Dieses wird anschliessend über das mathematische Verfahren der Fourier-Transformation aus dem Interferogramm berechnet Die Auswertung von NIR-Spektren erfordert wegen der starken Überlagerung komplexe Rechenalgorithmen auf der Grundlage statistischer Verfahren. Für die Auswertung muss deshalb eine relativ große Zahl von Referenzstandards zur Verfügung stehen
17 Most- und Weinanalyse mit Hilfe der FTIR-Spektroskopie (I) Zur schnellen und simultanen Analyse mehrerer Parameter für die Routineanalytik Ablauf einer FTIR-Messung bei Wein oder Most Probe durch Zentrifugation oder Filtration klären Probe (ca. 30 ml) in die Messzelle geben und IR- Spektrum aufnehmen (Zeitdauer ca. 2 min) Interpretation des IR-Spektrums IR-Strahlung versetzt chemische Bindungen in definierte Schwingungen. Lage und Intensität der Absorptionsbanden liefern wichtige Informationen Ist die Probe ein Substanzgemisch (z.b. Most oder Wein), so enthält das resultierende IR-Spektrum die qualitative und quantitative Überlagerung aller vorhandenen Einzelkomponente Informationen über das Vorhandensein einzelner Stoffe bzw. deren Konzentration lassen sich daher nur indirekt, d.h. mittels Eichung/Kalibration und statistischer Methoden gewinnen Grenzen der Methode Substanzen < 0.1 g/l können nicht mehr bestimmt werden -> kein Ersatz für HPLC Produktspezifische Eichungen nötig, d.h. jedes Produkt (Traubenmost, Wein etc.) benötigt eine eigene Kalibrierung Most- und Weinanalyse mit Hilfe der FTIR-Spektroskopie (II) Vorteile Umfassende Qualitätsanalyse von Most- und Weininhaltsstoffen; z.b. zur Überwachung während der Gärung oder beim biologischen Säureabbau -> Informationen über die Beschaffenheit und Veränderungen des Produkts Simultane Analyse von mehr als einem Dutzend unterschiedlicher Inhaltsstoffe/Parameter (z.b. Alkohol, Dichte, Extrakt, Glycerol, Gesamtphenol, Zucker, Gesamtsäure, Wein- Äpfel- und Citronensäure, Gesamt-SO 2 ) Erstellung eines Fingerabdrucks zur Identitätskontrolle Umweltschonend (kein Anfall toxischer Chemikalien) Niedrige Verbrauchs- und Unterhaltskosten Praxistauglichkeit Kurze Analysenzeit (2-3 min) Hoher Probendurchsatz Minimale Probenvorbereitung Einfache Bedienung Nachteile Hohe Investitionskosten Indirekte Methode, produktabhängige Kalibration nötig Keine Mineralstoffe messbar Bestimmungsgrenze: ca. 0,1 g/l Enzym-/Biosensoren zur Qualitätskontrolle von Fruchtsaft und Wein Herstellung und Lagerung von Saft / Wein: On-line Warnsystem, z.b. laktatbildende Mikroorganismen Monitoring erfordert einfache und schnelle Messmethoden Alternative zur Standardanalytik, keine Probenahme hohe Spezifität, einsatzfähig für stark gefärbte / trübe Lösungen Anwendung der Biosensor online-messung für die Bioprozesskontrolle Anwendung von Kellerbehandlungsmitteln Unterschiedliche Produkte und Verfahren sind sind -je nach Land (z.b. D, A, CH, F)- zugelassen, reglementiert (zulässige Höchstmengen) oder verboten (-> evtl. Änderung der chemischen Zusammensetzung des Weins). Beispiele: Calciumcarbonat zur Entsäuerung des Weins (maximal 1 g/l) Metaweinsäure (maximal 100 mg/l) zur Verhinderung der Weinstein-(Tartrat-)Ausfällung während der Lagerung des Weins in Flaschen Ascorbinsäure (bis zu 400 mg/l) Na- und Calciumbentonit -> Na + und Ca ++ können in den Wein gelangen Gelatine (evtl. nicht kosher!) Kaliumhexacyanoferrat(II) zur Entferung von Schwermetallionen im Wein; bei Überdosierung -> Cyanid in Wein! Nicht zugelassene Kellerbehandlungs- und Konservierungsmittel, z.b. Natriumazid, Sorbinsäure (gegen Hefen)
18 Qualitätsmindernde Substanzen im Wein Beispiele Böcksergeschmack : Fehlgeschmack, Geruch nach faulen Eiern (Reaktion der Säure des Weins mit Eisen -> Bildung von Wasserstoff; Reaktion mit Schwefel -> Schwefelwasserstoff) zu hoher Gehalt an Ethylacetat (> 200 mg/l) mikrobieller Abbau von Glycerol zu 1,3 Propandiol Hydroxymethylfurfural (HMF) bei Erhitzen fructosehaltiger Weine biogene Amine (z.b. Histamin durch Decarboxylierung von Histidin durch bestimmte Milchsäurebakterien) Acetaldehyd (Zwischenprodukt der alkoholischen Gärung) hoher Diacetylgehalt 2,4,6 Trichloranisol (2,4,6-TCA): muffiger Korkton Abschliessende Bemerkungen Die chemische Zusammensetzung von Weinen kann je nach Rebsorte, Herkunft, Methoden der Weinzubereitung und Tradition stark variieren. Die Zusammensetzung des Weins sollte dennoch in relativ engen Grenzen liegen. Gewisse oenologische Verfahren, die in manchen Ländern zulässig sind, können in anderen reglementiert oder verboten sein (z.b. Anreicherung mit Saccharose, Säurezusatz, chemische Entsäuerung des Weins etc.) Nachweis eines unerlaubten Zusatzes von Wasser, Alkohol oder Glycerol: Schwierig! Nachweis von synthetischem Alkohol: über 14 C. Alkohol aus Zuckerung: eventuell über Isotopenverhältnisse ( 1 H/ 2 H; 16 O/ 18 O; 12 C/ 13 C) Sensorik nicht vernachlässigen! Beurteilung mit den menschlichen Sinnen: Geruch, Geschmack, Aussehen Erkennung von Weinfehlern, - krankheiten oder - mängeln. Allerdings viel Übung und Erfahrung nötig! Die sensorische Prüfung (Degustation) spielt eine wichtige Rolle für den Chemiker: (z.b. Bitterkeides Weins -> Hinweis auf Anwesenheit von Schwermetallen; Korkgeschmack -> Prüfung auf 2,4,6-Trichloranisol; etc.) Schweizerisches Lebensmittelbuch
Getränkeanalytik. Walter Weiss. Lehrstuhl für Allgemeine Lebensmitteltechnologie. Ascorbinsäure (Vitamin C)
 Getränkeanalytik Walter Weiss Lehrstuhl für Allgemeine Lebensmitteltechnologie Inhaltsstoffe/Parameter: Relative Dichte, Mostgewicht ( Oe) Zucker Alkohole Flüchtige Säure Organische Säuren, BSA Schweflige
Getränkeanalytik Walter Weiss Lehrstuhl für Allgemeine Lebensmitteltechnologie Inhaltsstoffe/Parameter: Relative Dichte, Mostgewicht ( Oe) Zucker Alkohole Flüchtige Säure Organische Säuren, BSA Schweflige
Bestimmung der titrierbaren Gesamtsäure
 Bestimmung der titrierbaren Gesamtsäure Die titrierbare Gesamtsäure (auch Gesamtsäure oder Säure ) von Most und Wein setzt sich hauptsächlich aus organischen Säuren zusammen, überwiegend Wein-, Äpfel-
Bestimmung der titrierbaren Gesamtsäure Die titrierbare Gesamtsäure (auch Gesamtsäure oder Säure ) von Most und Wein setzt sich hauptsächlich aus organischen Säuren zusammen, überwiegend Wein-, Äpfel-
¾ Kb / A. Analyse von Bier
 Analyse von Bier Zielsetzung: Bestimmung des Aschegehalts, des Dichte - und Alkohol- und Maltosegehaltes, des ph-wertes, der flüchtigen Säure sowie der Extrakte und Stammwürze durch jene im Schweizer Lebensmittelbuch
Analyse von Bier Zielsetzung: Bestimmung des Aschegehalts, des Dichte - und Alkohol- und Maltosegehaltes, des ph-wertes, der flüchtigen Säure sowie der Extrakte und Stammwürze durch jene im Schweizer Lebensmittelbuch
Seminar zum Quantitativen Anorganischen Praktikum WS 2011/12
 Seminar zum Quantitativen Anorganischen Praktikum WS 2011/12 Teil des Moduls MN-C-AlC Dr. Matthias Brühmann Dr. Christian Rustige Inhalt Montag, 09.01.2012, 8-10 Uhr, HS III Allgemeine Einführung in die
Seminar zum Quantitativen Anorganischen Praktikum WS 2011/12 Teil des Moduls MN-C-AlC Dr. Matthias Brühmann Dr. Christian Rustige Inhalt Montag, 09.01.2012, 8-10 Uhr, HS III Allgemeine Einführung in die
AnC I Protokoll: 3.4 Iodometrische Bestimmung von Ascorbinsäure (Vitamin C)" SS Analytische Chemie I. Versuchsprotokoll
 Analytische Chemie I Versuchsprotokoll 3.4 Iodometrische Bestimmung von Ascorbinsäure (Vitamin C) 1.! Theoretischer Hintergrund Bei dieser Redoxtitration wird Ascorbinsäure mit Hilfe von Triiodid oxidiert.
Analytische Chemie I Versuchsprotokoll 3.4 Iodometrische Bestimmung von Ascorbinsäure (Vitamin C) 1.! Theoretischer Hintergrund Bei dieser Redoxtitration wird Ascorbinsäure mit Hilfe von Triiodid oxidiert.
Ansatzwerte: SurTec 691 I Ansatzlösung 8 Vol% (7-9 Vol%) SurTec 691 II Ansatzadditiv 2 Vol% (1,5-3 Vol%)
 SurTec 691 Schwarzpassivierung für alkalische Zinküberzüge Eigenschaften Chrom(VI)-freie Schwarzpassivierung auf Basis von dreiwertigem Chrom speziell entwickelt für die Beschichtung von Massenware erzeugt
SurTec 691 Schwarzpassivierung für alkalische Zinküberzüge Eigenschaften Chrom(VI)-freie Schwarzpassivierung auf Basis von dreiwertigem Chrom speziell entwickelt für die Beschichtung von Massenware erzeugt
Technischer Milchsäurebakterien -Test 2012
 Technischer Milchsäurebakterien -Test 2012 Der vorliegende Test beinhaltet die technische Prüfung von Milchsäurebakterien-Starterkulturen für den biologischen Säureabbau. Dabei soll nicht das beste Präparat
Technischer Milchsäurebakterien -Test 2012 Der vorliegende Test beinhaltet die technische Prüfung von Milchsäurebakterien-Starterkulturen für den biologischen Säureabbau. Dabei soll nicht das beste Präparat
Beispiele zu Neutralisationsreaktionen
 Beispiele zu Neutralisationsreaktionen Einleitung: Im Zuge des folgenden Blocks wird die Titration als Beispiel einer gängigen quantitativen Bestimmungsmethode in der Chemie genauer besprochen und für
Beispiele zu Neutralisationsreaktionen Einleitung: Im Zuge des folgenden Blocks wird die Titration als Beispiel einer gängigen quantitativen Bestimmungsmethode in der Chemie genauer besprochen und für
Probe- und Vergleichslösungen: Trennschicht (stationäre Phase): Kieselgel. Fließmittel (mobile Phase):
 , der Allrounder aus dem Supermarkt Welche Zucker sind in enthalten? Nachweis mittels Dünnschichtchromatografie (DC) [6] 27.06.03 / 04.07.03 Jessica Bornemann Grundlagen: Für die DC verwendet man Kunststofffolien,
, der Allrounder aus dem Supermarkt Welche Zucker sind in enthalten? Nachweis mittels Dünnschichtchromatografie (DC) [6] 27.06.03 / 04.07.03 Jessica Bornemann Grundlagen: Für die DC verwendet man Kunststofffolien,
Gefahrenstoffe. 2 Bechergläser (230 ml), Bürette, Magnetrührer, Trichter, Rührschwein, Pipette, Stativ, Muffe, ph-meter
 1.1 V1 Titration von Cola In diesem Versuch wird die in Cola enthaltene Phosphorsäure mittels Säure-Base-Titration titriert und bestimmt. Ebenfalls wird mit den erhaltenen Werten gerechnet um das chemische
1.1 V1 Titration von Cola In diesem Versuch wird die in Cola enthaltene Phosphorsäure mittels Säure-Base-Titration titriert und bestimmt. Ebenfalls wird mit den erhaltenen Werten gerechnet um das chemische
Application Bulletin
 Nr. 225/2 d Application Bulletin Von Interesse für: Weinanalyse, Lebensmittel A G 1, 7 Einfache Weinanalyse mit dem Titrino Zusammenfassung Das Bulletin beschreibt die Bestimmung der folgenden Parameter
Nr. 225/2 d Application Bulletin Von Interesse für: Weinanalyse, Lebensmittel A G 1, 7 Einfache Weinanalyse mit dem Titrino Zusammenfassung Das Bulletin beschreibt die Bestimmung der folgenden Parameter
ETHANOL 70 Prozent Ethanolum 70 per centum. Aethanolum dilutum. Ethanol 70 Prozent ist eine Mischung von Ethanol 96 Prozent und Wasser.
 ÖAB 2008/004 ETHANOL 70 Prozent Ethanolum 70 per centum Aethanolum dilutum Definition Ethanol 70 Prozent ist eine Mischung von Ethanol 96 Prozent und Wasser. Gehalt: Ethanol 70 Prozent enthält mindestens
ÖAB 2008/004 ETHANOL 70 Prozent Ethanolum 70 per centum Aethanolum dilutum Definition Ethanol 70 Prozent ist eine Mischung von Ethanol 96 Prozent und Wasser. Gehalt: Ethanol 70 Prozent enthält mindestens
Identifizierung des Farbstoffes in blauen M&Ms durch Dünnschichtchromatographie
 Name Datum Identifizierung des Farbstoffes in blauen M&Ms durch Dünnschichtchromatographie Material: DC-Karten (Kieselgel), Glas mit Deckel(DC-Kammer), Kapillare, Messzylinder Chemikalien: Blaue M&Ms,
Name Datum Identifizierung des Farbstoffes in blauen M&Ms durch Dünnschichtchromatographie Material: DC-Karten (Kieselgel), Glas mit Deckel(DC-Kammer), Kapillare, Messzylinder Chemikalien: Blaue M&Ms,
Messung des Vitamin C Gehaltes in Orangen mit und ohne Schalen written by Cyril Hertz, 3dMN, 25.11.2004
 1. Fragestellung: Das Ziel des Versuches war, herauszufinden, ob sich die Ascorbinsäure 1 eher im Fruchtfleisch oder in der Schale von Orangen befindet. Zu diesem Zweck wurden Orangen mit und ohne Schale
1. Fragestellung: Das Ziel des Versuches war, herauszufinden, ob sich die Ascorbinsäure 1 eher im Fruchtfleisch oder in der Schale von Orangen befindet. Zu diesem Zweck wurden Orangen mit und ohne Schale
Titrimetrische Analyse von Konfitüren, Frucht- und Gemüsesäften und deren Konzentraten
 Titrimetrische Analyse von Konfitüren, Frucht- und Gemüsesäften und deren Konzentraten Von Interesse für: Lebensmittel und Getränke A, G 7 Zusammenfassung Das Bulletin beschreibt Analysenmethoden zur Bestimmung
Titrimetrische Analyse von Konfitüren, Frucht- und Gemüsesäften und deren Konzentraten Von Interesse für: Lebensmittel und Getränke A, G 7 Zusammenfassung Das Bulletin beschreibt Analysenmethoden zur Bestimmung
ph-wert Beschreibung Eigenschaften und Bedeutung Analyse
 ph-wert Beschreibung Jede wässrige Lösung (auch reines Wasser) enthält H + -Ionen. Ihre Konzentration ist für den mehr oder weniger stark ausgeprägten sauren Charakter verantwortlich. Konzentrationen werden
ph-wert Beschreibung Jede wässrige Lösung (auch reines Wasser) enthält H + -Ionen. Ihre Konzentration ist für den mehr oder weniger stark ausgeprägten sauren Charakter verantwortlich. Konzentrationen werden
Kohlenhydrat-Analytik
 Kohlenhydrat-Analytik Kohlenhydrate sind in ihrem strukturellen Aufbau sehr ähnlich. Eine spezifische Bestimmung wird dadurch erschwert. Ein gruppenweises Unterscheiden mit verschiedenen einfachen Nachweisreaktionen
Kohlenhydrat-Analytik Kohlenhydrate sind in ihrem strukturellen Aufbau sehr ähnlich. Eine spezifische Bestimmung wird dadurch erschwert. Ein gruppenweises Unterscheiden mit verschiedenen einfachen Nachweisreaktionen
Methodenkennzeichnung (Angaben auf Ausdruck)
 Methodenkennzeichnung (Angaben auf Ausdruck) 1. Gesamtalkohol 1.1. Berechnung des potentiellen Alkohols nach der Formel (Gesamtzucker reduktometrisch, als Invertzucker berechnet 1) x 0,47 g/l (Gesamtzucker
Methodenkennzeichnung (Angaben auf Ausdruck) 1. Gesamtalkohol 1.1. Berechnung des potentiellen Alkohols nach der Formel (Gesamtzucker reduktometrisch, als Invertzucker berechnet 1) x 0,47 g/l (Gesamtzucker
Titrationen. Experimentiermappe zum Thema. Lernwerkstatt Schülerlabor Chemie
 Lernwerkstatt Schülerlabor Chemie Experimentiermappe zum Thema Titrationen Friedrich-Schiller-Universität Jena Arbeitsgruppe Chemiedidaktik August-Bebel-Straße 6-8 07743 Jena Fonds der Chemischen Industrie
Lernwerkstatt Schülerlabor Chemie Experimentiermappe zum Thema Titrationen Friedrich-Schiller-Universität Jena Arbeitsgruppe Chemiedidaktik August-Bebel-Straße 6-8 07743 Jena Fonds der Chemischen Industrie
physikalische Vorgänge Chemische Reaktionen
 physikalische Vorgänge Chemische Reaktionen Im täglichen Leben lassen sich vielfältige Veränderungen von Stoffen beobachten. Ob es sich dabei um physikalische oder chemische Vorgänge handelt, sollen folgende
physikalische Vorgänge Chemische Reaktionen Im täglichen Leben lassen sich vielfältige Veränderungen von Stoffen beobachten. Ob es sich dabei um physikalische oder chemische Vorgänge handelt, sollen folgende
SurTec 691 Schwarzpassivierung für alkalische Zinküberzüge
 Protection upgraded SurTec 691 Schwarzpassivierung für alkalische Zinküberzüge Eigenschaften Chrom(VI)-freie Schwarzpassivierung auf Basis von dreiwertigem Chrom speziell entwickelt für die Beschichtung
Protection upgraded SurTec 691 Schwarzpassivierung für alkalische Zinküberzüge Eigenschaften Chrom(VI)-freie Schwarzpassivierung auf Basis von dreiwertigem Chrom speziell entwickelt für die Beschichtung
Leonardo da Vinci Innovationstransferprojekt TraWi. Projektnummer: DE/13/LLP-LdV/TOI/147629
 ŠPŠCH Pardubice Erarbeitung berufspädagogischer Konzepte für das berufliche Handlungsfeld Operator Chemist operator LEE 2b: 2. ph-wert-bestimmung Sie sind chemischer Operator in einem chemischen Betrieb,
ŠPŠCH Pardubice Erarbeitung berufspädagogischer Konzepte für das berufliche Handlungsfeld Operator Chemist operator LEE 2b: 2. ph-wert-bestimmung Sie sind chemischer Operator in einem chemischen Betrieb,
Versuch 412: Photometrische Bestimmung von Phosphatspuren als "Phosphormolybdänblau"
 Instrumentelle Bestimmungsverfahren 131 Versuch 412: Photometrische Bestimmung von Phosphatspuren als "Phosphormolybdänblau" Phosphationen reagieren mit Molybdat MoO 4 in saurer Lösung zur 2 gelben Dodekamolybdatophosphorsäure
Instrumentelle Bestimmungsverfahren 131 Versuch 412: Photometrische Bestimmung von Phosphatspuren als "Phosphormolybdänblau" Phosphationen reagieren mit Molybdat MoO 4 in saurer Lösung zur 2 gelben Dodekamolybdatophosphorsäure
!!! NEUE ÖAB-MONOGRAPHIE!!!
 !!! NEUE ÖAB-MONOGRAPHIE!!! Die folgende neue Monographie ist für die Aufnahme in das ÖAB (österreichisches Arzneibuch) vorgesehen. Stellungnahmen zu diesem Gesetzesentwurf sind bis zum 31.05.2014 an folgende
!!! NEUE ÖAB-MONOGRAPHIE!!! Die folgende neue Monographie ist für die Aufnahme in das ÖAB (österreichisches Arzneibuch) vorgesehen. Stellungnahmen zu diesem Gesetzesentwurf sind bis zum 31.05.2014 an folgende
RI 55. Cyanidisches Glanzkupferverfahren
 Postfach 169 CH-9545 Wängi TG 19.08.2009 RI 55 Cyanidisches Glanzkupferverfahren Das cyanidische Glanzkupferbad RI 55 ist ein reiner Kaliumelektrolyt und dient zum Abscheiden glänzender Kupferniederschläge
Postfach 169 CH-9545 Wängi TG 19.08.2009 RI 55 Cyanidisches Glanzkupferverfahren Das cyanidische Glanzkupferbad RI 55 ist ein reiner Kaliumelektrolyt und dient zum Abscheiden glänzender Kupferniederschläge
Quantitativer, selektiver, eindeutiger, stöchiometrisch einheitlicher und rascher Reaktionsverlauf.
 Grundlage der Maßanalyse Quantitativer, selektiver, eindeutiger, stöchiometrisch einheitlicher und rascher Reaktionsverlauf. Was ist eine Maßlösung? Eine Lösung mit genau bekannter Konzentration mithilfe
Grundlage der Maßanalyse Quantitativer, selektiver, eindeutiger, stöchiometrisch einheitlicher und rascher Reaktionsverlauf. Was ist eine Maßlösung? Eine Lösung mit genau bekannter Konzentration mithilfe
Sekt Trocken Mumm & Co. Alkoholdeklaration laut Etikett 11,5 %vol
 Sekt Trocken Mumm & Co. Alkoholdeklaration laut Etikett 11,5 %vol Gesamtalkohol 102.0 g/l 1.1 Gesamtalkohol 12.92 %vol 1.1 Vorhandener Alkohol 91.7 g/l 2.9 NIR** Vorhandener Alkohol 11.62 %vol ber. Glycerin
Sekt Trocken Mumm & Co. Alkoholdeklaration laut Etikett 11,5 %vol Gesamtalkohol 102.0 g/l 1.1 Gesamtalkohol 12.92 %vol 1.1 Vorhandener Alkohol 91.7 g/l 2.9 NIR** Vorhandener Alkohol 11.62 %vol ber. Glycerin
RESOLUTION OIV-OENO gestützt auf die Arbeiten der Expertengruppen Spezifikationen önologischer Erzeugnisse und Mikrobiologie
 RESOLUTION OIV-OENO 496-2013 MONOGRAPHIE ÜBER HEFEAUTOLYSATE DIE GENERALVERSAMMLUNG, gestützt auf Artikel 2 Absatz iv des Übereinkommens vom 3. April 2001 zur Gründung der Internationalen Organisation
RESOLUTION OIV-OENO 496-2013 MONOGRAPHIE ÜBER HEFEAUTOLYSATE DIE GENERALVERSAMMLUNG, gestützt auf Artikel 2 Absatz iv des Übereinkommens vom 3. April 2001 zur Gründung der Internationalen Organisation
AnC I Protokoll: 6.1 Extraktionsphotometrische Bestimmung von Cobalt mit HDEHP! SS Analytische Chemie I. Versuchsprotokoll
 Analytische Chemie I Versuchsprotokoll 6.1 Extraktionsphotometrische Bestimmung von Mikromengen an Cobalt mit Phosphorsäure-bis- (2-ethylhexylester) (HDEHP) 1.! Theoretischer Hintergrund Zur Analyse wird
Analytische Chemie I Versuchsprotokoll 6.1 Extraktionsphotometrische Bestimmung von Mikromengen an Cobalt mit Phosphorsäure-bis- (2-ethylhexylester) (HDEHP) 1.! Theoretischer Hintergrund Zur Analyse wird
Bestimmung der Stoffmenge eines gelösten Stoffes mit Hilfe einer Lösung bekannter Konzentration (Titer, Maßlösung).
 Zusammenfassung: Titration, Maßanalyse, Volumetrie: Bestimmung der Stoffmenge eines gelösten Stoffes mit Hilfe einer Lösung bekannter Konzentration (Titer, Maßlösung). Bei der Titration lässt man so lange
Zusammenfassung: Titration, Maßanalyse, Volumetrie: Bestimmung der Stoffmenge eines gelösten Stoffes mit Hilfe einer Lösung bekannter Konzentration (Titer, Maßlösung). Bei der Titration lässt man so lange
Beispiele: Monocarbonsäuren, Di- und Tricarbonsäuren, gesättigte und ungesättigte Säuren, Hydroxycarbonsäuren
 Carbonsäuren (=> 6-8 Std.) Beispiele: Monocarbonsäuren, Di- und Tricarbonsäuren, gesättigte und ungesättigte Säuren, Hydroxycarbonsäuren Quellen: CD-Römpp http://www.chemieunterricht.de/dc2/facharbeit/alkansau.html
Carbonsäuren (=> 6-8 Std.) Beispiele: Monocarbonsäuren, Di- und Tricarbonsäuren, gesättigte und ungesättigte Säuren, Hydroxycarbonsäuren Quellen: CD-Römpp http://www.chemieunterricht.de/dc2/facharbeit/alkansau.html
Automatisierte Schwefeldioxid Bestimmung in Wein mit Random Access Analysatoren
 Automatisierte Schwefeldioxid Bestimmung in Wein mit Random Access Analysatoren Frank Fürle Thermo Fisher Scientific Bernkastel-Kues, 28.2.2012 Grundlagen Schweflige Säure : Behandlungsmittel mit verschiedenen
Automatisierte Schwefeldioxid Bestimmung in Wein mit Random Access Analysatoren Frank Fürle Thermo Fisher Scientific Bernkastel-Kues, 28.2.2012 Grundlagen Schweflige Säure : Behandlungsmittel mit verschiedenen
Aufgabe: Untersuchung der Kinetik der Zersetzung von Harnstoff durch Urease.
 A 36 Michaelis-Menten-Kinetik: Hydrolyse von Harnstoff Aufgabe: Untersuchung der Kinetik der Zersetzung von Harnstoff durch Urease. Grundlagen: a) Michaelis-Menten-Kinetik Im Bereich der Biochemie spielen
A 36 Michaelis-Menten-Kinetik: Hydrolyse von Harnstoff Aufgabe: Untersuchung der Kinetik der Zersetzung von Harnstoff durch Urease. Grundlagen: a) Michaelis-Menten-Kinetik Im Bereich der Biochemie spielen
Seminar: Photometrie
 Seminar: Photometrie G. Reibnegger und W. Windischhofer (Teil II zum Thema Hauptgruppenelemente) Ziel des Seminars: Theoretische Basis der Photometrie Lambert-Beer sches Gesetz Rechenbeispiele Literatur:
Seminar: Photometrie G. Reibnegger und W. Windischhofer (Teil II zum Thema Hauptgruppenelemente) Ziel des Seminars: Theoretische Basis der Photometrie Lambert-Beer sches Gesetz Rechenbeispiele Literatur:
Chemie zur Weihnacht. Farbreihe
 Farbreihe Reagenzien: 2 ml Phenolphthalein in 200 ml Wasser verdünnte Natronlauge in Tropfflasche Kaliumpermanganat 2,5 g Eisen(II)-sulfat in 50 ml Wasser 2,5 g Kaliumthiocyanat in 50 ml Wasser 2,5 g Kaliumhexacyanoferrat(II)
Farbreihe Reagenzien: 2 ml Phenolphthalein in 200 ml Wasser verdünnte Natronlauge in Tropfflasche Kaliumpermanganat 2,5 g Eisen(II)-sulfat in 50 ml Wasser 2,5 g Kaliumthiocyanat in 50 ml Wasser 2,5 g Kaliumhexacyanoferrat(II)
Photometrische Bestimmung von Phosphat in Nahrungsmitteln
 Photometrische Bestimmung von Phosphat in Nahrungsmitteln Grundlagen Die photometrische Bestimmung erfolgt nach der DIN EN 1189, D11-1 beziehungsweise nach dem DVGW W 504- Verfahren Die Vorteile der Vanadat-
Photometrische Bestimmung von Phosphat in Nahrungsmitteln Grundlagen Die photometrische Bestimmung erfolgt nach der DIN EN 1189, D11-1 beziehungsweise nach dem DVGW W 504- Verfahren Die Vorteile der Vanadat-
Anorganisches Praktikum 1. Semester. FB Chemieingenieurwesen. Labor für Anorg. Chemie Angew. Materialwiss. Versuchsvorschriften
 Anorganisches Praktikum 1. Semester FB Chemieingenieurwesen Labor für Anorg. Chemie Angew. Materialwiss. Versuchsvorschriften 1 Gravimetrie Bestimmung von Nickel Sie erhalten eine Lösung, die 0.1-0.2g
Anorganisches Praktikum 1. Semester FB Chemieingenieurwesen Labor für Anorg. Chemie Angew. Materialwiss. Versuchsvorschriften 1 Gravimetrie Bestimmung von Nickel Sie erhalten eine Lösung, die 0.1-0.2g
Technische Universität Chemnitz Chemisches Grundpraktikum
 Technische Universität Chemnitz Chemisches Grundpraktikum Protokoll «CfP5 - Massanalytische Bestimmungsverfahren (Volumetrie)» Martin Wolf Betreuerin: Frau Sachse Datum:
Technische Universität Chemnitz Chemisches Grundpraktikum Protokoll «CfP5 - Massanalytische Bestimmungsverfahren (Volumetrie)» Martin Wolf Betreuerin: Frau Sachse Datum:
Volumetrische Bestimmungsverfahren
 9 Die Titrimetrie oder Maßanalyse wurde 1830 von J.L. GAY-LUSSAC in die analytische Chemie eingeführt. Hierunter versteht man ein Verfahren zur quantitativen Bestimmung eines gelösten Stoffes durch Zugabe
9 Die Titrimetrie oder Maßanalyse wurde 1830 von J.L. GAY-LUSSAC in die analytische Chemie eingeführt. Hierunter versteht man ein Verfahren zur quantitativen Bestimmung eines gelösten Stoffes durch Zugabe
Wasser Kaffeefilter ein Streifen Filterpapier als Docht Schere Tasse
 Trennen von Farben Was Du brauchst: schwarzfarbige Filzstifte Wasser Kaffeefilter ein Streifen Filterpapier als Docht Schere Tasse Wie Du vorgehst: Schneide einen Kreis aus dem Kaffeefilter. Steche mit
Trennen von Farben Was Du brauchst: schwarzfarbige Filzstifte Wasser Kaffeefilter ein Streifen Filterpapier als Docht Schere Tasse Wie Du vorgehst: Schneide einen Kreis aus dem Kaffeefilter. Steche mit
Versuchsprotokoll. 1.) Versuch 2a: Quantitative Bestimmung der Atmung
 Versuchsprotokoll 1.) Versuch 2a: Quantitative Bestimmung der Atmung 1.1. Einleitung: Bei der aeroben Atmung, also dem oxidativen Abbau der Kohlenhydrate, entsteht im Citratzyklus und bei der oxidativen
Versuchsprotokoll 1.) Versuch 2a: Quantitative Bestimmung der Atmung 1.1. Einleitung: Bei der aeroben Atmung, also dem oxidativen Abbau der Kohlenhydrate, entsteht im Citratzyklus und bei der oxidativen
2. Bestimmen Sie die Geschwindigkeitskonstante k der Rohrzuckerinversion in s -1.
 Versuchsanleitungen zum Praktikum Physikalische Chemie für Anfänger 1 A 33 Spezifische Drehung von gelöstem Rohrzucker - Rohrzuckerinversion Aufgabe: 1. Bestimmen Sie den Drehwinkel α für Rohrzucker für
Versuchsanleitungen zum Praktikum Physikalische Chemie für Anfänger 1 A 33 Spezifische Drehung von gelöstem Rohrzucker - Rohrzuckerinversion Aufgabe: 1. Bestimmen Sie den Drehwinkel α für Rohrzucker für
Vergleich verschiedener Verfahren zur Bestimmung der schwefligen Säure
 Vergleich verschiedener Verfahren zur Bestimmung der schwefligen Säure Dr. Martin Pour Nikfardjam Staatliche Lehr- u. Versuchsanstalt für Wein- u. Obstbau Weinsberg Dr. Martin Pour Nikfardjam Inhalt Möglichkeiten
Vergleich verschiedener Verfahren zur Bestimmung der schwefligen Säure Dr. Martin Pour Nikfardjam Staatliche Lehr- u. Versuchsanstalt für Wein- u. Obstbau Weinsberg Dr. Martin Pour Nikfardjam Inhalt Möglichkeiten
Seminar zum Quantitativen Anorganischen Praktikum WS 2013/14
 Seminar zum Quantitativen Anorganischen Praktikum WS 2013/14 Teil des Moduls MN-C-AlC S. Sahler, M. Wolberg Inhalt Mittwoch, 08.01.2014, Allgemeine Einführung in die Quantitative Analyse Glasgeräte und
Seminar zum Quantitativen Anorganischen Praktikum WS 2013/14 Teil des Moduls MN-C-AlC S. Sahler, M. Wolberg Inhalt Mittwoch, 08.01.2014, Allgemeine Einführung in die Quantitative Analyse Glasgeräte und
Qualitative Analyse. - Identifikation von Ionen (häufig in einem Gemisch) - Charakterisierung der Analyse nach Farbe, Morphologie, Geruch,
 - Identifikation von Ionen (häufig in einem Gemisch) - Charakterisierung der Analyse nach Farbe, Morphologie, Geruch, Löslichkeit - charakteristische Nachweisreaktionen für Einzelionen: - Fällungsreaktionen
- Identifikation von Ionen (häufig in einem Gemisch) - Charakterisierung der Analyse nach Farbe, Morphologie, Geruch, Löslichkeit - charakteristische Nachweisreaktionen für Einzelionen: - Fällungsreaktionen
Kohlenhydrate in Lebensmitteln Schokolade ist nicht gleich Schokolade!
 Kohlenhydrate in Lebensmitteln ist nicht gleich! Einführung Sicher hast du schon davon gehört, dass es verschiedene Zuckerarten gibt. So gibt es Traubenzucker (Glucose), Fruchtzucker (Fructose) und natürlich
Kohlenhydrate in Lebensmitteln ist nicht gleich! Einführung Sicher hast du schon davon gehört, dass es verschiedene Zuckerarten gibt. So gibt es Traubenzucker (Glucose), Fruchtzucker (Fructose) und natürlich
Symposium der Vereinigung österreichischer Önologen und Weinforscher (VÖstÖF) am , Klosterneuburg
 Symposium der Vereinigung österreichischer Önologen und Weinforscher (VÖstÖF) am, Klosterneuburg HR Dipl.-Ing. Dr. Reinhard EDER HBLAuBA für Wein- und Obstbau, Klosterneuburg frühere Lesetermine höhere
Symposium der Vereinigung österreichischer Önologen und Weinforscher (VÖstÖF) am, Klosterneuburg HR Dipl.-Ing. Dr. Reinhard EDER HBLAuBA für Wein- und Obstbau, Klosterneuburg frühere Lesetermine höhere
ph-wert ph-wert eine Kenngröße für saure, neutrale oder basische Lösungen
 ph-wert ph-wert eine Kenngröße für saure, neutrale oder basische Lösungen ChemikerInnen verwenden den ph-wert um festzustellen, wie sauer oder basisch eine Lösung ist. Man verwendet eine Skala von 0-14:
ph-wert ph-wert eine Kenngröße für saure, neutrale oder basische Lösungen ChemikerInnen verwenden den ph-wert um festzustellen, wie sauer oder basisch eine Lösung ist. Man verwendet eine Skala von 0-14:
SS Thomas Schrader. der Universität Duisburg-Essen. (Teil 8: Redoxprozesse, Elektrochemie)
 Chemie für Biologen SS 2010 Thomas Schrader Institut t für Organische Chemie der Universität Duisburg-Essen (Teil 8: Redoxprozesse, Elektrochemie) Oxidation und Reduktion Redoxreaktionen: Ein Atom oder
Chemie für Biologen SS 2010 Thomas Schrader Institut t für Organische Chemie der Universität Duisburg-Essen (Teil 8: Redoxprozesse, Elektrochemie) Oxidation und Reduktion Redoxreaktionen: Ein Atom oder
Chemie entdecken. Mikrolabor Hefezelle. Christoph Rüthing. Experimentalwettbewerb der Klassenstufen 5-10 in NRW. Zum Thema. von
 Chemie entdecken Experimentalwettbewerb der Klassenstufen 5-10 in NRW Zum Thema Mikrolabor Hefezelle von Christoph Rüthing Versuch 1: Nach Hinzufügen der Hefe in die Zuckerlösung färbt sich das Gemisch
Chemie entdecken Experimentalwettbewerb der Klassenstufen 5-10 in NRW Zum Thema Mikrolabor Hefezelle von Christoph Rüthing Versuch 1: Nach Hinzufügen der Hefe in die Zuckerlösung färbt sich das Gemisch
Lösung 7. Allgemeine Chemie I Herbstsemester Je nach Stärke einer Säure tritt eine vollständige oder nur eine teilweise Dissoziation auf.
 Lösung 7 Allgemeine Chemie I Herbstsemester 2012 1. Aufgabe Je nach Stärke einer Säure tritt eine vollständige oder nur eine teilweise Dissoziation auf. Chlorwasserstoff ist eine starke Säure (pk a = 7),
Lösung 7 Allgemeine Chemie I Herbstsemester 2012 1. Aufgabe Je nach Stärke einer Säure tritt eine vollständige oder nur eine teilweise Dissoziation auf. Chlorwasserstoff ist eine starke Säure (pk a = 7),
RESOLUTION OIV-OENO 439-2012 ÖNOLOGISCHE PRAKTIKEN FÜR AROMATISIERTE WEINE, GETRÄNKE AUS WEINBAUERZEUGNISSEN UND WEINHALTIGE GETRÄNKE
 RESOLUTION OIV-OENO 439-2012 ÖNOLOGISCHE PRAKTIKEN FÜR AROMATISIERTE WEINE, GETRÄNKE AUS WEINBAUERZEUGNISSEN UND WEINHALTIGE GETRÄNKE Die Generalversammlung, UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der Resolution OIV-ECO
RESOLUTION OIV-OENO 439-2012 ÖNOLOGISCHE PRAKTIKEN FÜR AROMATISIERTE WEINE, GETRÄNKE AUS WEINBAUERZEUGNISSEN UND WEINHALTIGE GETRÄNKE Die Generalversammlung, UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der Resolution OIV-ECO
Fragen zum Versuch 11a Kinetik Rohrzuckerinversion:
 Fragen zum Versuch 11a Kinetik Rohrzuckerinversion: 1. Die Inversion von Rohrzucker ist: a. Die Umwandlung von Rohrzucker in Saccharose b. Die katalytische Spaltung in Glucose und Fructose c. Das Auflösen
Fragen zum Versuch 11a Kinetik Rohrzuckerinversion: 1. Die Inversion von Rohrzucker ist: a. Die Umwandlung von Rohrzucker in Saccharose b. Die katalytische Spaltung in Glucose und Fructose c. Das Auflösen
Online Projektlabor Chemie. Durchführung für die Spurenanalytik in Wasser
 Online Projektlabor Chemie Technische Universität Berlin Durchführung für die Spurenanalytik in Wasser Leitung des Projektlabores: Prof. Dr. Th. Friedrich Ersteller des Dokumentes: Daniel Christian Brüggemann
Online Projektlabor Chemie Technische Universität Berlin Durchführung für die Spurenanalytik in Wasser Leitung des Projektlabores: Prof. Dr. Th. Friedrich Ersteller des Dokumentes: Daniel Christian Brüggemann
Themengebiet: 1 HA + H 2 O A - + H 3 O + H 3 O + : Oxonium- oder Hydroxoniumion. Themengebiet: 2 B + H 2 O BH + + OH - OH - : Hydroxidion
 1 1 Säuren sind Protonendonatoren, d.h. Stoffe, die an einen Reaktionspartner ein oder mehrere Protonen abgeben können; Säuredefinition nach Brönsted Im Falle von Wasser: HA + H 2 O A - + H 3 O + H 3 O
1 1 Säuren sind Protonendonatoren, d.h. Stoffe, die an einen Reaktionspartner ein oder mehrere Protonen abgeben können; Säuredefinition nach Brönsted Im Falle von Wasser: HA + H 2 O A - + H 3 O + H 3 O
Versuchsanleitungen zum Praktikum Physikalische Chemie für Anfänger 1. Lambert Beer sches Gesetz - Zerfall des Manganoxalations
 Versuchsanleitungen zum Praktikum Physikalische Chemie für Anfänger 1 A 34 Lambert Beer sches Gesetz - Zerfall des Manganoxalations Aufgabe: 1. Bestimmen Sie die Wellenlänge maximaler Absorbanz λ max eines
Versuchsanleitungen zum Praktikum Physikalische Chemie für Anfänger 1 A 34 Lambert Beer sches Gesetz - Zerfall des Manganoxalations Aufgabe: 1. Bestimmen Sie die Wellenlänge maximaler Absorbanz λ max eines
+ MnO MnO 3. Oxidierbarkeit primärer, sekundärer und tertiärer Alkohole. Chemikalien. Materialien
 DaChS xidierbarkeit primärer, sekundärer und tertiärer Alkohole 1 Versuch Nr. 005 xidierbarkeit primärer, sekundärer und tertiärer Alkohole C 3 Mn - 4 (violett) 3 C Mn 2 (braun) 3 C C 3 Mn - 4 (violett)
DaChS xidierbarkeit primärer, sekundärer und tertiärer Alkohole 1 Versuch Nr. 005 xidierbarkeit primärer, sekundärer und tertiärer Alkohole C 3 Mn - 4 (violett) 3 C Mn 2 (braun) 3 C C 3 Mn - 4 (violett)
ph-messung mit Glaselektrode: Bestimmung der Dissoziationskonstanten schwacher Säuren durch Titrationskurven
 Übungen in physikalischer Chemie für Studierende der Pharmazie Versuch Nr.: 11 Version 2016 Kurzbezeichnung: ph-messung ph-messung mit Glaselektrode: Bestimmung der Dissoziationskonstanten schwacher Säuren
Übungen in physikalischer Chemie für Studierende der Pharmazie Versuch Nr.: 11 Version 2016 Kurzbezeichnung: ph-messung ph-messung mit Glaselektrode: Bestimmung der Dissoziationskonstanten schwacher Säuren
Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
 Fehlaroma: Pentadien Pentadien (ein Kohlenwasserstoff) wird aus dem zugelassenen Konservierungsmittel Sorbinsäure gebildet. Der Abbau von Sorbinsäure wird durch Schimmelpilze verursacht. Die Bildung von
Fehlaroma: Pentadien Pentadien (ein Kohlenwasserstoff) wird aus dem zugelassenen Konservierungsmittel Sorbinsäure gebildet. Der Abbau von Sorbinsäure wird durch Schimmelpilze verursacht. Die Bildung von
Klausur in Anorganischer Chemie
 1 Klausur in Anorganischer Chemie zum Praktikum Chemie für Biologen, SS2000 Kurse SS Sa 20.05.2000 Name:... Vorname:... Wenn Nachschreiber aus einem der Vorkurse, bitte eintragen: Geb. am in Semester des
1 Klausur in Anorganischer Chemie zum Praktikum Chemie für Biologen, SS2000 Kurse SS Sa 20.05.2000 Name:... Vorname:... Wenn Nachschreiber aus einem der Vorkurse, bitte eintragen: Geb. am in Semester des
Anorganisch-chemisches Praktikum für Human- und Molekularbiologen
 Anorganisch-chemisches Praktikum für uman- und Molekularbiologen. Praktikumstag Andreas Rammo Allgemeine und Anorganische Chemie Universität des Saarlandes E-Mail: a.rammo@mx.uni-saarland.de Säure-Base-Definition
Anorganisch-chemisches Praktikum für uman- und Molekularbiologen. Praktikumstag Andreas Rammo Allgemeine und Anorganische Chemie Universität des Saarlandes E-Mail: a.rammo@mx.uni-saarland.de Säure-Base-Definition
Versuch 6.14 ph-abhängigkeit eines Indikators am Beispiel Thymolblau
 Versuch 6.14 ph-abhängigkeit eines Indikators am Beispiel Thymolblau Einleitung Lösungen mit verschiedenen ph-werten von stark sauer bis stark basisch werden mit gleich viel Thymolblau-Lösung versetzt.
Versuch 6.14 ph-abhängigkeit eines Indikators am Beispiel Thymolblau Einleitung Lösungen mit verschiedenen ph-werten von stark sauer bis stark basisch werden mit gleich viel Thymolblau-Lösung versetzt.
Harnstoffspaltung durch Urease
 Martin Raiber Chemie Protokoll Nr.5 Harnstoffspaltung durch Urease Versuch 1: Materialien: Reagenzglasgestell, Reagenzgläser, Saugpipetten, 100 ml-becherglas mit Eiswasser, 100 ml-becherglas mit Wasser
Martin Raiber Chemie Protokoll Nr.5 Harnstoffspaltung durch Urease Versuch 1: Materialien: Reagenzglasgestell, Reagenzgläser, Saugpipetten, 100 ml-becherglas mit Eiswasser, 100 ml-becherglas mit Wasser
Saurer Regen, was ist das?
 Saurer Regen, was ist das? 1. SO x (x=2,3) => SO 2 und SO 3 SO 2 + H 2 O H 2 SO 3 (schwefelige Säure) SO 3 + H 2 O H 2 SO 4 (Schwefelsäure) 2. NO x (x=1,2) 2 NO + H 2 O + ½O 2 2 H NO 2 (salpetrige Säure)
Saurer Regen, was ist das? 1. SO x (x=2,3) => SO 2 und SO 3 SO 2 + H 2 O H 2 SO 3 (schwefelige Säure) SO 3 + H 2 O H 2 SO 4 (Schwefelsäure) 2. NO x (x=1,2) 2 NO + H 2 O + ½O 2 2 H NO 2 (salpetrige Säure)
Österreichisches Lebensmittelbuch. IV. Auflage Kapitel / B 3 / Honig und andere Imkereierzeugnisse
 Österreichisches Lebensmittelbuch IV. Auflage Kapitel / B 3 / Honig und andere Imkereierzeugnisse Veröffentlicht mit Geschäftszahl: BMG-75210/0003-II/B/13/2015 vom 21.01.2015 INHALTSVERZEICHNIS Seite:
Österreichisches Lebensmittelbuch IV. Auflage Kapitel / B 3 / Honig und andere Imkereierzeugnisse Veröffentlicht mit Geschäftszahl: BMG-75210/0003-II/B/13/2015 vom 21.01.2015 INHALTSVERZEICHNIS Seite:
LEE2: 2. Messung der Molrefraktion der Flüssigkeiten für die Bestimmung der Qualität des Rohmaterials
 ŠPŠCH Brno Erarbeitung berufspädagogischer Konzepte für die beruflichen Handlungsfelder Arbeiten im Chemielabor und Operator Angewandte Chemie und Lebensmittelanalyse LEE2: 2. Messung der Molrefraktion
ŠPŠCH Brno Erarbeitung berufspädagogischer Konzepte für die beruflichen Handlungsfelder Arbeiten im Chemielabor und Operator Angewandte Chemie und Lebensmittelanalyse LEE2: 2. Messung der Molrefraktion
Säureregulierung bei Wein
 Säureregulierung bei Wein Entsäuerung eine Herausforderung für weinausbauende Betriebe? VOENOS am 29.10.2010 Entsäuerungs-Workshop Fachzentrum Analytik Dr. Martin Geßner Klimawandel Klimawandel bedeutet
Säureregulierung bei Wein Entsäuerung eine Herausforderung für weinausbauende Betriebe? VOENOS am 29.10.2010 Entsäuerungs-Workshop Fachzentrum Analytik Dr. Martin Geßner Klimawandel Klimawandel bedeutet
Zeit [h] Höchste Gäraktivität. Gäraktivität [(mg/ml)/h]
![Zeit [h] Höchste Gäraktivität. Gäraktivität [(mg/ml)/h] Zeit [h] Höchste Gäraktivität. Gäraktivität [(mg/ml)/h]](/thumbs/58/41417451.jpg) Johannes Gutenberg-Universität Mainz Institut für Mikrobiologie und Weinforschung FI-Übung: Identifizierung, Wachstum und Regulation (WS 2004/05) Sebastian Lux Datum: 15.2.2005 1. Gärungsbilanz 1. Theoretische
Johannes Gutenberg-Universität Mainz Institut für Mikrobiologie und Weinforschung FI-Übung: Identifizierung, Wachstum und Regulation (WS 2004/05) Sebastian Lux Datum: 15.2.2005 1. Gärungsbilanz 1. Theoretische
Es soll eine schriftliche Ausarbeitung abgegeben werden (1 Exemplar pro Gruppe).
 Gruppe 1 Thema: Wissenswertes über Essig 1. Bestimme den ph-wert von Haushaltsessig. 2. Wie viel Essigsäure (in mol/l und in g/l) ist in Haushaltsessig enthalten? 3. Wie wird Essigsäure hergestellt (Ausgangsstoffe,
Gruppe 1 Thema: Wissenswertes über Essig 1. Bestimme den ph-wert von Haushaltsessig. 2. Wie viel Essigsäure (in mol/l und in g/l) ist in Haushaltsessig enthalten? 3. Wie wird Essigsäure hergestellt (Ausgangsstoffe,
Dünnschichtchromatographie
 PB III/Seminar DC Dünnschichtchromatographie Dr. Johanna Liebl Chromatographie - Prinzip physikalisch-chemische Trennmethoden Prinzip: Verteilung von Substanzen zwischen einer ruhenden (stationären) und
PB III/Seminar DC Dünnschichtchromatographie Dr. Johanna Liebl Chromatographie - Prinzip physikalisch-chemische Trennmethoden Prinzip: Verteilung von Substanzen zwischen einer ruhenden (stationären) und
Typische Fragen für den Gehschul-Teil: Typ 1: Mengen und Konzentrationen:
 Die Gehschule ist ein Teil der Biochemischen Übungen für das Bakkalaureat LMBT. Aus organisatorischen Gründen wird dieser Test gleichzeitig mit der Prüfung aus Grundlagen der Biochemie angeboten. Das Abschneiden
Die Gehschule ist ein Teil der Biochemischen Übungen für das Bakkalaureat LMBT. Aus organisatorischen Gründen wird dieser Test gleichzeitig mit der Prüfung aus Grundlagen der Biochemie angeboten. Das Abschneiden
Organische Hilfsstoffe/Ascorbinsäure
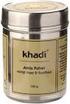 ZUCKER Organische Hilfsstoffe/Ascorbinsäure Teil I Gestermann L., Lehmann S., Pick A. Stein G., Fleischer R., Wiese M. Pharmazeutische Chemie Endenich Universität Bonn, FRG Bearbeitet wurden folgende Substanzen:
ZUCKER Organische Hilfsstoffe/Ascorbinsäure Teil I Gestermann L., Lehmann S., Pick A. Stein G., Fleischer R., Wiese M. Pharmazeutische Chemie Endenich Universität Bonn, FRG Bearbeitet wurden folgende Substanzen:
3. Seminar zum Quantitativen Anorganischen Praktikum WS 2013/14
 3. Seminar zum Quantitativen Anorganischen Praktikum WS 2013/14 Teil des Moduls MN-C-AlC S. Sahler, M. Wolberg 20.01.14 Titrimetrie (Volumetrie) Prinzip: Messung des Volumenverbrauchs einer Reagenslösung
3. Seminar zum Quantitativen Anorganischen Praktikum WS 2013/14 Teil des Moduls MN-C-AlC S. Sahler, M. Wolberg 20.01.14 Titrimetrie (Volumetrie) Prinzip: Messung des Volumenverbrauchs einer Reagenslösung
ph-wertsenkung im Most: Kationentauscher als Alternative zur Weinsäure
 ph-wertsenkung im Most: Kationentauscher als Alternative zur Weinsäure Konrad Pixner Ulrich Pedri Sektion Kellerwirtschaft Marling, 20. August 2014 1 Blauburgunder Kastelbell Reifedaten vom 2. Montag im
ph-wertsenkung im Most: Kationentauscher als Alternative zur Weinsäure Konrad Pixner Ulrich Pedri Sektion Kellerwirtschaft Marling, 20. August 2014 1 Blauburgunder Kastelbell Reifedaten vom 2. Montag im
Chemiebuch Elemente Lösungen zu Aufgaben aus Kapitel 13
 Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Chemiebuch Elemente Lösungen zu Aufgaben aus Kapitel 13 Grundregeln für stöchiometrische Berechnungen Wenn es um Reaktionen geht zuerst die chem. Gleichung aufstellen
Kantonsschule Kreuzlingen, Klaus Hensler Chemiebuch Elemente Lösungen zu Aufgaben aus Kapitel 13 Grundregeln für stöchiometrische Berechnungen Wenn es um Reaktionen geht zuerst die chem. Gleichung aufstellen
Flüchtige organische Säuren. Skript Kapitel 5.5.2, Seite 108
 Flüchtige organische Säuren Skript Kapitel 5.5.2, Seite 108 201409_V1_#1 Schlammfaulung allgemein Die Schlammfaulung dient der Stabilisierung von Klärschlämmen Dazu wird eine anaerobe (sauerstofffreie)
Flüchtige organische Säuren Skript Kapitel 5.5.2, Seite 108 201409_V1_#1 Schlammfaulung allgemein Die Schlammfaulung dient der Stabilisierung von Klärschlämmen Dazu wird eine anaerobe (sauerstofffreie)
Alles was uns umgibt!
 Was ist Chemie? Womit befasst sich die Chemie? Die Chemie ist eine Naturwissenschaft, die sich mit der Materie (den Stoffen), ihren Eigenschaften und deren Umwandlung befasst Was ist Chemie? Was ist Materie?
Was ist Chemie? Womit befasst sich die Chemie? Die Chemie ist eine Naturwissenschaft, die sich mit der Materie (den Stoffen), ihren Eigenschaften und deren Umwandlung befasst Was ist Chemie? Was ist Materie?
Michaelis-Menten-Gleichung
 Physikalisch-Chemische Praktika Michaelis-Menten-Gleichung Versuch K4 1 Aufgabe Experimentelle Bestimmung der Kinetik der Zersetzung von Harnsto durch Urease. 2 Grundlagen Im Bereich der Biochemie spielen
Physikalisch-Chemische Praktika Michaelis-Menten-Gleichung Versuch K4 1 Aufgabe Experimentelle Bestimmung der Kinetik der Zersetzung von Harnsto durch Urease. 2 Grundlagen Im Bereich der Biochemie spielen
G1 pk S -Wert Bestimmung der Essigsäure
 G1 pk S -Wert Bestimmung der Essigsäure Bürette Rührer, Rührfisch ph-meter mit Einstabmesskette Stativ Becherglas Essigsäure H: 226, 314 P: 210, 260, 280.1+3, 303+361+353, 304+340, 305+351+338, 310 Phenolphthalein
G1 pk S -Wert Bestimmung der Essigsäure Bürette Rührer, Rührfisch ph-meter mit Einstabmesskette Stativ Becherglas Essigsäure H: 226, 314 P: 210, 260, 280.1+3, 303+361+353, 304+340, 305+351+338, 310 Phenolphthalein
Ethylcarbamat in Steinobstbränden
 Ethylcarbamat in Steinobstbränden Entstehung und Vermeidung C. Athanasakis 11.02.2003 1 Einstufung von Ethylcarbamat Ethylcarbamat ist eine genotoxische, kanzerogene Substanz, die insbesondere bei Steinobstbränden
Ethylcarbamat in Steinobstbränden Entstehung und Vermeidung C. Athanasakis 11.02.2003 1 Einstufung von Ethylcarbamat Ethylcarbamat ist eine genotoxische, kanzerogene Substanz, die insbesondere bei Steinobstbränden
Studienbegleitende Prüfung Anorganisch-Chemisches Grundpraktikum WS 2005/
 Klausur zum Anorganisch-Chemischen Grundpraktikum vom 07.04.06 Seite 1 von 10 Studienbegleitende Prüfung Anorganisch-Chemisches Grundpraktikum WS 2005/2006 07.04.2006 Matrikelnummer: Name: Vorname: Bitte
Klausur zum Anorganisch-Chemischen Grundpraktikum vom 07.04.06 Seite 1 von 10 Studienbegleitende Prüfung Anorganisch-Chemisches Grundpraktikum WS 2005/2006 07.04.2006 Matrikelnummer: Name: Vorname: Bitte
Übung zum chemischen Praktikum für Studierende mit Chemie als Nebenfach Übung Nr. 2,
 Übung zum chemischen Praktikum für Studierende mit Chemie als Nebenfach Übung Nr., 6.04.11 1. Sie legen 100 ml einer 0, mol/l Natronlauge vor. Als Titrant verwenden Sie eine 0,8 mol/l Salzsäure. Berechnen
Übung zum chemischen Praktikum für Studierende mit Chemie als Nebenfach Übung Nr., 6.04.11 1. Sie legen 100 ml einer 0, mol/l Natronlauge vor. Als Titrant verwenden Sie eine 0,8 mol/l Salzsäure. Berechnen
NAD+/NADH ADH CH 3 CH 2 OH + NAD + CH 3 CHO + NADH + H + Hier unterscheiden sich Ethanol und NAD + in der Tat funktionell nicht.
 NAD+/NADH NAD + (Nicotinamid-adenin-dinukleotid) ist das häufigste "Coenzym" enzymatischer Redox-reaktionen. Von den Lehrbüchern wird es teils als Coenzym, teils als Cosubstrat eingeordnet. Das erstere
NAD+/NADH NAD + (Nicotinamid-adenin-dinukleotid) ist das häufigste "Coenzym" enzymatischer Redox-reaktionen. Von den Lehrbüchern wird es teils als Coenzym, teils als Cosubstrat eingeordnet. Das erstere
Alkoholmessgerät für Wein. Alcolyzer Wine
 Alkoholmessgerät für Wein Alcolyzer Wine Alkoholbestimmung und mehr Die Bestimmung des Alkoholgehaltes zählt bei Herstellern von Wein, Apfelwein und ähnlichen Produkten zu den alltäglichen Untersuchungen.
Alkoholmessgerät für Wein Alcolyzer Wine Alkoholbestimmung und mehr Die Bestimmung des Alkoholgehaltes zählt bei Herstellern von Wein, Apfelwein und ähnlichen Produkten zu den alltäglichen Untersuchungen.
Chemisches Grundpraktikum für Ingenieure. 2. Praktikumstag. Andreas Rammo
 Chemisches Grundpraktikum für Ingenieure. Praktikumstag Andreas Rammo Allgemeine und Anorganische Chemie Universität des Saarlandes E-Mail: a.rammo@mx.uni-saarland.de Das chemische Gleichgewicht Säure-Base-Reaktionen
Chemisches Grundpraktikum für Ingenieure. Praktikumstag Andreas Rammo Allgemeine und Anorganische Chemie Universität des Saarlandes E-Mail: a.rammo@mx.uni-saarland.de Das chemische Gleichgewicht Säure-Base-Reaktionen
Trennungen, Mehrkomponenten-Bestimmungen 65
 Trennungen, Mehrkomponenten-Bestimmungen 65 Versuch 311 Hydrolysentrennung von Eisen und Magnesium Arbeitsanleitung Geräte: Bunsenbrenner, Dreifuß, Ceranplatte, 20-mL-Vollpipette, Messzylinder, 600-mL-Bechergläser,
Trennungen, Mehrkomponenten-Bestimmungen 65 Versuch 311 Hydrolysentrennung von Eisen und Magnesium Arbeitsanleitung Geräte: Bunsenbrenner, Dreifuß, Ceranplatte, 20-mL-Vollpipette, Messzylinder, 600-mL-Bechergläser,
Kapitel 13: Laugen und Neutralisation
 Kapitel 13: Laugen und Neutralisation Alkalimetalle sind Natrium, Kalium, Lithium (und Rubidium, Caesium und Francium). - Welche besonderen Eigenschaften haben die Elemente Natrium, Kalium und Lithium?
Kapitel 13: Laugen und Neutralisation Alkalimetalle sind Natrium, Kalium, Lithium (und Rubidium, Caesium und Francium). - Welche besonderen Eigenschaften haben die Elemente Natrium, Kalium und Lithium?
Einfache DOC- und TOC-Bestimmung im Abwasser
 Vollzug Umwelt MITTEILUNGEN ZUM GEWÄSSERSCHUTZ NR. 28 Einfache DOC- und TOC-Bestimmung im Abwasser Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL Herausgeber Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft
Vollzug Umwelt MITTEILUNGEN ZUM GEWÄSSERSCHUTZ NR. 28 Einfache DOC- und TOC-Bestimmung im Abwasser Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL Herausgeber Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft
Versuch 1: Extraktion von ß-Carotin aus Lebensmitteln
 Name Datum Versuch 1: Extraktion von aus Lebensmitteln Geräte: 4 Reagenzgläser, 4 Gummistopfen, Reagenzglasständer, 1 Erlenmeyerkolben mit Stopfen, Messer, Mörser, Spatel, Messpipette, 1 kleine Petrischale,
Name Datum Versuch 1: Extraktion von aus Lebensmitteln Geräte: 4 Reagenzgläser, 4 Gummistopfen, Reagenzglasständer, 1 Erlenmeyerkolben mit Stopfen, Messer, Mörser, Spatel, Messpipette, 1 kleine Petrischale,
Der Messkolben wird mit dest. Wasser auf 250 ml aufgefüllt und gut geschüttelt, damit die
 Versuch 1: Acidimetrie Titration von NaOH Der Messkolben wird mit dest. Wasser auf 250 ml aufgefüllt und gut geschüttelt, damit die Lösung homogen wird. Mit einer 50 ml Vollpipette werden 50 ml in einen
Versuch 1: Acidimetrie Titration von NaOH Der Messkolben wird mit dest. Wasser auf 250 ml aufgefüllt und gut geschüttelt, damit die Lösung homogen wird. Mit einer 50 ml Vollpipette werden 50 ml in einen
Bestimmung des Stickstoffgehalts von Erde
 Bestimmung des Stickstoffgehalts von Erde Schülerversuch, ca. 25 Minuten Experiment Teil 1 Material und Chemikalien: Ofentrockene Erde Kaliumchloridlösung (c = 2 mol/l) Flasche (250 ml) Trichter Filterpapier
Bestimmung des Stickstoffgehalts von Erde Schülerversuch, ca. 25 Minuten Experiment Teil 1 Material und Chemikalien: Ofentrockene Erde Kaliumchloridlösung (c = 2 mol/l) Flasche (250 ml) Trichter Filterpapier
Institut für Lebensmittelchemie und Arzneimittelprüfung Mainz
 Institut für Lebensmittelchemie und Arzneimittelprüfung Mainz Dr. Christine Schleich Wein mit Vanillearoma Bestimmung von Vanillin in Wein mittels HPLC-DAD Inhalt Allgemeines Fall 1: Chips-Behandlung Fall
Institut für Lebensmittelchemie und Arzneimittelprüfung Mainz Dr. Christine Schleich Wein mit Vanillearoma Bestimmung von Vanillin in Wein mittels HPLC-DAD Inhalt Allgemeines Fall 1: Chips-Behandlung Fall
Photometrische Bestimmung von D-Glucose
 Photometrische Bestimmung von D-Glucose Spezial/Multiwellenlängen- Methode mit WTW photolab UV-VIS Spektralphotometern 2015 WTW GmbH. Juli 2015 Photometrische Bestimmung von D-Glucose Photometer Test Methode
Photometrische Bestimmung von D-Glucose Spezial/Multiwellenlängen- Methode mit WTW photolab UV-VIS Spektralphotometern 2015 WTW GmbH. Juli 2015 Photometrische Bestimmung von D-Glucose Photometer Test Methode
7.2.1 Nitrierung von Toluol zu 2-Nitrotoluol (1a), 4-Nitrotoluol (1b) und 2,4-Dinitrotoluol
 7.2.1 Nitrierung von Toluol zu 2-Nitrotoluol (1a), 4-Nitrotoluol (1b) und 2,4-Dinitrotoluol (1c) HNO 3, H 2 SO 4 + + C 7 H 8 (92.1) HNO 3 (63.0) H 2 SO 4 (98.1) 1a 1b 1c C 7 H 7 (137.1) C 7 H 6 N 2 O 4
7.2.1 Nitrierung von Toluol zu 2-Nitrotoluol (1a), 4-Nitrotoluol (1b) und 2,4-Dinitrotoluol (1c) HNO 3, H 2 SO 4 + + C 7 H 8 (92.1) HNO 3 (63.0) H 2 SO 4 (98.1) 1a 1b 1c C 7 H 7 (137.1) C 7 H 6 N 2 O 4
Alkohol- und Extraktmessgerät für Wein. Alex 500
 Alkohol- und Extraktmessgerät für Wein Alex 500 Dein Wein dein Stil Bestimmen Sie den Alkohol- und Gesamtextraktgehalt Ihres Weins, wann immer Sie möchten. Mit dem Alkohol- und Extraktmessgerät Alex 500
Alkohol- und Extraktmessgerät für Wein Alex 500 Dein Wein dein Stil Bestimmen Sie den Alkohol- und Gesamtextraktgehalt Ihres Weins, wann immer Sie möchten. Mit dem Alkohol- und Extraktmessgerät Alex 500
Photochemische Reaktion
 TU Ilmenau Chemisches Praktikum Versuch Fachgebiet Chemie 1. Aufgabe Photochemische Reaktion V5 Es soll die Reduktion des Eisen(III)-trisoxalats nach Gleichung (1) unter der Einwirkung von Licht untersucht
TU Ilmenau Chemisches Praktikum Versuch Fachgebiet Chemie 1. Aufgabe Photochemische Reaktion V5 Es soll die Reduktion des Eisen(III)-trisoxalats nach Gleichung (1) unter der Einwirkung von Licht untersucht
Projekt- Nachweisreaktionen. Dieses Skript gehört: NaT-Lab für Schülerinnen und Schüler Johannes Gutenberg-Universität Mainz
 Projekt- Nachweisreaktionen NaT-Lab für Schülerinnen und Schüler Johannes Gutenberg-Universität Mainz Dieses Skript gehört: 1 Nachweise von Anionen 1. Nachweis von Sulfat 3 Reagenzgläser im Reagenzglasständer
Projekt- Nachweisreaktionen NaT-Lab für Schülerinnen und Schüler Johannes Gutenberg-Universität Mainz Dieses Skript gehört: 1 Nachweise von Anionen 1. Nachweis von Sulfat 3 Reagenzgläser im Reagenzglasständer
Universität der Pharmazie
 Universität der Pharmazie Institut für Pharmazie Pharmazie-Straße 1 12345 Pharmastadt Identitäts-, Gehalts- und Reinheitsbestimmung von Substanzen in Anlehnung an Methoden des Europäischen Arzneibuchs
Universität der Pharmazie Institut für Pharmazie Pharmazie-Straße 1 12345 Pharmastadt Identitäts-, Gehalts- und Reinheitsbestimmung von Substanzen in Anlehnung an Methoden des Europäischen Arzneibuchs
Zuckernachweis mit Tollens-Reagenz
 Zuckernachweis mit Tollens-Reagenz Betriebsanweisung nach 0 Gefahrstoffverordnung Verwendete Chemikalien Bezeichnung R-Sätze S-Sätze Gefährlichkeitsmerkmale Silbernitrat (öllenstein) AgN 3 3-0/3 6--60-61
Zuckernachweis mit Tollens-Reagenz Betriebsanweisung nach 0 Gefahrstoffverordnung Verwendete Chemikalien Bezeichnung R-Sätze S-Sätze Gefährlichkeitsmerkmale Silbernitrat (öllenstein) AgN 3 3-0/3 6--60-61
Säure-Base-Titrationen
 Säure-Base-Titrationen Dieses Skript gehört: Säure Base - Titrationen Seite 2 Hinweis: Mit den Säuren und Basen ist vorsichtig umzugehen, um Verätzungen zu vermeiden! Versuch 1: Herstellen einer Natronlauge
Säure-Base-Titrationen Dieses Skript gehört: Säure Base - Titrationen Seite 2 Hinweis: Mit den Säuren und Basen ist vorsichtig umzugehen, um Verätzungen zu vermeiden! Versuch 1: Herstellen einer Natronlauge
