Die Evolution des Geruchssinns Olfactory system evolution in insects
|
|
|
- Tristan Kaufman
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Die Evolution des Geruchssinns Olfactory system evolution in insects Grunwald-Kadow, Ilona Max-Planck-Institut für Neurobiologie, Martinsried Korrespondierender Autor Zusammenfassung Insekten nutzen ihren Geruchssinn, um Futter, Feinde oder Paarungspartner zu finden. Dabei ist Kohlendioxid ein wichtiger Botenstoff. Interessanterweise lehnen Fliegen ihn ab und fliehen. Mücken hingegen nutzen ihn, um Menschen bzw. Tiere zum Stechen und Blutsaugen aufzuspüren. CO 2 und seine Detektion in Insekten wird intensiv untersucht, da man hofft, zur Ausrottung von Krankheiten wie Malaria beitragen zu können. Bestimmte Gene könnten in der Evolution eine wichtige Rolle dabei gespielt haben, dass Mücken und Fliegen CO 2 so gegensätzlich wahrnehmen können. Summary Insects use their sense of smell to find food, mating partners or to avoid danger. Carbon dioxide is an important cue for insects. Interestingly, fruitflies reject it strongly, while mosquitoes use it to find human or animal hosts for blood feeding. CO 2 and its detection is a field of active research, because we hope to contribute knowledge to the fight against malaria and other deadly diseases. Certain genes could have played an important role during evolution making mosquitoes attracted and fruitflies repelled by CO 2. Es ist allgemein bekannt, dass der Geruchssinn bei vielen Säugetieren, wie etwa Hunden, sehr gut ausgeprägt ist und eine wichtige Rolle spielt. Über die Nasen von Insekten hingegen wissen die meisten nur wenig. Die Arbeitsgruppe von Ilona Grunwald-Kadow am Max-Planck-Institut für Neurobiologie erforscht den Geruchssinn und die Verarbeitung von Gerüchen im Gehirn von Insekten. Konkret wollen die Wissenschaftler verstehen, wie Gene den Aufbau eines Nervensystems kontrollieren, welches Gen ein bestimmtes Verhalten steuert. Die Gruppe hat untersucht, wie Gene über ihre Bildung oder Nicht-Bildung bestimmen könnten, wie sich ein Insekt nach Duftkontakt verhalten wird. Warum Insekten? Eine ganze Reihe guter Gründe hat vor einigen Jahrzehnten besonders ein Insekt in den Blickpunkt von Naturwissenschaftlern in der ganzen Welt gerückt: die Fruchtfliege Drosophila melanogaster. Die etwa 2,5 mm große Fliege mit den knallroten Augen hat nicht nur ein sehr kompaktes Nervensystem, sondern auch eine Erbinformation, die der unsrigen sehr ähnlich ist. Mit anderen Worten heißt das, dass ein Gen mit hoher Wahrscheinlichkeit in Drosophila fundamental genau das Gleiche macht wie in der Maus, dem Hund oder dem Menschen. Anders als Maushaltung ist die Haltung von Fliegen im Labor denkbar einfach und 2012 Max-Planck-Gesellschaft 1/5
2 kostengünstig. Anhand von Gentechnik in Fliegen haben Wissenschaftler Erstaunliches über die Funktion der menschlichen Gene gelernt. In den letzten Jahren ist die Fruchtfliege mehr und mehr auch in den Fokus der Neurobiologen gerückt. Intensive Verhaltensstudien zeigten, dass Fliegen und andere Insekten ein ausgeprägtes Seh- und Geruchssystem besitzen und sogar lernen können. Riechen mit Antennen die Nase der Insekten A bb. 1: Das Geruchssystem der Fruchtfliege. Duftneurone befinden sich auf Antennen und Maxillen. Sie schicken Inform ationen m it den Axonen in den sogenannten Antennallobus im Gehirn der Fliege. Duftneurone befinden sich in Sensillen (rechts). Max-Planck-Institut für Neurobiologie/Purayil Ein weiterer Vorteil an der Arbeit mit Fliegen besteht für die Kadow-Gruppe darin, dass der Geruchssinn von Insekten dem des Menschen sehr ähnlich ist. Betrachtet man eine Fliege von außen, überwiegen die deutlichen Unterschiede. Insekten und somit auch Drosophila riechen mit ihren Antennen oder einem weiteren Geruchsorgan, der sogenannten Maxille (Abb. 1). Und obwohl diese externen Geruchsorgane so unterschiedlich aussehen, sind die molekularen Vorgänge des Riechens vergleichbar. Riechzellen, auch Geruchsneurone genannt, produzieren Oberflächenproteine, die Duftrezeptoren, die bestimmte Duftstoffe binden und als Signal in die Riechzelle weiterleiten können. Um möglichst viele verschiedene Düfte wahrnehmen und unterscheiden zu können, bildet jede Riechzelle oder eine kleine Gruppe von Riechzellen eine eigene Version dieses Duftrezeptors. Um die Information über die Duftumgebung zu verarbeiten, senden Riechzellen Nerven in das Gehirn. Dort bilden sie mit anderen weiterverarbeitenden Neuronen eine Schaltstelle, auch Synapse genannt. Damit das Hirn die Duftinformation weiterverarbeiten kann, wird die Duftumgebung aus einem Mix an Duftstoffen in eine räumliche Karte umgewandelt. Mit anderen Worten: Vanilleduft aktiviert eine Gruppe von Neuronen im Gehirn, die räumlich von denen getrennt sind, die Schwefelduft erkennen. Dieser geniale Trick wird in einer Hirnstruktur verwirklicht, die beim Menschen olfaktorischer Bulbus und bei Insekten Antennallobus heißt (Abb. 1). Beide Strukturen bilden sogenannte Glomeruli, knotenartige Ansammlungen von Nervenenden-, die von einem duftabhängigen Code aktiviert werden. Sobald ein Duft oder ein Duftgemisch einen oder mehrere dieser Glomeruli aktiviert hat, werden die Signale durch weitere Neurone in einer Glomerulus-abhängigen Weise an die höheren Hirnzentren weitergegeben. In den höheren Hirnstrukturen werden dann weitere Informationen, wie z. B. visueller Input und Erinnerungen mitverarbeitet, um ein der Situation angemessenes Verhalten zu initiieren. CO 2 anziehend oder abstoßend? 2012 Max-Planck-Gesellschaft 2/5
3 A bb. 2: CO 2 hat eine unterschiedliche Bedeutung für Mücken und Fliegen. Fliegen besitzen CO 2- Neurone auf ihren Antennen. Bei Mücken befinden sich diese auf den Maxillen. Fliegen fliehen vor CO 2, wohingegen Mücken es nutzen, um Menschen und Tiere aufzustöbern. Ein sim pler Verhaltenstest, der T-m aze, kann im Labor genutzt werden. Tiere haben die Möglichkeit, zwischen zwei Röhrchen, gefüllt m it Luft oder CO 2, zu wählen. Max-Planck-Institut für Neurobiologie/Gom pel; Bild der Mücke aus /2012/02/healthtip-yoong-m eans-m osquito.htm l/ Natürlicherweise haben verschiedene Düfte eine unterschiedliche Bedeutung für ein bestimmtes Tier oder den Menschen. Manche Bedeutungen sind erlernt, andere sind rein instinktiv und angeboren. Zu den Düften, die ein starkes angeborenes Verhalten auslösen, gehört Kohlendioxid (CO 2 ). Bei vielen Tieren und auch beim Menschen können hohe Konzentrationen an CO 2 Fluchtverhalten oder sogar Panikattacken auslösen. Ein Grund für dieses Verhalten ist möglicherweise, dass hohe Konzentrationen von CO 2 ein Indiz für eine niedrige Sauerstoffkonzentration sein können. Die Fliege Drosophila reagiert ähnlich und flüchtet schon vor relativ niedrigen Konzentrationen an CO 2 (Abb. 2). Interessanterweise reagieren einige Insekten genau umgekehrt: Sie lieben CO 2. Ein bekanntes und wichtiges Beispiel ist die blutsaugende Mücke (Abb. 2). Mücken nutzen CO 2, um Menschen bzw. Tiere zu lokalisieren. Ein Mensch atmet ca. 4-5 Prozent CO 2 mit jedem Atemzug aus. Mücken können schon ein Zehntel davon detektieren und daher über längere Distanzen die CO 2 -Quelle aufstöbern. Das heißt, dass bei zwei Insekten, die ungefähr 250 Millionen Jahre Evolution trennen, ein komplett entgegengesetztes Verhalten durch den gleichen Stimulus, nämlich CO 2, ausgelöst wird. Vom Gen zum Verhalten Gene kontrollieren den Aufbau von Nervensystemen. Der Aufbau von Nervensystemen kontrolliert das Verhalten. Gene und ihre Produktionsmuster, wie auch Nervensysteme und Verhaltensweisen, unterliegen den Regeln der Evolution. Wie haben sich Gene, Genbildung und -funktionen verändert, um ein Nervensystem so zu verändern, dass es konträre Verhaltensweisen auslöst? Wie oben beschrieben aktivieren Düfte bestimmte Muster oder Glomeruli im Hirn. Je nach Aktivierungsmuster bekommen die höheren Hirnzentren einen 2012 Max-Planck-Gesellschaft 3/5
4 unterschiedlichen Befehl. Mücken bewegen sich zu CO 2 hin, Fliegen davon weg. Das kann in einfachen Labortests untersucht werden, wie z. B. dem T-maze (Abb. 2). Parallel dazu findet man, dass CO 2 in beiden Tieren sehr unterschiedliche Aktivierungsmuster im Antennallobus auslöst. Diese Aktivierungsmuster resultieren aus der unterschiedlichen Lokalisation der CO 2 detektierenden Rezeptorneurone selbst und ihrer Projektionsmuster im Antennallobus. In der Fliege sitzen die CO 2 -Neurone ausschließlich auf der Antenne und schicken ihre Axone zu einem bestimmten einzelnen Glomerulus. In der Mücke wird ein komplett anderer Glomerulus von CO 2 -Neuronen angesteuert, die exklusiv auf den Maxillen zu finden sind. Da Düfte, die die maxillaren Rezeptorneurone aktivieren, typischerweise Futtergerüche sind, erscheint es fast logisch, dass bei Mücken CO 2 -Neurone auch dort zu finden sind. Gene, die die Struktur dieser beiden CO 2 -sensorischen Systeme bestimmen, steuern somit auch indirekt das Verhalten der Tiere. A bb. 3: Fliegenm utanten m it Mückengeruchssystem. In Wildtyp-Fliegen sitzen die CO 2 -Neurone ausschließlich auf der Antenne. Entfernt m an m icrorna m ir-279 oder auch andere Proteine wie Prospero, einen Transkriptionsfaktor, entwickelt die Fliege ein CO 2- Nervensystem, welches dem der Mücke ähnelt. Max-Planck-Institut für Neurobiologie Welche Gene sind verantwortlich und wie hat sich ihre Funktion im Laufe der Evolution verändert, um diese unterschiedlichen Nervensysteme hervorzubringen? Durch Nutzung der Fliege als genetischen Modellorganismus wurden mehrere wichtige Gene gefunden, die möglicherweise die Diversifizierung der CO 2 - Nervensysteme dieser beiden Insekten gesteuert haben [1, 2]. Eines dieser Gene ist eine sogenannte microrna. MicroRNAs sind kürzlich entdeckte Moleküle, die ähnlich wie die DNA aufgebaut sind, aber Ribo- statt Desoxyribonukleinsäuren enthalten. Ganz anders als DNA oder herkömmliche, sogenannte messenger RNA, kodieren sie nicht für ein Protein, sondern agieren als Inhibitoren für die Produktion ganz spezifischer Zielproteine. Diese Inhibition ist räumlich und zeitlich sehr eng an die Proteinproduktion der Zelle gekoppelt und ist daher sehr nützlich, um schnell Proteinmengen zu reduzieren bzw. insgesamt eine Überproduktion eines bestimmten Proteins zu verhindern. Fliegen, denen diese microrna, mir-279, fehlt, entwickeln ein CO 2 - sensorisches System, das dem der Mücken sehr ähnlich ist (Abb. 3). Wie in Mücken besitzen diese Fliegen CO 2 -Neurone auf ihren Maxillen. Diese CO 2 -Neurone innervieren die gleichen Glomeruli, die auch in der Mücke von CO 2 -Neuronen innerviert werden. Durch weitere Untersuchungen konnte die Gruppe zeigen, dass mir-279 in der normalen Fliege Teil eines Signalnetzwerks ist, das die Produktion von zwei bestimmten Proteinen unterdrückt. Nicht unterdrückt, haben diese Proteine 2012 Max-Planck-Gesellschaft 4/5
5 ist, das die Produktion von zwei bestimmten Proteinen unterdrückt. Nicht unterdrückt, haben diese Proteine die Eigenschaft, die Entwicklung von maxillaren CO 2 -Neuronen hervorzurufen und auch deren Verbindungen zum Antennallobus zu steuern. Die gefundenen genetischen Faktoren aus der Fliege sind alle auch in der Mücke vorhanden. Allerdings scheint ihre Interaktion im Vergleich zur Fliege möglicherweise verändert. Diese evolutionäre Veränderung könnte zur Folge gehabt haben, dass Mücken CO 2 -Neurone auf ihren Maxillen besitzen, deren Aktivierung eine CO 2 -Anziehung hervorruft. Mücken, die kein CO 2 mehr mögen Mücken, die kein CO 2 mehr detektieren können das wäre das ideale Ergebnis der Studien des Teams um Ilona Grunwald-Kadow. Denn solche Mücken hätten Probleme, Menschen oder Tiere aufzuspüren. Langfristig könnten diese Ergebnisse also dazu beitragen, krankheitsübertragende Moskitos vom Stechen abzuhalten. Leider liegen noch viele Schritte zwischen den vorgestellten Ergebnissen und einer CO 2 -blinden Mücke. Zunächst soll gezeigt werden, dass die gleichen Faktoren, wie auch in Drosophila, die CO 2 -Neurone auf Maxillen von Mücken induzieren. Derzeit ist die Mücke bei weitem kein so praktischer genetischer Modellorganismus wie Drosophila. Die Wegnahme oder Veränderung eines Gens oder Proteins oder einer microrna in der Mücke gestalten sich als recht schwierig. In Zusammenarbeit mit der Gruppe von Elena Levashina am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin und Eric Marois an der Universität von Straßburg werden Methoden entwickelt, um CO 2 -Neurone mit genetischen Methoden sichtbar und manipulierbar zu machen. Eine spannende Frage ist, ob die microrna mir-279 in der Mücke die Bildung von CO 2 -Neuronen ganz oder zumindest teilweise verhindern kann. [1] Grunwald Kadow I.*; Cayirlioglu P.*; Zhan X.; Okamura K.; Gunning D.; Lai E. C.; Zipursky S. L. Hybrid Neurons in a microrna mutant are putative evolutionary intermediates in insect CO 2 sensory systems Science 319, (2008) [2] Hartl M.; Loschek L. F.; Stephan D.; Siju K. P.; Knappmeyer C.; Grunwald Kadow I. C. Prospero and microrna-279 Pathway Restricts CO 2 Receptor Neuron Formation The Journal of Neuroscience 31 (44), (2011) 2012 Max-Planck-Gesellschaft 5/5
Wie körperliche Bedürfnisse und physiologische Zustände die. How internal state and physiological conditions change perception of odors and tastes
 Wie körperliche Bedürfnisse und physiologische Zustände die How internal state and physiological conditions change perception of odors and tastes Ilona Grunwald Kadow Max-Planck-Institut für Neurobiologie,
Wie körperliche Bedürfnisse und physiologische Zustände die How internal state and physiological conditions change perception of odors and tastes Ilona Grunwald Kadow Max-Planck-Institut für Neurobiologie,
Olfaktion. Olfaktion
 Olfaktion Emotionen und Verhalten Erinnerung Sozialverhalten Aroma Kontrolle der Nahrung Reviermarkierung Partnerwahl Orientierung in der Umwelt Duftstoffwahrnehmung Axel, R. Spektrum der Wissenschaft,
Olfaktion Emotionen und Verhalten Erinnerung Sozialverhalten Aroma Kontrolle der Nahrung Reviermarkierung Partnerwahl Orientierung in der Umwelt Duftstoffwahrnehmung Axel, R. Spektrum der Wissenschaft,
Riechen. 1. Die Analyse der Luft in der Nase
 Riechen 1. Die Analyse der Luft in der Nase Was ist Riechen? Analyse Arom a Entscheidung Erinnerung Sozialverhalten Zwei Riechsysteme: eins für Duftstoffe, eins für Pheromone Quelle: Michael Meredith,
Riechen 1. Die Analyse der Luft in der Nase Was ist Riechen? Analyse Arom a Entscheidung Erinnerung Sozialverhalten Zwei Riechsysteme: eins für Duftstoffe, eins für Pheromone Quelle: Michael Meredith,
Entdeckungen unter der Schädeldecke. Jean-Marc Fritschy Institut für Pharmakologie und Toxikologie
 Entdeckungen unter der Schädeldecke Jean-Marc Fritschy Institut für Pharmakologie und Toxikologie Inhalt 1. GFP, das Wunderprotein 2. Die Nervenzellen bei der Arbeit beobachten 3. Nervenzellen mit Licht
Entdeckungen unter der Schädeldecke Jean-Marc Fritschy Institut für Pharmakologie und Toxikologie Inhalt 1. GFP, das Wunderprotein 2. Die Nervenzellen bei der Arbeit beobachten 3. Nervenzellen mit Licht
Glia- sowie Nervenzellen (= Neuronen) sind die Bausteine des Nervensystems. Beide Zellarten unterscheiden sich vorwiegend in ihren Aufgaben.
 (C) 2014 - SchulLV 1 von 5 Einleitung Du stehst auf dem Fußballfeld und dein Mitspieler spielt dir den Ball zu. Du beginnst loszurennen, denn du möchtest diesen Ball auf keinen Fall verpassen. Dann triffst
(C) 2014 - SchulLV 1 von 5 Einleitung Du stehst auf dem Fußballfeld und dein Mitspieler spielt dir den Ball zu. Du beginnst loszurennen, denn du möchtest diesen Ball auf keinen Fall verpassen. Dann triffst
1. Der Geruchssinn Mensch 10 000 Gerüche unterscheiden
 1. Der Geruchssinn Das Organ des Geruchssinnes ist die mit Geruchsnerven (olfaktorischen Nerven) ausgestattete Riechschleimhaut der Nase. Die Geruchsnerven wirken auch bei der Wahrnehmung verschiedener
1. Der Geruchssinn Das Organ des Geruchssinnes ist die mit Geruchsnerven (olfaktorischen Nerven) ausgestattete Riechschleimhaut der Nase. Die Geruchsnerven wirken auch bei der Wahrnehmung verschiedener
Wirkungen auf die Blut-Hirn-Schranke, DNA-Schädigung
 Wirkungen auf die Blut-Hirn-Schranke, DNA-Schädigung Dr. Monika Asmuß Bundesamt für Strahlenschutz Mobilfunk und Gesundheit BfS-Informationsveranstaltung, 25. Juni 2009, München 1 Blut-Hirn-Schranke (BHS)
Wirkungen auf die Blut-Hirn-Schranke, DNA-Schädigung Dr. Monika Asmuß Bundesamt für Strahlenschutz Mobilfunk und Gesundheit BfS-Informationsveranstaltung, 25. Juni 2009, München 1 Blut-Hirn-Schranke (BHS)
Neurobiologie des Lernens. Hebb Postulat Die synaptische Verbindung von zwei gleichzeitig erregten Zellen wird verstärkt
 Neurobiologie des Lernens Hebb Postulat 1949 Die synaptische Verbindung von zwei gleichzeitig erregten Zellen wird verstärkt Bliss & Lomo fanden 1973 langdauernde Veränderungen der synaptischen Aktivität,
Neurobiologie des Lernens Hebb Postulat 1949 Die synaptische Verbindung von zwei gleichzeitig erregten Zellen wird verstärkt Bliss & Lomo fanden 1973 langdauernde Veränderungen der synaptischen Aktivität,
Messung des Ruhepotentials einer Nervenzelle
 Messung des Ruhepotentials einer Nervenzelle 1 Extrazellulär Entstehung des Ruhepotentials K+ 4mM Na+ 120 mm Gegenion: Cl- K + kanal offen Na + -kanal zu Na + -K + Pumpe intrazellulär K+ 120 mm Na+ 5 mm
Messung des Ruhepotentials einer Nervenzelle 1 Extrazellulär Entstehung des Ruhepotentials K+ 4mM Na+ 120 mm Gegenion: Cl- K + kanal offen Na + -kanal zu Na + -K + Pumpe intrazellulär K+ 120 mm Na+ 5 mm
Traditionelle und innovative Impfstoffentwicklung
 Traditionelle und innovative Impfstoffentwicklung Reingard.grabherr@boku.ac.at Traditionelle Impfstoffentwicklung Traditionelle Impfstoffentwicklung Louis Pasteur in his laboratory, painting by A. Edelfeldt
Traditionelle und innovative Impfstoffentwicklung Reingard.grabherr@boku.ac.at Traditionelle Impfstoffentwicklung Traditionelle Impfstoffentwicklung Louis Pasteur in his laboratory, painting by A. Edelfeldt
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Die klassische Genetik: T.H. Morgan und seine Experimente mit Drosophila melanogaster Das komplette Material finden Sie hier: Download
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Die klassische Genetik: T.H. Morgan und seine Experimente mit Drosophila melanogaster Das komplette Material finden Sie hier: Download
adäquater Reiz Riechorgan Schnüffeln? Riechzellen / Aufbau Riechzellen / Mechanismus vomeronasales Organ
 Riechen: gaslösliche Moleküle eines Geruchstoffs adäquater Reiz > reagieren mit Sekret der Nasenschleimhaut Mensch: unterscheidet ca. 10 000 verschiedene Gerüche Riechepithel: Riechorgan für Riechen spezialisierte
Riechen: gaslösliche Moleküle eines Geruchstoffs adäquater Reiz > reagieren mit Sekret der Nasenschleimhaut Mensch: unterscheidet ca. 10 000 verschiedene Gerüche Riechepithel: Riechorgan für Riechen spezialisierte
Neurobiologie. Prof. Dr. Bernd Grünewald, Institut für Bienenkunde, FB Biowissenschaften
 Neurobiologie Prof. Dr. Bernd Grünewald, Institut für Bienenkunde, FB Biowissenschaften www.institut-fuer-bienenkunde.de b.gruenewald@bio.uni-frankfurt.de Franz Xaver Messerschmidt Chemorezeption: Schmecken
Neurobiologie Prof. Dr. Bernd Grünewald, Institut für Bienenkunde, FB Biowissenschaften www.institut-fuer-bienenkunde.de b.gruenewald@bio.uni-frankfurt.de Franz Xaver Messerschmidt Chemorezeption: Schmecken
Metasystemische Ergebnisse zum Rezeptor-Protein Npr21 und dem molekularen Schalter cgki2.
 Metasystemische Ergebnisse zum Rezeptor-Protein Npr21 und dem molekularen Schalter cgki2. Verschaltung des Nervensystems Forscher auf der Spur eines Schlüsselprozesses Nervenzellen müssen sich verschalten,
Metasystemische Ergebnisse zum Rezeptor-Protein Npr21 und dem molekularen Schalter cgki2. Verschaltung des Nervensystems Forscher auf der Spur eines Schlüsselprozesses Nervenzellen müssen sich verschalten,
Sie sagen Kartoffel. Huntington-Krankheit zu entwickeln.
 Neuigkeiten aus der Huntington-Forschung. In einfacher Sprache. Von Wissenschaftlern geschrieben Für die Huntington-Gemeinschaft weltweit. Übersetzungsprobleme? Neue Einblicke in die Entstehung des Huntington-Proteins
Neuigkeiten aus der Huntington-Forschung. In einfacher Sprache. Von Wissenschaftlern geschrieben Für die Huntington-Gemeinschaft weltweit. Übersetzungsprobleme? Neue Einblicke in die Entstehung des Huntington-Proteins
Aufbau der Nervenzelle. Zentrales Nervensystem
 Aufbau der Nervenzelle 2 A: Zellkörper (Soma): Stoffwechselzentrum B: Axon: Weiterleitung der elektrischen Signale C: Dendrit: Informationsaufnahme D: Hüllzellen: Isolation E: Schnürring: Unterbrechung
Aufbau der Nervenzelle 2 A: Zellkörper (Soma): Stoffwechselzentrum B: Axon: Weiterleitung der elektrischen Signale C: Dendrit: Informationsaufnahme D: Hüllzellen: Isolation E: Schnürring: Unterbrechung
UNSER GEHIRN VERSTEHEN
 UNSER GEHIRN VERSTEHEN te ihnen gesagt werden, dass in vielen Fällen die richtigen Techniken bereits im Zeitraum weniger Wochen zu einer erheblichen Verbesserung der Angstsituation führen etwa in dem gleichen
UNSER GEHIRN VERSTEHEN te ihnen gesagt werden, dass in vielen Fällen die richtigen Techniken bereits im Zeitraum weniger Wochen zu einer erheblichen Verbesserung der Angstsituation führen etwa in dem gleichen
Grundwissenkarten Gymnasium Vilsbisburg. 9. Klasse. Biologie
 Grundwissenkarten Gymnasium Vilsbisburg 9. Klasse Biologie Es sind insgesamt 10 Karten für die 9. Klasse erarbeitet. davon : Karten ausschneiden : Es ist auf der linken Blattseite die Vorderseite mit Frage/Aufgabe,
Grundwissenkarten Gymnasium Vilsbisburg 9. Klasse Biologie Es sind insgesamt 10 Karten für die 9. Klasse erarbeitet. davon : Karten ausschneiden : Es ist auf der linken Blattseite die Vorderseite mit Frage/Aufgabe,
Lichtsinnesorgan Auge. Augentypen und visuelle Fähigkeiten bei Wirbellosen Tieren sind äußerst unterschiedlich.
 Augentypen und visuelle Fähigkeiten bei Wirbellosen Tieren sind äußerst unterschiedlich. Wirbeltierauge Die Hauptteile des Wirbeltierauges sind: die Hornhaut (Cornea) und die Sklera als schützende Außenhaut
Augentypen und visuelle Fähigkeiten bei Wirbellosen Tieren sind äußerst unterschiedlich. Wirbeltierauge Die Hauptteile des Wirbeltierauges sind: die Hornhaut (Cornea) und die Sklera als schützende Außenhaut
Grundlagen der Allgemeinen Psychologie: Wahrnehmungspsychologie
 Grundlagen der Allgemeinen Psychologie: Wahrnehmungspsychologie Herbstsemester 2008 07.10.2008 (aktualisiert) Prof. Dr. Adrian Schwaninger Universität Zürich & Fachhochschule Nordwestschweiz Visual Cognition
Grundlagen der Allgemeinen Psychologie: Wahrnehmungspsychologie Herbstsemester 2008 07.10.2008 (aktualisiert) Prof. Dr. Adrian Schwaninger Universität Zürich & Fachhochschule Nordwestschweiz Visual Cognition
Die Verbindungen zwischen Parkinson und der Huntington Krankheit
 Neuigkeiten aus der Huntington-Forschung. In einfacher Sprache. Von Wissenschaftlern geschrieben Für die Huntington-Gemeinschaft weltweit. Erfolgreiche Studie zu Gentherapie bei Parkinson macht Hoffnung
Neuigkeiten aus der Huntington-Forschung. In einfacher Sprache. Von Wissenschaftlern geschrieben Für die Huntington-Gemeinschaft weltweit. Erfolgreiche Studie zu Gentherapie bei Parkinson macht Hoffnung
ÜBERSICHTSRASTER ZU DEN UNTERRICHTSVORHABEN IN BIOLOGIE IN DER EINFÜHRUNGSPHASE (EP)
 ÜBERSICHTSRASTER ZU DEN UNTERRICHTSVORHABEN IN BIOLOGIE IN DER EINFÜHRUNGSPHASE (EP) THEMA Kein Leben ohne Zelle I KONTEXT Wie sind Zellen aufgebaut und organisiert? INHALTSFELD IF 1 (Biologie der Zelle)
ÜBERSICHTSRASTER ZU DEN UNTERRICHTSVORHABEN IN BIOLOGIE IN DER EINFÜHRUNGSPHASE (EP) THEMA Kein Leben ohne Zelle I KONTEXT Wie sind Zellen aufgebaut und organisiert? INHALTSFELD IF 1 (Biologie der Zelle)
Ein Netzwerk für den Orientierungssinn Networks underlying the sense of direction
 Ein Netzwerk für den Orientierungssinn Networks underlying the sense of direction Seelig, Johannes Assoziierte Einrichtung - Forschungszentrum caesar (center of advanced european studies and research),
Ein Netzwerk für den Orientierungssinn Networks underlying the sense of direction Seelig, Johannes Assoziierte Einrichtung - Forschungszentrum caesar (center of advanced european studies and research),
Gene Silencing: was ist das noch mal?
 Neuigkeiten aus der Huntington-Forschung. In einfacher Sprache. Von Wissenschaftlern geschrieben Für die Huntington-Gemeinschaft weltweit. Gen Silencing macht einen zielstrebigen Schritt nach vorne Das
Neuigkeiten aus der Huntington-Forschung. In einfacher Sprache. Von Wissenschaftlern geschrieben Für die Huntington-Gemeinschaft weltweit. Gen Silencing macht einen zielstrebigen Schritt nach vorne Das
Chemorezeption. z.b. bei Wirbeltieren: Glomus caroticum, Rezeptor misst O 2. -Gehalt des Blutes
 Chemorezeption z.b. bei Wirbeltieren: Glomus caroticum, Rezeptor misst O 2 -Gehalt des Blutes * Geschmacksinn (Nahsinn, Kontaktchemorezeptoren) zur Überprüfung der Nahrung Mollusken: Osphradium unter dem
Chemorezeption z.b. bei Wirbeltieren: Glomus caroticum, Rezeptor misst O 2 -Gehalt des Blutes * Geschmacksinn (Nahsinn, Kontaktchemorezeptoren) zur Überprüfung der Nahrung Mollusken: Osphradium unter dem
Einführungsphase. Unterrichtsvorhaben III: Thema/Kontext: Kein Leben ohne Zelle I Wie sind Zellen aufgebaut und organisiert?
 Unterrichtsvorhaben I: Einführungsphase Unterrichtsvorhaben II: Thema/Kontext: Kein Leben ohne Zelle I Wie sind Zellen aufgebaut und organisiert? K1 Dokumentation Inhaltsfeld: IF 1 (Biologie der Zelle)
Unterrichtsvorhaben I: Einführungsphase Unterrichtsvorhaben II: Thema/Kontext: Kein Leben ohne Zelle I Wie sind Zellen aufgebaut und organisiert? K1 Dokumentation Inhaltsfeld: IF 1 (Biologie der Zelle)
Wie wir die Erkenntnisse der Gehirnforschung für mehr Kreativität und innovative Ideen nutzen können.
 Wie wir die Erkenntnisse der Gehirnforschung für mehr Kreativität und innovative Ideen nutzen können. Kreativität und innovative Ideen sind gefragter als je zuvor. Sie sind der Motor der Wirtschaft, Wissenschaft
Wie wir die Erkenntnisse der Gehirnforschung für mehr Kreativität und innovative Ideen nutzen können. Kreativität und innovative Ideen sind gefragter als je zuvor. Sie sind der Motor der Wirtschaft, Wissenschaft
Biologische Psychologie I
 Biologische Psychologie I Kapitel 7 Mechanismen der Wahrnehmung, des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit Organisationsprinzipien eines sensorischen Systems: Primärer und sekundärer sensorischer Kortex
Biologische Psychologie I Kapitel 7 Mechanismen der Wahrnehmung, des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit Organisationsprinzipien eines sensorischen Systems: Primärer und sekundärer sensorischer Kortex
Präsentiert von Christina Staudigl
 Präsentiert von Christina Staudigl Was bisher geschah 2 Was bisher geschah Neues aus der Signaltransduktion? - nichts wirklich grundlegendes Aber: mehr ARFs gefunden (10x) mit leichten Unterschieden in
Präsentiert von Christina Staudigl Was bisher geschah 2 Was bisher geschah Neues aus der Signaltransduktion? - nichts wirklich grundlegendes Aber: mehr ARFs gefunden (10x) mit leichten Unterschieden in
Neuronale Grundlagen bei ADHD. (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) Mechanismen der Ritalinwirkung. Dr. Lutz Erik Koch
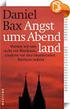 Neuronale Grundlagen bei ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) Mechanismen der Ritalinwirkung Dr. Lutz Erik Koch Die Verschreibung von Ritalin bleibt kontrovers Jeden Tag bekommen Millionen von
Neuronale Grundlagen bei ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) Mechanismen der Ritalinwirkung Dr. Lutz Erik Koch Die Verschreibung von Ritalin bleibt kontrovers Jeden Tag bekommen Millionen von
Biologie. Carl-von-Ossietzky-Gymnasium Bonn schulinternes Curriculum. Unterrichtsvorhaben: Materialhinweise:
 Jahrgang 5 UV 1: Vielfalt von Lebewesen / Vom Wild- zum Nutztier UV 2: Bau und Leistung des menschlichen Körpers / Bewegungssystem UV 3: Bau und Leistung des menschlichen Körpers / Ernährung und Verdauung
Jahrgang 5 UV 1: Vielfalt von Lebewesen / Vom Wild- zum Nutztier UV 2: Bau und Leistung des menschlichen Körpers / Bewegungssystem UV 3: Bau und Leistung des menschlichen Körpers / Ernährung und Verdauung
Evolution und Entwicklung
 Evolution und Entwicklung Wie aus einzelnen Zellen die Menschen wurden: Phylogenese Klassische Genetik: Mendel Moderne Genetik: Watson & Crick Wie aus einer einzigen Zelle ein Mensch wird: Ontogenese Vererbung
Evolution und Entwicklung Wie aus einzelnen Zellen die Menschen wurden: Phylogenese Klassische Genetik: Mendel Moderne Genetik: Watson & Crick Wie aus einer einzigen Zelle ein Mensch wird: Ontogenese Vererbung
Personalisierte Medizin
 Personalisierte Medizin Möglichkeiten und Grenzen Prof. Dr. Friedemann Horn Universität Leipzig, Institut für Klinische Immunologie, Molekulare Immunologie Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie
Personalisierte Medizin Möglichkeiten und Grenzen Prof. Dr. Friedemann Horn Universität Leipzig, Institut für Klinische Immunologie, Molekulare Immunologie Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie
Aristides Arrenberg untersucht den Arbeitsspeicher im Gehirn mit Licht
 Powered by Seiten-Adresse: https://www.gesundheitsindustriebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/aristides-arrenberguntersucht-den-arbeitsspeicher-im-gehirn-mit-licht/ Aristides Arrenberg untersucht den Arbeitsspeicher
Powered by Seiten-Adresse: https://www.gesundheitsindustriebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/aristides-arrenberguntersucht-den-arbeitsspeicher-im-gehirn-mit-licht/ Aristides Arrenberg untersucht den Arbeitsspeicher
NEUE BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN MONOKLONALE ANTIKÖRPER
 NEUE BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN MONOKLONALE ANTIKÖRPER Was sind Antikörper? Antikörper patrouillieren wie Wächter im Blutkreislauf des Körpers und achten auf Krankheitserreger wie Bakterien, Viren und Parasiten
NEUE BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN MONOKLONALE ANTIKÖRPER Was sind Antikörper? Antikörper patrouillieren wie Wächter im Blutkreislauf des Körpers und achten auf Krankheitserreger wie Bakterien, Viren und Parasiten
OZONTHERAPIE BEI SSPE
 OZONTHERAPIE BEI SSPE Dr. Murat BAS OZON KLINIK - BURSA, Türkei Deutsche Übersetzung: R.Schönbohm 1 SSPE (subakut sklerosierende Panenzephalitis) ist eine seltene Komplikation der Masern. Sie gehört zu
OZONTHERAPIE BEI SSPE Dr. Murat BAS OZON KLINIK - BURSA, Türkei Deutsche Übersetzung: R.Schönbohm 1 SSPE (subakut sklerosierende Panenzephalitis) ist eine seltene Komplikation der Masern. Sie gehört zu
Funktionelle Analyse von Neuropilin 1 und 2 in der Epidermis: Bedeutung in der Wundheilung und in der UVBinduzierten
 Funktionelle Analyse von Neuropilin 1 und 2 in der Epidermis: Bedeutung in der Wundheilung und in der UVBinduzierten Apoptose INAUGURAL-DISSERTATION zur Erlangung des Doktorgrades der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen
Funktionelle Analyse von Neuropilin 1 und 2 in der Epidermis: Bedeutung in der Wundheilung und in der UVBinduzierten Apoptose INAUGURAL-DISSERTATION zur Erlangung des Doktorgrades der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen
Neuronale Kodierung sensorischer Reize. Computational Neuroscience Jutta Kretzberg
 Neuronale Kodierung sensorischer Reize Computational Neuroscience 30.10.2006 Jutta Kretzberg (Vorläufiges) Vorlesungsprogramm 23.10.06!! Motivation 30.10.06!! Neuronale Kodierung sensorischer Reize 06.11.06!!
Neuronale Kodierung sensorischer Reize Computational Neuroscience 30.10.2006 Jutta Kretzberg (Vorläufiges) Vorlesungsprogramm 23.10.06!! Motivation 30.10.06!! Neuronale Kodierung sensorischer Reize 06.11.06!!
Einblicke in die Entwicklung des menschlichen Gehirns anhand von Untersuchungen in der Fruchtfliege Drosophila melanogaster. Tuesday, March 27, 12
 Einblicke in die Entwicklung des menschlichen Gehirns anhand von Untersuchungen in der Fruchtfliege Drosophila melanogaster Wozu ist Forschung mit der Fruchtfliege nuetzlich? "You've heard about some of
Einblicke in die Entwicklung des menschlichen Gehirns anhand von Untersuchungen in der Fruchtfliege Drosophila melanogaster Wozu ist Forschung mit der Fruchtfliege nuetzlich? "You've heard about some of
4) Diese Hirnregion steuert die wichtigsten Körperfunktionen wie Essen, Trinken und Schlafen.
 Wie gut haben Sie aufgepasst? 1) Das Gehirn und das Rückenmark bilden das... periphere Nervensystem autonome Nervensystem zentrale Nervensystem 2) Das System wird auch als emotionales Gehirn bezeichnet.
Wie gut haben Sie aufgepasst? 1) Das Gehirn und das Rückenmark bilden das... periphere Nervensystem autonome Nervensystem zentrale Nervensystem 2) Das System wird auch als emotionales Gehirn bezeichnet.
kam zum Prozess vor einem Gericht in Los Angeles, Kalifornien. Chaplin erwirkte einen Bluttest, um anhand der Blutgruppen zu zeigen, dass er nicht
 kam zum Prozess vor einem Gericht in Los Angeles, Kalifornien. Chaplin erwirkte einen Bluttest, um anhand der Blutgruppen zu zeigen, dass er nicht der Vater war. Er kannte die Blutgruppe des Kindes nicht,
kam zum Prozess vor einem Gericht in Los Angeles, Kalifornien. Chaplin erwirkte einen Bluttest, um anhand der Blutgruppen zu zeigen, dass er nicht der Vater war. Er kannte die Blutgruppe des Kindes nicht,
Biologie I/B: Klassische und molekulare Genetik, molekulare Grundlagen der Entwicklung Tutorium SS 2016
 Biologie I/B: Klassische und molekulare Genetik, molekulare Grundlagen der Entwicklung Tutorium SS 2016 Fragen für die Tutoriumsstunde 5 (27.06. 01.07.) Mendel, Kreuzungen, Statistik 1. Sie bekommen aus
Biologie I/B: Klassische und molekulare Genetik, molekulare Grundlagen der Entwicklung Tutorium SS 2016 Fragen für die Tutoriumsstunde 5 (27.06. 01.07.) Mendel, Kreuzungen, Statistik 1. Sie bekommen aus
KIFFEN IST DOCH NICHT SCHÄDLICH! ODER DOCH?
 Dr. Miriam Schneider Institut für Hirnforschung, Abteilung für Neuropharmakologie, Universität Bremen KIFFEN IST DOCH NICHT SCHÄDLICH! ODER DOCH? Mögliche Folgen des Cannabiskonsums während der Entwicklung
Dr. Miriam Schneider Institut für Hirnforschung, Abteilung für Neuropharmakologie, Universität Bremen KIFFEN IST DOCH NICHT SCHÄDLICH! ODER DOCH? Mögliche Folgen des Cannabiskonsums während der Entwicklung
"Rundum-Service" für alternde Nervenzellen Aid system for aging nerve cells
 "Rundum-Service" für alternde Aid system for aging nerve cells Kramer, Edgar; Aron, Liviu; Schulz, Jörg; Klein, Rüdiger Max-Planck-Institut für Neurobiologie, Martinsried Korrespondierender Autor E-Mail:
"Rundum-Service" für alternde Aid system for aging nerve cells Kramer, Edgar; Aron, Liviu; Schulz, Jörg; Klein, Rüdiger Max-Planck-Institut für Neurobiologie, Martinsried Korrespondierender Autor E-Mail:
Suchtgedächtnis. Selbsthilfethemennachmittag FSHG 23.April 2010. Bezirksverband Potsdam e.v.
 Selbsthilfethemennachmittag FSHG 23.April 2010 Suchtgedächtnis Suchtgedächtnis 1. Definitionen 2. Grundlagen 3. Gedächtnis & Lernen 4. Neurobiologisches Belohungssystem 5. Besonderheiten des Suchtgedächtnisses
Selbsthilfethemennachmittag FSHG 23.April 2010 Suchtgedächtnis Suchtgedächtnis 1. Definitionen 2. Grundlagen 3. Gedächtnis & Lernen 4. Neurobiologisches Belohungssystem 5. Besonderheiten des Suchtgedächtnisses
Zirkadiane Periode bei Pflanzen
 Zirkadiane Periodik Innere Zeitgeber Verschiedene Schlafstadien Entwicklung von Schlafmustern im Laufe der Lebensspanne Neuronales Substrat Schlafstörungen Zirkadiane Periode bei Pflanzen Versuchsaufbau
Zirkadiane Periodik Innere Zeitgeber Verschiedene Schlafstadien Entwicklung von Schlafmustern im Laufe der Lebensspanne Neuronales Substrat Schlafstörungen Zirkadiane Periode bei Pflanzen Versuchsaufbau
Vom Genotyp zum Phänotyp
 Vom Genotyp zum Phänotyp Eineiige Zwillinge, getrennt und in verschiedenen Umwelten aufgewachsen 1 Die Huntington-Krankheit 1) erblich 2) motorische Störung mit fortdauernden, schnellen, ruckartigen Bewegungen
Vom Genotyp zum Phänotyp Eineiige Zwillinge, getrennt und in verschiedenen Umwelten aufgewachsen 1 Die Huntington-Krankheit 1) erblich 2) motorische Störung mit fortdauernden, schnellen, ruckartigen Bewegungen
Ein Rezept für eine Krankheit
 Neuigkeiten aus der Huntington-Forschung. In einfacher Sprache. Von Wissenschaftlern geschrieben Für die Huntington-Gemeinschaft weltweit. Bauen wir bessere Mäuse(fallen): Neues Modell für die Huntington-Krankheit
Neuigkeiten aus der Huntington-Forschung. In einfacher Sprache. Von Wissenschaftlern geschrieben Für die Huntington-Gemeinschaft weltweit. Bauen wir bessere Mäuse(fallen): Neues Modell für die Huntington-Krankheit
..den Sinneszellen. zu schützen. optimal zuzuführen. die Qualität des Reizes festzustellen die Quantität des Reizes festzustellen
 9.1 Welche Funktionen haben Sinneszellen und Sinnesorgan? Sinneszellen nehmen die Reize auf und wandeln die Information in elektrische Signale um. Die Sinnesorgane dienen unter anderem dazu. Beispiel Auge
9.1 Welche Funktionen haben Sinneszellen und Sinnesorgan? Sinneszellen nehmen die Reize auf und wandeln die Information in elektrische Signale um. Die Sinnesorgane dienen unter anderem dazu. Beispiel Auge
nur täglich, sondern auch von einer Mahlzeit zur anderen. Trotz dieser kurzfristigen Variationen in der Energiebilanz stimmen bei den meisten
 Hunger Sättigung Nehmen wir einmal an, dass ein 70 Kilogramm schwerer Mann von seinem 18. Lebensjahr, ab dem das Körpergewicht einigermaßen konstant bleibt, bis zu seinem 80. Lebensjahr etwa 60 Millionen
Hunger Sättigung Nehmen wir einmal an, dass ein 70 Kilogramm schwerer Mann von seinem 18. Lebensjahr, ab dem das Körpergewicht einigermaßen konstant bleibt, bis zu seinem 80. Lebensjahr etwa 60 Millionen
Neuronale Verarbeitung von Geruchsreizen im Riechkolben der Maus
 Neuronale Verarbeitung von Geruchsreizen im Riechkolben der Maus Schaefer, Andreas T. Max-Planck-Institut für medizinische Forschung, Heidelberg Korrespondierender Autor Email: schaefer@mpimf-heidelberg.mpg.de
Neuronale Verarbeitung von Geruchsreizen im Riechkolben der Maus Schaefer, Andreas T. Max-Planck-Institut für medizinische Forschung, Heidelberg Korrespondierender Autor Email: schaefer@mpimf-heidelberg.mpg.de
Das Zentralnervensystem
 Das Zentralnervensystem Hören Sehen Riechen Gehirn/ZNS motivationales System Angstzentrum Gedächtnissystem motorische Systeme Muskel (100 Mrd. Nervenzellen beim Meschen) Verhalten: Räumlich / zeitliche
Das Zentralnervensystem Hören Sehen Riechen Gehirn/ZNS motivationales System Angstzentrum Gedächtnissystem motorische Systeme Muskel (100 Mrd. Nervenzellen beim Meschen) Verhalten: Räumlich / zeitliche
Weniger Nebenwirkungen bei Herzinfarkt - und Schlaganfall-Therapie? Würzburger Forscher finden neuen Mechanismus bei der Blutgerinnung
 Weniger Nebenwirkungen bei Herzinfarkt - und Schlaganfall-Therapie? Würzburger Forscher finden neuen Mechanismus bei der Blutgerinnung Würzburg (17.06.2008) - Ein erhöhtes Blutungsrisiko ist die unerwünschte
Weniger Nebenwirkungen bei Herzinfarkt - und Schlaganfall-Therapie? Würzburger Forscher finden neuen Mechanismus bei der Blutgerinnung Würzburg (17.06.2008) - Ein erhöhtes Blutungsrisiko ist die unerwünschte
Können Sie Grundstrukturen, die NLP als Kommunikationsmodell bietet, erklären? Seite 10
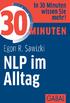 Können Sie Grundstrukturen, die NLP als Kommunikationsmodell bietet, erklären? Seite 10 Was wird bei NLP unter dem Begriff Modellieren verstanden? Seite 11 Kennen Sie die fünf wichtigsten Repräsentationssysteme?
Können Sie Grundstrukturen, die NLP als Kommunikationsmodell bietet, erklären? Seite 10 Was wird bei NLP unter dem Begriff Modellieren verstanden? Seite 11 Kennen Sie die fünf wichtigsten Repräsentationssysteme?
B.2. 04/2009 Die Sinne des Hundes
 B.2. 04/2009 Die Sinne des Hundes Gesicht: Der Mensch nimmt seine Umwelt im wesentlichen über die Augen wahr. Beim Hund spielt das Auge im Verhältnis zu anderen Sinnen nur eine untergeordnete Rolle. Um
B.2. 04/2009 Die Sinne des Hundes Gesicht: Der Mensch nimmt seine Umwelt im wesentlichen über die Augen wahr. Beim Hund spielt das Auge im Verhältnis zu anderen Sinnen nur eine untergeordnete Rolle. Um
Bielefeld Graphics & Geometry Group. Brain Machine Interfaces Reaching and Grasping by Primates
 Reaching and Grasping by Primates + 1 Reaching and Grasping by Primates Inhalt Einführung Theoretischer Hintergrund Design Grundlagen Experiment Ausblick Diskussion 2 Reaching and Grasping by Primates
Reaching and Grasping by Primates + 1 Reaching and Grasping by Primates Inhalt Einführung Theoretischer Hintergrund Design Grundlagen Experiment Ausblick Diskussion 2 Reaching and Grasping by Primates
BK07_Vorlesung Physiologie. 05. November 2012
 BK07_Vorlesung Physiologie 05. November 2012 Stichpunkte zur Vorlesung 1 Aktionspotenziale = Spikes Im erregbaren Gewebe werden Informationen in Form von Aktions-potenzialen (Spikes) übertragen Aktionspotenziale
BK07_Vorlesung Physiologie 05. November 2012 Stichpunkte zur Vorlesung 1 Aktionspotenziale = Spikes Im erregbaren Gewebe werden Informationen in Form von Aktions-potenzialen (Spikes) übertragen Aktionspotenziale
Restriktion und Gentechnik
 Restriktion und Gentechnik Einteilung 1.) Restriktion - Restriktionsenzyme - Southern Blotting 2.)Gentechnik - sticky ends - blunt ends Restriktion Grundwerkzeuge der Gentechnik - Restriktionsenzymanalyse
Restriktion und Gentechnik Einteilung 1.) Restriktion - Restriktionsenzyme - Southern Blotting 2.)Gentechnik - sticky ends - blunt ends Restriktion Grundwerkzeuge der Gentechnik - Restriktionsenzymanalyse
Medienbegleitheft zur DVD 14175. IM BANN DER DÜFTE Parfüm Geschichte und Wirkung
 Medienbegleitheft zur DVD 14175 IM BANN DER DÜFTE Parfüm Geschichte und Wirkung Medienbegleitheft zur DVD 14175 38 Minuten, Produktionsjahr 2014 Inhaltsverzeichnis 1. Lückentext Funktionen des Geruchssinns...
Medienbegleitheft zur DVD 14175 IM BANN DER DÜFTE Parfüm Geschichte und Wirkung Medienbegleitheft zur DVD 14175 38 Minuten, Produktionsjahr 2014 Inhaltsverzeichnis 1. Lückentext Funktionen des Geruchssinns...
Frauenkrebs Kommunikationsprojekt. Krebs und die genetische Verbindung
 Frauenkrebs Kommunikationsprojekt Koordiniert durch das Europäische Institut für Frauengesundheit http://www.eurohealth.ie/cancom/ Krebs und die genetische Verbindung In Irland ist Brustkrebs eine der
Frauenkrebs Kommunikationsprojekt Koordiniert durch das Europäische Institut für Frauengesundheit http://www.eurohealth.ie/cancom/ Krebs und die genetische Verbindung In Irland ist Brustkrebs eine der
Olfactory coding in the insect brain and how to use fruit fly to detect cancer. Giovanni Galizia Universität Konstanz
 Olfactory coding in the insect brain and how to use fruit fly to detect cancer Giovanni Galizia Universität Konstanz Überblick Teil 1: 1. Der Geruch und Geschmack von Krankheiten 2. Hunde können Krebs
Olfactory coding in the insect brain and how to use fruit fly to detect cancer Giovanni Galizia Universität Konstanz Überblick Teil 1: 1. Der Geruch und Geschmack von Krankheiten 2. Hunde können Krebs
Zelluläre Reproduktion: Zellzyklus. Regulation des Zellzyklus - Proliferation
 Zelluläre Reproduktion: Zellzyklus Regulation des Zellzyklus - Proliferation Alle Zellen entstehen durch Zellteilung Der Zellzyklus kann in vier Haupt-Phasen eingeteilt werden Interphase Zellwachstum;
Zelluläre Reproduktion: Zellzyklus Regulation des Zellzyklus - Proliferation Alle Zellen entstehen durch Zellteilung Der Zellzyklus kann in vier Haupt-Phasen eingeteilt werden Interphase Zellwachstum;
Zentrales Nervensystem
 Zentrales Nervensystem Funktionelle Neuroanatomie (Struktur und Aufbau des Nervensystems) Neurophysiologie (Ruhe- und Aktionspotenial, synaptische Übertragung) Fakten und Zahlen (funktionelle Auswirkungen)
Zentrales Nervensystem Funktionelle Neuroanatomie (Struktur und Aufbau des Nervensystems) Neurophysiologie (Ruhe- und Aktionspotenial, synaptische Übertragung) Fakten und Zahlen (funktionelle Auswirkungen)
Teil Osiewacz, 5 Seiten, 5 Fragen, 50 Punkte
 Teil Osiewacz, 5 Seiten, 5 Fragen, 50 Punkte Frage 1: 10 Punkte a) Die Bildung der Gameten bei Diplonten und bei Haplonten erfolgt im Verlaufe von Kernteilungen. Ergänzen Sie die angefangenen Sätze (2
Teil Osiewacz, 5 Seiten, 5 Fragen, 50 Punkte Frage 1: 10 Punkte a) Die Bildung der Gameten bei Diplonten und bei Haplonten erfolgt im Verlaufe von Kernteilungen. Ergänzen Sie die angefangenen Sätze (2
Fettmoleküle und das Gehirn
 Neuigkeiten aus der Huntington-Forschung. In einfacher Sprache. Von Wissenschaftlern geschrieben Für die Huntington-Gemeinschaft weltweit. Spezielle "Gehirn Fett Injektion hilft Huntington Mäusen Direktes
Neuigkeiten aus der Huntington-Forschung. In einfacher Sprache. Von Wissenschaftlern geschrieben Für die Huntington-Gemeinschaft weltweit. Spezielle "Gehirn Fett Injektion hilft Huntington Mäusen Direktes
32 MaxPlanckForschung 2 09
 32 MaxPlanckForschung 2 09 Klein aber oho. Etwa zehn Millionen Riechzellen taxieren bei der Maus die einströmende Atemluft auf vielversprechende Odeurs. Beim Menschen ist die Anzahl zwar nicht so genau
32 MaxPlanckForschung 2 09 Klein aber oho. Etwa zehn Millionen Riechzellen taxieren bei der Maus die einströmende Atemluft auf vielversprechende Odeurs. Beim Menschen ist die Anzahl zwar nicht so genau
Sensory Re-education
 Sensory Re-education Sensibilitätstraining nach Nervennaht Birgitta Rosén, 2006 Department of Hand Surgery, Malmö University Hospital, Sweden Deutsche Übersetzung mit Erlaubnis der Autorin Lilian Santschi,
Sensory Re-education Sensibilitätstraining nach Nervennaht Birgitta Rosén, 2006 Department of Hand Surgery, Malmö University Hospital, Sweden Deutsche Übersetzung mit Erlaubnis der Autorin Lilian Santschi,
Wie zeigt sich das in den Hirnbildern?
 Inhaltsverzeichnis Wie zeigt sich das in den Hirnbildern? Die Sprachen können noch so verschieden sein, es sind immer die gleichen Hirnareale, die involviert sind inklusive der Zeichensprache. Es ist genetisch
Inhaltsverzeichnis Wie zeigt sich das in den Hirnbildern? Die Sprachen können noch so verschieden sein, es sind immer die gleichen Hirnareale, die involviert sind inklusive der Zeichensprache. Es ist genetisch
Bei autistischen Mäusen ist die Inselrinde im Gehirn verändert Insular cortex alterations in the autistic mouse brain
 Bei autistischen Mäusen ist die Inselrinde im Gehirn verändert Insular cortex alterations in the autistic mouse brain Gogolla, Nadine Max-Planck-Institut für Neurobiologie, Martinsried Korrespondierender
Bei autistischen Mäusen ist die Inselrinde im Gehirn verändert Insular cortex alterations in the autistic mouse brain Gogolla, Nadine Max-Planck-Institut für Neurobiologie, Martinsried Korrespondierender
RNA-binding proteins and micrornas in the mammalian embryo
 RNA-bindende Proteine und MikroRNAs im Säugetierembryo RNA-binding proteins and micrornas in the mammalian embryo Winter, Jennifer Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik, Freiburg Korrespondierender
RNA-bindende Proteine und MikroRNAs im Säugetierembryo RNA-binding proteins and micrornas in the mammalian embryo Winter, Jennifer Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik, Freiburg Korrespondierender
Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben Biologie Q1 Grundkurs
 Clemens-Brentano-Gymnasium An der Kreuzkirche 7 48249 Dülmen Telefon 02594 4893 Telefax 02594 949908 sekretariat@cbg.duelmen.org schulleitung@cbg.duelmen.org cbg.duelmen.org Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben
Clemens-Brentano-Gymnasium An der Kreuzkirche 7 48249 Dülmen Telefon 02594 4893 Telefax 02594 949908 sekretariat@cbg.duelmen.org schulleitung@cbg.duelmen.org cbg.duelmen.org Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben
6 THESEN ZUR ZUKUNFT DER ERNÄHRUNG
 6 THESEN ZUR ZUKUNFT DER ERNÄHRUNG 1. Die Herausforderung Der Wunsch von uns allen ist ein gesundes und langes Leben. Dazu bedarf es in der Zukunft grundlegender Veränderungen in der Ernährung: Die gesunde
6 THESEN ZUR ZUKUNFT DER ERNÄHRUNG 1. Die Herausforderung Der Wunsch von uns allen ist ein gesundes und langes Leben. Dazu bedarf es in der Zukunft grundlegender Veränderungen in der Ernährung: Die gesunde
Entdecken Sie. Chiropraktik!
 Entdecken Sie Chiropraktik! Was ist so anders daran? Das Hauptaugenmerk der traditionellen Gesundheitsvorsorge richtet sich auf Krankheitserreger und Blutwerte. In der Chiropraktik ist das anders. Die
Entdecken Sie Chiropraktik! Was ist so anders daran? Das Hauptaugenmerk der traditionellen Gesundheitsvorsorge richtet sich auf Krankheitserreger und Blutwerte. In der Chiropraktik ist das anders. Die
 Abbildungen Schandry, 2006 Quelle: www.ich-bin-einradfahrer.de Abbildungen Schandry, 2006 Informationsvermittlung im Körper Pioniere der Neurowissenschaften: Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Camillo
Abbildungen Schandry, 2006 Quelle: www.ich-bin-einradfahrer.de Abbildungen Schandry, 2006 Informationsvermittlung im Körper Pioniere der Neurowissenschaften: Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Camillo
Entwicklungs /gewebespezifische Genexpression. Coexpression funktional überlappender Gene
 Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten Konzepte: Entwicklungs /gewebespezifische Genexpression Coexpression funktional überlappender Gene Positive Genregulation Negative Genregulation cis /trans Regulation
Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten Konzepte: Entwicklungs /gewebespezifische Genexpression Coexpression funktional überlappender Gene Positive Genregulation Negative Genregulation cis /trans Regulation
Grundlagen der Vererbungslehre
 Grundlagen der Vererbungslehre Zucht und Fortpflanzung Unter Zucht verstehen wir die planvolle Verpaarung von Elterntieren, die sich in ihren Rassemerkmalen und Nutzleistungen ergänzen zur Verbesserung
Grundlagen der Vererbungslehre Zucht und Fortpflanzung Unter Zucht verstehen wir die planvolle Verpaarung von Elterntieren, die sich in ihren Rassemerkmalen und Nutzleistungen ergänzen zur Verbesserung
Lern- und Gedächtnisprozesse im Gehirn: Die Biene als Modellorganismus
 Lern- und Gedächtnisprozesse im Gehirn: Die Biene als Modellorganismus PD Dr. Ricarda Scheiner Technische Universität Berlin Institut für Ökologie Franklinstr. 28/29, FR 1-1 10587 Berlin E-mail: Ricarda.Scheiner-Pietsch@TU-Berlin.de
Lern- und Gedächtnisprozesse im Gehirn: Die Biene als Modellorganismus PD Dr. Ricarda Scheiner Technische Universität Berlin Institut für Ökologie Franklinstr. 28/29, FR 1-1 10587 Berlin E-mail: Ricarda.Scheiner-Pietsch@TU-Berlin.de
Die Neurobiologischen Bedingungen Menschlichen Handelns. Peter Walla
 Die Neurobiologischen Bedingungen Menschlichen Handelns 3 wichtige Sichtweisen der Neurobiologie 1. Das Gehirn produziert kontrolliertes Verhalten (somit auch jegliches Handeln) 2. Verhalten ist gleich
Die Neurobiologischen Bedingungen Menschlichen Handelns 3 wichtige Sichtweisen der Neurobiologie 1. Das Gehirn produziert kontrolliertes Verhalten (somit auch jegliches Handeln) 2. Verhalten ist gleich
Die Entwicklung der Gefühle: Aspekte aus der Hirnforschung. Andreas Lüthi, Friedrich Miescher Institut, Basel
 Die Entwicklung der Gefühle: Aspekte aus der Hirnforschung Andreas Lüthi, Friedrich Miescher Institut, Basel Wie lernen wir Angst zu haben? Wie kann das Gehirn die Angst wieder loswerden? Angst und Entwicklung
Die Entwicklung der Gefühle: Aspekte aus der Hirnforschung Andreas Lüthi, Friedrich Miescher Institut, Basel Wie lernen wir Angst zu haben? Wie kann das Gehirn die Angst wieder loswerden? Angst und Entwicklung
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Einführung in die Immunbiologie. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Einführung in die Immunbiologie Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de S 2 M 2 Das Immunsystem eine Übersicht Das
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Einführung in die Immunbiologie Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de S 2 M 2 Das Immunsystem eine Übersicht Das
27 Funktionelle Genomanalysen Sachverzeichnis
 Inhaltsverzeichnis 27 Funktionelle Genomanalysen... 543 27.1 Einleitung... 543 27.2 RNA-Interferenz: sirna/shrna-screens 543 Gunter Meister 27.3 Knock-out-Technologie: homologe Rekombination im Genom der
Inhaltsverzeichnis 27 Funktionelle Genomanalysen... 543 27.1 Einleitung... 543 27.2 RNA-Interferenz: sirna/shrna-screens 543 Gunter Meister 27.3 Knock-out-Technologie: homologe Rekombination im Genom der
Klassische Konditionierung Iwan P. Pawlow ( ) Psychologie des Lernens. Iwan P. Pawlow. Iwan P. Pawlow - Literatur
 Psychologie des Lernens Klassische Konditionierung Iwan P. Pawlow (1849-1936) Klassischer Konditionierung Instrumentelle Konditionierung Operante Konditionierung Kognitiver Behaviorismus Lernen am Modell
Psychologie des Lernens Klassische Konditionierung Iwan P. Pawlow (1849-1936) Klassischer Konditionierung Instrumentelle Konditionierung Operante Konditionierung Kognitiver Behaviorismus Lernen am Modell
Unwiderstehliche Düfte Warum Mäuse und Elefantenspitzmäuse Pflanzen bestäuben
 // 02. Mai 2011 PD Dr. Stefan Dötterl bei chromatographischen Untersuchungen im Labor des Lehrstuhls für Pflanzensystematik. Unwiderstehliche Düfte Warum Mäuse und Elefantenspitzmäuse Pflanzen bestäuben
// 02. Mai 2011 PD Dr. Stefan Dötterl bei chromatographischen Untersuchungen im Labor des Lehrstuhls für Pflanzensystematik. Unwiderstehliche Düfte Warum Mäuse und Elefantenspitzmäuse Pflanzen bestäuben
Chemorezeption: Geschmackssinn, Geruchssinn
 Chemorezeption: Geschmackssinn, Geruchssinn 1 Geschmacksqualitäten Mensch Süß Zucker, Kohlenhydrate = kalorienreiche Nahrung Umami Glutamat, Proteine = proteinreiche Nahrung Sauer Warnsignal (unreife Früchte,
Chemorezeption: Geschmackssinn, Geruchssinn 1 Geschmacksqualitäten Mensch Süß Zucker, Kohlenhydrate = kalorienreiche Nahrung Umami Glutamat, Proteine = proteinreiche Nahrung Sauer Warnsignal (unreife Früchte,
Übungsblatt: Protein interaction networks. Ulf Leser and Samira Jaeger
 Übungsblatt: Protein interaction networks Ulf Leser and Samira Jaeger Aufgabe 1 Netzwerkzentralität (6P) In der Vorlesung haben Degree Centrality besprochen. Finde drei weitere etablierte Zentralitätsmaße
Übungsblatt: Protein interaction networks Ulf Leser and Samira Jaeger Aufgabe 1 Netzwerkzentralität (6P) In der Vorlesung haben Degree Centrality besprochen. Finde drei weitere etablierte Zentralitätsmaße
Neue Strategien und Studien zur Therapie des Angelman-Syndroms. B. Horsthemke, Essen
 Neue Strategien und Studien zur Therapie des Angelman-Syndroms B. Horsthemke, Essen DNA und Erbinformation Chromosom - AGTCCGTAAGCTGAACGCTGAGTGCACATGCAGTCATGTGCATGGCTGTACAAAGTCTGCTAGTCAGT - TCAGGCATTCGACTTGCGACTCACGTGTACGTCAGTACACGTACCGACATGTTTCAGACGATCAGTCA
Neue Strategien und Studien zur Therapie des Angelman-Syndroms B. Horsthemke, Essen DNA und Erbinformation Chromosom - AGTCCGTAAGCTGAACGCTGAGTGCACATGCAGTCATGTGCATGGCTGTACAAAGTCTGCTAGTCAGT - TCAGGCATTCGACTTGCGACTCACGTGTACGTCAGTACACGTACCGACATGTTTCAGACGATCAGTCA
>Ada Wissen: Das menschliche Gehirn
 Titel 2a.1 2a >Ada Wissen: Das menschliche Gehirn Das Gehirn befähigt uns, logisch zu denken, mit unseren Mitmenschen zu kommunizieren, zu lernen, und es verleiht uns Erinnerungsvermögen. Aber auch Emotionen
Titel 2a.1 2a >Ada Wissen: Das menschliche Gehirn Das Gehirn befähigt uns, logisch zu denken, mit unseren Mitmenschen zu kommunizieren, zu lernen, und es verleiht uns Erinnerungsvermögen. Aber auch Emotionen
Was ist Angst? Was ist Angst? Neuronale Grundlagen der Angst. 1. Körper 2. Angstgefühl 3. Verhalten. Was ist Angst? Wie lernen wir Angst zu haben?
 Neuronale Grundlagen der Angst Andreas Lüthi Friedrich Miescher Institut für biomedizinische Forschung Novartis Forschungsstiftung Basel Was ist Angst? Wie lernen wir Angst zu haben? Können wir Angst wieder
Neuronale Grundlagen der Angst Andreas Lüthi Friedrich Miescher Institut für biomedizinische Forschung Novartis Forschungsstiftung Basel Was ist Angst? Wie lernen wir Angst zu haben? Können wir Angst wieder
1 Bau von Nervenzellen
 Neurophysiologie 1 Bau von Nervenzellen Die funktionelle Einheit des Nervensystems bezeichnet man als Nervenzelle. Dendrit Zellkörper = Soma Zelllkern Axon Ranvier scher Schnürring Schwann sche Hüllzelle
Neurophysiologie 1 Bau von Nervenzellen Die funktionelle Einheit des Nervensystems bezeichnet man als Nervenzelle. Dendrit Zellkörper = Soma Zelllkern Axon Ranvier scher Schnürring Schwann sche Hüllzelle
Können Computer Gedanken lesen?
 Können Computer Gedanken lesen? Oder: wie können wir uns unserem Computer mitteilen Prof. Dr.-Ing. Tanja Schultz Dominic Heger, Dirk Gehrig, Matthias Janke, Felix Putze und Michael Wand KIT Universität
Können Computer Gedanken lesen? Oder: wie können wir uns unserem Computer mitteilen Prof. Dr.-Ing. Tanja Schultz Dominic Heger, Dirk Gehrig, Matthias Janke, Felix Putze und Michael Wand KIT Universität
Exkurs: Circadiane Rhythmik. Physiologie der Zeitumstellung
 Exkurs: Circadiane Rhythmik Physiologie der Zeitumstellung Chronobiologie Die biologische Uhr circadiane Rhythmik Biologische Uhren sind Anpassungen des Organismus an zyklische Veränderungen der Umwelt
Exkurs: Circadiane Rhythmik Physiologie der Zeitumstellung Chronobiologie Die biologische Uhr circadiane Rhythmik Biologische Uhren sind Anpassungen des Organismus an zyklische Veränderungen der Umwelt
Gene, Proteine und Aufgaben
 Neuigkeiten aus der Huntington-Forschung. In einfacher Sprache. Von Wissenschaftlern geschrieben Für die Huntington-Gemeinschaft weltweit. Karte der Nachbarschaft: Huntingtin s neue Protein Partner Studie
Neuigkeiten aus der Huntington-Forschung. In einfacher Sprache. Von Wissenschaftlern geschrieben Für die Huntington-Gemeinschaft weltweit. Karte der Nachbarschaft: Huntingtin s neue Protein Partner Studie
Neue Diagnostik für akute myeloische Leukämie
 Neue Diagnostik für akute myeloische Leukämie Neuherberg (9. März 2011) - Wissenschaftler des Helmholtz Zentrums München und der Ludwig-Maximilians-Universität München haben eine Methode entwickelt, mit
Neue Diagnostik für akute myeloische Leukämie Neuherberg (9. März 2011) - Wissenschaftler des Helmholtz Zentrums München und der Ludwig-Maximilians-Universität München haben eine Methode entwickelt, mit
Inflammasom bei der Wundheilung
 MolCare Consulting Dr. Bernd Becker Schulsiedlung 6 D-93109 Wiesent Mobil: +49 173 66 79 505 - Tel: +49 9482 9099 036 - Fax: +49 9482 9099 037 - E-Mail: becker@molcare-consulting.com Inflammasom bei der
MolCare Consulting Dr. Bernd Becker Schulsiedlung 6 D-93109 Wiesent Mobil: +49 173 66 79 505 - Tel: +49 9482 9099 036 - Fax: +49 9482 9099 037 - E-Mail: becker@molcare-consulting.com Inflammasom bei der
Wissen. Demenz Was ist das?
 19 Wissen Demenz Was ist das? Demenz Wie häufig tritt sie auf? Demenz Welche Formen sind bekannt? Demenz Welche Phasen gibt es? Demenz Wie kommt der Arzt zu einer Diagnose? Demenz Welche Therapien gibt
19 Wissen Demenz Was ist das? Demenz Wie häufig tritt sie auf? Demenz Welche Formen sind bekannt? Demenz Welche Phasen gibt es? Demenz Wie kommt der Arzt zu einer Diagnose? Demenz Welche Therapien gibt
Wie viele Neuronen hat der Mensch? a b c
 Wie viele Neuronen hat der Mensch? a. 20 000 000 000 b. 500 000 000 000 c. 100 000 000 000 000 Aus Eins mach Viele Konzentration und Spezialisierung Alle Neurone = Nervensystem Axone Nerven Zellkörper
Wie viele Neuronen hat der Mensch? a. 20 000 000 000 b. 500 000 000 000 c. 100 000 000 000 000 Aus Eins mach Viele Konzentration und Spezialisierung Alle Neurone = Nervensystem Axone Nerven Zellkörper
Phobiemodell. Wer keine Angst hat, hat keine Vorstellungskraft. unbekannt. Ängste in neue Möglichkeiten verwandeln. Worum es geht
 Wer keine Angst hat, hat keine Vorstellungskraft. unbekannt Worum es geht Ängste sind Teil des Lebens; jeder Mensch kennt sie. Sie erfüllen zum Teil wichtige Funktionen, mahnen zur Vorsicht, bewahren vor
Wer keine Angst hat, hat keine Vorstellungskraft. unbekannt Worum es geht Ängste sind Teil des Lebens; jeder Mensch kennt sie. Sie erfüllen zum Teil wichtige Funktionen, mahnen zur Vorsicht, bewahren vor
Vortrag: EEG- Neurofeedback
 Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde Vortrag: EEG- Neurofeedback Organisation des Nervensystems Cortex cerebri (Hirnrinde): 10-50 Mrd. Neurone und Gliazellen ( Stützzellen ) Alle Prozesse, die unter
Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde Vortrag: EEG- Neurofeedback Organisation des Nervensystems Cortex cerebri (Hirnrinde): 10-50 Mrd. Neurone und Gliazellen ( Stützzellen ) Alle Prozesse, die unter

