Gerd Lehmkuhl Fritz Poustka Martin Holtmann Hans Steiner (Hrsg.) Praxishandbuch. Kinder- und Jugendpsychiatrie
|
|
|
- Busso Huber
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Gerd Lehmkuhl Fritz Poustka Martin Holtmann Hans Steiner (Hrsg.) Praxishandbuch Kinder- und Jugendpsychiatrie
2 Praxishandbuch Kinder- und Jugendpsychiatrie
3
4 Praxishandbuch Kinder- und Jugendpsychiatrie herausgegeben von Gerd Lehmkuhl, Fritz Poustka, Martin Holtmann und Hans Steiner unter Mitarbeit von Ulla Breuer Mit Illustrationen von Wolf Erlbruch GÖTTINGEN BERN WIEN PARIS OXFORD PRAG TORONTO BOSTON AMSTERDAM KOPENHAGEN STOCKHOLM FLORENZ HELSINKI SÃO PAULO
5 Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Gerd Lehmkuhl, geb Seit 1988 Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der Universität zu Köln. Prof. Dr. med. Fritz Poustka, geb Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters, Universitätsklinikum Frankfurt am Main. Seit Dezember 2008 Privatpraxis in Frankfurt am Main. Prof. Dr. Dr. med. Martin Holtmann, geb Seit 2010 Direktor der LWL-Universitätsklinik Hamm, Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik. Prof. Dr. med. Hans Steiner, geb Seit 2009 Professor emeritus der Psychiatrie, Stanford University, School of Medicine, Professor für Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters und Entwicklungswissenschaften an der School of Medicine der Stanford University. Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG Göttingen Bern Wien Paris Oxford Prag Toronto Boston Amsterdam Kopenhagen Stockholm Florenz Helsinki São Paulo Merkelstraße 3, Göttingen Aktuelle Informationen Weitere Titel zum Thema Ergänzende Materialien Copyright-Hinweis: Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten. Illustrationen: Wolf Erlbruch, Wuppertal Satz: ARThür Grafik-Design & Kunst, Weimar Format: PDF Print: ISBN E-Book-Formate: (PDF), (EPUB)
6 Nutzungsbedingungen: Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt. Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen. Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book auch nicht auszugsweise anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten. Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig. Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden. Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien. Anmerkung: Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
7 Vorwort Die kleinen Kröteriche von Wolf Erlbruch begleiten auch das vorliegende Praxishandbuch. Es soll eine kurze und pragmatische Einführung in die Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie mit ihren vielfältigen diagnostischen und therapeutischen Fragestellungen sein und die wichtigsten Fakten vermitteln. Wer sich in einzelne Themen weiter vertiefen möchte, findet entsprechende Hinweise auf Textstellen im zweibändigen Lehrbuch der Kinder- und Jugendpsychiatrie (Lehmkuhl et al., 2013). Einleitend werden grundlegende Informationen über Krankheitskonzepte, diagnostische Methoden, Klassifikation und Befunderhebung, therapeutische Prinzipien, Behandlung mit Psychopharmaka, Umgang mit Notfällen und Krisen sowie über zu beachtende rechtliche Aspekte dargestellt. In 15 weiteren Kapiteln wird auf die psychischen Störungsbilder von A bis Z, von affektiven bis Zwangsstörungen näher eingegangen. Warum erschien uns eine solche kompakte Zusammenfassung nach dem Erscheinen des Lehrbuches der Kinder- und Jugendpsychiatrie noch notwendig und sinnvoll? Das Praxishandbuch soll einerseits eine rasche Orientierung bei Fragestellungen in der täglichen klinischen Arbeit ermöglichen und andererseits als Einführung in die Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie dienen. Untersuchungen zur Prävalenz psychischer Störungen, z. B. die bundesweit durchgeführte BELLA -Studie (Ravens-Sieberer et al., 2008), belegen eindrucksvoll, dass bei ca. 15 % der Kinder und Jugend lichen Verhaltensauffälligkeiten vorliegen. Fuchs et al. (2013) weisen darauf hin, dass die Kenntnisse zu Häufigkeit, Bedeutung und weitreichenden Konsequenzen von psychischen Erkrankungen in dieser Altersgruppe im auffälligen Gegensatz zu dem ungenügenden Zugang und der mangelnden Inanspruchnahme von professioneller Hilfe stehen, denn weniger als die Hälfte der Betroffenen befindet sich in Behandlung. Dabei werfen psychische Erkrankungen in Kindheit und Jugend lange Schatten bis weit in das Erwachsenenalter hinein. Aus diesen Gründen kommt Prävention und sachgerechter Behandlung in dieser Lebensspanne, so Fuchs et al. (2013, S. 211), eine immense gesundheitliche und nicht zuletzt ökonomische Bedeutung zu. Ein solches Anliegen lässt sich jedoch nur umsetzen, wenn bereits im Medizinstudium kinder- und jugendpsychiatrische Themen ausreichend vermittelt werden und ein öffentliches Bewusstsein geschaffen wird, das die psychischen Belastungen dieser Altersgruppe ernst nimmt und nicht bagatellisiert. In diesem Sinne soll das Praxishandbuch alle Interessierten ansprechen und motivieren, sich mit Fragen der seelischen Gesundheit von Kindern und Jugend lichen zu beschäftigen. Ein besonderer Dank gilt Frau Dipl.-Psych. Ulla Breuer für die kompetente redaktionelle Planung und Organisation sowie Frau Doris Bürgel für die unermüdliche
8 VI Vorwort Bearbeitung der Texte. Frau Gabriele Meyer-Enders erweiterte mit ihrem Wissen die Liste der störungsspezifischen Kinderbücher. Vom Verlag haben Frau Dipl.- Psych. Susanne Weidinger und Herr Dr. Michael Vogtmeier unser Vorhaben bereitwillig und ermutigend unterstützt. Es bleibt zu hoffen, dass wir mit dem Praxishandbuch viele Leser erreichen und für kinder- und jugendpsychiatrische Themen interessieren können. Köln, Frankfurt, Hamm und Stanford, im März 2015 Gerd Lehmkuhl, Fritz Poustka, Martin Holtmann und Hans Steiner Literatur Fuchs, M., Hayward, Ch. & Steiner, H. (2013). Epidemiologie. In G. Lehmkuhl, F. Poustka, M. Holtmann & H. Steiner (Hrsg.), Lehrbuch der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Band 1: Grundlagen (S ). Göttingen: Hogrefe. Lehmkuhl, G., Holtmann, M., Poustka, F. & Steiner, H. (2013). Lehrbuch der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Band 1 und 2. Göttingen: Hogrefe. Ravens-Sieberer, U., Wille, N., Erhart, M., Bettge, S., Wittchen, H.-U., Rothenberger, A. et al. (2008). Prevalence of mental health problems among children and adolescents in Germany: results of the BELLA study within the National Health Interview and Examination Survey. European Child and Adolescent Psychiatry, 17 (Suppl. 1),
9 Inhaltsverzeichnis I. Allgemeine Grundlagen 1. Theoretische und klinische Grundlagen und pathogenetische Modelle Martin Holtmann, Hans Steiner, Fritz Poustka und Gerd Lehmkuhl Diagnostische Methoden und Untersuchungsverfahren Gerd Lehmkuhl und Fritz Poustka Diagnostik, Befunddokumentation und Klassifikation Gerd Lehmkuhl und Martin Holtmann Grundlagen für Therapie und Beratung Ulrike Lehmkuhl und Gerd Lehmkuhl Grundlagen der Psychopharmako therapie Christoph Wewetzer Psychiatrische Notfälle und Krisen Paul L. Plener Rechtliche Grundlagen Armin Claus II. Störungsbilder von A bis Z 8. Affektive Störungen: Depression und bipolare Störung Martin Holtmann Angststörungen Bernhard Blanz Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen Gerd Lehmkuhl und Martin Holtmann Ausscheidungsstörungen Alexander von Gontard Autismus und tiefgreifende Entwick lungs störungen: Autismus-Spektrum-Störung (ASS) Fritz Poustka und Luise Poustka Borderline-Persönlichkeitsstörung und Selbstverletzungen Maya K. Krischer
10 VIII Inhaltsverzeichnis 14. Dissoziative Störungen und Konversionsstörungen Romuald Brunner Essstörungen Charlotte Jaite und Harriet Salbach-Andrae Posttraumatische Belastungsstörungen Ulla Breuer und Maya Krischer Schizophrenie Ulf Thiemann, Michael Kaess und Franz Resch Störungen im Säuglings- und Kleinkindalter Eva Möhler Störungen des Sozialverhaltens, Dissozialität und Delinquenz Sabine Völkl-Kernstock, Christina Stadler und Hans Steiner Suchterkrankungen Rainer Thomasius und Anneke Aden Tic-Störungen Sina Wanderer, Sabine Mogwitz und Veit Roessner Zwangsstörungen Luise Poustka und Boris Rothermel III. Perspektiven für die Praxis 23. Kinder- und jugendpsychiatrische Störungen: Perspektiven für die Praxis Gerd Lehmkuhl, Martin Holtmann, Fritz Poustka und Hans Steiner Anhang Die Autorinnen und Autoren des Bandes Sachregister
11 I. Allgemeine Grundlagen
12
13 Kapitel 1 Theoretische und klinische Grundlagen und pathogenetische Modelle Martin Holtmann, Hans Steiner, Fritz Poustka und Gerd Lehmkuhl Inhaltsübersicht 1.1 Fallbeispiel Kommentar mit Verlaufs- und Prognose aspekten Nosologie und Epidemiologie: Was sind psy chische Störungen und wie häufig sind sie? Entwicklungspsychopathologie Warum erkrankt dieses Kind? Vulnerabilität und Resilienz: Was tut der Seele gut? Was schadet ihr? Multifaktorielle Krankheitsentstehung Wechselwirkungen von Genen und Umwelt Adoptions- und Zwillingsstudien: Warum unterscheiden sich Menschen? Umweltfaktoren Äqui- und Multifinalität Bindungsforschung und Selbstregulation Welchen Einfluss haben frühe familiäre Interaktionen? Emotions- und Selbstregulation Komorbidität, Verlauf und Prognose Komorbidität Verlauf und Prognose Fallstricke und Konsequenzen für die Therapie Literatur Fallbeispiel Der depressive Nils lebt in einer virtuellen Welt Nils, ein 14-jähriger Realschüler, besucht seit fast 6 Monaten die Schule nicht mehr. Er verbringt bis zu 10 Stunden täglich vor dem PC, beschäftigt sich in dieser Zeit mit Online- Rollenspielen, ist aber auch über soziale Netzwerke mit Jugend lichen in aller Welt in Kontakt. Seine Stimmung ist immer wieder wechselnd, vorherrschend ist eine große Unsicherheit im Kontakt mit Gleichaltrigen. Sein Zimmer verlässt Nils kaum noch, er schläft vom frühen Morgen bis mittags. Schon während der Schwangerschaft hatten Nils Eltern sich getrennt, er wächst bei der Mutter auf, die halbtags berufstätig ist. Zum Vater besteht kein Kontakt. Im Kindergarten war Nils als eher zurückhaltendes Kind erlebt worden. Nils sei nach Angaben der ihm sehr zugewandten Lehrerin in der Grundschule recht gut in die Klassengemeinschaft integriert gewesen, er habe einen engen Freund gehabt. Der Freund sei dann auf ein Gymnasium
14 4 Martin Holtmann, Hans Steiner, Fritz Poustka und Gerd Lehmkuhl gegangen, Nils zur Realschule. Danach sei der Kontakt zwischen beiden nur noch sporadisch gewesen. Nils selbst beschreibt den Wechsel auf die weiterführende Schule als belastenden Einschnitt: Er habe zwar schulisch mithalten können, sich aber in der Klasse überhaupt nicht wohlgefühlt. Die Mutter berichtet, Nils habe sich von einigen Mitschülern gemobbt gefühlt. Obwohl es objektiv nicht zu gravierenden Beleidigungen oder gar Übergriffen gekommen sei, habe Nils sich zunehmend zurückgezogen und aufgrund morgendlicher Bauchschmerzen den Unterricht unregelmäßiger besucht. Sie selbst habe dem nichts entgegensetzen können; eine ambulante Unterstützung durch das Jugendamt sei letztlich wirkungslos geblieben. Die Mutter beschreibt sich selbst als sozial ängstliche Frau; als Jugend liche habe sie eine depressive Phase durchlebt, sei aber nie in therapeutischer Behandlung gewesen. Da Nils selbst eine Behandlung zunächst abgelehnt hatte, erlaubte das Familiengericht eine Unterbringung gegen seinen Willen in einer jugendpsychiatrischen Fachklinik. 1.2 Kommentar mit Verlaufs- und Prognoseaspekten Das Fallbeispiel von Nils soll, stark vereinfachend und reduziert, verdeutlichen, wie eine im Jugendalter auftretende klinische Symptomatik (hier: ängstlich-depressiver Rückzug mit exzessivem Medienkonsum) sich i. S. eines multifaktoriellen Störungsmodells vor dem Hintergrund eines komplexen Bedingungsgefüges von frühem Temperament (schüchtern, zaghaft, slow-to-warm-up), mehreren familiären Belastungsfaktoren (Trennung der Eltern, Fehlen eines männlichen Rollenvorbildes, internalisierende Symptomatik der Mutter) und lebensgeschichtlichen Entwicklungsaufgaben (Schulwechsel) entwickeln kann. Schutzfaktoren (eine wohlwollende Lehrerin in der Grundschule) können zeitweise stabilisierend wirken. Im folgenden Kapitel sollen nach einer kurzen Einführung in die Epidemiologie dann relevante Grundkenntnisse von Entwicklungspsychologie und -psychopathologie, über Schutz- und Risikofaktoren, und die komplexen Wechselwirkungen anlage- und umweltbedingter Einflüsse vermittelt werden. Eine ausführliche, vertiefende Darstellung dieser Themen und weiterer Grundlagen unseres Faches bietet Band 1 von Lehmkuhl und Kollegen (2013). 1.3 Nosologie und Epidemiologie: Was sind psychische Störungen und wie häufig sind sie? Im Rahmen der Psychiatrie hat es immer wieder Grundsatzdiskussionen über die allgemeine Definition von psychischen Störungen gegeben. Eine häufig verwendete Definition betrachtet psychische Störungen als Beeinträchtigungen der normalen Funktionsfähigkeit des Erlebens und Verhaltens, die sich in emotionalen, kognitiven, behavioralen und/oder körperlichen Beeinträchtigungen äußern und
15 Theoretische und klinische Grundlagen und pathogenetische Modelle 5 von der jeweiligen Person nicht oder nur begrenzt beeinflussbar sind. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der Normbegriff. Remschmidt (2000) weist darauf hin, dass sich die Normfrage weniger bei schwerwiegenden psychiatrischen Störungen und Erkrankungen wie Anorexien, Schizophrenien oder schweren Zwangsstörungen stellt, sondern bei einer Reihe von Verhaltensauffälligkeiten, die eher eine Überspitzung des normalen Verhaltens darstellen. Die kategoriale Diagnostik unterteilt in der Tradition somatisch-medizinischer Diagnostik psychische Auffälligkeiten in klar voneinander und von psychischer Normalität abgrenzbare Störungsbilder ( Hat das Kind ADHS oder nicht? ). Kategoriale Diagnosen sind nicht nur die Grundlage und Voraussetzung für epidemiologische und klinische Forschung, sie begründen auch den Zugang zu Therapie und Kostenerstattung. Auch Kinder und Jugend liche, die nicht die kategorialen Kriterien für eine psychiatrische Diagnose erfüllen, sind aber z. T. in ihrem Funktionsniveau erheblich beeinträchtigt. Mit Hilfe eines dimensionalen Ansatzes werden nicht nur die unstrittig pathologischen Fälle identifiziert, sondern auch subklinische Ausprägungen und Normvarianten; dimensionale Verfahren erfassen aber keine Angaben zu Beginn, Verlauf und Prognose einer beschriebenen Störung und dazu, ob einer zunächst rein psychometrisch gewonnenen Störungsdimension eine differenzielle Ätiologie, eine spezifische Pathogenese und ein charakteristischer Verlauf zugeordnet werden können (vgl. Kapitel 3 in diesem Buch). Die Frage nach der Grenze zwischen Normalität und Pathologie, zwischen seelischem Leiden und Krankheit ist u. a. im Zuge der Entstehung des DSM-5 intensiv diskutiert und mit der Warnung vor einer Verschiebung von diagnostischen Grenzen zwischen krank und gesund im Sinne einer Ausweitung psychischen Krankseins verknüpft worden (z. B. DGPPN, 2013; Frances, 2013). Im Kern geht es darum, wie normale Reaktionen auf unvermeidliche Erschütterungen des Lebens von behandlungsbedürftigen Erkrankungen unterschieden werden können. Bei der Unterscheidung von normalem, subklinischem und klinisch relevantem, pathologischem Verhalten ist neben einer fundierten Fachkenntnis eine besondere Sensibilität im Hinblick auf fließende Übergänge von Verhaltensmerkmalen oder Verhaltensauffälligkeiten gefordert; viele bei erwachsenen Menschen auffällige Verhaltensmerkmale gehören bei Kindern und Jugend lichen in verschiedenen Altersbereichen zu einer normgerechten Entwicklung. Epidemiologische Studien führten in den letzten Jahrzehnten zu einem Paradigmenwechsel in der Frage der Existenz, Häufigkeit und Behandlungsbedürftigkeit von psychischen Problemen in Kindheit und Jugend. Mittlerweile gilt als gesichert, dass in etwa die Hälfte aller psychisch erkrankten Erwachsenen weltweit im Teenageralter bereits erkrankt waren. Durch Entwicklung und Einsatz standardisierter Interviewverfahren wurden Resultate international vergleichbar und reproduzierbar (vgl. Lehmkuhl et al., 2013, Kapitel 12). Nicht zuletzt konnte durch epidemiologische Studien gezeigt werden, dass der Anteil an psychisch kranken Menschen in der Gruppe der Kinder und Jugend lichen in etwa gleich groß ist wie in der Gruppe der Erwachsenen.
16 6 Martin Holtmann, Hans Steiner, Fritz Poustka und Gerd Lehmkuhl Merke: Prävalenz Die Prävalenz gibt den Anteil kranker Personen im Vergleich zur untersuchten Bevölkerungsgruppe an. In Abhängigkeit vom Betrachtungszeitraum kann die Prävalenz als Anteil der Erkrankten zu einem bestimmten Zeitpunkt (Punktprävalenz) oder als Anteil der Erkrankten innerhalb eines gewissen Zeitraumes angegeben werden. Die Punktprävalenz ist somit eine Art Bestandsaufnahme der Bevölkerung zu einem bestimmten Zeitpunkt. In vielen Studien wird nur das Wort Prävalenz verwendet, damit ist dann in den meisten Fällen die Punktprävalenz gemeint. Wird die Anzahl der Erkrankten in der bis zum Erhebungszeitpunkt verstrichenen Lebenszeit angegeben, wird von Lebenszeitprävalenz gesprochen. Beobachtungszeiträume in epidemiologischen Studien in der Kinder- und Jugendpsychiatrie können verschieden definiert sein, häufig sind Angaben wie 1 Jahr ( 1-Jahres-Prävalenz ) oder 6 Monate ( 6-Monats-Prävalenz ). Wenn in einer Studie angegeben wird, dass die 6-Monats prä valenz(rate) aller psychischen Störungen im Kinder- und Jugendalter 20 % beträgt, bedeutet das: in einem Beobachtungszeitraum von einem halben Jahr sind im Schnitt 20 % der beobachteten Gruppe erkrankt. Das hieße, praktisch angewendet: In einer durchschnittlichen Schulklasse von 25 Kindern sind in einem Beobachtungszeitraum von einem halben Jahr im Schnitt 20 % der Schulkasse, d. h. 5 Kinder psychisch erkrankt. Wichtige Prävalenzraten sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Die großen 4 der psychiatrischen Diagnosegruppen in Kindheit und Jugend sind demnach: Angststörungen, aggressiv-dissoziale Störungen, emotionale Störungen sowie hyperkinetische Störungen. Tabelle 1: Durchschnittliche Prävalenzraten psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter Störungsbild Durchschnittliche 6-Monats- Prävalenz bis 13 Jahre (Ihle & Esser, 2002) Durchschnittliche 6-Monats-Prävalenz im Kindes- und Jugendalter gesamt (Ihle & Esser, 2002) Ergebnisse der BELLA Studie 7 17 Jahre (Ravens-Sieberer et al., 2008) Angststörungen 7.0 % 10.4 % 10.0 % Aggressiv-dissoziale Störungen Emotionale Störungen Hyperkinetische Störungen 6.5 % 7.5 % 7.6 % 1.5 % 4.4 % 5.4 % 3.5 % 4.4 % 2.2 %
17 Theoretische und klinische Grundlagen und pathogenetische Modelle Entwicklungspsychopathologie Warum erkrankt dieses Kind? Die Wege in eine Störung hinein und aus einer Störung heraus sind sehr individuell. Erklärungsansätze für kinder- und jugendpsychiatrische Erkrankungen haben daher in aller Regel verschiedene Ursachen zu berücksichtigen. Merke: Bei der multifaktoriellen Betrachtung sind sowohl genetische, biologische, psychosoziale, biografische und entwicklungspsychologische Aspekte zu betrachten. Die psychopathologische Symptombildung ist immer im Zusammenhang mit der Lebens- und Zeitgeschichte des einzelnen Kindes im Zusammenleben mit seiner Familie zu begreifen. Fehlanpassungen und psychische Auffälligkeiten können aus der Kombination von normalen Entwicklungsaufgaben, wie Schuleintritt oder Pubertät und kritischen Lebensereignissen entstehen. Lebensereignisse positiver und negativer Art beeinflussen die Entwicklung eines Kindes, müssen jedoch in einem individuellen Kontext betrachtet werden. So kann eine Scheidung für ein Kind positiv sein, wenn es dadurch nicht länger massivsten Streitigkeiten ausgesetzt ist. Eine Heirat kann sich negativ auswirken, wenn der zukünftige Partner der Kindesmutter sich als gewalttätig entpuppt. Durch die Häufung verschiedener Belastungsfaktoren und das Fehlen von gelungenen Bewältigungsstrategien können sich Verhaltensweisen so verändern, dass eine Destabilisierung bis hin zur Erkrankung erfolgt Vulnerabilität und Resilienz: Was tut der Seele gut? Was schadet ihr? Innerhalb der Entwicklungspsychopathologie gewinnt die Untersuchung von Risiko- und Schutzfaktoren zunehmende Bedeutung (vgl. Lehmkuhl et al., 2013, Kapitel 10). Im Zentrum steht die Frage, warum einige Kinder trotz gleicher Risikofaktoren an psychischen Störungen erkranken und andere nicht. Merke: Risikofaktoren Bei einem Risikofaktor handelt es sich um ein Merkmal, bei dessen Vorliegen die Störungswahrscheinlichkeit im Vergleich zu einer unbelasteten Vergleichsgruppe erhöht ist. Man unterscheidet drei Gruppen von Risikofaktoren: biologische Risikofaktoren, wie Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen, genetische Veranlagung, psychologische Risikofaktoren (z. B. Disharmonie in der Partnerschaft, psychische Störung eines Elternteils, Vernachlässigung) und soziale Risikofaktoren (z. B. beengte Wohnverhältnisse, Ein-Eltern-Familie, finanzielle Probleme).
18 8 Martin Holtmann, Hans Steiner, Fritz Poustka und Gerd Lehmkuhl Im klinischen Einzelfall wird die Identifikation von Risikofaktoren für die Entwicklung einer psychischen Störung erschwert durch das Phänomen der Erinnerungsverzerrung; die bereits an einer psychischen Störung leidenden Kinder und Jugend lichen oder ihre Eltern erinnern ihre Vergangenheit anders als die gesunde Normalbevölkerung. Im Kasten 1 sind psychosoziale Risikofaktoren für die Entstehung psychischer Störungen zusammengestellt, die in Längsschnittstudien als relevant identifiziert wurden. Kasten 1: Psychosoziale Risikofaktoren für die Entstehung psychischer Störungen (Häfner et al., 2001a) Chronische Disharmonie und Beziehungspathologie innerhalb der Familie. Psychische Störungen der Mutter oder des Vaters. Häufig wechselnde frühe Bezugspersonen. Kriminalität oder Dissozialität eines Elternteils. Schwere körperliche Erkrankungen der Mutter oder des Vaters. Schlechte Schulbildung der Eltern. Große Familien. Wenig Wohnraum. Verlust der Mutter. Allein erziehende Mutter. Mütterliche Berufstätigkeit im ersten Lebensjahr. Autoritäres väterliches Verhalten. Schlecht ausgeprägte Kontakte zu Gleichaltrigen. Altersabstand zum nächsten Geschwister geringer als 18 Monate. Unerwünschtheit. Nichteheliche Geburt. Junge Mütter bei Geburt des ersten Kindes. Ernste oder häufige Erkrankungen in der Kindheit. Sexueller und/oder aggressiver Missbrauch. Niedriger sozioökonomischer Status. Kontakt mit Einrichtungen der sozialen Kontrolle. Hoher Gesamtrisikoscore/stärkere frühkindliche psychosoziale Belastung. Bedeutsam ist, zu welchem Zeitpunkt in der Entwicklung Belastungen auf ein bestimmtes Kind treffen. Entwicklungsabschnitte, in denen Risikofaktoren einen größeren Einfluss auf die Entstehung von psychischen Störungen haben, werden als kritische Perioden oder Phasen erhöhter Vulnerabilität (Laucht, Esser & Schmidt, 2000) bezeichnet. So gilt das Säuglings- und Kleinkindalter als Phase erhöhter Vulnerabilität, da die Schutz- und Bewältigungsmöglichkeiten noch nicht vollständig ausgebildet sind. Die Risikofaktoren habe in Abhängigkeit von Alter, Geschlecht oder Kontext eine unterschiedliche Auswirkung. Mit zunehmendem Alter verlieren biologische Risiken an Bedeutung, dafür treten die psychosozialen Risiken in den Vordergrund.
19 Theoretische und klinische Grundlagen und pathogenetische Modelle 9 Es treten neben alters- auch geschlechtsspezifische Unterschiede auf, z. B. ist das Erkrankungsrisiko von Jungen (insbesondere für externalisierende Störungen) vor der Pubertät höher. Bei Mädchen hingegen treten vermehrt Störungen (insbesondere Angst und Depression) mit und nach der Pubertät auf. Risikofaktoren können zeitlich nah (proximal) oder mit größerem Abstand (distal) zum Störungsbeginn auftreten. Ein Risikofaktor kann bereits Jahre zurück liegen, ehe eine psychische Störung auftritt. Andere Risiken treten unmittelbar vor Krankheitsbeginn auf: z. B. sind kritische Lebensereignisse (Verlust einer nahe stehenden Person, Umschulung und andere psychosoziale Belastungen) oftmals proximale Risikofaktoren, die einer psychischen Störung unmittelbar vorausgehen. Dass die Auswirkungen von Risikofaktoren (z. B. traumatischen Lebensereignissen) bei einigen Kindern weniger schwerwiegend sind, bzw. psychische Störungen im weiteren Verlauf nicht auftreten, ist eine der wichtigsten Beobachtungen der Entwicklungspsychologie. Trotz widriger, riskanter Umstände und Lebensereignisse entwickeln sich nicht wenige Kinder später zu gesunden Erwachsenen ohne nennenswerte Beeinträchtigungen. Diese Fähigkeit, relativ unbeschadet mit den Folgen belastender und bedrohlicher Lebensumstände umgehen und Bewältigungskompetenzen entwickeln zu können, steht im Zentrum der Resilienzforschung. Merke: Resilienz Mit Resilienz wird die Stärke eines Menschen bezeichnet, relativ unbeschadet mit den Folgen belastender und bedrohlicher Lebensumstände umgehen und Bewältigungskompetenzen entwickeln zu können. Resilienz ist nicht in jedem Fall eine unveränderliche, zeitlich überdauernde Persönlichkeitseigenschaft; vielmehr können Kinder und Jugend liche zu einem Zeitpunkt gegenüber aversiven Erfahrungen resilient sein, sich aber später gegenüber anderen Belastungen als vulnerabel erweisen. Die frühe Resilienzforschung konzentrierte sich besonders auf die personalen Ressourcen der Kinder und belegte in diesem Zusammenhang etwa die Bedeutung von positiven Temperamentsfaktoren, Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, positivem Selbstwertgefühl und guter Begabung (Laucht et al., 1997). Im Verlauf wurde zusätzlich berücksichtigt, dass die positive Bewältigung von Risiken oftmals durch außerhalb des Kindes liegende Faktoren gestützt wird, die etwa in der Familie oder der sozialen Umwelt des Kindes in Erscheinung treten. Somit unterscheidet man nunmehr zwischen kindbezogenen Resilienzfaktoren und familiären und sozialen Ressourcen. Bei den protektiven Faktoren geht es nicht nur um die Abwesenheit von Risikound Belastungsmerkmalen, sondern auch um fördernde Faktoren im sozialen Umfeld der Kinder sowie um deren physiologische und psychologische Eigenschaften (vgl. Kasten 2).
20 10 Martin Holtmann, Hans Steiner, Fritz Poustka und Gerd Lehmkuhl Kasten 2: Schutzfaktoren (nach Häfner et al., 2001b) Dauerhafte und gute Beziehung zu mindestens einer primären Bezugsperson. Internale Kontrollüberzeugungen: Ich kann wirksam sein. Aufwachsen in einer Familie mit Entlastung der Mutter, weitere kompensatorische Bezugspersonen. Ein insgesamt positives Elternbild. Mindestens durchschnittliche Intelligenz. Ein robustes, aktives und kontaktfreudiges Temperament. Soziale Förderung (Schule, Kirche, Jugendgruppen). Eine oder mehrere verlässlich unterstützende Bezugspersonen im Erwachsenenalter. Lebenszeitlich späteres Eingehen sogenannter schwer auflösbarer Bindungen. Geringere Risikogesamtbelastung. Statt zu untersuchen, welche Faktoren im Sinne einer einfachen Ursache-Wirkungs-Beziehung mit einer besseren Bewältigung von Belastungen einhergehen, hat sich der Fokus der modernen Resilienzforschung verschoben hin zu einem Bemühen um das Verständnis der spezifischen Prozesse und Mechanismen, die protektiv wirken. Dieses Vorgehen berücksichtigt verschiedenste Ebenen, von den Genen bis zu Beziehungen, und bemüht sich, die Wechselwirkungen zwischen diesen zu erhellen (Holtmann & Schmidt, 2004). 1.5 Multifaktorielle Krankheitsentstehung Wechselwirkungen von Genen und Umwelt Im klinischen Einzelfall wird es nicht immer gelingen, die verschiedenen wirksamen Einflüsse auf die Entstehung einer Störung voneinander zu trennen. Für das Kind einer Mutter mit eigener depressiver Störung ist diese Mutter sowohl prägende Umwelt als auch möglicherweise Vermittlerin einer genetischen Veranlagung für affektive Erkrankungen. Die Forschung zu genetischen und Umwelteinflüssen hilft aber, auch für den individuellen klinischen Fall möglicherweise bedeutsame Mechanismen zu verstehen. Die Mehrzahl psychischer Störungen hat eine multifaktorielle Genese. An ihrer Entstehung sind neben komplexen genetischen Ursachen meist ein oder mehrere Umweltfaktoren beteiligt. Adoptions-, Zwillings- und Familienstudien legen eine starke genetische Komponente für viele kinder- und jugendpsychiatrische Störungen nahe, etwa für die hyperkinetische Störung, das Tourette-Syndrom, affektive Erkrankungen, Schizophrenie, Zwangsstörungen und Dyslexie (vgl. Lehmkuhl et al., 2013, Kapitel 3, S. 69).
21 Theoretische und klinische Grundlagen und pathogenetische Modelle 11 Das Wissen um genetische Grundlagen kann unser Verständnis davon verbessern warum und durch welche Mechanismen Veränderungen der Proteinexpression psychische Erkrankungen bedingen (Molekularbiologie), wie Wechselwirkungen zwischen genetischer Ausstattung und Umwelteinflüssen, wie Erziehungsbedingungen, Traumata und belastenden Lebensereignissen vorstellbar sind (Gen-Umwelt-Interaktion), wie Menschen sich aufgrund ihrer genetischen Ausstattung eine bestimmte Umwelt suchen (Gen-Umwelt-Korrelation), warum manche Individuen nicht mit Störungen auf belastende Lebensereignisse reagieren, sondern gegen diese resilient, d. h. widerstandsfähig sind (Resilienz-Forschung). Das Ausmaß genetischer Einflüsse kann mittels eines Kennwertes quantifiziert werden, der als Erblichkeit bezeichnet wird. Merke: Erblichkeit Erblichkeit (Heritabilität) ist ein statistischer Begriff, der aussagt, in welchem Ausmaß die beobachteten (phänotypischen) Unterschiede (Varianz) zwischen Menschen durch genetische Bedingungen bestimmt werden. Phänotypische Unterschiede, die nicht durch genetische Unterschiede erklärt werden, können der Umwelt zugeschrieben werden. Die Angabe, dass die Erblichkeit der Körpergröße 80 % beträgt, besagt, dass 80 % der Varianz in einer definierten Population auf genetische Differenzen zurückgeht Adoptions- und Zwillingsstudien: Warum unterscheiden sich Menschen? Die Verhaltensgenetik interessiert sich für die genetischen und umweltbedingten Ursachen interindividueller Unterschiede (Plomin et al., 1999). Im Bereich komplexer menschlicher Verhaltensmerkmale macht man sich natürliche, quasi-experimentelle Situationen zunutze, um die kombinierten Einflüsse von genetischer Anlage und Umwelt zu erfassen: Adoptionen und Zwillingsgeburten. Adoptionen stellen den unmittelbarsten Zugang zur Entflechtung von genetischen und umweltbedingten Ursachen der Ähnlichkeit und Unähnlichkeit in Familien dar. Bei Adoptionen existieren genetische Eltern (die leiblichen Eltern, die ihr Kind kurz nach der Geburt zur Adoption freigeben) und Umwelt -Eltern (die die Kinder adoptieren, genetisch aber nicht mit ihnen verwandt sind). Die Ähnlichkeit zwischen den leiblichen Eltern und ihren adoptierten Kindern ist die Grundlage zur Schätzung des Anteils der Familienähnlichkeit, der auf genetische Faktoren zurückgeht. Die Ähnlichkeit zwischen Adoptiveltern und Adoptivkindern ist ein direktes Maß für den Beitrag von Umwelteinflüssen zur Eltern-Kind-Ähnlichkeit. Eine zweite wichtige Methode stützt sich auf Zwillingsgeburten. Vereinfacht dargestellt teilen Zwillinge, gleich ob mono- oder dizygot, miteinander die gleiche
22 12 Martin Holtmann, Hans Steiner, Fritz Poustka und Gerd Lehmkuhl prä-, peri- und postnatale Umgebung. Wenn ein bestimmtes Merkmal bei monound dizygoten Zwillingen gleichermaßen häufig auftritt, ist dieses mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht genetisch bedingt. Als Beispiel mag die Konkordanzrate für die Muttersprache dienen: ob ein Zwilling, wenn sein Co-Zwilling Deutsch spricht, auch Deutsch als Muttersprache aufweist, hängt nicht davon ab, ob es sich um mono- oder dizygote Zwillinge handelt. Die Muttersprache ist vielmehr von nicht genetischen Umweltbedingungen beeinflusst. Wenn das untersuchte Merkmal aber stark genetisch determiniert ist, wird die Konkordanzrate monozygoter Zwillinge weit über derjenigen dizygoter Zwillinge liegen. Neben klassischen Zwillingsuntersuchungen können auch ein- und zweieiige Zwillinge verglichen werden, die kurz nach der Geburt voneinander getrennt und adoptiert wurden und in zwei verschiedenen Umgebungen aufwachsen (twins raised apart) Umweltfaktoren Zwillings- und Adoptionsstudien haben nicht nur das Wissen über den Einfluss genetischer Faktoren auf Verhaltensausprägungen vermehrt, sondern auch den Einfluss der Familienumwelt deutlich gemacht. Interessanterweise spielen Einflüsse der geteilten Umwelt in den meisten Bereichen der Psychopathologie eine untergeordnete Rolle. In der Regel sind es (neben den genetischen Faktoren) die Einflüsse der nicht geteilten Umwelt, auf welche die phänotypische Varianz zurückgeht. Zur Aufdeckung nicht geteilter Umwelteinflüsse ist es notwendig, solche Umweltaspekte zu erheben, die spezifisch für ein Kind sind, anstatt von Geschwistern geteilte Einflüsse zu untersuchen. Die Tatsache, dass Eltern beispielsweise geschieden sind, gilt zunächst für zwei Kinder einer Familie gleichermaßen. Erfasst man ein Lebensereignis wie die Scheidung auf diese allgemeine Weise, kann die Information keine Quelle für Unterschiede in den Merkmalen von Geschwistern sein. Werden aber die unterschiedlichen, spezifischen Wahrnehmungen der Kinder in Bezug auf den durch die Trennung der Eltern ausgelösten Stress erfragt, können diese sich durchaus bei Geschwistern unterscheiden und zu Unterschieden beitragen. Die nicht geteilte Umwelt beschränkt sich aber nicht auf den Familienbereich. Erfahrungen außerhalb der Familie, wie etwa in Gruppen Gleichaltriger, werden von Kindern oft recht unterschiedlich erlebt und sind vermutlich noch wichtigere Quellen nicht geteilter Umwelt. Merke: Die Beziehungen zwischen genetischer Ausstattung und Umwelteinflüssen sind komplex. Studien deuten darauf hin, dass Menschen aktiv an der Schaffung ihrer Erfahrung mitwirken, und dies teilweise aus genetischen Gründen. Dieses Phänomen wird auch als die Genetik der Umwelt oder Gen-Umwelt-Korrelation bezeichnet, weil es zu erklären sucht, wie Menschen sich aufgrund ihrer genetisch bedingten Ausstattung und Neigung eine bestimmte Umwelt schaffen oder suchen. Demgegenüber untersuchen Studien zur Genotyp-Umwelt-Interak-
Meyer Hautzinger. Ratgeber Manisch-depressive Erkrankung. Informationen für Menschen mit einer bipolaren Störung und deren Angehörige
 Meyer Hautzinger Ratgeber Manisch-depressive Erkrankung Informationen für Menschen mit einer bipolaren Störung und deren Angehörige Ratgeber Manisch-depressive Erkrankung Ratgeber zur Reihe Fortschritte
Meyer Hautzinger Ratgeber Manisch-depressive Erkrankung Informationen für Menschen mit einer bipolaren Störung und deren Angehörige Ratgeber Manisch-depressive Erkrankung Ratgeber zur Reihe Fortschritte
Wolkenstein Hautzinger. Ratgeber Chronische Depression. Informationen für Betroffene und Angehörige
 Wolkenstein Hautzinger Ratgeber Chronische Depression Informationen für Betroffene und Angehörige Ratgeber Chronische Depression und an Dritte weitergegeben werden Aus Wolkenstein und Hautzinger: Ratgeber
Wolkenstein Hautzinger Ratgeber Chronische Depression Informationen für Betroffene und Angehörige Ratgeber Chronische Depression und an Dritte weitergegeben werden Aus Wolkenstein und Hautzinger: Ratgeber
Chronische Depression
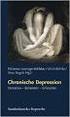 tschritte der Eva-Lotta Psychotherapie Brakemeier Fortschritte der Elisabeth Psychotherapie Schramm Fortschritte de Fortschritte Martin der Psychotherapie Hautzinger Fortschritte der Psychotherapie Fortschritte
tschritte der Eva-Lotta Psychotherapie Brakemeier Fortschritte der Elisabeth Psychotherapie Schramm Fortschritte de Fortschritte Martin der Psychotherapie Hautzinger Fortschritte der Psychotherapie Fortschritte
Nyberg Hofecker-Fallahpour Stieglitz. Ratgeber ADHS bei Erwachsenen. Informationen für Betroffene und Angehörige
 Nyberg Hofecker-Fallahpour Stieglitz Ratgeber ADHS bei Erwachsenen Informationen für Betroffene und Angehörige Ratgeber ADHS bei Erwachsenen und an Dritte weitergegeben werden Aus E Nyberg/M Hofecker-Fallahpour/R-D
Nyberg Hofecker-Fallahpour Stieglitz Ratgeber ADHS bei Erwachsenen Informationen für Betroffene und Angehörige Ratgeber ADHS bei Erwachsenen und an Dritte weitergegeben werden Aus E Nyberg/M Hofecker-Fallahpour/R-D
Anpassungsstörung und Akute Belastungsreaktion
 Anpassungsstörung und Akute Belastungsreaktion Fortschritte der Psychotherapie Band 39 Anpassungsstörung und Akute Belastungsreaktion von Prof. Dr. Dr. Jürgen Bengel und Dipl.-Psych. Sybille Hubert Herausgeber
Anpassungsstörung und Akute Belastungsreaktion Fortschritte der Psychotherapie Band 39 Anpassungsstörung und Akute Belastungsreaktion von Prof. Dr. Dr. Jürgen Bengel und Dipl.-Psych. Sybille Hubert Herausgeber
Deviantes Verkehrsverhalten
 Jürgen Raithel Andreas Widmer Deviantes Verkehrsverhalten Grundlagen, Diagnostik und verkehrspsychologische Therapie Deviantes Verkehrsverhalten Deviantes Verkehrsverhalten Grundlagen, Diagnostik und
Jürgen Raithel Andreas Widmer Deviantes Verkehrsverhalten Grundlagen, Diagnostik und verkehrspsychologische Therapie Deviantes Verkehrsverhalten Deviantes Verkehrsverhalten Grundlagen, Diagnostik und
Diagnostik von Rechenstörungen
 Claus Jacobs Franz Petermann Diagnostik von Rechenstörungen 2., überarbeitete und erweiterte Auflage Kompendien Psychologische Diagnostik Band 7 Diagnostik von Rechenstörungen Kompendien Psychologische
Claus Jacobs Franz Petermann Diagnostik von Rechenstörungen 2., überarbeitete und erweiterte Auflage Kompendien Psychologische Diagnostik Band 7 Diagnostik von Rechenstörungen Kompendien Psychologische
Zahnbehandlungs- phobie
 ortschritte Gudrun der Psychotherapie Sartory Fortschritte André der Wannemüller Psychotherapie Fortschritte pie Fortschr Psychotherapie Zahnbehandlungs- Fortschritte der Psychotherapie Fortschritte der
ortschritte Gudrun der Psychotherapie Sartory Fortschritte André der Wannemüller Psychotherapie Fortschritte pie Fortschr Psychotherapie Zahnbehandlungs- Fortschritte der Psychotherapie Fortschritte der
Gunilla Wewetzer Martin Bohus. Borderline- Störung im Jugendalter. Ein Ratgeber für Jugendliche und Eltern
 Gunilla Wewetzer Martin Bohus Borderline- Störung im Jugendalter Ein Ratgeber für Jugendliche und Eltern Borderline-Störung im Jugendalter Gunilla Wewetzer Martin Bohus Borderline-Störung im Jugendalter
Gunilla Wewetzer Martin Bohus Borderline- Störung im Jugendalter Ein Ratgeber für Jugendliche und Eltern Borderline-Störung im Jugendalter Gunilla Wewetzer Martin Bohus Borderline-Störung im Jugendalter
Klärungsorientierte Psychotherapie der histrionischen Persönlichkeitsstörung
 Praxis der Psychotherapie von Persönlichkeitsstörungen Rainer Sachse Jana Fasbender Janine Breil Meike Sachse Klärungsorientierte Psychotherapie der histrionischen Persönlichkeitsstörung Klärungsorientierte
Praxis der Psychotherapie von Persönlichkeitsstörungen Rainer Sachse Jana Fasbender Janine Breil Meike Sachse Klärungsorientierte Psychotherapie der histrionischen Persönlichkeitsstörung Klärungsorientierte
eine Hochrisikopopulation: Biographien betroffener Persönlichkeiten
 Kinder psychisch kranker Eltern eine Hochrisikopopulation: p Biographien betroffener Persönlichkeiten Susanne Schlüter-Müller Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Fürstenbergerstr.
Kinder psychisch kranker Eltern eine Hochrisikopopulation: p Biographien betroffener Persönlichkeiten Susanne Schlüter-Müller Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Fürstenbergerstr.
Ratgeber Schlafstörungen
 Ratgeber zur Reihe Fortschritte der Psychotherapie herausgegeben von Prof. Dr. Dietmar Schulte, Prof. Dr. Klaus Grawe, Prof. Dr. Kurt Hahlweg, Prof. Dr. Dieter Vaitl Band 2 Ratgeber Schlafstörungen von
Ratgeber zur Reihe Fortschritte der Psychotherapie herausgegeben von Prof. Dr. Dietmar Schulte, Prof. Dr. Klaus Grawe, Prof. Dr. Kurt Hahlweg, Prof. Dr. Dieter Vaitl Band 2 Ratgeber Schlafstörungen von
Aggression bei Kindern und Jugendlichen
 Cecilia A. Essau Judith Conradt Aggression bei Kindern und Jugendlichen Mit 21 Abbildungen, 11 Tabellen und 88 Übungsfragen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. Cecilia A. Essau lehrt Entwicklungspsychopathologie
Cecilia A. Essau Judith Conradt Aggression bei Kindern und Jugendlichen Mit 21 Abbildungen, 11 Tabellen und 88 Übungsfragen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. Cecilia A. Essau lehrt Entwicklungspsychopathologie
Veränderte Kindheit? Wie beeinflusst der aktuelle Lebensstil die psychische Gesundheit von Kindern?
 Tag der Psychologie 2013 Lebensstilerkrankungen 1 Veränderte Kindheit? Wie beeinflusst der aktuelle Lebensstil die psychische Gesundheit von Kindern? 2 Überblick Lebensstilerkrankungen bei Kindern Psychische
Tag der Psychologie 2013 Lebensstilerkrankungen 1 Veränderte Kindheit? Wie beeinflusst der aktuelle Lebensstil die psychische Gesundheit von Kindern? 2 Überblick Lebensstilerkrankungen bei Kindern Psychische
Fortschritte der Psychotherapie Fortschritte der Psychotherapie. pie Fortschritte der Psychotherapie Fortschritte der Psychotherapie Fortschr
 Psychotherapie Fortschritte der Psychotherapie Fortschritte der Psychother er Psychotherapie Fortschritte der Psychotherapie Fortschritte der Psychoritte der Psychotherapie Fortschritte der Psychotherapie
Psychotherapie Fortschritte der Psychotherapie Fortschritte der Psychother er Psychotherapie Fortschritte der Psychotherapie Fortschritte der Psychoritte der Psychotherapie Fortschritte der Psychotherapie
Depressive Störungen bei Krebserkrankungen
 Depressive Störungen bei Krebserkrankungen Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden Aus Beutel et al: Depressive
Depressive Störungen bei Krebserkrankungen Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden Aus Beutel et al: Depressive
Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie Band 6 Lese-Rechtschreibstörungen von Prof. Dr. Andreas Warnke, Dr. Uwe Hemminger und Dr.
 Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie Band 6 Lese-Rechtschreibstörungen von Prof. Dr. Andreas Warnke, Dr. Uwe Hemminger und Dr. Ellen Plume Herausgeber der Reihe: Prof. Dr. Manfred Döpfner, Prof.
Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie Band 6 Lese-Rechtschreibstörungen von Prof. Dr. Andreas Warnke, Dr. Uwe Hemminger und Dr. Ellen Plume Herausgeber der Reihe: Prof. Dr. Manfred Döpfner, Prof.
Aktiv gegen Demenz. Wolf D. Oswald. Fit und selbstständig bis ins hohe Alter mit dem SimA Gedächtnis- und Psychomotoriktraining
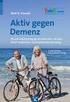 Wolf D. Oswald Aktiv gegen Demenz Fit und selbstständig bis ins hohe Alter mit dem SimA Gedächtnis- und Psychomotoriktraining 2., überarbeitete und erweiterte Auflage Aktiv gegen Demenz Fit und selbstständig
Wolf D. Oswald Aktiv gegen Demenz Fit und selbstständig bis ins hohe Alter mit dem SimA Gedächtnis- und Psychomotoriktraining 2., überarbeitete und erweiterte Auflage Aktiv gegen Demenz Fit und selbstständig
Inhalt. Vorwort 13. Teil I Grundlagen Entwicklungspsychopathologie: Definition 16
 2011 Beltz Verlag, Weinheim Basel http://www.beltz.de/de/nc/verlagsgruppe-beltz/gesamtprogramm.html?isbn=978-3-621-27806-5 Vorwort 13 Teil I Grundlagen 15 1 Entwicklungspsychopathologie: Definition 16
2011 Beltz Verlag, Weinheim Basel http://www.beltz.de/de/nc/verlagsgruppe-beltz/gesamtprogramm.html?isbn=978-3-621-27806-5 Vorwort 13 Teil I Grundlagen 15 1 Entwicklungspsychopathologie: Definition 16
Aggression bei Kindern und Jugendlichen
 Cecilia A. Essau Judith Conradt Aggression bei Kindern und Jugendlichen Mit 21 Abbildungen, 11 Tabellen und 88 Übungsfragen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Inhalt Vorwort und Danksagung 11 I Merkmale
Cecilia A. Essau Judith Conradt Aggression bei Kindern und Jugendlichen Mit 21 Abbildungen, 11 Tabellen und 88 Übungsfragen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Inhalt Vorwort und Danksagung 11 I Merkmale
Grundbedingungen nach Jaspers (1965)
 Inhaltsübersicht -Allgemeine Überlegungen -Nomenklatur psychoreaktiver Störungen -Akute Belastungsreaktion -Posttraumatische Belastungsstörung -Anpassungsstörungen -Sonstige psychopathologische Syndrome
Inhaltsübersicht -Allgemeine Überlegungen -Nomenklatur psychoreaktiver Störungen -Akute Belastungsreaktion -Posttraumatische Belastungsstörung -Anpassungsstörungen -Sonstige psychopathologische Syndrome
Kindes und Jugendalters. Störung des.
 Vorlesung Psychopathologie des Kindes und Jugendalters Störung des Sozialverhaltens www.zi-mannheim.de Störungen 2 Kernsymptomatik 1. Wutausbrüche 2. Häufiges Streiten 3. Opposition gg Erwachsene 4. Planvolles
Vorlesung Psychopathologie des Kindes und Jugendalters Störung des Sozialverhaltens www.zi-mannheim.de Störungen 2 Kernsymptomatik 1. Wutausbrüche 2. Häufiges Streiten 3. Opposition gg Erwachsene 4. Planvolles
Sind wir noch normal? Psychische Störungen vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen.
 Sind wir noch normal? Psychische Störungen vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen. Prof. Dr. Dr. Martin Holtmann Martin Holtmann LWL-Universitätsklinik Hamm der Ruhr-Universität Klinik für
Sind wir noch normal? Psychische Störungen vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen. Prof. Dr. Dr. Martin Holtmann Martin Holtmann LWL-Universitätsklinik Hamm der Ruhr-Universität Klinik für
DEPRESSIONEN. Referat von Sophia Seitz und Ester Linz
 DEPRESSIONEN Referat von Sophia Seitz und Ester Linz ÜBERSICHT 1. Klassifikation 2. Symptomatik 3. Gruppenarbeit 4. Diagnostische Verfahren 5. Epidemiologie 6. Ätiologische Modelle 7. Fallbeispiel KLASSIFIKATION
DEPRESSIONEN Referat von Sophia Seitz und Ester Linz ÜBERSICHT 1. Klassifikation 2. Symptomatik 3. Gruppenarbeit 4. Diagnostische Verfahren 5. Epidemiologie 6. Ätiologische Modelle 7. Fallbeispiel KLASSIFIKATION
Diagnostik sozialer Kompetenzen
 Diagnostik sozialer Kompetenzen Kompendien Psychologische Diagnostik Band 4 Diagnostik sozialer Kompetenzen von Prof. Dr. Uwe Peter Kanning Herausgeber der Reihe: Prof. Dr. Franz Petermann und Prof. Dr.
Diagnostik sozialer Kompetenzen Kompendien Psychologische Diagnostik Band 4 Diagnostik sozialer Kompetenzen von Prof. Dr. Uwe Peter Kanning Herausgeber der Reihe: Prof. Dr. Franz Petermann und Prof. Dr.
Neue Bindungen wagen
 Silke Birgitta Gahleitner Neue Bindungen wagen Beziehungsorientierte Therapie bei sexueller Traumatisierung Ernst Reinhardt Verlag München Basel Dr. phil. Silke Birgitta Gahleitner, Studium der Sozialpädagogik
Silke Birgitta Gahleitner Neue Bindungen wagen Beziehungsorientierte Therapie bei sexueller Traumatisierung Ernst Reinhardt Verlag München Basel Dr. phil. Silke Birgitta Gahleitner, Studium der Sozialpädagogik
Psychische Gesundheit und Resilienz stärken
 Psychische Gesundheit und Resilienz stärken 19. Fachtagung der Fachschule für Sozialwesen der Johannes-Diakonie Mosbach 14. April 2016 Dipl.-Psych. Lisa Lyssenko Prof. Dr. Martin Bohus Zentralinstitut
Psychische Gesundheit und Resilienz stärken 19. Fachtagung der Fachschule für Sozialwesen der Johannes-Diakonie Mosbach 14. April 2016 Dipl.-Psych. Lisa Lyssenko Prof. Dr. Martin Bohus Zentralinstitut
Diagnostik von Traumafolgestörungen bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
 Diagnostik von Traumafolgestörungen bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen Sabine Korda Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie
Diagnostik von Traumafolgestörungen bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen Sabine Korda Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie
Aufmerksamkeitsstörungen
 Aufmerksamkeitsstörungen Fortschritte der Neuropsychologie Band 4 Aufmerksamkeitsstörungen von Prof. Dr. Walter Sturm Herausgeber der Reihe: Prof. Dr. Herta Flor, Prof. Dr. Siegfried Gauggel, Prof. Dr.
Aufmerksamkeitsstörungen Fortschritte der Neuropsychologie Band 4 Aufmerksamkeitsstörungen von Prof. Dr. Walter Sturm Herausgeber der Reihe: Prof. Dr. Herta Flor, Prof. Dr. Siegfried Gauggel, Prof. Dr.
Gunter Groen Franz Petermann. Wie wird mein. Kind. wieder glücklich? Praktische Hilfe gegen Depressionen
 Gunter Groen Franz Petermann Wie wird mein Kind wieder glücklich? Praktische Hilfe gegen Depressionen Groen / Petermann Wie wird mein Kind wieder glücklich? Verlag Hans Huber Psychologie Sachbuch Wissenschaftlicher
Gunter Groen Franz Petermann Wie wird mein Kind wieder glücklich? Praktische Hilfe gegen Depressionen Groen / Petermann Wie wird mein Kind wieder glücklich? Verlag Hans Huber Psychologie Sachbuch Wissenschaftlicher
Was unser Baby sagen will
 Angelika Gregor Was unser Baby sagen will Mit einem Geleitwort von Manfred Cierpka Mit 48 Abbildungen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Dr. phil. Dipl.-Psych. Angelika Gregor, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin,
Angelika Gregor Was unser Baby sagen will Mit einem Geleitwort von Manfred Cierpka Mit 48 Abbildungen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Dr. phil. Dipl.-Psych. Angelika Gregor, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin,
Ratgeber Soziale Phobie
 Ratgeber Soziale Phobie Ratgeber zur Reihe Fortschritte der Psychotherapie Band 20 Ratgeber Soziale Phobie von Katrin von Consbruch und Ulrich Stangier Herausgeber der Reihe: Prof. Dr. Dietmar Schulte,
Ratgeber Soziale Phobie Ratgeber zur Reihe Fortschritte der Psychotherapie Band 20 Ratgeber Soziale Phobie von Katrin von Consbruch und Ulrich Stangier Herausgeber der Reihe: Prof. Dr. Dietmar Schulte,
Psychosoziale Diagnostik in der Jugendhilfe
 Viola Harnach Psychosoziale Diagnostik in der Jugendhilfe Grundlagen und Methoden für Hilfeplan, Bericht und Stellungnahme 5., überarbeitete Auflage 2007 Juventa Verlag Weinheim und München Inhalt 1. Aufgaben
Viola Harnach Psychosoziale Diagnostik in der Jugendhilfe Grundlagen und Methoden für Hilfeplan, Bericht und Stellungnahme 5., überarbeitete Auflage 2007 Juventa Verlag Weinheim und München Inhalt 1. Aufgaben
Abgerufen am von anonymous. Management Handbuch für die Psychotherapeutische Praxis
 Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar.
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar.
Inhaltsverzeichnis. Allgemeine Einführung in die Ursachen psychischer Erkrankungen sowie deren Bedeutung
 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Einführung in die Ursachen psychischer Erkrankungen sowie deren Bedeutung XIII 1 Diagnostik und Klassifikation in der Psychiatrie 1.1 Psychiatrische Anamneseerhebung 1 Synonyme
Inhaltsverzeichnis Allgemeine Einführung in die Ursachen psychischer Erkrankungen sowie deren Bedeutung XIII 1 Diagnostik und Klassifikation in der Psychiatrie 1.1 Psychiatrische Anamneseerhebung 1 Synonyme
Zahlen, Daten, Fakten zur gesundheitlichen Lage von Heranwachsenden
 Zahlen, Daten, Fakten zur gesundheitlichen Lage von Heranwachsenden & KiGGS Study Group Robert Koch-Institut, Berlin Kein Kind zurück lassen! Fachveranstaltung RUNDUM GESUND 19. Februar 2015, Bielefeld
Zahlen, Daten, Fakten zur gesundheitlichen Lage von Heranwachsenden & KiGGS Study Group Robert Koch-Institut, Berlin Kein Kind zurück lassen! Fachveranstaltung RUNDUM GESUND 19. Februar 2015, Bielefeld
Wir über uns. Informationen zur Station 0.2// Mutter-Kind-Behandlung // Kompetent für Menschen.
 Wir über uns Informationen zur Station 0.2// Mutter-Kind-Behandlung // Kompetent für Menschen. 02 BEGRÜSSUNG Gesundheit ist das höchste Gut. Sie zu erhalten, haben wir uns zur Aufgabe gemacht. Wir heißen
Wir über uns Informationen zur Station 0.2// Mutter-Kind-Behandlung // Kompetent für Menschen. 02 BEGRÜSSUNG Gesundheit ist das höchste Gut. Sie zu erhalten, haben wir uns zur Aufgabe gemacht. Wir heißen
Gustav Keller Professionelle Kommunikation im Schulalltag. Praxishilfen für Lehrkräfte
 Gustav Keller Professionelle Kommunikation im Schulalltag Praxishilfen für Lehrkräfte Professionelle Kommunikation im Schulalltag Professionelle Kommunikation im Schulalltag Praxishilfen für Lehrkräfte
Gustav Keller Professionelle Kommunikation im Schulalltag Praxishilfen für Lehrkräfte Professionelle Kommunikation im Schulalltag Professionelle Kommunikation im Schulalltag Praxishilfen für Lehrkräfte
Inhalt: Der Herausgeber: Titel von Alfried Längle bei facultas.wuv: Copyright-Hinweis: Nutzungsbedingungen:
 Inhalt: Die Personale Existenzanalyse ist eine psychotherapeutische Methode, durch welche die Ressourcen der Person zu therapeutischen Zwecken unmittelbar mobilisiert werden können. Das Buch vermittelt
Inhalt: Die Personale Existenzanalyse ist eine psychotherapeutische Methode, durch welche die Ressourcen der Person zu therapeutischen Zwecken unmittelbar mobilisiert werden können. Das Buch vermittelt
Wahrnehmung von Resilienzfaktoren und deren Förderung in HzE
 Wahrnehmung von Resilienzfaktoren und deren Förderung in HzE Martina Huxoll 7. Oktober 2010 in Wuppertal Merkmale und Fähigkeiten resilienter Menschen : Resilienz ist nach Opp: Kombination von Faktoren,
Wahrnehmung von Resilienzfaktoren und deren Förderung in HzE Martina Huxoll 7. Oktober 2010 in Wuppertal Merkmale und Fähigkeiten resilienter Menschen : Resilienz ist nach Opp: Kombination von Faktoren,
Ärztliche Stellungnahme zur Planung einer Eingliederungshilfe
 Ärztliche Stellungnahme zur Planung einer Eingliederungshilfe Vertrauliche Stellungnahme ( 203 StGB und 76 SGB X) nach 35a SGB VIII (KJHG), nach 53 SGB XII (nur amts- oder landesärztliche Stellungnahme)
Ärztliche Stellungnahme zur Planung einer Eingliederungshilfe Vertrauliche Stellungnahme ( 203 StGB und 76 SGB X) nach 35a SGB VIII (KJHG), nach 53 SGB XII (nur amts- oder landesärztliche Stellungnahme)
Das Alter hat nichts Schönes oder doch. Depressionen im Alter Ende oder Anfang?
 Das Alter hat nichts Schönes oder doch Depressionen im Alter Ende oder Anfang? Depressionen im Alter Gedanken zum Alter was bedeutet höheres Alter Depressionen im Alter Häufigkeit Was ist eigentlich eine
Das Alter hat nichts Schönes oder doch Depressionen im Alter Ende oder Anfang? Depressionen im Alter Gedanken zum Alter was bedeutet höheres Alter Depressionen im Alter Häufigkeit Was ist eigentlich eine
Bindungsstörung bei psychisch kranken Eltern
 nicht von schlechten Eltern Bindungsstörung bei psychisch kranken Eltern Vortrag Fachtag Frühförderung Kinder werden in verschiedenen Lebens- und Entwicklungskontexten wahrgenommen, selten aber in der
nicht von schlechten Eltern Bindungsstörung bei psychisch kranken Eltern Vortrag Fachtag Frühförderung Kinder werden in verschiedenen Lebens- und Entwicklungskontexten wahrgenommen, selten aber in der
Traurigkeit, Rückzug, Depression
 Groen Ihle Ahle Petermann Ratgeber Traurigkeit, Rückzug, Depression Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher Ratgeber Traurigkeit, Rückzug, Depression Ratgeber Kinder- und Jugendpsychotherapie
Groen Ihle Ahle Petermann Ratgeber Traurigkeit, Rückzug, Depression Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher Ratgeber Traurigkeit, Rückzug, Depression Ratgeber Kinder- und Jugendpsychotherapie
Allgemeine und Spezielle Krankheitslehre
 Ergotherapie Prüfungswissen Allgemeine und Spezielle Krankheitslehre Herausgegeben von Karin Götsch 2. Auflage 75 Abbildungen 95 Tabellen 6.3 Systematik psychischer Erkrankungen Klassifikationen... 509
Ergotherapie Prüfungswissen Allgemeine und Spezielle Krankheitslehre Herausgegeben von Karin Götsch 2. Auflage 75 Abbildungen 95 Tabellen 6.3 Systematik psychischer Erkrankungen Klassifikationen... 509
Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten
 Angela Heine Verena Engl Verena Thaler Barbara Fussenegger Arthur M. Jacobs Neuropsychologie von Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten Fortschritte der Neuropsychologie Neuropsychologie von Entwicklungsstörungen
Angela Heine Verena Engl Verena Thaler Barbara Fussenegger Arthur M. Jacobs Neuropsychologie von Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten Fortschritte der Neuropsychologie Neuropsychologie von Entwicklungsstörungen
Hinweise zur Benutzung dieses Lehrbuchs Vorwort... 13
 Inhalt Hinweise zur Benutzung dieses Lehrbuchs.................. 11 Vorwort............................................ 13 I Geschichte, Symptome, Abgrenzung....... 15 1 Geschichte der ADHS..........................
Inhalt Hinweise zur Benutzung dieses Lehrbuchs.................. 11 Vorwort............................................ 13 I Geschichte, Symptome, Abgrenzung....... 15 1 Geschichte der ADHS..........................
Angststörungen im Kindes- und Jugendalter. Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Universität Göttingen
 Angststörungen im Kindes- und Jugendalter Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Universität Göttingen Angststörungen mit Beginn im Kindesalter Emotionale Störungen des Kindesalters (F93) - Emotionale
Angststörungen im Kindes- und Jugendalter Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Universität Göttingen Angststörungen mit Beginn im Kindesalter Emotionale Störungen des Kindesalters (F93) - Emotionale
Albert Lenz Ressourcen fördern. Materialien für die Arbeit mit Kindern und ihren psychisch kranken Eltern. mit CD-ROM
 Albert Lenz Ressourcen fördern Materialien für die Arbeit mit Kindern und ihren psychisch kranken Eltern mit CD-ROM Ressourcen fördern Ressourcen fördern Materialien für die Arbeit mit Kindern und ihren
Albert Lenz Ressourcen fördern Materialien für die Arbeit mit Kindern und ihren psychisch kranken Eltern mit CD-ROM Ressourcen fördern Ressourcen fördern Materialien für die Arbeit mit Kindern und ihren
Psychische Störungen Einführung. PD Dr. Peter Schönknecht Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Universitätsklinikum Leipzig
 Psychische Störungen Einführung PD Dr. Peter Schönknecht Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Universitätsklinikum Leipzig Psychopathologische Symptome Psychopathologische Symptome
Psychische Störungen Einführung PD Dr. Peter Schönknecht Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Universitätsklinikum Leipzig Psychopathologische Symptome Psychopathologische Symptome
Die Beeinträchtigung des Kindeswohls durch elterliche Partnerschaftsgewalt
 Die Beeinträchtigung des Kindeswohls durch elterliche Partnerschaftsgewalt Kindliches Miterleben elterlicher Partnerschaftsgewalt und die langfristigen Folgen Marion Ernst, Dipl.-Soziologin Koordinierungsstelle
Die Beeinträchtigung des Kindeswohls durch elterliche Partnerschaftsgewalt Kindliches Miterleben elterlicher Partnerschaftsgewalt und die langfristigen Folgen Marion Ernst, Dipl.-Soziologin Koordinierungsstelle
Günther Opp / Michael Fingerle (Hrsg.) Erziehung zwischen Risiko und Resilienz
 a Günther Opp / Michael Fingerle (Hrsg.) Was Kinder stärkt Erziehung zwischen Risiko und Resilienz Mit Beiträgen von Doris Bender, Karl-Heinz Brisch, Michael Fingerle, Rolf Göppel, Werner Greve, Karin
a Günther Opp / Michael Fingerle (Hrsg.) Was Kinder stärkt Erziehung zwischen Risiko und Resilienz Mit Beiträgen von Doris Bender, Karl-Heinz Brisch, Michael Fingerle, Rolf Göppel, Werner Greve, Karin
Lehrbuch ADHS. Modelle, Ursachen, Diagnose, Therapie. Caterina Gawrilow. Ernst Reinhardt Verlag München Basel. 2. aktualisierte Auflage
 Caterina Gawrilow Lehrbuch ADHS Modelle, Ursachen, Diagnose, Therapie 2. aktualisierte Auflage Mit 16 Abbildungen, 10 Tabellen und 47 Vertiefungsfragen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. Caterina
Caterina Gawrilow Lehrbuch ADHS Modelle, Ursachen, Diagnose, Therapie 2. aktualisierte Auflage Mit 16 Abbildungen, 10 Tabellen und 47 Vertiefungsfragen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. Caterina
Psychotherapiebereich und Bereich zur Behandlung akuter Krisen unter einem Dach
 Alter: [PDF-Download] [ Mehr Raum für Kinder und Jugendliche mit seelischen Problemen 20.11.2008 Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Heidelberg eröffnet neue Station für Entwicklung und
Alter: [PDF-Download] [ Mehr Raum für Kinder und Jugendliche mit seelischen Problemen 20.11.2008 Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Heidelberg eröffnet neue Station für Entwicklung und
Kinder mit psychisch auffälligen/kranken Eltern
 Kinder mit psychisch auffälligen/kranken Eltern Fortbildung MultiplikaktorIn Kinderschutz Dipl.Soz.Päd. Sabine Haversiek-Vogelsang SFBB 25.11.2014 Häufigkeit psychischer Störungen Definition (Bundespsychotherapeutenkammer
Kinder mit psychisch auffälligen/kranken Eltern Fortbildung MultiplikaktorIn Kinderschutz Dipl.Soz.Päd. Sabine Haversiek-Vogelsang SFBB 25.11.2014 Häufigkeit psychischer Störungen Definition (Bundespsychotherapeutenkammer
Unterstützung von Familien mit psychisch kranken Eltern in Basel Erfolgsfaktoren und Stolpersteine
 Unterstützung von Familien mit psychisch kranken Eltern in Basel Erfolgsfaktoren und Stolpersteine Workshop-Tagung Kinder psychisch kranker Eltern 04.02.2016 Alain Di Gallo 1 Risikofaktoren Genetik Krankheits-
Unterstützung von Familien mit psychisch kranken Eltern in Basel Erfolgsfaktoren und Stolpersteine Workshop-Tagung Kinder psychisch kranker Eltern 04.02.2016 Alain Di Gallo 1 Risikofaktoren Genetik Krankheits-
Coaching als Brücke. Wie Umgehen mit Grenzthemen im Coaching? Dipl.-Psych. / Senior Coach DBVC. Die Coachs mit dem Trüffelschwein-Prinzip
 Coaching als Brücke Wie Umgehen mit Grenzthemen im Coaching? 20.10.2012 Andreas Steinhübel Dipl.-Psych. / Senior Coach DBVC Die Coachs mit dem Trüffelschwein-Prinzip 2 Die meistgestellte Frage...! Wie
Coaching als Brücke Wie Umgehen mit Grenzthemen im Coaching? 20.10.2012 Andreas Steinhübel Dipl.-Psych. / Senior Coach DBVC Die Coachs mit dem Trüffelschwein-Prinzip 2 Die meistgestellte Frage...! Wie
Psychosoziale Begleitung von Kindern krebskranker Eltern
 Psychosoziale Begleitung von Kindern krebskranker Eltern 16. Krebskrankenpflegesymposium für f r Krebskrankenpflege in Heidelberg Edvard Munch: Tod im Krankenzimmer Hintergrund I Ca. 200 000 Kinder erleben
Psychosoziale Begleitung von Kindern krebskranker Eltern 16. Krebskrankenpflegesymposium für f r Krebskrankenpflege in Heidelberg Edvard Munch: Tod im Krankenzimmer Hintergrund I Ca. 200 000 Kinder erleben
Fragebogen zur Einleitung oder Verlängerung einer ambulanten Psychotherapie
 Fragebogen zur Einleitung oder Verlängerung einer ambulanten Psychotherapie Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, dieser Fragebogen soll helfen, Ihre ambulante Psychotherapie einzuleiten bzw.
Fragebogen zur Einleitung oder Verlängerung einer ambulanten Psychotherapie Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, dieser Fragebogen soll helfen, Ihre ambulante Psychotherapie einzuleiten bzw.
Bindung. Definition nach John Bowlby:
 Bindung und Bildung Bindung Definition nach John Bowlby: Beziehung ist der übergeordnete Begriff Bindung ist Teil von Beziehung Mutter und Säugling sind Teilnehmer/innen in einem sich wechselseitig bedingenden
Bindung und Bildung Bindung Definition nach John Bowlby: Beziehung ist der übergeordnete Begriff Bindung ist Teil von Beziehung Mutter und Säugling sind Teilnehmer/innen in einem sich wechselseitig bedingenden
Dissoziative Störungen, Konversionsstörungen
 Dissoziative Störungen, Konversionsstörungen Konversion (Freud, 1894) Begriff im Sinne eines psychoanalytischen Erklärungsmodells oder Phänomenologisch- deskriptiver Begriff Dissoziation... ein komplexer
Dissoziative Störungen, Konversionsstörungen Konversion (Freud, 1894) Begriff im Sinne eines psychoanalytischen Erklärungsmodells oder Phänomenologisch- deskriptiver Begriff Dissoziation... ein komplexer
In der Vergangenheit gab es keine klaren Kriterien für die
 Der Psychiater und Depressionsforscher Prof. Dr. Hubertus Himmerich erlebt das Leid, das die Krankheit Depression auslöst, tagtäglich als Oberarzt der Depressionsstation unserer Klinik, der Leipziger Universitätsklinik
Der Psychiater und Depressionsforscher Prof. Dr. Hubertus Himmerich erlebt das Leid, das die Krankheit Depression auslöst, tagtäglich als Oberarzt der Depressionsstation unserer Klinik, der Leipziger Universitätsklinik
Depression bei Kindern und Jugendlichen
 Cecilia A. Essau Depression bei Kindern und Jugendlichen Psychologisches Grundlagenwissen Mit 21 Abbildungen, 41 Tabellen und 139 Übungsfragen 2., überarbeitete Auflage Ernst Reinhardt Verlag München Basel
Cecilia A. Essau Depression bei Kindern und Jugendlichen Psychologisches Grundlagenwissen Mit 21 Abbildungen, 41 Tabellen und 139 Übungsfragen 2., überarbeitete Auflage Ernst Reinhardt Verlag München Basel
Die Welt des frühkindlichen Autismus
 Christian Klicpera, Paul Innerhofer Die Welt des frühkindlichen Autismus Unter Mitarbeit von Barbara Gasteiger-Klicpera 3. Auflage Mit 10 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. med. Dr.
Christian Klicpera, Paul Innerhofer Die Welt des frühkindlichen Autismus Unter Mitarbeit von Barbara Gasteiger-Klicpera 3. Auflage Mit 10 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. med. Dr.
Resilienz. Ein anderer Blick auf Verlustreaktionen. Aeternitas - Service - Reihe: Trauer. Aeternitas - Service - Reihe: Trauer
 Resilienz Ein anderer Blick auf Verlustreaktionen Gliederung Einführung Definition Trauer und Resilienz Resilienz-Forschung Was zeichnet resiliente Menschen aus? Schlussfolgerungen für die Praxis 2 Einführung
Resilienz Ein anderer Blick auf Verlustreaktionen Gliederung Einführung Definition Trauer und Resilienz Resilienz-Forschung Was zeichnet resiliente Menschen aus? Schlussfolgerungen für die Praxis 2 Einführung
Elterliche psychische Erkrankung, Erziehungsfähigkeit und kindliche Entwicklung
 Elterliche psychische Erkrankung, Erziehungsfähigkeit und kindliche Entwicklung Störungsraten bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einem erkrankten Elternteil (Mutter) Alkoholismus: unspezifisch
Elterliche psychische Erkrankung, Erziehungsfähigkeit und kindliche Entwicklung Störungsraten bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einem erkrankten Elternteil (Mutter) Alkoholismus: unspezifisch
Depression, Burnout. und stationäre ärztliche Versorgung von Erkrankten. Burnout I Depression Volkskrankheit Nr. 1? 1. Oktober 2014, Braunschweig
 Burnout I Depression Volkskrankheit Nr. 1? 1. Oktober 2014, Braunschweig Depression, Burnout und stationäre ärztliche Versorgung von Erkrankten Privatdozent Dr. med. Alexander Diehl M.A. Arzt für Psychiatrie
Burnout I Depression Volkskrankheit Nr. 1? 1. Oktober 2014, Braunschweig Depression, Burnout und stationäre ärztliche Versorgung von Erkrankten Privatdozent Dr. med. Alexander Diehl M.A. Arzt für Psychiatrie
Kinder unter Druck. Missstände in den Lebensrealitäten von Kindern und Jugendlichen und ihre gesundheitlichen Auswirkungen
 Kinder unter Druck Missstände in den Lebensrealitäten von Kindern und Jugendlichen und ihre gesundheitlichen Auswirkungen Mag. Ercan Nik Nafs, Wiener Kinder- & Jugendanwalt Kinder haben das Recht auf Gesundheit,
Kinder unter Druck Missstände in den Lebensrealitäten von Kindern und Jugendlichen und ihre gesundheitlichen Auswirkungen Mag. Ercan Nik Nafs, Wiener Kinder- & Jugendanwalt Kinder haben das Recht auf Gesundheit,
Inhaltsverzeichnis. Zusammenfassung... 1
 Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung... 1 1 Grundlagen... 4 1.1 Einleitung, Begriffsbestimmung... 4 1.2 Epidemiologie und Prävalenz... 5 1.2.1 Krankheitsbeginn... 5 1.2.2 Geschlechtsverteilung... 6 1.2.3
Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung... 1 1 Grundlagen... 4 1.1 Einleitung, Begriffsbestimmung... 4 1.2 Epidemiologie und Prävalenz... 5 1.2.1 Krankheitsbeginn... 5 1.2.2 Geschlechtsverteilung... 6 1.2.3
Mit einem Vorwort von Bernhard Ringbeck
 Marianne Gäng (Hrsg.) Reittherapie 2., überarbeitete und erweiterte Auflage Mit einem Vorwort von Bernhard Ringbeck Beiträge von Christina Bär, Claudia Baumann, Susanne Blume, Georgina Brandenberger, Annette
Marianne Gäng (Hrsg.) Reittherapie 2., überarbeitete und erweiterte Auflage Mit einem Vorwort von Bernhard Ringbeck Beiträge von Christina Bär, Claudia Baumann, Susanne Blume, Georgina Brandenberger, Annette
Psychische Gesundheit von älteren türkischen Migrantinnen und Migranten. Fidan Sahyazici Dr. Oliver Huxhold
 Psychische Gesundheit von älteren türkischen Migrantinnen und Migranten Fidan Sahyazici Dr. Oliver Huxhold Gliederung Bedeutung Theoretischer Hintergrund Fragestellungen Hypothesen Methode Ergebnisse Interpretation/Diskussion
Psychische Gesundheit von älteren türkischen Migrantinnen und Migranten Fidan Sahyazici Dr. Oliver Huxhold Gliederung Bedeutung Theoretischer Hintergrund Fragestellungen Hypothesen Methode Ergebnisse Interpretation/Diskussion
Fragenkatalog Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter. Fragen zu Kapitel 1: Klassifikation psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter
 Fragenkatalog Psychische Störungen im Fragen zu Kapitel 1: Klassifikation psychischer Störungen im 1. Welche Anforderungen werden nach heutigen Vorstellungen an ein modernes psychiatrisches Klassifikationssystem
Fragenkatalog Psychische Störungen im Fragen zu Kapitel 1: Klassifikation psychischer Störungen im 1. Welche Anforderungen werden nach heutigen Vorstellungen an ein modernes psychiatrisches Klassifikationssystem
Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik
 Geisteswissenschaft Sandra Mette Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik Rolle und Aufgabe der Sozialen Arbeit Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Geisteswissenschaft Sandra Mette Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik Rolle und Aufgabe der Sozialen Arbeit Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
4 Das Fachgebiet Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in der Versorgung... 55
 Inhalt XIX 3.1.4 Essstörungen............................................ 38 Binge-Eating-Störung und Adipositas........................ 41 3.1.5 Persönlichkeitsstörungen...................................
Inhalt XIX 3.1.4 Essstörungen............................................ 38 Binge-Eating-Störung und Adipositas........................ 41 3.1.5 Persönlichkeitsstörungen...................................
Einführung Klinische Psychologie
 Babette Renneberg, Thomas Heidenreich, Alexander Noyon Einführung Klinische Psychologie Mit 160 Übungsfragen, 19 Abbildungen und 28 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. Babette Renneberg
Babette Renneberg, Thomas Heidenreich, Alexander Noyon Einführung Klinische Psychologie Mit 160 Übungsfragen, 19 Abbildungen und 28 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. Babette Renneberg
indeswohlgefährdung!
 indeswohlgefährdung! Sichtweise aus einer kinderärztlichen Praxis Referat: Dr. Jörg Penner Arzt für Kinder- und Jugendmedizin Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie Hauptstraße 104 79379 Müllheim Man sieht
indeswohlgefährdung! Sichtweise aus einer kinderärztlichen Praxis Referat: Dr. Jörg Penner Arzt für Kinder- und Jugendmedizin Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie Hauptstraße 104 79379 Müllheim Man sieht
Entwicklung eines Erhebungsinstruments. Thema: Verteilung klinischer und subklinischer Essstörungen an der Universität Kassel
 Entwicklung eines Erhebungsinstruments Thema: Verteilung klinischer und subklinischer Essstörungen an der Universität Kassel Vorstellung des Themas In: Lehrforschungswerkstatt: Quantitative Untersuchungsverfahren
Entwicklung eines Erhebungsinstruments Thema: Verteilung klinischer und subklinischer Essstörungen an der Universität Kassel Vorstellung des Themas In: Lehrforschungswerkstatt: Quantitative Untersuchungsverfahren
Resilienz Kinder widerstandsfähig machen
 Resilienz Kinder widerstandsfähig machen Dr. Edith Wölfl Sonderschulrektorin, Wichern-Zentrum, München Definition Psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und psycholsozialen
Resilienz Kinder widerstandsfähig machen Dr. Edith Wölfl Sonderschulrektorin, Wichern-Zentrum, München Definition Psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und psycholsozialen
Konzept und Massnahmenplan Psychosoziale Gesundheit im schulischen Kontext
 Konzept und Massnahmenplan Psychosoziale Gesundheit im schulischen Kontext Teilprojekt der Dachstrategie Gesundheitsförderung und Prävention der Schul- und Sportdepartements der Stadt Zürich Erfa-Treffen
Konzept und Massnahmenplan Psychosoziale Gesundheit im schulischen Kontext Teilprojekt der Dachstrategie Gesundheitsförderung und Prävention der Schul- und Sportdepartements der Stadt Zürich Erfa-Treffen
Veränderung der Lebenswelt: Ursache für die Zunahme psychischer Störungen
 Veränderung der Lebenswelt: Ursache für die Zunahme psychischer Störungen Prof. Dr. Veit Rößner Dresden, 20. September 2012 Komplexität menschlichen Verhaltens unzählige Aspekte unzählige Veränderungen
Veränderung der Lebenswelt: Ursache für die Zunahme psychischer Störungen Prof. Dr. Veit Rößner Dresden, 20. September 2012 Komplexität menschlichen Verhaltens unzählige Aspekte unzählige Veränderungen
Fachbereich Erziehungswissenschaften und Psychologie der Freien Universität Berlin
 Fachbereich Erziehungswissenschaften und Psychologie der Freien Universität Berlin Aufmerksamkeitsdefizit /Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei arabischen Kindern in Grundschulalter in Berlin Ergebnisse von
Fachbereich Erziehungswissenschaften und Psychologie der Freien Universität Berlin Aufmerksamkeitsdefizit /Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei arabischen Kindern in Grundschulalter in Berlin Ergebnisse von
3 Fragestellung und Hypothesen 3.1 Herleitung der Fragestellung
 Fragestellung und Hypothesen 62 3 Fragestellung und Hypothesen 3.1 Herleitung der Fragestellung In der vorliegenden Arbeit wird folgenden Fragen nachgegangen: 1. Existieren Geschlechtsunterschiede in der
Fragestellung und Hypothesen 62 3 Fragestellung und Hypothesen 3.1 Herleitung der Fragestellung In der vorliegenden Arbeit wird folgenden Fragen nachgegangen: 1. Existieren Geschlechtsunterschiede in der
Bipolar oder nicht bipolar?
 Kinder- und jugendpsychiatrisches Kolloquium Bipolar oder nicht bipolar? Affektive Dysregulation bei Kindern und Jugendlichen SS 2012 Mittwoch, 5. September 2012 17:00 bis 18:30 Uhr Uschi Dreiucker / PIXELIO
Kinder- und jugendpsychiatrisches Kolloquium Bipolar oder nicht bipolar? Affektive Dysregulation bei Kindern und Jugendlichen SS 2012 Mittwoch, 5. September 2012 17:00 bis 18:30 Uhr Uschi Dreiucker / PIXELIO
Psychologische Beratungsstelle im Treffpunkt Familie, Hof. Jugend- und Familienhilfe Marienberg Psychologische Beratung ggmbh
 Psychologische Beratungsstelle im Treffpunkt Familie, Hof Jugend- und Familienhilfe Marienberg Psychologische Beratung ggmbh Psychologische Beratungsstelle Erziehungs- und Familienberatung mit Helmbrechtser
Psychologische Beratungsstelle im Treffpunkt Familie, Hof Jugend- und Familienhilfe Marienberg Psychologische Beratung ggmbh Psychologische Beratungsstelle Erziehungs- und Familienberatung mit Helmbrechtser
2 Schematherapie bei Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung 35 Christof Loose Peter Graaf' Gerhard Zarbock
 Inhaltsübersicht Geleitwort Wendy T. Behary Vorwort Christof Loose Gerhard Zarbock 13 16 1 Grundlagen der Anwendung von Schematherapie bei Kindern und Jugendlichen 20 Gerhard Zarbock Christof Loose 2 Schematherapie
Inhaltsübersicht Geleitwort Wendy T. Behary Vorwort Christof Loose Gerhard Zarbock 13 16 1 Grundlagen der Anwendung von Schematherapie bei Kindern und Jugendlichen 20 Gerhard Zarbock Christof Loose 2 Schematherapie
Wissenschaftliches Programm
 Wissenschaftliches Programm 4. Symposium Früherkennungs- und Präventionsmöglichkeiten in der Psychiatrie Früh Erkennen Früh Behandeln Neue Chancen zur Prävention von psychischen Erkrankungen Bonn, 8. November
Wissenschaftliches Programm 4. Symposium Früherkennungs- und Präventionsmöglichkeiten in der Psychiatrie Früh Erkennen Früh Behandeln Neue Chancen zur Prävention von psychischen Erkrankungen Bonn, 8. November
kultur- und sozialwissenschaften
 Christel Salewski & Manja Vollmann Gesundheitspsychologische Modelle zu Stress, Stressbewältigung und Prävention / Gesundheitsförderung kultur- und sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Christel Salewski & Manja Vollmann Gesundheitspsychologische Modelle zu Stress, Stressbewältigung und Prävention / Gesundheitsförderung kultur- und sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Alexander Grob Uta Jaschinski. Erwachsen werden. Entwicklungspsychologie des Jugendalters
 Alexander Grob Uta Jaschinski Erwachsen werden Entwicklungspsychologie des Jugendalters Inhalt Vorwort xi i Entwicklung und Menschenbild 1 1.1 Die Anfänge der Entwicklungspsychologie 2 1.2 Forschungstraditionen
Alexander Grob Uta Jaschinski Erwachsen werden Entwicklungspsychologie des Jugendalters Inhalt Vorwort xi i Entwicklung und Menschenbild 1 1.1 Die Anfänge der Entwicklungspsychologie 2 1.2 Forschungstraditionen
Förderung der Autonomieentwicklung im Umgang mit Kinderliteratur in der Grundschule
 Maria-Raphaela Lenz Förderung der Autonomieentwicklung im Umgang mit Kinderliteratur in der Grundschule Bachelorarbeit BACHELOR + MASTER Publishing Lenz, Maria-Raphaela: Förderung der Autonomieentwicklung
Maria-Raphaela Lenz Förderung der Autonomieentwicklung im Umgang mit Kinderliteratur in der Grundschule Bachelorarbeit BACHELOR + MASTER Publishing Lenz, Maria-Raphaela: Förderung der Autonomieentwicklung
PSYCHIATRIE & SOMATIK IM DIALOG
 PSYCHIATRIE & SOMATIK IM DIALOG Hauptsponsor: Co-Sponsoren: Psychiatrie und Somatik im Dialog Jugendliche in der Praxis Eine Herausforderung Dr. med. Niklas Brons Zentrum für Angst- und Depressionsbehandlung
PSYCHIATRIE & SOMATIK IM DIALOG Hauptsponsor: Co-Sponsoren: Psychiatrie und Somatik im Dialog Jugendliche in der Praxis Eine Herausforderung Dr. med. Niklas Brons Zentrum für Angst- und Depressionsbehandlung
Entwicklung s- psychopathologie des Kindes- und Jugendalters
 Franz Resch Entwicklung s- psychopathologie des Kindes- und Jugendalters Ein Lehrbuch Unter Mitarbeit von Peter Parzer, Romuald M. Brunner, Johann Haffner, Eginhard Koch, Bibiana Schuch PsychologieVeriagsUnion
Franz Resch Entwicklung s- psychopathologie des Kindes- und Jugendalters Ein Lehrbuch Unter Mitarbeit von Peter Parzer, Romuald M. Brunner, Johann Haffner, Eginhard Koch, Bibiana Schuch PsychologieVeriagsUnion
Fakten zur seelischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
 Fakten zur seelischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen Prof. Dr. Dr. Martin Holtmann LWL-Universitätsklinik Hamm der Ruhr-Universität Bochum Martin Holtmann Womit sind wir konfrontiert? Steigende
Fakten zur seelischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen Prof. Dr. Dr. Martin Holtmann LWL-Universitätsklinik Hamm der Ruhr-Universität Bochum Martin Holtmann Womit sind wir konfrontiert? Steigende
Einführung in die Gesundheitspsychologie
 Nina Knoll/Urte Scholz/Nina Rieckmann Einführung in die Gesundheitspsychologie Mit einem Vorwort von Ralf Schwarzer Mit 26 Abbildungen, 5 Tabellen und 52 Fragen zum Lernstoff Ernst Reinhardt Verlag München
Nina Knoll/Urte Scholz/Nina Rieckmann Einführung in die Gesundheitspsychologie Mit einem Vorwort von Ralf Schwarzer Mit 26 Abbildungen, 5 Tabellen und 52 Fragen zum Lernstoff Ernst Reinhardt Verlag München
Junge Menschen in der Adoleszenz Anforderungen an die psychiatrische und komplementäre Versorgung
 Junge Menschen in der Adoleszenz Anforderungen an die psychiatrische und komplementäre Versorgung Gunter Vulturius Halle/Saale, 13. Oktober 2015 Adoleszenz Lebensphase, die den Übergang von der Kindheit
Junge Menschen in der Adoleszenz Anforderungen an die psychiatrische und komplementäre Versorgung Gunter Vulturius Halle/Saale, 13. Oktober 2015 Adoleszenz Lebensphase, die den Übergang von der Kindheit
Tiergestützte Kinderpsychotherapie
 Anke Prothmann Tiergestützte Kinderpsychotherapie Theorie und Praxis der tiergestützten Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen 2., ergänzte Auflage PETER LANG Frankfurt am Main Berlin Bern Bruxelles
Anke Prothmann Tiergestützte Kinderpsychotherapie Theorie und Praxis der tiergestützten Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen 2., ergänzte Auflage PETER LANG Frankfurt am Main Berlin Bern Bruxelles
Das Kind und ich eine Bindung, die stärkt
 Das Kind und ich eine Bindung, die stärkt P Ä D A G O G I S C H E W E R K T A G U N G 1 3. 1 5. J U L I 2 0 1 0 S A L Z B U R G Ich darf Sie durch diesen Workshop begleiten: Klinische- u. Gesundheitspsychologin
Das Kind und ich eine Bindung, die stärkt P Ä D A G O G I S C H E W E R K T A G U N G 1 3. 1 5. J U L I 2 0 1 0 S A L Z B U R G Ich darf Sie durch diesen Workshop begleiten: Klinische- u. Gesundheitspsychologin
Curriculum Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten für (angehende) Psychologische Psychotherapeuten in Verhaltenstherapie Stand:
 FAKIP Freiburger Ausbildungsinstitut für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie Curriculum Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten für (angehende) Psychologische Psychotherapeuten in Verhaltenstherapie
FAKIP Freiburger Ausbildungsinstitut für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie Curriculum Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten für (angehende) Psychologische Psychotherapeuten in Verhaltenstherapie
