Ursula Klingenböck, Wien Zur Wir -Konstruktion am Beispiel von Linda Stift
|
|
|
- Christel Hermann
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Ursula Klingenböck, Wien
2 2 0. Vorbemerkungen Der Gewinner des 3. Ingeborg Bachmann-Preises im Jahre 1979 heißt Gert Hofmann. Mit einem Ausschnitt aus seinem Debütroman Die Fistelstimme hat er sich u.a. gegen Jurek Becker, Hanna Johansen und Josef Winkler durchgesetzt. Dreißig Jahre später, am 24. Juni 2009, hält Winkler die Eröffnungsrede zu den 33. Klagenfurter Tagen der deutschsprachigen Literatur, und es ist vielleicht kein Zufall, dass die österreichische Autorin Linda Stift mit einer Wir-Erzählung zum Wettlesen antritt. Sie greift damit eine Erzählform auf, die auf eine gut 100jährige Geschichte zurückblickt 1 und mit der Gert Hofmann in den Achtziger Jahren erfolgreich experimentiert hat. 2 Das Experiment Bartels spricht im Tagesspiegel von einem Sprachexperiment; 3 wenn überhaupt, handelt es sich um ein Erzähl- Experiment von Linda Stift erweist sich damit jedenfalls als Berufung auf eine erprobte Form, vielleicht auch auf die Autorität des Erzählers und Bachmann-Preisträgers Hofmann. Die Frage nach dem Kalkül und seiner Legitimität stellt sich bei Literaturwettbewerben wie dem Bachmann-Preis immer wieder: Für Stifts Erzählung Die Welt der schönen Dinge 4 muss sie sich weniger auf Grund des Form-Elements stellen als auf Grund des gewählten Erzählgegenstandes. Zweifellos sind Migration, Unterdrückung und Wohlstandsgefälle zentrale Fragen des gegenwärtigen gesellschaftlichen, politischen und auch kulturellen Diskurses; dass ein Text, der sich damit auseinander setzt, tatsächlich mit Vertrauensvorschüssen rechnen kann, hat die Kritik gezeigt: Sie hat das 1 Vgl. Brian Richardson: Unnatural voices. Extreme Narration in Modern and Contemporary Fiction. The Ohio State University 2006, Wir-Erzählungen im engeren Sinn ich komme darauf noch zurück sind u.a. Der Blindensturz, 1985, sowie Unsere Eroberung 1985 (jeweils Erscheinungsjahr der Buchausgabe). 3 Gerrit Bartels: Ich bin die Erregung. In: Der Tagesspiegel ( ), online unter (20.05.). 4 Linda Stift: Die Welt der schönen Dinge. Abrufbar unter (20.05.); die Seitenangeben folgen der Druckversion (word-format).
3 3 Thema als ehrenwert, 5 mutig[], 6 toll[], 7 brisant[] 8 u.ä. gewürdigt, und es ist zu fragen, inwieweit sie dabei ihrerseits eine Erwartungshaltung bedient, vielleicht auch einem kollektiven moralischen Druck genügt. Es ist aber nicht nur die Aktualität, die Linda Stift mit ihrer Themenwahl aufruft: Mit dem Erzählgegenstand, in mancher Hinsicht auch mit der (Erzähl)Form, stellt sie Die Welt der schönen Dinge in eine jahrzehntelange Tradition des historischen und literarischen Erzählens von Flucht und Vertreibung. Ihre Implikationen sind für die Welt der schönen Dinge noch zu untersuchen. Dass der Text dennoch nicht überzeugen konnte, wurde denn auch hauptsächlich über die Wahl eines unangemessenen erzähltechnischen Verfahrens, namentlich die Wir-Erzählung, argumentiert. Inwiefern es sich dabei um ein literarisch-ästhetisches Moment 9 handelt, wird noch zu diskutieren sein. In meinem Beitrag stelle ich die Frage nach der Wir-Konstruktion bei Linda Stift. Dazu soll Die Welt der schönen Dinge einer Relektüre vor dem Hintergrund aktueller erzähltheoretischer Forschung unterzogen werden. Es ist zu fragen, wie der Text die Schwierigkeiten quasi-kollektiven Erzählens löst (intratextuell), auf welche Wirklichkeit er referiert bzw. wie er sich dazu verhält (extratextuell) und, nicht zuletzt, wie er sich in den Erzählgenres Flüchtlingsliteratur und Wir-Erzählung (intertextuell) positioniert. Darüber hinaus ist das Erzählverfahren in Relation zu (s)einem Erzählgegenstand zu setzen. Eine meiner Thesen ist, dass sich im Wir stärker als in anderen Erzählstimmen und -perspektiven eine soziale und, wie sich zeigen wird, eine ideologische Dimension manifestiert, das Thema folglich mit der Erzählform grundsätzlich konvergiert. 1. Literaturkritische und erzähltheoretische Überlegungen 5 Meike Feßmann, Berlin; Diskussion der Jury unter (20.05.). 6 Hildegard E. Keller, Bloomington / Zürich, Diskussion der Jury unter (20.05.). 7 Ijoma Alexander Mangold, Berlin; Diskussion der Jury unter (20.05.). 8 Harald Klauhs: Bachmann-Wettbewerb. Sprechen statt Lesen. In: Die Presse, ; auch online unter (20.05.). 9 Mangold: Diskussion, (20.05.).
4 4 Linda Stifts Beitrag zum Bachmannpreis wurde fast einhellig negativ bewertet. Die ungewöhnlich emotionalen Stellungnahmen der Jury fokussieren einerseits auf die narrative Form der Wir-Erzählung, andererseits auf die Art der Darstellung hinsichtlich ihrer mimetischen Qualität. Beide Aspekte des discours, werden sie in Relation zum Erzählten, zur histoire gesetzt. 10 Ein wiederkehrendes Moment in den Stellungnahmen ist ein mit einem trivialen Moralischen korreliertes aptum. Wenn Ijoma Mangold das Problematische an Linda Stifts erzählendem Wir darin sieht, dass es changiert, dass es weder geschlechtlich genau zuordenbar noch genau individualisierbar sei, 11 setzt das die Vorstellung von einem intratextuell unveränderlichen, gegenständlichen und in seinen individuellen Bestandteilen lesbaren Wir voraus. Mit der Forderung nach der Festlegung und Identifizierbarkeit des Wir lanciert Mangold zugleich eine Qualität des Erzählens im Sinne eines wie auch immer gearteten Realismus; ich komme darauf noch zurück. Mangold rekurriert damit auf ein Konzept, dem die Phänomenologie der Wir -Erzählungen 12 vielfach widerspricht. Etwas differenzierter benennt Paul Jandl die Problematik des erzählenden Wir, das für sich beanspruche, verschiedene Realitäten, die gebrochen sind, miteinander zu vereinen, 13 Meike Feßmann lokalisiert sie in der Auswahl dessen, was verallgemeinerbar sei. 14 Synthese und Generalisierung begründen einerseits den Vorwurf einer emotional-moralisch charakterisierten Mandatsanmaßung 15 an Linda Stifts Wir Ähnliches diskutiert die Narratologie freilich nicht unter soziologischem Aspekt, sondern als erzähltechnische Frage u.a. unter dem Stichwort Fokalisierung. Andererseits provozieren sie die Forderung nach einer im Thema begründeten, (alltags)realistischen Darstellung, 16 die sich u.a. in temporalen, topografischen, nationalen etc. Konkretisationen des Textes bzw. in (s)einer nachvollziehbaren Referenz auf eine außertextuelle Wirklichkeit manifestiere. 10 In Ansatz und Terminologie folge ich Gérard Genette: Die Erzählung. München (= UTB 8083). 11 Mangold: Diskussion (20.05.). 12 Ein Überblick findet sich bei Richardson: Unnatural Voices; zur aktuellen Erzählforschung s.u. 13 Paul Jandl, Wien; Diskussion der Jury unter (20.05.). 14 Feßmann: Diskussion, (20.05.). 15 Keller: Diskussion, (20.05.). 16 Burkhard Spinnen, Münster; Diskussion der Jury unter (20.05.).
5 5 Der mimetische Anspruch wird in Frage gestellt von Claude Sulzer, demzufolge der Text mit realistischem Material [spiele], 17 ganz in Abrede gestellt wird er von Karin Fleischanderl. 18 Während also die Aspekte des discours zur Ebene der histoire in Beziehung gesetzt werden das ebenso naheliegende wie falsche Postulat, wonach Flüchtlingsgeschichte und Wir- Erzählung einander konterkarieren würden, bleibt ungesagt, wurde die Frage nach dem Verhältnis der beiden discours-elemente Wir-Erzählung und Realismus der Darstellung nicht gestellt. Dabei ermöglicht gerade sie eine neue Lesart von Linda Stifts Text, eine weitere Perspektive auf die Wir- Erzählung als literarische Form und regt in der Folge dazu an, die Basiskategorie Person bzw. die Ebenen von discours und histoire ein weiteres Mal zu überdenken. Nur selten sind Wir-Erzählungen explizit Gegenstand der Forschung. Standardwerke der Erzähltheorie wie Stanzel 19 oder Genette 20 fokussieren für das Erzählen in der ersten Person auf das erzählende Ich: einmal als Ich- Erzählsituation (Kriterium: Beteiligung), einmal als Erzählstimme (Kriterium: Wer spricht?) und -modus (Kriterium: Wer nimmt wahr?). Beachtung findet die Wir-Erzählung, soweit ich das überblicke, vor allem im angloamerikanischen Raum: Zu nennen sind hier unter anderem die Arbeiten von Uri Margolin 21 (insbesondere Telling the Plural: From Grammar to Ideology und Collective Perspective, Individual Perspective, and the Speaker in Between ), Brian Richardson 22 ( Unnatural voices. Extreme 17 Alain Claude Sulzer, Basel; Diskussion der Jury unter (20.05.). 18 Vgl. Karin Fleischanderl, Wien; Diskussion der Jury unter (20.05.). 19 Franz K. Stanzel: Theorie des Erzählens. Göttingen (= UTB 904). 20 Genette: Erzählung 21 Uri Margolin: Telling the Plural. From Grammar to Ideology. In: Poetics Today 21 (2000), H. 3, ; Volltext auch online unter (20.05.); ders.: Telling our Story. On We Literary Narratives. In: Language and Literature 5 (1996), H. 2, ; ders.: Collective Perspective, Individual Perspective, and the Speaker in Between. On We Literary Narratives. In: New Perspectives on Narrative Perspective. Hg. v. Willie van Peer and Seymour Chatman. State University of New York 2001, Brian Richardson: Unnatural voices, insbesondere Kap. 3 (Class and Consciousness: We Narration from Conrad to Postcolonial fiction) sowie 4 (I, et cetera: Multiperson Narration and the Range of Contemporary Narrators).
6 6 Narration in Modern and Contemporary Fiction ) und zuletzt Marcus Amit 23 ( A contextual view of narrative fiction in the first person plural ). Ich kann auf die unterschiedlichen Konzepte nicht im Einzelnen eingehen. Hier nur soviel: Uri Margolins weitgehend synchrone Untersuchungen basieren auf klassischen strukturalistischen Annahmen und vernachlässigen folglich kontextuelle Normen und ihren Einfluss auf erzählerische Verfahren. In der Konzeption des Bewusstseins als privat, einzigartig und unerforschlich für andere steht Margolin in der epistemologischen Tradition von René Descartes. Brian Richardson untersucht die Wir-Erzählung in ihren philosophischen, politischen, sozialen, kulturellen und literarischen Bedingungen. Ihre Geschichte begreift er als Transformation der Erzählerfigur und der Erzählfunktion. Vieles, was die Kritik an Linda Stifts Beitrag (wenn auch sehr unpräzise) angesprochen hat, wird auch in der aktuellen Narratologie diskutiert: die semantische Konsistenz des Wir (Wie ist das erzählende Wir profiliert und wie stabil ist es?), seine soziologischen Implikationen (Wer ist / ist nicht Wir und welche Möglichkeiten der Identifikation ergeben sich daraus?) sowie die Konzepte von privatem und kollektivem Bewusstsein / Sprechen und ihre Repräsentation in Wir-Erzählungen (Wie werden mentale Geschehnisse in Wir-Erzählungen dargestellt und inwieweit hat die Erzählinstanz Zugang zum Denken, Glauben, Fühlen, Wünschen anderer?). 2. Die Welt der schönen Dinge Unter dem metaphorischen Titel Die Welt der schönen Dinge erzählt Linda Stifts Text von einer Gruppe von Menschen, die in einem Lastwagen an einen nicht benannten Ort gebracht werden. Die Fahrt endet an der Grenze zu einer vorwiegend über materielle Werte bestimmten Welt. Topografische 23 Redaktionsschluss des Beitrags ist Mai. Marcus Amit: A contextual view of narrative fiction in the first person plural. In: Narrative 16 (2008), H. 1, 46 64; Volltext auch online unter (20.05.); ferner: ders.: Dialogue and Authoritativeness in We fictional Narratives. A Bakhtinian Approach. In: Partial Answers: Journal of Literature and the History of Ideas 6 (2008), H. 1, ; Volltext auch online unter (20.05.).
7 7 Minimalbestimmung und semantischer Raum im Sinne Lotmanns, 24 teilt sie die erzählte Welt in disjunkte Teilräume. Das intendierte Ziel der MigrantInnen liegt jenseits der Grenze: In der umschreibenden Antonomasie der Welt der schönen Dinge wird es zur Chiffre einer als ideal imaginierten Welt, die der erfahrenen diametral entgegengesetzt wird. Eine topografisch angelegte Grenzüberschreitung wird lediglich im Wechsel der Bewusstheitsgrade vollzogen: Das Ende führt in einer stark raffenden Paraphrase, die auch wörtliche Wiederaufnahmen enthält, an den Anfang zurück und klassifiziert das Vorangegangene als irreal, als Vorstellung, als Traum 25 und macht es dadurch prinzipiell wiederholbar. Mit der Aufhebung der Singularität, mit der Preisgabe des Einzigartigen entpflichtet es das Erzählte und gewissermaßen auch das Erzählen nachträglich von seiner Konkretheit. Dem korrespondiert die zyklische Struktur der Erzählung. Stifts Welt der schönen Dinge wurzelt nicht im authentischen Erlebnis von Flucht und / oder Vertreibung, ist also weder Erlebnis- noch Zeitgenossenbericht, sie erzählt auch kein bestimmtes historisches Ereignis, beschreibt keine konkrete historische Situation. Stattdessen stützt sie sich auf Attribute empirischer Wirklichkeiten, charakteristische Aspekte menschlicher Biografien und Dispositionen. Was der (literarische) Text schildert, ist ein über die Verfahren von Selektion und Akkumulation konstruiertes zu einer Geschichte arrangiertes Geschehen, das eine stilisierte Beliebigkeit in ein situatives Typisches erhebt. Seine Repräsentativität versucht der Text nicht durch ein bestimmtes Exemplarisches, sondern durch versatzstückhafte Universalität und damit Unbestimmtheit zu gewährleisten. Das Zielland bleibt, abgesehen von seiner Differenzqualität, so unbestimmt wie das Herkunftsland und seine BewohnerInnen, 26 die Beweggründe, die Heimat zu verlassen, sind politisch, religiös, wirtschaftlich und gesellschaftlich argumentiert. 27 Die Offenheit des Textes resultiert damit nicht primär aus Leerstellen, im Übrigen eine Attitüde postmodernen Erzählens, sondern aus 24 Jurij M. Lotman: Die Struktur literarischer Texte. München (=UTB 103); Karl Nikolaus Renner: Grenze und Ereignis. Weiterführende Überlegungen zum Ereigniskonzept von J. M. Lotman. In: Wolfgang Lukas u. Gustav Frank (Hgg.): Norm Grenze Abweichung. Kultursemiotische Studien zu Literatur, Medien, Wirtschaft. Passau: 2004, Als ich die Augen öffnete [ ], Stift: Die Welt, Vgl. etwa Stift: Die Welt, 3f. 27 Weil wir verfolgt, verstümmelt und getötet wurden, wegen Geld und Macht, wegen unserer Religion, weil wir einer höheren Idee geopfert wurden oder der Tradition [ ] Weil wir ein besseres Leben wollten, Stift: Die Welt, 4.
8 8 der Addition des Verschiedenen und dem Experiment seiner Synthese. Will man diesen Entwurf unabhängig davon, ob er im konkreten Fall als gelungen gelten kann, oder nicht als Erzählverfahren (an)erkennen, ist die Forderung nach einem (überprüfbaren) Realismus der Darstellung, wie sie u.a. Mangold in seiner Kritik formuliert hat, deutlich relativiert. Die Reklamation eines mimetischen Gerüsts wird sich auch aus einem zweiten Grund als obsolet erweisen. Spannung erhält die Erzählung dadurch, dass in ihrem Entwurf durchaus folgerichtig ein offensichtliches und als solches markiertes Divergentes in einem kollektiven Wir zusammengeführt wird. Über das Erzählverfahren ruft der Text ebenso bekannte wie beklemmende Erzählmuster ab, 28 stellt sich über die Form ein weiteres Mal in die Tradition der Flüchtlings- oder aber auch Erinnerungsliteratur und nimmt auch deren Implikationen auf sich bzw. für sich in Anspruch. In diesem Sinn ist das Erzähler-Wir nicht in erster Linie ästhetisches Moment, wie es Mangold lanciert hat, 29 sondern ein bewusstes und mehrfach funktionalisiertes literarisches (Form-)Zitat. Die Welt der schönen Dinge ist eine Wir-Erzählung im engeren Sinn, das heißt, sie ist überwiegend in der ersten Person Plural erzählt. 30 Das Wir steht in Iuxtaposition zu einem temporär verwendeten, indefiniten man hinsichtlich des Numerus ambig, entscheidet der Kontext über eine Lesung im Singular oder Plural und, nach einem unvermittelten (aber nicht unmotivierten) Wechsel der Erzählperspektive im vorletzten Absatz der Erzählung, 31 zu einem Ich, das die Erzählung zu ihrem (oder besser: einem vorläufigen) Ende und zurück zu einem Anfang führt. 32 Die Narratologie hat verschiedene Versuche unternommen, Wir-Erzähler zu definieren und zu klassifizieren. So unterscheidet etwa Margolin nach Art und Stärke der Bindung der Gruppenmitglieder zueinander fünf Typen 33 (Stifts Wir entspräche als temporäre, mehr oder minder zufällige und durch einen bestimmten Anlass motivierte Zusammenstellung sonst unabhängiger 28 Beispiele wären etwa: Tadeusz Borowski: Unser Auschwitz, sowie Wolfgang Koeppen: Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch. 29 Mangold: Diskussion, (20.05.). 30 Vgl. Margolin: Telling in the Plural, 594 u.ö. 31 Stift: Die Welt, 8f.: Wir gingen wieder schneller [ ] Unser Beine verfingen sich [ ] Wir schlugen der Länge nach hin [ ] man hörte sie [die Hunde] hecheln [ ] Nun vernahm man auch Stimmen [ ] Ich blieb einfach liegen [ ]. 32 Stift: Die Welt, 9: Als ich die Augen öffnete, konnte ich gerade noch hören, wie jemand Good Luck sagte, dann wurde eine Laderampe zugeschlagen. 33 Vgl. Margolin: Telling in the Plural,
9 9 Individuen dem Typus B), nach der Relation zwischen dem sprechenden Wir und der Referenzgruppe vier Typen 34 (hier wäre Die Welt der schönen Dinge am ehesten unter Punkt 3 einzuordnen, indem einige Mitglieder der Gruppe individuell und nacheinander als Sprecher-Wir agieren), um schließlich elf Charakteristika für Wir-Erzählungen zu formulieren, 35 darunter Aussagen zur Kontinuität des Erzählers, zur Identität der Gruppe, zur Rolle der Sprecherinstanz, zu den Adressaten der Rede, zum Verhältnis des erzählenden Wir zum Erzählten und zum Erzählen von Wahrnehmung und Bewusstsein. Auf einige werde ich im Folgenden näher eingehen. Die Welt der schönen Dinge wird von MigrantInnen (herbei)erzählt; die Größe 36 und auch die Zusammensetzung der Gruppe bleiben unbestimmt. 37 Ebenso wenig wie das Erzählte topografisch oder temporal fixiert wird, erhält das erzählende Wir ein soziales, politisches, nationales/ethnisches oder religiöses Profil. Die Entscheidung, ihr Land zu verlassen und in eine neue Zukunft aufzubrechen, ähnliche Ideale, Hoffnungen, Träume und Ängste machen die Menschen zu einer temporären (Zweck)Gemeinschaft. Im eigentlichen Sinne des Wortes verdichtet wird diese durch die räumliche Enge des Laderaumes, der als Heterotopie im Sinne Foucaults 38 gelesen werden kann. Eine Differenzierung innerhalb der Gruppe erfolgt nicht über Individualisierung des/r Einzelnen Mangold hat in diesem Zusammenhang nicht ganz unberechtigt vom universal refugee gesprochen, 39 sondern einerseits über eine nicht-intentionale, d.h. weder zielgerichtete noch zuordenbare Diversität, andererseits über das Geschlecht: die Gruppe umfasst Männer, Frauen, 40 die u.a. über eine weibliche bzw. männliche 34 Vgl. Margolin: Collective Perspective, 247f. 35 Vgl. Margolin, Collective Perspective, Die Anzahl der Mitglieder wird explizit offen gehalten: Wie viele? Wir zählten nicht durch, der Mann hatte keinen Appell durchgeführt. So blieb unsere Anzahl ungewiss. Stift: Die Welt, Zur Gemischtgeschlechtlichkeit der Gruppe, zu weiblichem und männlichem Sprechen und dessen Relevanz für eine Binnendifferenzierung des kollektivenwir s.u. 38 Michel Foucault: Andere Räume. In: Karlheinz Barck u.a. (Hgg.): Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik. Leipzig 1990, 34 46; Urs Urban: Der Raum des Anderen und Andere Räume. Würzburg Mangold: Diskussion, (20.05.). 40 Stift: Die Welt, 1.
10 10 Erzählperspektive 41 und deren Abfolge präsent sind. In der Welt der schönen Dinge gibt also nicht nur einen, sondern mindestens zwei, eigentlich drei Wir-ErzählerInnen (nämlich jene/n, der/die für die ganze Gruppe spricht, jene, die für die Frauen und jenen, der für die Männer spricht) und mehr: Das deshalb, weil die Geschlechtszugehörigkeit zeitweilig hinter andere gruppenbildende Faktoren 42 zurücktritt, die Teilmengen sich jeweils neu konstituieren, einander ablösen und in einem unbestimmten Ausmaß interferieren. Unabhängig von der Qualität der gruppenstiftenden Faktoren gilt: Im selben Maß, wie die Wir-ErzählerInnen für die Gruppe / ihre Teilgruppe sprechen, sprechen sie auch über sie und, indem sie Teil dieser Gruppe sind, auch von / über sich. Das erzählende Wir hat damit Teil an der Rolle von Sprecher (Ich) und Besprochenem (Nicht-Ich), es hat, in der Begrifflichkeit Genettes, homodiegetische und heterodiegetische Anteile zugleich. Der wesentlich der Mimesis-Theorie verpflichtete Diskurs der Erzählung, 43 wo ein/e SprecherIn an der erzählten Welt entweder teil hat oder auch nicht, verhandelt diese Konstellation nicht. Im Zusammenhang mit der Frage Wer spricht? steht jene nach dem Wissen, das die Stimme für sich beansprucht. Unabhängig davon, ob man nun für Die Welt der schönen Dinge zwei, drei oder mehr ErzählerInnen ansetzen will, geben sie die Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühle einer Anzahl von Figuren wieder. Über die (zumindest partielle) Homogenität der Äußerung suggeriert das jeweilige Sprecher-Wir auch eine Entsprechung des Wahrnehmens und Empfindens jener (Teil)Gruppe, auf die es referiert, für und über die es spricht. Die Tatsache, dass die ErzählerInnen uneingeschränkten Zugang zu mentalen und emotionalen Inhalten und Prozessen anderer Figuren haben und diese als Manifestationen eines konstruierten Gruppenbewusstseins 44 wiedergeben, hat zweifellos etwas Verstörendes. Immerhin lässt die Wir-Erzählung die traditionelle Auffassung 41 Beispielsweise: Wir hatten Tränen in den Augen vor Scham [ ], nur Männern ist so etwas egal [ ] (Stift: Die Welt, 2) bzw. Wir hingegen sind daran gewöhnt, halböffentlich [ ] zu urinieren [ ] Im Gegenteil. Wir machen uns einen Spaß daraus [ ] (Stift: Die Welt, 3). Die Frage nach der Klischeehaftigkeit der Bilder soll hier nicht weiter verfolgt werden; sie wird sich für das simplifizierend-polarisierende Konzept der Welt der schönen Dinge noch mehrfach stellen, eine Beantwortung soll insbesondere mit Blick auf die Wir - Konstruktion versucht werden, vgl. weiter unten. 42 Z.B. Bank- und Bodenschläfer (vgl. Stift: Die Welt, 3). 43 Genette: Erzählung, insbesondere Hans-Georg Schede: Gert Hofmann. Werkmonographie. Würzburg 1999 (= Epistemata. R. Literaturwissenschaft 289), 221.
11 11 davon, was der Erzählinstanz (der Stimme) und der Erzählperspektive (dem Modus) zukömmlich ist, damit ein weiteres Mal hinter sich. Neue Impulse erhält die Diskussion um die Fokalisierung der Wir-Erzählung durch die Psychoanalyse, die den Zugang zum (eigenen) Bewusstsein prinzipiell in Frage stellt, oder durch den Kritizismus Wittgensteins, der alles Sprachbasierte und damit auch das Bewusstsein als prinzipiell öffentlich definiert. 45 Beiden Theorien zufolge ist der Zugang zum Bewusstsein anderer Menschen nicht notwendigerweise spekulativer als der zum eigenen. Die Diskrepanz von Stimme und Modus relativiert sich aber auch, wenn man den Modus wie zuvor die Stimme aus den traditionellen mimetischen Konventionen und ihren Forderungen entlässt. Ambiguität und Fluktuation beides Konstituenten der Wir-Erzählung als Genre (und nicht, wie es die Kritik verstanden haben wollte, Defizite von Stifts ganz konkreter Wir- Erzählung) machen das erzählende Wir zu einer dialektischen Größe, die die eigenen Grenzen und jene des Genres in einer befremdenden Widersprüchlichkeit ausreizt. 46 Die Abkehr von einem realistischen Setup, wie es für die Wir-Erzählungen des 19. Jahrhunderts kennzeichnend war, 47 ist freilich vor einer Änderung der Features in modernen und postmodernen Erzählungen insgesamt zu sehen. Anregungen für eine Neuprofilierung des Wir-Erzählens kann das Konzept des postmodernen Ich-Erzählers geben, der nicht (mehr) an die epistemologischen Regeln des Realismus gebunden ist. 48 Mit der Abkehr vom Realismus bricht die Wir-Erzählung mit einer der folgenreichsten Forderungen traditioneller Erzählmuster. Als potenziell subversiv kann sie auch aus einem anderen Grund gelten. Wenn es stimmt, dass sich das erzählende Wir stärker als andere narrative Verfahren über ein ideologisches Moment bestimmt, 49 dann wäre Linda Stifts Formwahl auch eine politische Entscheidung. Wir-Erzählungen referieren auf mehr als eine Person (Ich-Erzählung) und haben daher ein durch die Bezugsgruppe limitiertes, quasi natürliches 45 Vgl. Amit: A contextual view, 2f. (Seitenzählung nach: (20.05.).) 46 Richardson spricht von einem Wir, that typically (an most successfully) plays with it s own boundaries, Richardson: Unnatural Voices, Vgl. Monika Fludernik: Towards a Natural Narratology. London, New York 1996, Richardson: Unnatural Voices, 58. Weitaus geringer schätzt Fludernik das Potenzial von Wir-Erzählungen ein, realistische Erzählkonzepte zu durchbrechen (Fludernik: Towards a Natural Narratology, 225). 49 Sehr zurückhaltend Amit: A contextual view, 5f. (Seitenzählung nach: (20.05.).)
12 12 Verallgemeinerungspotenzial. Anders als das unpersönliche, noch deutlich stärker generalisierende und Distanz schaffende man ist das Wir keine subjektlose Größe. Gleichsam multiples Subjekt Menschen werden nur fragmentarisch als Einzelwesen wahrnehmbar, entsteht seine Identität weniger über semantische Konkretisierungen wie etwa Nationalität, Religionszugehörigkeit, soziale Schicht etc. und (interne) Ordnungen als über die Kontrastierung mit einem Anderen, das fast ausschließlich in der Wahrnehmung bzw. der Imagination durch die MigrantInnen und damit über das Verfahren der Fremdperspektivierung präsent ist. Sowohl für das Wir als auch für das Sie ruft der Text kulturell geprägte und tradierte Bilder auf ich verweise nur auf die plakative Klischeehaftigkeit, mit der die Welt der schönen Dinge entworfen, die Welt der MigrantInnen erinnert wird. 50 Und hier zeigt sich das eigentliche Defizit des Textes, das nichts mit dem Genre der Wir-Erzählung an sich oder mit der fehlenden Alltagsrealität also der mangelnden historischen, geografischen, sozialen etc. Identifizier- und Verifizierbarkeit des Erzählten zu tun hat. Die Problematik des Textes liegt vielmehr darin, dass die Akkumulation von Stereotypen, die das Sprechen von anderen und das Sprechen von sich gleichermaßen prägt, weder für das Erzählte noch im Sinne des Erzählens selbst funktionalisiert wird. Auch wenn der Text die Situation politischer, sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit dokumentiert und zumindest implizit kritisiert, bleibt das der Wir-Erzählung zugeschriebene subversive Potenzial zu einem großen Teil ungenutzt: Das liegt einerseits daran, dass Stereotypen zwar dargestellt, aber nicht problematisiert und noch weniger reflektiert werden; und das liegt andererseits an einem Konzept, das von einem erzähltechnischen in ein ideologisches Dilemma führt. Kommen wir noch einmal auf den/die ErzählerInnen zurück. Während Stimme und Modus in der Darstellung des Anderen kongruieren (das Wir nimmt andere wahr bzw. stellt sie sich vor und spricht aus dieser Wahrnehmung / Vorstellung heraus über sie), gehen sie in der Selbstcharakteristik der Erzählinstanz auseinander (das Wir spricht, gibt aber eine nicht als solche ausgewiesene Wahrnehmung durch andere quasi als seine eigene wieder). Über dieses narrative Konstrukt erzeugt der Text nicht nur ein äußerst fragwürdiges MigrantInnen-Bild, sondern das durch die Erzählperspektive vorausbestimmte Identifikationsangebot erweist sich auch aus einem anderen Grund als problematisch: Indem das Wir durch 50 Oder auch die bereits angesprochenen, von Stereotypen geprägten Männlichkeits- und Weiblichkeitsentwürfe.
13 13 Projektion(en) eines Nicht-Wir entsteht, sich also über jene Merkmale und Eigenschaften konturiert, die ihm dieses zuschreibt / zugesteht, erhält es in der Welt der schönen Dinge kein reflektiertes Profil. Nimmt man das Identifikationsangebot des Textes ernst, so dient es letztlich der Konsolidierung des Anderen. Ich glaube nicht, dass das die Botschaft ist, die eine mutige 51 Auseinandersetzung mit dem Thema vermittelt. 51 Noch einmal Keller: Diskussion, (20.05.).
Erzählsituation - Fokalisierung
 Erzählsituation - Fokalisierung 26.4.2017 Fiction does not imitate reality out there. It imitates a fellow telling about it. (Baker) Wer spricht zu wem? Realer Autor (author) Erzähler (narrator) fiktiver
Erzählsituation - Fokalisierung 26.4.2017 Fiction does not imitate reality out there. It imitates a fellow telling about it. (Baker) Wer spricht zu wem? Realer Autor (author) Erzähler (narrator) fiktiver
Erzählinstanzen in Theodor Storms "Der Schimmelreiter"
 Germanistik Gudrun Kahles Erzählinstanzen in Theodor Storms "Der Schimmelreiter" Welche Wirkung erzeugt die Konstruktion des Diskurses beim Rezipienten und wie steht sie im Zusammenhang mit der Diegese?
Germanistik Gudrun Kahles Erzählinstanzen in Theodor Storms "Der Schimmelreiter" Welche Wirkung erzeugt die Konstruktion des Diskurses beim Rezipienten und wie steht sie im Zusammenhang mit der Diegese?
Elemente der Narratologie
 Wolf Schmid Elemente der Narratologie 2., verbesserte Auflage W DE G Walter de Gruyter Berlin New York Inhaltsverzeichnis I. Merkmale des Erzählens im fiktionalen Werk 1. Narrativität ung Ereignishaftigkeit
Wolf Schmid Elemente der Narratologie 2., verbesserte Auflage W DE G Walter de Gruyter Berlin New York Inhaltsverzeichnis I. Merkmale des Erzählens im fiktionalen Werk 1. Narrativität ung Ereignishaftigkeit
Gérard Genette: Die Erzählung (hg. von Jochen Vogt) discours : Abfolge von Zeichen, Text, das Wie der Darstellung
 Gérard Genette: Die Erzählung (hg. von Jochen Vogt) 1994 discours : Abfolge von Zeichen, Text, das Wie der Darstellung histoire : Abfolge von Ereignissen, eine Geschichte, das Was der Darstellung discours
Gérard Genette: Die Erzählung (hg. von Jochen Vogt) 1994 discours : Abfolge von Zeichen, Text, das Wie der Darstellung histoire : Abfolge von Ereignissen, eine Geschichte, das Was der Darstellung discours
Wolf Schmid. Ele01ente der. N arratologie. 3., erweiterte und überarbeitete Auflage. De Gruyter
 Wolf Schmid Ele01ente der N arratologie 3., erweiterte und überarbeitete Auflage De Gruyter Vorwort... - 1. Merkmale des Erzählens im fiktionalen Werk 1. Narrativität............ 1 a) Der klassische und
Wolf Schmid Ele01ente der N arratologie 3., erweiterte und überarbeitete Auflage De Gruyter Vorwort... - 1. Merkmale des Erzählens im fiktionalen Werk 1. Narrativität............ 1 a) Der klassische und
Einführung in die Erzähltextanalyse
 Einführung in die Erzähltextanalyse Bearbeitet von Matthias Aumüller, Benjamin Biebuyck, Anja Burghardt, Jens Eder, Per Krogh Hansen, Peter Hühn, Felix Sprang, Silke Lahn, Jan Christoph Meister 1. Auflage
Einführung in die Erzähltextanalyse Bearbeitet von Matthias Aumüller, Benjamin Biebuyck, Anja Burghardt, Jens Eder, Per Krogh Hansen, Peter Hühn, Felix Sprang, Silke Lahn, Jan Christoph Meister 1. Auflage
Gute. Geschichten erzählen. - ein Leitfaden -
 Gute Geschichten erzählen - ein Leitfaden - Inhaltsverzeichnis 1 Grundstruktur jeder Geschichte... 4 2 Eine Geschichte erfinden... 6 3 Dramaturgie des Erzählens... 9 Literaturverzeichnis Impressum 1 Grundstruktur
Gute Geschichten erzählen - ein Leitfaden - Inhaltsverzeichnis 1 Grundstruktur jeder Geschichte... 4 2 Eine Geschichte erfinden... 6 3 Dramaturgie des Erzählens... 9 Literaturverzeichnis Impressum 1 Grundstruktur
kultur- und sozialwissenschaften
 Univ.-Prof. Dr. Martin Huber Methoden der Textanalyse Überarbeitete Fassung vom März 2011 kultur- und sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere
Univ.-Prof. Dr. Martin Huber Methoden der Textanalyse Überarbeitete Fassung vom März 2011 kultur- und sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere
Vorlesung Theoriegeschichte der Ethnologie 3: Fortsetzung Durkheim & Georg Simmel. Prof. Dr. Helene Basu
 Vorlesung Theoriegeschichte der Ethnologie 3: Fortsetzung Durkheim & Georg Simmel Prof. Dr. Helene Basu 05. 11. 2007 Was sind soziale Tatsachen? Wirklichkeiten, die außerhalb des Individuums liegen und
Vorlesung Theoriegeschichte der Ethnologie 3: Fortsetzung Durkheim & Georg Simmel Prof. Dr. Helene Basu 05. 11. 2007 Was sind soziale Tatsachen? Wirklichkeiten, die außerhalb des Individuums liegen und
Verlauf Material LEK Glossar Literatur
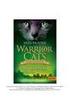 Reihe 21 S 5 Verlauf Material Schematische Verlaufsübersicht Peter Stamm: Blitzeis drei ausgewählte Erzählungen Über die Untersuchung von Sprache und Erzähltechnik zur Interpretation Modul 1 Die Erzählung
Reihe 21 S 5 Verlauf Material Schematische Verlaufsübersicht Peter Stamm: Blitzeis drei ausgewählte Erzählungen Über die Untersuchung von Sprache und Erzähltechnik zur Interpretation Modul 1 Die Erzählung
Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann
 Geisteswissenschaft Andrea Müller Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann Studienarbeit DIE SOZIALE KONSTRUKTION DER WIRKLICHKEIT NACH PETER L. BERGER UND THOMAS
Geisteswissenschaft Andrea Müller Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann Studienarbeit DIE SOZIALE KONSTRUKTION DER WIRKLICHKEIT NACH PETER L. BERGER UND THOMAS
Analyse der Tagebücher der Anne Frank
 Germanistik Amely Braunger Analyse der Tagebücher der Anne Frank Unter Einbeziehung der Theorie 'Autobiografie als literarischer Akt' von Elisabeth W. Bruss Studienarbeit 2 INHALTSVERZEICHNIS 2 1. EINLEITUNG
Germanistik Amely Braunger Analyse der Tagebücher der Anne Frank Unter Einbeziehung der Theorie 'Autobiografie als literarischer Akt' von Elisabeth W. Bruss Studienarbeit 2 INHALTSVERZEICHNIS 2 1. EINLEITUNG
Was bedeutet das alles?
 THOMAS NAGEL Was bedeutet das alles? Eine ganz kurze Einführung in die Philosophie Aus dem Englischen übersetzt von Michael Gebauer Philipp Reclam jun. Stuttgart Titel der englischen Originalausgabe: What
THOMAS NAGEL Was bedeutet das alles? Eine ganz kurze Einführung in die Philosophie Aus dem Englischen übersetzt von Michael Gebauer Philipp Reclam jun. Stuttgart Titel der englischen Originalausgabe: What
1. Erzählen als Basisform der Verständigung
 1. Erzählen als Basisform der Verständigung Erzählen ist eine Grundform sprachlicher Darstellung, die in verschiedenen Formen und Kontexten und mit unterschiedlichen Zielen stattfindet. Erzählungen sind
1. Erzählen als Basisform der Verständigung Erzählen ist eine Grundform sprachlicher Darstellung, die in verschiedenen Formen und Kontexten und mit unterschiedlichen Zielen stattfindet. Erzählungen sind
E rzä h I texta n a l yse und Gender Studies
 Vera Nünning und Ansgar Nünning (Hrsg.) E rzä h I texta n a l yse und Gender Studies Unter Mitarbeit von Nadyne Stritzke Verlag J.B. Metzler Weimar In ha I tsverzeic h n is I. Von der feministischen Narratologie
Vera Nünning und Ansgar Nünning (Hrsg.) E rzä h I texta n a l yse und Gender Studies Unter Mitarbeit von Nadyne Stritzke Verlag J.B. Metzler Weimar In ha I tsverzeic h n is I. Von der feministischen Narratologie
Produktive Störungen: Pause, Schweigen, Leerstelle. Lehrstuhl für Deutsche Philologie Anna Ullrich, Heiner Apel, Andreas Corr
 Produktive Störungen: Pause, Schweigen, Leerstelle Gliederung 1 Phänomene der Absenz Beschreibungsperspektiven - Pause - Schweigen - Leerstelle 2 Störung und Transkriptionstheorie 3 Absenz als produktive
Produktive Störungen: Pause, Schweigen, Leerstelle Gliederung 1 Phänomene der Absenz Beschreibungsperspektiven - Pause - Schweigen - Leerstelle 2 Störung und Transkriptionstheorie 3 Absenz als produktive
Evangelische Religion, Religionspädagogik
 Lehrplaninhalt Vorbemerkung Im Fach Evangelische Religion an der Fachschule für Sozialpädagogik geht es sowohl um 1. eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben, 2. die Reflexion des eigenen religiösen
Lehrplaninhalt Vorbemerkung Im Fach Evangelische Religion an der Fachschule für Sozialpädagogik geht es sowohl um 1. eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben, 2. die Reflexion des eigenen religiösen
Intertextualitätstheorie
 Intertextualitätstheorie Intertextualitätstheorie bezeichnet die Eigenschaft von insbes. lit. Texten, auf andere Texte bezogen zu sein beschreibt, erklärt oder systematisiert die Bezüge zwischen Texten
Intertextualitätstheorie Intertextualitätstheorie bezeichnet die Eigenschaft von insbes. lit. Texten, auf andere Texte bezogen zu sein beschreibt, erklärt oder systematisiert die Bezüge zwischen Texten
Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht"
 Geisteswissenschaft Nicole Friedrich Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht" Eine Annäherung Essay Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Lektürekurs Foucault Sommersemester 2011
Geisteswissenschaft Nicole Friedrich Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht" Eine Annäherung Essay Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Lektürekurs Foucault Sommersemester 2011
Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen Eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit Prof. Dr. Dr. Helmut Schneider (Steinbeis-Hochschule Berlin) Seite 2 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen Eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit Prof. Dr. Dr. Helmut Schneider (Steinbeis-Hochschule Berlin) Seite 2 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft
 Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft Teilband 2 Hans-Georg Gadamer I Heinrich. Fries Mythos und Wissenschaft Alois Halder / Wolf gang Welsch Kunst und Religion Max Seckler I Jakob J. Petuchowski
Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft Teilband 2 Hans-Georg Gadamer I Heinrich. Fries Mythos und Wissenschaft Alois Halder / Wolf gang Welsch Kunst und Religion Max Seckler I Jakob J. Petuchowski
Es wär dann an der Zeit zu gehen.
 Es wär dann an der Zeit zu gehen. Wenn Menschen mit Behinderung erwachsen werden Moment Leben heute Gestaltung: Sarah Barci Moderation und Redaktion: Marie-Claire Messinger Sendedatum: 13. November 2012
Es wär dann an der Zeit zu gehen. Wenn Menschen mit Behinderung erwachsen werden Moment Leben heute Gestaltung: Sarah Barci Moderation und Redaktion: Marie-Claire Messinger Sendedatum: 13. November 2012
KAPITEL I EINLEITUNG
 KAPITEL I EINLEITUNG A. Hintergrunds Eines des wichtigsten Kommunikationsmittel ist die Sprache. Sprache ist ein System von Lauten, von Wörtern und von Regeln für die Bildung von Sätzen, das man benutzt,
KAPITEL I EINLEITUNG A. Hintergrunds Eines des wichtigsten Kommunikationsmittel ist die Sprache. Sprache ist ein System von Lauten, von Wörtern und von Regeln für die Bildung von Sätzen, das man benutzt,
Ästhetik ist die Theorie der ästhetischen Erfahrung, der ästhetischen Gegenstände und der ästhetischen Eigenschaften.
 16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
Subjektiv, deutlich, offen. Erzählend GOTT zur Sprache bringen
 Subjektiv, deutlich, offen Erzählend GOTT zur Sprache bringen Bibelgeschichten sind Geschichten mit Gott. Ich habe Ihnen ein Erzählkonzept mitgebracht, das die Frage nach Gott in den Geschichten in den
Subjektiv, deutlich, offen Erzählend GOTT zur Sprache bringen Bibelgeschichten sind Geschichten mit Gott. Ich habe Ihnen ein Erzählkonzept mitgebracht, das die Frage nach Gott in den Geschichten in den
Gedächtniskonzepte der Kulturwissenschaft
 Gedächtniskonzepte der Kulturwissenschaft Desiree Hebenstreit Universität Wien Erasmus-Intensiv-Programm EIP Die Transformation von 'Mitteleuropa'. Identitätspolitiken und Erinnerungskonstruktionen vor
Gedächtniskonzepte der Kulturwissenschaft Desiree Hebenstreit Universität Wien Erasmus-Intensiv-Programm EIP Die Transformation von 'Mitteleuropa'. Identitätspolitiken und Erinnerungskonstruktionen vor
Der Weber. unsichtbar / fachhochschule dresden / fakultät design / andre bischoff / grafikdesign
 unsichtbar / fachhochschule dresden / fakultät design / andre bischoff / grafikdesign Der Weber Ihr seid zu spät, um diese Geschichte euer Eigen zu nennen und zu früh, um selber Geschichte zu gestalten.
unsichtbar / fachhochschule dresden / fakultät design / andre bischoff / grafikdesign Der Weber Ihr seid zu spät, um diese Geschichte euer Eigen zu nennen und zu früh, um selber Geschichte zu gestalten.
Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat?
 Einleitung Dr. M. Vogel Vorlesung Grundprobleme der Philosophie des Geistes Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat? Malvin Gattinger Vor einem Antwortversuch will ich
Einleitung Dr. M. Vogel Vorlesung Grundprobleme der Philosophie des Geistes Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat? Malvin Gattinger Vor einem Antwortversuch will ich
Metafiktionalität und Metalepsen in Daniel Kehlmanns "Ruhm"
 Germanistik Andreas Schlattmann Metafiktionalität und Metalepsen in Daniel Kehlmanns "Ruhm" Eine vergleichende Analyse der Erzählungen "In Gefahr" [I] und [II] Studienarbeit Metafiktionalität und Metalepsen
Germanistik Andreas Schlattmann Metafiktionalität und Metalepsen in Daniel Kehlmanns "Ruhm" Eine vergleichende Analyse der Erzählungen "In Gefahr" [I] und [II] Studienarbeit Metafiktionalität und Metalepsen
Aspekte der Bild- und Alltagskultur als Gegenstand der Bildnerischen Erziehung
 Aspekte der Bild- und Alltagskultur als Gegenstand der Bildnerischen Erziehung Im alten Curriculum heißt die LV Methoden der Kunstvermittlung 3 intime Einblicke Der Supermarkt als Kulturschule Die vielen
Aspekte der Bild- und Alltagskultur als Gegenstand der Bildnerischen Erziehung Im alten Curriculum heißt die LV Methoden der Kunstvermittlung 3 intime Einblicke Der Supermarkt als Kulturschule Die vielen
AUTORSCHAFT. Einführung in die Literaturtheorie silkehorstkotte.wordpress.com
 AUTORSCHAFT Einführung in die Literaturtheorie silkehorstkotte.wordpress.com Gliederung 1. Fragen und Antworten aus der letzten Stunde 2. Der Tod des Autors 3. Die Rückkehr des Autors 1. FRAGEN UND ANTWORTEN
AUTORSCHAFT Einführung in die Literaturtheorie silkehorstkotte.wordpress.com Gliederung 1. Fragen und Antworten aus der letzten Stunde 2. Der Tod des Autors 3. Die Rückkehr des Autors 1. FRAGEN UND ANTWORTEN
Erzählstimmen im aktuellen Film
 Christina Heiser Erzählstimmen im aktuellen Film Strukturen, Traditionen und Wirkungen der Voice-Over-Narration SCHÜREN Danksagung Einleitung 10 11 I. Die Voice-Over-Narration in der Filmgeschichte 1 Der
Christina Heiser Erzählstimmen im aktuellen Film Strukturen, Traditionen und Wirkungen der Voice-Over-Narration SCHÜREN Danksagung Einleitung 10 11 I. Die Voice-Over-Narration in der Filmgeschichte 1 Der
Hermann Paul. Aufgabe und Methode der Geschichtswissenschaften
 Hermann Paul Aufgabe und Methode der Geschichtswissenschaften C e l t i s V e r l a g Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
Hermann Paul Aufgabe und Methode der Geschichtswissenschaften C e l t i s V e r l a g Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
Sprachwissenschaft und Literatur
 Sprachwissenschaft und Literatur Berliner Lehrbücher Sprachwissenschaft Band 3 Jesús Zapata González Sprachwissenschaft und Literatur Ein Einstieg in die Literaturtheorie Bibliografische Information Der
Sprachwissenschaft und Literatur Berliner Lehrbücher Sprachwissenschaft Band 3 Jesús Zapata González Sprachwissenschaft und Literatur Ein Einstieg in die Literaturtheorie Bibliografische Information Der
Methoden der Kunstvermittlung 3
 Methoden der Kunstvermittlung 3 Überkommene Bezeichnung im neuen Curriculum heißt die LV Aspekte der Bild- und Alltagskultur als Gegenstand des BE-Unterrichts Methoden der Kunstvermittlung 3 Der Supermarkt
Methoden der Kunstvermittlung 3 Überkommene Bezeichnung im neuen Curriculum heißt die LV Aspekte der Bild- und Alltagskultur als Gegenstand des BE-Unterrichts Methoden der Kunstvermittlung 3 Der Supermarkt
LUDWIK-FLECK-KOLLOQUIUM WAS HEISST: WIRKLICH SEIN? TEIL III
 LUDWIK-FLECK-KOLLOQUIUM WAS HEISST: WIRKLICH SEIN? TEIL III Mittwoch, 18. Mai 2016, 16:15 19:30 Uhr Ludwik Fleck Zentrum am Collegium Helveticum Schmelzbergstrasse 25, 8006 Zürich COLLEGIUM H E LV E T
LUDWIK-FLECK-KOLLOQUIUM WAS HEISST: WIRKLICH SEIN? TEIL III Mittwoch, 18. Mai 2016, 16:15 19:30 Uhr Ludwik Fleck Zentrum am Collegium Helveticum Schmelzbergstrasse 25, 8006 Zürich COLLEGIUM H E LV E T
Aus: Peter Fischer Phänomenologische Soziologie. Oktober 2012, 144 Seiten, kart., 12,50, ISBN
 Aus: Peter Fischer Phänomenologische Soziologie Oktober 2012, 144 Seiten, kart., 12,50, ISBN 978-3-8376-1464-0 Die Phänomenologie erfährt in der Soziologie gegenwärtig eine Renaissance. Insbesondere die
Aus: Peter Fischer Phänomenologische Soziologie Oktober 2012, 144 Seiten, kart., 12,50, ISBN 978-3-8376-1464-0 Die Phänomenologie erfährt in der Soziologie gegenwärtig eine Renaissance. Insbesondere die
»Wenn du wüsstest, wie kostbar mir dein Schweigen ist«
 »Wenn du wüsstest, wie kostbar mir dein Schweigen ist«phänomene der Absenz im Kontext transkriptiver Bedeutungsgenerierung 1 Phänomene der Absenz Beschreibungsperspektiven 2 Absenz und Transkriptionstheorie
»Wenn du wüsstest, wie kostbar mir dein Schweigen ist«phänomene der Absenz im Kontext transkriptiver Bedeutungsgenerierung 1 Phänomene der Absenz Beschreibungsperspektiven 2 Absenz und Transkriptionstheorie
Die Opfer schreiben - Tagebücher aus der Holocaustzeit
 Germanistik Genka Yankova-Brust Die Opfer schreiben - Tagebücher aus der Holocaustzeit Studienarbeit 1 Inhalt Einleitung... 2 1. Das Tagebuch... 3 1.1 Tagebücher als literarische Gattung... 3 1.2 Forschungssituation...
Germanistik Genka Yankova-Brust Die Opfer schreiben - Tagebücher aus der Holocaustzeit Studienarbeit 1 Inhalt Einleitung... 2 1. Das Tagebuch... 3 1.1 Tagebücher als literarische Gattung... 3 1.2 Forschungssituation...
Das Menschenbild im Koran
 Geisteswissenschaft Nelli Chrispens Das Menschenbild im Koran Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...2 2. Der Mensch als Geschöpf Gottes...3 3. Stellung des Menschen im Islam...4 3.1 Der Mensch
Geisteswissenschaft Nelli Chrispens Das Menschenbild im Koran Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...2 2. Der Mensch als Geschöpf Gottes...3 3. Stellung des Menschen im Islam...4 3.1 Der Mensch
Die Verwendung zweier unterschiedlicher Demonstrativpronomina in gesprochenem Deutsch
 Germanistik David Horak Die Verwendung zweier unterschiedlicher Demonstrativpronomina in gesprochenem Deutsch Der/die/das vs. dieser/diese/dieses Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 1 2.
Germanistik David Horak Die Verwendung zweier unterschiedlicher Demonstrativpronomina in gesprochenem Deutsch Der/die/das vs. dieser/diese/dieses Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 1 2.
Auf der Suche nach dem Praktischen im Urteilen.
 Geisteswissenschaft Thomas Grunewald Auf der Suche nach dem Praktischen im Urteilen. Hannah Arendt und Kants Politische Philosophie. Studienarbeit Gliederung Seite 1. Einleitung 2 2. Eine politische Theorie
Geisteswissenschaft Thomas Grunewald Auf der Suche nach dem Praktischen im Urteilen. Hannah Arendt und Kants Politische Philosophie. Studienarbeit Gliederung Seite 1. Einleitung 2 2. Eine politische Theorie
Ideologie & Utopie und Abschied von der Utopie?
 , Ideologie & Utopie und Abschied von der Utopie? Eine kurze Einführung in zwei Schriften von Ernst Bloch Agenda 1. Ernst Bloch als Kind seiner Zeit 2. Kernthesen 3. Fragen zur Diskussion 2 1. Ernst Bloch
, Ideologie & Utopie und Abschied von der Utopie? Eine kurze Einführung in zwei Schriften von Ernst Bloch Agenda 1. Ernst Bloch als Kind seiner Zeit 2. Kernthesen 3. Fragen zur Diskussion 2 1. Ernst Bloch
Über das Altern einer Generation
 12. Fachtagung der Deutschen Alterswissenschaftlichen Gesellschaft (DAWG) e.v. 15./ 16. September 2006 Ludwig-Windthorst Windthorst-Haus Haus,, Lingen Vorstellung der Diplomarbeit Die 68er Über das Altern
12. Fachtagung der Deutschen Alterswissenschaftlichen Gesellschaft (DAWG) e.v. 15./ 16. September 2006 Ludwig-Windthorst Windthorst-Haus Haus,, Lingen Vorstellung der Diplomarbeit Die 68er Über das Altern
Die Verfälschung der Aussage Max Frischs Werk "Homo Faber" durch die filmische Adaption Volker Schlöndorffs
 Germanistik Martin Zerrle Die Verfälschung der Aussage Max Frischs Werk "Homo Faber" durch die filmische Adaption Volker Schlöndorffs Facharbeit (Schule) Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 1 2 Zum Roman
Germanistik Martin Zerrle Die Verfälschung der Aussage Max Frischs Werk "Homo Faber" durch die filmische Adaption Volker Schlöndorffs Facharbeit (Schule) Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 1 2 Zum Roman
Konfliktforschung I Kriegsursachen im historischen Kontext
 Konfliktforschung I Kriegsursachen im historischen Kontext Woche 5: Die zwei Weltkriege und das Konzept der Kollektiven Sicherheit Lena Kiesewetter Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for
Konfliktforschung I Kriegsursachen im historischen Kontext Woche 5: Die zwei Weltkriege und das Konzept der Kollektiven Sicherheit Lena Kiesewetter Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for
ENGLISCHE LITERATURGESCHICHTE DES 20. JAHRHUNDERTS
 Ina Schabert ENGLISCHE LITERATURGESCHICHTE DES 20. JAHRHUNDERTS Eine neue Darstellung aus der Sicht der Geschlechterforschung Mit 17 Abbildungen ALFRED KRONER VERLAG STUTTGART Vorwort XI 1. Einleitung
Ina Schabert ENGLISCHE LITERATURGESCHICHTE DES 20. JAHRHUNDERTS Eine neue Darstellung aus der Sicht der Geschlechterforschung Mit 17 Abbildungen ALFRED KRONER VERLAG STUTTGART Vorwort XI 1. Einleitung
Aktuell zu vergebende Abschlussarbeiten
 Aktuell zu vergebende Abschlussarbeiten Inhalt A Themenbereich Führung... 2 A.1 Merkmale, Ursachen und Folgen negativen Führungsverhaltens... 2 A.2 Führung... 2 B Themenbereich spezielle Formen der Mitarbeiterleistung
Aktuell zu vergebende Abschlussarbeiten Inhalt A Themenbereich Führung... 2 A.1 Merkmale, Ursachen und Folgen negativen Führungsverhaltens... 2 A.2 Führung... 2 B Themenbereich spezielle Formen der Mitarbeiterleistung
Logic and Selfreference
 Seminar Logik auf Abwegen Logic and Selfreference Heike Fischer 09.08.2004 1. Motivation 2. Objekt -und Metasprache 3. Modus Ponens 4. Lewis Caroll s Paradoxon 4.1 Inhalt & Analyse 4.2 Lösungsansätze 5.
Seminar Logik auf Abwegen Logic and Selfreference Heike Fischer 09.08.2004 1. Motivation 2. Objekt -und Metasprache 3. Modus Ponens 4. Lewis Caroll s Paradoxon 4.1 Inhalt & Analyse 4.2 Lösungsansätze 5.
Bilder als Diskurse, Sichtbares und Sagbares. Stefan Vater / Masterstudium Genderstudies
 Bilder als Diskurse, Sichtbares und Sagbares Stefan Vater / Masterstudium Genderstudies Michel Foucault Michel Foucault (1926-1984) Franz. Philosoph, Historiker, Ideengeschichtler Werke: Die Ordnung der
Bilder als Diskurse, Sichtbares und Sagbares Stefan Vater / Masterstudium Genderstudies Michel Foucault Michel Foucault (1926-1984) Franz. Philosoph, Historiker, Ideengeschichtler Werke: Die Ordnung der
(Chinesische Weisheit)
 Typische menschliche Denkfehler und deren Auswirkungen Worauf ihr zu sinnen habt, ist nicht mehr, dass die Welt von euch spreche, sondern wie ihr mit euch selbst sprechen solltet. (Chinesische Weisheit)
Typische menschliche Denkfehler und deren Auswirkungen Worauf ihr zu sinnen habt, ist nicht mehr, dass die Welt von euch spreche, sondern wie ihr mit euch selbst sprechen solltet. (Chinesische Weisheit)
Die Region und ihre Potenziale
 Die Region und ihre Potenziale Wie können lokale Identität und lokales Sozialkapital in der Region weiter entwickelt werden? Vernetzung und Teilhabe von Akteuren der Region Dr. Anke Kaschlik Wissenschaftliche
Die Region und ihre Potenziale Wie können lokale Identität und lokales Sozialkapital in der Region weiter entwickelt werden? Vernetzung und Teilhabe von Akteuren der Region Dr. Anke Kaschlik Wissenschaftliche
Bildnerisches Gestalten
 Anzahl der Lektionen Bildungsziel Bildnerische Gestaltung ist Teil der Kultur. Sie visualisiert und verknüpft individuelle und gesellschaftliche Inhalte. Sie ist eine Form der Kommunikation und setzt sich
Anzahl der Lektionen Bildungsziel Bildnerische Gestaltung ist Teil der Kultur. Sie visualisiert und verknüpft individuelle und gesellschaftliche Inhalte. Sie ist eine Form der Kommunikation und setzt sich
Was es heißt, (selbst-)bewusst zu leben. Theorien personaler Identität
 Geisteswissenschaft Miriam Ben-Said Was es heißt, (selbst-)bewusst zu leben. Theorien personaler Identität Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1) Einleitung...S.2 2) Bedeutung der Schlüsselbegriffe...S.3
Geisteswissenschaft Miriam Ben-Said Was es heißt, (selbst-)bewusst zu leben. Theorien personaler Identität Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1) Einleitung...S.2 2) Bedeutung der Schlüsselbegriffe...S.3
Zu Gustave Le Bons: "Psychologie der Massen"
 Geisteswissenschaft Karin Ulrich Zu Gustave Le Bons: "Psychologie der Massen" Die Massenseele - Über Massenbildung und ihre wichtigsten Dispositionen Essay Technische Universität Darmstadt Institut für
Geisteswissenschaft Karin Ulrich Zu Gustave Le Bons: "Psychologie der Massen" Die Massenseele - Über Massenbildung und ihre wichtigsten Dispositionen Essay Technische Universität Darmstadt Institut für
Pestalozzi-Gymnasium Unna im Januar Schulinternes Curriculum Praktische Philosophie für die Jahrgangsstufen 9 und 10 bzw.
 Pestalozzi-Gymnasium Unna im Januar 2010 Schulinternes Curriculum Praktische Philosophie für die Jahrgangsstufen 9 und 10 bzw. 8 und 9: Fragenkreis 1. Die dem Selbst Körper Leib Seele Freiheit ( obligatorisch)
Pestalozzi-Gymnasium Unna im Januar 2010 Schulinternes Curriculum Praktische Philosophie für die Jahrgangsstufen 9 und 10 bzw. 8 und 9: Fragenkreis 1. Die dem Selbst Körper Leib Seele Freiheit ( obligatorisch)
Aktuell zu vergebende Abschlussarbeiten
 Aktuell zu vergebende Abschlussarbeiten Inhalt A Themenbereich Führung... 2 A.1 Merkmale, Ursachen und Folgen negativen Führungsverhaltens... 2 A.2 Führung... 2 B Themenbereich spezielle Formen der Mitarbeiterleistung
Aktuell zu vergebende Abschlussarbeiten Inhalt A Themenbereich Führung... 2 A.1 Merkmale, Ursachen und Folgen negativen Führungsverhaltens... 2 A.2 Führung... 2 B Themenbereich spezielle Formen der Mitarbeiterleistung
Bildung das handelnde Subjekt. Cornelie Dietrich, Universität Lüneburg
 Bildung das handelnde Subjekt Cornelie Dietrich, Universität Lüneburg Bildung das handelnde Subjekt / Prof. Dr. Cornelie Dietrich / 2 Bildung das handelnde Subjekt / Prof. Dr. Cornelie Dietrich / 3 Bildung
Bildung das handelnde Subjekt Cornelie Dietrich, Universität Lüneburg Bildung das handelnde Subjekt / Prof. Dr. Cornelie Dietrich / 2 Bildung das handelnde Subjekt / Prof. Dr. Cornelie Dietrich / 3 Bildung
Migration und Zuwanderung als Themen in Bildungsmedien für den Deutschunterricht. Tipps für Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer
 Tipps für Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer Vorbemerkung Das vorliegende digitale Produkt wendet sich an Berufsanfänger_innen, die noch nicht so viel Routine bei der Materialauswahl für ihren Unterricht
Tipps für Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer Vorbemerkung Das vorliegende digitale Produkt wendet sich an Berufsanfänger_innen, die noch nicht so viel Routine bei der Materialauswahl für ihren Unterricht
LUDWIK-FLECK-KOLLOQUIUM WAS HEISST: WIRKLICH SEIN? TEIL III
 LUDWIK-FLECK-KOLLOQUIUM WAS HEISST: WIRKLICH SEIN? TEIL III Mittwoch, 18. Mai 2016, 15:30 20:00 Uhr Ludwik Fleck Zentrum am Collegium Helveticum Schmelzbergstrasse 25, 8006 Zürich COLLEGIUM H E LV E T
LUDWIK-FLECK-KOLLOQUIUM WAS HEISST: WIRKLICH SEIN? TEIL III Mittwoch, 18. Mai 2016, 15:30 20:00 Uhr Ludwik Fleck Zentrum am Collegium Helveticum Schmelzbergstrasse 25, 8006 Zürich COLLEGIUM H E LV E T
 '140 SVEN STRASEN 6.7 Toolkit νοn Leitfragen fiir die Analyse der Erzahlsituation und der Fokalisierung 7 ZUR ANALYSE DESERZAHLMODUS UND VERSCffiEDENER FORMEN νον FIGURENREDE 1) Treten ίη der vorliegenden
'140 SVEN STRASEN 6.7 Toolkit νοn Leitfragen fiir die Analyse der Erzahlsituation und der Fokalisierung 7 ZUR ANALYSE DESERZAHLMODUS UND VERSCffiEDENER FORMEN νον FIGURENREDE 1) Treten ίη der vorliegenden
Zukunftsperspektiven des Christentums
 Karl Gabriel Wie kann der Glaube überleben? Die Zukunftsperspektiven des Christentums (Vortrag gehalten am 08. 02. 2017 im Sozialseminar der evang. Kirchengemeinde Jöllenbeck) 1. Einleitung 500 Jahre Reformation,
Karl Gabriel Wie kann der Glaube überleben? Die Zukunftsperspektiven des Christentums (Vortrag gehalten am 08. 02. 2017 im Sozialseminar der evang. Kirchengemeinde Jöllenbeck) 1. Einleitung 500 Jahre Reformation,
INHALT TEIL I: DIE BILDER DES SOZIALEN IN DER SOZIOLOGISCHEN THEORIEBILDUNG Einleitung... 11
 Einleitung.................................................. 11 TEIL I: DIE BILDER DES SOZIALEN IN DER SOZIOLOGISCHEN THEORIEBILDUNG.................................... 19 1 Zur Rolle der Bilder in der
Einleitung.................................................. 11 TEIL I: DIE BILDER DES SOZIALEN IN DER SOZIOLOGISCHEN THEORIEBILDUNG.................................... 19 1 Zur Rolle der Bilder in der
Michel Foucault
 Michel Foucault 15.10.1962 25.06.1984 Inhaber des Lehrstuhls für die Geschichte der Denksysteme am Collège de France in Paris, Philosoph, Psychologe, Historiker, Soziologe und Begründer der Diskursanalyse
Michel Foucault 15.10.1962 25.06.1984 Inhaber des Lehrstuhls für die Geschichte der Denksysteme am Collège de France in Paris, Philosoph, Psychologe, Historiker, Soziologe und Begründer der Diskursanalyse
Es war einmal Über Geschichte schreiben und zu Geschichte werden
 Es war einmal Über Geschichte schreiben und zu Geschichte werden Meike Watzlawik An dem klassischen Märchenauftakt Es war einmal wird deutlich, dass Geschichten egal ob fiktiven oder realen Inhalts etwas
Es war einmal Über Geschichte schreiben und zu Geschichte werden Meike Watzlawik An dem klassischen Märchenauftakt Es war einmal wird deutlich, dass Geschichten egal ob fiktiven oder realen Inhalts etwas
Das giftige Herz der Dinge
 Das giftige Herz der Dinge diaphanes Michel Foucault Das giftige Herz der Dinge Gespräch mit Claude Bonnefoy Herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von Philippe Artières Aus dem Französischen
Das giftige Herz der Dinge diaphanes Michel Foucault Das giftige Herz der Dinge Gespräch mit Claude Bonnefoy Herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von Philippe Artières Aus dem Französischen
Sicherer, nicht sinnvoll bezweifelbarer Ausgangspunkt des Denkens: Ich existiere.
 Descartes, Zweite Meditation Sicherer, nicht sinnvoll bezweifelbarer Ausgangspunkt des Denkens: Ich existiere. Das ist selbst dann nicht bezweifelbar, wenn ich in Betracht ziehe, dass es einen allmächtigen
Descartes, Zweite Meditation Sicherer, nicht sinnvoll bezweifelbarer Ausgangspunkt des Denkens: Ich existiere. Das ist selbst dann nicht bezweifelbar, wenn ich in Betracht ziehe, dass es einen allmächtigen
SUBJEKT UND IDENTITÄT. Einführung in die Literaturtheorie silkehorstkotte.wordpress.com
 SUBJEKT UND IDENTITÄT Einführung in die Literaturtheorie silkehorstkotte.wordpress.com Gliederung 1. Resümee und Fragen 2. Konzepte von Identität und Subjektivität 3. Das Problem des Naturalismus 4. Das
SUBJEKT UND IDENTITÄT Einführung in die Literaturtheorie silkehorstkotte.wordpress.com Gliederung 1. Resümee und Fragen 2. Konzepte von Identität und Subjektivität 3. Das Problem des Naturalismus 4. Das
Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung
 Geisteswissenschaft Sarah Nolte Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Studienarbeit Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Sarah Nolte Universität zu Köln 1. Einleitung...1
Geisteswissenschaft Sarah Nolte Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Studienarbeit Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Sarah Nolte Universität zu Köln 1. Einleitung...1
Konstruktion der Vergangenheit
 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Chris Lorenz Konstruktion der Vergangenheit Eine Einführung in die
2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Chris Lorenz Konstruktion der Vergangenheit Eine Einführung in die
Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen
 Geisteswissenschaft Marian Berginz Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen Studienarbeit Marian Berginz WS 04/05 Soziologische Theorien Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen
Geisteswissenschaft Marian Berginz Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen Studienarbeit Marian Berginz WS 04/05 Soziologische Theorien Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen
Hypothesen. Ziel: Vorwissen der ForscherInnen in den Griff zu bekommen - Strukturierung des Vorwissens
 Hypothesen Ziel: Vorwissen der ForscherInnen in den Griff zu bekommen - Strukturierung des Vorwissens Quantitativ: ex-ante Kritik: ForscherInnen dadurch vorab auf eigenen Relevanzbereich zum Thema festgelegt
Hypothesen Ziel: Vorwissen der ForscherInnen in den Griff zu bekommen - Strukturierung des Vorwissens Quantitativ: ex-ante Kritik: ForscherInnen dadurch vorab auf eigenen Relevanzbereich zum Thema festgelegt
Arthur Schnitzlers "Der grüne Kakadu". Schein und Wirklichkeit
 Germanistik Antje Schmidt Arthur Schnitzlers "Der grüne Kakadu". Schein und Wirklichkeit Studienarbeit Universität Hamburg Institut für Germanistik II Seminar: Die Gattung Komödie Der grüne Kakadu die
Germanistik Antje Schmidt Arthur Schnitzlers "Der grüne Kakadu". Schein und Wirklichkeit Studienarbeit Universität Hamburg Institut für Germanistik II Seminar: Die Gattung Komödie Der grüne Kakadu die
Philosophische Semantik
 Wir behaupten, daß es möglich ist, daß zwei Sprecher genau im selben Zustand (im engen Sinne) sind, obwohl die Extension von A im Ideolekt des einen sich von der Extension von A im Ideolekt des anderen
Wir behaupten, daß es möglich ist, daß zwei Sprecher genau im selben Zustand (im engen Sinne) sind, obwohl die Extension von A im Ideolekt des einen sich von der Extension von A im Ideolekt des anderen
Sorgenlos und grübelfrei
 Korn Rudolf Sorgenlos und grübelfrei Wie der Ausstieg aus der Grübelfalle gelingt Online-Material an den Überfall aus. Für die betroffene Person ist das sehr unangenehm, aus der Sicht unseres Gehirns jedoch
Korn Rudolf Sorgenlos und grübelfrei Wie der Ausstieg aus der Grübelfalle gelingt Online-Material an den Überfall aus. Für die betroffene Person ist das sehr unangenehm, aus der Sicht unseres Gehirns jedoch
Brechts Theatertheorie
 Germanistik Napawan Masaeng Brechts Theatertheorie Studienarbeit Das epische Theater Bertolt Brechts Inhalt: Zum Begriff:...1 Grundgedanke :...1 Das Wesentliche vom epischen Theater in Kürze :...4 Das
Germanistik Napawan Masaeng Brechts Theatertheorie Studienarbeit Das epische Theater Bertolt Brechts Inhalt: Zum Begriff:...1 Grundgedanke :...1 Das Wesentliche vom epischen Theater in Kürze :...4 Das
Kategoriale Ontologie. Dinge Eigenschaften Sachverhalte Ereignisse
 Kategoriale Ontologie Dinge Eigenschaften Sachverhalte Ereignisse 1334 Dinge und ihre Eigenschaften 1335 Dinge sind konkret. (raum-zeitlich lokalisierbar) Dinge sind den Sinnen zugänglich. Dinge sind partikulär.
Kategoriale Ontologie Dinge Eigenschaften Sachverhalte Ereignisse 1334 Dinge und ihre Eigenschaften 1335 Dinge sind konkret. (raum-zeitlich lokalisierbar) Dinge sind den Sinnen zugänglich. Dinge sind partikulär.
Wie sieht ein wertvolles Leben für Sie aus, was treibt Sie dahin? Seite 12
 Wie sieht ein wertvolles Leben für Sie aus, was treibt Sie dahin? Seite 12 Wenn Sie etwas einschränkt, ist es eher Schuld, Angst oder der Entzug von Zuneigung, und wie gehen Sie damit um? Seite 16 Welchen
Wie sieht ein wertvolles Leben für Sie aus, was treibt Sie dahin? Seite 12 Wenn Sie etwas einschränkt, ist es eher Schuld, Angst oder der Entzug von Zuneigung, und wie gehen Sie damit um? Seite 16 Welchen
3. Sitzung. Wie schreibe ich eine Hausarbeit?
 3. Sitzung Wie schreibe ich eine Hausarbeit? Inhalt der heutigen Veranstaltung I. Aufgabe einer Hausarbeit II. Schreibprozess III. Themenfindung IV. Elemente einer Hausarbeit V. Fragestellung VI. Hausarbeit
3. Sitzung Wie schreibe ich eine Hausarbeit? Inhalt der heutigen Veranstaltung I. Aufgabe einer Hausarbeit II. Schreibprozess III. Themenfindung IV. Elemente einer Hausarbeit V. Fragestellung VI. Hausarbeit
Inhalt. Einleitung Überblick Recht und Literatur Analogien und Interdependenzen... 13
 Inhalt Einleitung... 1 Kapitel I 1. Überblick... 11 2. Recht und Literatur Analogien und Interdependenzen... 13 2.1 Produktionsästhetische Perspektive... 14 2.2 Wirkungsästhetische Perspektive... 18 a.
Inhalt Einleitung... 1 Kapitel I 1. Überblick... 11 2. Recht und Literatur Analogien und Interdependenzen... 13 2.1 Produktionsästhetische Perspektive... 14 2.2 Wirkungsästhetische Perspektive... 18 a.
Die analytische Tradition
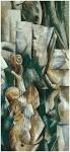 Die analytische Tradition lingustic turn : Wende von der Bewusstseins- zur Sprachphilosophie ab Ende des 19. bzw. Beginn des 20. Jahrhunderts Die analytische Tradition Die Philosophie ist ein Kampf gegen
Die analytische Tradition lingustic turn : Wende von der Bewusstseins- zur Sprachphilosophie ab Ende des 19. bzw. Beginn des 20. Jahrhunderts Die analytische Tradition Die Philosophie ist ein Kampf gegen
Annahme: Jede Wahrnehmung ist subjektiv: ICH sehe, höre und fühle. Regel: Ich spreche von meiner Wahrnehmung, also von ich nicht von
 Feedback-Regeln Feedback bedeutet Rückmeldung. Rückmeldung zu bekommen ist für viele Menschen ungewohnt. Daher sollte vor der Rückmeldung gefragt werden, ob diese überhaupt erwünscht ist. Außerdem sollte
Feedback-Regeln Feedback bedeutet Rückmeldung. Rückmeldung zu bekommen ist für viele Menschen ungewohnt. Daher sollte vor der Rückmeldung gefragt werden, ob diese überhaupt erwünscht ist. Außerdem sollte
Schulinternes Curriculum für das Fach Praktische Philosophie (Sekundarstufe I)
 Schulinternes Curriculum für das Fach Praktische Philosophie (Sekundarstufe I) Grundlage ist folgendes Lehrbuch vom Verlag C.C. Buchner: für die Jahrgangstufen 5/6: philopraktisch 1 für die Jahrgangstufe
Schulinternes Curriculum für das Fach Praktische Philosophie (Sekundarstufe I) Grundlage ist folgendes Lehrbuch vom Verlag C.C. Buchner: für die Jahrgangstufen 5/6: philopraktisch 1 für die Jahrgangstufe
transnationale Perspektive
 Perspektive Migration und Alter eine transnationale Barbara Laubenthal / Ludger Pries 1. Grundannahmen des Transnationalismus Ansatzes 2. Alter und grenzüberschreitende Migration: ein Analyserahmen 3.
Perspektive Migration und Alter eine transnationale Barbara Laubenthal / Ludger Pries 1. Grundannahmen des Transnationalismus Ansatzes 2. Alter und grenzüberschreitende Migration: ein Analyserahmen 3.
Gliederung. Stil als Wahrscheinlichkeitsbegriff
 Mathematik und Linguistik nach Lubomír Doležel Gliederung 1. Die statistische Stilanalyse 1.1. 1.2. Selektionsfaktoren 2. Die statistische Theorie der 2.1. Prager Theorie der 2.2. Statistik der 2.3. Stilcharakteristiken
Mathematik und Linguistik nach Lubomír Doležel Gliederung 1. Die statistische Stilanalyse 1.1. 1.2. Selektionsfaktoren 2. Die statistische Theorie der 2.1. Prager Theorie der 2.2. Statistik der 2.3. Stilcharakteristiken
Logik und modelltheoretische Semantik. Was ist Bedeutung?
 Logik und modelltheoretische Semantik Was ist Bedeutung? Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 30.5.2017 Zangenfeind: Was ist Bedeutung? 1 / 19 Zunächst: der
Logik und modelltheoretische Semantik Was ist Bedeutung? Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 30.5.2017 Zangenfeind: Was ist Bedeutung? 1 / 19 Zunächst: der
3. Kcmstrufftirismus. Der Mensch "konstruiert" sich seine Welt. Ist die Welt so, wie wir annehmen?
 Der Mensch "konstruiert" sich seine Welt. Ist die Welt so, wie wir annehmen? 3. Kcmstrufftirismus Können wir etwas von einer "wirklichen Wirklichkeit" - der Realität außerhalb von uns selbst - wissen?
Der Mensch "konstruiert" sich seine Welt. Ist die Welt so, wie wir annehmen? 3. Kcmstrufftirismus Können wir etwas von einer "wirklichen Wirklichkeit" - der Realität außerhalb von uns selbst - wissen?
Theorie des Erzählens
 Theorie des Erzählens Bearbeitet von Franz K. Stanzel 8. unv. Aufl. 2008. Taschenbuch. 339 S. Paperback ISBN 978 3 8252 0904 9 Format (B x L): 12 x 18,5 cm Weitere Fachgebiete > Literatur, Sprache > Literaturwissenschaft:
Theorie des Erzählens Bearbeitet von Franz K. Stanzel 8. unv. Aufl. 2008. Taschenbuch. 339 S. Paperback ISBN 978 3 8252 0904 9 Format (B x L): 12 x 18,5 cm Weitere Fachgebiete > Literatur, Sprache > Literaturwissenschaft:
17/07/15 Stimmen aus Berlin L. Raderschall FU Berlin Tagung Zukunftsforschung
 1 2 3 IDEE 4 Ein Projekt bei der die Zukunft Berlins aus der Perspektive unterschiedlicher Subkulturen mit Hilfe ethnografischer Methoden untersucht wird. 5 FRAGEN 6 Wie sehen Zukunftsbilder dieser Subkulturen
1 2 3 IDEE 4 Ein Projekt bei der die Zukunft Berlins aus der Perspektive unterschiedlicher Subkulturen mit Hilfe ethnografischer Methoden untersucht wird. 5 FRAGEN 6 Wie sehen Zukunftsbilder dieser Subkulturen
Wahrheit individuell wahr, doch die Art, wie wir das, was wir wahrnehmen, rechtfertigen und erklären, ist nicht die Wahrheit es ist eine Geschichte.
 Was ist Wahrheit Jeder Mensch ist ein Künstler, und unsere größte Kunst ist das Leben. Wir Menschen erfahren das Leben und versuchen, den Sinn des Lebens zu verstehen, indem wir unsere Wahrnehmung durch
Was ist Wahrheit Jeder Mensch ist ein Künstler, und unsere größte Kunst ist das Leben. Wir Menschen erfahren das Leben und versuchen, den Sinn des Lebens zu verstehen, indem wir unsere Wahrnehmung durch
Regionale Netzwerke zur Versorgung traumatisierter Flüchtlinge
 Regionale Netzwerke zur Versorgung traumatisierter Flüchtlinge Fachdienst Grundsatz- und Koordinierungsangelegenheiten Koordinierungsstelle zur Integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen (KiA)
Regionale Netzwerke zur Versorgung traumatisierter Flüchtlinge Fachdienst Grundsatz- und Koordinierungsangelegenheiten Koordinierungsstelle zur Integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen (KiA)
Das Verhältnis von Christlicher Lehre und Glaubenspraxis
 Das Verhältnis von Christlicher Lehre und Glaubenspraxis Prof. Dr. Markus Mühling Systematische Theologie und Wissenschaftskulturdialog Leuphana Universität Lüneburg 1. Das Problem 2. Klassische Lösungen
Das Verhältnis von Christlicher Lehre und Glaubenspraxis Prof. Dr. Markus Mühling Systematische Theologie und Wissenschaftskulturdialog Leuphana Universität Lüneburg 1. Das Problem 2. Klassische Lösungen
Pierre Bourdieu "Die männliche Herrschaft"
 Geisteswissenschaft Eva Kostakis Pierre Bourdieu "Die männliche Herrschaft" Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung:... 2 2. Die Kabylei:... 3 3. Die gesellschaftliche Konstruktion der Körper:...
Geisteswissenschaft Eva Kostakis Pierre Bourdieu "Die männliche Herrschaft" Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung:... 2 2. Die Kabylei:... 3 3. Die gesellschaftliche Konstruktion der Körper:...
Text: Ausschnitt aus dem ersten Kapitel (Morality, Religion, and the Meaning of Life) des Buchs Evolution, Morality, and the Meaning of Life (1982)
 Jeffrie G. Murphy: Warum? * 1940 1966 Ph.D. mit einer Arbeit über Kants Rechtsphilosophie Lehre an der University of Minnesota, der University of Arizona, ab 1994 als Professor of Law and Philosophy an
Jeffrie G. Murphy: Warum? * 1940 1966 Ph.D. mit einer Arbeit über Kants Rechtsphilosophie Lehre an der University of Minnesota, der University of Arizona, ab 1994 als Professor of Law and Philosophy an
Richard M. Hare: Alles egal? Richard M. Hare
 Richard M. Hare: Alles egal? Richard M. Hare *1919 Bristol während des 2. Weltkriegs mehr als drei Jahre in japanischer Kriegsgefangenschaft 1947 Abschluss seines Studiums in Philosophie und Altphilologie
Richard M. Hare: Alles egal? Richard M. Hare *1919 Bristol während des 2. Weltkriegs mehr als drei Jahre in japanischer Kriegsgefangenschaft 1947 Abschluss seines Studiums in Philosophie und Altphilologie
Martin Huber Nicolas Pethes Ulf-Michael Schneider. Grundlagen der Literaturwissenschaft. kultur- und sozialwissenschaften
 Martin Huber Nicolas Pethes Ulf-Michael Schneider Grundlagen der Literaturwissenschaft kultur- und sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere
Martin Huber Nicolas Pethes Ulf-Michael Schneider Grundlagen der Literaturwissenschaft kultur- und sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere
Schulinternes Curriculum für das Fach Praktische Philosophie. Fach / Jahrgangsstufe Praktische Philosophie 5/6
 Fach / Jahrgangsstufe 5/6 Nr. des Unterrichtsvorhabens im Doppeljahrgang: 1 Fragekreis 1 Die Frage nach dem Selbst Personale Kompetenz beschreiben die eigenen Stärken geben ihre Gefühle wieder und stellen
Fach / Jahrgangsstufe 5/6 Nr. des Unterrichtsvorhabens im Doppeljahrgang: 1 Fragekreis 1 Die Frage nach dem Selbst Personale Kompetenz beschreiben die eigenen Stärken geben ihre Gefühle wieder und stellen
