Neue theoretische Konzepte der Kernstrukturphysik
|
|
|
- Carsten Beyer
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Struktur und Dynamik exotischer Kerne Neue theoretische Konzepte der Kernstrukturphysik Robert Roth Institut für Kernphysik Technische Universität Darmstadt
2 Aktuelle Herausforderungen REX-ISOLDE, RISING, AGATA... Nukleare Astrophysik Kerne abseits der Stabilität FAIR Hyperkerne
3 Aktuelle Herausforderungen REX-ISOLDE, RISING, AGATA... Nukleare Astrophysik Kerne abseits der Stabilität FAIR Hyperkerne Zuverlässige Kernstrukturtheorie für exotische Kerne
4 Aktuelle Herausforderungen REX-ISOLDE, RISING, AGATA... Nukleare Astrophysik Kerne abseits der Stabilität FAIR Hyperkerne Zuverlässige Kernstrukturtheorie für exotische Kerne Brückenschlag zwischen Niederenergie-QCD und Kernstrukturtheorie
5 Moderne Kernstrukturtheorie Kernstruktur ab initio Methoden effektive Wechselwirkungen Vielteilchenmodelle Dichtefunktionalzugänge realistische Potentiale chirale Wechselwirkungen Niederenergie-QCD
6 Moderne Kernstrukturtheorie Kernstruktur ab initio Methoden effektive Wechselwirkungen Vielteilchenmodelle Dichtefunktionalzugänge realistische Potentiale chirale Wechselwirkungen Niederenergie-QCD
7 Realistische Wechselwirkungen NN-Potential QCD motiviert: Mesonenaustauschbild Phänomenologie: kurzreichweitiges Verhalten exp. Zweinukleondaten (Streuphasen & Deuteron) mit hoher Genauigkeit reproduziert Argonne V18 Nijmegen I/II CD Bonn
8 Realistische Wechselwirkungen NN-Potential QCD motiviert: Mesonenaustauschbild Phänomenologie: kurzreichweitiges Verhalten exp. Zweinukleondaten (Streuphasen & Deuteron) mit hoher Genauigkeit reproduziert Argonne V18 Nijmegen I/II CD Bonn NNN-Potential Phänomenologische Ergänzung des Zweiteilchenpotentials Einfachste Drei-Nukleonen-Prozesse Anpassung an Bindungs- & Anregungsenergien leichter Kerne Argonne V18 + Illinois 2 CD Bonn + Tuscon Melbourne
9 Chirale Wechselwirkungen chirale effektive Feldtheorie für (π,n)-system langreichweitige Pionen-Dynamik explizit behandelt kurzreichweitige Dynamik in Kontakttermen absorbiert Niederenergiekonstanten angepaßt an experimentelle Daten (NN, πn,...) konsistente Ableitung von NN- & NNN-Wechselwirkungen (inkl. elektromag. Ströme) U.-G. Meißner W. Glöckle A. Nogga...
10 Chirale Wechselwirkungen 2N forces 3N forces 4N forces chirale effektive Feldtheorie für (π,n)-system langreichweitige Pionen-Dynamik explizit behandelt kurzreichweitige Dynamik in Kontakttermen absorbiert Niederenergiekonstanten angepaßt an experimentelle Daten (NN, πn,...) konsistente Ableitung von NN- & NNN-Wechselwirkungen (inkl. elektromag. Ströme) U.-G. Meißner W. Glöckle A. Nogga... [Meißner, NPA 751 (25) 149c]
11 Ab initio Methoden exakte Lösung des quantenmechanischen Vielteilchenproblems mit realistischen Wechselwirkungen Quanten-Monte-Carlo-Methoden Variational Monte Carlo: Energieminimierung mit Vielteilchen- Versuchswellenfunktion Green s Function Monte Carlo: Propagation in imaginärer Zeit No-Core Schalenmodell großskalige Schalenmodell-Diagonalisierung & Lee-Suzuki- Transformation
12 Green s Function Monte Carlo Energy (MeV) He 6 He 6 Li Li 5/2 5/2 7/2 1/2 3/2 5/2 5/2 7/2 1/2 3/2 8 He Argonne v 18 With Illinois-2 GFMC Calculations 22 June 24 AV18 8 Be Be 9/2 (5/2 ) 7/2 (3/2 ) 1/2 5/2 3/2 4 + (4 + ) Be 1 B [S.C. Pieper, NPA 751 (25) 516c] IL2 Exp 12 C 12 C results are preliminary.
13 Green s Function Monte Carlo Energy (MeV) He 6 He 6 Li Li 5/2 5/2 7/2 1/2 3/2 5/2 5/2 7/2 1/2 3/2 8 He Argonne v 18 With Illinois-2 GFMC Calculations 22 June 24 AV18 8 Be extrem rechenzeitintensiv 9 Be 9/2 (5/2 ) 7/2 (3/2 ) 1/2 5/2 3/2 nur für leichte Kerne realisierbar 4 + (4 + ) Be 1 B CPU-Stunden -1 [S.C. Pieper, NPA 751 (25) 516c] IL2 Exp 12 C 12 C results are preliminary.
14 Moderne Kernstrukturtheorie Kernstruktur ab initio Methoden effektive Wechselwirkungen Vielteilchenmodelle Dichtefunktionalzugänge realistische Potentiale chirale Wechselwirkungen Niederenergie-QCD
15 Moderne Kernstrukturtheorie Kernstruktur ab initio Methoden effektive Wechselwirkungen Vielteilchenmodelle Dichtefunktionalzugänge realistische Potentiale chirale Wechselwirkungen Niederenergie-QCD
16 Effektive Wechselwirkungen Anpassung der Ww. an eingeschränkte Hilberträume durch streuphasenerhaltende Transformation Niederimpuls-Wechselwirkung V lowk Renormierungsgruppenreduktion auf Niederimpuls- Ww. & Entkopplung der Beiträge zu hohen Impulsen A. Nogga H. Müther J. Wambach Unitär korrelierte Wechselwirkung V UCOM unitäre Transformation zur expliziten Beschreibung kurzreichweitiger Zentral- und Tensorkorrelationen H. Feldmeier T. Neff R. Roth zustands- & basisunabhängige Operatordarstellung
17 Universelle Vielteilchenmodelle Lösung des Vielteilchenproblems in eingeschränktem Hilbertraum mit effektiven Wechselwirkungen Hartree-Fock, RPA, Schalenmodell etc. streuphasenäquiv. effektive Wechselwirkungen als universelle Basis Fermionische Molekulardynamik (FMD) nicht-orthogonale gaußsche Basis (sphärische Zustände, intrinsische Deformation, Cluster) K. Langanke H. Müther H. Lenske J. Wambach R. Roth... H. Feldmeier T. Neff R. Roth Variation, Projektion, Multi-Konfiguration
18 FMD: Intrinsische Dichteverteilungen 4 He 16 O 4 Ca ρ (1) ( x) [ρ] 9 Be 2 Ne 24 Mg
19 FMD: Intrinsische Dichteverteilungen 4 He 16 O 4 Ca ρ (1) ( x) [ρ] beschreibt sphärische, intrinsisch deformierte Ausgangspunkt für Drehimpuls/Paritätsprojektion 9 Be und Cluster-Zustände 2 Ne 24 und Mg gleichermaßen Multi-Konfiguration
20 FMD: Struktur von 12 C E MeV C x [fm] Multi-Config 4 Multi-Config 14 Experiment Multi-Config Experiment E [ MeV] R ch [ fm] B(E2, ) [e2 fm 4 ] ± 3.3 M(E, ) [ fm2 ] ±.2
21 FMD: Struktur von 12 C E MeV C x [fm] Multi-Config 4 Multi-Config 14 Experiment -5-5 Multi-Config Experiment E [ MeV] R ch [ fm] B(E2, ) [e2 fm 4 ] ± 3.3 M(E, ) [ fm2 ] ± etc.
22 FMD: Struktur von 12 C E MeV Hoyle- Zustand C x [fm] Multi-Config 4 Multi-Config 14 Experiment -5-5 Multi-Config Experiment E [ MeV] R ch [ fm] B(E2, ) [e2 fm 4 ] ± 3.3 M(E, ) [ fm2 ] ± etc.
23 Moderne Kernstrukturtheorie Kernstruktur ab initio Methoden effektive Wechselwirkungen Vielteilchenmodelle Dichtefunktionalzugänge realistische Potentiale chirale Wechselwirkungen Niederenergie-QCD
24 Moderne Kernstrukturtheorie Kernstruktur ab initio Methoden effektive Wechselwirkungen Vielteilchenmodelle Dichtefunktionalzugänge realistische Potentiale chirale Wechselwirkungen Niederenergie-QCD
25 Dichtefunktionalzugänge Dichtefunktionalmethoden zur Beschreibung von Kernen auf Basis eines (phänom.) Energiefunktionals Relativistische Mean-Field-Modelle eff. Lagrangian mit verschiedenen Mesonenbeiträgen & dichteabhängiger Kopplung Parameter angepaßt an experimentelle Daten oder unabhängige Kernmaterierechnungen Chirale effektive Feldtheorie Energiefunktional konstruiert mittels chiraler effektiver Feldtheorie & QCD Summenregeln P. Ring H. Lenske H. Wolter J. Maruhn P.G. Reinhardt... W. Weise N. Kaiser U.-G. Meißner...
26 Chirale effektive Feldtheorie [Finelli, Kaiser, Vretenar, Weise NPA 735 (24) 449 & priv. comm.]
27 Chirale effektive Feldtheorie [Finelli, Kaiser, Vretenar, Weise NPA 735 (24) 449 & priv. comm.] Single particle energy levels (MeV) ν 56 Ni π NL3 FKVW NL3 FKVW 1f 7/2 2s 1/2 1d 3/2 1d 5/2 1p 1/2 1p 3/2 1s 1/2 1f 7/2 2s 1/2 1d 3/2 1d 5/2 1p 1/2 1p 3/2 1s 1/ F(q) Ca FKVW expt q (fm -1 ) ρ ch (fm -3 ) FKVW expt r (fm)
28 Perspektiven Weiterentwicklung innovativer, zukunftsweisender Konzepte der Kernstrukturtheorie: chirale Wechselwirkungen (NN + NNN) effektive streuphasenäquivalente Ww. (V lowk, V UCOM ) vielseitige Vielteilchenmodelle (FMD,...) Energiefuktionale aus (chiralen) effektiven Feldtheorien Anwendung auf Kerne abseits der Stabilität, Hyperkerne, astrophysikalische Reaktionen,... Aufregende Zeiten für die Kernstrukturtheorie!
Moderne effektive Wechselwirkungen in der Kernstrukturphysik
 Moderne effektive Wechselwirkungen in der Kernstrukturphysik Robert Roth Institut für Kernphysik Technische Universität Darmstadt Überblick Motivation Moderne Effektive Wechselwirkungen Lee-Suzuki-Transformation
Moderne effektive Wechselwirkungen in der Kernstrukturphysik Robert Roth Institut für Kernphysik Technische Universität Darmstadt Überblick Motivation Moderne Effektive Wechselwirkungen Lee-Suzuki-Transformation
Moderne Kernstrukturtheorie: von der QCD zur Nuklidkarte
 Moderne Kernstrukturtheorie: von der QCD zur Nuklidkarte Robert Roth Institut für Kernphysik Technische Universität Darmstadt Überblick Motivation Nukleon-Nukleon-Wechselwirkungen exakte Lösung des Vielteilchenproblems
Moderne Kernstrukturtheorie: von der QCD zur Nuklidkarte Robert Roth Institut für Kernphysik Technische Universität Darmstadt Überblick Motivation Nukleon-Nukleon-Wechselwirkungen exakte Lösung des Vielteilchenproblems
Moderne Experimente der Kernphysik II
 Moderne Experimente der Kernphysik II - Aktuelle Fragestellungen der Kernstrukturphysik - Prof. Dr. Reiner Krücken Physik Department E12 Raum 2003 Tel. 12433 E-mail: reiner.kruecken@ph.tum.de Ein Blick
Moderne Experimente der Kernphysik II - Aktuelle Fragestellungen der Kernstrukturphysik - Prof. Dr. Reiner Krücken Physik Department E12 Raum 2003 Tel. 12433 E-mail: reiner.kruecken@ph.tum.de Ein Blick
Moderne Experimente der Kernphysik
 Moderne Experimente der Kernphysik Wintersemester 2011/12 Vorlesung 09 28.11.2011 1 Halo Kerne 2 Grenzen der Existenz Existiert ein Kern?? Kein 28 O!!! T 1/2 > 250 ns T 1/2 = 65 ms Dripline ( Abbruchkante
Moderne Experimente der Kernphysik Wintersemester 2011/12 Vorlesung 09 28.11.2011 1 Halo Kerne 2 Grenzen der Existenz Existiert ein Kern?? Kein 28 O!!! T 1/2 > 250 ns T 1/2 = 65 ms Dripline ( Abbruchkante
Der Kern der Dinge. ein komplexes Vielteilchensystem
 30 forschen Der Kern der Dinge ein komplexes Vielteilchensystem Auf der Erde findet man rund 270 verschiedene Spezies stabiler Atomkerne, die sich in der Anzahl ihrer Protonen und Neutronen unterscheiden.
30 forschen Der Kern der Dinge ein komplexes Vielteilchensystem Auf der Erde findet man rund 270 verschiedene Spezies stabiler Atomkerne, die sich in der Anzahl ihrer Protonen und Neutronen unterscheiden.
Cluster-Struktur in Kernen. Cluster: Aus mehr als einem Nukleon zusammengesetzten und identifizierbarem Subsystem
 Cluster-Struktur in Kernen Cluster: Aus mehr als einem Nukleon zusammengesetzten und identifizierbarem Subsystem Die Struktur von 11 Li Beim Aufbruch von 11 Li wird nicht nur ein Neutron herausgeschlagen
Cluster-Struktur in Kernen Cluster: Aus mehr als einem Nukleon zusammengesetzten und identifizierbarem Subsystem Die Struktur von 11 Li Beim Aufbruch von 11 Li wird nicht nur ein Neutron herausgeschlagen
Modifikation der Eigenschaften von Antikaonen in dichter Materie
 Modifikation der Eigenschaften von Antikaonen in dichter Materie Thomas Roth 7. Juli 2004 Motivation Kaonen...... in dichter Materie Motivation Kaonen... sind die leichtesten Mesonen mit Strangeness ±1...
Modifikation der Eigenschaften von Antikaonen in dichter Materie Thomas Roth 7. Juli 2004 Motivation Kaonen...... in dichter Materie Motivation Kaonen... sind die leichtesten Mesonen mit Strangeness ±1...
Kerne und Teilchen. Aufbau der Kerne (1) Moderne Experimentalphysik III Vorlesung 17.
 Kerne und Teilchen Moderne Experimentalphysik III Vorlesung 17 MICHAEL FEINDT INSTITUT FÜR EXPERIMENTELLE KERNPHYSIK Aufbau der Kerne (1) KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum
Kerne und Teilchen Moderne Experimentalphysik III Vorlesung 17 MICHAEL FEINDT INSTITUT FÜR EXPERIMENTELLE KERNPHYSIK Aufbau der Kerne (1) KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum
Kerne und Teilchen. Kernkraft. Moderne Experimentalphysik III Vorlesung 16.
 Kerne und Teilchen Moderne Experimentalphysik III Vorlesung 16 MICHAEL FEINDT & THOMAS KUH INSTITUT FÜ EXPEIMENTELLE KENPHYSIK Kernkraft KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum
Kerne und Teilchen Moderne Experimentalphysik III Vorlesung 16 MICHAEL FEINDT & THOMAS KUH INSTITUT FÜ EXPEIMENTELLE KENPHYSIK Kernkraft KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum
PHYSIK der STARKEN WECHSELWIRKUNG - Phasen und Strukturen -
 PHYSIK der STARKEN WECHSELWIRKUNG - Phasen und Strukturen - Experiment... Reiner Krücken Stephan Paul E 12 E 18... und Theorie Wolfram Weise T 39 Erforschung der STÄRKSTEN KRAFT im Kosmos Ursprung der
PHYSIK der STARKEN WECHSELWIRKUNG - Phasen und Strukturen - Experiment... Reiner Krücken Stephan Paul E 12 E 18... und Theorie Wolfram Weise T 39 Erforschung der STÄRKSTEN KRAFT im Kosmos Ursprung der
Kernstruktur mit effektiven Dreiteilchenpotentialen
 Kernstruktur mit effektiven Dreiteilchenpotentialen Diplomarbeit Anneke Zapp Betreut von Professor Dr Robert Roth Technische Universität Darmstadt Institut für Kernphysik November 26 ii Inhaltsverzeichnis
Kernstruktur mit effektiven Dreiteilchenpotentialen Diplomarbeit Anneke Zapp Betreut von Professor Dr Robert Roth Technische Universität Darmstadt Institut für Kernphysik November 26 ii Inhaltsverzeichnis
Computational Chemistry
 The fundamental laws necessary for the mathematical treatment of a large part of physics and the whole of chemistry are thus completely known, and the difficulty lies only in the fact that application
The fundamental laws necessary for the mathematical treatment of a large part of physics and the whole of chemistry are thus completely known, and the difficulty lies only in the fact that application
Einführung in die Teilchenphysik: Schwache Wechselwirkung - verschiedene Prozesse der schwachen WW - Cabibbo-Kobayashi-Maskawa-Matrix Standardmodell
 Kern- und Teilchenphysik Einführung in die Teilchenphysik: Schwache Wechselwirkung - verschiedene Prozesse der schwachen WW - Cabibbo-Kobayashi-Maskawa-Matrix Standardmodell Typische Prozesse der schwachen
Kern- und Teilchenphysik Einführung in die Teilchenphysik: Schwache Wechselwirkung - verschiedene Prozesse der schwachen WW - Cabibbo-Kobayashi-Maskawa-Matrix Standardmodell Typische Prozesse der schwachen
Kernphysik I. Kernkräfte und Kernmodelle: Ladungsunabhängigkeit der Kernkräfte Isospin
 Kernphysik I Kernkräfte und Kernmodelle: Ladungsunabhängigkeit der Kernkräfte Isospin Kernphysik I Universität u Köln - Fachgruppe Physik Großes Physikalisches Kolloquium Dienstag, 0. Juni 008, 6:45 Uhr
Kernphysik I Kernkräfte und Kernmodelle: Ladungsunabhängigkeit der Kernkräfte Isospin Kernphysik I Universität u Köln - Fachgruppe Physik Großes Physikalisches Kolloquium Dienstag, 0. Juni 008, 6:45 Uhr
Universalität in der Kernphysik
 Universalität in der Kernphysik Seminar-Vortrag von Thilo Egenolf https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/borromean_rings_illusion.png 09.06.16 Theorieseminar: Kernstruktur und Nukleare Astrophysik
Universalität in der Kernphysik Seminar-Vortrag von Thilo Egenolf https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/borromean_rings_illusion.png 09.06.16 Theorieseminar: Kernstruktur und Nukleare Astrophysik
Übungen Physik VI (Kerne und Teilchen) Sommersemester 2010
 Übungen Physik VI (Kerne und Teilchen) Sommersemester 21 Übungsblatt Nr. 3 Bearbeitung bis 6.5.21 Aufgabe 1: Neutronensterne Im Allgemeinen kann man annehmen, dass die Dichte in Zentrum von Neutronensternen
Übungen Physik VI (Kerne und Teilchen) Sommersemester 21 Übungsblatt Nr. 3 Bearbeitung bis 6.5.21 Aufgabe 1: Neutronensterne Im Allgemeinen kann man annehmen, dass die Dichte in Zentrum von Neutronensternen
Komplexe Kräfte effizient berechnen
 22 Komplexe Kräfte effizient berechnen Abb. 1: Prof. Dr. Evgeny Epelbaum rechnet: Mittels verschiedener Vereinfachungsstrategien wie der effektiven Feldtheorie wenden er und sein Team die Quantenchromodynamik
22 Komplexe Kräfte effizient berechnen Abb. 1: Prof. Dr. Evgeny Epelbaum rechnet: Mittels verschiedener Vereinfachungsstrategien wie der effektiven Feldtheorie wenden er und sein Team die Quantenchromodynamik
Kernphysik II Kernstruktur & Kernreaktionen Nuclear Structure & Reactions
 Kernphysik II Kernstruktur & Kernreaktionen Nuclear Structure & Reactions Dozent: Prof. Dr. P. Reiter Ort: Seminarraum Institut für Kernphysik Zeit: Montag 14:00 14:45 Mittwoch 16:00 17:30 Kernphysik II
Kernphysik II Kernstruktur & Kernreaktionen Nuclear Structure & Reactions Dozent: Prof. Dr. P. Reiter Ort: Seminarraum Institut für Kernphysik Zeit: Montag 14:00 14:45 Mittwoch 16:00 17:30 Kernphysik II
Bachelor Thesis. Optimierung von UCOM-Korrelatoren für das chirale N3LO Potential. Florian Wagner. Betreut von Prof. Dr.
 Bachelor Thesis Optimierung von UCOM-Korrelatoren für das chirale N3LO Potential Florian Wagner Betreut von Prof. Dr. Robert Roth November 2008 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 2 Methode der unitären
Bachelor Thesis Optimierung von UCOM-Korrelatoren für das chirale N3LO Potential Florian Wagner Betreut von Prof. Dr. Robert Roth November 2008 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 2 Methode der unitären
11. Quantenchemische Methoden
 Computeranwendung in der Chemie Informatik für Chemiker(innen) 11. Quantenchemische Methoden Jens Döbler 2004 "Computer in der Chemie", WS 2003-04, Humboldt-Universität VL11 Folie 1 Grundlagen Moleküle
Computeranwendung in der Chemie Informatik für Chemiker(innen) 11. Quantenchemische Methoden Jens Döbler 2004 "Computer in der Chemie", WS 2003-04, Humboldt-Universität VL11 Folie 1 Grundlagen Moleküle
Chirale Symmetrie, ihre Brechung und Restauration
 Chirale Symmetrie, ihre Brechung und Restauration Kathrin Leonhardt 14.06.2006 Gliederung 1. Motivation 2. Grundlagen 1. Lagrangeformalismus 2. Transformationen 3. Symmetriebrechung 4. Beispiel masseloser
Chirale Symmetrie, ihre Brechung und Restauration Kathrin Leonhardt 14.06.2006 Gliederung 1. Motivation 2. Grundlagen 1. Lagrangeformalismus 2. Transformationen 3. Symmetriebrechung 4. Beispiel masseloser
Atomkerne und Kernmaterie
 Atomkerne und Kernmaterie Atomkerne 1000 m 10 cm 1 cm < 0.01 mm Kernmaterie ρ = 4 10 17 kg/m³ Struktur von Atomkernen Atomkerne sind eine Agglomeration von Nukleonen (Protonen und Neutronen), die durch
Atomkerne und Kernmaterie Atomkerne 1000 m 10 cm 1 cm < 0.01 mm Kernmaterie ρ = 4 10 17 kg/m³ Struktur von Atomkernen Atomkerne sind eine Agglomeration von Nukleonen (Protonen und Neutronen), die durch
Modifikation der Schalenstruktur bei leichten Kernen (A<50)
 Modifikation der Schalenstruktur bei leichten Kernen (A
Modifikation der Schalenstruktur bei leichten Kernen (A
Einfache Modelle für komplexe Biomembranen
 Einfache Modelle für komplexe Biomembranen Hergen Schultze Disputation am 6. Oktober 2003 Institut für Theoretische Physik Georg-August-Universität Göttingen Φ[ q,p]= ih 1 7 3 7 Hergen Schultze: Einfache
Einfache Modelle für komplexe Biomembranen Hergen Schultze Disputation am 6. Oktober 2003 Institut für Theoretische Physik Georg-August-Universität Göttingen Φ[ q,p]= ih 1 7 3 7 Hergen Schultze: Einfache
Phänomene und Konzepte der Elementarteilchenphysik
 Otto Nachtmann Phänomene und Konzepte der Elementarteilchenphysik Mit 171 Bildern und 40 Tabellen Herausgegeben von Roman U. Sexl vieweg IX Inhaltsverzeichnis Vorwort Notation, Symbole und Abkürzungen
Otto Nachtmann Phänomene und Konzepte der Elementarteilchenphysik Mit 171 Bildern und 40 Tabellen Herausgegeben von Roman U. Sexl vieweg IX Inhaltsverzeichnis Vorwort Notation, Symbole und Abkürzungen
Symmetrie und Dynamik
 Fortbildung II, 25.3.2006 Symmetrie und Dynamik H.G. Dosch Inst. Theor. Physik 1. Spezielle Relativitätstheorie und Quantenmechanik Negative Energien Dirac-Gleichung Dirac-See Antimaterie 2. Quantenmechanik
Fortbildung II, 25.3.2006 Symmetrie und Dynamik H.G. Dosch Inst. Theor. Physik 1. Spezielle Relativitätstheorie und Quantenmechanik Negative Energien Dirac-Gleichung Dirac-See Antimaterie 2. Quantenmechanik
Physik IV Einführung in die Atomistik und die Struktur der Materie
 Physik IV Einführung in die Atomistik und die Struktur der Materie Sommersemester 2011 Vorlesung 16 09.06.2011 Physik IV - Einführung in die Atomistik Vorlesung 16 Prof. Thorsten Kröll 09.06.2011 1 Online-Vorlesung
Physik IV Einführung in die Atomistik und die Struktur der Materie Sommersemester 2011 Vorlesung 16 09.06.2011 Physik IV - Einführung in die Atomistik Vorlesung 16 Prof. Thorsten Kröll 09.06.2011 1 Online-Vorlesung
Einführung in die Kern- und Elementarteilchenphysik
 Hartmut Machner Einführung in die Kern- und Elementarteilchenphysik WILEY- VCH WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA Inhaltsverzeichnis Vorwort XIII 1 Historische Anfänge 1 1.1 Aufgaben 4 2 Experimentelle Methoden
Hartmut Machner Einführung in die Kern- und Elementarteilchenphysik WILEY- VCH WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA Inhaltsverzeichnis Vorwort XIII 1 Historische Anfänge 1 1.1 Aufgaben 4 2 Experimentelle Methoden
Restwechselwirkung zwischen Protonen und Neutronen treibt Deformation Art und Stärke der Restwechselwirkung hängt von der Konfiguration ab
 Formkoexistenz Ein paar Gedanken zur Einführung Restwechselwirkung zwischen Protonen und Neutronen treibt Deformation Art und Stärke der Restwechselwirkung hängt von der Konfiguration ab verschiedene Konfigurationen
Formkoexistenz Ein paar Gedanken zur Einführung Restwechselwirkung zwischen Protonen und Neutronen treibt Deformation Art und Stärke der Restwechselwirkung hängt von der Konfiguration ab verschiedene Konfigurationen
Kernphysik. Elemententstehung. 2. Kernphysik. Cora Fechner. Universität Potsdam SS 2014
 Elemententstehung 2. Cora Fechner Universität Potsdam SS 2014 alische Grundlagen Kernladungszahl: Z = Anzahl der Protonen Massenzahl: A = Anzahl der Protonen + Anzahl der Neutronen Bindungsenergie: B
Elemententstehung 2. Cora Fechner Universität Potsdam SS 2014 alische Grundlagen Kernladungszahl: Z = Anzahl der Protonen Massenzahl: A = Anzahl der Protonen + Anzahl der Neutronen Bindungsenergie: B
Kernmodelle! Inhalt: Kernradien Bindungenergien MassenbesFmmung Tröpfchenmodell Fermigas Model Kernspin und magnefsches Moment Schalenmodell
 Inhalt: Kernradien Bindungenergien MassenbesFmmung Tröpfchenmodell Fermigas Model Kernspin und magnefsches Moment Schalenmodell Kernmodelle! Kerne sind zusammengesetzte Systeme aus Protonen und Neutronen:
Inhalt: Kernradien Bindungenergien MassenbesFmmung Tröpfchenmodell Fermigas Model Kernspin und magnefsches Moment Schalenmodell Kernmodelle! Kerne sind zusammengesetzte Systeme aus Protonen und Neutronen:
Der Super-Kamiokande Detektor
 Der Super-Kamiokande Detektor (Kamioka Nuclear Decay Experiment) Hauptseminar SoSe 008 Schlüsselexperimente der Elementarteilchenphysik Vortrag am 6.6.008 von Michael Renner Übersicht Grundlagen Neutrino-Oszillationen
Der Super-Kamiokande Detektor (Kamioka Nuclear Decay Experiment) Hauptseminar SoSe 008 Schlüsselexperimente der Elementarteilchenphysik Vortrag am 6.6.008 von Michael Renner Übersicht Grundlagen Neutrino-Oszillationen
Kernphysik I. Kernmodelle: Beschreibung deformierter Kerne Kollektive Anregungen γ-zerfälle
 Kernphysik I Kernmodelle: Beschreibung deformierter Kerne Kollektive Anregungen γ-zerfälle Wiederholung: Erfolge des Schalenmodells Mit dem Schalenmodell können die "magischen" Zahlen erklärt werden. Kernspin
Kernphysik I Kernmodelle: Beschreibung deformierter Kerne Kollektive Anregungen γ-zerfälle Wiederholung: Erfolge des Schalenmodells Mit dem Schalenmodell können die "magischen" Zahlen erklärt werden. Kernspin
Experimentalphysik V - Kern- und Teilchenphysik Vorlesungsmitschrift. Dozent: Prof. K. Jakobs Verfasser: Ralf Gugel
 Experimentalphysik V - Kern- und Teilchenphysik Vorlesungsmitschrift Dozent: Prof. K. Jakobs Verfasser: Ralf Gugel 13. Januar 2013 Motivation: Die Feinstruktur der Bindungsenergie pro Nukleon ist bisher
Experimentalphysik V - Kern- und Teilchenphysik Vorlesungsmitschrift Dozent: Prof. K. Jakobs Verfasser: Ralf Gugel 13. Januar 2013 Motivation: Die Feinstruktur der Bindungsenergie pro Nukleon ist bisher
Nukleon-Nukleon-Reaktionen
 Nukleon-Nukleon-Reaktionen Eigenschaften des Nukleons Formalismus zur Beschreibung der elastischen Streuung (Optisches Modell, Streuphasen) und von Reaktionen Zwei-Nukleonen-Problem (Streulängen, NN-Potential,
Nukleon-Nukleon-Reaktionen Eigenschaften des Nukleons Formalismus zur Beschreibung der elastischen Streuung (Optisches Modell, Streuphasen) und von Reaktionen Zwei-Nukleonen-Problem (Streulängen, NN-Potential,
Kerne und Teilchen. Aufbau der Kerne (3) Moderne Experimentalphysik III Vorlesung 19.
 Kerne und Teilchen Moderne Experimentalphysik III Vorlesung 19 MICHAEL FEINDT INSTITUT FÜR EXPERIMENTELLE KERNPHYSIK Aufbau der Kerne (3) KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum
Kerne und Teilchen Moderne Experimentalphysik III Vorlesung 19 MICHAEL FEINDT INSTITUT FÜR EXPERIMENTELLE KERNPHYSIK Aufbau der Kerne (3) KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum
Nukleosynthese: Wie bildeten sich die Elemente? und was kann man mit INTEGRAL dazu lernen. Roland Diehl MPE
 Nukleosynthese: Wie bildeten sich die Elemente? und was kann man mit INTEGRAL dazu lernen MPE Periodensystem der Elemente Periodensystem : Chemische Elemente, Anordnung nach Eigenschaften der Elektronenhülle
Nukleosynthese: Wie bildeten sich die Elemente? und was kann man mit INTEGRAL dazu lernen MPE Periodensystem der Elemente Periodensystem : Chemische Elemente, Anordnung nach Eigenschaften der Elektronenhülle
Gesamtdrehimpuls Spin-Bahn-Kopplung
 Gesamtdrehimpuls Spin-Bahn-Kopplung > 0 Elektron besitzt Bahndrehimpuls L und S koppeln über die resultierenden Magnetfelder (Spin-Bahn-Kopplung) Vektoraddition zum Gesamtdrehimpuls J = L + S Für J gelten
Gesamtdrehimpuls Spin-Bahn-Kopplung > 0 Elektron besitzt Bahndrehimpuls L und S koppeln über die resultierenden Magnetfelder (Spin-Bahn-Kopplung) Vektoraddition zum Gesamtdrehimpuls J = L + S Für J gelten
2. Beschreibung von Teilchenprozessen
 2. Beschreibung von Teilchenprozessen 2.1 Relativistische Kinematik 2.2 Streuprozesse und Wirkungsquerschnitte 2.3 Rutherford-Streuung Caren Hagner / PHYSIK 5 / Wintersemester 2012/2013 Kapitel 2: Beschreibung
2. Beschreibung von Teilchenprozessen 2.1 Relativistische Kinematik 2.2 Streuprozesse und Wirkungsquerschnitte 2.3 Rutherford-Streuung Caren Hagner / PHYSIK 5 / Wintersemester 2012/2013 Kapitel 2: Beschreibung
Kernphysik I. Grundlegende Eigenschaften der Atomkerne: Bindungs-, Separationsenergie Massenmessungen Weizsäcker Massenformel
 Kernphysik I Grundlegende Eigenschaften der Atomkerne: Bindungs-, Separationsenergie Massenmessungen Weizsäcker Massenformel Massendefekt und Bindungsenergie Kerne sind die einzigen gebundenen Systeme,
Kernphysik I Grundlegende Eigenschaften der Atomkerne: Bindungs-, Separationsenergie Massenmessungen Weizsäcker Massenformel Massendefekt und Bindungsenergie Kerne sind die einzigen gebundenen Systeme,
Standardmodell der Teilchenphysik
 Standardmodell der Teilchenphysik Eine Übersicht Bjoern Walk bwalk@students.uni-mainz.de 30. Oktober 2006 / Seminar des fortgeschrittenen Praktikums Gliederung Grundlagen Teilchen Früh entdeckte Teilchen
Standardmodell der Teilchenphysik Eine Übersicht Bjoern Walk bwalk@students.uni-mainz.de 30. Oktober 2006 / Seminar des fortgeschrittenen Praktikums Gliederung Grundlagen Teilchen Früh entdeckte Teilchen
Fortgeschrittene Experimentalphysik für Lehramtsstudierende. Teil II: Kern- und Teilchenphysik
 Fortgeschrittene Experimentalphysik für Lehramtsstudierende Markus Schumacher 30.5.2013 Teil II: Kern- und Teilchenphysik Prof. Markus Schumacher Sommersemester 2013 Kapitel1: Einleitung und Grundbegriffe
Fortgeschrittene Experimentalphysik für Lehramtsstudierende Markus Schumacher 30.5.2013 Teil II: Kern- und Teilchenphysik Prof. Markus Schumacher Sommersemester 2013 Kapitel1: Einleitung und Grundbegriffe
Kapitel 5. Kernmodelle. 5.1 Tröpfchenmodell
 Kapitel 5 Kernmodelle Da Atomkerne Vielteilchensysteme sind, kann man sie praktisch nicht mit analytischen Methoden berechnen, und ist deshalb auf Modelle angewiessen. Die wichtigsten gängigen Kernmodelle
Kapitel 5 Kernmodelle Da Atomkerne Vielteilchensysteme sind, kann man sie praktisch nicht mit analytischen Methoden berechnen, und ist deshalb auf Modelle angewiessen. Die wichtigsten gängigen Kernmodelle
Struktur der Materie II (L) Kern und Teilchenphysik
 Struktur der Materie II (L) Kern und Teilchenphysik Vorlesung für das Lehramt Physik Dr. Martin zur Nedden Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Physik nedden@physik.hu-berlin.de Berlin, Wintersemester
Struktur der Materie II (L) Kern und Teilchenphysik Vorlesung für das Lehramt Physik Dr. Martin zur Nedden Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Physik nedden@physik.hu-berlin.de Berlin, Wintersemester
Isospin. N N I I 3 Q pp nn Triplet pp np Singulet I 3 Q B
 Isospin Isospinarstelleng er Nkleonen: p = I = 1 2, I = + 1 2 n = I = 1 2, I = 1 2 Gekoppelte Nkleon Nkleon Systeme: N N I I Q pp 1 +1 +2 nn 1 1 0 Triplet pp 1 0 +2 np 0 0 +1 Singlet Allgemein gilt für
Isospin Isospinarstelleng er Nkleonen: p = I = 1 2, I = + 1 2 n = I = 1 2, I = 1 2 Gekoppelte Nkleon Nkleon Systeme: N N I I Q pp 1 +1 +2 nn 1 1 0 Triplet pp 1 0 +2 np 0 0 +1 Singlet Allgemein gilt für
Struktur der Materie II (L), Kern und Teilchenphysik
 Struktur der Materie II (L), Kern und Teilchenphysik Dr. Martin zur Nedden, Humboldt Universität zu Berlin Vorlesung für das Lehramt Physik, Folien zur Vorlesung Berlin, Wintersemester 2003/2004 Struktur
Struktur der Materie II (L), Kern und Teilchenphysik Dr. Martin zur Nedden, Humboldt Universität zu Berlin Vorlesung für das Lehramt Physik, Folien zur Vorlesung Berlin, Wintersemester 2003/2004 Struktur
6. Das Quarkmodell Vorbemerkungen , S,
 6. Das Quarkmodell 6.1. Voremerkungen Hadronen sind ausgedehnt ( Formfaktoren ) Es git diskrete quantenmechanische Zustände fester Energien ( Massen ), charakterisiert durch Quantenzahlen J π, I, I 3,
6. Das Quarkmodell 6.1. Voremerkungen Hadronen sind ausgedehnt ( Formfaktoren ) Es git diskrete quantenmechanische Zustände fester Energien ( Massen ), charakterisiert durch Quantenzahlen J π, I, I 3,
Effektive Feldtheorien in Higgs-Physik
 19 Januar 2017 Übersicht 1 EFT Grundlagen 2 Higgsmechanismus 3 Effektive Feldtheorien in Higgsphysik 4 Literatur Effektive Feldtheorien Effektive Feldtheorien sind Näherungen, bei denen über Oszillationen
19 Januar 2017 Übersicht 1 EFT Grundlagen 2 Higgsmechanismus 3 Effektive Feldtheorien in Higgsphysik 4 Literatur Effektive Feldtheorien Effektive Feldtheorien sind Näherungen, bei denen über Oszillationen
Experimentelle Untersuchungen zur Struktur des Nukleons
 Experimentelle Untersuchungen zur Struktur des Nukleons 1. Einleitung 2. Der elektrische Formfaktor des Protons 3. Ergebnisse, die auf eine Abweichung einer sphärischen Ladungsverteilung beim Proton bzw.
Experimentelle Untersuchungen zur Struktur des Nukleons 1. Einleitung 2. Der elektrische Formfaktor des Protons 3. Ergebnisse, die auf eine Abweichung einer sphärischen Ladungsverteilung beim Proton bzw.
Moderne Experimente der Kernphysik
 Moderne Exerimente der Kernhysik Wintersemester 2011/12 Vorlesung 22 08.02.2012 1 Hyerkerne 2 Quarkstruktur von Hadronen Hyeronen und Kaonen Hyerkerne Produktion von Hyerkernen Hyernukleare Einteilchenniveaus
Moderne Exerimente der Kernhysik Wintersemester 2011/12 Vorlesung 22 08.02.2012 1 Hyerkerne 2 Quarkstruktur von Hadronen Hyeronen und Kaonen Hyerkerne Produktion von Hyerkernen Hyernukleare Einteilchenniveaus
Struktur der Materie II (L), Kern und Teilchenphysik
 Struktur der Materie II (L), Kern und Teilchenphysik Dr. Martin zur Nedden, Humboldt Universität zu Berlin Vorlesung für das Lehramt Physik, Folien zur Vorlesung Berlin, Wintersemester 2002/2003 Struktur
Struktur der Materie II (L), Kern und Teilchenphysik Dr. Martin zur Nedden, Humboldt Universität zu Berlin Vorlesung für das Lehramt Physik, Folien zur Vorlesung Berlin, Wintersemester 2002/2003 Struktur
Virialentwicklung. Janek Landsberg Fakultät für Physik, LMU München. Janek Landsberg. Die Virialentwicklung. Verschiedene Potentiale
 Die Warum Fakultät für Physik, LMU München 14.06.2006 Die Warum 1 Die Der zweite Virialkoeffizient 2 Hard-Sphere-Potential Lennard-Jones-Potential 3 Warum 4 Bsp. Hard-Sphere-Potential Asakura-Oosawa-Potential
Die Warum Fakultät für Physik, LMU München 14.06.2006 Die Warum 1 Die Der zweite Virialkoeffizient 2 Hard-Sphere-Potential Lennard-Jones-Potential 3 Warum 4 Bsp. Hard-Sphere-Potential Asakura-Oosawa-Potential
Selbstkonsistente Näherungen
 Selbstkonsistente Näherungen: Vektormesonen bei endlichen Temperaturen Hendrik van Hees Motivation Thermodynamik stark wechselwirkender Teilchensysteme Resonanzen, Teilchen mit Dämpfungsbreite in dichter
Selbstkonsistente Näherungen: Vektormesonen bei endlichen Temperaturen Hendrik van Hees Motivation Thermodynamik stark wechselwirkender Teilchensysteme Resonanzen, Teilchen mit Dämpfungsbreite in dichter
Um das zu verdeutlichen, seien noch einmal Wasserstoff-Wellenfunktionen gezeigt:
 II. 3 Schalenmodell der Elektronen Bei den wasserstoff-ähnlichen Alkali-Atomen und gerade beim He hatten wir schon kurz über den Einfluß des effektiven Potentials auf die energetische Lage der verschiedenen
II. 3 Schalenmodell der Elektronen Bei den wasserstoff-ähnlichen Alkali-Atomen und gerade beim He hatten wir schon kurz über den Einfluß des effektiven Potentials auf die energetische Lage der verschiedenen
FK Experimentalphysik 3, Lösung 4
 1 Sterne als schwarze Strahler FK Experimentalphysik 3, 4 1 Sterne als schwarze Strahler Betrachten sie folgende Sterne: 1. Einen roten Stern mit einer Oberflächentemperatur von 3000 K 2. einen gelben
1 Sterne als schwarze Strahler FK Experimentalphysik 3, 4 1 Sterne als schwarze Strahler Betrachten sie folgende Sterne: 1. Einen roten Stern mit einer Oberflächentemperatur von 3000 K 2. einen gelben
Computergrundlagen Computergestützte Physik
 Computergrundlagen Computergestützte Physik Maria Fyta Institut für Computerphysik Universität Stuttgart Wintersemester 2017/18 Computerphysik? Ein Werkzeug das komplexe Probleme der Physik numerisch lösen
Computergrundlagen Computergestützte Physik Maria Fyta Institut für Computerphysik Universität Stuttgart Wintersemester 2017/18 Computerphysik? Ein Werkzeug das komplexe Probleme der Physik numerisch lösen
1.6 Aufbau der Hadronen. In der Natur werden keine freien Quarks oder Gluonen beobachtet.
 1.6 Aufbau der Hadronen In der Natur werden keine freien Quarks oder Gluonen beobachtet. 1.6 Aufbau der Hadronen In der Natur werden keine freien Quarks oder Gluonen beobachtet. Beobachtbare stark wechselwirkende
1.6 Aufbau der Hadronen In der Natur werden keine freien Quarks oder Gluonen beobachtet. 1.6 Aufbau der Hadronen In der Natur werden keine freien Quarks oder Gluonen beobachtet. Beobachtbare stark wechselwirkende
0 Vorlesung Übersicht
 0 Vorlesung Übersicht Kernmodelle (Wiederholung Tröpfchenmodell) Fermigas-Modell Schalenmodell (Hyperkerne) 1.0 Wiederholung Hierarchie Atom Längenskala Anregungsenergie Kern, Elektron 3 Elektronenhülle
0 Vorlesung Übersicht Kernmodelle (Wiederholung Tröpfchenmodell) Fermigas-Modell Schalenmodell (Hyperkerne) 1.0 Wiederholung Hierarchie Atom Längenskala Anregungsenergie Kern, Elektron 3 Elektronenhülle
Kernradien 39. = ρ(r)dv. r 2. 0 r2 dr = 3 5 R2. (66)
 Kernradien 39 3 Kernradien 3.1 Vorbemerkung Viele experimentelle Befunde, die wir in den nächsten Kapiteln kennenlernen werden, sprechen dafür, dass der Kern eine definierte Oberfläche hat und damit auch
Kernradien 39 3 Kernradien 3.1 Vorbemerkung Viele experimentelle Befunde, die wir in den nächsten Kapiteln kennenlernen werden, sprechen dafür, dass der Kern eine definierte Oberfläche hat und damit auch
Wechselwirkung von Neutrinos und Kopplung an W und Z
 Wechselwirkung von Neutrinos und Kopplung an W und Z Bosonen Fakultät für Physik und Astronomie Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 16. Mai 2007 Agenda der Neutrinos 1 der Neutrinos 2 Erhaltungsgrößen
Wechselwirkung von Neutrinos und Kopplung an W und Z Bosonen Fakultät für Physik und Astronomie Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 16. Mai 2007 Agenda der Neutrinos 1 der Neutrinos 2 Erhaltungsgrößen
Renormierung und laufende Quarkmassen. Beziehung zur Quantenelektrodynamik
 6. Vorlesung 7. Die Protonmasse Die Energiedichte des QCD- Vakuums Hadron-Massen im statischen Quarkmodell Literatur: Perkins, Introduction to High Energy Physiscs Nukleon-Masse aus Gitter-Eichtheorie
6. Vorlesung 7. Die Protonmasse Die Energiedichte des QCD- Vakuums Hadron-Massen im statischen Quarkmodell Literatur: Perkins, Introduction to High Energy Physiscs Nukleon-Masse aus Gitter-Eichtheorie
Kosmische Strahlung auf der Erde
 Kosmische Strahlung auf der Erde Spektrum Zusammensetzung Messmethoden (direkt undindirekt indirekt) Magnetfelder Direkte Messungen der KS Detektortypen Geladene Teilchen Elektron-Loch Erzeugung Ionisation
Kosmische Strahlung auf der Erde Spektrum Zusammensetzung Messmethoden (direkt undindirekt indirekt) Magnetfelder Direkte Messungen der KS Detektortypen Geladene Teilchen Elektron-Loch Erzeugung Ionisation
Effektive Wechselwirkungen für Quantenflüssigkeiten und Quantengase
 Effektive Wechselwirkungen für Quantenflüssigkeiten und Quantengase Kernmaterie, flüssiges Helium und ultrakalte atomare Fermigase Vom Fachbereich Physik der Technischen Universität Darmstadt zur Erlangung
Effektive Wechselwirkungen für Quantenflüssigkeiten und Quantengase Kernmaterie, flüssiges Helium und ultrakalte atomare Fermigase Vom Fachbereich Physik der Technischen Universität Darmstadt zur Erlangung
6. Experimentelle Methoden
 Notizen zur Kern-Teilchenphysik II (SS 24): 6. Experimentelle Methoden Prof. Dr. R. Santo Dr. K. Reygers http://www.uni-muenster.de/physik/kp/lehre/kt2-ss4/ Kern- Teilchenphysik II - SS 24 1 Wechselwirkung
Notizen zur Kern-Teilchenphysik II (SS 24): 6. Experimentelle Methoden Prof. Dr. R. Santo Dr. K. Reygers http://www.uni-muenster.de/physik/kp/lehre/kt2-ss4/ Kern- Teilchenphysik II - SS 24 1 Wechselwirkung
Reaktionsrate, Energieproduktionsrate. ε = r Q/ρ
 nuclear reaction rates Reaktionsrate, Energieproduktionsrate Reaktionsrate r (Anzahl der Reaktionen pro Zeit- und Volumeneinheit) r 1 = NpNT σv 1 + δ pt σv = σ(v) v φ(v) dv Schlüsselgrössen N i = Dichte
nuclear reaction rates Reaktionsrate, Energieproduktionsrate Reaktionsrate r (Anzahl der Reaktionen pro Zeit- und Volumeneinheit) r 1 = NpNT σv 1 + δ pt σv = σ(v) v φ(v) dv Schlüsselgrössen N i = Dichte
Diskrete Symmetrien C, P, T
 Hauptseminar 2006 Symmetrien in Kern und Teilchenphysik Diskrete Symmetrien C, P, T Marcus Heinrich 03. Mai 2005 03. Mai 06 Marcus Heinrich 1 Gliederung Multiplikative Quantenzahlen Paritätsoperator P
Hauptseminar 2006 Symmetrien in Kern und Teilchenphysik Diskrete Symmetrien C, P, T Marcus Heinrich 03. Mai 2005 03. Mai 06 Marcus Heinrich 1 Gliederung Multiplikative Quantenzahlen Paritätsoperator P
Notizen zur Kern-Teilchenphysik II (SS 2004): 2. Erhaltungsgrößen. Prof. Dr. R. Santo Dr. K. Reygers
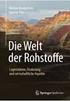 Notizen zur Kern-Teilchenphysik II (SS 4):. Erhaltungsgrößen Prof. Dr. R. Santo Dr. K. Reygers http://www.uni-muenster.de/physik/kp/lehre/kt-ss4/ Kern- Teilchenphysik II - SS 4 1 Parität (1) Paritätsoperator:
Notizen zur Kern-Teilchenphysik II (SS 4):. Erhaltungsgrößen Prof. Dr. R. Santo Dr. K. Reygers http://www.uni-muenster.de/physik/kp/lehre/kt-ss4/ Kern- Teilchenphysik II - SS 4 1 Parität (1) Paritätsoperator:
Von Farbladungen und Quarkteilchen: die Starke Wechselwirkung. Harald Appelshäuser Institut für Kernphysik JWG Universität Frankfurt
 Von Farbladungen und Quarkteilchen: die Starke Wechselwirkung Harald Appelshäuser Institut für Kernphysik JWG Universität Frankfurt Die vier Kräfte Gravitation Starke Kraft Schwache Kraft Elektromagnetismus
Von Farbladungen und Quarkteilchen: die Starke Wechselwirkung Harald Appelshäuser Institut für Kernphysik JWG Universität Frankfurt Die vier Kräfte Gravitation Starke Kraft Schwache Kraft Elektromagnetismus
Kern- und Teilchenphysik
 Schalenmodell Kern- und Teilchenphysik Schalenmodell Das Tröpfchenmodell ist ein phänemonologisches Modell mit beschränktem Anwendungsbereich. Es wird an die Experimente angepasst (z.b. die Konstanten
Schalenmodell Kern- und Teilchenphysik Schalenmodell Das Tröpfchenmodell ist ein phänemonologisches Modell mit beschränktem Anwendungsbereich. Es wird an die Experimente angepasst (z.b. die Konstanten
Experimentelle Grundlagen γ + N N + π
 Experimentelle Grundlagen γ + N N + π Thomas Schwindt 28. November 2007 1 Relativistische Kinematik Grundlagen Lorentz-Transformation Erzeugung und Zerfall von Teilchen 2 Das Experiment Kinematik Aufbau
Experimentelle Grundlagen γ + N N + π Thomas Schwindt 28. November 2007 1 Relativistische Kinematik Grundlagen Lorentz-Transformation Erzeugung und Zerfall von Teilchen 2 Das Experiment Kinematik Aufbau
Primordiale Nukleosynthese
 Hauptseminar: Dunkle Materie in Teilchen- und Astrophysik Primordiale Nukleosynthese Karin Haiser 14.06.2005 Inhalt Einführung Ablauf der Primordialen Nukleosynthese Definition wichtiger Größen Anfangsbedingungen
Hauptseminar: Dunkle Materie in Teilchen- und Astrophysik Primordiale Nukleosynthese Karin Haiser 14.06.2005 Inhalt Einführung Ablauf der Primordialen Nukleosynthese Definition wichtiger Größen Anfangsbedingungen
Experimentelle Elementarteilchenphysik
 Experimentelle Elementarteilchenphysik Hermann Kolanoski Humboldt-Universität zu Berlin Woraus besteht das Universum, wie ist es entstanden, wohin wird es sich entwickeln? Was ist Materie, was ist um uns
Experimentelle Elementarteilchenphysik Hermann Kolanoski Humboldt-Universität zu Berlin Woraus besteht das Universum, wie ist es entstanden, wohin wird es sich entwickeln? Was ist Materie, was ist um uns
E 3. Ergänzungen zu Kapitel 3
 E 3. Ergänzungen zu Kapitel 3 1 E 3.1 Kritisches Verhalten des van der Waals Gases 2 E 3.2 Kritisches Verhalten des Ising Spin-1/2 Modells 3 E 3.3 Theorie von Lee und Yang 4 E 3.4 Skalenhypothese nach
E 3. Ergänzungen zu Kapitel 3 1 E 3.1 Kritisches Verhalten des van der Waals Gases 2 E 3.2 Kritisches Verhalten des Ising Spin-1/2 Modells 3 E 3.3 Theorie von Lee und Yang 4 E 3.4 Skalenhypothese nach
Symmetrien und Erhaltungssätze
 Symmetrien und Erhaltungssätze Noether Theorem (1918): Symmetrien Erhaltungsgröße Transformation Erhaltungsgröße Kontinuierliche Transformationen: Raum Translation Zeit Translation Rotation Eichtransformation
Symmetrien und Erhaltungssätze Noether Theorem (1918): Symmetrien Erhaltungsgröße Transformation Erhaltungsgröße Kontinuierliche Transformationen: Raum Translation Zeit Translation Rotation Eichtransformation
Vom Ursprung der Masse
 Vom Ursprung der Masse Uwe-Jens Wiese Albert Einstein Center for Fundamental Physics Institut fu r Theoretische Physik, Universita t Bern Kolloquium fu r Mittelschullehrkra fte, 14. Oktober 2009 Vom Ursprung
Vom Ursprung der Masse Uwe-Jens Wiese Albert Einstein Center for Fundamental Physics Institut fu r Theoretische Physik, Universita t Bern Kolloquium fu r Mittelschullehrkra fte, 14. Oktober 2009 Vom Ursprung
Exotische Atome: Rosen aus dem Blumengarten der subatomaren Physik
 Exotische Atome: Rosen aus dem Blumengarten der subatomaren Physik Paul Kienle Stefan Meyer Institut/ÖAW und TU München EXA05 Paul Kienle 1 Übersicht Was sind (exotische) Atome Exotische Atome in der Hadronenphysik
Exotische Atome: Rosen aus dem Blumengarten der subatomaren Physik Paul Kienle Stefan Meyer Institut/ÖAW und TU München EXA05 Paul Kienle 1 Übersicht Was sind (exotische) Atome Exotische Atome in der Hadronenphysik
Historisches Präludium
 Historisches Präludium Sir saac Newton (1642-1727) "Now the smallest particles of matter may cohere by the strongest attractions, and compose bigger particles of weaker virtue... There are therefore agents
Historisches Präludium Sir saac Newton (1642-1727) "Now the smallest particles of matter may cohere by the strongest attractions, and compose bigger particles of weaker virtue... There are therefore agents
N.BORGHINI Version vom 20. November 2014, 21:56 Kernphysik
 II.4.4 b Kernspin und Parität angeregter Zustände Im Grundzustand besetzen die Nukleonen die niedrigsten Energieniveaus im Potentialtopf. Oberhalb liegen weitere Niveaus, auf welche die Nukleonen durch
II.4.4 b Kernspin und Parität angeregter Zustände Im Grundzustand besetzen die Nukleonen die niedrigsten Energieniveaus im Potentialtopf. Oberhalb liegen weitere Niveaus, auf welche die Nukleonen durch
Chern-Simons Theorie. Thomas Unden, Sabrina Kröner 01. Feb Theorie der kondensierten Materie. Fraktionaler Quanten-Hall-Effekt
 Chern-Simons Theorie Thomas Unden, Sabrina Kröner 01. Feb. 2012 Theorie der kondensierten Materie Fraktionaler Quanten-Hall-Effekt Seite 2 Chern-Simons Theorie Thomas Unden, Sabrina Kröner 01. Feb. 2012
Chern-Simons Theorie Thomas Unden, Sabrina Kröner 01. Feb. 2012 Theorie der kondensierten Materie Fraktionaler Quanten-Hall-Effekt Seite 2 Chern-Simons Theorie Thomas Unden, Sabrina Kröner 01. Feb. 2012
Standard Sonnenmodell
 Standard Sonnenmodell Max Camenzind Akademie HD - Juli 2016 Inhalt Sonnenmodell Die Sonne in Zahlen Aufbau der Sonne Die Sonne im Gleichgewicht Woher stammt die Energie? Nukleare Prozesse im Sonnenkern
Standard Sonnenmodell Max Camenzind Akademie HD - Juli 2016 Inhalt Sonnenmodell Die Sonne in Zahlen Aufbau der Sonne Die Sonne im Gleichgewicht Woher stammt die Energie? Nukleare Prozesse im Sonnenkern
Übersicht Halo Kerne
 Proton-Dripline Übersicht Halo Kerne Was kann man an der Neutronen-Dripline erwarten? Ψ () r e r κr κ = 2 2 µe 2 h Je kleiner die Bindungsenergie, je ausgedehnter die Wellenfunktion A = 10 µ = 1, 1m N
Proton-Dripline Übersicht Halo Kerne Was kann man an der Neutronen-Dripline erwarten? Ψ () r e r κr κ = 2 2 µe 2 h Je kleiner die Bindungsenergie, je ausgedehnter die Wellenfunktion A = 10 µ = 1, 1m N
Kernphysik I. Grundlegende Eigenschaften der Atomkerne: Bindungs-, Separationsenergie Massenmessungen Weizsäcker Massenformel
 Kernphysik I Grundlegende Eigenschaften der Atomkerne: Bindungs-, Separationsenergie Massenmessungen Weizsäcker Massenformel Massendefekt und Bindungsenergie Kerne sind die einzigen gebundenen Systeme,
Kernphysik I Grundlegende Eigenschaften der Atomkerne: Bindungs-, Separationsenergie Massenmessungen Weizsäcker Massenformel Massendefekt und Bindungsenergie Kerne sind die einzigen gebundenen Systeme,
Bloch Oszillationen. Klassisch chaotische Streuung. Klassisch chaotische Streuung
 Bloch Oszillationen periodische Oszillation keine systematische Dispersion Modell der gekippten Bänder: Zwei Zeitskalen: Bloch-Zeit Antriebsperiode Annahme: mit teilerfremden ganzen Zahlen Hamilton-Operator
Bloch Oszillationen periodische Oszillation keine systematische Dispersion Modell der gekippten Bänder: Zwei Zeitskalen: Bloch-Zeit Antriebsperiode Annahme: mit teilerfremden ganzen Zahlen Hamilton-Operator
Kosmische Neutrinos. Sommersemester Universität Siegen Claus Grupen. Kosmische Neutrinos p. 1/52
 Kosmische Neutrinos Sommersemester 2015 Universität Siegen Claus Grupen Kosmische Neutrinos p. 1/52 Neutrino Astronomie Solare Neutrinos (MeV-Bereich) Atmospherische Neutrinos (GeV-Bereich) Neutrino Oszillationen
Kosmische Neutrinos Sommersemester 2015 Universität Siegen Claus Grupen Kosmische Neutrinos p. 1/52 Neutrino Astronomie Solare Neutrinos (MeV-Bereich) Atmospherische Neutrinos (GeV-Bereich) Neutrino Oszillationen
Übungen zu Moderne Experimentalphysik III (Kerne und Teilchen)
 KIT-Fakultät für Physik Institut für Experimentelle Kernphysik Prof. Dr. Günter Quast Priv. Doz. Dr. Roger Wolf Dr. Pablo Goldenzweig Übungen zu Moderne Experimentalphysik III (Kerne und Teilchen) Sommersemester
KIT-Fakultät für Physik Institut für Experimentelle Kernphysik Prof. Dr. Günter Quast Priv. Doz. Dr. Roger Wolf Dr. Pablo Goldenzweig Übungen zu Moderne Experimentalphysik III (Kerne und Teilchen) Sommersemester
Lösung der zeitunabhängigen Schrödingergleichung. Ansatz : Entwicklung in Basisfunktionen - Prinzip analog zur Taylor- oder Fourierreihe
 Lösung der zeitunabhängigen Schrödingergleichung 2 ℏ 2 +V (r ) Erinnerung: H Ψ= E Ψ mit H = 2m Ansatz : Entwicklung in Basisfunktionen - Prinzip analog zur Taylor- oder Fourierreihe Potentialterm V(r)
Lösung der zeitunabhängigen Schrödingergleichung 2 ℏ 2 +V (r ) Erinnerung: H Ψ= E Ψ mit H = 2m Ansatz : Entwicklung in Basisfunktionen - Prinzip analog zur Taylor- oder Fourierreihe Potentialterm V(r)
3.7. Coulomb-Loch und FERMI-Loch Eigenschaften der Slater-Determinante: antisymmetrisches Produkt von Einelektronenfunktionen ( )" 2.
 3.7. Coulomb-Loch und FERMI-Loch Eigenschaften der Slater-Determinante: antisymmetrisches Produkt von Einelektronenfunktionen!( x 1,x ) = 1 ( ) " ( 1) ( ) " ( ) = 1 $ " 1 1 " 1 1 " 1 ( )" ( ) " 1 ( )"
3.7. Coulomb-Loch und FERMI-Loch Eigenschaften der Slater-Determinante: antisymmetrisches Produkt von Einelektronenfunktionen!( x 1,x ) = 1 ( ) " ( 1) ( ) " ( ) = 1 $ " 1 1 " 1 1 " 1 ( )" ( ) " 1 ( )"
Entdeckung der B - Oszillation mit ARGUS (1987)
 Entdeckung der - Oszillation mit ARGUS (1987) Überblick Kaonen -Mesonen Experimenteller Aufbau Messung Auswertung Ausblick Kaonenzerfall K = p K L q K S K = p K L q K S K L, K S Masseneigenzustände Zeitentwicklung
Entdeckung der - Oszillation mit ARGUS (1987) Überblick Kaonen -Mesonen Experimenteller Aufbau Messung Auswertung Ausblick Kaonenzerfall K = p K L q K S K = p K L q K S K L, K S Masseneigenzustände Zeitentwicklung
6.2 Kovalente Bindung + + r B. r AB. πε0. Ĥ Nicht separierbar. Einfachstes Molekül: Hamiltonoperator: Kinetische Energie. Potentielle Energie
 6. Kovalente indung Einfachstes Molekül: - r H + r + + r e Hamiltonoperator: Ĥ ħ ħ ħ = + m m Kern Kern e me Elektron Kinetische Energie + e 1 1 1 4 πε r r r Kern Kern e nziehung bstoßung Kern Kern e nziehung
6. Kovalente indung Einfachstes Molekül: - r H + r + + r e Hamiltonoperator: Ĥ ħ ħ ħ = + m m Kern Kern e me Elektron Kinetische Energie + e 1 1 1 4 πε r r r Kern Kern e nziehung bstoßung Kern Kern e nziehung
Vorlesung Kern- und Teilchenphysik WS12/ Dezember 2012
 Vorlesung Kern- und Teilchenphysik WS12/13 14. Dezember 2012 0 Vorlesung Übersicht Ergänzung: Herstellung von Antimaterie Kernmodelle Wiederholung: Tröpfchenmodell, Fermigas Hyperkerne Schalenmodell Angeregte
Vorlesung Kern- und Teilchenphysik WS12/13 14. Dezember 2012 0 Vorlesung Übersicht Ergänzung: Herstellung von Antimaterie Kernmodelle Wiederholung: Tröpfchenmodell, Fermigas Hyperkerne Schalenmodell Angeregte
41. Kerne. 34. Lektion. Kernzerfälle
 41. Kerne 34. Lektion Kernzerfälle Lernziel: Stabilität von Kernen ist an das Verhältnis von Protonen zu Neutronen geknüpft. Zu viele oder zu wenige Neutronen führen zum spontanen Zerfall. Begriffe Stabilität
41. Kerne 34. Lektion Kernzerfälle Lernziel: Stabilität von Kernen ist an das Verhältnis von Protonen zu Neutronen geknüpft. Zu viele oder zu wenige Neutronen führen zum spontanen Zerfall. Begriffe Stabilität
Stark wechselwirkende Materie: Quarks und Co.
 Stark wechselwirkende Materie: Quarks und Co. Christian S. Fischer TU Darmstadt 25. Januar 2007 Christian S. Fischer (TU Darmstadt) Quarks und Co. 25. Januar 2007 1 / 43 Überblick 1 Aspekte der Starken
Stark wechselwirkende Materie: Quarks und Co. Christian S. Fischer TU Darmstadt 25. Januar 2007 Christian S. Fischer (TU Darmstadt) Quarks und Co. 25. Januar 2007 1 / 43 Überblick 1 Aspekte der Starken
Padé-Resummierte Vielteilchen-Störungstheorie hoher Ordnung für doppeltmagische Kerne mit realistischen Potentialen
 Padé-Resummierte Vielteilchen-Störungstheorie hoher Ordnung für doppeltmagische Kerne mit realistischen Potentialen Bachelor-Thesis Joachim Langhammer September 2008 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1
Padé-Resummierte Vielteilchen-Störungstheorie hoher Ordnung für doppeltmagische Kerne mit realistischen Potentialen Bachelor-Thesis Joachim Langhammer September 2008 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1
VII. Starke Wechselwirkung (QCD)
 VII. Starke Wechselwirkung (QCD). Elemente der QCD (i) Quarks in 3 Farbzuständen: R, G, (ii) Farbige Gluonen (mit Farbladung) als Austauschteilchen R Es gibt 8 Gluonen mit Farbladung: R R R, RG, G, GR,
VII. Starke Wechselwirkung (QCD). Elemente der QCD (i) Quarks in 3 Farbzuständen: R, G, (ii) Farbige Gluonen (mit Farbladung) als Austauschteilchen R Es gibt 8 Gluonen mit Farbladung: R R R, RG, G, GR,
F-Theory und der Open String Landscape
 September 11, 2007 Institut für theoretische Physik, Universität Heidelberg 39. Herbstschule für Hochenergiephysik Maria Laach Typ IIB In diesem Vortrag geht es darum aus der String Theorie heraus Modelle
September 11, 2007 Institut für theoretische Physik, Universität Heidelberg 39. Herbstschule für Hochenergiephysik Maria Laach Typ IIB In diesem Vortrag geht es darum aus der String Theorie heraus Modelle
Einführung in die Elementarteilchenphysik. Michael Buballa. Wintersemester 2006/2007
 Einführung in die Elementarteilchenphysik Michael Buballa Wintersemester 2006/2007 Koordinaten Michael Buballa Institut für Kernphysik (S214) Raum 417 michael.buballa@physik.tu-darmstadt.de Vorlesungstermine
Einführung in die Elementarteilchenphysik Michael Buballa Wintersemester 2006/2007 Koordinaten Michael Buballa Institut für Kernphysik (S214) Raum 417 michael.buballa@physik.tu-darmstadt.de Vorlesungstermine
r 2 /R 2 eine sehr gute Näherung. Dabei hängen die Parameter wie folgt von Massen- und Ladungszahl ab.
 I.. Dichteverteilungen von Atomkernen I.. a Ladungsdichteverteilung Zur Beschreibung eines ausgedehnten elektrisch geladenen Bereichs, insbesondere eines Atomkerns, ist mehr als seine Gesamtladung Q erforderlich.
I.. Dichteverteilungen von Atomkernen I.. a Ladungsdichteverteilung Zur Beschreibung eines ausgedehnten elektrisch geladenen Bereichs, insbesondere eines Atomkerns, ist mehr als seine Gesamtladung Q erforderlich.
WAS FEHLT? STATISCHE KORRELATION UND VOLLE KONFIGURATIONSWECHSELWIRKUNG
 31 besetzen als die β Elektronen. Wenn man dies in der Variation der Wellenfunktion zulässt, also den Satz der Orbitale verdoppelt und α und β Orbitale gleichzeitig optimiert, so ist i. A. die Energie
31 besetzen als die β Elektronen. Wenn man dies in der Variation der Wellenfunktion zulässt, also den Satz der Orbitale verdoppelt und α und β Orbitale gleichzeitig optimiert, so ist i. A. die Energie
