Hensel/Cartellieri/Kupfernagel Memopharm
|
|
|
- Gabriel Stieber
- vor 3 Jahren
- Abrufe
Transkript
1
2 Hensel/Cartellieri/Kupfernagel Memopharm 1
3 2
4 Memopharm Pharmazeutisches Praxiswissen Von Andreas Hensel, Münster und Sabine Cartellieri, Münster Antje Kupfernagel, Hamburg 3., überarbeitete und erweiterte Auflage für die Kitteltasche Deutscher Apotheker Verlag Stuttgart 3
5 Anschriften der Autoren: Prof. Dr. Andreas Hensel Universität Münster Institut für Pharmazeutische Biologie und Phytochemie Hittorfstr Münster Sabine Cartellieri Borkenfeld Münster Antje Kupfernagel Grandkoppelsteig 5a Hamburg unter Mitarbeit von: Dr. A. Baumgärtel, Cottbus Dr. A. Dauer, Bad Aibling Dr. med. H.W. Gerharz, Freiburg Prof. Dr. H.J. Groß, Ulm Dr. med. M. Hensel, Marpingen Prof. Dr. K.-A. Kovar, Tübingen Dr. W. Probst, Heidenheim Dr. U. Stapel, Bönen Dr. D. Türck, Ulm J. Verspohl, Münster S. Wanderburg, Süsel Die in diesem Buch aufgeführten Angaben wurden sorgfältig geprüft. Dennoch können Autoren und Verlag keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen. Ein Markenzeichen kann warenrechtlich geschützt sein, auch wenn ein Hinweis auf etwa bestehende Schutzrechte fehlt. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter dnb.d-nb.de abrufbar. ISBN Auflage 2008 Jede Verwertung des Werkes außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, Nachdrucke, Mikroverfilmungen oder vergleichbare Verfahren sowie für die Speicherung in Anlagen zur Datenverarbeitung Deutscher Apotheker Verlag Birkenwaldstr. 44, Stuttgart Printed in Germany Satz: Dörr + Schiller GmbH, Stuttgart Druck und Bindung: Ludwig Auer, Donauwörth Umschlaggestaltung: Atelier Schäfer, Esslingen 4
6 Vorwort Das vorliegende Buch mittlerweile in der 3. Auflage entstand aus der Erfahrung der Arbeit in der öffentlichen Apotheke. Tagtäglich werden dort eine Vielzahl von speziellen Informationen, Daten und Fakten abverlangt, die häufig nur in speziellen Listen, Fachbüchern oder Firmeninfos zu finden sind. Die unerwartete Konsequenz ist, dass viele Apothekenmitarbeiter in einer Zeit der modernen Informationstechnologie immer noch häufig auf Zettelkästen, Notizbücher oder andere Merkhilfen zurückgreifen, um für Nachfragen nach nicht ganz alltäglichen Informationen gewappnet zu sein. Auch in der Zeit des Internets und der schnellen Datenbanksuche werden immer wieder Fragen nach der Verlässlichkeit dieser Medien gestellt. In sehr vielen Fällen kann das Internet zwar Antworten anreißen, die Seriosität und die Tiefe der Information ist aber immer im Einzelfall zu hinterfragen. Das vorliegende Memopharm ist ein handlicher Helfer, um häufige und weniger häufig gebrauchte Informationen in komprimierter und didaktisch aufbereiteter Form schnell und zielsicher zugänglich zu machen. Memopharm ist immer zur Hand (oder in der Kitteltasche), die Informationen werden aktuell gehalten und sollen schnell auffindbar sein. So hoffen alle, die an dieser Auflage mitgearbeitet haben, dass das Büchlein als effiziente Beratungshilfe in der Neuauflage wieder einen Platz im Apothekenalltag findet. Für die vorliegende Auflage wurden alle Kapitel durch Fachpersonen aus dem jeweiligen Gebiet überarbeitet und aktualisiert. Insbesondere im Bereich der Bewertung pflanzlicher Mittel als Bestandteile von Nahrungsergänzungmitteln, der ESCOP-Bewertung von Phytopharmaka, der Herstellung und Anwendung rekombinanter Proteine und Antikörper, der Regulation des Immunsystems und vieler anderer Themen wurden neue Inhalte in das Memopharm integriert. Folgenden Kolleginnen sei für die Mithilfe herzlich gedankt: Dr. U. Stapel (Rechtsgebiete), Frau J. Verspohl (Notfallmedizin). In der 2. Auflage wurden wichtige Teile durch Dr. A. Dauer (Phytotherapie), Dr. med. H. W. Gerharz (Therapie bei Kindern), Prof. H. J. Groß (Diagnostik), Prof. K.-A. Kovar (Ausgangsstoffe für Designerdrogen), Dr. W. Probst (Verbandsstoffe), Dr. D. Türck (Pharmakologische Grundlagen), S. Wanderburg 5
7 (Tierarzneimittel) beratend mitgestaltet. Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit! Wir wenden uns aber auch gern an alle Nutzer des Memopharms: Pharmazeutische Wissenschaft ist ständig im Fluss und jeden Tag kommen neue Anfragen aus allen möglichen (und unmöglichen) Gebieten an die Apothekenmitarbeiter. Für diesbezügliche Informationen zu aktuellen Trends, Nachfragen etc. sind wir für jeden Hinweis dankbar und freuen uns über entsprechende Mitteilungen aus der Leserschaft, um die Aktualität des Memopharms halten zu können. Eine kurze Mail an genügt. Beim Deutschen Apotheker Verlag, besonders bei Frau Dr. Iris Milek, möchten wir uns für die gute Zusammenarbeit bei der Entstehung dieses Buches bedanken. Andreas Hensel, Sabine Cartellieri, Antje Kupfernagel; Sommer
8 Inhalt 1 Pharmakologische Grundlagen/Therapie mit Arzneimitteln 9 2 Spezielle Nebenwirkungen von Arzneimitteln Infektionskrankheiten und Impfungen Reisemedizin Parasiten Demenzielle Erkrankungen Haut und Hauterkrankungen Sucht und Abhängigkeit Erkrankungen und Arzneimitteltherapie bei Kindern Arzneimitteltherapie bei Tieren 463 7
9 11 Phytotherapie Alternativmedizin Ernährung und Diätik Verbandstoffe Diagnostik Rezeptur und Eigenherstellung Gifte im Alltag Apothekenpraxis und spezielle Rechtsvorschriften 845 Sachregister 903 8
10 1 Pharmakologische Grundlagen/ Therapie mit Arzneimitteln Einteilung Evidenz-basierter Medizin Pharmakokinetik und Bioverfügbarkeit Pharmakokinetische Zielgrößen Weitere Kenngrößen Beurteilung von Bioverfügbarkeitsstudien Rezeptoren: Wirkungen und pharmakologische Beeinflussbarkeit Angiotensin-II-Rezeptoren Cannabinoid-Rezeptoren Dopamin-Rezeptoren Serotonin-Rezeptoren (5-HT-Rezeptoren) Glutamatrezeptoren γ-aminobuttersäure-rezeptoren (GABA-Rezeptoren) Leukotrien-Rezeptoren Rezeptoren des Gonadotropin-Releasing-Hormons (LHRH-Rezeptoren) Östrogen-Rezeptoren Endothelin-Rezeptoren Sympathische und parasympathische Rezeptoren Sympathisches und parasympathisches System Erregungsübertragung an der adrenergen Synapse α- und β-sympathomimetische Wirkungen am Zielorgan 43 9
11 1.4.3 Relative Selektivitäten von Agonisten und Antagonisten der Adrenorezeptoren Am Sympathikus angreifende Wirkstoffe Parasympathomimetische Wirkungen von Acetylcholin am Zielorgan Am Parasympathikus angreifende Wirkstoffe Psychopharmaka Psychopharmaka Klassifizierung, Wirkungen Neuroleptika Klassifizierung nach Wirkstärke und Nebenwirkungen Antidepressiva Klassifizierung, Wirkungen, Nebenwirkungen Benzodiazepine Parkinsonsche Krankheit Krankheitsbild Morbus Parkinson Therapieprinzipien der Parkinsonschen Krankheit Vor- und Nachteile Bluthochdruck Arterielle Hypertonie Medikamentöse Behandlung der Hypertonie Therapieresistente Hypertonie mögliche Ursachen Modifikationen des Standardbehandlungsschemas Calciumantagonisten Diuretika Angiotensin-II-Rezeptor-Antagonisten Schmerz und Analgetika Peripher wirkende Analgetika Pharmakokinetische Parameter wichtiger NSAR und COX- Hemmer Zentral wirkende Analgetika WHO-Schema zur medikamentösen Schmerztherapie Pharmakologische Grundlagen
12 1.8.5 Medikamentöse Tumorschmerztherapie (Erwachsene) Umgang mit opiathaltigen transdermalen Systemen Stadieneinteilung von malignen, soliden Tumoren (TNM-System) Kreuzschmerzen Migräne Arzneimittel bei Schilddrüsenerkrankungen Hormonelle Steuerung der Schilddrüsenfunktion Einteilung von Schilddrüsenerkrankungen nach Häufigkeit Iodbedarf und -aufnahme pro Tag Chronischer Iodmangel und Effekte auf die Schilddrüse Anwendung von Iodid in verschiedenen Konzentrationen Eigenschaften von L-Thyroxin und L-Triiodthyronin Therapie mit Schilddrüsenhormonen Asthma/Chronisch obstruktive Lungenerkrankung Asthma Krankheit und therapeutische Möglichkeiten Stufenplan zur Asthmatherapie bei Personen ab 14 Jahren Stufenplan zur Asthmatherapie bei Kindern bis 14 Jahren β 2 -Sympathomimetika: Wirkdauer und Wirkeintritt Analgetikainduziertes Asthma Anstrengungsinduziertes Asthma, Beratungshinweise Glucocorticoide Tagesdosen inhalativer Glucocorticoide Chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (COPD) Therapie mit Dosieraerosolen Asthmatherapie mit treibgasfreien Inhalatoren Beratung von Asthmapatienten Allergien und ihre Therapie Typen der Überempfindlichkeitsreaktionen Beratungshinweise bei Allergien Pollen- und Sporenflugkalender
13 Nicht rezeptpflichtige Arzneimittel bei Allergien Allergische Rhinokonjunktivitis Blut und Hämostase Zelluläre Bestandteile des Blutes Antikoagulantien Wechselwirkungen von oralen Antikoagulantien Therapiekontrolle Blutgerinnung Hausapotheke für orale Antikoagulantien-Patienten Magen-Darm-Mittel Pharmakotherapie des peptischen Ulcus Eradikationstherapie zur Eliminierung von Helicobacter pylori Chronische Obstipation im Alter Laxantien bei chronischer Obstipation Therapeutika bei entzündlichen Darmerkrankungen Therapie der Diarrhoe Mittel zur Beeinflussung der GI-Motilität (Prokinetika) Antazida Funktionelle Dyspepsie (FD) und Reizdarmsyndrom (RDS) Antibiotika und Chemotherapeutika Antibiotika Klassifizierung, Wirkungen und Nebenwirkungen Nebenwirkungsprofile von Antibiotika Antibakterielle Wirksamkeit von oralen Cephalosporinen gegenüber Lactamasebildnern Pharmakokinetik oraler Antibiotika Lipidsenker Cholesterol-Synthese-Enzym-Hemmer (CSE-Hemmer, HMG-CoA- Reduktase-Hemmer) Weitere Lipidsenker Pharmakologische Grundlagen
14 1.16 Diabetes mellitus und seine Therapie Diät bei Diabetes mellitus Medikamentöse Diabetestherapie Nebenwirkungen der Diabetestherapie Diabetische Polyneuropathie Insuline Gentechnisch modifizierte Insuline (Insulin-Muteine) Insulin-Injektionsgeräte (Pens) Inhalierbares Insulin (Exubera ) benötige Applikationsmengen Blutzuckermessgeräte (Auswahl) Verhütung und Empfängnis Orale Kontrazeptiva Dosierungsschemata Sicherheit gängiger Verhütungsmethoden Kontrazeption durch Bestimmung der fruchtbaren/unfruchtbaren Tage Hormontherapie im Klimakterium Reproduktionsstörungen Biologicals rekombinante Proteine Vereinfachte Darstellung der Herstellung rekombinanter Proteine Gentechnologisch hergestellte Proteine/Peptide Das Immunsystem: 10 Schritte zur Immunabwehr Enzymtherapie Lifestyle-Medikamente Charakterisierung von Lifestyle-Medikamenten
15 14 Pharmakologische Grundlagen
16 1.1 Einteilung Evidenz-basierter Medizin Evidenzklasse* Ia Ib IIa IIb III IV V Höchste Evidenz durch Meta-Analysen** über mehrere randomisierte, kontrollierte Studien Deutliche Evidenz auf Grund von mindestens einer randomisierten, kontrollierten Studie Gute Evidenz auf Grund von mindestens einer gut angelegten, jedoch nicht randomisierten und kontrollierten Studie, z.b. Kohortenstudie Evidenz auf Grund von mindestens einer gut angelegten, quasiexperimentellen Studie Mittlere Evidenz auf Grund gut angelegter, nicht-experimenteller, deskriptiver Studien (z.b. Fall-Kontroll-Studie) Geringe Evidenz auf Grund von Berichten der Experten-Ausschüsse oder Expertenmeinung bzw. klinischer Erfahrung anerkannter Autoritäten Fallbericht * Nach FDA 5/98 Guidance for Industry, WHO und Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR) 1994 ** Erstellung einer Vielzahl von Meta-Analysen zur Bewertung unterschiedlichster medizinisch-pharmazeutischer Fragestellungen durch Cochrane-Collaboration ( oder Center for Review and Dissemination CRD ( 1 Design von klinischen Studien Meta-Studie (Experimentelle Studie) Systematische Übersichtsarbeit: alle in Datenbanken publizierten randomisierten, kontrollierten Studien werde retrospektiv bewertet. Im Falle, dass sie die definierten Einschluss- und Qualitätskritertien der Meta-Studie erfüllen, werden die eingeschlossenen Substudien statistisch zusammengeführt, um eine einzige Aussage zu einem bestimmten Behandlungsmodus zu treffen. Höchster Evidenzgrad. Limitierung durch Verfügbarkeit einschließbarer Studienergebnisse. Einteilung Evidenz-basierter Medizin 15
17 Randomisierte, kontrollierte Doppelblindstudie (Experimentelle Studie) Randomisierte, kontrollierte Studie (Experimentelle Studie) Matched-pair Design Kohortenstudie (Beobachtungsstudie) Fall-Kontroll-Studie Outcome-Studien Sammelstatistik Fall-Kontroll-Studie (Beobachtungsstudie) Fallstudie, case-study (Beobachtungsstudie) Fallbeschreibung, casereport (Beobachtungsstudie) Cross-over-Design Parallele Behandlung Randomisierung durch zufällige Zuordnung der Placebo- und Verummedikation schließt zufällige und systematische Störfaktoren aus. Weder Patient noch Arzt wissen um die Zuordnung der jeweiligen Studiengruppe. Streng zufällige (randomisierte) Zuordnung der Probanden zu den Studiengruppen. Einem bestimmten Patienten mit definierter Personenund Krankheitscharakteristik der Verumgruppe wird eine in möglichst vielen Parametern vergleichbare Person der Kontrollgruppe zugeordnet. Einarbeitung in Doppelblind-Design möglich. Beobachtung einer Gruppe, die einem bestimmten Risikofaktor ausgesetzt war (retrospektive Kohortenstudie) oder ist (prospektive Kohortenstudie). Umgekehrt wie bei Kohortenstudie: Ausgangspunkt ist ein bereits bestehendes Ereignis, wobei versucht wird, dessen Ursache zu ergründen. Untersuchung, in welchem Zusammenhang Therapie und Therapieergebnisse (auch aus der Sicht des Patienten) stehen. Rein deskriptiv, keine Hypothesenprüfung möglich. Beispiel: OP-Dokumentationen, Komplikationsraten. Kranke werden mit Gesunden verglichen; Störfaktoren werden nicht ausgeschlossen. Patienten mit gleicher Behandlung Einzelfall-Dokumentation Dieselben Probanden werden aufeinanderfolgend in zwei oder mehreren Behandlungen geprüft (z.b. Verumund Placebobehandlung). Ausschaltung individueller Reaktions- und Responsemechanismen. Die Reihenfolge der Einzeltherapien wird randomisiert zugeordnet. Zum gleichen Zeitpunkt werden verschiedene Probanden unterschiedlich behandelt. 16 Pharmakologische Grundlagen
18 Interventionsstudie Prospektiv Multizentrisch Prüfung von Präventivmaßnahmen (z.b. Ernährungsumstellung, funktionelle Lebensmittel) auf Wirksamkeit. Meist randomisiert in Placebo- und Verumgruppen. Offen, blind oder doppelblind Datenerhebung beginnt bevor die interessierenden Ereignisse eingetreten sind ( retrospektiv). Beteiligung mehrerer unabhängiger Untersuchungskliniken, -praxen ( monozentrisch) 1 Studienformen in der zulassungsrelevanten Arzneimittelprüfung I II Phase Zielsetzung Kollektiv Größe Studiendesign III IV Humane Erstanwendung, Toxizität, Metabolismus, Bioverfügbarkeit Dosis-Wirkung, Dosisfindung Wirksamkeit unter klinisch kontrollierten Bedingungen Wirksamkeit und Nutzen unter Routinebedingungen; nach erfolgter Zulassung Gesunde, austherapierte Kranke Ausgewählte Patienten Patienten mit definierten Ein-, Ausschlusskriterien Repräsentative Patientenstichprobe Klein (< 50) Mittel (50 100) Groß ( ) Sehr groß (> 400) Interventionsstudie Interventionsstudie, meist einarmig Randomisiert, placebokontrolliert, multizentrisch Kohortenstudie, Anwendungsbeobachtung Klinische Studien mit zulassungsrelevanter Aussage müssen den Richtlinien der Good Clinical Practice der WHO (GCP) und ICH (International Conference of Harmonisation) entsprechen. Dies wird in einer guten Studie auch als solche angegeben. Die Beurteilung von Studien verlangt genaue Angaben zu den Einschlusskriterien (Anzahl, Geschlechtsverteilung, Alter und andere demographische Charakteristika) um einschätzen zu können, ob die Studienaussage verallgemeinert werden kann. Die Zuteilung zu den Prüf- Einteilung Evidenz-basierter Medizin 17
19 gruppen muss durch Randomisierung erfolgen. Eine exakte Beschreibung der therapeutischen Maßnahmen ist detailliert anzugeben, und zwar so genau, dass jeder Leser die Maßnahmen reproduzieren könnte. Das Vorhandensein anderer Krankheiten oder Störungen muss angegeben sein, da hierdurch die Therapieeffizienz beeinflusst werden kann. Gleiches gilt für Comedikationen. Das Ausmaß, indem die Studienteilnehmer den therapeutischen Vorgaben folgen, muss dokumentiert werden (Compliance). Die Prüfungen hierzu sind Bestandteil von GCP. Die Anzahl an Probanden, die nicht bis zum Studienende gelangen, ist anzugeben. Diese drop-outs müssen dokumentiert werden und die Gründe für die Ausfälle sind zu benennen. Die Gesamtmortalität ist anzugeben. Alle auftretenden unerwünschten Arzneimittelwirkungen (UAW) sind zu dokumentieren und dem Leser kenntlich zu machen. Alle Studienendpunkte sind anzugeben, also welche Parameter werden zu welchem Zeitpunkt gemessen und bestimmt. Bevorzugt werden objektive Messparameter (z. B. Blutwerte, Organfunktionen etc.). Allerdings sind auch Eigenbeurteilungen der Patienten sowie Arztbeurteilungen valide, sofern diese nach einem vorgegebenen, validen Schema abgeprüft werden. Solche Schemata und hier zugehörige Prüffragen sollten aber internationalen Konsensvereinbarungen entsprechen (z. B. Hamilton-Depressionsskala). 1.2 Pharmakokinetik und Bioverfügbarkeit Pharmakokinetische Zielgrößen Die Pharmakokinetik beschäftigt sich damit, wie der menschliche oder tierische Organismus Pharmaka behandelt. Man unterscheidet Liberation (aus der Arzneiform), die Re- oder Absorption (in der Regel aus dem Gastrointestinaltrakt), die Distribution in verschiedene Körperteile, den Metabolismus (meist hepatisch, aber auch gastrointestinal oder renal) und die Exkretion bzw. Ausscheidung (hepatisch durch Metabolismus, biliär, renal oder durch andere, seltenere Mechanismen). 18 Pharmakologische Grundlagen
20 Plasmakonzentrations-Zeit-Diagramm und wichtige Kenngrößen nach Einmalgabe C max 1 AUC (0 ) = AUC (0 t) + C t /λ z Konzentration C 80% 20% AUC PLATEAU Terminal Mono-exponentielle Elimination C t Analytische Nachweisgrenze t max t PLATEAU t t Zeit C max : C t : t max : t t : AUC (0-t) : AUC (0- ): λ z : CL/f Maximale Konzentration Letzte gemessene Konzentration Zeitpunkt des C max -Eintritts Zeitpunkt des letzten Messpunktes über der Nachweisgrenze Fläche unter der Konzentrations-Zeit-Kurve von Zeit t o bis zum letzten quantifizierbaren Zeitpunkt Fläche unter der Konzentrations-Zeit-Kurve von Zeit t o bis unendlich (extrapoliert mit C t /λ z, extrapolierter Anteil darf 20% nicht übersteigen) Terminale Eliminationskonstante Vollständige Clearance (Dosis/AUC (0- )) Weitere Kenngrößen Verteilungsvolumen Hierbei handelt es sich nicht um reale Volumina, in denen ein Arzneistoff gelöst ist, sondern um reine Rechengrößen, die in seltenen Fällen zufällig mit den Volumina bestimmter Körperkompartimente übereinstimmen. Übersteigt der Wert für ein Verteilungsvolumen 70 bis 80 L, so ist dies ein Hinweis auf die Lipophilie des Arzneistoffes. Pharmakokinetik und Bioverfügbarkeit 19
21 Bestimmte Verteilungsvolumina sind z.b.: V z/f : Verteilungsvolumen (nur) während der terminalen Eliminationsphase V ss : Verteilungsvolumen im steady state Solche Werte sind nur in seltenen Fällen bekannt oder lassen sich auf Grund von Erkrankungen nicht genauer bestimmen (z. B. Antirheumatika). Dort, wo die Konzentrationen bekannt sind, sind sie oft irreführend, da die Konzentration in bestimmten Zielkompartimenten wichtiger ist als die im Plasma. Bioverfügbarkeit Die Bioverfügbarkeit beschreibt Geschwindigkeit und Ausmaß, mit denen ein Arzneistoff im Plasma erscheint. Bioäquivalenz C max und AUC (oder deren Äquivalent) für zwei verschiedene, gegeneinander austauschbare Arzneiformen werden in einer ausreichend großen Studie mittels eines bestimmten Designs miteinander verglichen. Die Verhältnisse Test-/Referenz-Behandlung werden gebildet, die Verhältnisse logarithmiert und auf Normalverteilung getestet. Ist diese gegeben, so werden die Punktschätzer und die 90%-Konfidenzintervalle für beide Parameter (C max und AUC) errechnet. Bioäquivalenz darf nur dann angenommen werden, wenn beide 90%- Konfidenzintervalle (C max und AUC) für die zu testende Behandlung im Bereich von 0,80 1,25 um den jeweiligen Punktschätzer der Referenz-Behandlung liegen. Der Bereich ist unsymmetrisch, da die Test-Referenz-Verhältnisse logarithmiert werden müssen. Dies geschieht, da weder C max noch AUC normalverteilt, sehr oft aber log-normalverteilt sind. Für C max wird häufig noch ein Intervall von 0,70 1,43 um den Punktschätzer akzeptiert, da C max stärker schwanken kann als AUC. Es reicht nicht aus, dass der Mittelwert der Testbehandlung weniger als 20% von dem der Referenzbehandlung entfernt ist, oder dass die Behandlungen gemäß einem gepaarten t-test nicht signifikant unterschiedlich sind. 20 Pharmakologische Grundlagen
22 1.2.3 Beurteilung von Bioverfügbarkeitsstudien Studiendesign Ist eine Fallzahlschätzung anhand intraindividueller Variationskoeffizienten vorgenommen worden? Ist die Probandenzahl ausreichend (im Allgemeinen 12 und mehr)? Wurde das Probandenkollektiv homogen ausgewählt (Lebensalter 18 bis 55 Jahre, Brocaindex +/ 15%)? Erfolgte die Behandlung randomisiert? Wurde ein Cross-over-Design durchgeführt? (Paralellgruppenvergleiche sind für Stoffe mit sehr langer Halbwertszeit (viele Tage) akzeptabel, werden aber etwas anders ausgewertet.) Wurde die Studie gemäß den GCP-Richtlinien zur guten klinischen Praxis durchgeführt? 1 Studiendurchführung Erfolgte die Behandlung unter standardisierten Bedingungen (Nahrungsaufnahme, Flüssigkeitsaufnahme, Alkoholverbot, Aufnahmeverbot von Methylxanthinen)? War die Auswaschphase ausreichend lang (mindestens fünfmal die terminale Halbwertszeit)? Wurde in einem geeigneten Kompartiment gemessen (in der Regel Plasma, nur selten im Urin)? Wurde Messungen über einen genügend langen Zeitraum durchgeführt (> 3 Halbwertszeiten während der Elimination bei Einfachgabe; ein volles Dossierintervall bei Mehrfachgabe)? Sind die Absorptionsphase, eine eventuelle Plateauphase und die Eliminationsphase durch optimierte Datenpunktauswahl belegt (ca. 15 Messpunkte und mehr). Pharmakokinetik und Bioverfügbarkeit 21
23 Verwendete Analytik Ist die verwendete Messmethode selektiv? Ist die verwendete Messmethode ausreichend empfindlich? (1/20 der Spitzenkonzentration, mindestens aber 1/10 muss mit der Methode quantifizierbar sein). Ist die Methode validiert? (Variationskoeffizienten < 15% an allen Messpunkten). Auswertung Sind die C max und AUC-Werte für jeden Probanden und jede Behandlung angegeben? Sind (bei ausgeprägtem Konzentrationspeak) t max oder Äquivalente (bei Retardformen z.b. HVD (half value duration, Halbwertsdauer), t 75 %Cmax, bei Mehrfachgabe % PTF (peak-through-fluctuation)) angegeben? Diese dürfen nicht wesentlich voneinander abweichen! Liegen die Konfidenzintervalle für die Testbehandlung im Bereich von 0,80 1,25 um den Punktschätzer für die Referenzbehandlung? (Im Fall von C max ist in Deutschland auch 0,70 1,43 in der Regel noch akzeptiert.) Wenn die geometrischen Mittelwerte der Test-Referenz-Quotienten mehr als 10 15% von 1,0 (also vom Referenzergebnis) abweichen, ist in der Regel eine sehr große Probandenzahl notwendig, um noch Äquivalenz zu demonstrieren. 1.3 Rezeptoren: Wirkungen und pharmakologische Beeinflussbarkeit Angiotensin-II-Rezeptoren Prinzip des Renin-Angiotensin-Systems Das Renin-Angiotensin-System (RAS) dient zur Aufrechterhaltung des Wasser- und Elektrolythaushaltes sowie zur mittel- bis langfristigen Blutdruckregulation. Die Aktivierung wird durch ein vermindertes Blutvolumen, durch 22 Pharmakologische Grundlagen
24 Blutdruckabfall (z.b. bei Orthostase), aber auch durch Wasser- und Elektrolytverluste ausgelöst. Hierzu wird das in der Niere gebildete Renin ausgeschüttet, das als Protease aus dem Glykoprotein Angiotensinogen, das Dekapeptid Angiotensin I schneidet. Angiotensin I wird durch ein Angiotensin- Converting-Enzym (ACE) durch Abspaltung zu dem Oktapeptid Angiotensin II umgebaut. Angiotensin II kann prinzipiell mit zwei Rezeptoren, nämlich AT 1 - und AT 2 -Rezeptoren interagieren. Die physiologische Funktion der AT 2 - Rezeptoren ist noch weitgehend unklar (wahrscheinlich Zellproliferationseffekte). 1 Stimulation von AT 1 -Rezeptoren bewirkt Vasokonstriktion, Blutdrucksteigerung Sympathikusaktivierung, damit indirekte Blutdrucksteigerung Positiv inotrope Wirkung am Herzen, damit erhöhte Herzleistung Verminderte Wasser- und Elektrolytausscheidung durch die Niere (renaler Blutfluss, Aldosteron ). Blockade von AT 1 -Rezeptoren durch AT 1 -Rezeptor-Antagonisten bewirkt Blutdrucksenkung über ausbleibende Vasokonstriktion Blutdrucksenkung über eine verminderte Noradrenalinausschüttung und verringerte Sympathikusaktivität Indikationsgebiet der -sartane : essentielle Hypertonie. Wirksamkeit auch bei chronischer Herzinsuffizienz; zusätzliche nephroprotektive Effekte. Nebenwirkungen der AT 1 -Rezeptor Antagonisten Schwindel, Müdigkeit, Kopfschmerz, Übelkeit In der Regel aber gute Verträglichkeit. Rezeptoren: Wirkungen und pharmakologische Beeinflussbarkeit 23
25 Verfügbare AT 1 -Rezeptor-Antagonisten ( -sartane ) Wirkstoff Candesartan Dosierung 8 16 mg, 1 tgl. Eprosartan Teveten mg, 1 tgl. Irbesartan* Aprovel Karvea mg, 1 tgl. Losartan* Lorzaar mg, 1 2 tgl. Valsartan Diovan Provas mg, 1 tgl. Telmisartan Micardis mg, 1 tgl. Olmesartan (reiner AT 1 - Antagonist) Votum mg, 1 tgl. Handelsname Atacand Blopress Bioverfügbarkeit 42% 6 9 ca. 13% 5 9 ca. 70% ca. 30% 23% % 24 26% Halbwertszeit (Std.) 2 (aktiver Metabolit 6 9) * Wirkung auch über aktiven Metaboliten, zusätzlich nephroprotektiv bei hypertensiven Typ- 2-Diabetikern Vorteile der AT 1 -Rezeptor-Antagonisten gegenüber ACE-Hemmern Verbessertes Nebenwirkungsprofil, da kein Reizhusten Bessere Verträglichkeit, insbesondere bei älteren Patienten mit pulmonalen Erkrankungen Nur Antagonisierung der durch AT 1 -vermittelten Effekte, AT 2 -Wirkungen bleiben unbeeinflusst Nephroprotektive Effekte. Nebenwirkungen der -sartane Schwindel, Müdigkeit, Kopfschmerz, Übelkeit In der Regel aber gute Verträglichkeit. 24 Pharmakologische Grundlagen
26 1.3.2 Cannabinoid-Rezeptoren Das Endocannabinoidsystem ist ein regulatorisches physiologisches Netzwerk mit Wirkungen auf ZNS, Immunsystem und Apoptose. Zwei Cannabinoid-Rezeptoren (CB1-R, CB2-R) aus der Klasse der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren, die verschiedene Ionenkanäle modulieren, sind bisher bekannt. CB1-R findet sich bevorzugt auf Neuronen, im Kleinhirn, in Ganglien, im Hippocampus und im Darm. Dieser Rezeptortyp dient der Bewältigung von Lern- und Bewegungsprozessen und scheint auch im Bereich des Löschens von negativen Erinnerungen essentiell zu sein. Deswegen scheinen die körpereigenen Liganden eine wichtige Rolle bei Angststörungen zu haben. CB2-R ist häufig auf Immunzellen lokalisiert und an Zellen, die am Auf- und Abbau des Knochensystems beteiligt sind. Das Endocannabinoidsystem moduliert im ZNS die neuronale Übertragung, Gedächtnisleistung, Apetittregulation, Nahrungsaufnahme, aber auch in der Peripherie Schmerz, Gefäßtonus, Augeninnendruck und Immunfunktion. Diese Effekte werden teilweise auch bei der Applikation von Tetrahydrocannabinol (Dronabinol, Marinol ) aus Cannabis deutlich, das appetittanregend, antiemetisch, muskelrelaxierend und analgetisch mit Senkung des Augeninnendruckes wirkt. Endogene Liganden: zwei Arachidonsäurederivate, nämlich Anandamid und Arachidonoylglycerol. Diese entstehen physiologischerweise aus Omega-6-Fettsäuren. Exogene Liganden: Cannabinoide mit der Leitsubstanz Tetrahydrocannabinol (THC) aus Cannabis sativa (Marihuana, Hasch). Rimonabant zur Raucher- und Ethanolentwöhnung und zur Behandlung der Adipositas Dopamin-Rezeptoren Für Dopamin als zentral und peripher wirkenden Transmitter sind bisher 5 unterschiedliche Rezeptoren (D 1 bis D 5 ) bekannt, die auf Grund der beiden unterschiedlichen Arten der Signalweiterleitung zwei Hauptgruppen zugeordnet werden ( D 1 -like -Gruppe mit D 1 - und D 5 -Rezeptoren stimulieren eine nachgeschaltete Adenylatcyclase, während die D 2 -like -Gruppe mit den D 2 -, D 3 - und D 4 -Rezeptoren hemmend auf eine Adenylatcyclase wirkt). Rezeptoren: Wirkungen und pharmakologische Beeinflussbarkeit 25
27 Wirkungen von Dopamin im ZNS und am peripheren Zielorgan Zielorgan Dopamin- Dopaminerge Wirkung Rezeptor Niere D 1 -like Vasodilatation mit gesteigerter Durchblutung und Harnmenge; Hemmung der Na + -Rückresorption Herz D 4 Unbekannt Sympathikus D 2 -like Hemmung der Noradrenalinfreisetzung D 1 -like Stimulation der Noradrenalinfreisetzung Nebennierenrinde D 2 Hemmung der Aldosteronsekretion ZNS D 1 Überwiegend lokalisiert im Mittelhirn (Schaltzentrale für Motorik, Sehen, Hören) mit Akkumulation im Striatum (Schaltstelle für motorische Reaktionen) Stimulation u.a. verantwortlich für das motorische Geschehen und Bewegungsabläufe D 2 Überwiegend lokalisiert im Mittelhirn (Schaltzentrale für Motorik, Sehen, Hören) mit Akkumulation im Striatum (Schaltstelle für motorische Reaktionen) Stimulation im Zusammenwirken mit D 1 - Rezeptoren, u.a. verantwortlich für das motorische Geschehen und Bewegungsabläufe Auch angereichert am Hypophysenvorderlappen Stimulation bewirkt eine verminderte Ausschüttung von Prolactin Auch in der Area postrema des Hirnstamms zur Aktivierung des Brechzentrums D 3 Überwiegend lokalisiert im Zwischenhirn mit Akkumulation im limbischen System (zuständig für emotionale Reaktionen, zur Verarbeitung von Erlebnissen, Gedächtnisspeicher) Stimulation bewirkt u.a. korrekte Verarbeitung emotionaler Reaktionen D 4 Im frontalen Cortex, Hippocampus (zuständig für Denkprozesse, Emotionen, Entscheidungsfindung) D 5 Im Hippocampus? 26 Pharmakologische Grundlagen
28 Durch dopaminerge/antidopaminerge Wirkstoffe beeinflussbare Krankheitsbilder Morbus Parkinson, da hierbei Degeneration dopaminerger Neurone in der Substantia nigra sowie Verarmung des Striatums an Dopamin Einsatz von D 1 - und D 2 -Agonisten (s ) Psychotische Zustände, insbesondere Schizophrenien, da hierbei wahrscheinlich eine Überaktivität dopaminerger Neurone im limbischen System vorliegt Einsatz von D 2 -Antagonisten (vermindern produktive Symptome der Schizophrenie, führen aber auch zu extrapyramidal-motorischen Störungen) (s ) Prolactin-bedingte Fertilitätsstörungen, prämenstruelles Syndrom (in der Regel durch erhöhte Prolactinspiegel bedingt), Abstillphase, Mastitis, Galactorrhoe Einsatz von D 2 -Agonisten, die an hypophysären D 2 -Rezeptoren die Sekretion von Prolactin vermindern/unterbinden Erbrechen und Nausea Einsatz von D 2 -Antagonisten durch Blockade im Brechzentrum. 1 An Dopamin-Rezeptoren angreifende Wirkstoffe (Auswahl) Rezeptor Wirkstoff Anwendung bei Bemerkungen D 1 -Agonisten Levodopa Morbus Parkinson Nur in Kombination mit Decarboxylase-Hemmern D 1,2 -Antagonisten D 2 -Agonisten Olanzapin (Zyprexa ) Pergolid (Parkotil ) Lisurid (Dopergin ) Carbergolin (Cabaseril ) Bromocriptin (Pravidel ) Schizophrene Psychosen Morbus Parkinson Morbus Parkinson Auch 5-HT 2 -, M 1 -, M 2 - und H 1 -Antagonist Auch D 1 -Agonist Auch Prolactin-Hemmer Morbus Parkinson Auch 5-HT 1 -, 5-HT 2 -, D 1 -Agonist Morbus Parkinson Auch partieller D 1 -Agonist und Prolactin-Hemmer Rezeptoren: Wirkungen und pharmakologische Beeinflussbarkeit 27
29 Rezeptor Wirkstoff Anwendung bei Bemerkungen D 2 -Agonisten Morbus Parkinson D 2 -Antagonisten (s ) D 3 -Antagonisten D 4 -Antagonisten Pramipexol (Sifrol ) Phytopharmaka Quinagolid (Norprolac ) Apomorphin (Xense ) Agnus-castus- Extrakte (Mastodynon, Agnucaston ) Phenothiazine Thioxantene Butyrophenone Risperidon (Risperdal ) Sertindol (Serdolect ) Metoclopramid (Paspertin ) Amisulprid (Solian ) Clozapin (Leponex ) Hyperprolactinämie und Folgen Erektiler Dysfunktion Prämenstruelles Syndrom, Menstruationsstörungen Schizophrene Psychosen Schizophrene Psychosen Schizophrene Psychosen Schizophrene Psychosen Schizophrenie Bei Erbrechen und GI-Motilitätsstörungen Schizophrene Psychosen Schizophrene Psychosen Auch D 3 -Agonist. NW: Nausea, Halluzinationen, Verwirrtheit Zentraler D 2 -Angriff im Hypothalamus Auch bei prolactinbedingter Infertilität verwendbar Geringe D 1,5 -, hohe D 2,3 - Affinität Hohe D 1,2 -Affinität Hohe D 2 -Affinität Hohe D 2 -Affinität, auch 5-HT 2A -, α 1 -, α 2 -, H 1 - Antagonismus Wirkung auch über Acetylcholin-Freisetzung via HT 3 Auch D 2 -Antagonismus Hohe D 4 -Affinität, weniger zu D 2 keine extrapyramidal-motorischen NW Auch 5-HT 2A Antagonismus 28 Pharmakologische Grundlagen
30 Rezeptor Wirkstoff Anwendung bei Bemerkungen Dopamin- Wieder- aufnahme- Hemmer Venlafaxin (Trevilor ) Cocain Depressive Erkrankungen Suchtmittel Auch Noradrenalin- Wiederaufnahme- Hemmer Serotonin-Rezeptoren (5-HT-Rezeptoren) Es existieren sowohl im ZNS als auch in der Peripherie eine Vielzahl verschiedener Rezeptoren, für die Serotonin (syn. 5-Hydroxytryptamin, 5-HT) als endogener Ligand fungiert. Diese Rezeptoren gehören verschiedenen Rezeptorfamilien an (5-HT 1 bis 5-HT 7 ), wobei sich die HT 1 - und HT 2 -Familie nach der Substratspezifität wiederum in verschiedene Subtypen unterteilen lassen. Die durch Stimulation oder Blockade der Rezeptoren erzielbaren, extrem vielschichtigen und komplexen pharmakologischen Wirkungen hängen zum einen vom jeweiligen Rezeptortyp, aber auch von der Lokalisation, sowie der Umschaltung der ausgelösten serotonergen Impulse auf andere Transmittersysteme (z.b. noradrenerge Systeme) ab. Klassifikation der pharmazeutisch relevanten 5-HT-Rezeptoren 5-HT 5-HT 1 5-HT 2 5-HT 3 5-HT 4 5-HT HT 1A 5-HT 1B 5-HT 1D 5-HT 2A 5-HT 2B 5-HT 2C Wirkmechanismen der 5-HT-Rezeptoren (Faustregeln) Stimulation von 5-HT 1 5-HT 2 Bewirkt in der Regel Hemmende Effekte Beispiele: Vasodilatation, Hemmung der Noradrenalinfreisetzung, Hemmung der zentralen 5-HT-Freisetzung, Anxiolyse durch Hemmung von 5-HT-Neuronen Exzitatorische Effekte Beispiel: Vasokonstriktion der Skelettmuskulatur (aber Ausnahme: Kontraktion der Gefäße der Herzkranzgefäße) Rezeptoren: Wirkungen und pharmakologische Beeinflussbarkeit 29
31 Stimulation von 5-HT 3 5-HT 4 Bewirkt in der Regel Exzitatorische Effekte über eine Verstärkung der Ausschüttung anderer Transmitter Beispiele: Auslösung von Nausea, Erbrechen, Schlaf-Wach- Rhythmus, Stimmungslage Stimulation der Acetylcholinfreisetzung und damit verbundener parasympathischer Sekundäreffekte (s ) Beispiel: Erhöhung der Darmmotilität Wirkungen von 5-HT im ZNS und am peripheren Zielorgan Zielorgan 5-HT-Rezeptor Serotonerge Wirkung Herz 5-HT 3 Bradykardie, auch Erhöhung des Auswurfvolumens; durch 5-HT-induzierte Noradrenalinfreisetzung, später Gegenreaktion und positiv inotrope und positiv chronotrope Effekte 5-HT 1B 5-HT 1B in den Koronararterien Vasokonstriktion 5-HT 4 Tachyarrhythmien Kreislauf 5-HT 2A Vasokonstriktion initiale Blutdrucksteigerung 5-HT 1A Vasodilatation über indirekte NO-Freisetzung anhaltende Blutdrucksenkung 5-HT 3 Vasodilatation Blutdrucksenkung (initial, kurze Dauer) Magen, Darm 5-HT 2, 3, 4 Erhöhte Motilität und Kontraktion Blutplättchen 5-HT 2A Verstärkte Thrombozytenaggregation Mastzellen 5-HT 3 Depolarisierung Schmerz, Juckreiz ZNS 5-HT 1A Anxiolyse durch Hemmung serotonerger Neurone in den Raphekernen des Hirnstamms 5-HT 1B Hemmung der 5-HT-Freisetzung (Rückkopplung) Inhibierung neurogener Entzündungen Zentrale Vasokonstriktion 30 Pharmakologische Grundlagen
32 Zielorgan 5-HT-Rezeptor Serotonerge Wirkung 5-HT 1D 5-HT 2 5-HT 3 Zentrale Vasokonstriktion Hemmung der Freisetzung anderer Transmitter und Neuropeptide, die an lokalen Entzündungs- und Schmerzreaktionen an der Hirnhäuten beteiligt sind Stimmungslage (Stimmungsaufhellung, Anxiolyse), Affektionen, Appetithemmung Übelkeit, Erbrechen (5-HT 3 überwiegend im Brechzentrum lokalisiert) 1 An 5-HT-Rezeptoren angreifende Wirkstoffe Rezeptor Wirkstoff Anwendung als Bemerkungen 5-HT 1A - Agonisten Buspiron (Bespar ) Anxiolytikum Auch neuroleptische Eigenschaften, Wirkungseintritt langsamer als bei Benzodiazepinen 5-HT 1 B/D - Agonisten Spezifische Endung: -triptan 5-HT 2 - Agonisten 5-HT 2 - Antagonisten Urapidil (Ebrantil ) Sumatriptan (Imigran ) Naratriptan (Naramig ) Antihypertensivum Auch sympathischer α 1 -Antagonismus Migränemittel (s.a ) Migränemittel (s.a ) Trazodon (Thombran ) Antidepressivum Rizatriptan Migränemittel (s.a ) (Maxalt ) Eletriptan (Relpax ) Migränemittel (s.a ) Ziprasidon Schizophrenie Auch 5-HT 1 -Agonist EG-Zulassung beantragt Psychomotorischdämpfend; zusätzlich auch 5-HT-Wiederaufnahme-Hemmer Rezeptoren: Wirkungen und pharmakologische Beeinflussbarkeit 31
33 Rezeptor Wirkstoff Anwendung als Bemerkungen 5-HT 2 - Antagonisten 5-HT 3 - Antagonisten Spezifische Endung: -setron 5-HT 4 - Agonisten Methysergid (Deseril ) Cyproheptadin (Peritol ) Pizotifen (Sandomigran ) Mirtazapin (Remergil ) Nefazodon (Nefadar ) Granisetron (Kevatril ) Ondansetron (Zofran ) Tropisetron (Navoban ) Metoclopramid (Paspertin ) Cisaprid (Propulsin ) Tegaserod (Zelmac ) Migräneprophylaxe zur Appetitsteigerung, Antihistaminikum 5-HT 2C -Antagonist; NW: Erbrechen, pektangiöse Beschwerden, Parästhesien Auch H 1 -Antihistaminikum Intervallbehandlung Migräne; zur Appetitsteigerung Antidepressivum Antidepressivum Antiemetikum Antiemetikum Antiemetikum Antiemetikum Prokinetikum Bei Reizdarmsyndrom 5-HT 2C -Antagonist; auch antihistaminische Eigenschaften NW: Gewichtszunahme, Sedation Begleitend zur Strahlen-, Chemotherapie Begleitend zur Strahlen-, Chemotherapie Begleitend zur Strahlen-, Chemotherapie Nur in hohen Dosen 5-HT 3 -Antagonismus; überwiegend Dopamin- Blockade Zur beschleunigten Magen-Darm-Entleerung bei GI-Störungen; NW = starke Arrhythmien 32 Pharmakologische Grundlagen
34 Rezeptor Wirkstoff Anwendung als Bemerkungen Antidepressivum 5-HT-Wieder- aufnahme- Hemmer (SSRI) Allgemeine NW: Übelkeit, Erbrechen, manische Reaktionen, Schlaflosigkeit, Kopfschmerz Fluoxetin (Fluctin ) Fluvoxamin (Fevarin ) Paroxetin (Tagonis ) Trazodon (Thombran ) Citalopram (Cipramil ) Sertralin (Gladem ) Antidepressivum Antidepressivum Antidepressivum Antidepressivum bei Panikstörungen Antidepressivum Psychomotorisch aktivierend Psychomotorisch aktivierend Psychomotorisch aktivierend Psychomotorisch dämpfend, da auch 5-HT 2 - Antagonist Glutamatrezeptoren Der im ZNS für die Impulsweitergabe und -verarbeitung wichtigste Transmitter ist die Aminosäure Glutamat. Die überragende Stellung dieses Transmitters wird durch die im Vergleich zu Dopamin etwa 1000fach höhere Konzentration und die ubiquitäre Lokalisation der Rezeptoren im ZNS deutlich. Glutamin und mit geringerer Wichtigkeit auch Asparaginsäure sind die typischen zentral erregenden Botenstoffe mit überragender Bedeutung für Lernvorgänge, kognitive Prozesse und schnelle Impulssignale. Vom Glutamatrezeptor sind vier Unterfamilien bekannt, die sich strukturell und funktionell unterscheiden. Die Differenzierung erfolgt durch unterschiedliche Ansprechbarkeit mit exogenen Agonisten. Lediglich zwei dieser vier Subtypen, nämlich NMDA- und AMPA-Rezeptoren, können momentan medikamentös beeinflusst werden. AMPA-Rezeptor: Abgrenzung von den anderen Glutamat-Rezeptoren durch die Stimulierbarkeit mit Amino-Hydroxy-Methyl-Isoxazol-Propionsäure. Lokalisation auf der postsynaptischen Membran und Aktivierung durch Glutamat im synaptischen Spalt. Aktivierung öffnet den Ionenkanal, wobei Rezeptoren: Wirkungen und pharmakologische Beeinflussbarkeit 33
35 Na + aus dem Spalt in das Zellinnere und im Austausch hiermit K + in den synaptischen Spalt transportiert werden (Na/K-Kanal). Es kommt zur Depolarisation und Reizweiterleitung. Durch die AMPA-Rezeptoren der Glutamat- Axone werden im ZNS die schnellen, erregenden postsynaptischen Potentiale (EPSP) ausgelöst. AMPA- Antagonist Wirkstoff Anwendung bei Epilepsie Bemerkungen Topiramat (Topamax ) Auch GABA-Aktivator NW: Schwindel, Müdigkeit, Ataxie NMDA-Rezeptor: Abgrenzung durch die Stimulierbarkeit mit N-Methyl-D- Aspartat. Wie AMPA ein Na/K-Ionenkanal (auch durchlässig für Ca 2+ ), der aber im Ruhezustand durch Mg 2+ -Ionen im Kanalrohr verschlossen ist. Nur wenn die umgebende Membran leicht gereizt (= depolarisiert) wird (z.b. durch AMPA-Rezeptoren), verlässt der Pfropfen Mg 2+ den Kanal und der Rezeptor ist aktivierbar. Sinn: Filterfunktion; nicht jeder Reiz wird weitergeleitet. Wichtig für kognitive Vorgänge und Lernprozesse. Auch Anpassung schneller Reize an die Anforderungen anderer glutamerger Nerven: intelligente Reizleitung und -verarbeitung. Pathophysiologie: Bei Überstimulation durch Glutamat (z. B. zerebraler Ischämie, Hypoglykämie) kann der Rezeptor leicht geschädigt werden eventuell Erklärung der zerebralen Ausfälle bei Schlaganfall etc. NMDA- Antagonist Wirkstoff Anwendung bei Hirnleistungsstörungen, als zentrales Muskelrelaxans Bemerkungen Memantin (Akatinol ) Nicht-kompetitiver Antagonist, der im Inneren des Kanals bindet und nur die Überstimulation unterbindet; auch Hemmstoff der Glutamat- Freisetzung neuroprotektiv 34 Pharmakologische Grundlagen
36 NMDA- Antagonist Wirkstoff Acamprosat (Campral ) Anwendung bei Alkoholabhängigkeit, Unterstützung der Abstinenz Bemerkungen Auch GABA-Agonismus Bei Alkoholismus Überexprimierung und gesteigerte Sensibilität von NMDA-Rezeptoren; Entzug Überstimulationseffekte durch Glutamat 1 Riluzol (Rilutek ) Amyotrophe Lateralsklerose Auch Hemmung der Glutamatausschüttung Ketamin (Ketanest ) Injektionsanästhetikum Felbamat (Taloxa ) Antiepileptikum Auch GABA-Agonist γ-aminobuttersäure-rezeptoren (GABA-Rezeptoren) Den wichtigsten Transmitter im ZNS, der für inhibitorische Prozesse verantwortlich ist, stellt die GABA dar, die an speziellen GABA-Rezeptoren angreift, wodurch Erregungs- und Reizzustände abgemildert werden und es zu Entkopplungserscheinungen kommt. Prinzipiell bewirkt Reizung der GABA- Rezeptoren Lähmung, Sedierung und Ruhigstellung (z.b. durch den psychotropen Stoff Muscimol aus Fliegenpilz), während Hemmung dieses Rezeptors oder eine Verminderung der Konzentration von GABA eine verstärkte Erregung bis hin zur Krampftätigkeit bedeutet (z. B. durch Tetanustoxin oder das Krampfgift Picrotoxin). Am GABA-Rezeptor angreifende Wirkstoffe Prinzip der Beeinflussung Wirkstoff/ Wirkstoffklasse Anwendung Bemerkungen GABA- Agonisten Acamprosat (Campral ) Unterstützung Alkoholentzug Auch NMDA-Antagonist (s ) Gabapentin (Neurontin ) Epilepsie Erhöhung der GABA-Konzentration durch ungeklärten Mechanismus Rezeptoren: Wirkungen und pharmakologische Beeinflussbarkeit 35
37 Prinzip der Beeinflussung Wirkstoff/ Wirkstoffklasse Anwendung Bemerkungen Valproinsäure (Ergenyl ) Epilepsie Hemmung GABA-abbauender Enzyme GABA- Wirkungsverstärker Benzodiazepine (s ) Als Tranquillantien, Anxiolytika und Antikonvulsiva Bindung an eine Nicht- GABA-Bindungsstelle der α-einheit ( Benzodiazepin- Rezeptor ), wodurch die Empfindlichkeit gegenüber GABA erhöht wird Zopiclon (Ximovan ) Als Schlafmittel Selektive Bindung an die α-untereinheit des GABA- Rezeptors; klassische Benzodiazepine binden an dieser Einheit nur unspezifisch Zolpidem (Bikalm ) Als Schlafmittel Abhängigkeitsprofil im Vergleich zu Benzodiazepinen wird kontrovers beurteilt Topiramat (Topamax ) Bei Epilepsie Auch AMPA-Antagonist (s ) Barbiturate Als Hypnotika und Antikonvulsiva Bindung an eine Nicht- GABA-Bindungsstelle der β-einheit ( Barbiturat-Rezeptor ), wodurch die Empfindlichkeit gegenüber GABA erhöht wird GABA-Wieder- aufnahme- Hemmer Tiagabin (Gabitril ) Epilepsie Hemmstoff GABA-abbauender Enzyme Vigabatrin (Sabril ) Epilepsie 36 Pharmakologische Grundlagen
38 1.3.7 Leukotrien-Rezeptoren Leukotriene werden aus Arachidonsäure durch die 5-Lipoxygenase biosynthetisiert. Hierbei entsteht im Rahmen einer Synthesekaskade zuerst das labile Epoxid Leukotrien A 4 (LTA 4 ), das durch Kopplung an Glutathion zu Leukotrien C 4 (LTC 4 ) umgebaut wird bzw. durch Wasseranlagerung zu Leukotrien B 4 (LTB 4 ) wird. Durch Abspaltung von Glutaminsäure aus LTC 4 entsteht LTD 4, das zu LTE 4 weiterreagieren kann. 1 Wichtige Wirkungen von Leukotrienen LTA 4 LTB 4 LTC 4, LTD 4, LTE 4 Keine Wirkung bekannt Chemotaxis Ödembildung durch Plasmaexsudation Adhäsion von Leukozyten am Endothel Stimulation der Interferonproduktion Starke Bronchokonstriktion, Konstriktion der Koronarien, Steigerung der Mucussekretion in den Atemwegen (Nach: Oderdisse E., Hackenthal E., Kuschinsky K. (1997): Pharmakologie und Toxikologie, Springer Verlag, 509) Leukotrienrezeptor-Antagonisten ( -lukaste ) Wirkstoff Handelsname Nebenwirkung Bemerkung Montelukast Singulair Kopfschmerz, Fieber Zafirlukast Bisher nur in USA, UK Einsatz bei Asthma, zusätzlich deutliche Senkung der benötigten Steroiddosen. Leukotrienrezeptor-Antagonisten gegenüber LTC 4 -,D 4 -,A 4 - Rezeptoren bewirken Erweiterung der Bronchien Verminderung der Sekretproduktion Indikationsgebiet der -lukaste : Asthma bronchiale, auch zur Senkung des Steroidbedarfs. Nicht zur Anfallsbehandlung geeignet. Rezeptoren: Wirkungen und pharmakologische Beeinflussbarkeit 37
39 1.3.8 Rezeptoren des Gonadotropin-Releasing-Hormons (LHRH-Rezeptoren) Das periphere endokrine System wird im Sinne eines vernetzten Kopplungs- Rückkopplungsmechanismus durch das ZNS reguliert. Als oberster Signalgeber fungieren Nervenzellen des Hypothalamus, die im Falle der Regulation der Sexualhormone das sogenannte Gonadotropin-Releasing-Hormon GnRH (syn. Gonadoliberin, LHRH) freisetzen, das an spezifische LHRH-Rezeptoren des Hypophysenvorderlappens bindet und dort die Ausschüttung des Follikelstimulierenden Hormons FSH und des Luteinisierenden Hormons LH bewirkt. FSH ist für die Reifung der weiblichen Follikel zuständig, während LH den Eisprung und beim Mann die Testosteronproduktion bewirkt. Gonadoliberin (Lutrelef ) wird aus diesem Grund bei Fertilitätsstörungen durch i.v.-gabe zur Auslösung der Ovulation eingesetzt (s ). GnRH-(syn. LHRH)-Agonisten ( -reline ) bewirken Primär eine Stimulation der FSH- und LH-Ausschüttung Sekundär bei längerer Gabe eine vollständige Down-Regulation der hypophysären LHRH-Rezeptoren, womit die Bildung von FSH, LH und damit sekundär verbunden auch die Plasmakonzentration der Sexualhormone auf Kastrationsniveau sinkt. Indikationsgebiet der -reline Kurzzeitgabe zur Ovulationsauslösung Langzeitgabe im Rahmen der In-vitro-Fertilisation (s ) Langzeitbehandlung zur palliativen Therapie sexualhormonabhängiger Prostata- und Mammakarzinome Langzeitbehandlung des Uterusmyoms und der Endometriose NW: Hitzewallungen, Schmierblutungen, Stimmungsschwankungen, Libidoverlust, Ödeme, Seborrhoe. 38 Pharmakologische Grundlagen
40 Wirkstoff Handelsname Bemerkung Gonadoliberin Lutrelef Nur kurzfristig i.v. zur Ovulationsauslösung Buserelin Goserelin Leuprorelin Nafarelin Triptorelin Suprefact, Suprecur Zoladex Carcinil, Enantone Synarela Decapeptyl Durch verzögerte metabolische Inaktivierung wirken die synthetischen LHRH-Agonisten stärker und länger als natives GnRH Applikation s.c. oder nasal 1 GnRH (syn. LHRH)-Antagonisten bewirken Dosisabhängige, reversible Inhibition der Ausschüttung der Sexualhormone bis auf Kastrationsniveau. Vorteil gegenüber LHRH-Agonisten: keine Primärstimulation, sondern sofortige Blockade (s ). Wirkstoff Handelsname Bemerkung Cetrorelix Cetrotide Begleitend zur In-vitro-Fertilisation zur Vermeidung eines vorzeitigen Eisprungs Abarelix Plenaxis Prostatakarzinom Östrogen-Rezeptoren Es existieren 2 Subtypen (α- und β-östrogenrezeptor, ER) mit unterschiedlicher Organverteilung. ER-α überwiegend in Brustdrüse, Uterus, Hypophyse, Hypothalamus mit proliferationsfördernden Effekten (endogener Agonist Östrogen). ER-β-Form in Knochen, Gefäßen, Prostata, Hippocampus mit teilweise antiproliferativen Effekten (endogener Agonist 5α-Androstan- 3β-17β-diol). In Ovarien sind beide Typen gleichermaßen verteilt. ER-α und ER-β stehen in direktem Wechselspiel miteinander. Der durch ER-α ausgelöste zelluläre Proliferationsdruck auf hormonabhängige Zellen wird durch ER-β gemildert. ER-β kontrolliert ER-α. Rezeptoren: Wirkungen und pharmakologische Beeinflussbarkeit 39
41 Vorkommen überwiegend Vorkommen etwa zu gleichen Anteilen Induzierte Wirkungen ER-α Leber, Gebärmutter Mammae, Ovarien, Gehirn Vermittelte Zellzellproliferative Effekte ER-β Knochen, Darmwand, Prostata, Gefäßwand Mammae, Ovarien, Gehirn Antientzündlich, antiproliferativ; vermittelt Zelldifferenzierung Agonist Östrogene Endogen: Androstandiol, syn. β-adiol (Metabolit aus Testosteron) Endogen: DHEA (Dehydrorepiandrosteron) Exogen: Isoflavone (z.b. Genistein, Daidzein aus Soja); Trioxyfen Antagonist DHEA (Dehydrorepiandrosteron) Pharmakologische Wirkungen von ER-β-Agonisten: antiproliferative Effekte ( Prostatakarzinom), antimetastatische Effekte ( Prostatakarzinom), antiinflammatorisch ( Endometriose), kardioprotektiv, anxiolytisch, antidepressiv. Östrogen bindet mit höherer Affinität an ER-α. In Phasen stark erhöhter Östrogenbildung (Schwangerschaft, Pubertät) kann Östrogen auch ER-β agonisieren, was eine Hemmung von ER-α induziert. In den Wechseljahren wird bei sinkender Östrogenkonzentration eher ER-α aktiviert, während die antiproliferative Wirkung von ER-β auch durch die sinkenden Androstandiolspiegel abnimmt. Somit kann es zu einer gestörten Rezeptorbalance kommen. Synthetische Östrogene beeinflussen überwiegend den ER-β. Isoflavone zeigen eine 10- bis 100fach höhere Affinität zum ER-β als zum ER-α. Da Hepatozyten keine ER-β-Rezeptoren besitzen, kann dies eine Erklärung sein, warum Isoflavon im Gegensatz zu exogenem Östrogen die Serumlipide nicht verändert und kein erhöhtes Risiko für Thrombosen darstellt. 40 Pharmakologische Grundlagen
neurologische Grundlagen Version 1.3
 neurologische Grundlagen Version 1.3 ÜBERBLICK: Neurone, Synapsen, Neurotransmitter Neurologische Grundlagen Zentrale Vegetatives Peripheres Überblick: Steuersystem des menschlichen Körpers ZNS Gehirn
neurologische Grundlagen Version 1.3 ÜBERBLICK: Neurone, Synapsen, Neurotransmitter Neurologische Grundlagen Zentrale Vegetatives Peripheres Überblick: Steuersystem des menschlichen Körpers ZNS Gehirn
Stichwortliste Pharmakologie M10 ab SS 2007
 Stichwortliste Pharmakologie M10 ab SS 2007 Allgemeine Pharmakologie Rezeptorvermittelte und nicht-rezeptorvermittelte Pharmakawirkungen Kinetik der Pharmakon-Rezeptor-Interaktion Agonisten und Antagonisten
Stichwortliste Pharmakologie M10 ab SS 2007 Allgemeine Pharmakologie Rezeptorvermittelte und nicht-rezeptorvermittelte Pharmakawirkungen Kinetik der Pharmakon-Rezeptor-Interaktion Agonisten und Antagonisten
neurologische Grundlagen Version 1.3
 neurologische Version 1.3 ÜBERBLICK: Überblick: Steuersystem des menschlichen Körpers ZNS Gehirn Rückenmark PNS VNS Hirnnerven Sympathicus Spinalnerven Parasympathicus 1 ÜBERBLICK: Neurone = Nervenzellen
neurologische Version 1.3 ÜBERBLICK: Überblick: Steuersystem des menschlichen Körpers ZNS Gehirn Rückenmark PNS VNS Hirnnerven Sympathicus Spinalnerven Parasympathicus 1 ÜBERBLICK: Neurone = Nervenzellen
Inhaltsverzeichnis. Teil A Medizinische Grundlagen 9
 Inhaltsverzeichnis Teil A Medizinische Grundlagen 9 1 Einleitung 10 1.1 Lernziele 10 1.2 Einführung in die Pharmakologie 10 1.3 Geschichte der Pharmakologie 10 Übungsfragen 12 2 Arzneimittel und Informationsquellen
Inhaltsverzeichnis Teil A Medizinische Grundlagen 9 1 Einleitung 10 1.1 Lernziele 10 1.2 Einführung in die Pharmakologie 10 1.3 Geschichte der Pharmakologie 10 Übungsfragen 12 2 Arzneimittel und Informationsquellen
Psychopharmaka. Physiologische, pharmakologische und pharmakokinetische Grundlagen für ihre klinische Anwendung. Herausgegeben von Werner P.
 Psychopharmaka Physiologische, pharmakologische und pharmakokinetische Grundlagen für ihre klinische Anwendung Herausgegeben von Werner P. Koella Mit Beiträgen von E. Eichenberger, P.L. Herrling, U. Klotz,
Psychopharmaka Physiologische, pharmakologische und pharmakokinetische Grundlagen für ihre klinische Anwendung Herausgegeben von Werner P. Koella Mit Beiträgen von E. Eichenberger, P.L. Herrling, U. Klotz,
Weitere Nicht-Opioid-Analgetika
 Analgetika II apl. Prof. Dr. med. A. Lupp Institut für Pharmakologie und Toxikologie Universitätsklinikum Jena Drackendorfer Str. 1, 07747 Jena Tel.: (9)325678 oder -88 e-mail: Amelie.Lupp@med.uni-jena.de
Analgetika II apl. Prof. Dr. med. A. Lupp Institut für Pharmakologie und Toxikologie Universitätsklinikum Jena Drackendorfer Str. 1, 07747 Jena Tel.: (9)325678 oder -88 e-mail: Amelie.Lupp@med.uni-jena.de
Psychopharmaka - Definition
 Psychopharmaka - Definition Medikamente, die auf das zentrale Nervensystem wirken und Gefühle, Denken und Verhalten verändern Wirkung durch Einfluss auf die Aktivität von Nervenzellen und Wirkung auf die
Psychopharmaka - Definition Medikamente, die auf das zentrale Nervensystem wirken und Gefühle, Denken und Verhalten verändern Wirkung durch Einfluss auf die Aktivität von Nervenzellen und Wirkung auf die
Überblick über die Psychopharmakologie
 Klinische Psychologie I WS 06/07 Überblick über die Psychopharmakologie 19.12.2006 Prof. Dr. Renate de Jong-Meyer Grundlegendes zu Psychopharmaka Existenz verschiedener n von Psychopharmaka mit unterschiedlichen
Klinische Psychologie I WS 06/07 Überblick über die Psychopharmakologie 19.12.2006 Prof. Dr. Renate de Jong-Meyer Grundlegendes zu Psychopharmaka Existenz verschiedener n von Psychopharmaka mit unterschiedlichen
Glutamat und Neurotoxizitaet. Narcisse Mokuba WS 18/19
 Glutamat und Neurotoxizitaet Narcisse Mokuba WS 18/19 Gliederung 1.Teil : Glutamat als Botenstoff ; Synthese Glutamat-Rezeptoren : Aufbau & Funktion Signaluebertragung 2.Teil : Bedeutung als Gescmacksverstaerker
Glutamat und Neurotoxizitaet Narcisse Mokuba WS 18/19 Gliederung 1.Teil : Glutamat als Botenstoff ; Synthese Glutamat-Rezeptoren : Aufbau & Funktion Signaluebertragung 2.Teil : Bedeutung als Gescmacksverstaerker
Inhaltsverzeichnis. 1. Abschnitt: Arzneimittel, Pharmakon, Gift, Pharmakologie und Toxikologie
 10 1. Abschnitt: Arzneimittel, Pharmakon, Gift, Pharmakologie und Toxikologie 1. Grundbegriffe... 15 2. Abschnitt: Pharmakokinetik 2. Membranpassage von Stoffen... 17 3. Resorption und Bioverfügbarkeit...
10 1. Abschnitt: Arzneimittel, Pharmakon, Gift, Pharmakologie und Toxikologie 1. Grundbegriffe... 15 2. Abschnitt: Pharmakokinetik 2. Membranpassage von Stoffen... 17 3. Resorption und Bioverfügbarkeit...
Block 2. Medikamentenkunde Teil 1. Übersicht Block 2. Psychopharmaka. Anxioly7ka Hypno7ka. An7depressiva. Phasenprophylak7ka. An7demen7va.
 Block 2 Medikamentenkunde Teil 1 Übersicht Block 2 F2: Schizophrenie Anamnese & Diagnostik mit Fallbeispielen F6: Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen Medikamentenkunde I Neurologische Grundlagen Prüfungssimulation
Block 2 Medikamentenkunde Teil 1 Übersicht Block 2 F2: Schizophrenie Anamnese & Diagnostik mit Fallbeispielen F6: Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen Medikamentenkunde I Neurologische Grundlagen Prüfungssimulation
Transmitterstoff erforderlich. und Tremor. Potenziale bewirken die Erregungsübertragung zwischen den Nervenzellen. Begriffen
 4 Kapitel 2 Nervensystem 2 Nervensystem Neurophysiologische Grundlagen 2.1 Bitte ergänzen Sie den folgenden Text mit den unten aufgeführten Begriffen Das Nervensystem besteht aus 2 Komponenten, dem und
4 Kapitel 2 Nervensystem 2 Nervensystem Neurophysiologische Grundlagen 2.1 Bitte ergänzen Sie den folgenden Text mit den unten aufgeführten Begriffen Das Nervensystem besteht aus 2 Komponenten, dem und
Therapeutisches Drug Monitoring bei Antiepileptika
 Therapeutisches Drug Monitoring bei Antiepileptika Prof. Dr. med. Gerd Mikus Abteilung Innere Medizin VI Klinische Pharmakologie und Pharmakoepidemiologie Universitätsklinikum Heidelberg gerd.mikus@med.uni-heidelberg.de
Therapeutisches Drug Monitoring bei Antiepileptika Prof. Dr. med. Gerd Mikus Abteilung Innere Medizin VI Klinische Pharmakologie und Pharmakoepidemiologie Universitätsklinikum Heidelberg gerd.mikus@med.uni-heidelberg.de
Drogen und Psychopharmaka
 Robert M. Julien Drogen und Psychopharmaka Aus dem Englischen übersetzt von Therese Apweiler und Stefan Härtung Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg Berlin Oxford Inhalt Vorwort zur deutschen Ausgabe
Robert M. Julien Drogen und Psychopharmaka Aus dem Englischen übersetzt von Therese Apweiler und Stefan Härtung Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg Berlin Oxford Inhalt Vorwort zur deutschen Ausgabe
Inhaltsverzeichnis. Teil A Grundlagen der Arzneimittelkunde 7
 Inhaltsverzeichnis Teil A Grundlagen der Arzneimittelkunde 7 1 Einführung in die Arzneimittelkunde 8 1.1 Lernziele 8 1.2 Einleitung 8 1.3 Heutige Entwicklung eines neuen Medikaments 8 1.4 Grundlagen 13
Inhaltsverzeichnis Teil A Grundlagen der Arzneimittelkunde 7 1 Einführung in die Arzneimittelkunde 8 1.1 Lernziele 8 1.2 Einleitung 8 1.3 Heutige Entwicklung eines neuen Medikaments 8 1.4 Grundlagen 13
TDM= therapeutisches Drug Monitoring
 1 2 3 4 TDM= therapeutisches Drug Monitoring 5 KVT= kognitive Verhaltenstherapie Empfehlungsgrad in Klammern angegeben A Soll -Empfehlung B Sollte Empfehlung 0 Kann -Empfehlung KKP Klinischer Konsenspunkt,
1 2 3 4 TDM= therapeutisches Drug Monitoring 5 KVT= kognitive Verhaltenstherapie Empfehlungsgrad in Klammern angegeben A Soll -Empfehlung B Sollte Empfehlung 0 Kann -Empfehlung KKP Klinischer Konsenspunkt,
Erregungsübertragung an Synapsen. 1. Einleitung. 2. Schnelle synaptische Erregung. Biopsychologie WiSe Erregungsübertragung an Synapsen
 Erregungsübertragung an Synapsen 1. Einleitung 2. Schnelle synaptische Übertragung 3. Schnelle synaptische Hemmung chemische 4. Desaktivierung der synaptischen Übertragung Synapsen 5. Rezeptoren 6. Langsame
Erregungsübertragung an Synapsen 1. Einleitung 2. Schnelle synaptische Übertragung 3. Schnelle synaptische Hemmung chemische 4. Desaktivierung der synaptischen Übertragung Synapsen 5. Rezeptoren 6. Langsame
Kompendium der medikamentösen Schmerztherapie
 Kompendium der medikamentösen Schmerztherapie Eckhard Beubler Kompendium der medikamentösen Schmerztherapie Wirkungen, Nebenwirkungen und Kombinationsmöglichkeiten 6. Auflage Unter Mitarbeit von Roland
Kompendium der medikamentösen Schmerztherapie Eckhard Beubler Kompendium der medikamentösen Schmerztherapie Wirkungen, Nebenwirkungen und Kombinationsmöglichkeiten 6. Auflage Unter Mitarbeit von Roland
Anhang III. Änderungen der entsprechenden Abschnitte der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels und der Packungsbeilagen
 Anhang III Änderungen der entsprechenden Abschnitte der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels und der Packungsbeilagen Anmerkung: Diese Änderungen der entsprechenden Abschnitte der Zusammenfassung
Anhang III Änderungen der entsprechenden Abschnitte der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels und der Packungsbeilagen Anmerkung: Diese Änderungen der entsprechenden Abschnitte der Zusammenfassung
Cannabidiol. Sachverständigen-Ausschuss für Verschreibungspflicht Sachverständigen-Ausschuss für Verschreibungspflicht
 Cannabidiol Sachverständigen-Ausschuss für Verschreibungspflicht 19.01.2016 Sachverständigen-Ausschuss für Verschreibungspflicht 19.01.2016 Seite 1 Hintergrund Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker
Cannabidiol Sachverständigen-Ausschuss für Verschreibungspflicht 19.01.2016 Sachverständigen-Ausschuss für Verschreibungspflicht 19.01.2016 Seite 1 Hintergrund Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker
Psychopharmakotherapie griffbereit
 griffbereit Psychopharmakotherapie griffbereit Medikamente, psychoaktive Genussmittel und Drogen - griffbereit Bearbeitet von Jan Dreher 1. 2014. Taschenbuch. 248 S. Paperback ISBN 978 3 7945 3078 6 Format
griffbereit Psychopharmakotherapie griffbereit Medikamente, psychoaktive Genussmittel und Drogen - griffbereit Bearbeitet von Jan Dreher 1. 2014. Taschenbuch. 248 S. Paperback ISBN 978 3 7945 3078 6 Format
Neuronale Grundlagen bei ADHD. (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) Mechanismen der Ritalinwirkung. Dr. Lutz Erik Koch
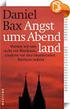 Neuronale Grundlagen bei ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) Mechanismen der Ritalinwirkung Dr. Lutz Erik Koch Die Verschreibung von Ritalin bleibt kontrovers Jeden Tag bekommen Millionen von
Neuronale Grundlagen bei ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) Mechanismen der Ritalinwirkung Dr. Lutz Erik Koch Die Verschreibung von Ritalin bleibt kontrovers Jeden Tag bekommen Millionen von
Zusammenfassung in deutscher Sprache
 Zusammenfassung in deutscher Sprache Zusammenfassung Man schätzt, dass in den Niederlanden einer von 200 Erwachsenen (=60.000) eine verborgene Nierenschädigung hat. Ungefähr 40.000 Menschen sind bekennt
Zusammenfassung in deutscher Sprache Zusammenfassung Man schätzt, dass in den Niederlanden einer von 200 Erwachsenen (=60.000) eine verborgene Nierenschädigung hat. Ungefähr 40.000 Menschen sind bekennt
Nicht selektive β- Sympatholytika
 Nicht selektive β- Sympatholytika Nicht selektive β-sympatholytika (β-blocker) blockieren sowohl β 1 - als auch β 2 - Rezeptoren. Therapeutisch erwünscht ist aber bei den meisten Indikationen die β 1 -Blockade.
Nicht selektive β- Sympatholytika Nicht selektive β-sympatholytika (β-blocker) blockieren sowohl β 1 - als auch β 2 - Rezeptoren. Therapeutisch erwünscht ist aber bei den meisten Indikationen die β 1 -Blockade.
M. Gerlach C. Mehler-Wex S. Walitza A. Warnke C. Wewetzer Hrsg. Neuro-/ Psychopharmaka im Kindesund Jugendalter. Grundlagen und Therapie 3.
 M. Gerlach C. Mehler-Wex S. Walitza A. Warnke C. Wewetzer Hrsg. Neuro-/ Psychopharmaka im Kindesund Jugendalter Grundlagen und Therapie 3. Auflage Neuro-/Psychopharmaka im Kindes- und Jugendalter Manfred
M. Gerlach C. Mehler-Wex S. Walitza A. Warnke C. Wewetzer Hrsg. Neuro-/ Psychopharmaka im Kindesund Jugendalter Grundlagen und Therapie 3. Auflage Neuro-/Psychopharmaka im Kindes- und Jugendalter Manfred
Das Wichtigste: 3 Grundlagen der Erregungs- und Neurophysiologie. - Erregungsausbreitung -
 Das Wichtigste Das Wichtigste: 3 Grundlagen der Erregungs- und Neurophysiologie - Erregungsausbreitung - Das Wichtigste: 3.4 Erregungsleitung 3.4 Erregungsleitung Elektrotonus Die Erregungsausbreitung
Das Wichtigste Das Wichtigste: 3 Grundlagen der Erregungs- und Neurophysiologie - Erregungsausbreitung - Das Wichtigste: 3.4 Erregungsleitung 3.4 Erregungsleitung Elektrotonus Die Erregungsausbreitung
Wiederholung: Dendriten
 Wiederholung: Dendriten Neurone erhalten am Dendriten und am Zellkörper viele erregende und hemmende Eingangssignale (Spannungsänderungen) Die Signale werden über Dendrit und Zellkörper elektrisch weitergeleitet.
Wiederholung: Dendriten Neurone erhalten am Dendriten und am Zellkörper viele erregende und hemmende Eingangssignale (Spannungsänderungen) Die Signale werden über Dendrit und Zellkörper elektrisch weitergeleitet.
Analgetika in der Geriatrie ein Überblick. Mag. pharm. Michaela Mandl ahph
 Analgetika in der Geriatrie ein Überblick Mag. pharm. Michaela Mandl ahph m.mandl@salk.at Warum sind die Analgetika eine so wichtige Arzneimittelgruppe? 25-26% der älteren Menschen klagen über chronische
Analgetika in der Geriatrie ein Überblick Mag. pharm. Michaela Mandl ahph m.mandl@salk.at Warum sind die Analgetika eine so wichtige Arzneimittelgruppe? 25-26% der älteren Menschen klagen über chronische
Ligandengesteuerte Ionenkanäle
 Das Gehirn SS 2010 Ligandengesteuerte Ionenkanäle Ligandengesteuerte Kanäle Ligand-gated ion channels LGIC Ionotrope Rezeptoren Neurotransmission Liganden Acetylcholin Glutamat GABA Glycin ATP; camp; cgmp;
Das Gehirn SS 2010 Ligandengesteuerte Ionenkanäle Ligandengesteuerte Kanäle Ligand-gated ion channels LGIC Ionotrope Rezeptoren Neurotransmission Liganden Acetylcholin Glutamat GABA Glycin ATP; camp; cgmp;
Kompendium der Psychiatrischen Pharmakotherapie
 O. Benkert H. Hippius Kompendium der Psychiatrischen Pharmakotherapie Unter Mitarbeit von I. Anghelescu E. Davids G. Gründer Ch. Lange-Asschenfeldt A. Szegedi H. Wetzel Mit 45 Tabellen Springer Inhaltsverzeichnis
O. Benkert H. Hippius Kompendium der Psychiatrischen Pharmakotherapie Unter Mitarbeit von I. Anghelescu E. Davids G. Gründer Ch. Lange-Asschenfeldt A. Szegedi H. Wetzel Mit 45 Tabellen Springer Inhaltsverzeichnis
Forschungswerkstatt Herz Kreislauf 2007 Neue Daten zu Aspirin. Von Prof. Dr. Stefanie M. Bode Böger
 Forschungswerkstatt Herz Kreislauf 2007 Neue Daten zu Aspirin Von Prof. Dr. Stefanie M. Bode Böger Köln (15. März 2007) - Das akute Koronarsyndrom (AKS) ist durch Angina pectoris Beschwerden und Ischämie-typische
Forschungswerkstatt Herz Kreislauf 2007 Neue Daten zu Aspirin Von Prof. Dr. Stefanie M. Bode Böger Köln (15. März 2007) - Das akute Koronarsyndrom (AKS) ist durch Angina pectoris Beschwerden und Ischämie-typische
Neue medikamentöse Behandlungsstrategien
 Klinik und Poliklinik für Psychiatrie Psychosomatik und Psychotherapie der Universität am Bezirksklinikum /-missbrauch/ Neue medikamentöse Behandlungsstrategien Norbert Wodarz Medikamentöse Behandlung
Klinik und Poliklinik für Psychiatrie Psychosomatik und Psychotherapie der Universität am Bezirksklinikum /-missbrauch/ Neue medikamentöse Behandlungsstrategien Norbert Wodarz Medikamentöse Behandlung
Hinneburg Interaktionen
 Hinneburg Interaktionen Reihe PTAheute Buch Müller-Bohn Betriebswirtschaft für die Apotheke, 2009 PTAheute Redaktion Schwangerschaft und Apotheke, 2011 Weber Rezepte für die Beratung, 2009 Rall Ernährungsberatung
Hinneburg Interaktionen Reihe PTAheute Buch Müller-Bohn Betriebswirtschaft für die Apotheke, 2009 PTAheute Redaktion Schwangerschaft und Apotheke, 2011 Weber Rezepte für die Beratung, 2009 Rall Ernährungsberatung
Ausbildungsinhalte zum Sonderfach Pharmakologie und Toxikologie. Sonderfach Grundausbildung (36 Monate)
 Ausbildungsinhalte zum Sonderfach Pharmakologie und Toxikologie Anlage 24 Sonderfach Grundausbildung (36 Monate) 1. Standardisierungsmethoden und biologische Tests 2. Biometrische Methoden 3. Medikamente,
Ausbildungsinhalte zum Sonderfach Pharmakologie und Toxikologie Anlage 24 Sonderfach Grundausbildung (36 Monate) 1. Standardisierungsmethoden und biologische Tests 2. Biometrische Methoden 3. Medikamente,
Die Schizophrenie und das Glutamat: Neue Medikamente jenseits vom Dopamin?
 Die Schizophrenie und das Glutamat: Neue Medikamente jenseits vom Dopamin? Prof. Dr. Walter E. Müller Department of Pharmacology Biocentre of the University 60439 Frankfurt / M Die Dopaminhypothese der
Die Schizophrenie und das Glutamat: Neue Medikamente jenseits vom Dopamin? Prof. Dr. Walter E. Müller Department of Pharmacology Biocentre of the University 60439 Frankfurt / M Die Dopaminhypothese der
Sinn und Zweck von Psychopharmaka. Jochen Busse, Arzt Recklinghausen
 Sinn und Zweck von Psychopharmaka Jochen Busse, Arzt Recklinghausen www.autismus-med.de www.autismus-frueherkennung.de 1 Sinn und Zweck von Psychopharmaka Sinn und Unsinn Nutzen und Risiken Pro und contra
Sinn und Zweck von Psychopharmaka Jochen Busse, Arzt Recklinghausen www.autismus-med.de www.autismus-frueherkennung.de 1 Sinn und Zweck von Psychopharmaka Sinn und Unsinn Nutzen und Risiken Pro und contra
Inhaltsverzeichnis. Geleitwort... Vorwort... Abkürzungsverzeichnis... 1 Theorie und Praxis von Nebenwirkungen... 1
 Inhaltsverzeichnis Geleitwort...................................................................................... Vorwort... Abkürzungsverzeichnis... V VI XIII 1 Theorie und Praxis von Nebenwirkungen...
Inhaltsverzeichnis Geleitwort...................................................................................... Vorwort... Abkürzungsverzeichnis... V VI XIII 1 Theorie und Praxis von Nebenwirkungen...
Ausbildungsinhalte zum Sonderfach Pharmakologie und Toxikologie. Sonderfach Grundausbildung (36 Monate)
 Ausbildungsinhalte zum Sonderfach Pharmakologie und Toxikologie Anlage 24 Sonderfach Grundausbildung (36 Monate) A) Kenntnisse absolviert 1. Standardisierungsmethoden und biologische Tests 2. Biometrische
Ausbildungsinhalte zum Sonderfach Pharmakologie und Toxikologie Anlage 24 Sonderfach Grundausbildung (36 Monate) A) Kenntnisse absolviert 1. Standardisierungsmethoden und biologische Tests 2. Biometrische
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: 5511240 Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Schlagwörter Adrenalin; Aminosäuren; Aminosäurederivate; autokrin;
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: 5511240 Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Schlagwörter Adrenalin; Aminosäuren; Aminosäurederivate; autokrin;
PSYCHOPHARMAKA PSYCHOPHARMAKA PSYCHOPHARMAKA. PSYCHOPHARMAKA ENTWICKLUNG keine experimentelle Modelle. Modifizierung seelischer Abläufe
 Modifizierung seelischer Abläufe Beseitigung oder Abschwächung psychopathologischer Syndrome und psychischer Störungen Veränderungen von psychischen Funktionen (Erlebnisfähigkeit, Emotionalität, Verhalten)
Modifizierung seelischer Abläufe Beseitigung oder Abschwächung psychopathologischer Syndrome und psychischer Störungen Veränderungen von psychischen Funktionen (Erlebnisfähigkeit, Emotionalität, Verhalten)
Zulassung von Arzneimitteln. Klinische Untersuchungen. Katalin Müllner
 Zulassung von Arzneimitteln. Klinische Untersuchungen Katalin Müllner Arzneimittel In gesetzlicher Definition sind Arzneimittel Stoffe oder Zubereitungen aus Stoffen, die vom Hersteller, der sie in den
Zulassung von Arzneimitteln. Klinische Untersuchungen Katalin Müllner Arzneimittel In gesetzlicher Definition sind Arzneimittel Stoffe oder Zubereitungen aus Stoffen, die vom Hersteller, der sie in den
Aus Kuhl, H.: Sexualhormone und Psyche (ISBN ) Georg Thieme Verlag KG 2002 Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch
 Mit freundlicher Empfehlung von Wyeth Pharma Sexualhormone und Psyche Grundlagen, Symptomatik, Erkrankungen, Therapie Herausgegeben von Herbert Kuhl unter Mitarbeit von Wilhelm Braendle Meinert Breckwoldt
Mit freundlicher Empfehlung von Wyeth Pharma Sexualhormone und Psyche Grundlagen, Symptomatik, Erkrankungen, Therapie Herausgegeben von Herbert Kuhl unter Mitarbeit von Wilhelm Braendle Meinert Breckwoldt
Anhang III Änderungen der entsprechenden Abschnitte der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels und der Packungsbeilage
 Anhang III Änderungen der entsprechenden Abschnitte der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels und der Packungsbeilage Hinweis: Es kann notwendig sein, dass die Änderungen in der Zusammenfassung
Anhang III Änderungen der entsprechenden Abschnitte der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels und der Packungsbeilage Hinweis: Es kann notwendig sein, dass die Änderungen in der Zusammenfassung
Ca - Antagonisten. Ca-Kanal-Proteine
 Ca - Antagonisten Unter Ca-Antagonisten werden Arzneistoffe verstanden, die den Einstrom von Ca-Ionen in die Zelle durch die Ca-Kanäle verhindern. Sie werden auch als Ca-Kanal-Blocker bezeichnet. Die derzeit
Ca - Antagonisten Unter Ca-Antagonisten werden Arzneistoffe verstanden, die den Einstrom von Ca-Ionen in die Zelle durch die Ca-Kanäle verhindern. Sie werden auch als Ca-Kanal-Blocker bezeichnet. Die derzeit
Das Migräne-Chamäleon und die Triptanwelt - Migräne erkennen und erfolgreich therapieren. Peter Weber und Boris Zernikow
 Das Migräne-Chamäleon und die Triptanwelt - Migräne erkennen und erfolgreich therapieren Peter Weber und Boris Zernikow Attackentherapie Vorgehen Allgemeinmaßnahmen - Reizabschirmung, lokale Kühlung...
Das Migräne-Chamäleon und die Triptanwelt - Migräne erkennen und erfolgreich therapieren Peter Weber und Boris Zernikow Attackentherapie Vorgehen Allgemeinmaßnahmen - Reizabschirmung, lokale Kühlung...
Second Messenger keine camp, cgmp, Phospholipidhydrolyse (Prozess) Aminosäuren (Glutamat, Aspartat; GABA, Glycin),
 Neurotransmitter 1. Einleitung 2. Unterscheidung schneller und langsamer Neurotransmitter 3. Schnelle Neurotransmitter 4. Acetylcholin schneller und langsamer Neurotransmitter 5. Langsame Neurotransmitter
Neurotransmitter 1. Einleitung 2. Unterscheidung schneller und langsamer Neurotransmitter 3. Schnelle Neurotransmitter 4. Acetylcholin schneller und langsamer Neurotransmitter 5. Langsame Neurotransmitter
 Abbildungen Schandry, 2006 Quelle: www.ich-bin-einradfahrer.de Abbildungen Schandry, 2006 Informationsvermittlung im Körper Pioniere der Neurowissenschaften: Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Camillo
Abbildungen Schandry, 2006 Quelle: www.ich-bin-einradfahrer.de Abbildungen Schandry, 2006 Informationsvermittlung im Körper Pioniere der Neurowissenschaften: Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Camillo
die multimodale Stress-Therapie bei Patienten mit chronisch-entzündlichen Erkrankungen
 die multimodale Stress-Therapie bei Patienten mit chronisch-entzündlichen Erkrankungen Prof. Dr. med. Ulrich J. Winter, Essen IMD- Online- Seminar am 17.05.2017 1 multimodale Stress-Medizin : wichtige
die multimodale Stress-Therapie bei Patienten mit chronisch-entzündlichen Erkrankungen Prof. Dr. med. Ulrich J. Winter, Essen IMD- Online- Seminar am 17.05.2017 1 multimodale Stress-Medizin : wichtige
Dr. Sybille Rockstroh lehrt Biologische Psychologie an der Hochschule für Angewandte Psychologie in Olten, Schweiz.
 Dr. Sybille Rockstroh lehrt Biologische Psychologie an der Hochschule für Angewandte Psychologie in Olten, Schweiz. Für Christoph Lektorat / Redaktion im Auftrag des Ernst Reinhardt Verlages: Dr. med.
Dr. Sybille Rockstroh lehrt Biologische Psychologie an der Hochschule für Angewandte Psychologie in Olten, Schweiz. Für Christoph Lektorat / Redaktion im Auftrag des Ernst Reinhardt Verlages: Dr. med.
Psychopharmakotherapie griffbereit
 Jan Dreher griff bereit Psychopharmakotherapie griffbereit Medikamente, psychoaktive Genussmittel und Drogen 1.1 Wahl des Psychopharmakons Die Diagnose»Psychose«z. B. gibt vor, dass ein Neuroleptikum in
Jan Dreher griff bereit Psychopharmakotherapie griffbereit Medikamente, psychoaktive Genussmittel und Drogen 1.1 Wahl des Psychopharmakons Die Diagnose»Psychose«z. B. gibt vor, dass ein Neuroleptikum in
Telmisartan bei der Therapie der Hypertonie
 Gute Blutdrucksenkung gepaart mit günstigen Begleitwirkungen auf den Glukose- und Lipidmetabolismus sowie die Nieren Telmisartan bei der Therapie der Hypertonie Berlin (24. November 2005) - Die Hypertonie
Gute Blutdrucksenkung gepaart mit günstigen Begleitwirkungen auf den Glukose- und Lipidmetabolismus sowie die Nieren Telmisartan bei der Therapie der Hypertonie Berlin (24. November 2005) - Die Hypertonie
Beurteilung der striatalen Dopamin-D2-Rezeptorblockade durch Neuroleptika mit Hilfe der
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Nuklearmedizin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktorin: Frau Prof. Dr. med. habil. T. Mende Beurteilung der striatalen Dopamin-D2-Rezeptorblockade
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Nuklearmedizin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktorin: Frau Prof. Dr. med. habil. T. Mende Beurteilung der striatalen Dopamin-D2-Rezeptorblockade
Arzneimittelnebenund -Wechselwirkungen
 Arzneimittelnebenund -Wechselwirkungen Ein Handbuch und Tabellenwerk für Ärzte und Apotheker Herausgegeben von Hermann P. T. Ammon, Tübingen Mit Beiträgen von Hermann P. T. Ammon, Tübingen Claus-Jürgen
Arzneimittelnebenund -Wechselwirkungen Ein Handbuch und Tabellenwerk für Ärzte und Apotheker Herausgegeben von Hermann P. T. Ammon, Tübingen Mit Beiträgen von Hermann P. T. Ammon, Tübingen Claus-Jürgen
Zusammenhänge Blutdruckregulation
 Zusammenhänge Blutdruckregulation RR=HZV*R peripher Regulator RR=SV*HF*R peripher RR: Blutdruck HZV: Herzzeitvolumen SV: Schlagvolumen Ventrikelmyokard HF: Herzfrequenz Sinusknoten R peripher : Peripherer
Zusammenhänge Blutdruckregulation RR=HZV*R peripher Regulator RR=SV*HF*R peripher RR: Blutdruck HZV: Herzzeitvolumen SV: Schlagvolumen Ventrikelmyokard HF: Herzfrequenz Sinusknoten R peripher : Peripherer
Wichtige vasomotorische Funktionen des Endothels. Glatte Muskulatur
 Wichtige vasomotorische Funktionen des Endothels Endothel Glatte Muskulatur Wichtige vasomotorische Funktionen des Endothels Dilatation Dilatation Kon Dilatation striktion Kon striktion Zusammenhänge Blutdruckregulation
Wichtige vasomotorische Funktionen des Endothels Endothel Glatte Muskulatur Wichtige vasomotorische Funktionen des Endothels Dilatation Dilatation Kon Dilatation striktion Kon striktion Zusammenhänge Blutdruckregulation
Pharmakologische Grundlagen
 Pharmakologische Grundlagen Die Pharmakologie ist die Wissenschaft von den Wechselwirkungen zwischen Stoffen und Lebewesen (Zitat: Wikipedia) Wertung der Stoffe: Arzneistoffe (Pharmakologie) Giftstoffe
Pharmakologische Grundlagen Die Pharmakologie ist die Wissenschaft von den Wechselwirkungen zwischen Stoffen und Lebewesen (Zitat: Wikipedia) Wertung der Stoffe: Arzneistoffe (Pharmakologie) Giftstoffe
Arachidonsäure-Stoffwechsel
 Arachidonsäure-Stoffwechsel Fettsäuren mit einer Kettenlänge von 20 Kohlenstoffatomen nennt man Eicosanoiden. Diese Gruppe von Fettsäuren ist für den Menschen essentiell, da sie nicht vom Körper gebildet
Arachidonsäure-Stoffwechsel Fettsäuren mit einer Kettenlänge von 20 Kohlenstoffatomen nennt man Eicosanoiden. Diese Gruppe von Fettsäuren ist für den Menschen essentiell, da sie nicht vom Körper gebildet
Cimicifuga racemosa. Die Wirksamkeit ist dosisabhängig. Prof. Dr. med. Reinhard Saller Abteilung Naturheilkunde Universitätsspital Zürich
 Prof. Dr. med. Reinhard Saller Abteilung Naturheilkunde Universitätsspital Zürich Folie 1 Menopause relevante Beschwerden Hitzewallungen Schweissausbrüche Schlafstörungen Nervosität, Gereiztheit Depression
Prof. Dr. med. Reinhard Saller Abteilung Naturheilkunde Universitätsspital Zürich Folie 1 Menopause relevante Beschwerden Hitzewallungen Schweissausbrüche Schlafstörungen Nervosität, Gereiztheit Depression
Zulassung für JANUMET (Sitagliptin/Metformin) zur Behandlung des Typ-2-Diabetes in der Europäischen Union
 Zulassung für JANUMET (Sitagliptin/Metformin) zur Behandlung des Typ-2-Diabetes in der Europäischen Union Haar (23. Juli 2008) JANUMET (Sitagliptin/Metformin, MSD) hat von der Europäischen Kommission die
Zulassung für JANUMET (Sitagliptin/Metformin) zur Behandlung des Typ-2-Diabetes in der Europäischen Union Haar (23. Juli 2008) JANUMET (Sitagliptin/Metformin, MSD) hat von der Europäischen Kommission die
Kasuistische Beiträge zur modernen Pharmakotherapie mit Quetiapin
 Kasuistische Beiträge zur modernen Pharmakotherapie mit Quetiapin Hans-Peter Volz Siegfried Kasper Hans-Jürgen Möller Inhalt Vorwort 17 A Allgemeiner Teil Stürmiücn (I l.-.l. 1.1 Extrapyramidal-motorische
Kasuistische Beiträge zur modernen Pharmakotherapie mit Quetiapin Hans-Peter Volz Siegfried Kasper Hans-Jürgen Möller Inhalt Vorwort 17 A Allgemeiner Teil Stürmiücn (I l.-.l. 1.1 Extrapyramidal-motorische
Bluthochdruck. Facharztpraxis für Allgemeinmedizin Ansgar Hantke
 Bluthochdruck Facharztpraxis für Allgemeinmedizin Ansgar Hantke Bluthochdruck Herzlich Willkommen Bluthochdruck Thema: Stehst du auch unter Druck? Was hat das mit dem Blutdruck zu tun? Bluthochdruck 30%
Bluthochdruck Facharztpraxis für Allgemeinmedizin Ansgar Hantke Bluthochdruck Herzlich Willkommen Bluthochdruck Thema: Stehst du auch unter Druck? Was hat das mit dem Blutdruck zu tun? Bluthochdruck 30%
Kulturen von humanen Nabelschnur-Endothelzellen (HUVEC) produzieren konstant Endothelin-1 (ET-1) und geben dieses in das Kulturmedium ab.
 4 ERGEBNISSE 4.1 Endothelin Kulturen von humanen Nabelschnur-Endothelzellen (HUVEC) produzieren konstant Endothelin-1 (ET-1) und geben dieses in das Kulturmedium ab. 4.1.1 Dosisabhängige Herabregulation
4 ERGEBNISSE 4.1 Endothelin Kulturen von humanen Nabelschnur-Endothelzellen (HUVEC) produzieren konstant Endothelin-1 (ET-1) und geben dieses in das Kulturmedium ab. 4.1.1 Dosisabhängige Herabregulation
Inhalt. Vorwort.
 VII Inhalt Vorwort V Einleitung 1 Wozu brauchen wir Hormone? 3 Was sind naturidentische Hormone? 3 Wie kommt es zu Hormonstörungen? 4 Gibt es eine zeitliche Begrenzung für eine Therapie mit naturidentischen
VII Inhalt Vorwort V Einleitung 1 Wozu brauchen wir Hormone? 3 Was sind naturidentische Hormone? 3 Wie kommt es zu Hormonstörungen? 4 Gibt es eine zeitliche Begrenzung für eine Therapie mit naturidentischen
Hintergrund und Rationale des therapeutischen Drug Monitorings
 Hintergrund und Rationale des therapeutischen Drug Monitorings Plasma-Konz. [µg/l] 00 900 800 700 600 500 400 300 200 0 0 0 6 12 18 24 30 36 42 48 Zeit [h] HDoz Dr. Georg Hempel Institut für Pharmazeutische
Hintergrund und Rationale des therapeutischen Drug Monitorings Plasma-Konz. [µg/l] 00 900 800 700 600 500 400 300 200 0 0 0 6 12 18 24 30 36 42 48 Zeit [h] HDoz Dr. Georg Hempel Institut für Pharmazeutische
Neurobiologie und Rauchen. Der Nikotinrezeptor Grundlage der neurobiologischen Wirkung des Rauchens Anil Batra
 Neurobiologie und Rauchen Der Nikotinrezeptor Grundlage der neurobiologischen Wirkung des Rauchens Anil Batra Nicotin - Wirkstoff im Tabakrauch Resorption Zigarettenrauch enthält 30% des Nicotins einer
Neurobiologie und Rauchen Der Nikotinrezeptor Grundlage der neurobiologischen Wirkung des Rauchens Anil Batra Nicotin - Wirkstoff im Tabakrauch Resorption Zigarettenrauch enthält 30% des Nicotins einer
Vorwort 10 Vorwort zur 2. Auflage 12 Vorwort zur 1. Auflage Geschichte der medizinischen Hanfanwendung 18
 Inhalt Vorwort 10 Vorwort zur 2. Auflage 12 Vorwort zur 1. Auflage 14 1. Geschichte der medizinischen Hanfanwendung 18 1.1 Grossbritannien 20 1.2 USA 22 1.3 Frankreich 24 1.4 Deutschland 24 1.5 Erste pharmazeutische
Inhalt Vorwort 10 Vorwort zur 2. Auflage 12 Vorwort zur 1. Auflage 14 1. Geschichte der medizinischen Hanfanwendung 18 1.1 Grossbritannien 20 1.2 USA 22 1.3 Frankreich 24 1.4 Deutschland 24 1.5 Erste pharmazeutische
Psychopharmakotherapie im Rahmen der psychosomatischen Grundversorgung
 Psychopharmakotherapie im Rahmen der psychosomatischen Grundversorgung Dr. med. Dr. phil. H. Bandmann Oktober 2017 Allgemeines zur Pharmakotherapie Nebenwirkungen und Wechselwirkungen Alter: Grundprinzipien
Psychopharmakotherapie im Rahmen der psychosomatischen Grundversorgung Dr. med. Dr. phil. H. Bandmann Oktober 2017 Allgemeines zur Pharmakotherapie Nebenwirkungen und Wechselwirkungen Alter: Grundprinzipien
Serotinin und Melatonin
 FORUM VIA SANITAS Höglwörthweg 82 A-5020 Salzburg +43 (0) 662 26 20 01 office@forumviasanitas.org elearning Modul Serotinin und Melatonin Autor: Dr.med. Siegfried Kober Arzt für Allgemeinmedizin, Psychotherapeutische
FORUM VIA SANITAS Höglwörthweg 82 A-5020 Salzburg +43 (0) 662 26 20 01 office@forumviasanitas.org elearning Modul Serotinin und Melatonin Autor: Dr.med. Siegfried Kober Arzt für Allgemeinmedizin, Psychotherapeutische
Omalizumab. 2. An&asthma&ka Omalizumab Xolair /Novar&s CHO K1
 Omalizumab Omalizumab ist ein humanisierter rekombinanter, monoklonaler IgG1kappa- Antikörper, der selektiv an das menschliche Immunglobulin E (IgE) bindet. Nach Humanisierung des Maus-Moleküls durch Austausch
Omalizumab Omalizumab ist ein humanisierter rekombinanter, monoklonaler IgG1kappa- Antikörper, der selektiv an das menschliche Immunglobulin E (IgE) bindet. Nach Humanisierung des Maus-Moleküls durch Austausch
2.1 Acetylcholinesterase-Inhibitoren Sonstige Wirkstoffe Nootropika 23
 19 2 Antidementiva Simone Schmidt 2.1 Acetylcholinesterase-Inhibitoren 20 2.2 NMDA-Antagonisten 22 2.3 Sonstige Wirkstoffe Nootropika 23 2.4 Symptome der Demenz 25 S. Schmidt, Pflege mini Psychopharmaka
19 2 Antidementiva Simone Schmidt 2.1 Acetylcholinesterase-Inhibitoren 20 2.2 NMDA-Antagonisten 22 2.3 Sonstige Wirkstoffe Nootropika 23 2.4 Symptome der Demenz 25 S. Schmidt, Pflege mini Psychopharmaka
Datum: Kontakt: Abteilung: Tel. / Fax: Unser Zeichen: Ihr Zeichen:
 BASG / AGES Institut LCM Traisengasse 5, A-1200 Wien Datum: Kontakt: Abteilung: Tel. / Fax: E-Mail: Unser Zeichen: Ihr Zeichen: 25.06.2015 Mag. pharm. Dr. Ulrike Rehberger REGA +43 (0) 505 55 36258 pv-implementation@ages.at
BASG / AGES Institut LCM Traisengasse 5, A-1200 Wien Datum: Kontakt: Abteilung: Tel. / Fax: E-Mail: Unser Zeichen: Ihr Zeichen: 25.06.2015 Mag. pharm. Dr. Ulrike Rehberger REGA +43 (0) 505 55 36258 pv-implementation@ages.at
Spezielle Pharmakologie
 Allgemeine Pharmakologie... 13 0 1 Geschichte der Pharmakologie.... 14 1.1 Geschichte der Pharmakologie 14 2 Arzneistoffherkunft... 16 2.1 Droge und Wirkstoff... 16 2.2 Heimische Pflanzen als Quelle wirksamer
Allgemeine Pharmakologie... 13 0 1 Geschichte der Pharmakologie.... 14 1.1 Geschichte der Pharmakologie 14 2 Arzneistoffherkunft... 16 2.1 Droge und Wirkstoff... 16 2.2 Heimische Pflanzen als Quelle wirksamer
Allgemeine Pharmakologie., Geschichte der Pharmakologie. 14
 Allgemeine Pharmakologie., 13 1 Geschichte der Pharmakologie. 14 1.1 Geschichte der Pharmakologie 14? Arzneistoffherkunft, 1fi 2.1 Droge und Wirkstoff 16 2.4 Arzneimittelentwicklung... 22 2.2 Heimische
Allgemeine Pharmakologie., 13 1 Geschichte der Pharmakologie. 14 1.1 Geschichte der Pharmakologie 14? Arzneistoffherkunft, 1fi 2.1 Droge und Wirkstoff 16 2.4 Arzneimittelentwicklung... 22 2.2 Heimische
Der Autor Prof. Erich F. Elstner
 Der Autor Prof. Erich F. Elstner wurde 1939 geboren. Er studierte Chemie, Biologie und Geographie in München und promovierte 1967 in Göttingen zum Dr. rer. nat. (Biochemie). Sein Hauptarbeitsgebiet war
Der Autor Prof. Erich F. Elstner wurde 1939 geboren. Er studierte Chemie, Biologie und Geographie in München und promovierte 1967 in Göttingen zum Dr. rer. nat. (Biochemie). Sein Hauptarbeitsgebiet war
Zopiclon oder zolpidem
 Zopiclon oder zolpidem The Borg System is 100 % Zopiclon oder zolpidem Gewichtszunahme bei Zopiclon ; Erfahrungsberichte: 14 (5%); Zopiclon, auch Zopiclon, Zopiclon STADA, Zopiclon7,5 von ct, Zapiclon
Zopiclon oder zolpidem The Borg System is 100 % Zopiclon oder zolpidem Gewichtszunahme bei Zopiclon ; Erfahrungsberichte: 14 (5%); Zopiclon, auch Zopiclon, Zopiclon STADA, Zopiclon7,5 von ct, Zapiclon
PHYTO-EXTRAKT. Aktuelles für Sie und Ihre Patienten
 Ausgabe 8 11.03.2014 Liebe Leserin, lieber Leser, PHYTO-EXTRAKT Aktuelles für Sie und Ihre Patienten die närrischen Tage sind wieder vorbei unerwünschte Nachwirkungen wie z. B. Erkältungskrankheiten halten
Ausgabe 8 11.03.2014 Liebe Leserin, lieber Leser, PHYTO-EXTRAKT Aktuelles für Sie und Ihre Patienten die närrischen Tage sind wieder vorbei unerwünschte Nachwirkungen wie z. B. Erkältungskrankheiten halten
Pharmakologische Bewertung der Psychiatrie-relevantenSubstanzen der me too Liste 2007 der KV Nordrhein: Schwerpunkt Antipsychotika
 Pharmakologische Bewertung der Psychiatrie-relevantenSubstanzen der me too Liste 2007 der KV Nordrhein: Schwerpunkt Antipsychotika Prof. Dr. Walter E. Müller Pharmakologisches Institut für Naturwissenschaftler
Pharmakologische Bewertung der Psychiatrie-relevantenSubstanzen der me too Liste 2007 der KV Nordrhein: Schwerpunkt Antipsychotika Prof. Dr. Walter E. Müller Pharmakologisches Institut für Naturwissenschaftler
Pharmakokinetik - Modelle und Berechnungen
 Pharmakokinetik - Modelle und Berechnungen Bearbeitet von Heiko A. Schiffter 2., unveränderte Auflage 2015. Buch. XI, 147 S. Kartoniert ISBN 978 3 8047 3476 0 Format (B x L): 17 x 24 cm Weitere Fachgebiete
Pharmakokinetik - Modelle und Berechnungen Bearbeitet von Heiko A. Schiffter 2., unveränderte Auflage 2015. Buch. XI, 147 S. Kartoniert ISBN 978 3 8047 3476 0 Format (B x L): 17 x 24 cm Weitere Fachgebiete
PHYTO-EXTRAKT. Aktuelles für Sie und Ihre Patienten. Nichts ist hilfreicher als eine Herausforderung, um das Beste in einem Menschen hervorzubringen.
 Liebe Leserin, lieber Leser, PHYTO-EXTRAKT Aktuelles für Sie und Ihre Patienten Nichts ist hilfreicher als eine Herausforderung, um das Beste in einem Menschen hervorzubringen. Sir Thomas Sean Connery,
Liebe Leserin, lieber Leser, PHYTO-EXTRAKT Aktuelles für Sie und Ihre Patienten Nichts ist hilfreicher als eine Herausforderung, um das Beste in einem Menschen hervorzubringen. Sir Thomas Sean Connery,
Medikamentenkunde Teil 2 Version 1.2
 Medikamentenkunde Teil 2 Version 1.2 Medikamentenkunde Medikamentenkunde I Antidepressiva Neuroleptika Psychostimulanzien neurologische Grundlagen Medikamentenkunde II Anxiolytika Hypnotika Antidementiva
Medikamentenkunde Teil 2 Version 1.2 Medikamentenkunde Medikamentenkunde I Antidepressiva Neuroleptika Psychostimulanzien neurologische Grundlagen Medikamentenkunde II Anxiolytika Hypnotika Antidementiva
Benzodiazepine. Wirkprofil
 Benzodiazepine Die Benzodiazepine stellen die wichtigste Gruppe innerhalb der Tranquillantien dar. Sie können nach ihrer Wirkdauer eingeteilt werden in: ÿ Lang wirksame Benzodiazepine ÿ Mittellang wirksame
Benzodiazepine Die Benzodiazepine stellen die wichtigste Gruppe innerhalb der Tranquillantien dar. Sie können nach ihrer Wirkdauer eingeteilt werden in: ÿ Lang wirksame Benzodiazepine ÿ Mittellang wirksame
hormonelle Steuerung Freisetzung - Freisetzung der Hormone aus den endokrinen Drüsen unterliegt der Steuerung des ZNS und erfolgt:
 Das Hormonsystem 1. Hormone = sind spezifische Wirkstoffe - bzw. spezifische Botenstoffe - mit spezieller Eiweißstruktur - sehr empfindlich Chemischer Aufbau der Hormone: 1.Aminosäureabkömmlinge: Sie sind
Das Hormonsystem 1. Hormone = sind spezifische Wirkstoffe - bzw. spezifische Botenstoffe - mit spezieller Eiweißstruktur - sehr empfindlich Chemischer Aufbau der Hormone: 1.Aminosäureabkömmlinge: Sie sind
Antihypertonika (allgemein)
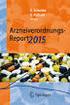 (allgemein) Beta-Blocker Beloc, Tenormin ACE-Hemmer Enac, Hypren L-Carnitin AT1-Blocker Atacand, Blopress antagonisten Verapabene, Isoptop Thiazide Fludex Speziell betroffene Wirkstoffe und Arzneimittel
(allgemein) Beta-Blocker Beloc, Tenormin ACE-Hemmer Enac, Hypren L-Carnitin AT1-Blocker Atacand, Blopress antagonisten Verapabene, Isoptop Thiazide Fludex Speziell betroffene Wirkstoffe und Arzneimittel
Nausea und Erbrechen Mechanismus und Therapie
 PROFO St. Anna 2013/2014 Palliativtherapie durch den Hausarzt (1) Nausea und Erbrechen Mechanismus und Therapie Nico Wiegand Gastroenterologie St. Anna 17.10.2013 1 2 Kortex Sinnesorgane Sx, Ekel, Erschöpfung
PROFO St. Anna 2013/2014 Palliativtherapie durch den Hausarzt (1) Nausea und Erbrechen Mechanismus und Therapie Nico Wiegand Gastroenterologie St. Anna 17.10.2013 1 2 Kortex Sinnesorgane Sx, Ekel, Erschöpfung
Position analgetisch wirksamer Substanzklassen in der Therapie von Gelenkschmerzen NSAR oder nicht NSAR?
 Position analgetisch wirksamer Substanzklassen in der Therapie von Gelenkschmerzen NSAR oder nicht NSAR? Von Dr. med. Wolfgang W. Bolten München (31. Januar 2006) - Für die medikamentöse Behandlung von
Position analgetisch wirksamer Substanzklassen in der Therapie von Gelenkschmerzen NSAR oder nicht NSAR? Von Dr. med. Wolfgang W. Bolten München (31. Januar 2006) - Für die medikamentöse Behandlung von
INHALT. Blutdruck als funktionelle Größe. Die Regulation des Blutdrucks 18. Definition des Bluthochdrucks (Hypertonie) Ursachen des Bluthochdrucks 27
 INHALT Vorwort 10 Blutdruck als funktionelle Größe lk Blutkreislauf 14 Blutdruck in verschiedenen Abschnitten des Kreislauf-Systems 16 Die Regulation des Blutdrucks 18 Vegetatives Nervensystem 19 Renin-Angiotensin-Aldosteron-System
INHALT Vorwort 10 Blutdruck als funktionelle Größe lk Blutkreislauf 14 Blutdruck in verschiedenen Abschnitten des Kreislauf-Systems 16 Die Regulation des Blutdrucks 18 Vegetatives Nervensystem 19 Renin-Angiotensin-Aldosteron-System
Synaptische Verbindungen - Alzheimer
 Vorlesung: Grundlagen der Neurobiologie (Teil des Grundmoduls Neurobiologie) Synaptische Verbindungen - Alzheimer R. Brandt (Email: brandt@biologie.uni-osnabrueck.de) Synaptische Verbindungen - Synapsen,
Vorlesung: Grundlagen der Neurobiologie (Teil des Grundmoduls Neurobiologie) Synaptische Verbindungen - Alzheimer R. Brandt (Email: brandt@biologie.uni-osnabrueck.de) Synaptische Verbindungen - Synapsen,
Synaptische Übertragung und Neurotransmitter
 Proseminar Chemie der Psyche Synaptische Übertragung und Neurotransmitter Referent: Daniel Richter 1 Überblick Synapsen: - Typen / Arten - Struktur / Aufbau - Grundprinzipien / Prozesse Neurotransmitter:
Proseminar Chemie der Psyche Synaptische Übertragung und Neurotransmitter Referent: Daniel Richter 1 Überblick Synapsen: - Typen / Arten - Struktur / Aufbau - Grundprinzipien / Prozesse Neurotransmitter:
Die chemische Blockierung des adrenergischen Systems am Menschen
 ACTA NEUROVEGETATIVA 1 SUPPLEMENTUM V Die chemische Blockierung des adrenergischen Systems am Menschen Experimentelle Studien und klinische Beobachtungen mit sympathicolytischen und ganglienblockierenden
ACTA NEUROVEGETATIVA 1 SUPPLEMENTUM V Die chemische Blockierung des adrenergischen Systems am Menschen Experimentelle Studien und klinische Beobachtungen mit sympathicolytischen und ganglienblockierenden
Synaptische Transmission
 Synaptische Transmission Wie lösen APe, die an den Endknöpfchen der Axone ankommen, die Freisetzung von Neurotransmittern in den synaptischen Spalt aus (chemische Signalübertragung)? 5 wichtige Aspekte:
Synaptische Transmission Wie lösen APe, die an den Endknöpfchen der Axone ankommen, die Freisetzung von Neurotransmittern in den synaptischen Spalt aus (chemische Signalübertragung)? 5 wichtige Aspekte:
VORWORT von Prof.Dr.med. Hans Schaefer aus Heidelberg... 1
 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S VORWORT von Prof.Dr.med. Hans Schaefer aus Heidelberg... 1 D A S O R AL E G - S T R O P H A N T H I N : EINE ALTBEWÄHRTE, ALS KÖRPEREIGEN NEUENTDECKTE SUBSTANZ VERHINDERT
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S VORWORT von Prof.Dr.med. Hans Schaefer aus Heidelberg... 1 D A S O R AL E G - S T R O P H A N T H I N : EINE ALTBEWÄHRTE, ALS KÖRPEREIGEN NEUENTDECKTE SUBSTANZ VERHINDERT
Von Prof. Dr. Maurice Stephan Michel, Universitätsklinikum, Mannheim
 Das logische Prinzip GnRH Blocker" Von Prof. Dr. Maurice Stephan Michel, Universitätsklinikum, Mannheim Stuttgart (25. September 2008) - Die chirurgische Kastration bewirkt bereits innerhalb weniger Stunden
Das logische Prinzip GnRH Blocker" Von Prof. Dr. Maurice Stephan Michel, Universitätsklinikum, Mannheim Stuttgart (25. September 2008) - Die chirurgische Kastration bewirkt bereits innerhalb weniger Stunden
1 Bau von Nervenzellen
 Neurophysiologie 1 Bau von Nervenzellen Die funktionelle Einheit des Nervensystems bezeichnet man als Nervenzelle. Dendrit Zellkörper = Soma Zelllkern Axon Ranvier scher Schnürring Schwann sche Hüllzelle
Neurophysiologie 1 Bau von Nervenzellen Die funktionelle Einheit des Nervensystems bezeichnet man als Nervenzelle. Dendrit Zellkörper = Soma Zelllkern Axon Ranvier scher Schnürring Schwann sche Hüllzelle
Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln DR. KATALIN MÜLLNER
 Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln DR. KATALIN MÜLLNER Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln - Definition Auch als Arzneimittelinteraktionen Viele Patienten erhalten gleichzeitig mehrere Medikamente
Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln DR. KATALIN MÜLLNER Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln - Definition Auch als Arzneimittelinteraktionen Viele Patienten erhalten gleichzeitig mehrere Medikamente
Cannabis und Multiple Sklerose
 Neurologische Abteilung Chefarzt Dr. med. Konrad Luckner Dr. med. Christiane Pollnau Cannabis und Multiple Sklerose Dr. med. C. Pollnau Ass.-Ärztin Neurologie Krankenhaus Buchholz Cannabis und Multiple
Neurologische Abteilung Chefarzt Dr. med. Konrad Luckner Dr. med. Christiane Pollnau Cannabis und Multiple Sklerose Dr. med. C. Pollnau Ass.-Ärztin Neurologie Krankenhaus Buchholz Cannabis und Multiple
Kapitel 1: Pharmakokinetische Modelle 1
 VII Kapitel 1: Pharmakokinetische Modelle 1 1.1 Einleitung... 1 1.2 Pharmakokinetische Modelle... 1 1.2.1 Kompartiment-Modell... 1 1.2.2 Statistisches Modell... 3 1.2.3 Physiologisches Modell... 3 1.3
VII Kapitel 1: Pharmakokinetische Modelle 1 1.1 Einleitung... 1 1.2 Pharmakokinetische Modelle... 1 1.2.1 Kompartiment-Modell... 1 1.2.2 Statistisches Modell... 3 1.2.3 Physiologisches Modell... 3 1.3
Bach-Blütentherapie. Ergebnisbericht aktualisierte Fassung
 Bach-Blütentherapie Ergebnisbericht aktualisierte Fassung Recherche Datum der Erstrecherche: 13.08.2011 Datum der Aktualisierungsrecherche: 11.03.2015 PICO-Fragestellung: Population: Personen mit diversen
Bach-Blütentherapie Ergebnisbericht aktualisierte Fassung Recherche Datum der Erstrecherche: 13.08.2011 Datum der Aktualisierungsrecherche: 11.03.2015 PICO-Fragestellung: Population: Personen mit diversen
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen
 Chronisch entzündliche Darmerkrankungen Arzneimitteltherapie und Diätetik 2., überarbeitete und ergänzte Auflage von Prof. Dr. med. Wolfgang Kruis Medizinische Universitätsklinik I, Köln und Gerhard Spangenberg
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen Arzneimitteltherapie und Diätetik 2., überarbeitete und ergänzte Auflage von Prof. Dr. med. Wolfgang Kruis Medizinische Universitätsklinik I, Köln und Gerhard Spangenberg
Bewertung relevanter pharmakodynamischer Interaktionen von Antidiabetika
 46. Jahrestagung Deutsche-Diabetes Diabetes- Gesellschaft 01.- 04. Juni 2011, Leipzig Bewertung relevanter pharmakodynamischer Interaktionen von Antidiabetika Dr. Nina Griese Zentrum für Arzneimittelinformation
46. Jahrestagung Deutsche-Diabetes Diabetes- Gesellschaft 01.- 04. Juni 2011, Leipzig Bewertung relevanter pharmakodynamischer Interaktionen von Antidiabetika Dr. Nina Griese Zentrum für Arzneimittelinformation
