Anästhesie und Anästhetika Kurs für Naturwissenschaftler
|
|
|
- Ralf Winter
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Anästhesie und Anästhetika Kurs für Naturwissenschaftler Prof. Dr. Jochen Klein Pharmakologisches Institut für Naturwissenschaftler, FB14 Goethe-Universität Frankfurt Der rote Faden Teil 1: Geschichte der Anästhesie Teil 2: Prinzipien der Anästhesie Teil 3: Wirkmechanismen der Anästhetika Kaliumkanäle, GABA A - und NMDA-Rezeptoren Teil 4: Inhalations- und Injektionsanästhetika Teil 5: Injektionsnarkotika 1
2 Anästhetische Gase/ Flüssigkeiten Geschichte der Anästhesie (1) Keine Chirurgie ohne Anästhesie!! Anästhetika bis zum 19. Jahrhundert: Pharmakologie : Opiate, Hashish, Alkohol... Oder: Strangulierung, Hammer und Holzhelm s: Ether, Chloroform, und Lachgas Erste Nutzung von Ether als Anästhetikum (1846): Crawford Long, Zahnarzt in Georgia (USA) Eingeführt in die Medizin durch William Morton in Boston (erfolgreicher chirurgischer Eingriff) Nachteile: (a.) entzündlich und Bildung explosiver Peroxide (b.) unangenehmer Geruch (c.) langsamer Wirkeintritt Interesting website: 2
3 Morton s inhaler Demonstration of ether as an anesthetic (Mass. Gen. Hosp.) Geschichte der Anästhesie (2) 1840 Simpson (Schottland) beschreibt die anäesthetischen Eigenschaften des Chloroforms, CHCl 3 Chloroform wird populär nach Nutzung bei der Königin Viktoria (a la reine) Vorteil: Chloroform ist nicht brennbar! Erst 50 Jahre später wurde die Hepatotoxizität des Chloroforms erkannt Moderne Inhalationsanästhetika haben Charakteristika von Ether und Chloroform 3
4 Geschichte der Anästhesie (3) 1793 Priestley & Davy (England) beschreiben N 2 0 als Lachgas 1844 Wells (ein Zahnarzt) bemerkt analgetische Wirkung des N 2 O während Jahrmarktsvorführung 1845 Öffentliche Vorführung in Harvard schlägt fehl (Wells begeht 1848 Selbstmord) Lachgas wird erst gegen 1900 als Anästhetikum akzeptiert, nachdem Dosierapparate entwickelt wurden Heute ist Lachgas das wichtigste Gas unter den Anästhetika. Ähnliche Wirkungen haben Xenon und Cyclopropan Der rote Faden Teil 1: Geschichte der Anästhesie Teil 2: Prinzipien der Anästhesie Teil 3: Wirkmechanismen der Anästhetika Kaliumkanäle, GABA A - und NMDA-Rezeptoren Teil 4: Inhalations- und Injektionsanästhetika Teil 5: Injektionsnarkotika 4
5 Komponenten der Anästhesie Verlust des Bewusstseins Keine sensorischen Informationen, keine bewusste Schmerzempfindung Patient unbeweglich, nicht weckbar Unterschied zu Schlaf Amnesie (kein Gedächtnis) Ebenen der Anästhesie Verhalten Beispiel: Verlust des Bewusstseins Hirnstrukturen Beispiel: Cortex, Thalamus Nervenbahnen Beispiel: pontine cholinerge Fasern Molekulare Angriffspunkte Beispiel: GABA A -Rezeptor 5
6 Wachen und Schlafen: Bedeutung des Thalamus Erwachen durch Aktivierung des ARAS (Berührung, Geräusche, Licht, Schmerz) Daraufhin Aktivierung des Thalamus, dann des Cortex und Erwachen Wachen und Schlafen in der Elektrophysiologie Wachen: Thalamus empfängt erregende Einflüsse vom ARAS und vom Cortex Thalamus ist erregt, sensorische Information wird zum Cortex weitergeleitet NREM-Schlaf: ARAS fällt weg, thalamische Neurone produzieren spontan einen burst-firing mode (rhythmisches Feuern) Thalamus ist deaktiviert, sensorischer Input wird nicht weitergeleitet 6
7 Verbindungen zwischen Thalamus und Cortex, ARAS und sensorischem Input Wachen und Schlafen 7
8 Schlaf und Wachen Kortikale Wachheit wird durch parallel aktivierte Systeme hervorgerufen, darunter cholinerge Neurone in der Brücke (Pons) noradrenerge Neurone im Locus coeruleus histaminerge Neurone im Hypothalamus (TMN) Im Schlaf sind andere Nervenbahnen aktiv: Z.B. Ventrolateraler präoptischer Nucleus (Hypothalamus) meist GABAerge Fasern? Aktivierende und sedierende Systeme sind gegensätzlich geschaltet, so dass ein bistabiles System entsteht: man ist entweder wach oder schlafend Wirkqualitäten der Anästhetika: steile Dosis- Wirkungskurve 8
9 Der rote Faden Teil 1: Geschichte der Anästhesie Teil 2: Prinzipien der Anästhesie Teil 3: Wirkmechanismen der Anästhetika Kaliumkanäle, GABA A - und NMDA-Rezeptoren Teil 4: Inhalations- und Injektionsanästhetika Teil 5: Injektionsnarkotika Allgemeinanästhetika: Ähnlichkeiten bei der Wirkung aber nicht bei Struktur oder Potenz 9
10 Wirken alle Anästhetika gleich? Potenz korreliert mit Lipophilie Öl / Wasser- Koeffizient als Maß (Meyer-Overton rule. MAC = minimal alveolar concentration) Wirkweise von Anästhetika: Lipidtheorie Um 1900: Meyer und Overton begründen anästhetische Aktivität mit Lipophilie Lipidtheorie vermutet Interaktion der Anästhetika mit Membranlipiden Aber: Unspezifische Interaktionen mit Lipidmembranen können Wirksamkeit nicht erklären Nur höchste Konzentrationen an Anästhetika beeinflussen Lipidstruktur Manche Anästhetika zeigen Enantioselektivität (Ketamin) Bei immer höherer Lipophilie von Alkoholen bricht anästhetische Potenz weg 10
11 Wirkweise von Anästhetika: Proteintheorie (Franks und Lieb, 1984) Anästhetika hemmen die Aktivität der Luciferase in Abhängigkeit von ihrer Lipophilie Strukturveränderungen des Proteins nicht nachweisbar Folgerung: Anästhetika binden in vorgeformten Kavernen Letzte 20 Jahre (viele Arbeitsgruppen): Am empfindlichsten sind Ionenkanäle Ähnlichkeiten mit Ethanol (GABA-, NMDA-Rezeptoren) Hypothese wird gestützt durch Mutationsstudien (z.b. in GlyR / Ethanol) Wirkort wahrscheinlich an Protein-Lipid-Interphase Ionenkanäle: spannungs- vs. ligandengesteuert Wichtige Ionenkanäle: Natrium-, Kalium-, Calcium- und Chloridkanäle 11
12 Gesamtsicht der neuronalen Impulsleitung Rezeptives Feld Projektives Feld Dendritenbaum und Soma: einfallende Reize werden empfangen und integriert Liganden-gesteuerte Ionenkanäle für schnelle Übertragung GPCR für langsame Übertragung Axonhügel / Axon: Auslösung und Leitung der Aktionspotentiale Spannungsgesteuerte Ionenkanäle Synapse: Wechsel auf chemische Erregungsübertragung Liganden-gesteuerte Ionenkanäle und GPCR Prä- und postsynaptische Rezeptoren Wirkorte der Anästhetika: Ruhemembranpotential Negativ bei ca. -70 mv Getragen von Kaliumströmen, v.a. K 2P -Kanäle (Schrittmacher: HCN-Kanäle) Inhibitorische Potentiale (hyperpolarisierend): Durch GABA ausgelöster Chlorid-Einstrom Exzitatorische Potentiale (depolarisierend): Durch Glutamat ausgelöster Natrium-Einstrom 12
13 Schneller Überblick Anästhetika bewirken Hyperpolarisation und verringerte Freisetzung von Transmittern Aktivierung der K2P-Kanäle durch Flurane, N 2 O, Etomidat Potenzierung des inhibitorischen GABA A - Rezeptors durch praktisch alle Anästhetika Ebenso Glycin A -Rezeptoren (Immobilität, Paralyse?) Hemmung erregender Rezeptoren Z.B. glutamaterge Rezeptoren oder nachr NMDA-Rezeptor-Hemmung durch Lachgas, Ketamin Spannungsabhängiger Kaliumkanal (nach Rodney McKinnon et al.) 13
14 Two-pore Kaliumkanal K 2P Kanal bestimmt Ruhepotential Öffnung des Kanals durch Anästhetika bewirkt Hyperpolarisation (verringerte Erregbarkeit) Kanal ist wichtiger Angriffspunkt für gasförmige Anästhetika TREK1-Knockouts reagieren wenig auf Anästhetika (Verlust der Analgesie) Wichtig für Lachgas, Xenon, Cyclopropan Eher unwichtig für intravenöse Anästhetika The GABA(A) receptor Der GABA(A)-Rezeptor Heteromerer Rezeptor mit α-, ß- und γ-untereinheiten Häufig sind (im ZNS) α1-3, ß1-3 und γ2 Öffnung des Rezeptors bedingt Einstrom von Chlorid und Hyperpolarisation McKernan & Whiting
15 Anästhesie und GABA A -Rezeptoren GABA ist der wichtigste inhibitorische (dämpfende) Transmitter im ZNS 40-50% der Synapsen sind GABAerg Potenzierung der GABA-Wirkung ist Teil der Wirkung von Anästhetika Analogie zur Wirkung des Alkohols und der Benzodiazepine: Sedation/Hypnose Zentrale Muskelrelaxation, antikonvulsiv Anxiolyse, Amnesie Mutationen im GABA A -Rezeptor und Wirkungen von Injektionsanästhetika Rudolph & Antkowiak NRN
16 Mutationen im GABA A -Rezeptor und Wirkungen von Anästhetika Der glutamaterge NMDA-Rezeptor Liganden: Glutamat und Glycin MK-801 und Memantin Ketamin und PCP Mg und Zn Polyamine 16
17 NMDA-Rezeptoren Glutamaterge Rezeptoren mit NR1 und NR2- Untereinheiten Wichtig für Gedächtnisbildung, z.b. im Hippokampus Koinzidenzdetektor, durchlässig für Calcium LTP Typischer Angriffspunkt von Ketamin (Hemmung) Wichtige Angriffspunkte für anästhetische Gase (N 2 O, Xenon, Cyclopropan) und für Ethanol Bindung/Verdrängung von Glycin Glutamaterge AMPA/Kainat-Rezeptoren zeigen geringere Sensitivität Zusammenfassung Molekularer Angriffspunkt K 2P -Kanäle NMDA-Rezeptoren GABA A -Rezeptoren Anästhetische Wirkung Senkung des Membranpotentials Hemmung erregender Impulse Potenzierung inhibitorischer Impulse Wirkmechanismus Öffnung K + -Efflux Hyperpolarisation der Neurone Erregbarkeit Hemmung Na + -Influx Depolarisierende Impulse Dämpfung, Amnesie, Analgesie Potenzierung Cl - -Influx Hyperpolarisation Sedation, Hypnose, Amnesie, Anxiolyse, Muskelrelaxation 17
18 Molekulare Angriffspunkte: eine Zusammenfassung (Alkire et al., 2008) Der rote Faden Teil 1: Geschichte der Anästhesie Teil 2: Prinzipien der Anästhesie Teil 3: Wirkmechanismen der Anästhetika Kaliumkanäle, GABA A - und NMDA-Rezeptoren Teil 4: Inhalations- und Injektionsanästhetika Teil 5: Injektionsnarkotika 18
19 Anfluten von Inhalationsanästhetika Gase mit geringer Wasser (Blut-) löslichkeit äquilibrieren schnell mit dem Gehirn Gase mit hoher Wasser (Blut-) löslichkeit äquilibrieren langsam Anästhesiegase: N 2 O (Lachgas) Farbloses, weitgehend geruchloses Gas. Nicht entflammbar Sehr schnelle Diffusionseigenschaften 100 O 2 nach Ende der Narkose; Pneumothorax Geringe Potenz (meist benutzt in 50-80% Konz.); In geringer Konzentration nützlich für kleine Eingriffe aber für tiefe Narkose nur in Kombination Sehr potentes Analgetikum (ab 20%) aber keine Muskelrelaxation Guter Kombinationspartner für andere Anästhesiegase Weitgehend neutral auf Herz- und Lungenfunktion Halluzinatorische Komponente 19
20 Pharmakokinetik: Lachgas Note: Stark perfundierte Organe erreichen schnell Gleichgewicht Äquilibrierung langsam in wenig durchbluteten Geweben Goodman-Gilman, 2001 Halogenierte Kohlenwasserstoffe: Halothan Seit 1956 in Gebrauch; geringe Wasserlöslichkeit, daher schneller Wirkungseintritt Meist zusammen mit Sauerstoff und Lachgas appliziert Hohe Potenz (MAC 0.7-1%) aber keine Analgesie und wenig Muskelrelaxation (Skelettmuskel, Uterus) Atemdepressiv und kardiodepressiv (dosisabhängig) Abfall des Blutdrucks sehr deutlich (20-25%); Hauptgrund Kardiodepression. Herzfrequenz bleibt niedrig Bradykardie, Sensitivierung gegenüber Katecholaminen Maligne Hyperthermie möglich 20% Metabolismus in Leber, Gefahr der fulminanten Hepatitis wenige Tage nach OP (1:10.000) Halothan ist weiterhin wichtig für 3. Welt aber im Westen obsolet 20
21 Halogenierte Kohlenwasserstoffe: Isofluran Sehr geringe Wasserlöslichkeit, daher sehr schnelle Kinetik. Weltweit beliebtes Anästhetikum Aber wg. Geruch nicht zur Induktion Abfall des Blutdrucks (dosisabhängig) durch periphere Vasodilatation Atemdepressiv Geringe Toxizität Praktisch kein Metabolismus und daher keine Lebertoxizität Sevofluran und Desfluran: Mittel der 1. Wahl Sevofluran: Beliebtes Anästhetikum, auch ambulant (z.b. bei Kindern, Kaiserschnitt) Reizt nicht die Atemwege, kein Laryngospasmus Mäßiger Abfall des Blutdrucks (dosisabhängig) durch periphere Vasodilatation; geringe Kardiodepression Atemdepressiv Flache, etwas beschleunigte Atmung. Deutliche Bronchodilatation Desfluran: schnellste Kinetik der halogenierten Gase Reizt die Atemwege nicht zur Induktion, Laryngo- und Bronchospasmen möglich Vasodilatation und Anstieg der Herzfrequenz typisch 21
22 Der rote Faden Teil 1: Geschichte der Anästhesie Teil 2: Prinzipien der Anästhesie Teil 3: Wirkmechanismen der Anästhetika Kaliumkanäle, GABA A - und NMDA-Rezeptoren Teil 4: Inhalations- und Injektionsanästhetika Teil 5: Injektionsnarkotika Intravenöse Anästhetika Thiopental (seit 1935) Barbiturat mit schneller Anflutung (Sekunden) und kurzer Wirkdauer (ca. 25 min). Achtung: lange terminale Halbwertszeit Keine Analgesie. Deutliche Atem- und Kreislaufdepression Verringerung des zerebralen Blutflusses und des ICP 22
23 Pharmakokinetik: Thiopental Kontextsensitive Halbwertszeit 23
24 Intravenöse Anästhetika Propofol Synthetisches, injizierbares, sehr hydrophobes Anästhetikum mit schnellem Wirkungseintritt (60 sec). Wirkdauer ca. 10 min. Schnelle, flusslimitierte Clearance durch hepatischen Metabolismus Wirkmechanismus: überwiegend GABAerg Vorteile: Standard zur Narkoseeinleitung; kein Laryngospasmus Euphorisierende und antiemetische Wirkung Geeignet zur TIVA (evtl mit Remifentanil) bei kurzdauernden Eingriffen (Polypen, Sectio) Nachteile: Dosisabhängige Atemdepression, Apnoe möglich Schmerzhaft an der Injektionsstelle; relativ teuer Propofol: dosisabhängige Wirkung und Angriffspunkte (abh. von Dichte GABAerger Rezeptoren?) Amnesia, Loss of sensory input Sedation/hypnosis, Loss of consciousness Immobility Overdose causes respiratory paralysis 24
25 Intravenöse Anästhetika Ketamin (Ketanest R ) NMDA-Rezeptor-Antagonist mit halluzinogenen Eigenschaften v.a. bei Erwachsenen (Katalepsie, dissoziative Anästhesie ) Patienten zeigen Amnesie und Analgesie; offene Augen, spontane Atmung, spontane Bewegungen Wirkt etwas länger (10-15 min nach einer Dosis) Erhöht Blutdruck, Herzfrequenz, CBF. Indirektes Sympathomimetikum, günstig für Asthmatiker Erhöhung des Hirndrucks nicht mehr bei S-Ketamin. Angriffspunkte von Ketamin 25
26 Anästhetikum Komponenten der Anästhesie Definition Bewusstlosigkeit Verlust des Bewusstseins, schlafähnlicher Zustand Amnesie Unfähigkeit, Gedächtnis zu bilden oder Gedächtnisinhalte aktiv abzurufen Muskelrelaxation ( Immobilität ) Unterbleiben motorischer Reaktionen auf sensorische Reize Analgesie (Antinozizeption) Verlust der Wahrnehmung von Schmerz Merkmale Wachbewusstsein temporär ausgeschaltet Sinneseindrücke nicht bewusst erinnerlich, aber im Unterbewusstsein vorhanden (vgl. Awareness ) Ausschaltung motorischer Reaktionen Reduktion oder Unterbrechung der Erregungsleitung Molekulare Mechanismen Aktivierung von GABA A - Rezeptoren Blockade von NMDA- Rezeptoren in Thalamus und Cortex Aktivierung von GABA A - Rezeptoren Blockade von NMDA- Rezeptoren GABA A - und Glycin A - Rezeptoren im subkortikalen und spinalen Bereich Blockade von nachr? Blockade von NMDA-Rezeptoren Arzneistoff Halogenierte volatile Anästhetika Propofol, Etomidat Benzodiazepine Ketamin Lachgas Benzodiazepine volatile Anästhetika Ketamin Lachgas Dosis Mittlere Dosen Geringe Dosen Hohe Dosen Wirksamkeit Steile Dosis- Wirkungsbeziehung Anterograd und retrograd Synergismus mit Muskelrelaxantien (Wirkort: nach-rezeptor) Bei Analgetika- Gabe Dosis der Anästhetika Barbiturate wirken u.u. hyperalgetisch Ablauf der Narkose 26
27 27
Ligandengesteuerte Ionenkanäle
 Das Gehirn SS 2010 Ligandengesteuerte Ionenkanäle Ligandengesteuerte Kanäle Ligand-gated ion channels LGIC Ionotrope Rezeptoren Neurotransmission Liganden Acetylcholin Glutamat GABA Glycin ATP; camp; cgmp;
Das Gehirn SS 2010 Ligandengesteuerte Ionenkanäle Ligandengesteuerte Kanäle Ligand-gated ion channels LGIC Ionotrope Rezeptoren Neurotransmission Liganden Acetylcholin Glutamat GABA Glycin ATP; camp; cgmp;
Vorlesung Einführung in die Biopsychologie. Kapitel 4: Nervenleitung und synaptische Übertragung
 Vorlesung Einführung in die Biopsychologie Kapitel 4: Nervenleitung und synaptische Übertragung Prof. Dr. Udo Rudolph SoSe 2018 Technische Universität Chemnitz Grundlage bisher: Dieser Teil nun: Struktur
Vorlesung Einführung in die Biopsychologie Kapitel 4: Nervenleitung und synaptische Übertragung Prof. Dr. Udo Rudolph SoSe 2018 Technische Universität Chemnitz Grundlage bisher: Dieser Teil nun: Struktur
Exzitatorische (erregende) Synapsen
 Exzitatorische (erregende) Synapsen Exzitatorische Neurotransmitter z.b. Glutamat Öffnung von Na+/K+ Kanälen Membran- Potential (mv) -70 Graduierte Depolarisation der subsynaptischen Membran = Erregendes
Exzitatorische (erregende) Synapsen Exzitatorische Neurotransmitter z.b. Glutamat Öffnung von Na+/K+ Kanälen Membran- Potential (mv) -70 Graduierte Depolarisation der subsynaptischen Membran = Erregendes
Erregungsübertragung an Synapsen. 1. Einleitung. 2. Schnelle synaptische Erregung. Biopsychologie WiSe Erregungsübertragung an Synapsen
 Erregungsübertragung an Synapsen 1. Einleitung 2. Schnelle synaptische Übertragung 3. Schnelle synaptische Hemmung chemische 4. Desaktivierung der synaptischen Übertragung Synapsen 5. Rezeptoren 6. Langsame
Erregungsübertragung an Synapsen 1. Einleitung 2. Schnelle synaptische Übertragung 3. Schnelle synaptische Hemmung chemische 4. Desaktivierung der synaptischen Übertragung Synapsen 5. Rezeptoren 6. Langsame
Das Wichtigste: 3 Grundlagen der Erregungs- und Neurophysiologie. - Erregungsausbreitung -
 Das Wichtigste Das Wichtigste: 3 Grundlagen der Erregungs- und Neurophysiologie - Erregungsausbreitung - Das Wichtigste: 3.4 Erregungsleitung 3.4 Erregungsleitung Elektrotonus Die Erregungsausbreitung
Das Wichtigste Das Wichtigste: 3 Grundlagen der Erregungs- und Neurophysiologie - Erregungsausbreitung - Das Wichtigste: 3.4 Erregungsleitung 3.4 Erregungsleitung Elektrotonus Die Erregungsausbreitung
Volatile oder intravenöse Anästhetika Die Eigenschaften bestimmen den klinischen Einsatz
 Pharmakologie Allgemeiner Teil 3.2.1.3 3.2.1.3 Volatile oder intravenöse Anästhetika Die Eigenschaften bestimmen den klinischen Einsatz B. DRExLER 1 Einleitung Mit der Einführung von Propofol in die Klinik
Pharmakologie Allgemeiner Teil 3.2.1.3 3.2.1.3 Volatile oder intravenöse Anästhetika Die Eigenschaften bestimmen den klinischen Einsatz B. DRExLER 1 Einleitung Mit der Einführung von Propofol in die Klinik
neurologische Grundlagen Version 1.3
 neurologische Grundlagen Version 1.3 ÜBERBLICK: Neurone, Synapsen, Neurotransmitter Neurologische Grundlagen Zentrale Vegetatives Peripheres Überblick: Steuersystem des menschlichen Körpers ZNS Gehirn
neurologische Grundlagen Version 1.3 ÜBERBLICK: Neurone, Synapsen, Neurotransmitter Neurologische Grundlagen Zentrale Vegetatives Peripheres Überblick: Steuersystem des menschlichen Körpers ZNS Gehirn
Biopsychologie als Neurowissenschaft Evolutionäre Grundlagen Genetische Grundlagen Mikroanatomie des NS
 1 1 25.10.06 Biopsychologie als Neurowissenschaft 2 8.11.06 Evolutionäre Grundlagen 3 15.11.06 Genetische Grundlagen 4 22.11.06 Mikroanatomie des NS 5 29.11.06 Makroanatomie des NS: 6 06.12.06 Erregungsleitung
1 1 25.10.06 Biopsychologie als Neurowissenschaft 2 8.11.06 Evolutionäre Grundlagen 3 15.11.06 Genetische Grundlagen 4 22.11.06 Mikroanatomie des NS 5 29.11.06 Makroanatomie des NS: 6 06.12.06 Erregungsleitung
neurologische Grundlagen Version 1.3
 neurologische Version 1.3 ÜBERBLICK: Überblick: Steuersystem des menschlichen Körpers ZNS Gehirn Rückenmark PNS VNS Hirnnerven Sympathicus Spinalnerven Parasympathicus 1 ÜBERBLICK: Neurone = Nervenzellen
neurologische Version 1.3 ÜBERBLICK: Überblick: Steuersystem des menschlichen Körpers ZNS Gehirn Rückenmark PNS VNS Hirnnerven Sympathicus Spinalnerven Parasympathicus 1 ÜBERBLICK: Neurone = Nervenzellen
Narkose. Inhalationsnarkotika Injektionsnarkotika Klassische Narkosestadien (Äthernarkose) T. Griesbacher, 2006.
 arkose Inhalationsnarkotika Injektionsnarkotika T. Klassische arkosestadien (Äthernarkose) Stufen Atmung Verlauf der Reflexe Muskel- Spannung Stufen Bewusstsein diaphragmal thorakal Augenbewegungen Pupillenweite
arkose Inhalationsnarkotika Injektionsnarkotika T. Klassische arkosestadien (Äthernarkose) Stufen Atmung Verlauf der Reflexe Muskel- Spannung Stufen Bewusstsein diaphragmal thorakal Augenbewegungen Pupillenweite
BK07_Vorlesung Physiologie. 05. November 2012
 BK07_Vorlesung Physiologie 05. November 2012 Stichpunkte zur Vorlesung 1 Aktionspotenziale = Spikes Im erregbaren Gewebe werden Informationen in Form von Aktions-potenzialen (Spikes) übertragen Aktionspotenziale
BK07_Vorlesung Physiologie 05. November 2012 Stichpunkte zur Vorlesung 1 Aktionspotenziale = Spikes Im erregbaren Gewebe werden Informationen in Form von Aktions-potenzialen (Spikes) übertragen Aktionspotenziale
Synaptische Übertragung und Neurotransmitter
 Proseminar Chemie der Psyche Synaptische Übertragung und Neurotransmitter Referent: Daniel Richter 1 Überblick Synapsen: - Typen / Arten - Struktur / Aufbau - Grundprinzipien / Prozesse Neurotransmitter:
Proseminar Chemie der Psyche Synaptische Übertragung und Neurotransmitter Referent: Daniel Richter 1 Überblick Synapsen: - Typen / Arten - Struktur / Aufbau - Grundprinzipien / Prozesse Neurotransmitter:
2 Einleitung 2.1 Einführung in die Thematik
 2 Einleitung 2.1 Einführung in die Thematik Ziel der Allgemeinanästhesie ist es, intraoperativ eine Bewusstseinsausschaltung mit dem Verlust der Schmerzempfindung und der Abwehreaktionen zu induzieren.
2 Einleitung 2.1 Einführung in die Thematik Ziel der Allgemeinanästhesie ist es, intraoperativ eine Bewusstseinsausschaltung mit dem Verlust der Schmerzempfindung und der Abwehreaktionen zu induzieren.
GABAa receptor subtypes as neuronal substrates for selective actions of benzodiazepines and general anesthetics
 Research Collection Doctoral Thesis GABAa receptor subtypes as neuronal substrates for selective actions of benzodiazepines and general anesthetics Author(s): Zeller, Anja Publication Date: 2006 Permanent
Research Collection Doctoral Thesis GABAa receptor subtypes as neuronal substrates for selective actions of benzodiazepines and general anesthetics Author(s): Zeller, Anja Publication Date: 2006 Permanent
1.2 Eigenschaften der Narkose. A. Komponenten der Narkose. Grundlagen von Anästhesie und Narkose. C. Klinische Bedeutung
 Unter Narkose (Syn.: Allgemeinanästhesie) versteht man eine zur Durchführung operativer, diagnostischer oder interventioneller Eingriffe pharmakologisch induzierte, reversible Verminderung der Aktivität
Unter Narkose (Syn.: Allgemeinanästhesie) versteht man eine zur Durchführung operativer, diagnostischer oder interventioneller Eingriffe pharmakologisch induzierte, reversible Verminderung der Aktivität
Das Gehirn: Eine Einführung in die Molekulare Neurobiologie. A. Baumann
 Das Gehirn: Eine Einführung in die Molekulare Neurobiologie A. Baumann Das Gehirn Ligandengesteuerte Ionenkanäle Das Gehirn Ligandengesteuerte Kanäle Ligand-gated ion channels LGIC Ionotrope Rezeptoren
Das Gehirn: Eine Einführung in die Molekulare Neurobiologie A. Baumann Das Gehirn Ligandengesteuerte Ionenkanäle Das Gehirn Ligandengesteuerte Kanäle Ligand-gated ion channels LGIC Ionotrope Rezeptoren
Neuronale Signalverarbeitung
 neuronale Signalverarbeitung Institut für Angewandte Mathematik WWU Münster Abschlusspräsentation am 08.07.2008 Übersicht Aufbau einer Nervenzelle Funktionsprinzip einer Nervenzelle Empfang einer Erregung
neuronale Signalverarbeitung Institut für Angewandte Mathematik WWU Münster Abschlusspräsentation am 08.07.2008 Übersicht Aufbau einer Nervenzelle Funktionsprinzip einer Nervenzelle Empfang einer Erregung
Unterschied zwischen aktiver und passiver Signalleitung:
 Unterschied zwischen aktiver und passiver Signalleitung: Passiv: Ein kurzer Stromimpuls wird ohne Zutun der Zellmembran weitergeleitet Nachteil: Signalstärke nimmt schnell ab Aktiv: Die Zellmembran leitet
Unterschied zwischen aktiver und passiver Signalleitung: Passiv: Ein kurzer Stromimpuls wird ohne Zutun der Zellmembran weitergeleitet Nachteil: Signalstärke nimmt schnell ab Aktiv: Die Zellmembran leitet
Epilepsie. ein Vortrag von Cara Leonie Ebert und Max Lehmann
 Epilepsie ein Vortrag von Cara Leonie Ebert und Max Lehmann Inhaltsverzeichnis Definition Epilepsie Unterschiede und Formen Ursachen Exkurs Ionenkanäle Diagnose Das Elektroenzephalogramm (EEG) Therapiemöglichkeiten
Epilepsie ein Vortrag von Cara Leonie Ebert und Max Lehmann Inhaltsverzeichnis Definition Epilepsie Unterschiede und Formen Ursachen Exkurs Ionenkanäle Diagnose Das Elektroenzephalogramm (EEG) Therapiemöglichkeiten
 Abbildungen Schandry, 2006 Quelle: www.ich-bin-einradfahrer.de Abbildungen Schandry, 2006 Informationsvermittlung im Körper Pioniere der Neurowissenschaften: Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Camillo
Abbildungen Schandry, 2006 Quelle: www.ich-bin-einradfahrer.de Abbildungen Schandry, 2006 Informationsvermittlung im Körper Pioniere der Neurowissenschaften: Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Camillo
Analgesie und Narkose im Rettungsdienst. Dr. med. Norman Philipp Hecker
 Analgesie und Narkose im Rettungsdienst Dr. med. Norman Philipp Hecker Ziel Vermittlung von sicheren Kochrezepten zur Analgesie Narkose Analgesie ist eine elementare Hilfeleistung Die beste Schmerztherapie
Analgesie und Narkose im Rettungsdienst Dr. med. Norman Philipp Hecker Ziel Vermittlung von sicheren Kochrezepten zur Analgesie Narkose Analgesie ist eine elementare Hilfeleistung Die beste Schmerztherapie
1 Bau von Nervenzellen
 Neurophysiologie 1 Bau von Nervenzellen Die funktionelle Einheit des Nervensystems bezeichnet man als Nervenzelle. Dendrit Zellkörper = Soma Zelllkern Axon Ranvier scher Schnürring Schwann sche Hüllzelle
Neurophysiologie 1 Bau von Nervenzellen Die funktionelle Einheit des Nervensystems bezeichnet man als Nervenzelle. Dendrit Zellkörper = Soma Zelllkern Axon Ranvier scher Schnürring Schwann sche Hüllzelle
Die Schizophrenie und das Glutamat: Neue Medikamente jenseits vom Dopamin?
 Die Schizophrenie und das Glutamat: Neue Medikamente jenseits vom Dopamin? Prof. Dr. Walter E. Müller Department of Pharmacology Biocentre of the University 60439 Frankfurt / M Die Dopaminhypothese der
Die Schizophrenie und das Glutamat: Neue Medikamente jenseits vom Dopamin? Prof. Dr. Walter E. Müller Department of Pharmacology Biocentre of the University 60439 Frankfurt / M Die Dopaminhypothese der
Weitere Nicht-Opioid-Analgetika
 Analgetika II apl. Prof. Dr. med. A. Lupp Institut für Pharmakologie und Toxikologie Universitätsklinikum Jena Drackendorfer Str. 1, 07747 Jena Tel.: (9)325678 oder -88 e-mail: Amelie.Lupp@med.uni-jena.de
Analgetika II apl. Prof. Dr. med. A. Lupp Institut für Pharmakologie und Toxikologie Universitätsklinikum Jena Drackendorfer Str. 1, 07747 Jena Tel.: (9)325678 oder -88 e-mail: Amelie.Lupp@med.uni-jena.de
Übertragung zwischen einzelnen Nervenzellen: Synapsen
 Übertragung zwischen einzelnen Nervenzellen: Synapsen Kontaktpunkt zwischen zwei Nervenzellen oder zwischen Nervenzelle und Zielzelle (z.b. Muskelfaser) Synapse besteht aus präsynaptischen Anteil (sendendes
Übertragung zwischen einzelnen Nervenzellen: Synapsen Kontaktpunkt zwischen zwei Nervenzellen oder zwischen Nervenzelle und Zielzelle (z.b. Muskelfaser) Synapse besteht aus präsynaptischen Anteil (sendendes
Narkose im Rettungsdienst
 Stephan Uhl Klinik für Anaesthesie und Operative Intensivmedizin Klinikum Passau Narkose, besser Anaesthesie, beschreibt einen reversiblen Zustand der Unempfindlichkeit gegenüber Schmerz und anderen äußeren
Stephan Uhl Klinik für Anaesthesie und Operative Intensivmedizin Klinikum Passau Narkose, besser Anaesthesie, beschreibt einen reversiblen Zustand der Unempfindlichkeit gegenüber Schmerz und anderen äußeren
Passive und aktive elektrische Membraneigenschaften
 Aktionspotential Passive und aktive elektrische Membraneigenschaften V m (mv) 20 Overshoot Aktionspotential (Spike) V m Membran potential 0-20 -40 Anstiegsphase (Depolarisation) aktive Antwort t (ms) Repolarisation
Aktionspotential Passive und aktive elektrische Membraneigenschaften V m (mv) 20 Overshoot Aktionspotential (Spike) V m Membran potential 0-20 -40 Anstiegsphase (Depolarisation) aktive Antwort t (ms) Repolarisation
Psychopharmaka. Physiologische, pharmakologische und pharmakokinetische Grundlagen für ihre klinische Anwendung. Herausgegeben von Werner P.
 Psychopharmaka Physiologische, pharmakologische und pharmakokinetische Grundlagen für ihre klinische Anwendung Herausgegeben von Werner P. Koella Mit Beiträgen von E. Eichenberger, P.L. Herrling, U. Klotz,
Psychopharmaka Physiologische, pharmakologische und pharmakokinetische Grundlagen für ihre klinische Anwendung Herausgegeben von Werner P. Koella Mit Beiträgen von E. Eichenberger, P.L. Herrling, U. Klotz,
Neuronale Grundlagen bei ADHD. (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) Mechanismen der Ritalinwirkung. Dr. Lutz Erik Koch
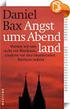 Neuronale Grundlagen bei ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) Mechanismen der Ritalinwirkung Dr. Lutz Erik Koch Die Verschreibung von Ritalin bleibt kontrovers Jeden Tag bekommen Millionen von
Neuronale Grundlagen bei ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) Mechanismen der Ritalinwirkung Dr. Lutz Erik Koch Die Verschreibung von Ritalin bleibt kontrovers Jeden Tag bekommen Millionen von
Myorelaxantien bei Rückenschmerzen Sinn oder Unsinn?
 Myorelaxantien bei Rückenschmerzen Sinn oder Unsinn? SAMM Kongress Interlaken 25.11.2011 11.00-11:20 PD Dr. med. H. R. Ziswiler Bern Realität im Praxisalltag? 35-60% der Patienten mit Rückenschmerz (LBP)
Myorelaxantien bei Rückenschmerzen Sinn oder Unsinn? SAMM Kongress Interlaken 25.11.2011 11.00-11:20 PD Dr. med. H. R. Ziswiler Bern Realität im Praxisalltag? 35-60% der Patienten mit Rückenschmerz (LBP)
Postsynaptische Potenziale
 Postsynaptisches Potenzial Arbeitsblatt Nr 1 Postsynaptische Potenziale Links ist eine Versuchsanordnung zur Messung der Membranpotenziale an verschiedenen Stellen abgebildet. Das Axon links oben wurde
Postsynaptisches Potenzial Arbeitsblatt Nr 1 Postsynaptische Potenziale Links ist eine Versuchsanordnung zur Messung der Membranpotenziale an verschiedenen Stellen abgebildet. Das Axon links oben wurde
Synaptische Transmission
 Synaptische Transmission Wie lösen APe, die an den Endknöpfchen der Axone ankommen, die Freisetzung von Neurotransmittern in den synaptischen Spalt aus (chemische Signalübertragung)? 5 wichtige Aspekte:
Synaptische Transmission Wie lösen APe, die an den Endknöpfchen der Axone ankommen, die Freisetzung von Neurotransmittern in den synaptischen Spalt aus (chemische Signalübertragung)? 5 wichtige Aspekte:
Pharmakokinetik, Teil 3
 Pharmakokinetik, Teil 3 Thomas Schnider 29. März 2016 1 Wirkeintritt Zeit zur maximalen Wirkortkonzentration t peak ist Dosis unabhängig! Nach der Bolusgabe, sinkt die C p und aufgrund des Konzentrationsgradienten
Pharmakokinetik, Teil 3 Thomas Schnider 29. März 2016 1 Wirkeintritt Zeit zur maximalen Wirkortkonzentration t peak ist Dosis unabhängig! Nach der Bolusgabe, sinkt die C p und aufgrund des Konzentrationsgradienten
Pharmakokinetik-Grundlagen, Teil 2
 Pharmakokinetik-Grundlagen, Teil 2 Thomas Schnider 29. März 2016 1 Bisherige Betrachtung: Ein Kompartiment Modell. Ein Kompartiment Modell: Annahmen well stirred Ein Input Eine Elimination (-skonstante)
Pharmakokinetik-Grundlagen, Teil 2 Thomas Schnider 29. März 2016 1 Bisherige Betrachtung: Ein Kompartiment Modell. Ein Kompartiment Modell: Annahmen well stirred Ein Input Eine Elimination (-skonstante)
Übungsfragen, Neuro 1
 Übungsfragen, Neuro 1 Grundlagen der Biologie Iib FS 2012 Auf der jeweils folgenden Folie ist die Lösung markiert. Die meisten Neurone des menschlichen Gehirns sind 1. Sensorische Neurone 2. Motorische
Übungsfragen, Neuro 1 Grundlagen der Biologie Iib FS 2012 Auf der jeweils folgenden Folie ist die Lösung markiert. Die meisten Neurone des menschlichen Gehirns sind 1. Sensorische Neurone 2. Motorische
Narkosemittel aus der Sicht der EAV
 Narkosemittel aus der Sicht der EAV Celler Herbsttagung 1999 Geschichtliches: Am 10. Dezember 1844 besuchte der Zahnarzt H. Wells die Vorstellung einer Wanderbühne in Hartford (Connecticut, USA). Eine
Narkosemittel aus der Sicht der EAV Celler Herbsttagung 1999 Geschichtliches: Am 10. Dezember 1844 besuchte der Zahnarzt H. Wells die Vorstellung einer Wanderbühne in Hartford (Connecticut, USA). Eine
abiweb NEUROBIOLOGIE Abituraufgaben 17. März 2015 Webinar zur Abiturvorbereitung
 abiweb NEUROBIOLOGIE Abituraufgaben 17. März 2015 Webinar zur Abiturvorbereitung Vergleichen Sie die Leitungsgeschwindigkeiten der myelinisierten (blau/ grau) und nicht myelinisierten (helles blau) Nervenbahnen!
abiweb NEUROBIOLOGIE Abituraufgaben 17. März 2015 Webinar zur Abiturvorbereitung Vergleichen Sie die Leitungsgeschwindigkeiten der myelinisierten (blau/ grau) und nicht myelinisierten (helles blau) Nervenbahnen!
abiweb NEUROBIOLOGIE 17. März 2015 Webinar zur Abiturvorbereitung
 abiweb NEUROBIOLOGIE 17. März 2015 Webinar zur Abiturvorbereitung Bau Nervenzelle Neuron (Nervenzelle) Dentrit Zellkörper Axon Synapse Gliazelle (Isolierung) Bau Nervenzelle Bau Nervenzelle Neurobiologie
abiweb NEUROBIOLOGIE 17. März 2015 Webinar zur Abiturvorbereitung Bau Nervenzelle Neuron (Nervenzelle) Dentrit Zellkörper Axon Synapse Gliazelle (Isolierung) Bau Nervenzelle Bau Nervenzelle Neurobiologie
Das Ruhemembranpotential eines Neurons
 Das Ruhemembranpotential eines Neurons Genaueres zu den 4 Faktoren: Faktor 1: Die so genannte Brown sche Molekularbewegung sorgt dafür, dass sich Ionen (so wie alle Materie!) ständig zufällig bewegen!
Das Ruhemembranpotential eines Neurons Genaueres zu den 4 Faktoren: Faktor 1: Die so genannte Brown sche Molekularbewegung sorgt dafür, dass sich Ionen (so wie alle Materie!) ständig zufällig bewegen!
Frankfurter Referierabend 4/2013 (Tacke) 1
 Dämpfung von Atmung Kreislauf O 2 Aufnahme CO 2 Abgabe O 2 Transport zur Zelle CO 2 Transport zur Lunge Frankfurter Referierabend 4/2013 (2) Frankfurter Referierabend 4/2013 (Tacke) 1 Eine Narkose ohne
Dämpfung von Atmung Kreislauf O 2 Aufnahme CO 2 Abgabe O 2 Transport zur Zelle CO 2 Transport zur Lunge Frankfurter Referierabend 4/2013 (2) Frankfurter Referierabend 4/2013 (Tacke) 1 Eine Narkose ohne
Pathophysiologie des chronischen Schmerzes
 Pathophysiologie des chronischen Schmerzes H.O. H.O. Handwerker Pörtschach 25.06.2018 Berlin, 09.03.2018 90% der Patienten im organisierten Notdienst haben Rücken. Und davon 90% erwarten eine Spritze:
Pathophysiologie des chronischen Schmerzes H.O. H.O. Handwerker Pörtschach 25.06.2018 Berlin, 09.03.2018 90% der Patienten im organisierten Notdienst haben Rücken. Und davon 90% erwarten eine Spritze:
M 3. Informationsübermittlung im Körper. D i e N e r v e n z e l l e a l s B a s i s e i n h e i t. im Überblick
 M 3 Informationsübermittlung im Körper D i e N e r v e n z e l l e a l s B a s i s e i n h e i t im Überblick Beabeablog 2010 N e r v e n z e l l e n ( = Neurone ) sind auf die Weiterleitung von Informationen
M 3 Informationsübermittlung im Körper D i e N e r v e n z e l l e a l s B a s i s e i n h e i t im Überblick Beabeablog 2010 N e r v e n z e l l e n ( = Neurone ) sind auf die Weiterleitung von Informationen
Pharmakologie des Zentralen Nervensystems 2: Hypnotika, Anästhetika, Antiepileptika
 Pharmakologie des Zentralen Nervensystems 2: Hypnotika, Anästhetika, Antiepileptika Ralf Stumm Institut für Pharmakologie und Toxikologie Drackendorfer Straße 1 07747 Jena 03641 9 325680 Ralf.Stumm@med.uni-jena.de
Pharmakologie des Zentralen Nervensystems 2: Hypnotika, Anästhetika, Antiepileptika Ralf Stumm Institut für Pharmakologie und Toxikologie Drackendorfer Straße 1 07747 Jena 03641 9 325680 Ralf.Stumm@med.uni-jena.de
Inhaltsfeld: IF 4: Neurobiologie
 Unterrichtsvorhaben IV: Thema/Kontext: Molekulare und zellbiologische Grundlagen der neuronalen Informationsverarbeitung Wie ist das Nervensystem Menschen aufgebaut und wie ist organisiert? Inhaltsfeld:
Unterrichtsvorhaben IV: Thema/Kontext: Molekulare und zellbiologische Grundlagen der neuronalen Informationsverarbeitung Wie ist das Nervensystem Menschen aufgebaut und wie ist organisiert? Inhaltsfeld:
Scriptum Anästhesie Teil I.1 Wie funktioniert Anästhesie? Molekulare Mechanismen von Narkose und Lokalanästhesie Vs. 0.1
 Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin Medizinische Fakultät Mannheim der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Scriptum Anästhesie 2012 Teil I.1 Wie funktioniert Anästhesie? Molekulare
Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin Medizinische Fakultät Mannheim der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Scriptum Anästhesie 2012 Teil I.1 Wie funktioniert Anästhesie? Molekulare
Klinische Pharmakologie der Anästhetika. Narkosestadien einer Äthernarkose. Analgesiestadium Exzitationsstadium Toleranzstadium Asphyxiestadium
 Klinische Pharmakologie der Anästhetika Narkosestadien einer Äthernarkose Analgesiestadium Exzitationsstadium Toleranzstadium Asphyxiestadium Anästhesiologisches Gesamtkonzept einer Narkose Eigenschaften
Klinische Pharmakologie der Anästhetika Narkosestadien einer Äthernarkose Analgesiestadium Exzitationsstadium Toleranzstadium Asphyxiestadium Anästhesiologisches Gesamtkonzept einer Narkose Eigenschaften
GEBRAUCHSINFORMATION Isoba, Flüssigkeit zur Herstellung eines Dampfes zur Inhalation 100 % w/w
 GEBRAUCHSINFORMATION, Flüssigkeit zur Herstellung eines Dampfes zur Inhalation 100 % w/w 1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST
GEBRAUCHSINFORMATION, Flüssigkeit zur Herstellung eines Dampfes zur Inhalation 100 % w/w 1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST
Neurale Grundlagen kognitiver Leistungen II
 Neurale Grundlagen kognitiver Leistungen II Inhalt: 1. Lernen und Gedächtnis: Hirnregionen und wichtige Bahnen 2. Aufbau der Hippocampusformation 2.1 Anatomie und Mikroanatomie der Hippocampusformation
Neurale Grundlagen kognitiver Leistungen II Inhalt: 1. Lernen und Gedächtnis: Hirnregionen und wichtige Bahnen 2. Aufbau der Hippocampusformation 2.1 Anatomie und Mikroanatomie der Hippocampusformation
Vom Reiz zum Aktionspotential. Wie kann ein Reiz in ein elektrisches Signal in einem Neuron umgewandelt werden?
 Vom Reiz zum Aktionspotential Wie kann ein Reiz in ein elektrisches Signal in einem Neuron umgewandelt werden? Vom Reiz zum Aktionspotential Primäre Sinneszellen (u.a. in den Sinnesorganen) wandeln den
Vom Reiz zum Aktionspotential Wie kann ein Reiz in ein elektrisches Signal in einem Neuron umgewandelt werden? Vom Reiz zum Aktionspotential Primäre Sinneszellen (u.a. in den Sinnesorganen) wandeln den
Beide bei Thieme ebook
 Beide bei Thieme ebook Neurophysiologie 1) Funktionelle Anatomie 2) Entstehung nervaler Potentiale 3) Erregungsfortleitung 4) Synaptische Übertragung 5) Transmitter und Reflexe 6) Vegetatives Nervensystem
Beide bei Thieme ebook Neurophysiologie 1) Funktionelle Anatomie 2) Entstehung nervaler Potentiale 3) Erregungsfortleitung 4) Synaptische Übertragung 5) Transmitter und Reflexe 6) Vegetatives Nervensystem
Funktionsprinzipien von Synapsen
 17.3.2006 Funktionsprinzipien von Synapsen Andreas Draguhn Aufbau Transmitter und präsynaptische Vesikel Postsynaptische Rezeptoren Funktion einzelner Synapsen Prinzipien der Informationsverarbeitung:
17.3.2006 Funktionsprinzipien von Synapsen Andreas Draguhn Aufbau Transmitter und präsynaptische Vesikel Postsynaptische Rezeptoren Funktion einzelner Synapsen Prinzipien der Informationsverarbeitung:
SEDIERUNG, ANALGESIE UND NARKOSE IN NOTFALLSITUATIONEN
 SEDIERUNG, ANALGESIE UND NARKOSE IN NOTFALLSITUATIONEN Rainer Schmid FA für Anästhesie und Intensivmedizin, Notarzt, LNA OA an der Abt. f. Anästhesie und Intensivmedizin, Wilhelminenspital, Wien LNA, Arbeiter-Samariter-Bund,
SEDIERUNG, ANALGESIE UND NARKOSE IN NOTFALLSITUATIONEN Rainer Schmid FA für Anästhesie und Intensivmedizin, Notarzt, LNA OA an der Abt. f. Anästhesie und Intensivmedizin, Wilhelminenspital, Wien LNA, Arbeiter-Samariter-Bund,
SEDIERUNG, ANALGESIE UND NARKOSE IN NOTFALLSITUATIONEN
 SEDIERUNG, ANALGESIE UND NARKOSE IN NOTFALLSITUATIONEN Rainer Schmid FA für Anästhesie und Intensivmedizin, Notarzt, LNA Abt. f. Anästhesie und Intensivmedizin, Wilhelminenspital, Wien Was ist eigentlich
SEDIERUNG, ANALGESIE UND NARKOSE IN NOTFALLSITUATIONEN Rainer Schmid FA für Anästhesie und Intensivmedizin, Notarzt, LNA Abt. f. Anästhesie und Intensivmedizin, Wilhelminenspital, Wien Was ist eigentlich
Glossar Zur Anästhesie April 2007, J. Henke
 Glossar Zur April 2007, J. Henke Säure BA Buprenorphin Butorphanol Antipyretikum Balancierte Fachbegriff Substanzgruppe Erläuterung Bemerkungen Bevorzugter Einsatz α 2 -Agonist Sedativum Mit relaxierenden
Glossar Zur April 2007, J. Henke Säure BA Buprenorphin Butorphanol Antipyretikum Balancierte Fachbegriff Substanzgruppe Erläuterung Bemerkungen Bevorzugter Einsatz α 2 -Agonist Sedativum Mit relaxierenden
VL.4 Prüfungsfragen:
 VL.4 Prüfungsfragen: 1. Skizzieren Sie eine chemische Synapse mit allen wesentlichen Elementen. 2. Skizzieren Sie eine elektrische Synapse mit allen wesentlichen Elementen. 3. Welche Art der Kommunikation
VL.4 Prüfungsfragen: 1. Skizzieren Sie eine chemische Synapse mit allen wesentlichen Elementen. 2. Skizzieren Sie eine elektrische Synapse mit allen wesentlichen Elementen. 3. Welche Art der Kommunikation
INHALATIONSNARKOTIKA Gase:
 Narkose Historisch: Wells 1845: Stickoxydul Morton 1846: Diäthyläther Simpson 1847: Chloroform 1868: N 2 O+O 2 1929: Cyclopropan 1932/35: Methohexital/Thiopenthal, i.v. Kurznarkose 1940: Muskelrelaxation
Narkose Historisch: Wells 1845: Stickoxydul Morton 1846: Diäthyläther Simpson 1847: Chloroform 1868: N 2 O+O 2 1929: Cyclopropan 1932/35: Methohexital/Thiopenthal, i.v. Kurznarkose 1940: Muskelrelaxation
Epilepsie. Ein Vortrag von Sarah Matingu und Fabienne Brutscher
 Epilepsie Ein Vortrag von Sarah Matingu und Fabienne Brutscher Inhalt Allgemeines Definition Formen der Epilepsie Elektroenzophalografie (EEG) Molekulare Ursachen Genetische Ursachen Ionenkanäle Kandidatengene
Epilepsie Ein Vortrag von Sarah Matingu und Fabienne Brutscher Inhalt Allgemeines Definition Formen der Epilepsie Elektroenzophalografie (EEG) Molekulare Ursachen Genetische Ursachen Ionenkanäle Kandidatengene
Narkotika Allgemein, Inhalationsnarkotika. PD Dr. med. habil. K. Wohlfarth Neurologie
 Narkotika Allgemein, Inhalationsnarkotika PD Dr. med. habil. K. Wohlfarth Neurologie - Mitte des 19. Jahrhund. Beginn mit Chloroform und Diethylether - etwas später auch erste Versuche mit Distickstoffmonoxid
Narkotika Allgemein, Inhalationsnarkotika PD Dr. med. habil. K. Wohlfarth Neurologie - Mitte des 19. Jahrhund. Beginn mit Chloroform und Diethylether - etwas später auch erste Versuche mit Distickstoffmonoxid
Warum hat mein Patient Schmerzen? Hans-Georg Schaible Institut für Physiologie 1/ Neurophysiologie Universität Jena
 Warum hat mein Patient Schmerzen? Hans-Georg Schaible Institut für Physiologie 1/ Neurophysiologie Universität Jena Fragen, die gestellt werden müssen: 1) Wodurch sind die Schmerzen entstanden? Einordnung
Warum hat mein Patient Schmerzen? Hans-Georg Schaible Institut für Physiologie 1/ Neurophysiologie Universität Jena Fragen, die gestellt werden müssen: 1) Wodurch sind die Schmerzen entstanden? Einordnung
ANALGOSEDIERUNG für schmerzhafte Eingriffe in der Kinder- und Jugendheilkunde im stationären Bereich
 ANALGOSEDIERUNG für schmerzhafte Eingriffe in der Kinder- und Jugendheilkunde im stationären Bereich Dr. Barbara Seidel FÄ für Kinder- und Jugendheilkunde an der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde
ANALGOSEDIERUNG für schmerzhafte Eingriffe in der Kinder- und Jugendheilkunde im stationären Bereich Dr. Barbara Seidel FÄ für Kinder- und Jugendheilkunde an der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde
Wirkungsmechanismen von Anästhetika: Beitrag der GABAA- Rezeptoren analysiert durch Punktmutationen von β- Untereinheiten
 Research Collection Doctoral Thesis Wirkungsmechanismen von Anästhetika: Beitrag der GABAA- Rezeptoren analysiert durch Punktmutationen von β- Untereinheiten Author(s): Lambert, Sachar Kurt Publication
Research Collection Doctoral Thesis Wirkungsmechanismen von Anästhetika: Beitrag der GABAA- Rezeptoren analysiert durch Punktmutationen von β- Untereinheiten Author(s): Lambert, Sachar Kurt Publication
Pharmakologie des Zentralen Nervensystems 1: Einführung, Glutamaterges und GABAerges System
 Pharmakologie des Zentralen Nervensystems 1: Einführung, Glutamaterges und GABAerges System Ralf Stumm Institut für Pharmakologie und Toxikologie Drackendorfer Straße 1 07747 Jena 03641 9 325680 Ralf.Stumm@med.uni-jena.de
Pharmakologie des Zentralen Nervensystems 1: Einführung, Glutamaterges und GABAerges System Ralf Stumm Institut für Pharmakologie und Toxikologie Drackendorfer Straße 1 07747 Jena 03641 9 325680 Ralf.Stumm@med.uni-jena.de
Glutamat und Neurotoxizitaet. Narcisse Mokuba WS 18/19
 Glutamat und Neurotoxizitaet Narcisse Mokuba WS 18/19 Gliederung 1.Teil : Glutamat als Botenstoff ; Synthese Glutamat-Rezeptoren : Aufbau & Funktion Signaluebertragung 2.Teil : Bedeutung als Gescmacksverstaerker
Glutamat und Neurotoxizitaet Narcisse Mokuba WS 18/19 Gliederung 1.Teil : Glutamat als Botenstoff ; Synthese Glutamat-Rezeptoren : Aufbau & Funktion Signaluebertragung 2.Teil : Bedeutung als Gescmacksverstaerker
Neurobiologie. Prof. Dr. Bernd Grünewald, Institut für Bienenkunde, FB Biowissenschaften
 Neurobiologie Prof. Dr. Bernd Grünewald, Institut für Bienenkunde, FB Biowissenschaften www.institut-fuer-bienenkunde.de b.gruenewald@bio.uni-frankfurt.de Synapsen II Die postsynaptische Membran - Synapsentypen
Neurobiologie Prof. Dr. Bernd Grünewald, Institut für Bienenkunde, FB Biowissenschaften www.institut-fuer-bienenkunde.de b.gruenewald@bio.uni-frankfurt.de Synapsen II Die postsynaptische Membran - Synapsentypen
Analgesie und Sedierung
 Analgesie und Sedierung Folie Nr. 1 Analgesie und Sedierung Ziele der Analgosedierung Nebenwirkungen und Komplikationen Beurteilung des Analgesiegrades Opiatanalgetika Beurteilung der Sedierungstiefe Ausgewählte
Analgesie und Sedierung Folie Nr. 1 Analgesie und Sedierung Ziele der Analgosedierung Nebenwirkungen und Komplikationen Beurteilung des Analgesiegrades Opiatanalgetika Beurteilung der Sedierungstiefe Ausgewählte
Benzodiazepine. Wirkprofil
 Benzodiazepine Die Benzodiazepine stellen die wichtigste Gruppe innerhalb der Tranquillantien dar. Sie können nach ihrer Wirkdauer eingeteilt werden in: ÿ Lang wirksame Benzodiazepine ÿ Mittellang wirksame
Benzodiazepine Die Benzodiazepine stellen die wichtigste Gruppe innerhalb der Tranquillantien dar. Sie können nach ihrer Wirkdauer eingeteilt werden in: ÿ Lang wirksame Benzodiazepine ÿ Mittellang wirksame
Benzodiazepine. Alprazolam 11-16
 Benzodiazepine Benzodiazepine zeigen folgendes Wirkprofil, dass je nach Substitutionsmuster unterschiedlich ausgeprägt ist. Sie wirken angstlösend (anxiolytisch) muskelrelaxiernd (zentral myotonolytisch)
Benzodiazepine Benzodiazepine zeigen folgendes Wirkprofil, dass je nach Substitutionsmuster unterschiedlich ausgeprägt ist. Sie wirken angstlösend (anxiolytisch) muskelrelaxiernd (zentral myotonolytisch)
Olfaktion. Das Gehirn
 Olfaktion Emotionen und Verhalten Erinnerung Sozialverhalten Aroma Kontrolle der Nahrung Reviermarkierung Partnerwahl Orientierung in der Umwelt Duftstoffwahrnehmung Axel, R. Spektrum der Wissenschaft,
Olfaktion Emotionen und Verhalten Erinnerung Sozialverhalten Aroma Kontrolle der Nahrung Reviermarkierung Partnerwahl Orientierung in der Umwelt Duftstoffwahrnehmung Axel, R. Spektrum der Wissenschaft,
Conotoxine. Von Dominic Hündgen und Evgeni Drobjasko
 Conotoxine Von Dominic Hündgen und Evgeni Drobjasko Inhalt Vorkommen Aufbau/Arten Wirkungsweise Therapie und Nutzen 2 Vorkommen Gruppe von Toxinen aus der Kegelschnecken-Gattung Conus 600 anerkannte Arten
Conotoxine Von Dominic Hündgen und Evgeni Drobjasko Inhalt Vorkommen Aufbau/Arten Wirkungsweise Therapie und Nutzen 2 Vorkommen Gruppe von Toxinen aus der Kegelschnecken-Gattung Conus 600 anerkannte Arten
Opioide in der anästhesiologischen Schmerztherapie Begrüßung
 Begrüßung 08.01.2002 Sebastian Streckbein 1 (1) Struktur des Beitrags (1) Struktur des Beitrags (2) Einführung (3) Opioidrezeptoren und endogene Opioidpeptide (4) Klassifizierung der Opioide nach Rezeptorwirkung
Begrüßung 08.01.2002 Sebastian Streckbein 1 (1) Struktur des Beitrags (1) Struktur des Beitrags (2) Einführung (3) Opioidrezeptoren und endogene Opioidpeptide (4) Klassifizierung der Opioide nach Rezeptorwirkung
Epilepsie. Klinik Physiologie EEG
 Epilepsie Klinik Physiologie EEG Grand mal Anfall (generalisiert tonisch-klonisch) Vorboten: Unruhe, Verstimmung, Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen Aura: Wärmegefühl Geruchs- oder Geschmacksempfindung
Epilepsie Klinik Physiologie EEG Grand mal Anfall (generalisiert tonisch-klonisch) Vorboten: Unruhe, Verstimmung, Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen Aura: Wärmegefühl Geruchs- oder Geschmacksempfindung
Präklinische Narkose
 Indikationen: Akute respiratorische Insuffizienz GCS < 7 (Aspirationsgefahr) Polytrauma SHT Schwerer Schock Stärkste Schmerzzustände Probleme: Unbekannter Patient Instabile Vitalfunktionen Nicht nüchterner
Indikationen: Akute respiratorische Insuffizienz GCS < 7 (Aspirationsgefahr) Polytrauma SHT Schwerer Schock Stärkste Schmerzzustände Probleme: Unbekannter Patient Instabile Vitalfunktionen Nicht nüchterner
LERNFELD 5 Endodontische Behandlungen begleiten
 LERNFELD 5 Endodontische Behandlungen begleiten 02 Die Anästhesie Die Schmerzausschaltung Die Anästhesie Als Anästhesie bezeichnet man eine Unempfindlichkeit gegen Schmerz-, Temperatur- und Berührungsreize,
LERNFELD 5 Endodontische Behandlungen begleiten 02 Die Anästhesie Die Schmerzausschaltung Die Anästhesie Als Anästhesie bezeichnet man eine Unempfindlichkeit gegen Schmerz-, Temperatur- und Berührungsreize,
Dynamische Systeme in der Biologie: Beispiel Neurobiologie
 Dynamische Systeme in der Biologie: Beispiel Neurobiologie Dr. Caroline Geisler geisler@lmu.de April 11, 2018 Veranstaltungszeiten und -räume Mittwoch 13:00-14:30 G00.031 Vorlesung Mittwoch 15:00-16:30
Dynamische Systeme in der Biologie: Beispiel Neurobiologie Dr. Caroline Geisler geisler@lmu.de April 11, 2018 Veranstaltungszeiten und -räume Mittwoch 13:00-14:30 G00.031 Vorlesung Mittwoch 15:00-16:30
Dynamische Systeme in der Biologie: Beispiel Neurobiologie
 Dynamische Systeme in der Biologie: Beispiel Neurobiologie Caroline Geisler geisler@lmu.de April 18, 2018 Elektrische Ersatzschaltkreise und Messmethoden Wiederholung: Membranpotential Exkursion in die
Dynamische Systeme in der Biologie: Beispiel Neurobiologie Caroline Geisler geisler@lmu.de April 18, 2018 Elektrische Ersatzschaltkreise und Messmethoden Wiederholung: Membranpotential Exkursion in die
Kommentar SERT-Cocain, GABA-A-Ethanol, 5-HT2-LSD, NMDA-PCP und Ketamin, AMPA? Welches der folgenden Symptome weist auf Heroinvergiftung hin?
 Suchtmitel Was ist der molekulare Angriffspunkt für Phencyclidin? A) Serotonintransporter B) GABA-A Rezeptoren C) 5-HT2 Rezeptoren D) NMDA Rezeptoren E) AMPA Rezeptoren SERT-Cocain, GABA-A-Ethanol, 5-HT2-LSD,
Suchtmitel Was ist der molekulare Angriffspunkt für Phencyclidin? A) Serotonintransporter B) GABA-A Rezeptoren C) 5-HT2 Rezeptoren D) NMDA Rezeptoren E) AMPA Rezeptoren SERT-Cocain, GABA-A-Ethanol, 5-HT2-LSD,
Glutamat und Neurotoxizität
 Glutamat und Neurotoxizität Elizaveta Polishchuk; Lea Vohwinkel Januar 2016 Inhalt 1. Welche Glutamat-Rezeptoren gibt es im Gehirn? 2. Wie sind die Rezeptoren aufgebaut? 3. Funktion der Glutamatrezeptoren
Glutamat und Neurotoxizität Elizaveta Polishchuk; Lea Vohwinkel Januar 2016 Inhalt 1. Welche Glutamat-Rezeptoren gibt es im Gehirn? 2. Wie sind die Rezeptoren aufgebaut? 3. Funktion der Glutamatrezeptoren
Peter Walla. Die Hauptstrukturen des Gehirns
 Die Hauptstrukturen des Gehirns Die Hauptstrukturen des Gehirns Biologische Psychologie I Kapitel 4 Nervenleitung und synaptische Übertragung Nervenleitung und synaptische Übertragung Wie werden Nervensignale
Die Hauptstrukturen des Gehirns Die Hauptstrukturen des Gehirns Biologische Psychologie I Kapitel 4 Nervenleitung und synaptische Übertragung Nervenleitung und synaptische Übertragung Wie werden Nervensignale
1. Kommunikation Informationsweiterleitung und -verarbeitung
 1. Kommunikation Informationsweiterleitung und -verarbeitung Sinnesorgane, Nervenzellen, Rückenmark, Gehirn, Muskeln und Drüsen schaffen die Grundlage um Informationen aus der Umgebung aufnehmen, weiterleiten,
1. Kommunikation Informationsweiterleitung und -verarbeitung Sinnesorgane, Nervenzellen, Rückenmark, Gehirn, Muskeln und Drüsen schaffen die Grundlage um Informationen aus der Umgebung aufnehmen, weiterleiten,
Inhaltsfeld: IF 4: Neurobiologie
 Unterrichtsvorhaben IV (Grundkurs): Thema/Kontext: Molekulare und zellbiologische Grundlagen der Informationsverarbeitung und Wahrnehmung Wie wird aus einer durch einen Reiz ausgelösten Erregung eine Wahrnehmung?
Unterrichtsvorhaben IV (Grundkurs): Thema/Kontext: Molekulare und zellbiologische Grundlagen der Informationsverarbeitung und Wahrnehmung Wie wird aus einer durch einen Reiz ausgelösten Erregung eine Wahrnehmung?
Schematische Übersicht über das Nervensystem eines Vertebraten
 Schematische Übersicht über das Nervensystem eines Vertebraten Die Integration des sensorischen Eingangs und motorischen Ausgangs erfolgt weder stereotyp noch linear; sie ist vielmehr durch eine kontinuierliche
Schematische Übersicht über das Nervensystem eines Vertebraten Die Integration des sensorischen Eingangs und motorischen Ausgangs erfolgt weder stereotyp noch linear; sie ist vielmehr durch eine kontinuierliche
Lokalanästhetika und Narkotika
 Inhalationsnarkose Vorlesung Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie SS 2008 Injektionsnarkose Leitungsanästhesie Infiltrationsanästhesie Dr. Urs Christen Pharmazentrum, JWG Universität http://www.urschristen.homepage.t-online.de/
Inhalationsnarkose Vorlesung Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie SS 2008 Injektionsnarkose Leitungsanästhesie Infiltrationsanästhesie Dr. Urs Christen Pharmazentrum, JWG Universität http://www.urschristen.homepage.t-online.de/
AnaConDa. Inhalative Analgosedierung als Alternative auf der Intensivstation? Frank Feick :57 1
 AnaConDa Inhalative Analgosedierung als Alternative auf der Intensivstation? Frank Feick 22.12.2013 10:57 1 Übersicht 1. Was ist AnaConDa? 2. Indikation und Kontraindikationen 3. Vorteile der inhalativen
AnaConDa Inhalative Analgosedierung als Alternative auf der Intensivstation? Frank Feick 22.12.2013 10:57 1 Übersicht 1. Was ist AnaConDa? 2. Indikation und Kontraindikationen 3. Vorteile der inhalativen
Die Entwicklung der Gefühle: Aspekte aus der Hirnforschung. Andreas Lüthi, Friedrich Miescher Institut, Basel
 Die Entwicklung der Gefühle: Aspekte aus der Hirnforschung Andreas Lüthi, Friedrich Miescher Institut, Basel Wie lernen wir Angst zu haben? Wie kann das Gehirn die Angst wieder loswerden? Angst und Entwicklung
Die Entwicklung der Gefühle: Aspekte aus der Hirnforschung Andreas Lüthi, Friedrich Miescher Institut, Basel Wie lernen wir Angst zu haben? Wie kann das Gehirn die Angst wieder loswerden? Angst und Entwicklung
Epilepsie. im Rahmen der Vorlesung: molekulare Ursachen neuronaler Krankheiten. von Dustin Spyra und Tatjana Linnik
 im Rahmen der Vorlesung: molekulare Ursachen neuronaler Krankheiten von Dustin Spyra und Tatjana Linnik Definition - Angriff/Überfall - Anfallsleiden wiederkehrend unvorhersehbar -langfristige Veränderung
im Rahmen der Vorlesung: molekulare Ursachen neuronaler Krankheiten von Dustin Spyra und Tatjana Linnik Definition - Angriff/Überfall - Anfallsleiden wiederkehrend unvorhersehbar -langfristige Veränderung
Übung 6 Vorlesung Bio-Engineering Sommersemester Nervenzellen: Kapitel 4. 1
 Bitte schreiben Sie Ihre Antworten direkt auf das Übungsblatt. Falls Sie mehr Platz brauchen verweisen Sie auf Zusatzblätter. Vergessen Sie Ihren Namen nicht! Abgabe der Übung bis spätestens 21. 04. 08-16:30
Bitte schreiben Sie Ihre Antworten direkt auf das Übungsblatt. Falls Sie mehr Platz brauchen verweisen Sie auf Zusatzblätter. Vergessen Sie Ihren Namen nicht! Abgabe der Übung bis spätestens 21. 04. 08-16:30
Vorlesung: Grundlagen der Neurobiologie (Teil des Grundmoduls Neurobiologie) Synaptische Verbindungen. R. Brandt
 Vorlesung: Grundlagen der Neurobiologie (Teil des Grundmoduls Neurobiologie) Synaptische Verbindungen R. Brandt Synaptische Verbindungen - Synapsen, Dornen und Lernen - Alzheimer Krankheit und Vergessen
Vorlesung: Grundlagen der Neurobiologie (Teil des Grundmoduls Neurobiologie) Synaptische Verbindungen R. Brandt Synaptische Verbindungen - Synapsen, Dornen und Lernen - Alzheimer Krankheit und Vergessen
Wiederholung: Dendriten
 Wiederholung: Dendriten Neurone erhalten am Dendriten und am Zellkörper viele erregende und hemmende Eingangssignale (Spannungsänderungen) Die Signale werden über Dendrit und Zellkörper elektrisch weitergeleitet.
Wiederholung: Dendriten Neurone erhalten am Dendriten und am Zellkörper viele erregende und hemmende Eingangssignale (Spannungsänderungen) Die Signale werden über Dendrit und Zellkörper elektrisch weitergeleitet.
Membranen und Potentiale
 Membranen und Potentiale 1. Einleitung 2. Zellmembran 3. Ionenkanäle 4. Ruhepotential 5. Aktionspotential 6. Methode: Patch-Clamp-Technik Quelle: Thompson Kap. 3, (Pinel Kap. 3) 2. ZELLMEMBRAN Abbildung
Membranen und Potentiale 1. Einleitung 2. Zellmembran 3. Ionenkanäle 4. Ruhepotential 5. Aktionspotential 6. Methode: Patch-Clamp-Technik Quelle: Thompson Kap. 3, (Pinel Kap. 3) 2. ZELLMEMBRAN Abbildung
Schmerz. Schmerzempfindung
 Schmerzempfindung Definition Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- oder Gefühlserlebnis, das mit tatsächlicher oder drohender Gewebeschädigung einhergeht oder von Betroffenen so beschrieben wird, als wäre
Schmerzempfindung Definition Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- oder Gefühlserlebnis, das mit tatsächlicher oder drohender Gewebeschädigung einhergeht oder von Betroffenen so beschrieben wird, als wäre
1. Teil Stoffwechselphysiologie
 A TIERPHYSIOLOGISCHES PRAKTIKUM Martin-Luther-King-Platz KLAUSUR WS 2011/12 D-20146 Hamburg Name:... Matrikel Nr... (Ausweis vorlegen) 0.02.2012 1. Teil Stoffwechselphysiologie Fachbereich Biologie Biozentrum
A TIERPHYSIOLOGISCHES PRAKTIKUM Martin-Luther-King-Platz KLAUSUR WS 2011/12 D-20146 Hamburg Name:... Matrikel Nr... (Ausweis vorlegen) 0.02.2012 1. Teil Stoffwechselphysiologie Fachbereich Biologie Biozentrum
Injektionsnarkotika in der Medizin
 Diplomarbeit Injektionsnarkotika in der Medizin eingereicht von Dr. med. dent. Nikola Adamovic Geb.Dat.: 04.11.1979 zur Erlangung des akademischen Grades Doktor(in) der gesamten Heilkunde (Dr. med. univ.)
Diplomarbeit Injektionsnarkotika in der Medizin eingereicht von Dr. med. dent. Nikola Adamovic Geb.Dat.: 04.11.1979 zur Erlangung des akademischen Grades Doktor(in) der gesamten Heilkunde (Dr. med. univ.)
Neurobiologische Grundlagen einfacher Formen des Lernens
 Professur für Allgemeine Psychologie Vorlesung im WS 2011/12 Lernen und Gedächtnis Neurobiologische Grundlagen einfacher Formen des Lernens Prof. Dr. Thomas Goschke Neurowissenschaftliche Gedächtnisforschung
Professur für Allgemeine Psychologie Vorlesung im WS 2011/12 Lernen und Gedächtnis Neurobiologische Grundlagen einfacher Formen des Lernens Prof. Dr. Thomas Goschke Neurowissenschaftliche Gedächtnisforschung
Die Wirkungsmechanismus und die Pharmakologie der Lokalanästhetika. Dr. Noémi Kovács
 Die Wirkungsmechanismus und die Pharmakologie der Lokalanästhetika. Dr. Noémi Kovács Lokalanästhetikum Präparate = 1. Chemisches Anästhetikum +Puffersystem 2. Vasopressor +Stabilisatoren 3. Konzervierungsmittel
Die Wirkungsmechanismus und die Pharmakologie der Lokalanästhetika. Dr. Noémi Kovács Lokalanästhetikum Präparate = 1. Chemisches Anästhetikum +Puffersystem 2. Vasopressor +Stabilisatoren 3. Konzervierungsmittel
Physiologische Grundlagen. Inhalt
 Physiologische Grundlagen Inhalt Das Ruhemembranpotential - RMP Das Aktionspotential - AP Die Alles - oder - Nichts - Regel Die Klassifizierung der Nervenfasern Das Ruhemembranpotential der Zelle RMP Zwischen
Physiologische Grundlagen Inhalt Das Ruhemembranpotential - RMP Das Aktionspotential - AP Die Alles - oder - Nichts - Regel Die Klassifizierung der Nervenfasern Das Ruhemembranpotential der Zelle RMP Zwischen
Synaptische Verbindungen - Alzheimer
 Vorlesung: Grundlagen der Neurobiologie (Teil des Grundmoduls Neurobiologie) Synaptische Verbindungen - Alzheimer R. Brandt (Email: brandt@biologie.uni-osnabrueck.de) Synaptische Verbindungen - Synapsen,
Vorlesung: Grundlagen der Neurobiologie (Teil des Grundmoduls Neurobiologie) Synaptische Verbindungen - Alzheimer R. Brandt (Email: brandt@biologie.uni-osnabrueck.de) Synaptische Verbindungen - Synapsen,
Transmitterstoff erforderlich. und Tremor. Potenziale bewirken die Erregungsübertragung zwischen den Nervenzellen. Begriffen
 4 Kapitel 2 Nervensystem 2 Nervensystem Neurophysiologische Grundlagen 2.1 Bitte ergänzen Sie den folgenden Text mit den unten aufgeführten Begriffen Das Nervensystem besteht aus 2 Komponenten, dem und
4 Kapitel 2 Nervensystem 2 Nervensystem Neurophysiologische Grundlagen 2.1 Bitte ergänzen Sie den folgenden Text mit den unten aufgeführten Begriffen Das Nervensystem besteht aus 2 Komponenten, dem und
Second Messenger keine camp, cgmp, Phospholipidhydrolyse (Prozess) Aminosäuren (Glutamat, Aspartat; GABA, Glycin),
 Neurotransmitter 1. Einleitung 2. Unterscheidung schneller und langsamer Neurotransmitter 3. Schnelle Neurotransmitter 4. Acetylcholin schneller und langsamer Neurotransmitter 5. Langsame Neurotransmitter
Neurotransmitter 1. Einleitung 2. Unterscheidung schneller und langsamer Neurotransmitter 3. Schnelle Neurotransmitter 4. Acetylcholin schneller und langsamer Neurotransmitter 5. Langsame Neurotransmitter
Herzlich willkommen! Sucht und Gehirn 17. Jan. 2007. PD Dr. Bernd Grünewald PD Dr. Petra Skiebe-Corrette
 Herzlich willkommen! Sucht und Gehirn 17. Jan. 2007 PD Dr. Bernd Grünewald PD Dr. Petra Skiebe-Corrette Wie wirken Drogen im Gehirn? http://www.gfs-ebs.de/index.htm PD Dr. Bernd Grünewald Institut für
Herzlich willkommen! Sucht und Gehirn 17. Jan. 2007 PD Dr. Bernd Grünewald PD Dr. Petra Skiebe-Corrette Wie wirken Drogen im Gehirn? http://www.gfs-ebs.de/index.htm PD Dr. Bernd Grünewald Institut für
