Grundlagen Volkswirtschaftslehre: Schwerpunkt Umweltökonomie Dr. Robert Tichler
|
|
|
- Louisa Schubert
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Grundlagen Volkswirtschaftslehre: Schwerpunkt Umweltökonomie Dr. Robert Tichler Universitätslehrgang "Energiemanagement" 1
2 Inhalte Einleitung Definition von Umweltökonomie Bedeutung von Umweltökonomie Wohlfahrtsökonomie Messung des Wohlfahrtsniveaus Theoretisches Wohlfahrtsoptimum Nachhaltigkeit Environmental Kuznets Curve Ressourcenökonomie Exkurs: Hauptparameter in Rohölpreisvolatilität 2008 Externalitäten Staatliche Lösungen für Externalitäten Problem bestehender Regulierungen von Externalitäten Anforderungen an umweltpolitische Instrumente Vorhandene Umweltabgaben in Österreich 2
3 Umweltökonomie eine Einordnung Umweltökonomie ist eine Teildisziplin der Volkswirtschaftslehre. (Energiepolitik ist ein Teilbereich der Politik: Bestandteil der Wirtschaftspolitik mit Querverbindungen zur Umwelt- und Klimapolitik sowie zur Entwicklungs-, Verkehrs-, Sozial- und Technologiepolitik ) In diesem Kurs des Lehrgangs erfolgt in einem theoretischem Zugang die Darstellung der grundlegenden Paradigmen, Maßnahmen und Theorien der Umweltökonomie. Aufgrund der Tatsache, dass Energiepolitik stark von umweltökonomischen / wohlfahrtsökonomischen / ressourcenökonomischen Theorien und Maßnahmen beeinflusst wird, wird in diesem Kurs ein Konnex hergestellt. 3
4 Umweltökonomie und Wohlfahrtsökonomie Umweltökonomie steht in starker Interdependenz zur Wohlfahrtsökonomie dadurch wird eine generelle Einordnung der umweltpolitischer Maßnahme möglich bzw. erleichtert Aus diesem Grund wird in diesem Kurs sowohl Umweltökonomie als auch und Wohlfahrtsökonomie diskutiert bzw. erörtert. Beide Disziplinen sind stark in der sogenannten Finanzwissenschaft verankert. Finanzwissenschaft: wirtschaftlichen Aspekte der öffentlichen Haushalte ökonomische Analyse der öffentlichen Wirtschaftstätigkeit 4
5 Definition von Umweltökonomie Umweltökonomie: Wirtschaftswissenschaft, die in ihren Theorien, Analysen und Kostenrechnungen ökologische Parameter miteinbezieht 2 grundlegende Formen der Umweltökonomie: Betriebliche Umweltökonomie Volkswirtschaftliche Umweltökonomie (neoklassische vs. Ökologische Umweltökonomie) betriebliche Umweltökonomie (nicht im Fokus dieses Kurses): Disziplin der BWL, die die Beziehungen des Betriebes zu dessen natürlicher Umwelt sowie die Einwirkungen der Umwelt und deren Qualität sowie der Umweltpolitik auf den Betrieb darstellt und analysiert. Gewinnmaximierung des Betriebes berücksichtigt die ökologischen Erfordernisse des Marktes und der gegebenen Regulierungen 5
6 Definition von Umweltökonomie Volkswirtschaftliche Umweltökonomie (im Fokus dieses Kurses): klassische Disziplin der Umweltökonomie Zielsetzung: Realisierung einer optimalen Allokation der natürlichen Ressourcen Wirtschaftswissenschaft, die insbesondere mit wohlfahrts- und finanzwissenschaftlichen Methoden das gesamtgesellschaftliche Wohlfahrtsniveau unter besonderer Berücksichtigung der Umweltqualität analysiert und im Optimalzustand maximiert. relativ junge Teildisziplin der Volkswirtschaftslehre grundlegende Fragestellungen der Umweltökonomie: Bewertung/Monetarisierung von Veränderungen der Umweltqualität Analyse der umweltpolitischen Instrumente Analyse der Zusammenhänge bzw. des Konfliktes zwischen umweltökonomischen und rein-wirtschaftlichen Zielen 6
7 Definition von Umweltökonomie Neoklassische vs. Ökologische Umweltökonomie: 2 differente Grundparadigmen in der Umweltökonomie Neoklassiche Umweltökonomie (environmental economics) Fokus: anthropogenes Handeln, individuelle Präferenzen des Menschen (Nutzenfunktion: [U i (x 1,x 2,.)]) Grundlegende Annahme: rationales Handeln Umwelt ist ein Gut des gesamten Güterbündels Substitutionsprinzip: Güter und Bedürfnisse können substituiert werden Angebot und Nachfrage führen auch für das Gut Umwelt zu einem Preis; es existiert allerdings Marktversagen (Notwendigkeit der Korrektur); Individuelle Nutzenfunktion (U i ) definieren den Wert des Gutes Umwelt relative Ressourcenknappheit (backstop-technologien) 7
8 Definition von Umweltökonomie ökologische Umweltökonomie (ecological economics) basiert auf Naturwissenschaften, relativ neues Grundparadigma Umwelt basiert auf komplexen Zusammenhängen (keine eindimensionale Relation von Ursache und Wirkung) langfristigen Effekte sind nicht quantifizierbar (unbekannte Größen; black boxes ) keine Existenz von neoklassischen Gleichgewichten (Angebot / Nachfrage) Ablehnung einer monetären Bewertung; kein Erklärungsansatz für menschliches Verhalten Umwelt ist nicht substituierbar und nicht teilbar; Ablehnung des intertemporalen Ansatzes (absolute Ressourcenverknappung) 8
9 Definition von Umweltökonomie Neoklassische vs. Ökologische Umweltökonomie: Argumente für neoklassischen Ansatz: Instrumentarium für Kosten-/Nutzenanalyse, Möglichkeit der Bewertung der Umweltqualität Möglichkeit der monetären Bewertung ermöglicht Einschätzung der Veränderungen und somit auch realpolitische Relevanz und Operationalität (höhere Akzeptanz des Ansatzes) Möglichkeit der Einbindung der Umweltökonomie in die klassische Volkswirtschaftslehre Konsequenz: im Fokus des Lehrgangs steht neoklassische Umweltökonomie 9
10 Bedeutung von Umweltökonomie Umweltökonomische und umweltpolitische Problemstellungen sind vor allem im wohlfahrtsökonomischen Zusammenhang von Bedeutung dafür ist ein Exkurs zu den wohlfahrtstheoretischen Grundlagen notwendig Wohlfahrt Wohlstand: Wohlstand beinhaltet die quantitativ messbaren Parameter der Wohlfahrt (Einkommen, Vermögen, ) Wohlfahrt umfasst auch immaterielle Komponenten, die durch soziale und ökologische Indikatoren erfasst werden (Umweltqualität, Gesundheitszustand, Zufriedenheit am Arbeitsplatz, ) Eine Zunahme des Wohlstandsniveaus kann mit der Abnahme des Wohlfahrtsniveaus verbunden sein (z.b. leicht erhöhtes Wirtschaftswachstum, stark gesunkene Umweltqualität) 10
11 Messung des Wohlfahrtsniveaus gängiger Wohlfahrtsindikator : Bruttoinlandsprodukt (BIP) stellt das BIP wirklich eine umfassende Messung des Wohlfahrtsniveaus einer Volkswirtschaft dar? BIP = C + I + X M + G t BIP C I X M G t t t t t t Bruttoinlandsprodukt privater Konsum Investitionen Exporte Importe Staatsausgaben (öffentliche Ausgaben) Jahr Einkommensverteilung? Umweltqualität? Gerechtigkeit? diverse Versuche, einen alternativen Wohlfahrtsindikator zum Bruttoinlandsprodukt zu generieren, der zusätzliche soziale, ökologische und ökonomische Parameter enthält 11
12 Messung des Wohlfahrtsniveaus Differenzen von ISEW und BIP in Österreich von 1955 bis 1992 nach Stockhammer et al. (1997) ISEW: Index for Sustainable Economic Welfare Als Gründe für den steigenden Gap werden insbesondere zunehmende Umweltschäden sowie eine zunehmend asymmetrische Einkommensverteilung angeführt. 12
13 Messung des Wohlfahrtsniveaus alternative Wohlfahrtsindikatoren: Genuine Progress Indicator (GPI) Index for Sustainable Economic Welfare (ISEW) Ecological Footprint Bruttonationalglück Happy Planet Index komplexe und aufwendige Berechnungsmethoden nicht durchgesetzt im volkswirtschaftlichen Diskurs Österreich: ISEW z.b. nur bis 1992 Hauptproblem: spiegelt die Festlegung auf bestimmte zusätzlich zu integrierende Parameter eine objektive Wohlfahrtsmessung wieder? Wieso existiert kein eindeutiger Wohlfahrtsindikator? 13
14 Messung des Wohlfahrtsniveaus Beispiel Bruttonationalglück Ansatz in Bhutan Materielle, kulturelle, spirituelle Komponenten Frage: wer definiert objektiv die Parameter des Glücks? Beispiel Happy Planet Index: Berechnung: ((durchschnittliche Lebenserwartung) x (Lebenszufriedenheit)) / (Ökologischer Fußabdruck) Ökol. Fußabdruck: Fläche, die notwendig ist, um den Lebensstandard eines Menschen dauerhaft zu ermöglichen Happy Planet Index: höchster Wert in Europa in Albanien, weil: Flächenbedarf (Ökol. Fußabdruck) sehr niedrig, obwohl Albaner in Relation eine sehr geringe Lebenszufriedenheit aufweisen 14
15 Theoretisches Wohlfahrtsoptimum Kann man ein Wohlfahrtsoptimum bzw. -verbesserungen eigentlich theoretisch definieren? Welche Bedingungen müssen in einem Markt erfüllt sein, um ein wohlfahrtsökonomisches Optimum durch die Nutzung der knappen Ressourcen zu generieren? Als zentrale Ausgangslage hierfür dient das Effizienzkriterium der Pareto- Optimalität. Pareto-Optimalität: Zustand, in dem kein Individuum durch Änderung der Allokation besser gestellt werden kann ohne ein anderes Individuum schlechter zu stellen Es können keine Wohlfahrtsverbesserungen durch Reallokation der Ressourcen mehr erreicht werden. 15
16 Theoretisches Wohlfahrtsoptimum Pareto-ineffizienter Zustand bzw. Allokation: es ist eine Alternative vorhanden, die jemanden besser stellt ohne jemand anderen schlechter zu stellen Beispiel: Es existieren 2 verschiedene Häuser, Typ A und Typ B, alle Häuser werden nach dem Zufallsprinzip zugewiesen. Person X erhält Typ A, sie misst dem Haus einen Wert von 200 bei. Person Y erhält Typ B. Person Y ist bereit, 300 für das Haus A von Person X zu bezahlen. Der Tausch wird abgeschlossen, alle freiwilligen Tauschgeschäfte sind durchgeführt, alle Tauschgewinne ausgeschöpft. Die Allokation ist somit Pareto-optimal, es kann keine Allokation mehr gefunden werden, die jemanden besser stellt, ohne jemand anderen schlechter zu stellen. 16
17 Theoretisches Wohlfahrtsoptimum erstes Wohlfahrtstheorem: Jedes Marktgleichgewicht (jede Allokation) ist Pareto-optimal; wenn alle Eigentumsrechte definiert sind, die Marktsubjekte (Konsumenten, Unternehmen) sich rational verhalten (Nutzenmaximierung der Konsumenten, Gewinnmaximierung der Unternehmen), der Markt und seine Preise transparent sind, keine externen Effekte und keine öffentlichen Güter vorhanden sind und keine Transaktionskosten vorliegen. 17
18 Theoretisches Wohlfahrtsoptimum Problem 1: im Allgemeinen kann eine Vielzahl von Pareto-optimalen Zuständen identifiziert werden (Pareto-Prinzip offeriert kein Kriterium der Reihung von Pareto-optimalen Zuständen). Problem 2: Durch das Pareto-Kriterium kann kein Rückschluss auf eine Präferenz bzw. Rangordnung der Pareto-optimalen Zustände getroffen werden, sodass keine eindeutige wohlfahrtsökonomische Bewertung möglich ist. Es erweist sich als notwendig, die soziale Präferenz der Gesellschaft zwischen verschiedenen Pareto-optimalen Zuständen zu kennen und das Optimum unter den Pareto-optimalen Zuständen identifizieren bzw. analysieren zu können. Pareto-Effizienz bezieht sich auf die individuellen Wohlfahrtsniveaus und nicht auf die Relation der Wohlfahrtsniveaus der einzelnen Individuen 18
19 Theoretisches Wohlfahrtsoptimum Demzufolge ist es erforderlich, eine gesellschaftliche (= soziale) Wohlfahrtsfunktion aufzustellen, die den Aspekt der Einkommensverteilung inkludiert und dennoch die Nutzenniveaus der einzelnen Individuen berücksichtigt. Lösung: soziale Wohlfahrtsfunktion neues Problem: Ausprägung der sozialen Wohlfahrtsfunktion; wie individuellen Nutzenniveaus aggregiert? werden die Da bestimmte Bewertungskriterien zur Vergleichbarkeit von bestimmten Wohlfahrtsniveaus definiert werden müssen, ist die Ausgestaltung der Funktion an sich immer mit einer Subjektivität aufgrund der notwendigen Definition der Bewertungskriterien verbunden: Die Gestalt der Wohlfahrtsfunktion ist dabei Ausdruck außerökonomisch vorgegebener Wertsetzungen. (Giersch, 1993) 19
20 Theoretisches Wohlfahrtsoptimum Die soziale Wohlfahrtsfunktion impliziert nicht automatisch eine eindimensionale Aggregation von individuellen Präferenzen und individuellen Nutzenniveaus: W Rawlsche Wohlfahrtsfunktion: W = min ( v 1,..., v H ) h Utilitaritische Wohlfahrtsfunktion: = h v h intermediate social welfare function : W = h ( v h ) υ 1/ υ W soziale Wohlfahrtsniveau v Nutzenniveau eines Haushalts h Haushalt (h = 1,,H) υ Ungleichheits-Aversion Eine eindeutige Bestimmung des gesamtgesellschaftlich optimalen Wohlfahrtsniveaus ist daher nicht möglich. Zudem kennen wir die individuellen Nutzenfunktionen nicht (wie ist z.b. der Parameter Umweltqualität enthalten???) 20
21 Subjektivität der Messung des Wohlfahrtsniveaus Konsequenz: Die bereits theoretisch diffizile und ohne subjektiven Eingriff nicht durchführbare Identifikation eines sogenannten Optimum Optimorum lässt auch die Problematik erkennen, auf realen Märkten ein allgemein akzeptiertes soziales Wohlfahrtsoptimum zu identifizieren und danach zu streben. Die Unmöglichkeit einer eindeutigen Bestimmung der Präferenzen der Gesellschaft durch die Ableitung der Präferenzen der Individuen wird im Arrow-Unmöglichkeitstheorem festgehalten. (Entsprechen alle sozialen Reihungen die Reihungen eines Individuums, so muss es sich um eine Diktatur handeln). Dies impliziert auch einen grundlegenden Konflikt zwischen Umwelt-relevanten Variablen und ökonomischen Variablen, der auch auf Basis der Wohlfahrtsökonomie nicht zu einem objektiven/eindeutigen Optimalzustand des Marktes führen kann 21
22 Exkurs Wie definieren Sie persönlich Nachhaltigkeit? Neue Frage wie definieren Sie smart? 22
23 Exkurs: Nachhaltigkeit In der Literatur existieren eine Reihe von Definitionen, sodass der Begriff mittlerweile inflationär gebraucht wird: A temptation when writing on defining sustainability is to try to distill, from the myriad debates, a single definition which commands the widest possible academic consent. However, several years spent in fitful pursuit of this goal have finally persuaded me that it is an alchemist s dream, no more likely to be found than an elixir to prolong life indefinitely. (Pezzey, 1997) Neuer energiepolitischer Trend: smart Steigerung von nachhaltig? 23
24 Exkurs: Nachhaltigkeit Brundtlandt-Report (1987) der Vereinten Nationen (Weltkommission für Umwelt und Entwicklung (WCED = World Commission on Environment and Development)): Sustainability = [ ] development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. (UN, 1987) Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftigegenerationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können wurde der sogenannte Brundtland-Report veröffentlicht. Er beeinflusste die Debatte über internationale Umweltpolitik. Der Report wurde auf den internationalen Konferenzen in London (1987) und in Mailand (1988) diskutiert und gilt als auslösender Faktor für die Umweltkonferenz in Rio de Janeiro
25 Exkurs: Nachhaltigkeit Zwei wesentliche ökonomische Positionen: Neoklassische Umweltökonomie (environmental economics) schwache Nachhaltigkeit Natürliches und anthropogenes Kapital sind substituierbar. Wenn der natürliche Kapitalstock abgebaut wird, muss dafür der anthropogene Kapitalstock ausgebaut werden Ressourcenabbau nicht primäres Problem, da Preis der Ressource die Nachfrage und das Angebot ins Gleichgewicht bringen. Ökologische Umweltökonomie (ecological economics) starke Nachhaltigkeit Der natürliche Kapitalstock darf nicht abgebaut werden. 25
26 Exkurs: Nachhaltigkeit - Innovation - Forschung & Entwicklung - Effiziente Verwaltungsstrukturen - Unternehmenskultur stärken - Preissignale für nachhaltiges Verhalten schaffen - Energieverbrauch und Wachstum weiter entkoppeln - Nachhaltiger Tourismus - Umweltschutz & Klimaschutz - Erhaltung natürlicher Ressourcen - Tier- und Pflanzenvielfalt erhalten - Natur- und Kulturlandschaften erhalten - Raumnutzung - Regionalentwicklung - Verkehrssysteme optimieren 3 Dimensionen der Nachhaltigkeit Wirtschaftliche Verantwortung Umweltverantwortung NACHHALTIGKEIT - Bildung - Gesundheitswesen - Alterssicherung - Gleichstellung von Frauen und Männern - Forschung, Ausbildung - Sozialer Zusammenhalt - Einkommensverteilung Soziale Verantwortung 26
27 Exkurs: Nachhaltigkeit Existiert ein Konflikt zwischen Wachstum und Nachhaltigkeit? Das Erreichen eines nachhaltigen Wachstumspfades hängt vor allem vom Grad des technologischen Fortschrittes ab. Eine wirtschaftspolitische Stimulation von technologischem Fortschritt in der Form von environmental research and development durch politische Strategien lässt das Erreichen von höherem Wirtschaftswachstum, verstärkter Nachhaltigkeit sowie verbesserter Wettbewerbsfähigkeit zu. Gesellschaft misst der Nachhaltigkeit ohne Institutionen und resultierenden Regulierungen keine zu große Bedeutung bei Ökonomische Institutionen müssen somit Rahmenbedingungen für nachhaltiges Wirtschaften setzen, um umweltschonende Produktion und umweltfreundlichen Konsum zu fördern. Geeignete politische Maßnahmen ermöglichen ein simultanes Wachstum von Wirtschaft und Nachhaltigkeit! to be discussed 27
28 Exkurs: Nachhaltigkeit Ayres (1995) konstatiert zur potentiellen Korrelation zwischen Wachstum und Nachhaltigkeit folgendes: [ ] in principle, economic growth needs not be antithetical to environment protection. In einer approximativen historischen Betrachtung der letzten Jahrzehnte ist festzustellen, dass das stetig steigende Wirtschaftswachstum stark mit einem steigenden Energieverbrauchswachstum korreliert, sodass wiederum eine hohe Korrelation zwischen dem Wirtschaftswachstum und den Luftschadstoffund Treibhausgasemissionen vorhanden war. doppelter kausaler Zusammenhang: o o zum einen hat das steigende Wirtschaftswachstum zu einem höheren Energieverbrauch geführt und zum anderen ermöglichte in der Vergangenheit jedoch auch ein höherer Energieeinsatz technologische Entwicklungen und somit auch ökologische Optimierungen und darauf folgend eine höheres Wirtschaftswachstum. 28
29 Environmental Kuznets Curve Wie ist in einer makroökonomischen Perspektive der Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Umweltqualität ausgeprägt? Konzept der Environmental Kuznets Curve veranschaulicht die grundlegende Korrelation zwischen Wirtschaftswachstum und Umweltqualität UV Umweltqualität Y Output (Bruttoinlandsprodukt) 29
30 Environmental Kuznets Curve Das Konzept der Environmental Kuznets Curve beschreibt die Auswirkung von Änderungen im Einkommensniveau der Bevölkerung in einer spezifischen Volkswirtschaft auf die Umweltverschmutzung dieser Volkswirtschaft. Die Umweltverschmutzung steigt hierbei simultan zu einem steigenden Einkommensniveau an, bis ein Einkommensniveau erreicht wird, ab dem die Umweltverschmutzung kontinuierlich wieder abnimmt ( Y-Wende ). Exakter formuliert erhöhen sich die negativen Umweltauswirkungen relativ betrachtet in den unteren Einkommenssegmenten stärker als die Einkommenszuwächse. Sobald höhere Einkommensniveaus bzw. höhere Wohlfahrtsniveaus erreicht werden, wird den ökologischen Parametern mehr Bedeutung beigemessen, sodass die negativen Umweltauswirkungen wiederum abnehmen. 30
31 Environmental Kuznets Curve Umweltökonomisches Ziel: Vermeidung der Phase 4, einer simultanen Erhöhung von Wirtschaftswachstum und Umweltverschmutzung 31
32 Environmental Kuznets Curve Kritik am Konzept der Environmental Kuznets Curve: EKC ist ein generelles Konzept zur Betrachtung der aggregierten Umweltauswirkungen, es greift jedoch in der Betrachtung bestimmter Umweltauswirkungen zu kurz. The EKC is generally rejected for municipal waste, CO 2 and aggregate energy consumption; these variables monotonically increase with the level of income in a cross-section of countries. (Smulders (2004)) Das Konzept der Environmental Kuznets Curve wird jedoch auch aus grundlegenden Überlegungen in Frage gestellt. Suri und Chapman (1998): der grundlegende turning point (Y-Wende) der EKC befindet sich auf einem Level, das mit großer Wahrscheinlichkeit von keiner Volkswirtschaft in der näher liegenden Zukunft erreicht werden kann. 32
33 Ressourcenökonomie Ist ein Abbau von erschöpfbaren Ressourcen mit dem Konzept von Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen? Antworten darauf liefert die Ressourcenökonomie Sustainability = development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Grundsätzlich ist zwischen der Nutzung von erschöpfbaren und erneuerbaren Ressourcen (im speziellen Fall zwischen erneuerbaren und erschöpfbaren Energieträgern) zu differenzieren. Beispiele für erschöpfbare Ressourcen: Erdöl, Erdgas, Eisen, Uran, Kohle, erschöpfbare Ressourcen: Keine Regenerationskapazität Beispiele für erneuerbare/ regenerierbare Ressourcen: Wald/Holz, Fischbestand, erneuerbare Ressourcen: Regenerationskapazität bei nachhaltigem Management 33
34 Ressourcenökonomie Frage/Diskussion: In welchem Zusammenhang steht aktuell die Exploration von amerikanischem Schieferöl (erschöpfbare Ressource) mit dem österreichischen Strompreis? Und wie beeinflusst die Entscheidung der Saudis unsere Stromnachfrage? 34
35 Ressourcenökonomie Sowohl im Falle von erschöpfbaren Ressourcen als auch im Fall von regenerierbaren Ressourcen ist bei perfekt funktionierenden Märkten eine optimale Verteilung der Ressourcen über die Zeit vorhanden. Welche perfekt funktionierenden Märkte existieren Ihrer Meinung nach? Der Rohstoffpreis ergibt sich ceteris paribus durch eine zunehmende Verknappung bzw. im Falle von regenerierbaren Ressourcen durchaus auch durch eine Ausweitung der Ressourcen. 35
36 Ressourcenökonomie Erschöpfbare Ressourcen Das fundamentale Prinzip der Entscheidung der Nutzung von erschöpfbaren Ressourcen und somit auch die Determinierung des Marktpreises der erschöpfbaren Ressource stellt Hotelling s rule dar Hotelling s rule: die Grenzproduktivität der Ressource muss der Grenzproduktivität des Kapitals entsprechen. (Indifferenz zwischen Ressource und Kapital) [Preis steigt mit Zinssatz] Als Konsequenz ergibt sich z.b. bei einem temporären Aufschieben des Ressourcenabbaus und bei konstanter Nachfrage eine Verknappung des aktuellen Angebots, eine Erhöhung des Ressourcenpreises und somit des Energiepreises bei fossilen Energieträgern (Komponente der Rohölpreishausse Frühjahr/Sommer 2008). Dieser Entscheidungsmechanismus wird im Fall von fossilen Energieträgern über Terminmärkte abgebildet. Diese Marktprozesse führen in theoretischer Sicht bei optimaler Ausgestaltung zur optimalen intertemporalen Allokation von erschöpfbaren Ressourcen 36
37 Ressourcenökonomie Erschöpfbare Ressourcen In diesem Zusammenhang kann von keinen Marktverzerrungen bei den relevanten Rohstoffpreisen gesprochen werden. Durch die Existenz von sogenannten backstop-technologien wird es im Allgemeinen zu keiner vollständigen Ausbeutung von erschöpfbaren Ressourcen kommen. Backstop-Technologien bezeichnen spezifische Technologien bei erneuerbaren Ressourcen, die eine weitere Ausbeutung der erschöpfbaren Ressourcen aus Kostengründen unprofitabel werden lässt. Der somit beginnende Substitutionsprozess, der bei einigen Energieträgern bereits in den letzten Jahren stark eingesetzt hat, verhindert den Abbau des vollständigen Ressourcenbestandes der fossilen Energieträger. 37
38 Exkurs: Hauptparameter in Rohölpreisvolatilität 2008 Frage: wurde 2008 der Rohölpreis ausschließlich durch das physische Angebot und die physische Nachfrage nach Rohöl (auf Basis von Hotelling s Rule) determiniert oder hauptsächlich durch Spekulationen an den Rohstoffbörsen? Aussage im Mai 2008 vom Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman: Suffice it to say that some economists, myself included, make much of the fact that the usual telltale signs of a speculative price boom are missing. But other economists argue, in effect, that absence of evidence isn t solid evidence of absence. Erklärungsansatz 1: Dominanz von market fundamentals (keine Spekulationen) Gemäß IEA unzureichende Investitionen in der Vergangenheit in die Rohölexploration und Trägheit des Systems (lange Errichtungszeiten der Förderinfrastruktur!) --- steigende Nachfrage nach Rohöl kann nur unzureichend gedeckt werden (Hotelling s Rule: Ressource wird erst wieder bei höherem Preis abgebaut, Zinssatz am Kapitalmarkt war attraktiver). 38
39 Exkurs: Hauptparameter in Rohölpreisvolatilität 2008 Entwicklung des Rohölpreises von Jänner 2007 bis Jänner 2009 ($ je Barrel) Jän.07 Feb.07 Mär.07 Apr.07 Mai.07 Jun.07 Jul.07 Aug.07 Sep.07 Okt.07 Nov.07 Dez.07 Jän.08 Feb.08 Mär.08 Apr.08 Mai.08 Jun.08 Jul.08 Aug.08 Sep.08 Okt.08 Nov.08 Dez.08 Jän.09 Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten der EIA
40 Exkurs: Hauptparameter in Rohölpreisvolatilität 2008 Erklärungsansatz 1: Dominanz von market fundamentals (keine Spekulationen) Relative Verlagerung des Ressourcenangebots in die Zukunft erhöht bei einem simultanen Anstieg der Nachfrage den Ressourcenpreis --- restriktive Explorationspolitik ist als intergenerationale Verschiebung der Ressourcennutzung zu verstehen. Die gedämpft getätigten Investitionen und die damit einhergehende relative Verknappung des Angebots kann auf die konstanten Rohölpreise der Zeitperiode von 1985 bis 2003 zurückgeführt werden, in der Investitionen in eine Erweiterung der Förderaktivitäten aufgrund des relativ geringen Preisniveaus nicht ausreichend realisiert wurden. Die hohe Nachfragesteigerung (Asien!) kombiniert mit aktuell zurückhaltenden Investitionen in zukünftige Exploration lassen den Rohölpreis zusätzlich ansteigen 40
41 Exkurs: Hauptparameter in Rohölpreisvolatilität 2008 Globale Nachfrage nach Rohöl Jahre Energienachfrage (Mtoe) Rest der Welt EU China Indien 41
42 Exkurs: Hauptparameter in Rohölpreisvolatilität 2008 Erklärungsansatz 2: Spekulationen waren für den hohen Rohölpreis im Sommer 2008 verantwortlich Rapider Preisanstieg im ersten Halbjahr des Jahres 2008 und Preisverfall ab Juli 2008 deuten an, dass Preisentwicklung nicht ausschließlich auf Veränderungen des physischen Angebots und auf Veränderung der Nachfrage nach physischem Rohöl zurückgeführt werden kann. Krise der Aktienmärkte fördert spekulative Geschäfte an den Rohstoffbörsen - Renditen und Erträge an den konventionellen Börsen verlieren gegenüber Gewinnen an Rohstoffbörsen an Bedeutung. (Teil von Hotelling s Rule) Entscheidungsbasis für Transaktion am Rohölmarkt: Erwartung über zukünftige Preisänderungen und Profit aus der Vorhersage der Preisänderung. Die restriktiven Förderkapazitäten fördern die Attraktivität der Rohölbörsen in Kombination mit Versorgungsängsten (Geopolitische Krisen!). Unterschiede in den Preiserwartungen führen tendenziell seitens nichtkommerzieller Marktteilnehmer (auch hedge-fonds) an den Rohölbörsen zu vermehrten Spekulationen (spekulative Blase!). 42
43 Exkurs: Hauptparameter in Rohölpreisvolatilität 2008 Implikation: Spekulationen an den Rohölbörsen basieren auch auf den Erwartungen zur Entwicklung der market-fundamentals von physischem Rohöl --- Marktentwicklung auf Basis von Angebot und Nachfrage von physischem Rohöl & Existenz eines spekulativen Preisaufschlags!? Wahrscheinlich: Grundlegende Tendenz sind market fundamentals; Spekulationen basieren auf market fundamentals und verstärken die Dynamik Wie hoch die kurz- und mittelfristigen potentiellen Preisverzerrungen durch Spekulationen ausgeprägt sind, bleibt unklar (gemäß ersten Abschätzungen in der Presse bei ca. 30%). 43
44 Ressourcenökonomie Historische Gegenüberstellung der Rohölförderung / Extraktion und des Rohölpreises (US-Dollar zu Preisen des Jahres 2000) 44
45 Ressourcenökonomie Peak-Oil Peak-Oil: globales Rohölfördermaximum Der globale Peak-Oil-Punkt ist (vielmehr noch als eine bestimmte Ausprägung einer Rohölpreisprognose) als Politikum für umwelt- und energiepolitische Positionen zu bezeichnen. Peak-Oil spiegelt die kontinuierliche Abnahme der weltweiten Rohölreserven wieder. Darüber hinaus reflektiert Peak-Oil durch die Bestimmung einer Abnahme des globalen Angebots auch bei einer konstanten Nachfrage bzw. verstärkt bei einer zunehmenden Nachfrage ein steigendes Preisniveau von Rohöl. somit auch steigende Endverbraucherpreise von fossilen Sekundärenergieträgern wie Benzin und Diesel, wodurch alternative Energieträger in ihrer Wettbewerbsfähigkeit (relativ) gestärkt werden Rarely has the outlook for oil prices been more uncertain than now, in mid-september (International Energy Agency, 2008) 45
46 Ressourcenökonomie Prognosen zum globalen Peak-Oil und Peak-Gas: Autor Peak-Oil Peak-Gas Bentley (2002) Green et al. (2006) USGS (2000) [In: Greene et al. (2006)] Campbell (2003) [In: Greene et al. (2006)] Campbell (2002) Bentley et al. (2007)
47 Ressourcenökonomie Resultate der Meta-Studie von Bentley et al. (2007) Results of some oil forecasts that see no near-term peak Date Author Hydrocarbon Ultimat e (Gb) F cast date of peak (by study end-date) World prod. Mb/d WEC/IIASA-A2 Cv. oil No peak IEA: WEO 2000 Cv. oil (+N) 3345 No peak US DoE EIA Cv. oil /2037 Various 2002 US DoE Ditto No peak Shell Scenario Cv.&Ncv. oil ~4000 a Plateau: WETO study Ditto 4500 b No peak ExxonMobil Ditto No peak IEA: WEO 2005 Reference Sc. Ditto No peak Deferred Invest. Ditto No peak a Shell s ultimate of 4000Gb is composed of: _2300Gb of conventional oil (incl. NGLs); plus _600Gb of scope for further recovery (SFR) oil; plus 1000Gb of non-conventional oil. b WETO s ultimate of 4500Gb is for conventional oil only; it starts with a USGS figure of 2800 Gb, then grown by assuming large and rapid recovery factor gains to Mb/d: Million barrels per day. Quelle: Bentley et al. (2007) 47
48 Ressourcenökonomie Resultate der Meta-Studie von Bentley et al. (2007), Auszug für Werte ab 1998 Results of oil forecasts that see a peak (or current plateau) Date Author Hydrocarbon Ultimate Gb Date of global peak 1998 IEA: WEO 1998 Cv. oil 1999 Magoon of the USGS 2000 Bartlett Ditto ref.case 2014 Pr. Cv. Oil ~2000 Peak ~ and and 2019, respectively BGR (Germany) Cv.&Ncv. oil Cv.: 2670 Combined peak in Deffeyes Cv. oil a Later-Hubbert method ~ P-R Bauquis All liquids Combined peak in Campbell/U. Uppsala All h carbons Combined peak ~ Laherrère All liquids 3000 n/a 2003 Energyfiles Ltd. All liquids Cv: (if 2% demand growth) Energyfiles Ltd. All h carbons Comb d pk. ~2020 (if 0% growth) Bahktiari model. Pr. Cv. oil Miller, BP- own model Cv.&Ncv. oil 2004 PFC Energy Cv.&Ncv. oil 2018-base case 2025: All poss. OPEC prodn. used. 48
49 Ressourcenökonomie Graphische Darstellung der Veränderung in den Rohölreserven Quelle: Erdmann und Zweifel (2008) 49
50 Ressourcenökonomie Darstellung der Veränderung der Rohölprognosen 50 Quelle: Erdmann und Zweifel (2008)
51 Ressourcenökonomie Prognose der Kohlereserven Quelle: Erdmann und Zweifel (2008) 51
52 Ressourcenökonomie Regenerierbare Ressourcen: Erneuerbare Ressourcen können dadurch charakterisiert werden, dass sie die Möglichkeit besitzen, dass ihr Ressourcenbestand dauerhaft genutzt werden kann, sodass der aktuelle Verbrauch der Ressource den Verbrauch der zukünftigen Generationen nicht beeinflusst. Zentrale Einflussgröße der Ressourcennutzung ist die Regenerationsfähigkeit der Ressource. Zusätzlich zur Entscheidungsfindung bei erschöpfbaren Ressourcen wird bei den regenerierbaren Ressourcen auch relevant, dass eine zeitliche Aufschiebung des Abbaus in zukünftige Perioden einen Zuwachs im Ressourcenbedarf bedingt. Allerdings: Tragedy of the commons möglich. Durch ineffiziente oder inexistente Eigentumsrechte kann es bei geringen Entekosten der erneuerbaren Ressource zu einer zu extensiven Nutzung der Ressource kommen, die bis zur Ausrottung der Ressource führt. 52
53 Ressourcenökonomie Beispiel für tragedy of the commons: Abholzung des tropischen Regenwalds zur Produktion von Biokraftstoffen (z.b. von Palmöl in Indonesien) Anpflanzung von Kurzumtriebsgewächsen anstelle der ursprünglichen Vegetation des tropischen Regenwaldes lässt keine CO 2 -Neutralität dieser Biomasse zu Das sogenannte technische CO 2, das bei der Verbrennung der Biomasse (bei der Verwendung der Biokraftstoffe) übersteigt die CO 2 -Bindung in der neuen Biomasse, sodass kein nachhaltiger Effekt durch diese Biokraftstoffproduktion existiert Die extensive Nutzung ist auch durch nicht bzw. unzureichend definierte Eigentumsrechte an der ursprünglichen Vegetation zu erklären 53
54 Externalitäten Die Existenz von externen Effekten von Externalitäten - ist ein zentrales Marktversagen (das insbesondere auch im Angebot und in der Nachfrage von Energie zu analysieren ist). externe Effekte: Auswirkungen von wirtschaftlichen Aktivitäten, die nicht auf das spezifische handelnde Marktsubjekt beschränkt bleiben, sondern auch andere Individuen bzw. die gesamte Gesellschaft beeinflussen, wobei sich diese spill-over-effekte nicht in einer Kompensation der nicht-handelnden Individuen beispielsweise über den Marktpreis niederschlagen. Als Konsequenz sind Externalitäten in jenen Situationen vorhanden, in denen der Nutzen oder die Kosten eines Individuums Variablen enthält, deren Wert von anderen Individuen (seien es Personen, Korporationen oder die öffentliche Hand) ohne Rücksicht auf das Wohlfahrtsniveau des Individuums (oder auf die Profitsituation eines Unternehmens) beeinflusst werden, ohne dass seitens des beeinflussenden Individuums eine Kompensation der Wohlfahrtsveränderung des beeinflussten Individuums getätigt wird. 54
55 Externalitäten 55
56 Externalitäten Beispiel: externe Kosten der Stromerzeugung in Deutschland Quelle: Erdmann und Zweifel (2008) 56
57 Externalitäten Beispiele für negative externe Externalitäten im Straßenverkehr: Luftschadstoff- und Treibhausgasemissionen Lärmbelastung, Zeitkosten, Staukosten Beispiele für positive externe Effekte: Landschaftspflege in der Landwirtschaft Impfungen zur Verhinderung von Seuchen/Epidemien Unterscheidung notwendig zwischen technischen und pekuniären Externalitäten Pekuniäre (monetäre): verursachen kein Marktversagen. Beeinflussung des Nutzens oder der Profite durch geänderte Einkommen oder veränderte Marktpreise (normale Erscheinungen des Wirtschaftsgeschehens); [z.b. höhere Unternehmensgewinne durch bessere Infrastrukturanbindung] Technische: zuvor erwähnte Effekte, unmittelbare Beeinflussung von Nutzen- und Produktionsfunktion 57
58 Externalitäten Externalitäten können auch durch eine positive Beeinflussung des Wohlfahrtsniveaus anderer Individuen präsent sein, wobei in diesem Fall in der Regel von einem externen Nutzen gesprochen wird. Im Energiebereich könnte beispielsweise ein positiver externer Nutzen bei der Produktion von elektrischer Energie aus Wasserkraft vorliegen, wenn aufgrund der Errichtung eines Wasserkraftwerkes durch die entstehende Regulierung des Fließgewässers Hochwasserschäden verhindert werden können. Dieser externe Nutzen wird in der Folge nicht über den Marktpreis abgegolten, sodass in diesem Zusammenhang auch eine Marktverzerrung durch eine positive Beeinflussung der Wohlfahrtsniveaus bzw. der Nutzen anderer Individuen am Markt entsteht, die nicht im Endverbraucherpreis internalisiert ist. Die Existenz von Externalitäten bedingt ohne Regulierung (private oder öffentliche Lösung) eine Abweichung vom Paretooptimalen Marktzustand 58
59 Externalitäten Externe Kosten: In einer Volkswirtschaft, in der keine Regulierung der Verursachung von externen Effekten existiert werden die externen Kosten auf die gesamte Gesellschaft bzw. Volkswirtschaft ausgelagert Der eigentliche Verursacher für die Produktion der Externalitäten hat ohne Regulierung keine Kosten zu tragen. Die Allokation der Ressourcen ist in der Folge durch den existenten verzerrten Marktpreis nicht in einem optimalen Niveau vorhanden es liegt ein Marktversagen vor. Die Marktpreise beinhalten somit ausschließlich die privaten Kosten. Eine Einbeziehung der externen Kosten in die Preisdeterminierung ergibt erst die sozialen Kosten eines spezifischen Gutes. Das resultierende Marktversagen äußert sich durch eine zu große Nachfrage nach dem spezifischen Gut, mit dem die externen Kosten verbunden sind. Die privaten Grenzkosten sind nicht ident mit den gesellschaftlichen Grenzkosten. Die nachgefragte und produzierte Menge des Gutes ist somit größer als die hypothetische gesellschaftlich optimale Menge. 59
60 Externalitäten Gründe für fehlende automatische Internalisierung der Externalitäten am Markt: Gefangenendilemma, Free-rider-Verhalten Charakteristia des Gutes Umwelt als öffentliches Gut Informationsdefizite und asymmetrie Externe Effekte werden gemäß Bartel (1994) aufgrund von grundlegenden individuellen Freiheitsrechten von Produzenten und Konsumenten in liberalen Gesellschaftssystemen ohne Markteingriffe nicht internalisiert. Die individuellen Nutzen- bzw. Kostenfunktionen werden ohne regulatorische Mechanismen nicht den gesellschaftlichen Nutzen- bzw. Kostenfunktionen angepasst; es existiert kein genereller automatischer Koordinationsmechanismus zur Internalisierung der wohlfahrtsökonomischen Ineffizienzen. 60
61 Externalitäten Gefangenendilemma: Ein potentielles free-rider-verhalten der anderen Marktteilnehmer lässt für jedes Marktsubjekt ein Gefangenendilemma entstehen, durch das eine kollektive Anpassung der individuellen Nutzen- und Kostenfunktionen bzw. niveaus nicht erfolgen wird. Das Individuum kann sich nie sicher sein, dass die anderen Marktteilnehmer sich auch solidarisch (sozial optimal) verhalten. Gemäß Spieltheorie wird das Individuum als Konsequenz ebenfalls kein sozial optimales Verhalten zeigen, obwohl das soziale Optimum auch den individuellen Nutzen erhöhen würde; es kommt zum free-rider-verhalten. Gefangenendilemma: Bei einer fehlenden Internalisierung der Externalitäten (keine Regulierung) kann ein gesellschaftlich optimales ökologisches Verhalten die Nutzen- und Produktionsniveaus der Marktsubjekte einschränken. Ohne regulatorische Mechanismen ist in der Folge die Ressourcen- Allokation nicht effizient zu gestalten, sofern das Kollektiv eine größere Anzahl von Individuen beinhaltet 61
62 Externalitäten Coase-Theorem: In einem relativ überschaubaren Kollektiv ( Small number case ) kann allerdings das free-rider-verhalten (aufgrund des Gefangenendilemmas) verhindert werden Durch private Verhandlungen können individuelle Verhaltensweisen auch kollektiv verhandelt werden, wodurch das soziale Wohlfahrtsniveau des Kollektivs maximiert wird: Coase-Theorem Die Maximierung des sozialen Wohlfahrtsniveaus wird durch Kompensationszahlungen erreicht. Der Verursacher des externen Effekts kompensiert alle betroffenen Individuen Voraussetzung: Festlegung der Eigentumsrechte (problematisch bei Gütern wie Luft bzw. Luftqualität), keine Transaktionskosten, rationales Verhalten In einem größeren Kollektiv werden keine effizienten privaten Verhandlungen möglich sein (zu hohe Transaktionskosten, zu viel free-rider) 62
63 Externalitäten Charakteristia des Gutes Umweltqualität als öffentliches Gut Konsequenz aus Problem des free-rider-verhaltens und einem Ausschluss des small number case: Umweltqualität kommt nicht durch die individuellen Produktions- und Konsumentscheidungen auf den Märkten zustande, sondern muß als sogenanntes Kollektivgut vom Staat durch umweltpolitische Einflussnahme bereitgestellt werden. (Bartel, 1994) Öffentliche Güter werden durch die Nichtausschließbarkeit vom Konsum und durch die Nichtrivalität des Konsums charakterisiert. Nichtausschließbarkeit vom Konsum: der Ausschluss vom Konsum eines Gutes ist nicht möglich bzw. nicht ökonomisch effizient Nichtrivalität des Konsums: Die Nutzung eines Gutes durch ein Individuum beeinflusst nicht die Nutzung dieses Gutes von anderen Individuen Es erweist sich zum einen teilweise nicht möglich, jemanden vom einem spezifischen Umwelt-Gut auszuschließen ( Luft ), zum anderen aufgrund von hohem technischen und administrativen Aufwand als nicht sinnvoll, jemanden vom Konsum des Gutes Umwelt auszuschließen ( Wald, Wasser ) 63
64 Externalitäten Charakteristia des Gutes Umwelt als öffentliches Gut Der Anreiz zum free-rider Verhalten ist gegeben, da ein Individuum auch den Nutzen des Gutes konsumieren kann, wenn andere dafür bezahlen. Es wird dadurch zu keiner Offenbarung der persönlichen Präferenzen für das Gut Umwelt kommen. Dieses strategische Verhalten lässt keine Preisbildung am Markt zu. Somit ist keine Pareto-optimale Allokation des Gutes Umwelt existent - der kollektive Charakter des Gutes Umwelt führt zu einer exzessiven Nutzung des Gutes. Die Präsenz eines öffentlichen Gutes bzw. eines Gemeineigentums wie der Umweltqualität führt ohne Regulierung zu kurzfristigen individuellen Gewinn- und Nutzenmaximierungen und als Konsequenz langfristig zu sozialer Ineffizienz ( Tragedy of the commons ). Die Regulierung eines öffentlichen Gutes muss somit zur Vermeidung von gesellschaftlichen Ineffizienzen über öffentliche Institutionen reguliert werden. 64
65 Externalitäten Informationsdefizite/Informationsasymmetrie Das allgemeine Konkurrenzgleichgewicht impliziert die Transparenzbedingung, somit vollständige Information aller Marktteilnehmer. In der Realität bedeutet diese Bedingung, dass in einem vollständigen Konkurrenzgleichgewicht für homogene Güter der idente Preis vorliegt. Eine asymmetrische Information zwischen den Marktteilnehmern kann somit zu einem Marktversagen führen (z.b. gewisse Gütereigenschaften oder auch Produktionskosten sind nicht genau bekannt); es existiert keine umfassende und kostenlose Information aller Marktteilnehmer zum betreffenden Transaktionsgeschäft, sodass der Markt in seiner Funktionsfähigkeit beeinträchtigt ist. Auch aufgrund von imperfekter Information bzw. von Informationsasymmetrien ist es in der Realität in nahezu allen Fällen notwendig, öffentliche Regulierungsmechanismen zu implementieren, wenngleich öffentliche und somit auch politische Mechanismen ebenfalls keinen Anspruch auf perfekte Allokationen stellen können. 65
66 Externalitäten Beispiel für Externalität: Treibhausgas- und Luftschadstoff- Emissionen in Oberösterreich von 1990 bis 2005 CO 2 CH 4 N 2 O S0 2 NO x NMVOC Jahr in Tonnen ,6 7,1 18,1 46,8 53, ,9 7,4 17,5 50,0 50, ,2 6,8 13,4 46,9 45, ,1 6,8 13,0 43,7 44, ,0 6,9 11,8 42,6 40, ,8 7,1 11,1 42,0 40, ,9 7,0 11,0 45,8 38, ,0 7,0 9,8 43,3 37, ,2 7,1 9,0 45,9 34, ,6 7,1 8,8 43,8 32, ,8 7,1 8,3 45,5 32, ,1 6,6 8,5 46,5 34, ,2 6,7 8,2 48,2 33, ,0 6,8 8,5 50,5 32, ,3 4,7 7,1 48,6 31, ,2 4,7 6,9 49,1 30,8 66 Quelle: Statistik Austria (2007), Bundesländer-Schadstoffinventur
67 Externalitäten Exkurs: Monetarisierung der Schadenskosten der Luftschadstoffund Treibhausgasemissionen Luftschadstoff bzw. Treibhausgas Schadenskosten in je Tonne Quelle Schwefeldioxid (SO 2 ) ExternE (2004) Stickoxid (NO x ) ExternE (2004) Flüchtige organische Verbindungen außer Methan (NMVOC) ExternE (2004) Kohlendioxid (CO 2 ) ~ 50 Berechnung basierend auf Tol (2005) Staub (PM 10 und PM 2,5 ) ExternE (2004) Existieren Ihrer Meinung nach in Österreich Regulierungen zur Internalisierung der Schadenskosten der Treibhausgas-und Luftschadstoffemissionen? 67
68 Externalitäten Beispiel: CO 2 -Emissionen in der Stromerzeugung in Deutschland Quelle: Erdmann und Zweifel (2008) 68
69 Externalitäten Regulierung der externen Effekte Die Regulierung der externen Effekte kann grundlegend nachfrageseitig oder angebotsseitig erfolgen. Eine nachfrageseitige Regulierung der externen Effekte gleicht die individuellen Grenzkosten des Konsumenten den gesellschaftlichen Grenzkosten an, sodass bei negativen Externalitäten ein höherer Marktpreis verursacht wird und in der Folge eine geringere Nachfrage bzw. Gleichgewichtsmenge nach dem spezifischen Gut vorhanden ist (z.b. MÖSt). Diese Anpassung generiert bei optimaler Implementierung eine sozial optimale Nutzung eines Gutes Die zweite Alternative stellt die angebotsseitige Regulierung dar, in der die private Grenzkostenfunktion der Anbieter durch die Regulierung verändert wird und somit das Angebot reduziert wird, wodurch eine geringere Gleichgewichtsmenge entsteht (z.b. CO 2 -Zertifikate). Ohne regulatorische Mechanismen ist in der Folge die Ressourcen- Allokation nicht effizient zu gestalten wie veranschaulicht (Achtung Coase- Theorem). 69
70 Staatliche Lösungen für Externalitäten Pigou-Steuer (Form der Umweltsteuer): Der Ansatz der Pigou-Steuer geht davon aus, dass der Markt Umweltprobleme nicht lösen kann und daher direkte staatliche Eingriffe zur Internalisierung negativer externer Effekte notwendig sind und durch die Pigou-Steuer eine Pareto-optimale Allokation erreicht wird. Aufgebaut ist die Pigou-Steuer auf dem Verursacherprinzip. Der Produzent, der einen ökologischen Schaden verursacht, wird vom Staat mit einer Zusatzlast in der Höhe der sozialen zusätzlichen Kosten auf jede Produktionseinheit besteuert. Somit wird der Produzent die zusätzlichen sozialen Kosten in seine Produktion involvieren, wodurch eine Berücksichtigung des Grenzschadens erreicht wird. Die Steuer und somit auch der Marktpreis wird hierfür von zentraler Stelle vorgegeben, als Konsequenz kann nicht von einer reinen Marktlösung gesprochen werden, sondern von einer interventionistischen Umweltpolitik, bei der der Staat die Aufgabe hat, einen Steuersatz zu ermitteln, der eine Pareto-optimale Allokation mit sich zieht 70
71 Staatliche Lösungen für Externalitäten Standard-Preis-Ansatz Aufgrund der schwierigen Umsetzung der Pigou-Steuer (Informationsasymmetrie; Festlegung z.b. der optimalen Emissionsmenge) entwickelten in den siebziger Jahren Baumol und Oates den Standard- Preis Ansatz. Ziel dieses Ansatzes ist es, über die theoretisch pareto-optimale Allokation hinaus eine kostenminimale Durchsetzung realistischer Zielwerte (= Standard) bei Emissionen zu erreichen. Die zentrale Behörde gibt Imissionsnormen vor (oder Emissionsnormen); somit handelt es sich im Gegensatz zum Konzept der Pigou-Steuer um ein ordnungsrechtliches Instrumentarium der Umweltpolitik. In der Praxis wird dies nur durch ein Trial-and-Error-Verfahren erreicht werden. Die Abgabensätze müssen sehr flexibel gestaltet sein, da sich die ökologischen Faktoren ständig ändern. Ein geringerer Informationsaufwand ist daher im Standard-Preis-Ansatz damit verknüpft, dass eine effiziente Umweltpolitik durch den Steuersatz nur zufällig erreicht werden wird. 71
72 Staatliche Lösungen für Externalitäten There is no escape from the fact that regulation often remains imperfect as it is difficult to eliminate all the inefficiencies arising from a collective mode of exploitation. The remaining inefficiencies must therefore be considered as genuine costs of maintaining the commons. In other words, regulation is necessarily imperfect, and a fully efficient outcome cannot be expected to result from the joint exploitation of a natural resource. Baland und Platteau(2003), S
73 Staatliche Lösungen für Externalitäten Weitere Formen der Internalisierung von Externalitäten Subventionen (= positive Umweltsteuer) Subventionen sind eine Form von finanzieller Unterstützung für den Produzenten durch den Regulator, vor allem durch den öffentlichen Sektor. Sie können als Anreiz zur Kontrolle von Verschmutzung oder zur leichteren und effizienteren Realisierung der Umweltauflagen erteilt werden. Gängige Formen von Subventionen im Umweltbereich stellen Zuschüsse, Kredite und Steuererleichterungen dar. Problem: Informationsasymmetrie Umweltauflagen Staatlich definierte Einschränkungen der Umweltbelastung Auflagenlösung ist Verbot von Umweltschädigungen mit Erlaubnisvorbehalt (Bartel (1994)) Erlaubnis wird nur bei der Einhaltung bestimmter ökologischer Kriterien erteilt 73
74 Staatliche Lösungen für Externalitäten Umweltzertifikate Mit diesem umweltpolitischen Instrument werden künstliche Märkte geschaffen, auf denen Akteure Rechte für aktuelle und zukünftige Umweltbelastungen erwerben können bzw. auf denen sie ihre erworbenen Verschmutzungs-Rechte wieder verkaufen können (z.b. Emissionshandel). Festlegung einer Obergrenze an Verschmutzung /Gesamtemission Gütermengen ident zu Umweltsteuer, Zertifikatspreis = Umweltsteuersatz Wiederverwertungssysteme In Wiederverwertungssystemen zahlt der Käufer / der Konsument einen Aufpreis, den er bei der Retournierung des Produkts wieder zurückbekommt. Gängigerweise erfolgt dies bei einem Recycling-Center. Wiederverwertungssysteme können als relativ effizient bewertet werden, da sie ökonomische Vorteile für umweltfreundliches Verhalten garantieren und gleichzeitig bei ökologisch unerwünschtem Verhalten dem Verbraucher des Produkts höhere Kosten auferlegen, sofern die Bevölkerung dieses umweltbewusste Verhalten auch durchführt und die Gebühren auf unerwünschte Produkte nicht allzu hoch sind. 74
75 Staatliche Lösungen für Externalitäten Moral Suasion Unter dem Begriff Moral Suasion sind alle Instrumente zusammengefasst, die eine Bewusstseinsbildung für ökologische Sensitivität in der Bevölkerung fördern sollen. Die Möglichkeiten reichen von Appellen der öffentlichen Hand an Produzenten und Konsumenten, bis zu Informationen der Verbraucher über umweltfreundliche Produkte. Ziel ist es, ein Umweltbewusstsein zu schaffen, das zu einer Änderung der Prioritäten in der Bevölkerung führt, sodass ein spürbar besseres ökologisches Verhalten sowohl von Produzenten als auch von Konsumenten existiert. 75
Umweltökonomie und Energiepolitik: Einige grundsätzliche Fragestellungen
 Umweltökonomie und Energiepolitik: Einige grundsätzliche Fragestellungen o. Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c.mult. Friedrich Schneider 1 Inhalte 1. Einleitung 1.1. Definition von Umweltökonomie 1.2. Bedeutung von
Umweltökonomie und Energiepolitik: Einige grundsätzliche Fragestellungen o. Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c.mult. Friedrich Schneider 1 Inhalte 1. Einleitung 1.1. Definition von Umweltökonomie 1.2. Bedeutung von
Nachhaltiges Wirtschaftswachstum: Kann dies in der Praxis funktionieren?
 Nachhaltiges Wirtschaftswachstum: Kann dies in der Praxis funktionieren? Beitrag zum Symposium Ressourcenschonendes Wirtschaften Technische Universität Wien, 25. März 204 Univ.-Prof. Dr. Michael Getzner
Nachhaltiges Wirtschaftswachstum: Kann dies in der Praxis funktionieren? Beitrag zum Symposium Ressourcenschonendes Wirtschaften Technische Universität Wien, 25. März 204 Univ.-Prof. Dr. Michael Getzner
7. Einheit Nachhaltigkeit
 7. Einheit Nachhaltigkeit Wachstum Wachstum (umgefähre Werte) 7 6 5 4 3 2 1 400 350 300 250 200 150 100 50 Bevölkerung (Mrd.) BIP (Int. $, 100 Mrd.) 0 1750 1800 1850 1900 1950 2000 0 Grenzen des Wachstums
7. Einheit Nachhaltigkeit Wachstum Wachstum (umgefähre Werte) 7 6 5 4 3 2 1 400 350 300 250 200 150 100 50 Bevölkerung (Mrd.) BIP (Int. $, 100 Mrd.) 0 1750 1800 1850 1900 1950 2000 0 Grenzen des Wachstums
Allgemeine Volkswirtschaftslehre. 4. Grundzüge der Wirtschaftspolitik. WiMa und andere (AVWL I) WS 2007/08
 I 4. Grundzüge der Wirtschaftspolitik 1 4. Grundzüge der Wirtschaftspolitik Wirtschaftspolitik = Gesamtheit aller zielgerichteten Eingriffe in den Wirtschaftsbereich Träger der Wirtschaftspolitik: - Nationale
I 4. Grundzüge der Wirtschaftspolitik 1 4. Grundzüge der Wirtschaftspolitik Wirtschaftspolitik = Gesamtheit aller zielgerichteten Eingriffe in den Wirtschaftsbereich Träger der Wirtschaftspolitik: - Nationale
Theorie => Modell => falsifizierbare Prognose => empirische Prüfung. Bestandteile eines positiven Modells in der Ökonomie:
 Theorie => Modell => falsifizierbare Prognose => empirische Prüfung 1 - wipo051102.doc Bestandteile eines positiven Modells in der Ökonomie: => Akteure (Handelnde, Betroffene) => deren Ziele (Nutzen, Motive)
Theorie => Modell => falsifizierbare Prognose => empirische Prüfung 1 - wipo051102.doc Bestandteile eines positiven Modells in der Ökonomie: => Akteure (Handelnde, Betroffene) => deren Ziele (Nutzen, Motive)
Drei Szenarien: RWE 18/017 gkl Seite 1
 Drei Szenarien: New Policies (NP) Zeigt auf, wie sich das Energiesystem bei Zugrundelegung der aktuellen Politik und der bis August 2018 angekündigten Pläne entwickeln könnte. Current Policies (CP) Geht
Drei Szenarien: New Policies (NP) Zeigt auf, wie sich das Energiesystem bei Zugrundelegung der aktuellen Politik und der bis August 2018 angekündigten Pläne entwickeln könnte. Current Policies (CP) Geht
Definition für Externe Effekte
 Externe Effekte 1 Definition für Externe Effekte sind in der Volkswirtschaft der Begriff für die unkompensierten Auswirkungen ökonomischer Entscheidungen auf unbeteiligte Dritte Sie stellen eine Form von
Externe Effekte 1 Definition für Externe Effekte sind in der Volkswirtschaft der Begriff für die unkompensierten Auswirkungen ökonomischer Entscheidungen auf unbeteiligte Dritte Sie stellen eine Form von
Mikroökonomik II/Makroökonomik II
 Mikroökonomik II/Makroökonomik II Prof. Dr. Maik Heinemann Universität Lüneburg Institut für Volkswirtschaftslehre Wirtschaftstheorie und Makroökonomik heinemann@uni-lueneburg.de Wintersemester 2007/2008
Mikroökonomik II/Makroökonomik II Prof. Dr. Maik Heinemann Universität Lüneburg Institut für Volkswirtschaftslehre Wirtschaftstheorie und Makroökonomik heinemann@uni-lueneburg.de Wintersemester 2007/2008
Das Profilfach»Sustainability«
 Das Profilfach»Sustainability«1. Leitmotiv und Ausbildungsziel 2. Die beteiligten Lehrstühle 3. Die Struktur des Profilfaches 4. Inhalte der Lehrveranstaltungen 5. Berufsperspektiven 6. Ansprechpartner
Das Profilfach»Sustainability«1. Leitmotiv und Ausbildungsziel 2. Die beteiligten Lehrstühle 3. Die Struktur des Profilfaches 4. Inhalte der Lehrveranstaltungen 5. Berufsperspektiven 6. Ansprechpartner
Wohlfahrtsanalyse. Ökonomische Entscheidungen und Märkte IK. Alexander Ahammer. Institut für Volkswirtschaftslehre Johannes Kepler Universität Linz
 Wohlfahrtsanalyse Ökonomische Entscheidungen und Märkte IK Alexander Ahammer Institut für Volkswirtschaftslehre Johannes Kepler Universität Linz Letztes Update: 9. Januar 2018, 12:51 Alexander Ahammer
Wohlfahrtsanalyse Ökonomische Entscheidungen und Märkte IK Alexander Ahammer Institut für Volkswirtschaftslehre Johannes Kepler Universität Linz Letztes Update: 9. Januar 2018, 12:51 Alexander Ahammer
Kapitel 5.1: Kollektiventscheidungen 1
 1 Diese Folien dienen der Ergänzung des Vorlesungsstoffes im Rahmen der Vor- und Nachbereitung. Sie stellen kein Skript dar; es wird keine Gewähr für Richtigkeit und/oder Vollständigkeit übernommen. Kapitel
1 Diese Folien dienen der Ergänzung des Vorlesungsstoffes im Rahmen der Vor- und Nachbereitung. Sie stellen kein Skript dar; es wird keine Gewähr für Richtigkeit und/oder Vollständigkeit übernommen. Kapitel
Energie und Wachstum
 Energie und Wachstum WIE VIEL ENERGIEVERBRAUCH IST ANGEMESSEN? 3. Oktober 2017 Lucas Bretschger, ETH Zürich «Angemessen».. 2 Effizienz Moral Fairness Ethik Lifestyle Übergeordnete Ziele 3 BV Art. 2 Zweck
Energie und Wachstum WIE VIEL ENERGIEVERBRAUCH IST ANGEMESSEN? 3. Oktober 2017 Lucas Bretschger, ETH Zürich «Angemessen».. 2 Effizienz Moral Fairness Ethik Lifestyle Übergeordnete Ziele 3 BV Art. 2 Zweck
Nachhaltigkeit 2-3 Folien
 Service Line Qualifizierung. Nachhaltigkeit 2-3 Folien Berater für nachhaltiges Management, Qualitäts-, Umwelt-, Energiemanagement Graneggstraße 10, D-78078 Niedereschach Tel. mobil: +49 (0) 175-41 606
Service Line Qualifizierung. Nachhaltigkeit 2-3 Folien Berater für nachhaltiges Management, Qualitäts-, Umwelt-, Energiemanagement Graneggstraße 10, D-78078 Niedereschach Tel. mobil: +49 (0) 175-41 606
Ressourcenstrategie. auf nationaler und europäischer Ebene
 Eine Ressourcenstrategie für Deutschland 4. April 2006, Berlin Ressourcenstrategie Beispiele für f r Politikmaßnahmen auf nationaler und europäischer Ebene Dr. Stefan Giljum Sustainable Europe Research
Eine Ressourcenstrategie für Deutschland 4. April 2006, Berlin Ressourcenstrategie Beispiele für f r Politikmaßnahmen auf nationaler und europäischer Ebene Dr. Stefan Giljum Sustainable Europe Research
Prof. Dr. Marco Runkel. Volkswirtschaftliche Fakultät Ludwig-Maximilians-Universität München. Sommersemester 2007
 Umweltökonomie Prof. Dr. Marco Runkel Volkswirtschaftliche Fakultät Ludwig-Maximilians-Universität München Sommersemester 2007 Diese Vorlesungsunterlagen werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
Umweltökonomie Prof. Dr. Marco Runkel Volkswirtschaftliche Fakultät Ludwig-Maximilians-Universität München Sommersemester 2007 Diese Vorlesungsunterlagen werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
Ökonomie - Umweltbelastungen
 Ökonomie - Umweltbelastungen Prof. Dr. Renate Schubert, Markus Ohndorf, Moritz Rohling Institut für Umweltentscheidungen (IED) 6.3.2009 Externe Effekte Definition: Externe Effekte entstehen, wenn die Handlungen
Ökonomie - Umweltbelastungen Prof. Dr. Renate Schubert, Markus Ohndorf, Moritz Rohling Institut für Umweltentscheidungen (IED) 6.3.2009 Externe Effekte Definition: Externe Effekte entstehen, wenn die Handlungen
Das Profilfach»Sustainability«
 Das Profilfach»Sustainability«1. Leitmotiv und Ausbildungsziel 2. Die beteiligten Lehrstühle 3. Die Struktur des Profilfaches 4. Inhalte der Lehrveranstaltungen 5. Berufsperspektiven 6. Ansprechpartner
Das Profilfach»Sustainability«1. Leitmotiv und Ausbildungsziel 2. Die beteiligten Lehrstühle 3. Die Struktur des Profilfaches 4. Inhalte der Lehrveranstaltungen 5. Berufsperspektiven 6. Ansprechpartner
Umweltpolitische Instrumente für eine effizient Klimapolitik. Gerhard Clemenz Institut für Volkswirtschaftslehre
 Umweltpolitische Instrumente für eine effizient Klimapolitik Gerhard Clemenz Institut für Volkswirtschaftslehre Inhalt 1. Das Grundproblem externe Effekte 2. Instrumente im Überblick 3. Emissionszertifikate
Umweltpolitische Instrumente für eine effizient Klimapolitik Gerhard Clemenz Institut für Volkswirtschaftslehre Inhalt 1. Das Grundproblem externe Effekte 2. Instrumente im Überblick 3. Emissionszertifikate
Markt oder Staat: Wann sollte der Staat eingreifen? Prof. Dr. Hanjo Allinger Technische Hochschule Deggendorf
 Markt oder Staat: Wann sollte der Staat eingreifen? Prof. Dr. Hanjo Allinger Technische Hochschule Deggendorf 0 Erster Hauptsatz der Wohlfahrtsökonomik Bei vollkommenem Wettbewerb ist jedes Marktgleichgewicht
Markt oder Staat: Wann sollte der Staat eingreifen? Prof. Dr. Hanjo Allinger Technische Hochschule Deggendorf 0 Erster Hauptsatz der Wohlfahrtsökonomik Bei vollkommenem Wettbewerb ist jedes Marktgleichgewicht
Zukunftsfähige Wasserkraft: Eine volkswirtschaftliche Sicht
 : Eine volkswirtschaftliche Sicht Werner Hediger Fachtagung Wasserkraft, Olten, 27. Juni 2018 FHO Fachhochschule Ostschweiz : Eine volkswirtschaftliche Sicht Nachhaltige Entwicklung (NE) Übersicht o Eine
: Eine volkswirtschaftliche Sicht Werner Hediger Fachtagung Wasserkraft, Olten, 27. Juni 2018 FHO Fachhochschule Ostschweiz : Eine volkswirtschaftliche Sicht Nachhaltige Entwicklung (NE) Übersicht o Eine
Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur. Wirtschaftspolitik. 1 Instrumente und Beurteilungskriterien
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dr. Kai Kohler Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Sommersemester 2009 Wirtschaftspolitik
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dr. Kai Kohler Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Sommersemester 2009 Wirtschaftspolitik
Ökologische Steuerreform und Emissionshandel: Die wissenschaftliche Perspektive. Building Competence. Crossing Borders.
 : Die wissenschaftliche Perspektive Building Competence. Crossing Borders. Prof. Dr. Reto Schleiniger shie@zhaw.ch, 24. Oktober 2013 Inhalt Externe Kosten und deren Internalisierung Die Diskussion um die
: Die wissenschaftliche Perspektive Building Competence. Crossing Borders. Prof. Dr. Reto Schleiniger shie@zhaw.ch, 24. Oktober 2013 Inhalt Externe Kosten und deren Internalisierung Die Diskussion um die
Grundzüge der Umweltökonomie
 Grundzüge der Umweltökonomie von PD Dr. Klaus Georg Binder Verlag Franz Vahlen München Inhaltsverzeichnis Vorwort Abbildungsverzeichnis V XV Erstes Kapitel - Erklärungsansätze für das Zustandekommen von
Grundzüge der Umweltökonomie von PD Dr. Klaus Georg Binder Verlag Franz Vahlen München Inhaltsverzeichnis Vorwort Abbildungsverzeichnis V XV Erstes Kapitel - Erklärungsansätze für das Zustandekommen von
Nachhaltige Entwicklung im Europarecht
 Walter Frenz/Herwig Unnerstall Nachhaltige Entwicklung im Europarecht Theoretische Grundlagen und rechtliche Ausformung Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden Inhaltsverzeichnis Teill: Das Konzept der nachhaltigen
Walter Frenz/Herwig Unnerstall Nachhaltige Entwicklung im Europarecht Theoretische Grundlagen und rechtliche Ausformung Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden Inhaltsverzeichnis Teill: Das Konzept der nachhaltigen
Überblick. 1 Instrumente der Umweltpolitik. 2 Grundmodell. 3 Pigousteuer. 4 Beispiel: Klimapolitik in der Schweiz. Vorlesung 3: Pigou-Steuer 1/15
 Vorlesung 3: Pigou-Steuer 1/15 Überblick 1 Instrumente der Umweltpolitik 2 Grundmodell 3 Pigousteuer 4 Beispiel: Klimapolitik in der Schweiz orlesung 3: Pigou-Steuer 2/15 Vorgehensweise 1 Das umweltpolitische
Vorlesung 3: Pigou-Steuer 1/15 Überblick 1 Instrumente der Umweltpolitik 2 Grundmodell 3 Pigousteuer 4 Beispiel: Klimapolitik in der Schweiz orlesung 3: Pigou-Steuer 2/15 Vorgehensweise 1 Das umweltpolitische
Ceteris Paribus Der lateinische Ausdruck für andere Dinge gleichbleibend wird als Erinnerung daran verwendet, daß alle anderen als die gerade untersuc
 Definitionen Angebotskurve Ein Graph für die Zuordnungen von Güterpreisen und Angebotsmengen. Quelle: Mankiw, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Stuttgart 1999, Seite 80 Angebotsüberschuß Eine Situation,
Definitionen Angebotskurve Ein Graph für die Zuordnungen von Güterpreisen und Angebotsmengen. Quelle: Mankiw, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Stuttgart 1999, Seite 80 Angebotsüberschuß Eine Situation,
Das Profilfach "Sustainability"
 Das Profilfach "Sustainability" 1. Leitmotiv und Ausbildungsziel 2. Die beteiligten Lehrstühle 3. Die Struktur des Profilfachs "Sustainability" 4. Inhalte der einzelnen Lehrveranstaltungen 5. Berufsperspektiven
Das Profilfach "Sustainability" 1. Leitmotiv und Ausbildungsziel 2. Die beteiligten Lehrstühle 3. Die Struktur des Profilfachs "Sustainability" 4. Inhalte der einzelnen Lehrveranstaltungen 5. Berufsperspektiven
Volkswirtschaft Modul 2
 Volkswirtschaft Modul 2 Teil II Angebot und Nachfrage I: Wie Märkte funktionieren 2012 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH www.sp-dozenten.de Institut für Wirtschaftswissenschaft.
Volkswirtschaft Modul 2 Teil II Angebot und Nachfrage I: Wie Märkte funktionieren 2012 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH www.sp-dozenten.de Institut für Wirtschaftswissenschaft.
Erstellt von Krischan
 Erstellt von Krischan Was ist Volkswirtschaftslehre? Die Volkwirtschaftslehre betrachtet die Entscheidungen von Individuen und Gesellschaften über die Verwendung der knappen Ressourcen, die Ihnen von der
Erstellt von Krischan Was ist Volkswirtschaftslehre? Die Volkwirtschaftslehre betrachtet die Entscheidungen von Individuen und Gesellschaften über die Verwendung der knappen Ressourcen, die Ihnen von der
6. Einheit Wachstum und Verteilung
 6. Einheit Wachstum und Verteilung Wirtschaftswachstum und Wohlstand (1) Wachstum: Wirtschaftswachstum = Zunahme des realen Bruttoinlandsprodukts real = zu konstanten Preisen Beispiele (2006): Österreich:
6. Einheit Wachstum und Verteilung Wirtschaftswachstum und Wohlstand (1) Wachstum: Wirtschaftswachstum = Zunahme des realen Bruttoinlandsprodukts real = zu konstanten Preisen Beispiele (2006): Österreich:
Gliederung der ersten Vorlesungen und Übungen
 Seite 1 Gliederung der ersten Vorlesungen und Übungen Vorlesung 2 (heute): Vorlesung 3 (06. Mai.): Grundlagen Grundlagen / Kartelle und Kartellverbot Übung 1 (07.Mai) Mikroökonomische Grundlagen Vorlesung
Seite 1 Gliederung der ersten Vorlesungen und Übungen Vorlesung 2 (heute): Vorlesung 3 (06. Mai.): Grundlagen Grundlagen / Kartelle und Kartellverbot Übung 1 (07.Mai) Mikroökonomische Grundlagen Vorlesung
Begriffsdefinitionen:
 Begriffsdefinitionen: Zeitliche Einheiten: In der VWL unterscheidet man hauptsächlich zwischen drei zeitlichen Betrachtungsebenen, wobei diese in ihrem Umfang von denen abweichen, wie man sie in der BWL
Begriffsdefinitionen: Zeitliche Einheiten: In der VWL unterscheidet man hauptsächlich zwischen drei zeitlichen Betrachtungsebenen, wobei diese in ihrem Umfang von denen abweichen, wie man sie in der BWL
Übung zu Mikroökonomik II
 Prof. Dr. G. Rübel SS 2005 Dr. H. Möller-de Beer Dipl.-Vw. E. Söbbeke Übung zu Mikroökonomik II Aufgabe 1: Eine gewinnmaximierende Unternehmung produziere ein Gut mit zwei kontinuierlich substituierbaren
Prof. Dr. G. Rübel SS 2005 Dr. H. Möller-de Beer Dipl.-Vw. E. Söbbeke Übung zu Mikroökonomik II Aufgabe 1: Eine gewinnmaximierende Unternehmung produziere ein Gut mit zwei kontinuierlich substituierbaren
Alfred Endres. Umweltökonomie. 4., aktualisierte und erweiterte Auflage. Verlag W. Kohlhammer
 Alfred Endres Umweltökonomie 4., aktualisierte und erweiterte Auflage Verlag W. Kohlhammer Inhaltsverzeichnis Vorwort zur vierten Auflage 5 Vorwort zur dritten Auflage 7 Erster Teil Die Internalisierung
Alfred Endres Umweltökonomie 4., aktualisierte und erweiterte Auflage Verlag W. Kohlhammer Inhaltsverzeichnis Vorwort zur vierten Auflage 5 Vorwort zur dritten Auflage 7 Erster Teil Die Internalisierung
Übersicht. 1 Grenzen des Wachstums? 2 Ökonomische Konzepte der Nachhaltigkeit. 3 Solow-Hartwick-Regel. 4 Kritik der Solow-Hartwick-Regel
 Vorlesung 10: Erneuerbare Ressourcen 1/20 Übersicht 1 Grenzen des Wachstums? 2 Ökonomische Konzepte der Nachhaltigkeit 3 Solow-Hartwick-Regel 4 Kritik der Solow-Hartwick-Regel 5 Erneuerbare Ressourcen:
Vorlesung 10: Erneuerbare Ressourcen 1/20 Übersicht 1 Grenzen des Wachstums? 2 Ökonomische Konzepte der Nachhaltigkeit 3 Solow-Hartwick-Regel 4 Kritik der Solow-Hartwick-Regel 5 Erneuerbare Ressourcen:
Was ist Mikroökonomie? Kapitel 1. Was ist Mikroökonomie? Was ist Mikroökonomie? Themen der Mikroökonomie
 Was ist Mikroökonomie? Mikroökonomie handelt von begrenzten Ressourcen. Kapitel 1 Themen der Mikroökonomie Beschränkte Budgets, beschränkte Zeit, beschränkte Produktionsmöglichkeiten. Welches ist die optimale
Was ist Mikroökonomie? Mikroökonomie handelt von begrenzten Ressourcen. Kapitel 1 Themen der Mikroökonomie Beschränkte Budgets, beschränkte Zeit, beschränkte Produktionsmöglichkeiten. Welches ist die optimale
Dipl. laök L. Voget: Klimawandel zwischen Effizienz und Suffizienz. Die Notwendigkeit gesellschaftlicher und individueller Verhaltensänderungen
 Dipl. laök L. Voget: Klimawandel zwischen Effizienz und Suffizienz Die Notwendigkeit gesellschaftlicher und individueller Verhaltensänderungen Gliederung Einführung in die Nachhaltigkeit Das Verhältnis
Dipl. laök L. Voget: Klimawandel zwischen Effizienz und Suffizienz Die Notwendigkeit gesellschaftlicher und individueller Verhaltensänderungen Gliederung Einführung in die Nachhaltigkeit Das Verhältnis
Internalisierung externer Effekte
 Prof. Dr. Werner Smolny Sommersemester 2006 Dr. Ralf Scherfling Abteilung Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 05 Tel. 0731 50 24261 UNIVERSITÄT DOCENDO CURANDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik
Prof. Dr. Werner Smolny Sommersemester 2006 Dr. Ralf Scherfling Abteilung Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 05 Tel. 0731 50 24261 UNIVERSITÄT DOCENDO CURANDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik
2. Phase Bachelor Info-Veranstaltung
 2. Phase Bachelor Info-Veranstaltung 10.12.2014 Lehrstuhl für Finanzwissenschaft Studieninfo Bachelor 2. Phase, 10. Dezember 2014 1 1. Ziele und Themen des Schwerpunkts In Mikroökonomie (bzw. teilweise
2. Phase Bachelor Info-Veranstaltung 10.12.2014 Lehrstuhl für Finanzwissenschaft Studieninfo Bachelor 2. Phase, 10. Dezember 2014 1 1. Ziele und Themen des Schwerpunkts In Mikroökonomie (bzw. teilweise
Wirtschaftspolitik. 1Einführung
 Prof. Dr. Werner Smolny Sommersemester 2003 Abteilung Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 05 Tel. 0731 50 24261 Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Universität Ulm Werner.Smolny@mathematik.uni-ulm.de
Prof. Dr. Werner Smolny Sommersemester 2003 Abteilung Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 05 Tel. 0731 50 24261 Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Universität Ulm Werner.Smolny@mathematik.uni-ulm.de
Markt und Umwelt. Moritz Carmesin Markt und Umwelt. Moritz Carmesin. Externe Effekte. Grundprobleme der Umweltpolitik
 2.2.2009 Inhaltsverzeichnis 1 2 3 4 5 Definition Als externen Effekt (auch Externalität) bezeichnet man in der Volkswirtschaftslehre die unkompensierten Auswirkungen ökonomischer Entscheidungen auf unbeteiligte
2.2.2009 Inhaltsverzeichnis 1 2 3 4 5 Definition Als externen Effekt (auch Externalität) bezeichnet man in der Volkswirtschaftslehre die unkompensierten Auswirkungen ökonomischer Entscheidungen auf unbeteiligte
Theoriegeschichte 2. Neoklassik und Keynesianische Ökonomie
 Theoriegeschichte 2 Neoklassik und Keynesianische Ökonomie Neoklassik Marginalistische Revolution Subjektive Wertlehre Gleichgewichtstheorie Say sches Gesetz Unterschiede zur Klassik Konsequenzen für Wirtschaftspolitik
Theoriegeschichte 2 Neoklassik und Keynesianische Ökonomie Neoklassik Marginalistische Revolution Subjektive Wertlehre Gleichgewichtstheorie Say sches Gesetz Unterschiede zur Klassik Konsequenzen für Wirtschaftspolitik
Was könnte eine ökologische Steuerreform in der Schweiz leisten? Prof. Dr. Dr. h.c. Gebhard Kirchgässner
 Was könnte eine ökologische Steuerreform in der Schweiz leisten? Prof. Dr. Dr. h.c. Gebhard Kirchgässner Universität St. Gallen, Schweizerisches Institut für Aussenwirtschaft und Angewandte Wirtschaftsforschung
Was könnte eine ökologische Steuerreform in der Schweiz leisten? Prof. Dr. Dr. h.c. Gebhard Kirchgässner Universität St. Gallen, Schweizerisches Institut für Aussenwirtschaft und Angewandte Wirtschaftsforschung
Die Ökosteuer. Wie entwickelt sich die Ökosteuer in Deutschland und welche Wirkung hat sie?
 Die Ökosteuer Wie entwickelt sich die Ökosteuer in Deutschland und welche Wirkung hat sie? Gliederung Einführung der Ökosteuer Grundgedanken und Ziele Diskussionen vor 1999 Wirkung der Ökosteuer Theoretischer
Die Ökosteuer Wie entwickelt sich die Ökosteuer in Deutschland und welche Wirkung hat sie? Gliederung Einführung der Ökosteuer Grundgedanken und Ziele Diskussionen vor 1999 Wirkung der Ökosteuer Theoretischer
Umweltökonomie. Marktversagen als Ursache für Umweltprobleme (1) Gerald J. Pruckner. Wintersemester 2010/11
 c Gerald J. Pruckner, JKU Linz Marktversagen 1 / 21 Umweltökonomie Marktversagen als Ursache für Umweltprobleme (1) Gerald J. Pruckner Wintersemester 2010/11 c Gerald J. Pruckner, JKU Linz Marktversagen
c Gerald J. Pruckner, JKU Linz Marktversagen 1 / 21 Umweltökonomie Marktversagen als Ursache für Umweltprobleme (1) Gerald J. Pruckner Wintersemester 2010/11 c Gerald J. Pruckner, JKU Linz Marktversagen
Öffentliche Finanzen: Ausgabenpolitik
 Giacomo Corneo Öffentliche Finanzen: Ausgabenpolitik 44 überarbeitete Auflage Mohr Siebeck XI I Institutionen und Kennziffern der öffentlichen Ausgaben 1 1.1 Der öffentliche Sektor 3 1.2 Der Haushaltsplan
Giacomo Corneo Öffentliche Finanzen: Ausgabenpolitik 44 überarbeitete Auflage Mohr Siebeck XI I Institutionen und Kennziffern der öffentlichen Ausgaben 1 1.1 Der öffentliche Sektor 3 1.2 Der Haushaltsplan
Prof. Dr. Gerhard Mauch, HfWU. Seite 1
 www.hfwu.de Seite 1 Liberalisierung und Nachhaltigkeit Ökonomische Herausforderungen und Beschäftigungstrends in der Energiewirtschaft Seite 2 Übersicht Einleitung Was erwartet uns im 21. Jahrhundert?
www.hfwu.de Seite 1 Liberalisierung und Nachhaltigkeit Ökonomische Herausforderungen und Beschäftigungstrends in der Energiewirtschaft Seite 2 Übersicht Einleitung Was erwartet uns im 21. Jahrhundert?
Einführung in die Wohlfahrtsökonomie
 Henner Kleinewefers Einführung in die Wohlfahrtsökonomie Theorie - Anwendung - Kritik Verlag W. Kohlhammer Vorwort 11 I. Teil: Fragestellungen 1 Einführung 17 1.1 Die grundlegende Fragestellung 17 1.2
Henner Kleinewefers Einführung in die Wohlfahrtsökonomie Theorie - Anwendung - Kritik Verlag W. Kohlhammer Vorwort 11 I. Teil: Fragestellungen 1 Einführung 17 1.1 Die grundlegende Fragestellung 17 1.2
Warum Wachstum oft eine unverdient schlechte Presse hat
 Warum Wachstum oft eine unverdient schlechte Presse hat Referat zum Themenschwerpunkt Wirtschaftswachstum für den Wohlstand : Forum für Universität und Gesellschaft Bern, 27. Februar 2016 Prof. Dr. Aymo
Warum Wachstum oft eine unverdient schlechte Presse hat Referat zum Themenschwerpunkt Wirtschaftswachstum für den Wohlstand : Forum für Universität und Gesellschaft Bern, 27. Februar 2016 Prof. Dr. Aymo
Wirtschaftliche Herausforderungen der Roadmap 2050 für die Landwirtschaft
 Franz Sinabell Wirtschaftliche Herausforderungen der Roadmap 2050 für die Landwirtschaft Fachdialog Roadmap 2050 AUSTRIAN INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH Landwirtschaft und Landnutzung 23. November 2011
Franz Sinabell Wirtschaftliche Herausforderungen der Roadmap 2050 für die Landwirtschaft Fachdialog Roadmap 2050 AUSTRIAN INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH Landwirtschaft und Landnutzung 23. November 2011
IK Ökonomische Entscheidungen und Märkte
 IK Ökonomische Entscheidungen und Märkte LVA-Leiterin: Ana-Maria Vasilache Einheit 6/I: Märkte und Wohlfahrt (Kapitel 9) Märkte und Wohlfahrt Fragestellung: Ist die zum Gleichgewichtspreis produzierte
IK Ökonomische Entscheidungen und Märkte LVA-Leiterin: Ana-Maria Vasilache Einheit 6/I: Märkte und Wohlfahrt (Kapitel 9) Märkte und Wohlfahrt Fragestellung: Ist die zum Gleichgewichtspreis produzierte
Grundlagen der Volkswirtschaftslehre ( )
 Institut für Wirtschaftsmathematik Ökonomie Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (175.067) Wiederholung Externalitäten Konsum- und Produktionsexternalität, positive und negative Externalität Ökonomische
Institut für Wirtschaftsmathematik Ökonomie Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (175.067) Wiederholung Externalitäten Konsum- und Produktionsexternalität, positive und negative Externalität Ökonomische
Von. Prof. Dr. Andreas Seeliger
 Energiepolitik Einführung in die volkswirtschaftlichen Grundlagen Von Prof. Dr. Andreas Seeliger Verlag Franz Vahlen München Vorwort V 1 Einführung in die Energiepolitik 1 1.1 Zur Notwendigkeit von Energiepolitik
Energiepolitik Einführung in die volkswirtschaftlichen Grundlagen Von Prof. Dr. Andreas Seeliger Verlag Franz Vahlen München Vorwort V 1 Einführung in die Energiepolitik 1 1.1 Zur Notwendigkeit von Energiepolitik
Wachstum, Produktivität und der Lebensstandard
 Wachstum, Produktivität und der MB Steigerungen im Reales BIP pro Kopf (in 1995 $) von 1870 bis 2000 Land 1870 1913 1950 1979 2000 Jährliche prozentuale Wachstumsrate 1870-2000 Jährliche prozentuale Wachstumsrate
Wachstum, Produktivität und der MB Steigerungen im Reales BIP pro Kopf (in 1995 $) von 1870 bis 2000 Land 1870 1913 1950 1979 2000 Jährliche prozentuale Wachstumsrate 1870-2000 Jährliche prozentuale Wachstumsrate
Vorlesung 2 - Ressourcen
 Vorlesung 2 - Ressourcen anne.neumann2@mailbox.tu-dresden.de Technische Universität Dresden Lehrstuhl EnErgiewirtschaft / EnergyEconomics Energiewirtschaft 1 Vorlesung 2 (Ressourcen) Lehrstuhl EnErgiewirtschaft
Vorlesung 2 - Ressourcen anne.neumann2@mailbox.tu-dresden.de Technische Universität Dresden Lehrstuhl EnErgiewirtschaft / EnergyEconomics Energiewirtschaft 1 Vorlesung 2 (Ressourcen) Lehrstuhl EnErgiewirtschaft
Öl und Gas Im Fokus der Volkswirtschaft
 Öl und Gas Im Fokus der Volkswirtschaft Öl und Gas im Blickfeld der Öffentlichkeit Wirtschaftskammer Wien, 10.11. 2011 Kurt Kratena 0 14.11.2011 Globale Zukunft für Öl und Gas Inhalt: 1. Die Zukunft der
Öl und Gas Im Fokus der Volkswirtschaft Öl und Gas im Blickfeld der Öffentlichkeit Wirtschaftskammer Wien, 10.11. 2011 Kurt Kratena 0 14.11.2011 Globale Zukunft für Öl und Gas Inhalt: 1. Die Zukunft der
Einführung in die. Regulierungsökonomie. Juristische Fakultät Lehrstuhl für Steuerrecht und Wirtschaftsrecht Karsten Zippack, M.Sc.
 Einführung in die Regulierungsökonomie Juristische Fakultät Lehrstuhl für Steuerrecht und Wirtschaftsrecht Karsten Zippack, M.Sc. Regulierungsökonomie Wiederholung Was sind Märkte und wie lassen sich diese
Einführung in die Regulierungsökonomie Juristische Fakultät Lehrstuhl für Steuerrecht und Wirtschaftsrecht Karsten Zippack, M.Sc. Regulierungsökonomie Wiederholung Was sind Märkte und wie lassen sich diese
Übung Makroökonomie zur Vorlesung Makroökonomische Theorie (Montag Uhr und Mittwoch 8-10 Uhr HS Loh 3/4)
 Grundzüge der Volkswirtschaftslehre II Übung Makroökonomie zur Vorlesung Makroökonomische Theorie (Montag 10-12 Uhr und Mittwoch 8-10 Uhr HS Loh 3/4) Übungstermine Montag 12-14 Uhr und 14 16 Uhr HS 4 (M.
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre II Übung Makroökonomie zur Vorlesung Makroökonomische Theorie (Montag 10-12 Uhr und Mittwoch 8-10 Uhr HS Loh 3/4) Übungstermine Montag 12-14 Uhr und 14 16 Uhr HS 4 (M.
1 Themen und Konzepte der Volkswirtschaftslehre 5. 2 Die Marktwirtschaft und die Rolle des Staates Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 81
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Themen und Konzepte der Volkswirtschaftslehre 5 1 Begriffe 6 2 Aufgaben 8 3 Lernkarten 23 2 Die Marktwirtschaft und die Rolle des Staates 29 1 Begriffe 30 2 Aufgaben
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Themen und Konzepte der Volkswirtschaftslehre 5 1 Begriffe 6 2 Aufgaben 8 3 Lernkarten 23 2 Die Marktwirtschaft und die Rolle des Staates 29 1 Begriffe 30 2 Aufgaben
8., aktualisierte und erweiterte Auflage
 MikroÖkonomie 8., aktualisierte und erweiterte Auflage Robert S. Pindyck Daniel L. Rubinfeld ALWAYS LEARNING PEARSON Inhaltsverzeichnis Vorwort 15 Teil I Einführung - Märkte und Preise 23 Kapitel 1 Vorbemerkungen
MikroÖkonomie 8., aktualisierte und erweiterte Auflage Robert S. Pindyck Daniel L. Rubinfeld ALWAYS LEARNING PEARSON Inhaltsverzeichnis Vorwort 15 Teil I Einführung - Märkte und Preise 23 Kapitel 1 Vorbemerkungen
positive vs. normative Analyse der sozialen Präferenzen
 Einführung in die Wirtschaftspolitik 2-1 Prof Andreas Haufler (SoSe 2010) 2 Das Pareto Prinzip 21 Grundfragen der Wohlfahrtsökonomie positive vs normative Analyse der sozialen Präferenzen positiver Ansatz:
Einführung in die Wirtschaftspolitik 2-1 Prof Andreas Haufler (SoSe 2010) 2 Das Pareto Prinzip 21 Grundfragen der Wohlfahrtsökonomie positive vs normative Analyse der sozialen Präferenzen positiver Ansatz:
Kapitel 3: Externalitäten Kapitel im Lehrbuch / Inhalt
 Kapitel 3: Externalitäten Kapitel im Lehrbuch / Inhalt Im Perman: - Kapitel 5: Welfare Economics and the Environment Inhalt der Vorlesung: - Externalitäten im Umweltbereich - Staatliche Internalisierung
Kapitel 3: Externalitäten Kapitel im Lehrbuch / Inhalt Im Perman: - Kapitel 5: Welfare Economics and the Environment Inhalt der Vorlesung: - Externalitäten im Umweltbereich - Staatliche Internalisierung
Kapitel 12: Externalitäten
 Kapitel 12: Externalitäten Hauptidee: Eine Konsum oder Produktionsaktivität hat Auswirkungen auf andere Produzenten/Konsumenten und dies wird nicht in den Marktpreisen berücksichtigt. 12.1 Definitionen
Kapitel 12: Externalitäten Hauptidee: Eine Konsum oder Produktionsaktivität hat Auswirkungen auf andere Produzenten/Konsumenten und dies wird nicht in den Marktpreisen berücksichtigt. 12.1 Definitionen
Nachhaltigkeitsökonomik: Prinzipien
 Nachhaltigkeitsökonomik: Prinzipien What is sustainabilty economics? - Baumgärtner/ Quass Towards sustainability economics: principles and values - Söderbaum Eden Asfaha und Vera Fuchs 11.11.2014 Gliederung
Nachhaltigkeitsökonomik: Prinzipien What is sustainabilty economics? - Baumgärtner/ Quass Towards sustainability economics: principles and values - Söderbaum Eden Asfaha und Vera Fuchs 11.11.2014 Gliederung
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre
 Grundzüge der Volkswirtschaftslehre 2., überarbeitete Auflage von N. Gregory Mankiw Harvard University Aus dem amerikanischen Englisch übertragen von Adolf Wagner nach der 2. Auflage 2001 Schäffer-Poeschel
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre 2., überarbeitete Auflage von N. Gregory Mankiw Harvard University Aus dem amerikanischen Englisch übertragen von Adolf Wagner nach der 2. Auflage 2001 Schäffer-Poeschel
Zukunft der fossilen Rohstoffe Ausblick bis 2050
 50 Jahre ÖGEW Zukunft der fossilen Rohstoffe Ausblick bis 2050 11. November, Naturhistorisches Museum, Wien Dipl.Ing. Karl Rose Geschäftsführer Strategy Lab GmbH, Wien Zukunft der fossilen Energieträger?
50 Jahre ÖGEW Zukunft der fossilen Rohstoffe Ausblick bis 2050 11. November, Naturhistorisches Museum, Wien Dipl.Ing. Karl Rose Geschäftsführer Strategy Lab GmbH, Wien Zukunft der fossilen Energieträger?
Wirtschaftswachstum als ökologische und soziale Herausforderung
 Wirtschaftswachstum als ökologische und soziale Herausforderung Heinrich-Böll Stiftung Berlin, 15. Februar 2012 Gespräche zur Nachhaltigkeit der Wirtschaft III Nachhaltigkeit der Wirtschaft Demographische
Wirtschaftswachstum als ökologische und soziale Herausforderung Heinrich-Böll Stiftung Berlin, 15. Februar 2012 Gespräche zur Nachhaltigkeit der Wirtschaft III Nachhaltigkeit der Wirtschaft Demographische
Übersicht. 1 Wozu Ressourcenökonomie? 2 Ressourcen: Klassifikation. 3 Erschöpfliche Ressourcen: Erdöl und Hotelling Modell
 Vorlesung 8+9: Ressourcenökonomie Einführung+Hotelling Modell 1/11 Übersicht 1 Wozu Ressourcenökonomie? 2 Ressourcen: Klassifikation 3 Erschöpfliche Ressourcen: Erdöl und Hotelling Modell Vorlesung 8+9:
Vorlesung 8+9: Ressourcenökonomie Einführung+Hotelling Modell 1/11 Übersicht 1 Wozu Ressourcenökonomie? 2 Ressourcen: Klassifikation 3 Erschöpfliche Ressourcen: Erdöl und Hotelling Modell Vorlesung 8+9:
Verfügbarkeit, Knappheit und Nutzung nicht-erneuerbarer Ressourcen
 Univ.Ass. Mag. Dr. Ursula Liebhart IP Seltene Erden WS 2013/14 Verfügbarkeit, Knappheit und Nutzung nicht-erneuerbarer Ressourcen Birgit Bednar-Friedl 9. Oktober 2013 Institut für Volkswirtschaftslehre,
Univ.Ass. Mag. Dr. Ursula Liebhart IP Seltene Erden WS 2013/14 Verfügbarkeit, Knappheit und Nutzung nicht-erneuerbarer Ressourcen Birgit Bednar-Friedl 9. Oktober 2013 Institut für Volkswirtschaftslehre,
Szenarien für den europäischen Energiesektor bis 2050
 Szenarien für den europäischen Energiesektor bis 2050 Martin Schönfelder, Dogan Keles, Dominik Möst, Wolf Fichtner EnInnov 2010, Graz 10.02.2010 (IIP), Lehrstuhl für Energiewirtschaft KIT Universität des
Szenarien für den europäischen Energiesektor bis 2050 Martin Schönfelder, Dogan Keles, Dominik Möst, Wolf Fichtner EnInnov 2010, Graz 10.02.2010 (IIP), Lehrstuhl für Energiewirtschaft KIT Universität des
Why the European Union Should Adopt Formula Apportionment with a Sales Factor. Ebru Kurukiz Constantin Jucho Tomas Cigan
 Why the European Union Should Adopt Formula Apportionment with a Sales Factor Gruppe 7: Nurcan Simsek-Acar Ebru Kurukiz Constantin Jucho Tomas Cigan Agenda 1. Einführung 2. Separate Accounting vs. Formula
Why the European Union Should Adopt Formula Apportionment with a Sales Factor Gruppe 7: Nurcan Simsek-Acar Ebru Kurukiz Constantin Jucho Tomas Cigan Agenda 1. Einführung 2. Separate Accounting vs. Formula
Teil 3: Einfluss von ICT auf die Arbeitswelt
 Dipl.-Ing. Halit Ünver 19. November 2014 Datenbanken / Künstliche Intelligenz, FAW/n, Lehrstuhl für Informatik Teil 3: Einfluss von ICT auf die Arbeitswelt halit.uenver@uni-ulm.de Seite 2 Agenda Einführung
Dipl.-Ing. Halit Ünver 19. November 2014 Datenbanken / Künstliche Intelligenz, FAW/n, Lehrstuhl für Informatik Teil 3: Einfluss von ICT auf die Arbeitswelt halit.uenver@uni-ulm.de Seite 2 Agenda Einführung
Prof. Dr. K. Ott Leitplanken für einen nachhaltigen Biomasseanbau
 7. Vilmer Sommerakademie Biomasseproduktion der große Leitplanken für einen nachhaltigen Biomasseanbau Gliederung Der Begriff der Von einer Theorie der zu Leitplanken Ökologische und Soziale Auswirkungen
7. Vilmer Sommerakademie Biomasseproduktion der große Leitplanken für einen nachhaltigen Biomasseanbau Gliederung Der Begriff der Von einer Theorie der zu Leitplanken Ökologische und Soziale Auswirkungen
Die zukünftige Rolle von Kohle im internationalen Energiemix International Market Realities vs. Climate Protection?
 Die zukünftige Rolle von Kohle im internationalen Energiemix International Market Realities vs. Climate Protection? Hannover, Germany April 14 th, 2015 Inhalt Internationale Diskussion über Kohle und Klimapolitik
Die zukünftige Rolle von Kohle im internationalen Energiemix International Market Realities vs. Climate Protection? Hannover, Germany April 14 th, 2015 Inhalt Internationale Diskussion über Kohle und Klimapolitik
Operationalisierung einer Nachhaltigkeitsstrategie
 Alexandro Kleine Operationalisierung einer Nachhaltigkeitsstrategie Ökologie, Ökonomie und Soziales integrieren Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Michael von Hauff GABLER EDITION WISSENSCHAFT Inhaltsverzeichnis
Alexandro Kleine Operationalisierung einer Nachhaltigkeitsstrategie Ökologie, Ökonomie und Soziales integrieren Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Michael von Hauff GABLER EDITION WISSENSCHAFT Inhaltsverzeichnis
Kapitel 6: Erneuerbare natürliche Ressourcen
 Kapitel 6: Erneuerbare natürliche Ressourcen Kapitel im Lehrbuch / Inhalt Im Perman: Kapitel 14: The efficient and optimal use of natural resources Kapitel 17: Renewable resources Inhalt der orlesung:
Kapitel 6: Erneuerbare natürliche Ressourcen Kapitel im Lehrbuch / Inhalt Im Perman: Kapitel 14: The efficient and optimal use of natural resources Kapitel 17: Renewable resources Inhalt der orlesung:
Volkswirtschaftliche Grundlagen
 Themenbereich I: Volkswirtschaftliche Grundlagen 1 Volkswirtschaftliche Grundlagen Themenbereich I: Volkswirtschaftliche Grundlagen 2 Volkswirtschaftslehre Mikroökonomie Makroökonomie Wirtschaftspolitik
Themenbereich I: Volkswirtschaftliche Grundlagen 1 Volkswirtschaftliche Grundlagen Themenbereich I: Volkswirtschaftliche Grundlagen 2 Volkswirtschaftslehre Mikroökonomie Makroökonomie Wirtschaftspolitik
Besonderheiten von Gesundheitsgütern und ihre allokativen Konsequenzen
 Gesundheitsökonomik Besonderheiten von Gesundheitsgütern und ihre allokativen Konsequenzen 1. Einführung Welche Besonderheiten weisen Gesundheitsgüter auf (Beispiel: Impfstoff gegen Schweigegrippe, Organtransplantationen)?
Gesundheitsökonomik Besonderheiten von Gesundheitsgütern und ihre allokativen Konsequenzen 1. Einführung Welche Besonderheiten weisen Gesundheitsgüter auf (Beispiel: Impfstoff gegen Schweigegrippe, Organtransplantationen)?
Pressekonferenz. Thema: Vorstellung des Geburtenbarometers - Eine neue Methode zur Messung der Geburtenentwicklung
 Pressekonferenz mit Bundesministerin Ursula Haubner, Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz und Prof. Dr. Wolfgang Lutz, Direktor des Instituts für Demographie der
Pressekonferenz mit Bundesministerin Ursula Haubner, Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz und Prof. Dr. Wolfgang Lutz, Direktor des Instituts für Demographie der
Globalisierung, Nachhaltigkeit, Zukunft
 Globalisierung, Nachhaltigkeit, Zukunft Sind wir noch zu retten? Vortrag im Rahmen der DBU-Ausstellung KonsumKompass Prof. Dr. Estelle L.A. Herlyn Osnabrück, 30. Juli 2014 Agenda Aktuelle Herausforderungen
Globalisierung, Nachhaltigkeit, Zukunft Sind wir noch zu retten? Vortrag im Rahmen der DBU-Ausstellung KonsumKompass Prof. Dr. Estelle L.A. Herlyn Osnabrück, 30. Juli 2014 Agenda Aktuelle Herausforderungen
IK Ökonomische Entscheidungen und Märkte LVA
 IK Ökonomische Entscheidungen und Märkte LVA LVA-Leiter: Michael Noldi Einheit 9: Die Analyse von Wettbewerbsmärkten (Kap. 9) Märkte und Wohlfahrt IK WS 2014/15 1 Was bisher geschah! Kapitel 1 und 2: Beschreibung
IK Ökonomische Entscheidungen und Märkte LVA LVA-Leiter: Michael Noldi Einheit 9: Die Analyse von Wettbewerbsmärkten (Kap. 9) Märkte und Wohlfahrt IK WS 2014/15 1 Was bisher geschah! Kapitel 1 und 2: Beschreibung
Definitions of Fossil Fuel Subsidies
 Definitions of Fossil Fuel Subsidies Definitions used in Germany with examples Workshop für NGOs am 10. September 2015 in Berlin Rupert Wronski Wissenschaftlicher Referent Energiepolitik Forum Ökologisch-Soziale
Definitions of Fossil Fuel Subsidies Definitions used in Germany with examples Workshop für NGOs am 10. September 2015 in Berlin Rupert Wronski Wissenschaftlicher Referent Energiepolitik Forum Ökologisch-Soziale
4 Stabilitäts- und Wachstumspolitik
 3 Staatsversagen 3.1 Welche wirtschaftspolitischen Akteure kennen Sie? Welche Ziele verfolgen die Akteure im politischen Prozess? In welcher Beziehung stehen Politiker zu anderen politischen Akteuren?
3 Staatsversagen 3.1 Welche wirtschaftspolitischen Akteure kennen Sie? Welche Ziele verfolgen die Akteure im politischen Prozess? In welcher Beziehung stehen Politiker zu anderen politischen Akteuren?
DIE UMWELT IN EUROPA
 "'"?-,, DIE UMWELT IN EUROPA ZUSTAND UND AUSBLICK 2010 SYNTHESEBERICHT Synthesebericht: 10 Kernaussagen für das Jahr 2010 9 Der Zustand der Umwelt in Europa 13 Europa ist in hohem Maß auf natürliches Kapital
"'"?-,, DIE UMWELT IN EUROPA ZUSTAND UND AUSBLICK 2010 SYNTHESEBERICHT Synthesebericht: 10 Kernaussagen für das Jahr 2010 9 Der Zustand der Umwelt in Europa 13 Europa ist in hohem Maß auf natürliches Kapital
Das Profilfach»Sustainability«
 Das Profilfach»Sustainability«1. Leitmotiv und Ausbildungsziel 2. Die beteiligten Lehrstühle 3. Die Struktur des Profilfaches 4. Inhalte der Lehrveranstaltungen 5. Berufsperspektiven 6. Ansprechpartner
Das Profilfach»Sustainability«1. Leitmotiv und Ausbildungsziel 2. Die beteiligten Lehrstühle 3. Die Struktur des Profilfaches 4. Inhalte der Lehrveranstaltungen 5. Berufsperspektiven 6. Ansprechpartner
Wohlstand & Lebensqualität Zusammenfassung
 Einfacher Wirtschaftskreislauf Bruttoinlandsprodukt (BIP) Das BIP als Wohlstandsindikator misst die Wirtschaftsleistung (d. h. die erstellten Güter, abzüglich der Vorleistungen), die eine Volkswirtschaft
Einfacher Wirtschaftskreislauf Bruttoinlandsprodukt (BIP) Das BIP als Wohlstandsindikator misst die Wirtschaftsleistung (d. h. die erstellten Güter, abzüglich der Vorleistungen), die eine Volkswirtschaft
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre
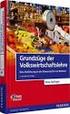 Grundzüge der Volkswirtschaftslehre von N. Gregory Mankiw Harvard University Aus dem amerikanischen Englisch übertragen von Adolf Wagner 1999 Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Inhalt Einführung 1 Zehn
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre von N. Gregory Mankiw Harvard University Aus dem amerikanischen Englisch übertragen von Adolf Wagner 1999 Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Inhalt Einführung 1 Zehn
Mikroökonomie: 1. Semester Vollzeit. Lösung zu der Aufgabensammlung. Prüfungsvorbereitung: Aufgabensammlung I
 Thema Dokumentart Mikroökonomie: 1. Semester Vollzeit Lösung zu der Aufgabensammlung Lösung Prüfungsvorbereitung: Aufgabensammlung I Aufgabe 1 Bezeichnen Sie die richtigen Aussagen. Das Menschenbild des
Thema Dokumentart Mikroökonomie: 1. Semester Vollzeit Lösung zu der Aufgabensammlung Lösung Prüfungsvorbereitung: Aufgabensammlung I Aufgabe 1 Bezeichnen Sie die richtigen Aussagen. Das Menschenbild des
Klimapolitik und Trumponomics
 Klimapolitik und Trumponomics Prof. Dr. Ottmar Edenhofer INSM Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft Berlin 18. Januar 2017 Die Emissionen steigen 2 Kumulative Emissionen wir sind nicht auf dem richtigen
Klimapolitik und Trumponomics Prof. Dr. Ottmar Edenhofer INSM Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft Berlin 18. Januar 2017 Die Emissionen steigen 2 Kumulative Emissionen wir sind nicht auf dem richtigen
Allgemeine Hinweise zur Klausur:
 Prof. Dr. B. Erke / Prof. Dr. Th. Siebe VWL (Bachelor Wirtschaft) März 2008 Allgemeine Hinweise zur Klausur: Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten Die maximale erreichbare Gesamtpunktzahl beträgt 90
Prof. Dr. B. Erke / Prof. Dr. Th. Siebe VWL (Bachelor Wirtschaft) März 2008 Allgemeine Hinweise zur Klausur: Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten Die maximale erreichbare Gesamtpunktzahl beträgt 90
Einführung in die Energie- und Umweltökonomik
 Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre insb. Wirtschaftspolitik Dr. Felix Stübben Klausur Einführung in die Energie- und Umweltökonomik im WS 2015/16 HINWEIS: Es sind sämtliche
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre insb. Wirtschaftspolitik Dr. Felix Stübben Klausur Einführung in die Energie- und Umweltökonomik im WS 2015/16 HINWEIS: Es sind sämtliche
Restriktive Fiskalpolitik im AS-
 Fiskalpolitik im AS-AD-Modell Restriktive Fiskalpolitik im AS- AD-Modell Eine Senkung des Budgetdefizits führt zunächst zu einem Fall der Produktion und einem Rückgang der Preise. Im Zeitverlauf kehrt
Fiskalpolitik im AS-AD-Modell Restriktive Fiskalpolitik im AS- AD-Modell Eine Senkung des Budgetdefizits führt zunächst zu einem Fall der Produktion und einem Rückgang der Preise. Im Zeitverlauf kehrt
Ein Gleichnis für die moderne Volkswirtschaft Die Regel vom komparativen Vorteil Anwendungen des Prinzips vom komparativen Vorteil...
 Inhalt Teil I Einführung... 1 Kapitel 1 Zehn volkswirtschaftliche Regeln... 3 Wie Menschen Entscheidungen treffen... 4 Wie Menschen zusammenwirken... 10 Wie die Volkswirtschaft insgesamt funktioniert...
Inhalt Teil I Einführung... 1 Kapitel 1 Zehn volkswirtschaftliche Regeln... 3 Wie Menschen Entscheidungen treffen... 4 Wie Menschen zusammenwirken... 10 Wie die Volkswirtschaft insgesamt funktioniert...
Kapitel 9: Marktgleichgewicht
 Kapitel 9: Marktgleichgewicht Hauptidee: In einem Wettbewerbsmarkt bestimmen Nachfrage und Angebot den Preis. Das Wettbewerbsgleichgewicht ist eine Vorhersage darüber, was zu erwarten ist, wenn jeder Marktteilnehmer
Kapitel 9: Marktgleichgewicht Hauptidee: In einem Wettbewerbsmarkt bestimmen Nachfrage und Angebot den Preis. Das Wettbewerbsgleichgewicht ist eine Vorhersage darüber, was zu erwarten ist, wenn jeder Marktteilnehmer
Robert Pindyck Daniell Rubinffeld
 Robert Pindyck Daniell Rubinffeld UfiS!lfi ;iii!' ' ; 1 - '>."- ' ' 'ü i I inhalttsübeirsoclht Vorwort 15 Teil! Kapitel 1 Kapitel 2 Teil Dl Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel
Robert Pindyck Daniell Rubinffeld UfiS!lfi ;iii!' ' ; 1 - '>."- ' ' 'ü i I inhalttsübeirsoclht Vorwort 15 Teil! Kapitel 1 Kapitel 2 Teil Dl Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel
Was verträgt unsere Erde noch?
 Was verträgt unsere Erde noch? Jill Jäger Was bedeutet globaler Wandel? Die tief greifenden Veränderungen der Umwelt, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten beobachtet wurden: Klimawandel, Wüstenbildung,
Was verträgt unsere Erde noch? Jill Jäger Was bedeutet globaler Wandel? Die tief greifenden Veränderungen der Umwelt, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten beobachtet wurden: Klimawandel, Wüstenbildung,
Christine Brandt Wintersemester 2004/2005. Wirtschaftswachstum
 Christine Brandt Wintersemester 2004/2005 Abteilung Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 01 Tel. 0731 50 24266 UNIVERSITÄT DOCENDO CURANDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Christine Brandt Wintersemester 2004/2005 Abteilung Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 01 Tel. 0731 50 24266 UNIVERSITÄT DOCENDO CURANDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
