KONZEPT UND ERFORSCHUNG VON DEUTSCH-ALS-FREMDSPRA- CHE-LERNERVARIETÄTEN
|
|
|
- Nele Krause
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Germanistische Studien X (2016) KONZEPT UND ERFORSCHUNG VON DEUTSCH-ALS-FREMDSPRA- CHE-LERNERVARIETÄTEN Ágnes Huber 0. Einleitende Gedanken Multikulturelle Einflüsse der Globalisierung machen sich in allen Lebensbereichen, auch hinsichtlich der Fremdsprachenkompetenz bemerkbar. Dem Erlernen von Fremdsprachen, v.a. dem der großen Sprachen 1, zu denen neben dem Englischen, der Lingua franca unserer Zeit, u.a. auch das Deutsche gehört, kommt eine immer größere Bedeutung zu. Mit der erhöhten Nachfrage nach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache geht, sowohl innerhalb der deutschsprachigen Länder, als auch im europäischen Ausland (vor allem in den osteuropäischen Ländern), ein erhöhter Bedarf an gut ausgebildeten Lehrkräften, geeigneten Lehrmaterialien und nicht zuletzt Forschungen bez. des Sprachlernprozesses einher. Die vorliegende Arbeit beabsichtigt, einen Beitrag zum letzterwähnten Punkt zu leisten: Sie gewährt einen Einblick in die beim Erlernen von Fremdsprachen entwickelte sog. Lernervarietät sowie als Hinführung zum Thema, ohne Anspruch auf Vollständigkeit bezüglich der Darstellung der Spracherwerbsmodelle 2, in die Strategien kontrastive Analyse und Fehleranalyse. Die Zielsetzung ist Grundbegriffe zu klären und die als relevant erachteten themenbezogenen Ansätze vorzustellen, ferner das methodische Potenzial der Korpuslinguistik auch anhand eines Großprojektes und eines im Aufbau befindlichen Lernerkorpus für den Einsatz in der Erforschung der Lernervarietät zu erörtern. Vorab zu klären ist die Tatsache, dass hier nur das gesteuerte, bewusste, institutionalisierte, durch Unterricht gelenkte, d.h. domestizierte (Klein 1992: 31) (Fremd)Sprachenlernen, nicht aber der natürliche, implizite, unbewusste 1 2 Zum Stellenwert der großen Sprachen siehe Nelde (1996: 109). Zum Nachschlagen der Spracherwerbsmodelle bieten sich u.a. folgende Werke an: Bausch/ Christ/Krumm (2007); Storch (1999); Rösch (2011).
2 194 Ágnes Huber (Erst- oder Zweit-) Spracherwerb 3 behandelt wird. Als Grunddichotomie wird, von der terminologischen Vielfalt 4 selektierend, das Begriffspaar Muttersprache 5 Fremdsprache 6 bevorzugt verwendet, v.a. in den Zitaten erscheinen aber auch weitere synonym gebrauchte Termini. 1. Kontrastive Analyse Kontrastivität, das Grundkonzept der kontrastiven Analyse, lässt sich mitnichten auf eine bestimmte sprachwissenschaftliche Disziplin einengen, sie ist als eine, auf allen Ebenen der Systemlinguistik einsetzbare Herangehensweise zu verstehen, die zwei Sprachen ausgehend von ihrer strukturalistischen Beschreibung vergleicht und nach gemeinsamen sowie abweichenden Merkmalen sucht. Vorliegender Beitrag befasst sich mit Fragestellungen der Fremdsprachenerwerbsforschung: Laut Hessky (1994, zit. nach Brdar-Szabó 2010: 519) bezieht sich Kontrastivität in diesem Sinne auf die Berücksichtigung des Verhältnisses zwischen der Muttersprache (MS) und der Fremdsprache (FS). Brdar-Szabó (ebd.: 520) führt die Definition weiter aus und definiert die Methode als [ ] die explizite Bewusstmachung von Unterschieden, Ähnlichkeiten und Identitäten in den Form- und Funktionszuordnungen als Strategie des kognitiven Lernens sowie [ ] die implizite Bewusstmachung von Kontrasten und Kontrastmangel in Situationen des Zweitspracherwerbs zur optimalen Steuerung des Lernprozesses. Wie Brdar-Szabó (ebd.: 522) betont, ist Kontrastivität nicht mit der angewandten kontrastiven Linguistik oder mit der Kontrastivhypothese zu verwechseln. Die angewandte kontrastive Linguistik erzielt, durch synchrone Sprachvergleiche einen Beitrag zur Verbesserung des Fremdsprachenunterrichts zu erreichen (Bausch/Raabe 1978: 56f.). Auf die Kontrastivhypothese deren extreme, z.t. aber auch falsch interpretierte Auffassungen die kontrastive Linguistik in einen üblen Ruf brachten (Brdar-Szabó 2010: 522) soll im Folgenden eingegangen werden Der in der einschlägigen Fachliteratur oft erscheinenden strikten Verwendung der beiden Begriffe Erwerb/erwerben und Lernen/(er)lernen wird in der vorliegenden Arbeit nicht gefolgt, es geht ja hier ausschließlich um das Phänomen Deutsch als Fremdsprache. Siehe u.a. bei Kniffka/Siebert-Ott (2012: 29). Das authentische, durch Automatismen gekennzeichnete Kommunikationsmittel (Bergner/ Zehetmair 2014: 5). Fremd nicht nur im Sinne unbekannt und fern, sondern auch die Spannung des faszinierenden, zu entdeckenden Neuen enthaltend (Hernig 2005: 15).
3 Konzept und Erforschung von Deutsch-als-Fremdsprache-Lernervarietäten 195 Das Aufeinandertreffen zweier Sprachen resp. Sprachsysteme beim Lernprozess zieht selbstverständlich die gegenseitige Beeinflussung der Varietäten nach sich: Nach der [von Fries in den 1940er Jahren initiierten und von Lado weitergeführten] 7 Kontrastivhypothese werden die Mechanismen des Zweitspracherwerbs primär durch die Struktur der Erstsprache des Lerners gesteuert (Brdar-Szabó 2010: 521). Laut der starken Version der Hypothese beeinflusst die Muttersprache den Fremdsprachenerwerb so, dass identische Elemente leicht erlernbar sind, abweichende dagegen Lernschwierigkeiten und damit Fehler verursachen (Edmondson/House 1993: 208). Die schwache Version formuliert vorsichtiger und liegt der Realität gewiss näher 8, ist aber an sich wenig aussagekräftig sie behauptet, dass manche Fehler auf die interlingualen Unterschiede zurückzuführen sind (ebd.: 210). Aus der Tatsache der Einwirkung der Muttersprache auf die Fremdsprache folgt, dass es beim Fremdsprachenlernen zu Transfererscheinungen kommt. Transfer, mit Lado (1967, zit. nach Juhász 1970: 30) die Übernahme muttersprachlicher Gewohnheiten in die Zielsprache, kann sowohl positiv, d.h. ohne Fehlerbildung, als auch negativ, d.h. Fehlerbildung verursachend, verlaufen (Edmondson/House 1993: 208). Negativer Transfer wird auch Interferenz genannt. Juhász (1970: 9), dessen empirische Ergebnisse auch heute noch beeindruckend und lehrreich erscheinen, definiert das Phänomen als die durch die Beeinflussung von anderen sprachlichen Elementen verursachte Verletzung einer sprachlichen Norm bzw. der Prozeß [sic!] der Beeinflussung. 9 Der Unterschied zwischen den beiden Phänomenen Transfer und Interferenz besteht also lediglich im linguistischen Ergebnis (ebd.: 32). 10 Die kontrastive Analyse wurde starker Kritik unterzogen 11, außer Zweifel steht m.e. dennoch, dass die Strategie des systematischen linguistischen Vergleichs der Mutter- und der Fremdsprache in Kombination mit anderen Konzepten und Techniken didaktisch nützlich, sogar unerlässlich in der einschlägigen Forschungspraxis ist. In den folgenden Punkten sollen weitere Spracherwerbs (Abruf: ) Außer Zweifel steht nämlich, dass u.a. auch ein Kontrastmangel zu Fehlern führen kann (Edmondson/House 1993: ; Juhász 1970: 92f.), laut der Statistik von Juhász (ebd.: 22) ist aber für mehr als 50 % der Fehler die interferierende Wirkung der Muttersprache verantwortlich. Zur Interferenz kann es nicht nur zwischen Mutter- und Fremdsprachen kommen, es können auch innerhalb einer Sprache Interferenzerscheinungen beobachtet werden (Juhász 1970: 9). Dabei soll angemerkt werden, dass es in der einschlägigen Fachliteratur auch andere Definitionsvorschläge zu den Begriffen Transfer und Interferenz zu finden sind: siehe Wode (1984/84: 21). Näheres zu den Kritikpunkten und der aktuellen Bewertung des Ansatzes siehe bei Brdar- Szabó (2010: 520f.).
4 196 Ágnes Huber strategien behandelt werden, die sich als kooperierende Ansätze für empirische Erhebungen anbieten. 2. Fehleranalyse Fehleranalyse entwickelte sich Mitte der 1960er Jahre als Zweig der Angewandten Linguistik, die Methode der Filterung fehlerhafter Verwendungen aus fremdsprachlichen Äußerungen ist aber wahrscheinlich so alt wie der Fremdsprachenunterricht selbst (Edmondson/House 1993: 204). Trotz der Tatsache, dass die Grundidee des Konzeptes nicht als revolutionär gelten kann, bietet die Strategie im Vergleich zur kontrastiven Analyse eindeutige Vorteile, weil sie sich an das Forschungsziel, d.h. an den Lernprozess sowie das Lernprodukt annähert und langfristig Informationen zu diesen bieten kann (Kasper 1995: 263f.). Fehler können nicht ausschließlich als Anzeichen dafür betrachtet werden, dass die Lernenden den im Unterricht vermittelten Lernstoff sich nicht erwartungsgemäß angeeignet haben was bis zu den 1960er Jahren als Sünde des Fremdsprachenler ners gesehen wurde (Kleppin 2000: 986), sie indizieren auch die Tatsache, dass Lerner dabei sind, sich das System der Zielsprache zu erschließen und dass dabei verschiedene Hypothesen aufgestellt werden, bei deren Nichtzutreffen ein Fehler auftritt (Edmondson/House 1993: 204). Ein objektiver Zugang zur Sprachbeherrschung der Lerner kann durch die Fehleranalyse keineswegs geschaffen werden auf welchem Sprachniveau sich Lerner gerade befinden, wird durch die Fehler, die jeweilig gemessenen Teilaspekte betreffend, nur durch die Distanz zur zielsprachlichen Norm gezeigt (Kohn 1990: 186). Fehleranalyse stellt einen in bestimmte Arbeitsschritte teilbaren komplexen Prozess dar, wobei anzumerken ist, dass die Stadien natürlich nicht isolierbar und voneinander unabhängig zu betrachten sind. Die Tätigkeit der Fehleranalyse setzt mit der in der Fachliteratur oft vernachlässigten, doch, wie Kasper bereits 1975 in ihrer Dissertation zeigte, breit gefächerten und viele Fragen aufwerfenden Phase der Fehleridentifizierung an, wobei grundlegende Kriterien wie Grammatikalität, Akzeptabilität, Angemessenheit und der Normbegriff geklärt werden müssen (Kasper 1975: I VII). Je nach Forschungsinteresse lassen sich weitere Arbeitsphasen bestimmen wie z.b. Fehlerbeschreibung, -erklärung, -korrektur, -bewertung, -klassifizierung sowie als langfristige Zielsetzungen Fehlertherapie, -prognose und -prophylaxe. 12 Von den erwähnten Stadien soll hier kurz auf den Punkt Fehlerklassifizierung eingegangen werden, wobei wir uns nicht der grundsätzlichen Problematik der Gliederung widmen 13, sondern von den zahlreichen Vorschlägen in der Fachliteratur einige Klassifizierungsmöglichkeiten hervorheben und kurz skizzieren möchten: Corder (1967, zit. nach Edmondson/ Eine ausführlichere Darstellung siehe bei Kleppin (2000). Zu den Problemen in puncto Fehlerklassifizierung siehe Edmondson/House (1993: 205f.).
5 Konzept und Erforschung von Deutsch-als-Fremdsprache-Lernervarietäten 197 House 1993: 205f.) schlägt eine Unterscheidung zwischen errors (Normverstöße, die vom Lerner nicht als Fehler wahrgenommen werden), mistakes (soziale Normverstöße) und lapses (Flüchtigkeitsfehler, Versprecher, die der Lerner selbst erkennen kann) vor. Bei Königs (1995), der sich ausführlich mit dem Bereich der Fehlerkorrektur auseinandersetzt, erscheint eine Gliederung linguistischer Art 14 und Knapp-Potthoff (1987) nimmt in ihrem unkonventionellen Klassifizierungsvorschlag die Lernerperspektive ein. 15 Die Strategie der Fehleranalyse resümierend können einige Faktoren angeführt werden, die unbestritten als Vorteile der Methode im Vergleich zur kontrastiven Analyse gelten: Der Lernprozess bzw. in erster Linie die Lerneräußerungen werden in die Untersuchung miteinbezogen, neben den linguistischen erscheinen auch didaktisch begründete Bewertungsaspekte und bei der Fehlererklärung werden auch kontextuelle und sprachpsychologische Faktoren zunehmend berücksichtigt (Bausch/Christ/Krumm 1995: 263f.). Warum die Forschungstechnik der Fehleranalyse dennoch weiterer Ergänzungen bedarf, liegt in erster Linie neben der bereits erwähnten Norm- und Typologisierungsproblematik daran, dass die Fehler oft isoliert als statische Sprachprodukte betrachtet werden (ebd.) und dem dynamischen Spracherwerbsprozess, den korrekten Äußerungen und dem Lernerindividuum nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt wird (Bausch/Raabe 1978: 60). Auf welche Weise die Lernersprachenanalyse resp. das Konzept der Lernervarietät die Resultate der Vorgängerstrategien verfeinern und bereichern kann, wird im nächsten Kapitel erläutert. 3. Lernersprachenanalyse Das Lernersprachenkonzept ist ein interdisziplinär-integrativer, in breiten Fachkreisen akzeptierter (Rösch 2011: 24) Forschungsansatz des Zweit- bzw. Fremdsprachenerwerbs 16, das sich in den 1970er 80er Jahren herausgebildet hat (Vogel 1990: 15, 21). Im Unterschied zu den beiden, in den vorigen Kapiteln behandelten Theorien strebt sie an, die gesamte Lernerperformanz d.h. sowohl die fehlerhaften als auch die korrekten Strukturen zu untersuchen (ebd.: 18; Kasper 1995: 264), den Ausgangspunkt bilden dabei authentische fremdsprach Z.B. R(echtschreibf), W(ortwahlf), A(usdruckf), T(empusf), Det (falscher Artikelgebrauch), Pron (falscher Pronomengebrauch), Präp (falsche Präposition, Konj (falsche Konjunktion) (Königs 1995: 269). Z.B. Fehler, die man mit Überzeugung gemacht hat, weil man sich bezüglich der aufgestellten Hypothese absolut sicher war ; Fehler, die man absichtlich macht ; Fehler, die man selbst korrigieren kann (Knapp-Potthoff 1987, zit. nach Edmondson/House 1993: 206f.). Die allgemeine Akzeptanz verdankt die Lernersprachentheorie den Tatsachen, dass sie sich dazu eignet, andere Ansätze zu integrieren und wegen der durchlässigen Formulierung des Grundkonzeptes viel Raum für weitere Ergänzungen, Präzisierungen bietet (Wode 1984/85: 48f.).
6 198 Ágnes Huber liche Äußerungen (Brdar-Szabó 2010: 522). Die grundsätzliche Zielsetzung der Lernersprachenanalyse ist es, dem Mechanismus des Fremdsprachenlernens näherzukommen (Klein 1992: 10), konkret zu erfahren, nach welchen Gesetzmäßigkeiten der Erwerbsprozeß [sic!] abläuft und welche Faktoren ihn steuern (ebd.: 13f.). Es wurden diverse Theorie-Varianten des Grundmodells seit Selinkers Interlanguagehypothese (1972) erarbeitet und zu diesen mehrere Termini Interlanguage, Interimsprache, Intersprache, Zwischensprache, Lernersprache, Lernervarietät in Bezug auf die Untersuchungseinheit vorgeschlagen. Auf die verschiedenen Lernersprachenkonzepte 17 und die terminologischen Differenzen soll im vorliegenden Beitrag nicht näher eingegangen werden, im Fokus des Interesses steht vielmehr die Charakterisierung des Fremdsprachenlernprozesses resp. der Lernervarietät selbst. Die Lernersprachenanalyse geht von der Annahme aus, dass Lerner im Laufe des Spracherwerbs Zwischensysteme, sog. Lernersprachen oder Lernervarietäten aufbauen (Sitta 1991: V). Es wird hier keine definitorische Abklärung angestrebt, es sollen aber an dieser Stelle drei Lernersprache-Erläuterungen zitiert werden, damit das Phänomen in einem zweiten Schritt charakterisiert und näher beleuchtet werden kann: Mit Lernersprache bezeichnen wir das Sprachgebilde, das sich in einem Fremdsprachenlerner infolge der Konfrontation mit zielsprachlichen Daten herausbildet, ohne dabei jedoch völlig mit der jeweiligen Zielsprache identisch zu sein. (Vogel 1990: 13) Beim Zweitspracherwerb bilden Lernende Lernersprachen aus. Dabei handelt es sich um grammatische Systeme, die Elemente der Zielsprache und der Erstsprache enthalten und außerdem Elemente, die weder in der Ziel- noch in der Erstsprache zu finden sind. (Rösch 2011: 24) Unter dem Begriff Lernervarietät wird die erfolgreiche bzw. nicht erfolgreiche Dynamik der Aneignung einer zweiten Sprache in verschiedenen Übergangsstadien von der Ausgangssprache bis hin zur Zielsprache verstanden. (Dittmar 1997, zit. nach Walter/Grommer 2008: 6) Ausgehend von den Definitionen ist Lernersprache eine eigenständige, von der vorhandenen Sprachkompetenz der Lerner, von den neu erworbenen sprachlichen Inhalten sowie von sonstigen, annehmbar universellen Spracherwerbszügen beeinflusste Varietät, bei der die Muttersprache, die gelernte Fremdsprache und andere beherrschte bzw. gekannte Sprachen die tragende Rolle spielen und deren Erwerb zwar zielorientiert, dennoch von vielen Faktoren abhängig sowie unsicher, also nicht vorhersagbar ist. Die Lernervarietät entfaltet sich nicht gleichmäßig und linear, man kann eher von wellenförmigen Entwicklungsabläufen ausgehen, die manchmal schneller, 17 Zu den Theorien siehe z.b. Klein (1992) und Vogel (1990).
7 Konzept und Erforschung von Deutsch-als-Fremdsprache-Lernervarietäten 199 manchmal langsamer und manchmal überhaupt nicht fortschreiten (Apeltauer 1995: 116, 128). Im letzterwähnten Fall, d.h. wenn die Entwicklung stockt und bestimmte Übergangsformen, die der Norm der Fremdsprache (noch) nicht entsprechen, sich verfestigen, spricht man von Fossilierung (ebd.: 116, Edmondson/ House 1993: 218) und wenn die gefestigte, also nicht mehr weiter ausgebaute Lernervarietät in dieser unreifen Form, also in einem zu frühen Lernstadium in natürlichen Kommunikationssituationen verwendet wird, kommt es zur Pidginisierung der Interlanguage. Pidgins 18 sind laut Vogel (1990: 16) [ ] grammatisch und lexikalisch stark vereinfachte und reduzierte Sprachen, die im Gegensatz zum Kreol nicht als Muttersprache, sondern immer nur als Zweitsprache von Sprechern verschiedener Ausgangssprachen erworben werden und die als Verständigungsmittel für eng begrenzte soziale Kontakte fungieren. Das Miteinbeziehen der Teildisziplin Pidginsprachenforschung in die Praxis der Erforschung von Lernervarietäten erscheint aus dem Grunde relevant, da ihre Resultate mit denen der Lernersprachenanalyse weitgehend vereinbar sind (Vogel 1990: 21). Die bisherigen Überlegungen zu den Eigenschaften der Lernersprache zusammenfassend sind diese spezifischen Varietäten individuelle, keine sozialen Phänomene, sie entstehen aus dem Zusammenwirken von mindestens zwei Sprachen, verfügen wegen der fehlenden Anwendungsautomatismen und wegen Wissenslücken über zahlreiche instabile Komponenten, trotzdem besitzen sie eine bestimmte innere Systematik und Autonomie, sie sind variabel 19, d.h. stark zeitund situationsabhängig, ihre Entwicklung wird überwiegend bewusst gesteuert, ist zielorientiert, dynamisch, ungleichmäßig, wellenartig und leicht störbar (Klein 1992: 40f., Kniffka/Siebert-Ott 2012: 45f.; Vogel 1990: 13f.). Trotz der bereits erwähnten breiten Akzeptanz des Ansatzes erfährt die Lernersprachenanalyse auch Kritik interessanterweise wird in diesem Zusammenhang dasselbe Argument aufgeführt, das zur Verbreitung des Modells beigetragen hat: Lernervarietäten seien nicht ausreichend konkret und eng definiert worden (Sitta 1991: V). In einem Punkt sind sich allerdings alle einig: Es bedarf weiterer empirischer Studien, um zu erfahren, was innerhalb der einzelnen Erwerbssequenzen des Lernprozesses abläuft und wie das Phänomen Lernervarietät auf den verschiedenen Niveaustufen 20 beschrieben werden kann. Um sich dieser mit Zur Beschreibung der Disziplin Pidginforschung und des Phänomens Pidginsprache siehe Klein (1992) und diverse Aufsätze im Band HSK Soziolinguistik (Ammon u.a. 2004). Die Variabilität von Lernersprachen kann nicht mit der systematischen Varianz von natürlichen Sprachen gleichgesetzt werden Näheres bzw. eine Begründung siehe bei Vogel (1990: 51 54). Man denke in diesem Zusammenhang nicht nur an die GER-Niveaustufen von Grießhaber (2009) wurde z.b. ein Sechs-Profilstufen-Modell zur Lernersprache ermittelt (Rösch 2011: 51).
8 200 Ágnes Huber Diehl (1991: 6) in ihrer Ganzheit momentan utopistisch erscheinenden Zielsetzung zumindest anzunähern, bietet sich die Kooperation der aufgeführten Strategien, d.h. der Rahmenkonzepte kontrastive, Fehler- und Lernersprachenanalyse, ferner das Heranziehen des methodischen Instruments der im folgenden Kapitel knapp behandelten Disziplin Korpuslinguistik als ein möglicher Lösungsweg an. 4. Korpuslinguistik, Lernerkorpuslinguistik Es wurde bereits erwähnt, dass die Lernersprachenanalyse die konkreten Sprachprodukte, d.h. die fremdsprachlichen Äußerungen der Lerner erforscht. Korpuslinguistik in diesem Sinne bietet sich als methodisches Instrument an, da sie derselben Zielsetzung folgt, d.h. Sprachgebrauch anhand von authentischen Sprachdaten zu untersuchen (Scherer 2006: 2) bezweckt. Mit der Kooperation und Verknüpfung der beiden Disziplinen Zweitsprachenerwerbforschung und (Lerner)Korpuslinguistik beschäftigt sich der von Walter und Grommes 2008 herausgegebene Sammelband, in dem durch verschiedene empirische Studien gezeigt wird, wie die beiden Fachbereiche sich gegenseitig befruchten können (Walter/Grommer 2008: 1). Das Ergebnis der Fusion heißt Lernerkorpuslinguistik eine verhältnismäßig junge Disziplin, da Lernerkorpora erst seit den 1990er Jahren, v.a. zur englischen Sprache aufgebaut wurden 21 (ebd. 15). Im Fokus des Interesses stehen in möglichst natürlichen, kommunikativen Kontexten d.h. nicht explizit für eine linguistische Untersuchung entstandene geschriebene Texte fortgeschrittener Lerner. 22 Der Grund liegt darin, dass Essays nicht von Anfängern erstellt werden können (ebd.: 16). Als Beispiel für Lernerkorpora sei Falko 23, ein frei zugängliches fehlerannotiertes Korpus des Deutschen als Fremdsprache angeführt, das an der Humboldt-Universität zu Berlin entstanden ist und sich aus sechs Subkorpora (Lernerkorpus, muttersprachliches Kontrollkorpus und Vorlagenkorpus) zusammensetzt. Die Größe des Lernersubkorpus beträgt insgesamt Tokens. Die Lernertexte sind Textzusammenfassungen von linguistischen und literaturwissenschaftlichen Fachtexten, die von fortgeschrittenen Deutschlernern unter Prüfungsbedingungen entstanden sind. Neben Falko soll ein, mit dem Großprojekt verglichen bescheidenes, im Aufbau befindliches Lerner- bzw. Aufsatzkorpus als weiteres Beispiel kurz her Es gilt als Forschungsdesiderat, Lernerkorpora auch in anderen Sprachen aufzubauen (Walter/ Grommes 2008: 15). Fortgeschrittene Lerner wurden bei der Erforschung des Zweitspracherwerbs typischerweise vernachlässigt, da man sich auf die Beschreibung des frühen Spracherwerbsstadiums konzentrierte (Walter/Grommes 2008: 4). (Abruf: )
9 Konzept und Erforschung von Deutsch-als-Fremdsprache-Lernervarietäten 201 angeführt werden. Das Korpus (im Sommersemester 2014/15 erstellte 55 Essays), dessen aktuelle Tokenanzahl beträgt, stammt von fortgeschrittenen Lernern, von Germanistikstudenten der Eötvös-Loránd-Universität Budapest und wurde bzw. wird von der Verfasserin des vorliegenden Beitrages erstellt. Das Thema resp. der vorgegebene Titel der Essays lautet So habe ich Deutsch gelernt. Das Korpus soll zukünftig sowohl sprachlich-grammatisch als auch inhaltlich einer sorgfältigen Analyse unterzogen werden. Bei der Interpretation der Texte wird auch dem beim Fremdsprachenlernen besonders relevanten Aspekt Sprachbewusstheit besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Von den Domänen der Sprachbewusstheit (James und Garrett 1991, nach Wolff 2002: 33) muss man die kognitive 24 und die auf die Performanz bezogene 25 unbedingt in die Untersuchung miteinbeziehen, die affektiven Aspekte 26 sollen aber auch nicht vernachlässigt werden. Bei der empirischen Arbeit empfiehlt es sich und diese Feststellung soll auch als Fazit und abschließender Gedanke der Überlegungen des Beitrages gelten den elementaren Fragestellungen der Zweitspracherwerbsforschung, d.h. (vereinfacht und keine Vollständigkeit anstrebend aufgelistet): wie das Erlernen einer Fremdsprache prozessual abläuft, wie die Sequenzen des Lernvorgangs (möglichst allgemeingültig) charakterisiert werden können, im Hinblick auf welche Merkmale sich (v.a. fortgeschrittene) Lernervarietäten von der Muttersprache und in erster Linie von der Fremdsprache unterscheiden und in welchen Fällen die von der Norm der Fremdsprache abweichenden Äußerungen mit der Interferenz, mit dem Kontrastmangel oder sonstigen, z.t. universell geltenden Faktoren erklärt werden können, wie die Gewährspersonen den eigenen Fremdsprachenerwerbsprozess beschreiben und beurteilen, bewerten integrativ, d.h. durch die Verwendung der Erkenntnisse von den wichtigsten beteiligten wissenschaftlichen Disziplinen und Ansätzen nachzugehen. In einem breiteren Kontext sollten u.a. die Bereiche Linguistik, Psychologie, Soziologie, Erziehungswissenschaft, in einem engeren Kontext u.a. die im vorliegenden Beitrag dargestellten Modelle Fehler-, kontrastive und Lernersprachenanalyse mitwirken [ ] in der kognitiven Domäne geht es um die Entwicklung von Bewusstheit für Kategorien und Sprachregeln (James und Garrett 1991, nach Wolff 2002: 33). [ ] die Domäne der Performanz bezieht sich einerseits auf die Bewusstheit für die Verarbeitung der Sprache, andererseits auf das Sprachlernbewusstheit (ebd.). Die affektive Domäne bezieht sich auf die Herausbildung von Haltungen, Meinungen, vom Interesse und ästhetischen Einfühlungsvermögen (ebd.).
10 202 Ágnes Huber 5. Literatur Ammon, Ulrich [u.a.] (Hg.) (2004): Soziolinguistik. Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft. Bd Berlin/New York: Walter de Gruyter. Apeltauer, Ernst (1997): Grundlagen des Erst- und Fremdsprachenerwerbs. Kassel: Universität Gesamthochschule Kassel. Bausch, Karl-Richard/Raabe, Horst (1978): Zur Frage der Relevanz von kontrastiver Analyse, Fehleranalyse und Interimsprachenanalyse für den Fremdsprachenunterricht. In: Wierlacher, Alois (Hg.): Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache. Bd. 4. Heidelberg: Julius Groos, S Bausch, Karl-Richard/Christ, Herbert/Krumm, Hans-Jürgen (Hg.) (2007): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen/Basel: Francke Verlag. Bergner, Christoph/Zehetmair, Hans (Hg.) (2014): Deutsch als Identitätssprache der deutschen Minderheiten. In: Argumente und Materialien zum Zeitgeschehen 92, S _Internetversion.pdf (Abruf: ). Brdar-Szabó, Rita (2010): Nutzen und Grenzen der kontrastiven Analyse für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. In: Krumm, Hans-Jürgen/Fandrych, Christian/Hufeisen, Britta/Riemer, Claudia (Hg.): Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. 1. Halbband. Berlin/New York: Walter de Gruyter Mouton, S Diehl, Erika (1991): Das ewiges Ärger mit die deutsche Deklination. [sic!] Beobachtungen zu den Erwerbsstrategien frankophoner Deutschlerner. In: Diehl, Erika/Albrecht, Helga/Zoch, Irene (Hg.): Lernerstrategien im Fremdsprachenerwerb. Untersuchungen zum Erwerb des deutschen Deklinationssystems. Tübingen: Max Niemeyer Verlag (= Reihe Germanistische Linguistik 114), S Edmondson, Willis/House, Julianne (1993): Einführung in die Sprachlehrforschung. Tübingen/Basel: A. Francke. Hernig, Marcus (2005): Deutsch als Fremdsprache. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften (= Studienbücher zur Linguistik Bd. 5). Juhász, János (1970): Probleme der Interferenz. Budapest: Akadémiai Kiadó. Kasper, Gabriele (1975): Die Problematik der Fehleridentifizierung. Ein Beitrag zur Fehleranalyse im Fremdsprachenunterricht. Bochum: Zentrales Fremdspracheninstitut der Ruhruniversität Bochum.
11 Konzept und Erforschung von Deutsch-als-Fremdsprache-Lernervarietäten 203 Kasper, Gabriele (1995): Funktionen und Formen der Lernersprachenanalyse. In: Bausch, Karl-Richard/Christ, Herbert/Krumm, Hans-Jürgen (Hg.): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen/Basel: Francke, S Klein, Wolfgang (1992): Zweitspracherwerb. Frankfurt am Main: Hain (= Athenäums Studienbuch: Linguistik). Kleppin, Karin (2000): Formen und Funktionen von Fehleranalyse, -korrektur und -therapie. In: Götze, Lutz/Helbig, Gerhard/Henrici, Gert [u.a.] (Hg.): Handbuch Deutsch als Fremdsprache. Bd. II. Berlin/New York, S Kniffka, Gabriele/Siebert-Ott, Gesa (2012): Deutsch als Zweitsprache. Lehren und Lernen. Paderborn/München/Wien/Zürich: Ferdinand Schöningh. Kohn, Kurt (1990): Dimensionen lernersprachlicher Performanz. Theoretische und empirische Untersuchungen zum Zweitsprachenerwerb. Tübingen: Gunter Narr Verlag (= Ergebnisse und Methoden moderner Sprachwissenschaft Bd. 24). Königs, Frank G. (1995): Fehlerkorrektur. In: Bausch, Karl-Richard/Christ, Herbert/Krumm, Hans-Jürgen (Hg.): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen/Basel: Francke, S Nelde, Peter Hans (1996): Vitalität und Dynamik europäischer Sprachgrenzminderheiten. In: Sprachenpolitik in Grenzregionen. Hrsg. von Marti, Roland. Saarbrücken. (= Veröffentlichungen der Kommission für Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung 29), S Reznicek, Mark/Lüdeling, Anke [u.a.] (2012): Das Falko-Handbuch. Korpusaufbau und Annotationen Version Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für deutsche Sprache und Linguistik Korpuslinguistik. Falko-Handbuch_Korpusaufbau%20und%20-Annotationen-_v2.01 (Abruf: ) Rösch, Heidi (2011): Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. Berlin: Akademie Verlag. Scherer, Carmen (2006): Korpuslinguistik. Heidelberg: Universitätsverlag Winter. Sitta, Horst (1991): Geleitwort. In: Diehl, Erika/Albrecht, Helga/Zoch, Irene (Hg.): Lernerstrategien im Fremdsprachenerwerb. Untersuchungen zum Erwerb des deutschen Deklinationssystems. Tübingen: Max Niemeyer Verlag (= Reihe Germanistische Linguistik 114), S. V VII. Storch, Günther (1999): Deutsch als Fremdsprache. Eine Didaktik. Theoretische Grundlagen und praktische Unterrichtsgestaltung. München: Wilhelm Fink Verlag.
12 204 Ágnes Huber Vogel, Klaus (1990): Lernersprache. Tübingen: Gunter Narr (= Tübinger Beiträge zur Linguistik 341). Walter, Maik/Grommes, Patrick (2008): Die Entdeckung des fortgeschrittenen Lerners in der Varietätenlinguistik. In: Walter, Maik/Grommes, Patrick (Hg.): Fortgeschrittene Lernervarietäten. Korpuslinguistik und Zweitspracherwerbsforschung. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, S Wode, Henning (1984/85): Zweitsprachenerwerbsforschung im Rückblick. In: Eppeneder, Ralf (Hg.): Lernersprache. München: Goethe Institut (= Münchener Werkheft), S Wolff, Dieter (2002): Sprachbewusstheit im Fremdsprachenunterricht. In: Der Deutschunterricht 3/02, S
Die großen Hypothesen: Kontrastiv-, Identitäts- und Interlanguage-Hypothese
 Die großen Hypothesen: Kontrastiv-, Identitäts- und Interlanguage-Hypothese Dörthe Uphoff FLM 0640 2014.1 28. Februar Erste Begriffe: ABC der Vielfalt Muttersprache, Fremdsprache, Erstsprache, Zweitsprache,
Die großen Hypothesen: Kontrastiv-, Identitäts- und Interlanguage-Hypothese Dörthe Uphoff FLM 0640 2014.1 28. Februar Erste Begriffe: ABC der Vielfalt Muttersprache, Fremdsprache, Erstsprache, Zweitsprache,
Evangelia Pappidou & Svenja Donner
 Evangelia Pappidou & Svenja Donner Fachbegriffserklärung Fehlerlinguistik Vorgehensweise Fehlertypen Transfer & Interferenz KL im Fremdsprachenunterricht Methoden im Fremdsprachenunterricht Interimsprache
Evangelia Pappidou & Svenja Donner Fachbegriffserklärung Fehlerlinguistik Vorgehensweise Fehlertypen Transfer & Interferenz KL im Fremdsprachenunterricht Methoden im Fremdsprachenunterricht Interimsprache
Formelbasierter Zweitspracherwerb bei erwachsenen Lernern
 Germanistik Christine Porath Formelbasierter Zweitspracherwerb bei erwachsenen Lernern Eine konstruktionsgrammatische Analyse von Äußerungen italienischer Lerner des Deutschen (L2) im ungesteuerten Zweitspracherwerb
Germanistik Christine Porath Formelbasierter Zweitspracherwerb bei erwachsenen Lernern Eine konstruktionsgrammatische Analyse von Äußerungen italienischer Lerner des Deutschen (L2) im ungesteuerten Zweitspracherwerb
Grundlagen der Kontrastiven Linguistik in Theorie und Praxis
 von Özlem Tekin Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2012, 224 S., ISBN 978-3-86057-109-5, 39,80 Rezensiert von Maria Thurmair, Regensburg Sprachen zu vergleichen ist ein zentraler Bestandteil vieler sprachwissenschaftlicher
von Özlem Tekin Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2012, 224 S., ISBN 978-3-86057-109-5, 39,80 Rezensiert von Maria Thurmair, Regensburg Sprachen zu vergleichen ist ein zentraler Bestandteil vieler sprachwissenschaftlicher
Einführung in Deutsch als Fremdsprache/ Deutsch als Zweitsprache: Grundlegendes. Willkommen zu dieser Vorlesung!
 Einführung in Deutsch als Fremdsprache/ Deutsch als Zweitsprache: Grundlegendes Willkommen zu dieser Vorlesung! www.foeldes.eu www.germanistische-sprachwissenschaft.eu www.facebook.com/germanistische-sprachwissenschaft
Einführung in Deutsch als Fremdsprache/ Deutsch als Zweitsprache: Grundlegendes Willkommen zu dieser Vorlesung! www.foeldes.eu www.germanistische-sprachwissenschaft.eu www.facebook.com/germanistische-sprachwissenschaft
der Zweitsprache Deutsch Vortrag auf dem DGFF-Kongress Inger Petersen, Universität Oldenburg
 Analyse von Schreibkompetenz in der Zweitsprache Deutsch Vortrag auf dem DGFF-Kongress 2009 02.10.2009 Inger Petersen, Universität Oldenburg Gliederung 1. Das Forschungsprojekt 2. Schreibkompetenz u. Schriftlichkeit
Analyse von Schreibkompetenz in der Zweitsprache Deutsch Vortrag auf dem DGFF-Kongress 2009 02.10.2009 Inger Petersen, Universität Oldenburg Gliederung 1. Das Forschungsprojekt 2. Schreibkompetenz u. Schriftlichkeit
Einführung in die Logik
 Einführung in die Logik Prof. Dr. Ansgar Beckermann Wintersemester 2001/2 Allgemeines vorab Wie es abläuft Vorlesung (Grundlage: Ansgar Beckermann. Einführung in die Logik. (Sammlung Göschen Bd. 2243)
Einführung in die Logik Prof. Dr. Ansgar Beckermann Wintersemester 2001/2 Allgemeines vorab Wie es abläuft Vorlesung (Grundlage: Ansgar Beckermann. Einführung in die Logik. (Sammlung Göschen Bd. 2243)
Vorlesung. Interkulturelle Germanistik und Deutsch als Fremdsprache: Eine Einführung. Sommersemester 2006
 Vorlesung Interkulturelle Germanistik und Deutsch als Fremdsprache: Sommersemester 2006 Prof. Dr. H. Casper-Hehne Januar 2006 Prof. Casper-Hehne 1 4. Sitzung (07.12.06) Thema: Interkulturelle Sprachwissenschaft
Vorlesung Interkulturelle Germanistik und Deutsch als Fremdsprache: Sommersemester 2006 Prof. Dr. H. Casper-Hehne Januar 2006 Prof. Casper-Hehne 1 4. Sitzung (07.12.06) Thema: Interkulturelle Sprachwissenschaft
- Theoretischer Bezugsrahmen -
 Inhaltsverzeichnis 1. Leserführung 1 1.1. Teil 1: Der theoretische Bezugsrahmen... 1 1.2. Teil 2: Das Produkt... 1 1.3. Teil 3: Das Produkt in der Praxis... 2 1.4. Teil 4: Schlussfolgerungen... 2 2. Einleitung
Inhaltsverzeichnis 1. Leserführung 1 1.1. Teil 1: Der theoretische Bezugsrahmen... 1 1.2. Teil 2: Das Produkt... 1 1.3. Teil 3: Das Produkt in der Praxis... 2 1.4. Teil 4: Schlussfolgerungen... 2 2. Einleitung
Grammatik in Schulbüchern
 Pädagogik Thorsten Witting Grammatik in Schulbüchern Studienarbeit Inhalt 1 Einleitung... 1 2 Stellung der Grammatik im Kerncurriculum Niedersachsen... 1 3 Optionen der Grammatikvermittlung... 2 4 Grammatik
Pädagogik Thorsten Witting Grammatik in Schulbüchern Studienarbeit Inhalt 1 Einleitung... 1 2 Stellung der Grammatik im Kerncurriculum Niedersachsen... 1 3 Optionen der Grammatikvermittlung... 2 4 Grammatik
Methoden des Fremdsprachen Unterrichts. Überblick
 Methoden des Fremdsprachen Unterrichts Überblick 1. Die Grammatik-Übersetzungsmethode (GÜM) 2. Die direkte Methode (DM) 3. Die audiolinguale Methode (ALM) 4. Die audiovisuelle Methode (AVM) 5. Die kommunikative
Methoden des Fremdsprachen Unterrichts Überblick 1. Die Grammatik-Übersetzungsmethode (GÜM) 2. Die direkte Methode (DM) 3. Die audiolinguale Methode (ALM) 4. Die audiovisuelle Methode (AVM) 5. Die kommunikative
Vorgehensweise bei der Erstellung. von Hausarbeiten (Bachelorarbeiten)
 Leuphana Universität Lüneburg Institut für Bank-, Finanz- und Rechnungswesen Abt. Rechnungswesen und Steuerlehre Vorgehensweise bei der Erstellung von Hausarbeiten (Bachelorarbeiten) I. Arbeitsschritte
Leuphana Universität Lüneburg Institut für Bank-, Finanz- und Rechnungswesen Abt. Rechnungswesen und Steuerlehre Vorgehensweise bei der Erstellung von Hausarbeiten (Bachelorarbeiten) I. Arbeitsschritte
Deutsch als Fremdsprache: Wissenschaftsanspruch Teilbereiche Bezugssdisziplinen
 Deutsch als Fremdsprache: Wissenschaftsanspruch Teilbereiche Bezugssdisziplinen Hrsg. von Claus Altmayer und Roland Forster Frankfurt a.m.: Peter Lang, 2003, 284 S., ISBN 3-631-50418-7, 45 / 30 (Werkstattreihe
Deutsch als Fremdsprache: Wissenschaftsanspruch Teilbereiche Bezugssdisziplinen Hrsg. von Claus Altmayer und Roland Forster Frankfurt a.m.: Peter Lang, 2003, 284 S., ISBN 3-631-50418-7, 45 / 30 (Werkstattreihe
Modul 7: Forschungspraxis. Autorenkollektiv
 Modul 7: Forschungspraxis Autorenkollektiv 1 Modul 7: Forschungspraxis Zu Modul 7: Forschungspraxis gehören folgende Online-Lernmodule: 1. Einführung in die Sprachlehr- und Mehrsprachigkeitsforschung 2.
Modul 7: Forschungspraxis Autorenkollektiv 1 Modul 7: Forschungspraxis Zu Modul 7: Forschungspraxis gehören folgende Online-Lernmodule: 1. Einführung in die Sprachlehr- und Mehrsprachigkeitsforschung 2.
Methodisch didaktische Aspekte der Sprachvermittlung im Unterricht in den Vorintegrationskursen
 Friedrich-Schiller-Universität Jena Philosophische Fakultät Institut für Auslandsgermanistik DaF/DaZ Nimet.Tan@uni-jena.de Methodisch didaktische Aspekte der Sprachvermittlung im Unterricht in den Vorintegrationskursen
Friedrich-Schiller-Universität Jena Philosophische Fakultät Institut für Auslandsgermanistik DaF/DaZ Nimet.Tan@uni-jena.de Methodisch didaktische Aspekte der Sprachvermittlung im Unterricht in den Vorintegrationskursen
Weiterbildendes Studienprogramm Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (WBSP DaFZ)
 Modulbeschreibung Weiterbildendes Studienprogramm Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (WBSP DaFZ) Dieser Kurs vermittelt in drei Modulen wesentliche Elemente für einen erfolgreichen fremdsprachlichen Deutschunterricht.
Modulbeschreibung Weiterbildendes Studienprogramm Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (WBSP DaFZ) Dieser Kurs vermittelt in drei Modulen wesentliche Elemente für einen erfolgreichen fremdsprachlichen Deutschunterricht.
Karl-Richard Bausch (Ruhr-Universität Bochum / Université de Montréal) Entwicklung einer Didaktik und Methodik der Mehrsprachigkeit - ein Thesenpapier
 93 In mehreren Sprachen leben Karl-Richard Bausch (Ruhr-Universität Bochum / Université de Montréal) Entwicklung einer Didaktik und Methodik der Mehrsprachigkeit - ein Thesenpapier Einsprachigkeit ist
93 In mehreren Sprachen leben Karl-Richard Bausch (Ruhr-Universität Bochum / Université de Montréal) Entwicklung einer Didaktik und Methodik der Mehrsprachigkeit - ein Thesenpapier Einsprachigkeit ist
Medienrecht und Persönlichkeitsrecht
 Germanistik Anna Mikhaylova Medienrecht und Persönlichkeitsrecht Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Einleitung 2 I. Fragestellungen des Medienrechts...4 1. Begriff und Einordnung des Medienrechts..4 2.
Germanistik Anna Mikhaylova Medienrecht und Persönlichkeitsrecht Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Einleitung 2 I. Fragestellungen des Medienrechts...4 1. Begriff und Einordnung des Medienrechts..4 2.
Inwiefern kann Kinderliteratur den Spracherwerb bei mehrsprachigen Kindern fördern?
 Germanistik Mian Fu Inwiefern kann Kinderliteratur den Spracherwerb bei mehrsprachigen Kindern fördern? Essay Universität Tübingen Philosophische Fakultät Deutsches Seminar Sommersemester 2011 HS Mehrsprachigkeit
Germanistik Mian Fu Inwiefern kann Kinderliteratur den Spracherwerb bei mehrsprachigen Kindern fördern? Essay Universität Tübingen Philosophische Fakultät Deutsches Seminar Sommersemester 2011 HS Mehrsprachigkeit
Inhaltsverzeichnis. Danksagung. Abbildungs Verzeichnis
 Inhaltsverzeichnis Danksagung Inhaltsverzeichnis Abbildungs Verzeichnis Teil 1 1 1. Fragestellung 3 2. Einleitung : 4 3. Aspekte des Zweitspracherwerbs 9 3.1 Neurophysiologische Aspekte des Zweitspracherwerbs
Inhaltsverzeichnis Danksagung Inhaltsverzeichnis Abbildungs Verzeichnis Teil 1 1 1. Fragestellung 3 2. Einleitung : 4 3. Aspekte des Zweitspracherwerbs 9 3.1 Neurophysiologische Aspekte des Zweitspracherwerbs
Einführung in die germanistische Linguistik
 Einführung in die germanistische Linguistik PhDr. Tamara Bučková, PhD. Karlsuniversität in Prag tamara.buckova@volny.cz Problemkreis I Allgemeine Linguistik Thema 4 Ansätze zur Klassifizierung linguistischer
Einführung in die germanistische Linguistik PhDr. Tamara Bučková, PhD. Karlsuniversität in Prag tamara.buckova@volny.cz Problemkreis I Allgemeine Linguistik Thema 4 Ansätze zur Klassifizierung linguistischer
Einleitung Ausgangssituation und Erkenntnisinteresse
 18 Einleitung Ausgangssituation und Erkenntnisinteresse In den letzten 40 Jahren sind zahlreiche Studien im Bereich des Fremdsprachenlehrens und -lernens erschienen, die der Frage nachgehen, auf welche
18 Einleitung Ausgangssituation und Erkenntnisinteresse In den letzten 40 Jahren sind zahlreiche Studien im Bereich des Fremdsprachenlehrens und -lernens erschienen, die der Frage nachgehen, auf welche
Kapitel 2, Führungskräftetraining, Kompetenzentwicklung und Coaching:
 Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? von Tanja Hollinger 1. Auflage Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? Hollinger schnell und portofrei
Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? von Tanja Hollinger 1. Auflage Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? Hollinger schnell und portofrei
Illlllllllllllllllllllll
 Band 6 Kunst auf Englisch? Ein Plädoyer für die Erweiterung des bilingualen Sachfachkanons Jutta Rymarczyk ULB Darmstadt Illlllllllllllllllllllll 16070408 Langenscheidt- Longman Inhalt INHALTSVERZEICHNIS
Band 6 Kunst auf Englisch? Ein Plädoyer für die Erweiterung des bilingualen Sachfachkanons Jutta Rymarczyk ULB Darmstadt Illlllllllllllllllllllll 16070408 Langenscheidt- Longman Inhalt INHALTSVERZEICHNIS
Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen Eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit Prof. Dr. Dr. Helmut Schneider (Steinbeis-Hochschule Berlin) Seite 2 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen Eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit Prof. Dr. Dr. Helmut Schneider (Steinbeis-Hochschule Berlin) Seite 2 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
Kompetenzenportfolio. Definition Kompetenzenportfolio. Aufgaben der Lernenden. Einführung
 Kompetenzenportfolio Leistungsziel 7.4.3 für die Berufsschule gemäss Standardlehrplan : Aus den Tätigkeiten und Kompetenzen ein Kompetenzenportfolio ableiten I: Definition Kompetenzenportfolio I: Sinn
Kompetenzenportfolio Leistungsziel 7.4.3 für die Berufsschule gemäss Standardlehrplan : Aus den Tätigkeiten und Kompetenzen ein Kompetenzenportfolio ableiten I: Definition Kompetenzenportfolio I: Sinn
Alfred Schütz und Karl Mannheim - Ein Vergleich zweier wissenschaftlicher Perspektiven
 Geisteswissenschaft Alfred Schütz und Karl Mannheim - Ein Vergleich zweier wissenschaftlicher Perspektiven Studienarbeit Hausarbeit im an der TU-Berlin Alfred Schütz und Karl Mannheim Ein Vergleich zweier
Geisteswissenschaft Alfred Schütz und Karl Mannheim - Ein Vergleich zweier wissenschaftlicher Perspektiven Studienarbeit Hausarbeit im an der TU-Berlin Alfred Schütz und Karl Mannheim Ein Vergleich zweier
VERGLEICH LEHRPLAN PASSEPARTOUT Lehrplan 21
 VERGLEICH LEHRPLAN PASSEPARTOUT Lehrplan 21 Übersicht zur Einpassung der Französisch und Englisch) in den Stand 16. September 2014 1 Projektvorgaben (Aussprachepapier zum Fachbereich Sprachen, von der
VERGLEICH LEHRPLAN PASSEPARTOUT Lehrplan 21 Übersicht zur Einpassung der Französisch und Englisch) in den Stand 16. September 2014 1 Projektvorgaben (Aussprachepapier zum Fachbereich Sprachen, von der
RAUMKONZEPT IM TÜRKISCHEN UND IM DEUTSCHEN
 RAUMKONZEPT IM TÜRKISCHEN UND IM DEUTSCHEN EINE UNTERRICHTSEINHEIT ZUR BILDBESCHREIBUNG FOKUSSIERT AUF DIE VERWENDUNG DER PRÄPOSITIONEN IN EINER SIEBTEN KLASSE MIT SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN, DIE DEUTSCH
RAUMKONZEPT IM TÜRKISCHEN UND IM DEUTSCHEN EINE UNTERRICHTSEINHEIT ZUR BILDBESCHREIBUNG FOKUSSIERT AUF DIE VERWENDUNG DER PRÄPOSITIONEN IN EINER SIEBTEN KLASSE MIT SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN, DIE DEUTSCH
DDZ- 01- IKS-DF. 1. Modultitel Deutsch als Zweitsprache / Interkulturelle Kommunikation und Zweitspracherwerb
 DDZ- 01- IKS-DF 1. Modultitel Deutsch als Zweitsprache / Interkulturelle und Zweitspracherwerb 4. Modulbeauftragte/r Dr. Reiß-Held, Prof. Dr. Rost-Roth 6. Einführung in die Bereiche Interkulturelle /Interkulturelles
DDZ- 01- IKS-DF 1. Modultitel Deutsch als Zweitsprache / Interkulturelle und Zweitspracherwerb 4. Modulbeauftragte/r Dr. Reiß-Held, Prof. Dr. Rost-Roth 6. Einführung in die Bereiche Interkulturelle /Interkulturelles
Literarische Kurztexte im DaF-Unterricht des chinesischen Germanistikstudiums
 Werkstattreihe Deutsch als Fremdsprache 84 Literarische Kurztexte im DaF-Unterricht des chinesischen Germanistikstudiums Ein Unterrichtsmodell für interkulturelle Lernziele Bearbeitet von Jingzhu Lü 1.
Werkstattreihe Deutsch als Fremdsprache 84 Literarische Kurztexte im DaF-Unterricht des chinesischen Germanistikstudiums Ein Unterrichtsmodell für interkulturelle Lernziele Bearbeitet von Jingzhu Lü 1.
3 Art des Leistungsnachweises: 80 % Vortragender/ Vortragende:
 Titel des Kurses Morphologie 1 3 Art des Morphologie als eine der grundlegenden linguistischen Disziplinen. Die Seminare geben einen Überblick über das deutsche Verb: Klassifikation von Verben und ihre
Titel des Kurses Morphologie 1 3 Art des Morphologie als eine der grundlegenden linguistischen Disziplinen. Die Seminare geben einen Überblick über das deutsche Verb: Klassifikation von Verben und ihre
Deutsch unterrichten zwischen DaF, DaZ und DaM
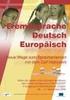 Deutsch unterrichten zwischen DaF, DaZ und DaM Akten der Gesamtschweizerischen Tagung für Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer 20. und 21. Juni 2008 Universität Bern herausgegeben von Monika Clalüna Barbara
Deutsch unterrichten zwischen DaF, DaZ und DaM Akten der Gesamtschweizerischen Tagung für Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer 20. und 21. Juni 2008 Universität Bern herausgegeben von Monika Clalüna Barbara
Sprachsensibler Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit geringen Deutschkenntnissen am Beispiel Mathematik
 Sprachsensibler Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit geringen Deutschkenntnissen am Beispiel Mathematik Workshop 3: Stefan Oppelt, Frank Reinhold Dillingen, 05.10.2016 Agenda 1. Einführungsvortrag
Sprachsensibler Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit geringen Deutschkenntnissen am Beispiel Mathematik Workshop 3: Stefan Oppelt, Frank Reinhold Dillingen, 05.10.2016 Agenda 1. Einführungsvortrag
2. Formen, Theorien und Probleme des Zweitspracherwerbs
 12 2. Formen, Theorien und Probleme des Zweitspracherwerbs In diesem Kapitel sollen zunächst der ungesteuerte und der gesteuerte Zweitspracherwerb (ZSE als die zwei praktisch relevanten unterschiedlichen
12 2. Formen, Theorien und Probleme des Zweitspracherwerbs In diesem Kapitel sollen zunächst der ungesteuerte und der gesteuerte Zweitspracherwerb (ZSE als die zwei praktisch relevanten unterschiedlichen
Höflichkeit durch Sozialdeixis in der japanisch-deutschen Übersetzung von Murakami Harukis "Die unheimliche Bibliothek"
 Germanistik Franziska Riedel Höflichkeit durch Sozialdeixis in der japanisch-deutschen Übersetzung von Murakami Harukis "Die unheimliche Bibliothek" Studienarbeit Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Germanistik Franziska Riedel Höflichkeit durch Sozialdeixis in der japanisch-deutschen Übersetzung von Murakami Harukis "Die unheimliche Bibliothek" Studienarbeit Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Monika Schwarz / Jeanette Chur: SEMANTIK. EIN ARBEITSBUCH. (narr studienbücher), Gunter Narr Verlag; Tübingen1993, pp. 223.
 Grazer Linguistische Studien 42 (Herbst 1994) 141 Monika Schwarz / Jeanette Chur: SEMANTIK. EIN ARBEITSBUCH. (narr studienbücher), Gunter Narr Verlag; Tübingen1993, pp. 223. Das vorliegende Werk setzt
Grazer Linguistische Studien 42 (Herbst 1994) 141 Monika Schwarz / Jeanette Chur: SEMANTIK. EIN ARBEITSBUCH. (narr studienbücher), Gunter Narr Verlag; Tübingen1993, pp. 223. Das vorliegende Werk setzt
Psycholinguistik. Definition: Psycholinguistik (synonym: Sprachpsychologie) erforscht das kognitive (mentale) System, das den Sprachgebrauch erlaubt.
 Psycholinguistik Definition: Psycholinguistik (synonym: Sprachpsychologie) erforscht das kognitive (mentale) System, das den Sprachgebrauch erlaubt. Teilgebiete der Psycholinguistik Können danach klassifiziert
Psycholinguistik Definition: Psycholinguistik (synonym: Sprachpsychologie) erforscht das kognitive (mentale) System, das den Sprachgebrauch erlaubt. Teilgebiete der Psycholinguistik Können danach klassifiziert
Inhaltsverzeichnis. Vorwort 5
 Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 0 Einleitung 11 0.1 Ausgangspunkt und Fragestellung 11 0.2 Aufbau der Arbeit 16 Teill Theoretische Grundlagen 1 Anglizismen im Kontest von Entlehnung 21 1.1 Entlehnung 21 1.1.1
Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 0 Einleitung 11 0.1 Ausgangspunkt und Fragestellung 11 0.2 Aufbau der Arbeit 16 Teill Theoretische Grundlagen 1 Anglizismen im Kontest von Entlehnung 21 1.1 Entlehnung 21 1.1.1
Ein- und Zweistichprobentests
 (c) Projekt Neue Statistik 2003 - Lernmodul: Ein- Zweistichprobentests Ein- Zweistichprobentests Worum geht es in diesem Modul? Wiederholung: allgemeines Ablaufschema eines Tests Allgemeine Voraussetzungen
(c) Projekt Neue Statistik 2003 - Lernmodul: Ein- Zweistichprobentests Ein- Zweistichprobentests Worum geht es in diesem Modul? Wiederholung: allgemeines Ablaufschema eines Tests Allgemeine Voraussetzungen
Die pädagogische Wirksamkeit vorschulischer Förderung des Schriftspracherwerbs
 Pädagogik Dirk Kranz Die pädagogische Wirksamkeit vorschulischer Förderung des Schriftspracherwerbs Bachelorarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 3 2. Spracherwerb und Schriftspracherwerb... 3 2.1.
Pädagogik Dirk Kranz Die pädagogische Wirksamkeit vorschulischer Förderung des Schriftspracherwerbs Bachelorarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 3 2. Spracherwerb und Schriftspracherwerb... 3 2.1.
als Hauptfach (44 SWS), als Leitfach (24 SWS) oder als affines Fach (24 SWS)
 6. Abschnitt: Französisch als Hauptfach (44 SWS), als Leitfach (24 SWS) oder als affines Fach (24 SWS) 27 Aufbau und Inhalte Modul Beschreibung (lt. RPO I) Sprachliche Basiskompetenzen Sichere Basiskompetenzen
6. Abschnitt: Französisch als Hauptfach (44 SWS), als Leitfach (24 SWS) oder als affines Fach (24 SWS) 27 Aufbau und Inhalte Modul Beschreibung (lt. RPO I) Sprachliche Basiskompetenzen Sichere Basiskompetenzen
Hochschulzertifikat Deutsch als Fremdsprache / Deutsch als Zweitsprache
 Hochschulzertifikat Deutsch als Fremdsprache / Deutsch als Zweitsprache Modulhandbuch, Stand: 01.04.2016 Vorbemerkung Die Pädagogische Hochschule Karlsruhe bietet ab Mai 2016 einen Zertifikatskurs Deutsch
Hochschulzertifikat Deutsch als Fremdsprache / Deutsch als Zweitsprache Modulhandbuch, Stand: 01.04.2016 Vorbemerkung Die Pädagogische Hochschule Karlsruhe bietet ab Mai 2016 einen Zertifikatskurs Deutsch
7 Gültigkeit und logische Form von Argumenten
 7 Gültigkeit und logische Form von Argumenten Zwischenresümee 1. Logik ist ein grundlegender Teil der Lehre vom richtigen Argumentieren. 2. Speziell geht es der Logik um einen spezifischen Aspekt der Güte
7 Gültigkeit und logische Form von Argumenten Zwischenresümee 1. Logik ist ein grundlegender Teil der Lehre vom richtigen Argumentieren. 2. Speziell geht es der Logik um einen spezifischen Aspekt der Güte
Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Physik
 Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Physik (Sekundarschule und Bezirksschule) Die vorliegende Umsetzungshilfe soll die Lehrpersonen unterstützen, die Sachkompetenz
Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Physik (Sekundarschule und Bezirksschule) Die vorliegende Umsetzungshilfe soll die Lehrpersonen unterstützen, die Sachkompetenz
EINE FEHLERANALYTISCHE UNTERSUCHUNG BEI DEN DAF- STUDENTINNEN DER VORBEREITUNGSKLASSE
 i TÜRKISCHE REPUBLIK UNIVERSITÄT SELÇUK INSTITUT FÜR ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN ABTEILUNG FÜR DEUTSCHDIDAKTIK EINE FEHLERANALYTISCHE UNTERSUCHUNG BEI DEN DAF- STUDENTINNEN DER VORBEREITUNGSKLASSE Elif ERDOĞAN
i TÜRKISCHE REPUBLIK UNIVERSITÄT SELÇUK INSTITUT FÜR ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN ABTEILUNG FÜR DEUTSCHDIDAKTIK EINE FEHLERANALYTISCHE UNTERSUCHUNG BEI DEN DAF- STUDENTINNEN DER VORBEREITUNGSKLASSE Elif ERDOĞAN
DaZ-Förderung im Deutschunterricht Sprachbewusstheit anregen, Fördersituationen schaffen. Beate Lütke. Blitzlicht
 DaZ-Förderung im Deutschunterricht Sprachbewusstheit anregen, Fördersituationen schaffen Fortbildung Sprache im Fachunterricht" 07./08.04.2011, Bozen Blitzlicht Geben Sie reihum einen kurzen Kommentar
DaZ-Förderung im Deutschunterricht Sprachbewusstheit anregen, Fördersituationen schaffen Fortbildung Sprache im Fachunterricht" 07./08.04.2011, Bozen Blitzlicht Geben Sie reihum einen kurzen Kommentar
1. Umrisse einer Didaktik der Mehrsprachigkeit 1
 V Vorwort XIII 1. Umrisse einer Didaktik der Mehrsprachigkeit 1 1.1 Mehrsprachigkeit als Regelfall 2 1.2 Welche Didaktik ist zuständig? DaM - DaZ - DaF oder die Interkulturelle Pädagogik? 4 1.2.1 Der ungeklärte
V Vorwort XIII 1. Umrisse einer Didaktik der Mehrsprachigkeit 1 1.1 Mehrsprachigkeit als Regelfall 2 1.2 Welche Didaktik ist zuständig? DaM - DaZ - DaF oder die Interkulturelle Pädagogik? 4 1.2.1 Der ungeklärte
Hermann Hesse-Gymnasium Calw. Schulcurriculum Englisch. Zielsetzung - 1
 Zielsetzung Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der englischen Sprache im Alltag nimmt das Fach Englisch als 1. Fremdsprache eine herausragende Stellung ein. Die Schulcurricula zielen auf eine ständig sich
Zielsetzung Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der englischen Sprache im Alltag nimmt das Fach Englisch als 1. Fremdsprache eine herausragende Stellung ein. Die Schulcurricula zielen auf eine ständig sich
Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand
 Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand Stand: August 2014 Unterrichtsvorhaben I Eigenart philosophischen Fragens und Denkens - Was heißt es
Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand Stand: August 2014 Unterrichtsvorhaben I Eigenart philosophischen Fragens und Denkens - Was heißt es
Deutsche Bilderbücher der Gegenwart im Unterricht Deutsch als Fremdsprache in Indonesien
 Kinder- und Jugendkultur, -literatur und -medien 79 Deutsche Bilderbücher der Gegenwart im Unterricht Deutsch als Fremdsprache in Indonesien Eine Studie zur Anwendung von Bilderbüchern im Landeskundeunterricht
Kinder- und Jugendkultur, -literatur und -medien 79 Deutsche Bilderbücher der Gegenwart im Unterricht Deutsch als Fremdsprache in Indonesien Eine Studie zur Anwendung von Bilderbüchern im Landeskundeunterricht
Anhang I: Lernziele und Kreditpunkte
 Anhang I: Lernziele und Kreditpunkte Modul Einführung in die slavische Sprach- und Literaturwissenschaft Veranstaltungen: Einführungsseminar Einführung in die Literaturwissenschaft (2 SWS, 6 ECTS, benotet);
Anhang I: Lernziele und Kreditpunkte Modul Einführung in die slavische Sprach- und Literaturwissenschaft Veranstaltungen: Einführungsseminar Einführung in die Literaturwissenschaft (2 SWS, 6 ECTS, benotet);
Sehenswürdigkeiten als Sensibilisierung
 Sehenswürdigkeiten als Sensibilisierung Rita de Cássia Cauzzo CEU EMEF Jardim Paulistano Besonders den Kindern, deren globale Kenntnis begrenzt ist, kann es an landeskundlichen Informationen über das zielsprachige
Sehenswürdigkeiten als Sensibilisierung Rita de Cássia Cauzzo CEU EMEF Jardim Paulistano Besonders den Kindern, deren globale Kenntnis begrenzt ist, kann es an landeskundlichen Informationen über das zielsprachige
Die Sprachmittlung (Mediation) in der Abschlussprüfung im Fach Englisch an der Wirtschaftsschule
 Die Sprachmittlung (Mediation) in der Abschlussprüfung im Fach Englisch an der Wirtschaftsschule Sprachmittlung ist die sinngemäße, adressaten- und situationsgerechte Übertragung von Informationen in die
Die Sprachmittlung (Mediation) in der Abschlussprüfung im Fach Englisch an der Wirtschaftsschule Sprachmittlung ist die sinngemäße, adressaten- und situationsgerechte Übertragung von Informationen in die
Grundlegendes zur Semantik 4. Januar 2005
 Linguistik Grundkurs Plenum Ruhr Universität Bochum Germanistisches Institut ********************************** Wolf Peter Klein Grundlegendes zur Semantik 4. Januar 2005 Wintersemester 04/05 Semantik
Linguistik Grundkurs Plenum Ruhr Universität Bochum Germanistisches Institut ********************************** Wolf Peter Klein Grundlegendes zur Semantik 4. Januar 2005 Wintersemester 04/05 Semantik
Was heisst eigentlich Sprachkompetenz?
 Claudio Nodari Was heisst eigentlich Sprachkompetenz? Bibliographischer Verweis: Nodari, C. (2002): Was heisst eigentlich Sprachkompetenz? In: Barriere Sprachkompetenz. Dokumentation zur Impulstagung vom
Claudio Nodari Was heisst eigentlich Sprachkompetenz? Bibliographischer Verweis: Nodari, C. (2002): Was heisst eigentlich Sprachkompetenz? In: Barriere Sprachkompetenz. Dokumentation zur Impulstagung vom
Zum Verhältnis der Wissenschaften Mathematik und Didaktik des Mathematikunterrichts. Hans Dieter Sill, Universität Rostock
 Zum Verhältnis der Wissenschaften Mathematik und Didaktik des Mathematikunterrichts Hans Dieter Sill, Universität Rostock Gliederung 1. Phänomene 2. Ursachen 3. Konsequenzen 2 Phänomene Studenten, Lehrer
Zum Verhältnis der Wissenschaften Mathematik und Didaktik des Mathematikunterrichts Hans Dieter Sill, Universität Rostock Gliederung 1. Phänomene 2. Ursachen 3. Konsequenzen 2 Phänomene Studenten, Lehrer
Kommunikative Methode
 Kommunikative Methode 10112038 Sayaka Kaneko 1. Einleitung Ich habe schon im letzten Semester über die Kommunikative Methode meine Seminar Arbeit geschrieben. Das vorige Mal habe ich die Kommunikative
Kommunikative Methode 10112038 Sayaka Kaneko 1. Einleitung Ich habe schon im letzten Semester über die Kommunikative Methode meine Seminar Arbeit geschrieben. Das vorige Mal habe ich die Kommunikative
Präzisierung der Seminar-Themen (SQ-13-Bulgarisch) Die sprachlichen Fertigkeiten
 Präzisierung der Seminar-Themen (SQ-13-Bulgarisch) Die sprachlichen Fertigkeiten * Haben Sie "Lieblingsfertigkeiten"? * Wie begründet sich das? * Was könnten Sie nach Lektüre der Texte tun, um bestimmte
Präzisierung der Seminar-Themen (SQ-13-Bulgarisch) Die sprachlichen Fertigkeiten * Haben Sie "Lieblingsfertigkeiten"? * Wie begründet sich das? * Was könnten Sie nach Lektüre der Texte tun, um bestimmte
Die Inhaltsangabe im Deutschunterricht der gymnasialen Mittelstufe in Theorie und Unterrichtspraxis
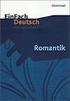 Germanistik Rebecca Mahnkopf Die Inhaltsangabe im Deutschunterricht der gymnasialen Mittelstufe in Theorie und Unterrichtspraxis Formen modernen Aufsatzunterrichts (Sprachdidaktik) Studienarbeit Hauptseminar:
Germanistik Rebecca Mahnkopf Die Inhaltsangabe im Deutschunterricht der gymnasialen Mittelstufe in Theorie und Unterrichtspraxis Formen modernen Aufsatzunterrichts (Sprachdidaktik) Studienarbeit Hauptseminar:
Übung zum wissenschaftlichen Arbeiten
 Übung zum wissenschaftlichen Arbeiten Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Wirtschaftsdidaktik Prof. Dr. Thomas Bienengräber Dipl.-Hdl. Verena Ulber Dipl.-Hdl. Gabriele Viedenz 6. Juni 2011 Agenda 1
Übung zum wissenschaftlichen Arbeiten Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik und Wirtschaftsdidaktik Prof. Dr. Thomas Bienengräber Dipl.-Hdl. Verena Ulber Dipl.-Hdl. Gabriele Viedenz 6. Juni 2011 Agenda 1
Synopse für Let s go Band 3 und 4
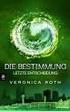 Synopse für Let s go Band 3 und 4 Umsetzung der Anforderungen des Kerncurriculums Englisch für die Sekundarstufe I an Hauptschulen Hessen 1 Kompetenzbereich Kommunikative Kompetenz am Ende der Jahrgangsstufe
Synopse für Let s go Band 3 und 4 Umsetzung der Anforderungen des Kerncurriculums Englisch für die Sekundarstufe I an Hauptschulen Hessen 1 Kompetenzbereich Kommunikative Kompetenz am Ende der Jahrgangsstufe
Hauptstudium: DGD 60 - Grammatik im DaF-Unterricht A. Tsokoglou SS
 Hauptstudium: DGD 60 - Grammatik im DaF-Unterricht A. Tsokoglou SS 2013-14 3. Die Darstellung und Vermittlung der Grammatik 3.1 Allgemeines: Einführung wichtiger Begriffe A) Darstellung der Grammatik:
Hauptstudium: DGD 60 - Grammatik im DaF-Unterricht A. Tsokoglou SS 2013-14 3. Die Darstellung und Vermittlung der Grammatik 3.1 Allgemeines: Einführung wichtiger Begriffe A) Darstellung der Grammatik:
Bernd Schorb, Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft eine notwendige und problematische Verbindung.
 Bernd Schorb, Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft eine notwendige und problematische Verbindung. Exposé aus Medienpädagogik Themenfeld Wechselverhältnis Medientheorie Medienpädagogik Artikel
Bernd Schorb, Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft eine notwendige und problematische Verbindung. Exposé aus Medienpädagogik Themenfeld Wechselverhältnis Medientheorie Medienpädagogik Artikel
Geschichte und Gegenstand der Kriminalsoziologie
 Geschichte und Gegenstand der Kriminalsoziologie König, René: Theorie und Praxis in der Kriminalsoziologie. In: Sack, König (1968): Kriminalsoziologie. Frankfurt am Main: Akademischer Verlagsgesellschaft,
Geschichte und Gegenstand der Kriminalsoziologie König, René: Theorie und Praxis in der Kriminalsoziologie. In: Sack, König (1968): Kriminalsoziologie. Frankfurt am Main: Akademischer Verlagsgesellschaft,
The bilingual tour. Bilingualer Unterricht im Fach Geschichte an der KGS Wiesmoor
 The bilingual tour Bilingualer Unterricht im Fach Geschichte an der KGS Wiesmoor Worüber werden sie informiert? Unser Verständnis von bilingualem Unterricht Warum überhaupt bilingualer Unterricht? Schafft
The bilingual tour Bilingualer Unterricht im Fach Geschichte an der KGS Wiesmoor Worüber werden sie informiert? Unser Verständnis von bilingualem Unterricht Warum überhaupt bilingualer Unterricht? Schafft
MEHRSPRACHIGES BERUFSORIENTIERENDES PORTFOLIO ALS INSTRUMENT DER AUTONOMEN BERUFSORIENTIERUNG IN MEHRSPRACHIGEN FACHSPEZIFISCHEN BEREICHEN
 MEHRSPRACHIGES BERUFSORIENTIERENDES PORTFOLIO ALS INSTRUMENT DER AUTONOMEN BERUFSORIENTIERUNG IN MEHRSPRACHIGEN FACHSPEZIFISCHEN BEREICHEN DER BERUFSORIENTIERENDE FREMDSPRACHENUNTERRICHT Unter dem berufsorientierenden
MEHRSPRACHIGES BERUFSORIENTIERENDES PORTFOLIO ALS INSTRUMENT DER AUTONOMEN BERUFSORIENTIERUNG IN MEHRSPRACHIGEN FACHSPEZIFISCHEN BEREICHEN DER BERUFSORIENTIERENDE FREMDSPRACHENUNTERRICHT Unter dem berufsorientierenden
Effizienz in der Wortschatzvermittlung
 Neda Teymoortash Effizienz in der Wortschatzvermittlung Eine vergleichende experimentelle Untersuchung zur Effektivität dreier Wortschatzvermittlungskonzepte für den Fremdsprachenunterricht: Suggestopädie,
Neda Teymoortash Effizienz in der Wortschatzvermittlung Eine vergleichende experimentelle Untersuchung zur Effektivität dreier Wortschatzvermittlungskonzepte für den Fremdsprachenunterricht: Suggestopädie,
Mehrsprachigkeit als Chance
 Fachtagung Migration Integration: Schule gestaltet Vielfalt Bonn 23.-24.5.2016 Mehrsprachigkeit als Chance Elisabeth Gessner / Horst Paul Kuhley Universität Kassel Forum Lesen Kassel Ausgangspunkt: Seminar
Fachtagung Migration Integration: Schule gestaltet Vielfalt Bonn 23.-24.5.2016 Mehrsprachigkeit als Chance Elisabeth Gessner / Horst Paul Kuhley Universität Kassel Forum Lesen Kassel Ausgangspunkt: Seminar
Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren?
 Geisteswissenschaft Anonym Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren? Essay Friedrich-Schiller-Universität
Geisteswissenschaft Anonym Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren? Essay Friedrich-Schiller-Universität
Bilingualer Unterricht an der Pestalozzischule
 Bilingualer Unterricht an der Pestalozzischule Der bilinguale Unterricht, d.h. der Sachfachunterricht in zwei Arbeitssprachen (Englisch als Zielsprache und Deutsch) wird bereits seit dem Schuljahr 2010/2011
Bilingualer Unterricht an der Pestalozzischule Der bilinguale Unterricht, d.h. der Sachfachunterricht in zwei Arbeitssprachen (Englisch als Zielsprache und Deutsch) wird bereits seit dem Schuljahr 2010/2011
LehrplanPLUS Mittelschule Englisch Klasse 5. Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick. 1. Aufbau des Lehrplans
 Mittelschule Englisch Klasse 5 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der Englischunterricht an der Mittelschule ist wie schon bisher - kommunikativ ausgerichtet. Die grundlegenden Voraussetzungen
Mittelschule Englisch Klasse 5 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der Englischunterricht an der Mittelschule ist wie schon bisher - kommunikativ ausgerichtet. Die grundlegenden Voraussetzungen
Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht"
 Geisteswissenschaft Nicole Friedrich Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht" Eine Annäherung Essay Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Lektürekurs Foucault Sommersemester 2011
Geisteswissenschaft Nicole Friedrich Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht" Eine Annäherung Essay Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Lektürekurs Foucault Sommersemester 2011
8. Statistik Beispiel Noten. Informationsbestände analysieren Statistik
 Informationsbestände analysieren Statistik 8. Statistik Nebst der Darstellung von Datenreihen bildet die Statistik eine weitere Domäne für die Auswertung von Datenbestände. Sie ist ein Fachgebiet der Mathematik
Informationsbestände analysieren Statistik 8. Statistik Nebst der Darstellung von Datenreihen bildet die Statistik eine weitere Domäne für die Auswertung von Datenbestände. Sie ist ein Fachgebiet der Mathematik
Spracherwerbsprozess beim Erwerb von Deutsch als Fremdsprache im schulischen Kontext Lernersprachen kroatischsprachiger Deutschlerner
 MAJA HÄUSLER (Zagreb, Kroatien) Spracherwerbsprozess beim Erwerb von Deutsch als Fremdsprache im schulischen Kontext Lernersprachen kroatischsprachiger Deutschlerner In diesem Beitrag sollen die Ergebnisse
MAJA HÄUSLER (Zagreb, Kroatien) Spracherwerbsprozess beim Erwerb von Deutsch als Fremdsprache im schulischen Kontext Lernersprachen kroatischsprachiger Deutschlerner In diesem Beitrag sollen die Ergebnisse
Didaktisch-methodische Gestaltung interkultureller Erkundungen
 4. qualiko Kolloquium: Didaktisch-methodische Gestaltung interkultureller Erkundungen Elke Bosse Inst. für Interkulturelle Kommunikation Universität Hildesheim bossee@uni-hildesheim.de Interkulturelles
4. qualiko Kolloquium: Didaktisch-methodische Gestaltung interkultureller Erkundungen Elke Bosse Inst. für Interkulturelle Kommunikation Universität Hildesheim bossee@uni-hildesheim.de Interkulturelles
Dossier: Funktionales Übersetzen
 Universität Leipzig Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie Sommersemester 2013 Modelle und Methoden der Übersetzungswissenschaft bei Prof. Dr. Carsten Sinner Johannes Markert Dossier: Funktionales
Universität Leipzig Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie Sommersemester 2013 Modelle und Methoden der Übersetzungswissenschaft bei Prof. Dr. Carsten Sinner Johannes Markert Dossier: Funktionales
Behaviorismus und Nativismus im Erstspracherwerb
 Behaviorismus und Nativismus im Erstspracherwerb 13-SQM-04 (Naturwissenschaft für Querdenker) 09.07.2015 Simeon Schüz Gliederung 1. Einleitung 2. Die Behavioristische Hypothese 2.1 Grundlegende Annahmen
Behaviorismus und Nativismus im Erstspracherwerb 13-SQM-04 (Naturwissenschaft für Querdenker) 09.07.2015 Simeon Schüz Gliederung 1. Einleitung 2. Die Behavioristische Hypothese 2.1 Grundlegende Annahmen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Genial! Deutsch DAZ/DAF - Schritt für Schritt zukunftsfit - Schulbuch Deutsch - Serviceteil Das komplette Material finden Sie hier:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Genial! Deutsch DAZ/DAF - Schritt für Schritt zukunftsfit - Schulbuch Deutsch - Serviceteil Das komplette Material finden Sie hier:
2 Mythen und Missverständnisse über die Methoden zum Erlernen einer Zweitsprache: Wie geht es wirklich? 22
 A Warum ist die Bilingualität so viel besser als die Monolingualität? 1 Welche Vorteile bietet die Zweisprachigkeit Ihrem Kind? 10 Der kognitive Vorteil der Zweisprachigkeit 11 Das Erlernen einer Fremdsprache
A Warum ist die Bilingualität so viel besser als die Monolingualität? 1 Welche Vorteile bietet die Zweisprachigkeit Ihrem Kind? 10 Der kognitive Vorteil der Zweisprachigkeit 11 Das Erlernen einer Fremdsprache
Schreiben in Unterrichtswerken
 Europäische Hochschulschriften 1014 Schreiben in Unterrichtswerken Eine qualitative Studie über die Modellierung der Textsorte Bericht in ausgewählten Unterrichtswerken sowie den Einsatz im Unterricht
Europäische Hochschulschriften 1014 Schreiben in Unterrichtswerken Eine qualitative Studie über die Modellierung der Textsorte Bericht in ausgewählten Unterrichtswerken sowie den Einsatz im Unterricht
Latein Lehrplan für das Grundlagenfach (mit Basissprache)
 Kantonsschule Zug l Gymnasium Latein mit Basissprache Grundlagenfach Latein Lehrplan für das Grundlagenfach (mit Basissprache) A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wochenstunden 0 0 3 3 3 3 B. Didaktische
Kantonsschule Zug l Gymnasium Latein mit Basissprache Grundlagenfach Latein Lehrplan für das Grundlagenfach (mit Basissprache) A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wochenstunden 0 0 3 3 3 3 B. Didaktische
Präsentation von Susanne Flükiger, Stabsstelle Pädagogik, Kanton Solothurn. PP Medienanlass
 Präsentation von Susanne Flükiger, Stabsstelle Pädagogik, Kanton Solothurn (Didaktische) Grundgedanken Was ist das Ziel des Fremdsprachenunterrichts? Wie erwerben wir neues Wissen? Wie lernen wir die erste
Präsentation von Susanne Flükiger, Stabsstelle Pädagogik, Kanton Solothurn (Didaktische) Grundgedanken Was ist das Ziel des Fremdsprachenunterrichts? Wie erwerben wir neues Wissen? Wie lernen wir die erste
Lernaufgabe: Das stand in der Zeitung 2 Stilblüten Lernarrangement: Kindernachrichten Klasse: 3/4
 Lernaufgabe: Das stand in der Zeitung 2 Stilblüten Lernarrangement: Kindernachrichten Klasse: 3/4 Bezug zum Lehrplan Bereich des Faches Schwerpunkt Kompetenzerwartungen Sprache und Sprachgebrauch untersuchen
Lernaufgabe: Das stand in der Zeitung 2 Stilblüten Lernarrangement: Kindernachrichten Klasse: 3/4 Bezug zum Lehrplan Bereich des Faches Schwerpunkt Kompetenzerwartungen Sprache und Sprachgebrauch untersuchen
Sprachpraxis Französisch IV
 Modulbeschreibungsformular Fachwissenschaft für das Lehramtsfach Französisch (Master) Sprachpraxis Französisch IV 537145000 180 h 6 LP Modulbeauftragter Véronique Barth-Lemoine WS oder SS des Moduls Master
Modulbeschreibungsformular Fachwissenschaft für das Lehramtsfach Französisch (Master) Sprachpraxis Französisch IV 537145000 180 h 6 LP Modulbeauftragter Véronique Barth-Lemoine WS oder SS des Moduls Master
Narrative Kompetenz in der Fremdsprache Englisch
 Fremdsprachendidaktik inhalts- und lernerorientiert / Foreign Language Pedagogy - content- and learneroriented 27 Narrative Kompetenz in der Fremdsprache Englisch Eine empirische Studie zur Ausprägung
Fremdsprachendidaktik inhalts- und lernerorientiert / Foreign Language Pedagogy - content- and learneroriented 27 Narrative Kompetenz in der Fremdsprache Englisch Eine empirische Studie zur Ausprägung
Der Oberdeutsche Präteritumschwund
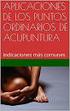 Germanistik Nadja Groß Der Oberdeutsche Präteritumschwund Zur Beobachtung einer sich verstärkenden Veränderung unseres Tempussystems Studienarbeit INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung... 1 2. Zwei Vergangenheits-Tempora:
Germanistik Nadja Groß Der Oberdeutsche Präteritumschwund Zur Beobachtung einer sich verstärkenden Veränderung unseres Tempussystems Studienarbeit INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung... 1 2. Zwei Vergangenheits-Tempora:
Die Bedeutungsrelation Synonymie im Französischen
 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Sommersemester 2012 Seminar: Wortschatz formal und inhaltlich (Französisch) Seminarleiterin: Nora Wirtz M.A. Referentin: Vanessa Almeida Silva Datum: 26.04.2012 Die
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Sommersemester 2012 Seminar: Wortschatz formal und inhaltlich (Französisch) Seminarleiterin: Nora Wirtz M.A. Referentin: Vanessa Almeida Silva Datum: 26.04.2012 Die
Hochschulzertifikat Deutsch als Fremdsprache / Deutsch als Zweitsprache
 Hochschulzertifikat Deutsch als Fremdsprache / Deutsch als Zweitsprache Modulhandbuch, Stand: 20.06.2016 Vorbemerkung Die Pädagogische Hochschule Karlsruhe bietet ab Oktober 2016 einen Zertifikatskurs
Hochschulzertifikat Deutsch als Fremdsprache / Deutsch als Zweitsprache Modulhandbuch, Stand: 20.06.2016 Vorbemerkung Die Pädagogische Hochschule Karlsruhe bietet ab Oktober 2016 einen Zertifikatskurs
Kernlehrplan Philosophie - Einführungsphase
 Kernlehrplan Philosophie - Einführungsphase Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie unterscheiden philosophische
Kernlehrplan Philosophie - Einführungsphase Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie unterscheiden philosophische
Modulhandbuch für das Fach Englisch im Masterstudium für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Studiensemester. Leistungs -punkte 8 LP
 Modulhandbuch für das Fach Englisch im Masterstudium für das Lehramt an Haupt, Real und Gesamtschulen Titel des Moduls Linguistik Kennnummer MEd EHRGeM 1 Workload 240 h 1.1 Vertiefung Ling 1: Sprachstruktur
Modulhandbuch für das Fach Englisch im Masterstudium für das Lehramt an Haupt, Real und Gesamtschulen Titel des Moduls Linguistik Kennnummer MEd EHRGeM 1 Workload 240 h 1.1 Vertiefung Ling 1: Sprachstruktur
Der Labeling Approach
 Geisteswissenschaft Feryal Kor Der Labeling Approach Studienarbeit 1. Einleitung In jeglichen Gesellschaftsformen leben die unterschiedlichsten Individuen, welche vielfältige und unterschiedliche Verhaltensweisen
Geisteswissenschaft Feryal Kor Der Labeling Approach Studienarbeit 1. Einleitung In jeglichen Gesellschaftsformen leben die unterschiedlichsten Individuen, welche vielfältige und unterschiedliche Verhaltensweisen
Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend
 Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend oder eindeutig, wenn keine alternativen Interpretationsmöglichkeiten
Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend oder eindeutig, wenn keine alternativen Interpretationsmöglichkeiten
2. Grammatikprogression
 2. Grammatikprogression Die Grammatikprogression betrifft die Auswahl, Reihenfolge und die Gewichtung der im Lehrwerk eingeführten grammatischen Phänomenen. 2.1 Die Grammatikprogression in der GÜM Es gibt
2. Grammatikprogression Die Grammatikprogression betrifft die Auswahl, Reihenfolge und die Gewichtung der im Lehrwerk eingeführten grammatischen Phänomenen. 2.1 Die Grammatikprogression in der GÜM Es gibt
NBl. MWV. Schl.-H. 2008, S. 170 Tag der Bekanntmachung auf der Internetseite der CAU: 8. Oktober 2008
 Studien- und Prüfungsordnung (Satzung) der Philosophischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel für Studierende des Zertifikatsstudiums Deutsch als Fremdsprache Vom 7. August 00 NBl. MWV.
Studien- und Prüfungsordnung (Satzung) der Philosophischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel für Studierende des Zertifikatsstudiums Deutsch als Fremdsprache Vom 7. August 00 NBl. MWV.
Interkulturelles Marketing - Werbesprache in Deutschland und Frankreich
 Sprachen Steffen Plutz Interkulturelles Marketing - Werbesprache in Deutschland und Frankreich Bachelorarbeit Justus-Liebig-Universität Gießen Institut für Romanistik Bachelorarbeit zur Erlangung des
Sprachen Steffen Plutz Interkulturelles Marketing - Werbesprache in Deutschland und Frankreich Bachelorarbeit Justus-Liebig-Universität Gießen Institut für Romanistik Bachelorarbeit zur Erlangung des
Vorlesung: Literatur und Landeskunde im DaF-Unterricht
 HS 2012, Mittwoch, 13:15-14:45, MIS 3024 Vorlesung: Literatur und Landeskunde im DaF-Unterricht Sitzung 10: Literatur im Fremdsprachenunterricht: Literarische Kurzformen Deutsch als Fremdsprache/ Deutsch
HS 2012, Mittwoch, 13:15-14:45, MIS 3024 Vorlesung: Literatur und Landeskunde im DaF-Unterricht Sitzung 10: Literatur im Fremdsprachenunterricht: Literarische Kurzformen Deutsch als Fremdsprache/ Deutsch
Bilingualer Sachfachunterricht. Chancen und Herausforderungen Ein Einblick in theoretische Hintergründe
 Bilingualer Sachfachunterricht Chancen und Herausforderungen Ein Einblick in theoretische Hintergründe Bilingualer Sachfachunterricht 1. Begriffe und Definitionen 2. Rahmenbedingungen des bilingualen Sachfachunterrichts
Bilingualer Sachfachunterricht Chancen und Herausforderungen Ein Einblick in theoretische Hintergründe Bilingualer Sachfachunterricht 1. Begriffe und Definitionen 2. Rahmenbedingungen des bilingualen Sachfachunterrichts
Zweisprachigkeit in der Kita Chance und Herausforderung. Agnieszka Meise
 Zweisprachigkeit in der Kita Chance und Herausforderung Agnieszka Meise Polnisch im Kindergarten Warum so früh? Warum Polnisch? Wie? Organisationsmodelle Erwartungen und Zielsetzung Rolle der zweisprachigen
Zweisprachigkeit in der Kita Chance und Herausforderung Agnieszka Meise Polnisch im Kindergarten Warum so früh? Warum Polnisch? Wie? Organisationsmodelle Erwartungen und Zielsetzung Rolle der zweisprachigen
Sozialwissenschaftliche Methoden und Methodologie. Begriffe, Ziele, Systematisierung, Ablauf. Was ist eine Methode?
 Sozialwissenschaftliche Methoden und Methodologie WiSe 2007/ 08 Prof. Dr. Walter Hussy Veranstaltung 1 Begriffe, Ziele, Systematisierung, Ablauf 24.01.2008 1 Was ist eine Methode? Eine Methode ist eine
Sozialwissenschaftliche Methoden und Methodologie WiSe 2007/ 08 Prof. Dr. Walter Hussy Veranstaltung 1 Begriffe, Ziele, Systematisierung, Ablauf 24.01.2008 1 Was ist eine Methode? Eine Methode ist eine
