Schlaf in der chronischen Phase eines Schlaganfalls
|
|
|
- Clara Albert
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Aus dem Zentrum für Psychische Erkrankungen Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg im Breisgau Schlaf in der chronischen Phase eines Schlaganfalls INAUGURAL-DISSERTATION zur Erlangung des Medizinischen Doktorgrades der Medizinischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau Vorgelegt 2016 von Sarah Katharina Trotter, geb. Funk Geboren in Scherzingen, Schweiz
2 Dekanin: Frau Prof. Dr. Kerstin Krieglstein Erster Gutachter: Herr Prof. Dr. Christoph Nissen Zweiter Gutachter: Herr Prof. Dr. Hans-Willi Clement Jahr der Promotion: 2017
3 Inhaltsverzeichnis Danksagung Zusammenfassung Einleitung Schlaganfall Schlaf Schlafregulation Schlaganfall und Schlaf Konsequenzen von Schlafstörungen Schlaf nach Schlaganfall Studienhypothesen Methodenteil Stichprobe Ein- und Ausschlusskriterien Rekrutierung und ethische Aspekte Untersuchungsdesign Untersuchungsablauf Ablauf des Screeningverfahrens Telefonscreening Voruntersuchung Ablauf der Testung Vorphase Adaptationsnacht Untersuchungsnacht: Untersuchungsinstrumente Aktigraphie Beck-Depressions-Inventar Edinburgh Händigkeitsinventar Pittsburgher Schlafqualitätsindex Mini International Neuropsychiatric Interview Motor Activity Log I
4 Polysomnographie Schlaftagebuch Schlaffragebogen A Stroke Impact Scale Statistische Auswertung Ergebnisse Ergebnisse der Untersuchungsnacht Korrelation der Stroke Impact Scale mit Schlafdaten der Untersuchungsnacht Ergebnisse der Adaptationsnacht Ergebnisse der Fragebögen, subjektive Schlafdaten Diskussion Diskussion der Ergebnisse der Untersuchungsnacht Diskussion der Korrelationen zwischen Einschränkungen nach einem Schlaganfall und Schlafdaten Diskussion der subjektiven Schlafdaten Stärken und Limitationen der Arbeit Anhang Literaturverzeichnis II
5 0. Danksagung Danksagung Dass diese Dissertation zu einem Abschluss gefunden hat verdanke ich der Unterstützung zahlreicher Personen, bei denen ich mich im Folgenden bedanken möchte. Zunächst danke ich Herrn Prof. Dr. Christoph Nissen sowie Frau Prof. Dr. Annette Sterr für das Überlassen der Arbeit, die geduldige Betreuung währenddessen und für die vielen konstruktiven Beiträge, die diese Arbeit bereichert und geformt haben. Herrn Prof. Dr. Hans-Willi Clement danke ich für die Übernahme der Zweitkorrektur! Bei Herrn Dipl.-Psych. Thomas Unbehaun, der die erste Phase dieser Arbeit betreute und Frau Dipl.-Psych. Marion Kuhn, die sich in der zweiten Phase dieses Werkes angenommen hat, möchte ich mich herzlich bedanken. Vielen Dank für alle Geduld, Zuverlässigkeit und Flexibilität! Für eure ständige Ansprechbarkeit und Unterstützung in allen Fragen war ich sehr dankbar! Für die entspannte, humorvolle Zusammenarbeit und zuverlässige Mitarbeit möchte ich mich bei Deviana Ettine bedanken. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Schlaflabors, die diese Arbeit unterstützt haben, möchte ich einen großen Dank aussprechen: Herr Prof. Dr. Riemann, Herr Dr. Feige, Herr Tritschler, Frau Frohn, Herr Anjard, Herr von Lucadou und Frau Franz. Für den beständigen Beistand, die fortwährenden Ermutigungen und liebevolle Unterstützung durch meine Familie, meinen Ehemann Martin und Gott während meines bisherigen Lebens und im Rahmen dieser Arbeit bin ich sehr dankbar
6 1. Zusammenfassung 1. Zusammenfassung Die vorliegende Studie untersuchte den Schlaf bei Schlaganfallpatienten in der chronischen Phase. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es herauszufinden, ob in dieser Phase spezifische Schlafveränderungen vorliegen, ob diese mit der Schwere des Schlaganfalls in Verbindung stehen und sich subjektive und objektive Schlafdaten bei Schlaganfallpatienten in der chronischen Phase decken. Dazu wurde der Schlaf von 19 Patienten (6 weibliche und 13 männliche Teilnehmer, 63.5 ± 8.0 Jahre) mit rechtshemisphärischem Schlaganfall und 21 gesunden Probanden (7 weibliche und 14 männliche Teilnehmer, 59.2 ± 8.6 Jahre) mittels Polysomnographie im Schlaflabor untersucht. Neben diesem Messverfahren kamen mit einem Schlaftagebuch und dem Schlaffragebogen A subjektive Untersuchungsinstrumente zum Einsatz. Die Schwere des Schlaganfalls und dessen Folgen wurden über bestehende Einschränkungen in verschiedenen Lebensbereichen mit Hilfe des Stroke Impact Scale Fragebogens eingeschätzt. Es zeigte sich eine signifikant geringere polysomnographisch bestimmte Schlafeffizienz mit signifikant längeren Wachzeiten bei den Schlaganfallpatienten im Vergleich zu den gesunden Probanden. Zugrunde lagen eine leicht, nicht signifikant geminderte Gesamtschlafdauer und eine etwas, ebenfalls nicht signifikant verlängerten Bettzeit und Schlafperiode (Zeit zwischen Einschlafen und morgendlichem Aufwachen). Weiterhin fanden sich in einer explorativen Betrachtung der Patientendaten positive Korrelationen zwischen der klinischen Schwere des Schlaganfalls und der REM- Latenz, dem prozentualen Anteil des Schlafstadiums 2 am Gesamtschlaf, der Schlafdauer, der Anzahl an Stadienwechseln und eine negative Korrelation zwischen der Schwere des Schlaganfalls mit der Anzahl an Augenbewegungen. Auch in den subjektiven Daten zeigte sich eine signifikant verringerte Schlafeffizienz in der Gruppe der Schlaganfallpatienten im Vergleich zu den Probanden, die aus einem Gruppenunterschied in der Bettzeit mit längeren Bettzeiten bei den Patienten hervorging. In der qualitativen Bewertung der Nacht mittels Schlaffragebogens A fand sich kein Gruppenunterschied. Somit scheinen die Unterschiede in der Schlafeffizienz in der Gruppe der Patienten keinen erkennbaren Einfluss auf die qualitative Bewertung der Nacht bzw. des Schlafes zu haben
7 2. Einleitung 2. Einleitung Etwa Menschen erleiden in Deutschland pro Jahr einen Schlaganfall (Heuschmann et al., 2010). Im Zuge der demographischen Entwicklung wird die Inzidenz und damit die Bedeutung in den kommenden Jahren in den Industrienationen weiter steigen (Foerch et al., 2008). Schon heute gehört der Schlaganfall in Deutschland zu den häufigsten Todesursachen. 20% der betroffenen Patienten sterben direkt an einem Schlaganfall (Berlit, 2014). Wenn der Schlaganfall nicht das Leben fordert, leiden viele Patienten in der Zeit danach unter starken Einschränkungen ihres Alltags. Körperliche Veränderungen, die direkt durch eine Hirnschädigung entstehen, wie Lähmungen, Sensibilitätsstörungen, Gesichtsfeldausfälle oder das Neglect-Syndrom, welches die geringere Wahrnehmung einer Körperhälfte beschreibt, erschweren den Alltag. Nicht selten kommen Inkontinenz (Nakayama, 1997), epileptische Anfälle (Bladin et al., 2000), sexuelle Dysfunktionen (Tamam et al., 2008) oder ein chronisches Schmerzsyndrom (Jonsson et al., 2006) hinzu. Neben häufigen Veränderungen im sozialen Umfeld, finden sich auch vermehrt psychische Erkrankungen, wobei depressive Störungen (Pohjasvaara et al., 1998) und Angststörungen (Castillo et al., 1993) einen Großteil ausmachen. Nicht zuletzt sind neu aufgetretene Schlafstörungen eine große Last für viele Betroffene (Hermann&Bassetti, 2009). Diese können als schlafassoziierte Atemstörungen oder Erkrankungen, die den Schlaf-Wach-Rhythmus, wie Hypersomnie oder Insomnie, betreffen, auftreten (Bassetti, 2005). Mit der Folge von teilweise schwerer Tagesmüdigkeit und Tagesschläfrigkeit führen diese nicht nur zu einer Risikoerhöhung für Unfälle, sondern schränken auch die Lebensqualität drastisch ein. Bisher ist die Datenlage zu Schlafstörungen in der chronischen Phase nach einem Schlaganfall dünn. Auch in der Frage, ob Veränderungen, die in der Akutphase nach einem Schlaganfall mit Hilfe einer polysomnographischen Untersuchung detektiert wurden, noch in der chronischen Phase nach einem Schlaganfall nachweisbar sind, besteht Unklarheit. Dies näher zu untersuchen, war Ziel dieser Arbeit. Im Folgenden werden Grundlagen zum Krankheitsbild des Schlaganfalls, des Schlafes allgemein und seiner Regulation sowie der aktuelle Stand der Wissenschaft zu Schlaf und Schlaganfall beschrieben
8 2. Einleitung 2.1 Schlaganfall Ein Schlaganfall bezeichnet den ischämischen Untergang von Hirngewebe. In ca. 80 % der Fälle sind Gefäßverschlüsse die Ursache, den Rest machen Hirnblutungen aus (Mumenthaler&Mattle, 2006). Ein Schlaganfall kann alle Bereiche des Gehirns betreffen. Abhängig von der Lokalisation und der dort verlaufenden Nervenbahnen kann ein Schlaganfall zu sensiblen, motorischen, aber auch sensorischen Funktionsausfällen, wie einer Gesichtsfeldeinschränkung oder Geschmacksveränderung, führen. Meist befinden sich diese Einschränkungen, wie beispielweise Lähmungen, auf der zum Ort der Hirnschädigung entgegengesetzten Körperhälfte, da ein Großteil der Nervenbahnen in ihrem Verlauf durch das Gehirn auf die Gegenseite kreuzt. So führt der Untergang von Nervenzellen im rechten mittelliniennahen Motorcortex zu Lähmungen des linken Beines. Nicht selten geht ein Schlaganfall mit Störungen des Bewusstseins, der Okulomotorik (Augenbewegungen) oder Kopfschmerzen einher. Die wichtigsten Risikofaktoren, die einen Schlaganfall begünstigen, sind eine arterielle Hypertonie, das Vorhandenseins eines Diabetes mellitus und eine Fettstoffwechselstörung. Um die Ursache, beispielsweise den Ursprungsort eines Embolus (Gefäßpropf) ausmachen und das Vorhandensein beziehungsweise das Ausmaß einer Hirnschädigung feststellen zu können werden verschiedene diagnostische Untersuchungen durchgeführt. Dazu gehört die Bestimmung diverser Blutparameter, unter anderem zum Ausschluss einer Koagulopathie (Störung der Blutgerinnung), die Auskultation und dopplersonographische Untersuchung der Halsgefäße, kardiologische Untersuchungen zum Ausschluss kardialer Emboliequellen und die Bildgebung des Kopfes durch Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT). Ergänzend kann eine Angiographie (Gefäßdarstellung) durchgeführt werden. Bei Vorliegen eines Gefäßverschlusses wird eine systemische Lyse mit rtpa (recombinant tissue-plasminogen-activator) als Therapieversuch angestrebt, um den Embolus aufzulösen. Diese Therapie ist bis zu 4,5 Stunden nach Auftreten des Schlaganfalls zugelassen. Alternativ kann bis zu 6 Stunden nach einem Schlaganfall eine mechanische Thrombektomie (Entfernung des Blutgerinnsels) durch ein Stent- Retriever-System (mechanisches System) oder durch lokale Applikation von rtpa oder Pro-Urikinase (beides Lysemedikamente) versucht werden
9 2. Einleitung Liegt als Ursache eine intrazerebrale Blutung vor, so geht man bei nichtraumfordernden Blutungen konservativ vor. Unter Beobachtung der Vitalparameter wird der Patient auf einer Intensivstation überwacht. Sobald Anzeichen für eine Komplikation auftreten, zum Beispiel durch eine neu aufgetretene Bewusstseinsstörung, wird die operative Ausräumung des Hämatoms angestrebt. 2.2 Schlaf Fest mit dem höher entwickelten Leben verbunden, unterlag die Bewertung des Schlafes im Verlauf der Jahrhunderte einem steten Wandel. Lange Zeit als passiver Vorgang bewertet, gelang 1929 durch die Entwicklung des Elektroenzephalogramms (EEG) durch Hans Berger das Ableiten von elektrischen Hirnströmen während des Schlafes (Berger, 1929). So entwickelte sich nach und nach das heutige Verständnis, nämlich dass Schlafen nicht nur ein hochkomplexes aktives Geschehen darstellt, sondern auch lebenswichtige Funktionen erfüllt. Mit Hilfe von Hans Bergers Erfindung, erweitert um Elektromyografie und Elektrookulografie, lässt sich der Schlaf durch charakteristische Hirnstrommuster in fünf verschiedene Phasen einteilen, die gemeinsam einen Zyklus von 90 Minuten bilden. In jeder Nacht durchläuft ein Mensch durchschnittlich fünf solcher Schlafzyklen. Abbildung 1 gibt exemplarisch einen Überblick über den Ablauf einer Nacht und die für die einzelnen Phasen typischen EEG-Muster. Während des Übergangs vom Zustand des Wachseins zum Schlafstadium IV kommt es zu einer Verlangsamung der Hirnstromfrequenz. Im Wachzustand dominieren Alpha- und Beta-Wellen, die während der Einschlafphase in Schlafstadium I in Theta-Wellen übergehen. In Schlafstadium II kommt es zum Auftreten besonderer Wellen: den Schlafspindeln und K-Komplexen. Die Schlafstadien III und IV werden als Tiefschlafphasen bezeichnet und als slow wave sleep (SWS) zusammengefasst. Namensgebend hierfür sind die in diesen Stadien vorwiegend zu beobachtenden niederfrequenten Delta-Wellen. Die ersten vier Stadien werden dem Non-Rapid-Eye-Movement- (NREM-) Schlaf zugeordnet. Daran schließt sich die fünfte Schlafphase als Rapid-Eye-Movement (REM-) Schlaf an. Im Gegensatz zu den ersten vier Stadien finden sich hier einerseits die namensgebenden raschen Augenbewegungen, andererseits eine Erschlaffung der peripheren Muskulatur und eine vegetative Aktivierung mit erhöhter Herzfrequenz und - 7 -
10 2. Einleitung gesteigertem Stoffwechsel. Wegen dieser Besonderheit spricht man auch von paradoxem Schlaf. Abbildung 1: Überblick über den Ablauf einer Nacht. Zu sehen sind fünf Schlafzyklen mit einer Dauer von jeweils 90 Minuten. Diese bestehen aus den fünf Schlafphasen, die durch typische Wellenmuster im Elektroenzephalogramms (EEG) unterschieden werden können. Im Wachzustand finden sich hochfrequente β-wellen sowie bei geschlossenen Augen α-wellen. In den Einschlafstadien dominieren ϴ-Wellen (Stadium I), die im Stadium II durch so genannte Schlafspindeln und K-Komplexe ergänzt werden. In den Tiefschlafphasen verlangsamen sich die gemessenen Hirnströme zu δ-wellen, während die sich daran anschließende Rapid-Eye-Movement-(REM-)Schlafphase durch hochfrequente EEG-Ausschläge gekennzeichnet ist. Quelle: modifiziert nach Deister et al., 2013 Im Verlauf einer Nacht nimmt die Dauer der REM-Phasen zu und die der NREM- Phasen ab. Auch mit zunehmenden Lebensjahren verändert sich der Schlaf. Die in unserer Studie untersuchte Altersgruppe von im Durchschnitt 59 Jahren bei den Kontrollpersonen bzw. 64 Jahren bei den Patienten weist im Vergleich zu jungen Erwachsenen eine verringerte Gesamtschlafzeit von etwa sieben Stunden pro Nacht auf. Außerdem hat sich der Anteil des REM-Schlafs auf unter 20% der Schlafzeit - 8 -
11 2. Einleitung verringert. Die Tiefschlafphasen (Stadien III und IV) werden seltener bis gar nicht mehr erreicht der Schlaf ist also oberflächlicher geworden. Interessant sind neben diesen Veränderungen und Charakteristika des Schlafes jedoch auch die Prozesse, die hinter diesen immer wiederkehrenden Abläufen stehen und mit denen sich das folgende Kapitel auseinandersetzt. Schlafregulation Im Gesamten betrachtet ähnelt das tägliche Wechselspiel zwischen Wach- und Schlafphasen einem Flip-Flop-Modell (Saper et al., 2001). Dieser Begriff aus der Elektronik beschreibt den Wechsel zwischen zwei Zuständen und kann mit einer Wippe verglichen werden. Indem die fördernden Strukturen des einen Zustandes diejenigen des anderen übersteigen, kommt es direkt zum Wechsel in den zweiten Zustand ohne langes Übergangsstadium. Genau diese Situation liegt auch bei Betrachtung des menschlichen Schlaf-Wach-Rhythmus vor mit nur 1-2% der Gesamtzeit, die in Übergangsstadien zwischen Schlafen und Wachen verbracht wird (Saper et al., 2005). Die regulatorischen Komponenten dieses Schlaf-Wach-Modells sind einerseits der zirkadiane (tagesrhythmische) endogene Rhythmus, der synchronisiert zum äußeren Tag-Nacht Rhythmus abläuft (Prozess C), und andererseits ein schlaf-wachabhängiger (homöostatischer) Prozess (Prozess S), der sich als Schlafdruck bzw. Schläfrigkeit bemerkbar macht, wenn diesem nicht ausreichend nachgekommen wird (Zwei-Prozess-Modell) (Borbely, 1982). Die erste Komponente, der zirkadiane Schlaf-Wach-Rhythmus, wird durch den suprachiasmatischen Kern im ventralen Hypothalamus gesteuert (Reppert&Weaver, 2002). Durch Vernetzung mit Neuronen der Retina und der Pinealdrüse mit dem chemischen Signal Melatonin gelingt die Synchronisierung des Schlaf-Wach- Rhythmus mit dem Tag-Nacht-Zyklus (Johnson et al., 1988). Über Verbindungen zu weiteren Kernen im Hypothalamus, wie dem dorsomedialen Nukleus, dem ventrolateralen präoptischen Kern und dem lateralen Hypothalamus wird über den suprachiasmatischen Kern neben dem Schlaf die zirkadiane Regulation der Körpertemperatur, des Corticoidspiegels und der Nahrungsaufnahme gesteuert
12 2. Einleitung Der Hintergrund des Schlafdrucks, der zweiten Komponente des Modells, ist noch nicht vollständig geklärt. Aktuell geht man jedoch davon aus, dass sich im Laufe eines Tages Schlafsubstanzen, wie möglicherweise Adenosin, im Gehirn ansammeln, die die Schlafeinleitung fördern. In der Schlaferhaltung kommt dem ventrobasalen präoptischen Kern eine wichtige Funktion zu. Er ist Teil des Hypothalamus und enthält die inhibitorischen Neurotransmitter Galanin und γ-aminobuttersäure (Gaus et al, 2002; Sherin et al., 1998). Im Schlaf inhibiert er alle wichtigen Nervengruppen, die durch das aufsteigende retikuläre Aktivierungssystem am Wachvorgang beteiligt sind (Sherin et al., 1996). Außerdem ist seit einigen Jahren bekannt, dass Orexin, auch Hypocretin genannt, bei der Stabilisierung des Flip-Flop-Modells eine entscheidende Rolle spielt (Saper et al., 2005). Das aufsteigende retikuläre Aktivierungssystem spielt dagegen für Aufmerksamkeit und Wachzustand eine zentrale Rolle. Es besteht aus verschiedenen Nervenzellgruppen, die der Formatio reticularis zugeordnet werden. Eine Erklärung für den periodischen Wechsel von REM- und NREM-Schlafphasen im Verlauf einer Nacht liefert das reziproke Interaktionsmodell von Hobson und McCarley (1975). Demnach kommt es im NREM-Schlaf zu einer Aktivitätsminderung von aminergen und cholinergen Nervenzellen. Dagegen nehmen im REM-Schlaf cholinerge Neurone ihre Aktivität wieder auf, während aminerge Neurone weiterhin gehemmt bleiben. Indem beide Zellgruppen sich selbst und gegenseitig hemmen, kommt es im Verlauf des Schlafes zu einer rhythmischen Abfolge beider Phasen (Hobson& McCarley, 1975). Der Schlaf kann weiterhin durch äußere Umstände, wie die Menge der Nahrungszufuhr mit nachfolgendem Hunger- oder Sättigungsgefühl (Yamanaka et al., 2003) sowie Gefühle und kognitive Zustände beeinflusst werden. Besonders für die Akutphase nach einem Schlaganfall hat dies Bedeutung
13 2. Einleitung 2.3 Schlaganfall und Schlaf Durch pflegeassoziierte Geräusche, Licht oder medizinische Apparate kann der Schlaf gestört werden (Bassetti, 2005). Doch nicht nur die veränderten Umgebungsbedingungen sind der Grund dafür, dass Schlaganfallpatienten häufig von Schlafstörungen betroffen sind. Auch aus direkten Schäden im Hirngewebe können Schlafstörungen resultieren. So ist beispielsweise bekannt, dass Läsionen, die das aufsteigende aktivierende retikuläre System betreffen, besonders im Bereich des Thalamus, Subthalamus, im tegmentalen Mittelhirn und in der oberen Pons, zu einer exzessiven Tagesschläfrigkeit (Hypersomnie) führen können. Konsequenzen von Schlafstörungen Viele Studien der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass diese und andere Veränderungen des Schlafes nicht harmlos sind. Andauernde Schlafstörungen führen demnach nicht nur zu Beschwerden, die direkt auf den entstehenden Schlafmangel zurückzuführen sind, wie Konzentrations-, Aufmerksamkeitsstörungen und kognitive Leistungseinbrüche (Van Dongen et al., 2003, Doran et al., 2001), sondern auch zu erhöhtem Stress (Orzeł-Gryglewska, 2010) und können in Extremsituationen Halluzinationen (Patrick&Gilbert, 1896) oder sogar eine Schlafentzugspsychose (Orzeł-Gryglewska, 2010) hervorrufen. Langfristig steigt das Risiko für eine Vielzahl an Erkrankungen. Kardiovaskuläre Erkrankungen, wie Bluthochdruck (Gottlieb et al., 2006), aber auch Diabetes mellitus (Gottlieb et al., 2005) nehmen zu. Auch psychische Erkrankungen, wie Depressionen, sind bei Schlafmangel häufiger zu verzeichnen (Baglioni et al., 2011). Im Zusammenhang mit Schlaganfall können parallel vorhandene Schlafstörungen den Rehabilitationsprozess verlängern (Kaneko et al, 2003) und zu schlechteren Heilungsergebnissen führen (Bassetti&Aldrich, 2001). Aus all diesen Gründen ist es essentiell, weiterhin an Schlafstörungen zu forschen. Besonders beim Krankheitsbild des Schlaganfalls könnten Erkenntnisse der Schlafmedizin zu Präventionsmöglichkeiten gegen das Auftreten eines (erneuten) Schlaganfalls führen, nach Eintritt der Erkrankung der positiven Beeinflussung des
14 2. Einleitung Heilungsprozesses dienen und behandelndem Personal durch neue Erkenntnisse eine bessere Betreuung von betroffenen Patienten ermöglichen. Schlaf nach Schlaganfall Akutphase Über Schlafstörungen in der Akutphase, die individuell von unterschiedlicher Dauer ist (Veltkamp, 2012) und in der Literatur die Zeit bis zum achten (Vock et al., 2002) bzw. 14. Tag (Heidbuchel et al, 2013) nach einem Schlaganfall umfasst, ist bereits einiges bekannt. So ist bekannt, dass ein Großteil der Patienten schlafassoziierte Atemstörungen aufweist, unter denen mit knapp 50-60% aller Patienten das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom das häufigste ist (Iranzo et al., 2002; Turkington et al., 2002). Dies beschreibt ein Krankheitsbild, bei dem während des Schlafes durch eine Verlegung der oberen Atemwege Atempausen von mindestens 10-sekündiger Dauer auftreten, die von dem Betroffenen selbst nicht wahrgenommen werden und als Konsequenz des gestörten Schlafes meist mit Tagesschläfrigkeit einhergeht. Die Anzahl der Atempausen pro Stunde werden im Apnoe-Hypopnoe-Index (AHI) erfasst und dienen der Einschätzung der Krankheitsschwere. Apnoen beschreiben eine vollständige Atempause, während Hypopnoen als Reduktion des Atemflusses definiert sind, die mit einem Abfall der Sauerstoffsättigung und/oder einer Aufwachreaktion einhergehen. Ab 5 Apnoen/Hypopnoen kann die Diagnose eines Schlafapnoe- Syndroms gestellt werden. Auch andere Schlafstörungen, wie das Restless-Legs- Syndrom, ein abendlicher, beinbetonter Bewegungsdrang werden bei 12 % der Patienten einen Monat nach Schlaganfall beobachtet (Lee et al., 2009). Ebenso finden sich bei 20-40% der Patienten Erkrankungen, die den Schlaf-Wach-Rhythmus betreffen, wie Insomnie, Hypersomnie und Tagesschläfrigkeit (Bassetti et al., 2005) sowie Veränderungen der zirkadianen Rhythmik (Takekawa et al., 2007) und eine veränderte Schlafkontinuität. Letztere rückte erst in den letzten Jahren in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses. In einer Studie von Terzoudi et al. (2009) fand sich in der Akutphase nach einem Schlaganfall unabhängig vom Vorliegen einer schlafassoziierten Atemstörung ein gestörter Nachtschlaf. Dazu gehörte eine verkürzte Gesamtschlafzeit sowie eine verkürzte Zeit, die im Schlafstadium II und Tiefschlaf verbracht wurde. Außerdem
15 2. Einleitung registrierten die Autoren eine verlängerte Einschlaflatenz, also die Zeit bis zum Eintritt des Schlafes, ein erhöhtes Wachsein in der Nacht und eine erniedrigte Schlafeffizienz im Vergleich zu Kontrollpersonen. In anderen Studien wurden Veränderungen in Schlafkontinuität und -architektur der Akutphase identifiziert, die mit einer schlechten Prognosen bezüglich Heilungsergebnissen in Verbindung stehen könnten: Dazu zählen eine verminderte Schlafeffizienz und Gesamtschlafzeit in der Nacht mit einer verkürzten Gesamtzeit, die im Stadium II verbracht wird (Bassetti et al., 2001), eine gesteigerte Schlafdauer über den Tag verteilt, eine reduzierte Anzahl an Schlafspindeln, K-Komplexen, REM-Schlaf (Giubilei et al., 1992) und Tiefschlaf (Müller et al., 2002; Terzoudi et al., 2009) Chronische Phase Auch wenn der Einfluss von Schlafstörungen auf den Heilungsverlauf in der chronischen Phase keine Rolle mehr spielt, so sind deren Diagnose und eventuelle Therapie auch in diesem Zeitabschnitt relevant und wichtig. Nicht nur wegen der eingangs bereits beschriebenen möglichen direkten und indirekter Folgen von Schlafstörungen, sondern auch aufgrund der potenziellen Lebensqualitätsminderung des einzelnen Patienten. Die in der Literatur verbreitete zeitliche Grenze des chronischen Schlaganfall sind sechs Monate. Dennoch war dieser Zeitabschnitt lange Zeit nicht im Blickfeld der Forschung. Bis zum Jahr 2014 gab es lediglich eine Studie zu diesem Thema (Vock et al., 2002). In jüngerer Zeit haben nun zusätzlich zu der vorliegenden Arbeit zwei weitere Forschungsgruppen Ergebnisse zu diesem Thema veröffentlicht. Diese Arbeiten sollen nun im Folgenden vorgestellt werden. Eine Forschungsgruppe untersuchte Schlaganfallpatienten mit Hilfe eines Aktigraphen, einem Bewegungmesser, der am Handgelenk getragen wurde, nach sechs Monaten (Bakken et al., 2014). Zwei weitere Arbeitsgruppen untersuchten mittels Polysomnographie Schlaganfallpatienten in einer Zeitphase von 5-24 Monaten (Vock et al., 2002) bzw. mindestens sechs Monaten (Al Dughmi et al., 2015) nach Schlaganfall und verglichen die Ergebnisse mit gesunden Kontrollpersonen
16 2. Einleitung Bereits aus Studien, die den Verlauf von Schlafstörungen bis zur subakuten Phase, dem Zeitabschnitt zwei bis vier Wochen nach einem Schlaganfall, untersuchten, ist bekannt, dass sich einige Schlafstörungen in Ausprägung und Prävalenz verbessern. Vock et al., die im Jahr 2002 Schlaganfallpatienten bis in die chronische Phase begleiteten, beobachteten im Verlauf ebenfalls Befundverbesserungen. Sowohl die subjektiv erfasste Gesamtschlafzeit als auch die Angabe zu Tagesschläfrigkeit normalisierten sich bis zur chronischen Phase auf die mittels Fragebögen geschätzten Werte der Zeit vor dem Schlaganfall. Auffällige Parameter der Schlafkontinuität und architektur verbesserten sich ebenfalls bis zum Erreichen der chronischen Phase. Dazu gehörte die Schlafeffizienz, der prozentuale Anteil an REM-Schlaf sowie die Zeit, die in der Nacht wach gelegen wurde. Zusätzlich wurde bei Patienten, die nach ihrem Schlaganfall keine Veränderungen in Schlafeffizienz oder REM-Schlaf aufwiesen, über eine Veränderung der Tiefschlafphasen im Verlauf der Studie berichtet, was jedoch sowohl eine mögliche Verkürzung oder Verlängerung der Tiefschlafphasen beinhaltete. Jedoch wies auch in der chronischen Phase weiterhin ein Anteil von 53% der untersuchten Schlaganfallpatienten auffällige EEG- Werte auf. In der Akutphase waren dies noch 76 %. Welche Werte dabei auffällig blieben, wird nicht näher erwähnt. Als Vergleichsgruppe wurden in dieser Studie hospitalisierte Patienten gewählt. Die EEG-Ergebnisse in dieser Gruppe unterschieden sich nicht signifikant von den Ergebnissen der chronischen Schlaganfallpatienten, so dass die Autoren schlussfolgerten, dass durch einen Schlaganfall zwar eine Hypersomnie oder ein veränderter Schlafbedarf ausgelöst werden können, jedoch keine für einen Schlaganfall charakteristischen bleibenden EEG-Veränderungen (Vock et al., 2002). Al-Dughmi et al. (2015) konzentrierten sich in ihrer Studie auf Veränderungen von Schlafkontinuität und -architektur und verglichen die Ergebnisse der Schlaganfallpatienten mit einer gesunden Kontrollgruppe. Sie zeigten, dass chronische Schlaganfallpatienten signifikant weniger Zeit im Schlafstadium 3, dem Tiefschlaf, verbrachten als die Gruppe der Kontrollpersonen. Dies werteten sie als mögliches Zeichen einer neuronalen Dysfunktion, das bei Auftreten in früheren Phasen des Schlaganfalls mit einem schlechteren Heilungsverlauf assoziiert sein könnte. Alle
17 2. Einleitung anderen gemessenen Parameter der Schlafkontinuität und -architektur wiesen im Gruppenvergleich keine Unterschiede auf. Gegensätzlich zu diesen Ergebnissen fanden Bakken et al beim Vergleich von Aktigraphiedaten von Schlaganfallpatienten mit Normalwerten in der akuten und chronischen Phase eine erniedrigte Schlafeffizienz mit erhöhtem Wachanteil in der Nacht bei unauffälliger Gesamtschlafzeit und eine erhöhte Anzahl an Aufwachereignissen. Unklar ist bisher auch, inwiefern die Schwere eines Schlaganfalls Schlafparameter beeinflusst (Terzoudi et al., 2009) und wie sich dies in der chronischen Phase nach einem Schlaganfall darstellt. Während bisherige Ergebnisse der Akutphase dafür sprechen, dass sich mit zunehmender Schwere eines Schlaganfalls Schlafveränderungen ausgeprägter darstellen, scheint es in der chronischen Phase keine Korrelation zwischen der Schwere eines Schlaganfalls gemessen am Volumen des ischämischen Areals und auffälligen Schlafparametern zu geben (Vock et al., 2002). Besonders in der Verknüpfung von bestehenden Einschränkungen im Alltag mit Schlafparametern finden sich bisher keine Studien. Um eventuellen Zusammenhängen auf die Spur zu kommen, wird eine explorative Korrelation dieser Daten Teil der Arbeit sein. Inwiefern sich gemessene Auffälligkeiten des Nachtschlafs im subjektiven Empfinden niederschlagen, ist bisher umstritten. Bakken et al. (2011) fanden in der Akutphase eine Übereinstimmung zwischen den durch Aktigraphie erfassten Daten zu Gesamtschlafzeit und der wachgelegenen Zeit in der Nacht mit den Angaben im Pittsburgher Schlafqualitätsindex. Drei Jahre später fanden sie bei anderen Patienten in der chronischen Phase nach einem Schlaganfall eine positive Korrelation zwischen der subjektiven Schlafdauer und Schlafunterbrechung zu den mittels Aktigraphie gemessenen Schlafdaten (Bakken et al., 2014). Die bereits erwähnte Studie von Vock et al. (2002) fand auch in der chronischen Phase nach einem Schlaganfall keine Übereinstimmungen zwischen subjektiven angegebenen Beschwerden über den Schlaf und der im Polysomnogramm erfassten Schlafstruktur. Durch den Einsatz von subjektiven Untersuchungsinstrumenten und dem Vergleich mit den polysomnographischen Daten soll nun auch die vorliegende Studie zu diesem Thema Erkenntnisse liefern
18 2. Einleitung Unsere Studie ist nun die erste, die rechtshemisphärische Schlaganfälle in der chronischen Phase eines Schlaganfalls untersucht und somit die bisherigen Forschungsergebnisse auf diese Gruppe von Patienten präzisiert. Die drei bisherigen Studien schließen sowohl links- als auch rechtshemisphärische und teilweise bilaterale Schlaganfälle ein. Weiterhin sind die Patienten, die an der vorliegenden Studie teilgenommen haben, in einem deutlich späteren Zeitfenster des chronischen Abschnitts nach einem Schlaganfall. Während in den bisherigen Studien Patienten ab sechs Monaten nach einem Schlaganfall eingeschlossen wurden, liegt der Schlaganfall bei den Patienten aus der vorliegenden Studie mindestens ein Jahr zurück, durchschnittlich lag er sogar mehr als zwei Jahre zurück. Dementsprechend sicher kann davon ausgegangen werden, dass stationäre und ambulante Rehabilitationsmaßnahmen beendet wurden und sich der Patient mit oder ohne verbliebene Einschränkungen im Alltag eingerichtet hat. Somit können Daten zu diesem spät gewählten Zeitpunkt Erkenntnisse darüber liefern, inwiefern der Schlaf langfristig nach einem Schlaganfall beeinträchtigt ist. Die genannten Themen wurden in folgenden Studienhypothesen zusammengefasst
19 2. Einleitung 2.4 Studienhypothesen 1.) Patienten in der chronischen Phase nach Schlaganfall zeigen im Vergleich zu Kontrollpersonen einen gestörten Nachtschlaf gemessen anhand polysomnographischer Parameter der Schlafkontinuität und -architektur. 2.) Die subjektive Schwere des Schlaganfalls operationalisiert anhand der in der Stroke Impact Scale angegebenen Einschränkungen korreliert explorativ betrachtet positiv mit polysomnographisch erfassten Schlafparametern. 3.) Die polysomnographisch erfassten auffälligen Schlafparameter korrelieren mit der im Schlaftagebuch und Schlaffragebogen A gemessenen subjektiven Bewertung der Nacht bei den Schlaganfallpatienten
20 3. Methodenteil 3. Methodenteil 3.1 Stichprobe Eingeschlossen wurden 19 Patienten mit zurückliegendem Schlaganfall und 21 gesunde Probanden. Die Gruppen waren nach Alter, Geschlecht, BMI und Anzahl der Schuljahre abgeglichen. Tabelle 1: Stichprobenbeschreibung. Mittelwerte ± SD, ANOVA mit Faktor Gruppe. Patienten (n=19) Probanden (n=21) F/X 2 p ηp 2 Geschlecht m/w 13/6 14/ Alter 63.5± ± BMI 26.9± ± Anzahl Schuljahre 10.1± ± PSQI 6.9± ± BDI 5.8± ± Die Ergebnisse des Pittsburgher Schlafqualitätsindexes (PSQI) zeigten für die Gruppe der Probanden einen normalen Schlaf und ergaben für die Gruppe der Schlaganfallpatienten einen leicht schlechteren Schlaf. Das Beck-Depressions- Inventar (BDI) ergab für keine der beiden Gruppen Hinweise auf das Vorliegen einer Depression. Die klinischen Charakteristika der Schlaganfallpatienten sind in Tabelle 2 aufgeführt. Bei allen Patienten lag der Schlaganfall zum Zeitpunkt der Studie mindestens 12 Monate zurück. Bei zwei erfolgten Schlaganfällen wurde jeweils der Abstand zum jüngeren beachtet. Die Beeinträchtigungen im Gebrauch der betroffenen Extremität nach dem Schlaganfall wurden mit Hilfe des Motor Activity Log-Fragebogens (MAL) ermittelt und ergaben eine im Durchschnitt mäßige Einschränkung
21 3. Methodenteil Die Ergebnisse des Stroke Impact Scales (SIS) entsprachen den Ergebnissen des MAL mit einer verbliebenen mäßigen Beeinträchtigung der betroffenen Extremität. Besonders in den Bereichen Gedächtnis, Gefühlsregulation und der sozialen Teilhabe empfanden die Patienten eine Beeinträchtigung. Tabelle 2: Charakteristika der Patienten mit Schlaganfall (n=19) Mittelwert SD Range (Min/Max) Schlaganfallsereignisse Anzahl Monate seit erstem Schlaganfall / /108 MAL Funktion /60 MAL Häufigkeit /60 SIS Kraft /100.0 SIS Gedächtnis /85.7 SIS Gefühle /100.0 SIS Kommunikation /100.0 SIS Aktivitäten des täglichen Lebens /100.0 SIS Mobilität /100.0 SIS Handfunktion /100.0 SIS soziale Teilhabe /100.0 SIS /100 allgemeine Erholung (global recovery score)
22 3. Methodenteil Ein- und Ausschlusskriterien Tabelle 3: Ein- und Ausschlusskriterien Einschlusskriterien Ausschlusskriterien allgemein 49 Jahre Psychiatrische oder andere neurologische Diagnose mit Ausnahme von Epilepsie Selbstständigkeit im Alltag Fähigkeit zur selbstständigen Körperpflege Epileptischer Anfall sechs Monate vor Studienteilnahme Mobilität ohne Rollstuhl Ausreichendes Sprachverständnis und -vermögen Schichtarbeit oder Auslandsreise mit Zeitverschiebung >2 Stunden vier Wochen vor Studienteilnahme Konsum illegaler Drogen oder schlafbeeinflussender Medikation zwei Wochen vor Studienteilnahme Alkoholabusus (aktuell&zurückliegend) Hemineglect Zusätzliche Kriterien bei Schlaganfallpatienten Unilateraler rechtshemisphärischer Schlaganfall vor 12 Monaten
23 3. Methodenteil Chronische oder remittierte linksseitige Hemiparese mit einem maximalen Paresegrad von 3 (auch Komplettremission) Rekrutierung und ethische Aspekte Mit Hilfe einer von der Klinik für Neurologie des Freiburger Universitätsklinikums zur Verfügung gestellten Datenbank wurden Schlaganfallpatienten kontaktiert, die während ihres stationären Aufenthalts in eine Kontaktaufnahme zu Studienzwecken eingewilligt hatten. Soweit es aus den Daten ersichtlich war, wurden bereits in diesem Schritt diejenigen ausgeschlossen, die nicht die gewünschten Kriterien erfüllten. Gesunde Probanden wurden über Inserate auf dem Blauen Brett, einer Internetseite für Mitarbeiter des Uniklinikums Freiburg sowie über Aushänge und durch direkte Ansprache geeigneter Teilnehmer gewonnen. Die 2285 angegebenen Kontakte in der Datenbank wurden auf die gewünschte Schlaganfalllokalisation (rechte Hemisphäre) durchgesehen. Aus dieser Gruppe eigneten sich 432 Patienten, die alle per Post eine Einladung zur Studienteilnahme sowie Informationen zur Studie zugeschickt bekamen. Nach Rückmeldung und Durchführung von Telefoninterviews wurden 26 Schlaganfallpatienten zu einer Voruntersuchung eingeladen. Davon mussten nach der Voruntersuchung wegen mangelnder Übereinstimmung mit den Ein-/Ausschlusskriterien vier ausgeschlossen werden und während oder im Anschluss an die Messphase nochmals drei (ein Patient mit linkshemisphärischem Schlaganfall, zwei Patienten, die die Studie nach der ersten Untersuchungsnacht abgebrochen haben). Schlussendlich wurden 19 Schlaganfallpatienten in die Auswertung eingeschlossen. Aus der Gruppe der potentiellen Probanden konnten nach Durchführung eines Telefoninterviews 34 Personen zu einer Voruntersuchung eingeladen werden. Davon erfüllten sechs die erforderlichen Kriterien der Studie nicht und mussten nach diesem Termin ausgeschlossen werden, sieben weitere zogen im Verlauf ihre Einwilligung zur
24 3. Methodenteil Studienteilnahme zurück. Mit 21 Kontrollpersonen konnten die Messungen abgeschlossen werden. Die Studie wurde durch die Ethikkommission des Universitätsklinikums Freiburg bewilligt (Antragsnummer 210/12) und von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg finanziert. Die Studienteilnehmer wurden vor der Studie detailliert über den Verlauf der Studie und ihre Rechte aufgeklärt und willigten schriftlich in die Teilnahme ein. Die Anforderungen an den Datenschutz wurden eingehalten. 3.2 Untersuchungsdesign Das Projekt wurde als nicht-randomisierte Vergleichsstudie konzipiert
25 3. Methodenteil 3.3 Untersuchungsablauf Folgende Abbildung gibt einen Überblick über den Studienablauf. Rekrutierung Telefoninterview Voruntersuchung Vorphase 1 Woche Aktigraphie (Bewegungsuhr) Schlaftagebuch Adaptationsnacht Motorische Aufgabe Fragebögen (PSQI, Edinburgh Händigkeitsinventar) Polysomnographie Am nächsten Morgen: Schlaffragebogen A Untersuchungsnacht Motorische Aufgabe Fragebögen (SIS-, MAL-Fragebogen) Polysomnographie Am nächsten Morgen: Schlaffragebogen A Tagesmessungen MSLT Konzentrationsaufgabe (TAP) Fragebogen (KSS) und Test zu Schläfrigkeit (KDT) Abbildung 2: Übersicht über die verschiedenen Phasen der Studie. Die Rekrutierungsphase beinhaltete ein Screening auf die Ein-/Ausschlusskriterien mittels eines Telefoninterviews und eines Untersuchungstermins. In der Woche vor der ersten Messnacht (Adaptationsnacht) führte jeder Studienteilnehmer ein Schlaftagebuch und trug eine Bewegungsuhr (Vorphase). Am Abend der Adaptationsnacht wurden von jedem Studienteilnehmer der Pittsburgher Schlafqualitätsindex (PSQI) und das Edinburgh Händigkeitsinventar ausgefüllt. Der Verlauf der Nacht wurde polysomnographisch erfasst. Die zweite Messnacht
26 3. Methodenteil (Untersuchungsnacht) verlief identisch zu der Adaptationsnacht. Nach dem Aufstehen am Morgen wurde sowohl nach der Adaptationsnacht, als auch nach der Untersuchungsnacht der Schlaffragebogen A ausgefüllt. Der abschließende Messtag umfasste den Multiplen Schlaf Latenz Test, der um 9,11,13,15,17 Uhr durchgeführt wurde, wobei sich an die 9,11,13,15 Uhr-Messzeiten jeweils der Karolinska Sleepiness Scale (KSS) sowie der Karolinska Drowsiness Test (KDT) und eine Konzentrationsaufgabe anschloss. Die Arbeit wird sich im Folgenden auf die Zeitspanne bis zum Abschluss der Untersuchungsnacht konzentrieren. Mit den Ergebnissen der Tagesmessungen und den Ergebnissen der Aktigraphie hat sich eine weitere Arbeit zum Thema Tagesmüdigkeit und Tagesschläfrigkeit bei Personen mit chronischer Hemiparese nach Schlaganfall befasst. 3.4 Ablauf des Screeningverfahrens Das Screening auf Ein- und Ausschlusskriterien erfolgte in zwei Phasen, zunächst mittels eines Telefoninterviews und daran im Anschluss durch eine Voruntersuchung. Telefonscreening In einem ca. 15 minütigen Gespräch wurden die formulierten Ein- und Ausschlusskriterien überprüft. Bei vollständigem Erfüllen der gewünschten Kriterien wurde der Teilnehmer zur persönlichen Vorstellung im Schlaflabor eingeladen. Voruntersuchung Schwerpunkt der eineinhalb- bis zweistündigen Voruntersuchung war neben der sorgfältigen körperlichen Untersuchung die weitergehende Überprüfung der Einschlusskriterien und die detailliertere Charakterisierung der Stichprobe mittels diverser Fragebögen. So wurde der Beck-Depressions-Inventar (BDI) und der Pittsburgher Schlafqualitätsindex (PSQI) von jedem Teilnehmer bearbeitet. Zusätzlich wurden relevante medizinische Informationen anhand vorgefertigter Standardfragebögen abgefragt. Diese beinhalteten das Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) und Fragebögen zur medizinischen Anamnese
27 3. Methodenteil Die körperliche Untersuchung wurde von erfahrenen Studienmitarbeitern durchgeführt. Gemessen und begutachtet wurden dabei: Blutdruck und Puls Herz und Lunge (Auskultation) Funktionstestung der 12 Hirnnerven Reflexkontrolle der Muskeleigenreflexe Tonuskontrolle bzw. Überprüfung des Paresegrads (0-5) und der Sensibilität Beurteilung des Zehen-/Hackengangs und des Gangbildes Beurteilung der Diadochokinese Alle Ergebnisse wurden in einem standardisierten Untersuchungsbogen festgehalten. 3.5 Ablauf der Testung Die Testung begann für jeden Studienteilnehmer eine Woche vor der ersten Messnacht mit dem Führen eines Schlaftagebuches und dem Tragen einer Bewegungsuhr. Daran schlossen sich die erste (Adaptationsnacht) und die zweite Messnacht im Schlaflabor (Untersuchungsnacht) an. Vorphase Eine Woche vor dem geplanten Termin zu den Schlafuntersuchungen wurden an jeden Studienteilnehmer (Schlaganfallpatienten sowie Kontrollpersonen) ein Schlaftagebuch sowie eine Bewegungsuhr verschickt, so dass das Schlafverhalten über sieben Tage erfasst werden konnte. Ergänzt wurden die Aussagen der Selbsteinschätzung durch eine parallel dazu durchgeführte Aktigraphie. Tabelle 5 beschreibt den Zeitplan der beiden Untersuchungsnächte. Der Vollständigkeit halber wird hierbei die motorische Aufgabe erwähnt. Jedoch sind deren Ergebnisse nicht Bestandteil dieser Arbeit, sondern einer weiteren zum Thema
28 3. Methodenteil Tagesmüdigkeit und Tagesschläfrigkeit bei Personen mit chronischer Hemiparese nach Schlaganfall. Um eine Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten, wurde an beiden Tagen zu ähnlichen Uhrzeiten begonnen und ein Studienteilnehmer von derselben Testleiterin betreut. Tabelle 4: Zeitplan der beiden Messnächte Uhrzeit Programm Adaptationsnacht Untersuchungsnacht 17:00 Uhr Ankunft der Studienteilnehmer 17:15-17:45 Motorische Uhr Aufgabe 17:50-18:30 Fragebögen PSQI- Bei Schlaganfall- Uhr Fragebogen, patienten: Edinburgh- Händigkeitsinventar MAL-Score, SIS- Fragebogen 18:30-19:30 Abendessen Uhr 20:00-21:15 Anbringen der Uhr Elektroden 21:30-23:30 Licht aus Uhr (Beginn der Polysomnographie) 06:00-08:00 Licht an Schlaffrage- Schlaffrage- Uhr bogen A bogen A Wann immer möglich wurden jeweils zwei Studienteilnehmer parallel gemessen. Dabei durchlief Studienteilnehmer 1 das in der Tabelle dargestellte Programm, wohingegen
29 3. Methodenteil Studienteilnehmer 2 nach seiner Ankunft zunächst die Fragebögen ausfüllte und anschließend erst als dritten Punkt die motorische Aufgabe bewältigte. Abendessen und Anbringen der Elektroden erfolgten parallel. Der Zeitpunkt Licht aus orientierte sich am individuell gewohnten Zeitrhythmus des Studienteilnehmeren und lag zwischen 21:30 und 23:30. Kurz zuvor wurden jeweils eine Bioeichung und eine Kontrolle der Signale durchgeführt. Der Schlaffragebogen A wurde für den nächsten Morgen bereitgelegt und nach dem Aufstehen von jedem Studienteilnehmer ausgefüllt. Adaptationsnacht Die erste Nacht wurde als Adaptationsnacht in den Studienablauf aufgenommen und trägt dem first-night-effect Rechnung. Darunter versteht man Schlafstörungen, die im Rahmen der ersten Nacht in einer ungewohnten Umgebung auftreten. Diese Veränderungen sind Ausdruck einer Anpassungsreaktion und spiegeln nicht den Schlaf in der gewohnten Umgebung wieder. Deshalb ist eine zweite Nacht notwendig, in der der Anpassungsprozess soweit fortgeschritten ist, dass eine Übertragung der Schlafdaten in den Alltag und damit der Ausschluss oder die Feststellung einer Pathologie möglich wird (Agnew et al., 1966). In der vorliegenden Studie wurde die Adaptationsnacht dazu verwendet, Hinweise auf eventuell bestehende Schlaferkrankungen zu geben. Im Rahmen der polysomnographischen Untersuchung wurde dabei Folgendes erfasst: Elektroenzephalogramm (EEG) mit folgenden Messpunkten: A1, A2, C3, C4, Fz, Oz Elektrookulographie (EOG) Elektromyogramm (EMG) (Kinn- und Beinmuskulatur) Atmungsparameter mittels Nasensonde und Brust-/Bauchgurt Elektrokardiographie (EKG) Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung mittels Pulsoxymeter
30 3. Methodenteil Untersuchungsnacht: Da die zweite Messnacht die eigentliche Untersuchungsnacht darstellte, wurde durch eine aufwändigere EEG-Ableitung eine umfangreichere Erfassung der Hirnströme sichergestellt. Atembewegungen, Beinbewegungen und Sauerstoffsättigung wurden nicht mehr erfasst. Der zeitliche Ablauf war dem der Adaptationsnacht ähnlich. Die Ankunftszeit der Studienteilnehmer lag jedoch meist eine Stunde später zwischen 18 und 19 Uhr. Begonnen wurde wieder mit der motorischen Aufgabe, an die sich bei den Schlaganfallpatienten die Austeilung der Fragebögen Stroke Impact Scale und Motor Activity Log anschloss. Nach dem Abendessen folgte das Anbringen der Elektroden. Die Polysomnographie umfasste das Elektroenzephalogramm (EEG) mit den Messpunkten A1, A2, Fp1, Fp2, F3, F4, T3, T4, C3, C4, P3, Pz, P4. Außerdem eine Elektrookulographie (EOG), ein Elektromyogramm (EMG) (Kinnmuskulatur) und ein Elektrokardiogramm (EKG). 3.6 Untersuchungsinstrumente Aktigraphie Die Aktigraphie, das Messen von Bewegungen im Laufe eines Tages, stellt ein verlässliches Messinstrument zur Erfassung von Schlaf-Wach-Rhythmen dar (Sadeh et al., 1995). Indem pro Minute die Bewegungen des Trägers registriert und abgespeichert werden entsteht eine lineare Kurve, die dem Schlaf-Wach-Rhythmus und Aktivitätsprofil des Trägers entspricht. Das Aktometer (Bewegungsmesser) wird sowohl tagsüber als auch nachts am rechten Handgelenk getragen und nur vor dem Duschen oder Baden abgenommen. Beck-Depressions-Inventar Das Beck-Depressions-Inventar (BDI) (Beck et. al, 1961) ermöglicht es, anhand von 21 Fragen die subjektive Schwere von einer aktuellen depressiven Symptomatik einzuschätzen und diese in eine leichte, mittelschwere und schwere Symptomatik einzuteilen. Dabei beziehen sich die Antworten auf den Zeitraum der zurückliegenden
31 3. Methodenteil Woche. Gefragt werden nach für eine Depression typischen Stimmungs- und Lebensveränderungen, wie z.b. nach einem Gefühl von Traurigkeit oder Versagen, rascher Ermüdbarkeit im Alltag und ungewolltem Gewichtverlust. Aus jedem Frageblock wird die zutreffendste Antwortmöglichkeit ausgewählt, für die zwischen 0-3 Punkten vergeben werden. Somit können als Gesamtergebnis Werte von 0 bis 63 Punkten erreicht werden. Ab 14 Punkten geht man von dem Vorliegen einer Depression (milde Form bis 19 Punkten) aus. Edinburgh Händigkeitsinventar Das Edinburgh Händigkeitsinventar (Oldfield, 1971) ist ein einfaches Instrument zur Feststellung der Händigkeit einer Person. Die Testperson gibt für 10 Aktivitäten die Hand an, mit der diese eher ausgeführt werden. Dabei können pro Spalte je nach Stärke der Seitenpräferenz rechts/links maximal zwei Kreuze ( + ) gesetzt werden. Ist sich der Studienteilnehmer unsicher über die Seite oder benutzt er beide Hände für eine Aktion gleichwertig, so soll in jede Spalte für rechts bzw. links jeweils ein Kreuz gesetzt werden. Ergänzt werden diese Aufgaben durch die Frage nach der Seitenpräferenz beim Einsatz des Fußes ( Mit welchem Fuß treten Sie bevorzugt einen Gegenstand? ) und beim einäugigen Sehen ( Welches Auge benutzen Sie, wenn Sie nur eines benutzen? ). Durch die Summe der Kreuze in den Spalten kann die Rechts-/Linkshändigkeit eines Menschen festgestellt werden und diese in ihrer Ausprägung als Lateralitätsquotient objektiviert werden. Pittsburgher Schlafqualitätsindex Um die subjektive Schlafqualität vergleichen zu können, wurde der Pittsburgher Schlafqualitätsindex (PSQI) (Buysse et al., 1989) eingesetzt. Zu den Kategorien subjektive Schlafqualität, übliche Schlaflatenz und Schlafdauer, geschätzte Schlafeffizienz, erkennbare Störfaktoren des Schlafes, gewöhnlicher Einsatz von Schlafmedikamenten sowie Schläfrigkeit und Motivationslosigkeit am Tag werden insgesamt 19 Fragen beantwortet. Pro Komponente können zwischen 0 ( keine
32 3. Methodenteil Probleme ) und maximal drei Punkten ( sehr schlechter Schlaf ) vergeben werden. Im Fragebogen enthalten sind fünf zusätzliche Fragen, die von einem Partner/Mitbewohner, der im selben Zimmer schläft, beantwortet werde können. In die Auswertung fließen jedoch lediglich die ersten 19 Fragen ein, die von der Testperson selbst beantwortet werden. Ergibt das Gesamtergebnis einen Wert >5 so kann mit einer Sensitivität von 89.6% und einer Spezifität von 86.5% auf einen schlechten Schlaf des Studienteilnehmers geschlossen werden. Mini International Neuropsychiatric Interview Das Mini International Neuropsychiatric Interview (Sheehan et al. 1998) wird eingesetzt, um vorliegende psychische Pathologien erkennen und diagnostizieren zu können. Der Fragebogen umfasst 16 Module, durch die die Krankheitsbilder/- symptome Depression, Dysthymie, Suizidalität, Manie, Panikstörungen, Phobien (Agoraphobie, Soziale Phobie), Angststörungen, Zwangsstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, Störungen des Essverhaltens, generalisierte Angststörungen und Psychosen erfasst werden. Der Diagnose wird sich zunächst über jeweils eine bis drei Eröffnungsfragen genähert. Bei Auffälligkeiten der Antworten, schließen sich daran mehrere standardisierte Fragen an, durch die die Hinweise auf Vorliegen einer Pathologie weiter bestätigt oder verworfen werden können. Motor Activity Log Der Motor Activity Log (Taub et al., 1993) ist ein Fragebogen, der eine Aussage über den Gebrauch und die Funktion einer paretischen Extremität im Alltag des Patienten machen soll. Anhand von 12 Alltagsaktivitäten wird die Häufigkeit im Gebrauch der betroffenen Seite auf einer Skala von 0 (niemals) bis 5 (genauso häufig wie vor dem Schlaganfall) angegeben, wobei auch die Vergabe von halben Punkten möglich ist. Auch die zweite Skala, mithilfe der die Funktionstüchtigkeit eingeschätzt wird, geht in 0,5-er Schritten von 0 (untauglich) bis 5 (keine eingeschränkte Funktion) Punkten. Am Ende wird eine Gesamtpunktzahl für den Gebrauch und die Funktion ermittelt, anhand derer man die Auswirkungen der Parese für den Patienten einschätzen kann. In beiden
Diagnostik und Therapie von Schlafstörungen Dr. Robert Göder Schlaflabor Kiel
 Diagnostik und Therapie von Schlafstörungen Dr. Robert Göder Schlaflabor Kiel Was ist Schlaf? Ein veränderter Zustand unseres Bewußtseins Ein Zustand mit hoher Abschirmung von der Außenwelt Ein Zustand,
Diagnostik und Therapie von Schlafstörungen Dr. Robert Göder Schlaflabor Kiel Was ist Schlaf? Ein veränderter Zustand unseres Bewußtseins Ein Zustand mit hoher Abschirmung von der Außenwelt Ein Zustand,
1 99 % Häufigkeit und Einteilung der Schlafstörungen. Häufigkeit von Schlafstörungen
 Häufigkeit und Einteilung der Schlafstörungen Patientenkongress Berlin, 16. 6. 2007 Peter Geisler Schlafmedizinisches Zentrum Psychiatrische Universitätsklinik am Bezirksklinikum Regensburg Häufigkeit
Häufigkeit und Einteilung der Schlafstörungen Patientenkongress Berlin, 16. 6. 2007 Peter Geisler Schlafmedizinisches Zentrum Psychiatrische Universitätsklinik am Bezirksklinikum Regensburg Häufigkeit
Schlaf im Alter. Hans-Peter Landolt Institut für Pharmakologie und Toxikologie Universität Zürich. Sleep & Health KFSP
 Schlaf im Alter Hans-Peter Landolt Institut für Pharmakologie und Toxikologie Universität Zürich Ein gesunder Schlaf ist wichtig! Seite 2 Heutiges Programm Funktionen des Schlafs Schlaf-Wachregulation
Schlaf im Alter Hans-Peter Landolt Institut für Pharmakologie und Toxikologie Universität Zürich Ein gesunder Schlaf ist wichtig! Seite 2 Heutiges Programm Funktionen des Schlafs Schlaf-Wachregulation
L-Dopa und Dopaminagonisten: Einfluss auf Schlaf und Vigilanz
 Klinik für Neurologie Parkinson und Schlaf L-Dopa und Dopaminagonisten: Einfluss auf Schlaf und Vigilanz Dr. med. Manuel Bertschi, Oberarzt Informationstagung Parkinson Schweiz, 20.10.2016, Basel Inhalt
Klinik für Neurologie Parkinson und Schlaf L-Dopa und Dopaminagonisten: Einfluss auf Schlaf und Vigilanz Dr. med. Manuel Bertschi, Oberarzt Informationstagung Parkinson Schweiz, 20.10.2016, Basel Inhalt
Leiter des Ambulanten Schlafzentrums Osnabrück.
 ...Liebling, schnarch woanders! Symposium Verkehrssicherheit 22.2.2013 Dr.med. Christoph Schenk Facharzt für Neurologie/Psychiatrie/Psychotherapie Schlafmedizin/Verkehrsmedizin Leiter des Ambulanten Schlafzentrums
...Liebling, schnarch woanders! Symposium Verkehrssicherheit 22.2.2013 Dr.med. Christoph Schenk Facharzt für Neurologie/Psychiatrie/Psychotherapie Schlafmedizin/Verkehrsmedizin Leiter des Ambulanten Schlafzentrums
Anamnesebogen Schlaflabor Schulkinder / Jugendliche
 Anamnesebogen Schlaflabor Schulkinder / Jugendliche Name, Vorname des Kindes: Geburtsdatum: Adresse: Telefon (privat/handy): Gewicht : kg Kinderarzt: Körperlänge : cm Liebe Eltern, bei Ihrem Kind soll
Anamnesebogen Schlaflabor Schulkinder / Jugendliche Name, Vorname des Kindes: Geburtsdatum: Adresse: Telefon (privat/handy): Gewicht : kg Kinderarzt: Körperlänge : cm Liebe Eltern, bei Ihrem Kind soll
Schlafstörungen und Tagesschläfrigkeit Univ.Prof. Dr. Bernd Saletu
 Schlafstörungen und Tagesschläfrigkeit Univ.Prof. Dr. Bernd Saletu Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Wien Institut für Schlafmedizin, Rudolfinerhaus, Wien Klassifikation von Schlafstörungen
Schlafstörungen und Tagesschläfrigkeit Univ.Prof. Dr. Bernd Saletu Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Wien Institut für Schlafmedizin, Rudolfinerhaus, Wien Klassifikation von Schlafstörungen
Lichttherapie, Schlafrestriktion und mehr.. Wie finde ich zu meinem Schlaf? ICC, Berlin
 Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie Lichttherapie, Schlafrestriktion und mehr.. Wie finde ich zu meinem Schlaf? ICC, Berlin 16.06.2007 Priv.-Doz. Dr. Magdolna Hornyak Oberärztin Schlafmedizinisches
Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie Lichttherapie, Schlafrestriktion und mehr.. Wie finde ich zu meinem Schlaf? ICC, Berlin 16.06.2007 Priv.-Doz. Dr. Magdolna Hornyak Oberärztin Schlafmedizinisches
Schlafstörungen erkennen und bewältigen
 Schlafstörungen erkennen und bewältigen Öffentlicher Vortrag 18. November 2010 Tracey Emin, 2002 Thomas C. Wetter Klinik für Affektive Erkrankungen und Allgemeinpsychiatrie ZH Ost Psychiatrische Universitätsklinik
Schlafstörungen erkennen und bewältigen Öffentlicher Vortrag 18. November 2010 Tracey Emin, 2002 Thomas C. Wetter Klinik für Affektive Erkrankungen und Allgemeinpsychiatrie ZH Ost Psychiatrische Universitätsklinik
Ärzteinitiative für ungestörten Schlaf Rhein Sieg
 Ärzteinitiative für ungestörten Schlaf Rhein Sieg c/o Dr. med. Gerda Noppeney Fachärztin für Innere Medizin Sozial-, Betriebs- und Rehabilitationsmedizin 53840 Troisdorf, Am Waldpark 1 02241 / 7 94 44
Ärzteinitiative für ungestörten Schlaf Rhein Sieg c/o Dr. med. Gerda Noppeney Fachärztin für Innere Medizin Sozial-, Betriebs- und Rehabilitationsmedizin 53840 Troisdorf, Am Waldpark 1 02241 / 7 94 44
Auf der 84. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN), die noch bis zum 1. Oktober in
 Restless-Legs-Syndrom: Ein besseres Leben ist möglich Die Qual der ruhelosen Beine ist eine kaum bekannte Volkskrankheit Wiesbaden (29. September 2011) Bis zu zehn Prozent der Bevölkerung sind von einem
Restless-Legs-Syndrom: Ein besseres Leben ist möglich Die Qual der ruhelosen Beine ist eine kaum bekannte Volkskrankheit Wiesbaden (29. September 2011) Bis zu zehn Prozent der Bevölkerung sind von einem
Modul Psychische Gesundheit (Bella-Studie)
 U. Ravens-Sieberer, N. Wille, S. Bettge, M. Erhart Modul Psychische Gesundheit (Bella-Studie) Korrespondenzadresse: Ulrike Ravens-Sieberer Robert Koch - Institut Seestraße 13353 Berlin bella-studie@rki.de
U. Ravens-Sieberer, N. Wille, S. Bettge, M. Erhart Modul Psychische Gesundheit (Bella-Studie) Korrespondenzadresse: Ulrike Ravens-Sieberer Robert Koch - Institut Seestraße 13353 Berlin bella-studie@rki.de
2
 1 2 3 Auf die Frage, warum Lebewesen schlafen, gibt es bis zum heutige Tage seitens der Schlafforschung noch keine eindeutige Antwort. Schlaf ist für den außenstehenden Betrachter ein Zustand der Ruhe.
1 2 3 Auf die Frage, warum Lebewesen schlafen, gibt es bis zum heutige Tage seitens der Schlafforschung noch keine eindeutige Antwort. Schlaf ist für den außenstehenden Betrachter ein Zustand der Ruhe.
Zweigbibliofhek Medizin
 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) Zweigbibliothek Medizin Diese Dissertation finden Sie original in Printform zur Ausleihe in der Zweigbibliofhek Medizin Nähere
Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) Zweigbibliothek Medizin Diese Dissertation finden Sie original in Printform zur Ausleihe in der Zweigbibliofhek Medizin Nähere
STIMMUNGS- UND SCHLAFREGULATION
 LWL-Universitätsklinik Hamm Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik STIMMUNGS- UND SCHLAFREGULATION Prof. Dr. Tanja Legenbauer Warum Schlaf- und Stimmungsregulation im
LWL-Universitätsklinik Hamm Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik STIMMUNGS- UND SCHLAFREGULATION Prof. Dr. Tanja Legenbauer Warum Schlaf- und Stimmungsregulation im
Schlafstörungen Wie komme ich zu meinem verdienten Ruheschlaf? 25. Februar 2014 Dr. med. Andres Ricardo Schneeberger, Co-Chefarzt 1
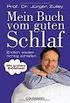 Schlafstörungen Wie komme ich zu meinem verdienten Ruheschlaf? 25. Februar 2014 Schneeberger, Co-Chefarzt 1 KOMPETENT UND GEMEINSAM FÜR LEBENSQUALITÄT Was ist Schlaf? Ein Zustand der äußeren Ruhe bei Menschen
Schlafstörungen Wie komme ich zu meinem verdienten Ruheschlaf? 25. Februar 2014 Schneeberger, Co-Chefarzt 1 KOMPETENT UND GEMEINSAM FÜR LEBENSQUALITÄT Was ist Schlaf? Ein Zustand der äußeren Ruhe bei Menschen
DIE INNERE UHR CIRCADIANE RHYTHMIK
 DIE INNERE UHR CIRCADIANE RHYTHMIK So nennt die Chronobiologie innere Rhythmen, die eine Periodenlänge von circa 24 Stunden haben. Tag = Leistungsbereitschaft Nacht = Erholung und Ruhe ist angeboren EULE
DIE INNERE UHR CIRCADIANE RHYTHMIK So nennt die Chronobiologie innere Rhythmen, die eine Periodenlänge von circa 24 Stunden haben. Tag = Leistungsbereitschaft Nacht = Erholung und Ruhe ist angeboren EULE
Nachgefragt! - Welche Perspektive haben Menschen nach einem schweren Schlaganfall?
 Nachgefragt! - Welche Perspektive haben Menschen nach einem schweren Schlaganfall? Ergebnisse einer Nachbefragung von Patienten ein Jahr nach der Frührehabilitation Die Neurologische Frührehabilitation
Nachgefragt! - Welche Perspektive haben Menschen nach einem schweren Schlaganfall? Ergebnisse einer Nachbefragung von Patienten ein Jahr nach der Frührehabilitation Die Neurologische Frührehabilitation
2 Der Einfluss von Sport und Bewegung auf die neuronale Konnektivität 11
 I Grundlagen 1 1 Neurobiologische Effekte körperlicher Aktivität 3 1.1 Einleitung 3 1.2 Direkte Effekte auf Neurone, Synapsenbildung und Plastizität 4 1.3 Indirekte Effekte durch verbesserte Hirndurchblutung,
I Grundlagen 1 1 Neurobiologische Effekte körperlicher Aktivität 3 1.1 Einleitung 3 1.2 Direkte Effekte auf Neurone, Synapsenbildung und Plastizität 4 1.3 Indirekte Effekte durch verbesserte Hirndurchblutung,
Kein Hinweis für eine andere Ursache der Demenz
 die später nach ihm benannte Krankheit. Inzwischen weiß man, dass die Alzheimer-Krankheit eine sogenannte primär-neurodegenerative Hirnerkrankung ist. Das bedeutet, dass die Erkrankung direkt im Gehirn
die später nach ihm benannte Krankheit. Inzwischen weiß man, dass die Alzheimer-Krankheit eine sogenannte primär-neurodegenerative Hirnerkrankung ist. Das bedeutet, dass die Erkrankung direkt im Gehirn
Kognitive Defizite bei der bipolaren Störung
 Kognitive Defizite bei der bipolaren Störung Einfluss von Schlaf und sub-syndromaler Depression DP Julia Volkert Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie Direktor: Prof.
Kognitive Defizite bei der bipolaren Störung Einfluss von Schlaf und sub-syndromaler Depression DP Julia Volkert Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie Direktor: Prof.
Schlafstörungen und Schmerzen
 Schlafstörungen und Schmerzen Dr. med. Christoph Schenk Arzt für Neurologie und Psychiatrie Arzt für Psychotherapeutische Medizin Schlafmedizin Leitung des Ambulanten Schlaflabor Osnabrück www.schlafmedizin.de
Schlafstörungen und Schmerzen Dr. med. Christoph Schenk Arzt für Neurologie und Psychiatrie Arzt für Psychotherapeutische Medizin Schlafmedizin Leitung des Ambulanten Schlaflabor Osnabrück www.schlafmedizin.de
Einführung in die Schlafmedizin. Workshop Herne 02.05.2003
 Einführung in die Schlafmedizin 1 Workshop Herne 02.05.2003 2 Der Patient mit Schlafapnoe 3 Der Patient mit Restless Legs Syndrom Einführung in die Schlafmedizin 4 Der normale Schlaf Klassifikation der
Einführung in die Schlafmedizin 1 Workshop Herne 02.05.2003 2 Der Patient mit Schlafapnoe 3 Der Patient mit Restless Legs Syndrom Einführung in die Schlafmedizin 4 Der normale Schlaf Klassifikation der
Um sinnvoll über Depressionen sprechen zu können, ist es wichtig, zwischen Beschwerden, Symptomen, Syndromen und nosologische Krankheitseinheiten
 1 Um sinnvoll über Depressionen sprechen zu können, ist es wichtig, zwischen Beschwerden, Symptomen, Syndromen und nosologische Krankheitseinheiten unterscheiden zu können. Beschwerden werden zu depressiven
1 Um sinnvoll über Depressionen sprechen zu können, ist es wichtig, zwischen Beschwerden, Symptomen, Syndromen und nosologische Krankheitseinheiten unterscheiden zu können. Beschwerden werden zu depressiven
5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung
 5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung Einleitung In der Schwangerschaft vollziehen sich Veränderungen des Kohlenhydratstoffwechsels im Sinne einer Insulinresistenz sowie eines Anstieges der Blutfettwerte.
5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung Einleitung In der Schwangerschaft vollziehen sich Veränderungen des Kohlenhydratstoffwechsels im Sinne einer Insulinresistenz sowie eines Anstieges der Blutfettwerte.
Der Schlaganfall wenn jede Minute zählt. Andreas Kampfl Abteilung Neurologie und Stroke Unit Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried im Innkreis
 Der Schlaganfall wenn jede Minute zählt Andreas Kampfl Abteilung Neurologie und Stroke Unit Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried im Innkreis Aufgaben des Großhirns Bewegung Sensibilität Sprachproduktion
Der Schlaganfall wenn jede Minute zählt Andreas Kampfl Abteilung Neurologie und Stroke Unit Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried im Innkreis Aufgaben des Großhirns Bewegung Sensibilität Sprachproduktion
Probandeninformation zur Studie
 Zentrum für Chronobiologie Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel www.chronobiology.ch Probandeninformation zur Studie Jugendliche benutzen Multimedia-Bildschirme, welche den Schlaf tief in die Nacht
Zentrum für Chronobiologie Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel www.chronobiology.ch Probandeninformation zur Studie Jugendliche benutzen Multimedia-Bildschirme, welche den Schlaf tief in die Nacht
Südtiroler Akademie für Allgemeinmedizin. Asthenie: ein häufiges Symptom in der Allgemeinpraxis
 Südtiroler Akademie für Allgemeinmedizin Asthenie: ein häufiges Symptom in der Allgemeinpraxis A. Sönnichsen Diagnostisches Ziel in der Allgemeinmedizin: Überdiagnostik vermeiden keinen mit ernster Erkrankung
Südtiroler Akademie für Allgemeinmedizin Asthenie: ein häufiges Symptom in der Allgemeinpraxis A. Sönnichsen Diagnostisches Ziel in der Allgemeinmedizin: Überdiagnostik vermeiden keinen mit ernster Erkrankung
Schlafstörungen können Hinweise auf neurologische Leiden sein
 ENS 2013 Schlafstörungen können Hinweise auf neurologische Leiden sein Barcelona, Spanien (10. Juni 2013) Schlafstörungen können das erste Anzeichen schwerer neurologischer Erkrankungen sein, betonten
ENS 2013 Schlafstörungen können Hinweise auf neurologische Leiden sein Barcelona, Spanien (10. Juni 2013) Schlafstörungen können das erste Anzeichen schwerer neurologischer Erkrankungen sein, betonten
Tab. 4.1: Altersverteilung der Gesamtstichprobe BASG SASG BAS SAS UDS SCH AVP Mittelwert Median Standardabweichung 44,36 43,00 11,84
 Im weiteren wird gemäß den allgemeinen statistischen Regeln zufolge bei Vorliegen von p=,5 und
Im weiteren wird gemäß den allgemeinen statistischen Regeln zufolge bei Vorliegen von p=,5 und
AXON GmbH Schmalkalden QUISI. Gerät zur automatischen Schlafstadienklassifikation
 AXON GmbH Schmalkalden QUISI Gerät zur automatischen Schlafstadienklassifikation Der Schlafanalysator QUISI Das Einsatzgebiet Schlaflosigkeit ist eines der am weitesten in der Bevölkerung verbreiteten
AXON GmbH Schmalkalden QUISI Gerät zur automatischen Schlafstadienklassifikation Der Schlafanalysator QUISI Das Einsatzgebiet Schlaflosigkeit ist eines der am weitesten in der Bevölkerung verbreiteten
Früh- und Vorbotensymptome der Parkinsonerkrankung
 Früh- und Vorbotensymptome der Parkinsonerkrankung 5. Hiltruper Parkinson-Tag 20. Mai 2015 Referent: Dr. Christoph Aufenberg, Oberarzt der Klinik für Neurologie Herz-Jesu-Krankenhaus Münster-Hiltrup Westfalenstraße
Früh- und Vorbotensymptome der Parkinsonerkrankung 5. Hiltruper Parkinson-Tag 20. Mai 2015 Referent: Dr. Christoph Aufenberg, Oberarzt der Klinik für Neurologie Herz-Jesu-Krankenhaus Münster-Hiltrup Westfalenstraße
Auszug aus der Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Niedersachsen und Richtlinien vom , geändert zum (siehe jeweilige Fußnoten)
 Auszug aus der Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Niedersachsen und Richtlinien vom 01.05.2005, geändert zum 01.02.2012 (siehe jeweilige Fußnoten) (Zusätzliche Weiterbildung in den Gebieten Allgemeinmedizin,
Auszug aus der Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Niedersachsen und Richtlinien vom 01.05.2005, geändert zum 01.02.2012 (siehe jeweilige Fußnoten) (Zusätzliche Weiterbildung in den Gebieten Allgemeinmedizin,
Langzeitverlauf posttraumatischer Belastungsreaktionen bei ehemals politisch Inhaftierten der DDR.
 Langzeitverlauf posttraumatischer Belastungsreaktionen bei ehemals politisch Inhaftierten der DDR. Ergebnisse einer 15-Jahre Follow-Up-Studie Matthias Schützwohl TU Dresden Klinik und Poliklinik für Psychiatrie
Langzeitverlauf posttraumatischer Belastungsreaktionen bei ehemals politisch Inhaftierten der DDR. Ergebnisse einer 15-Jahre Follow-Up-Studie Matthias Schützwohl TU Dresden Klinik und Poliklinik für Psychiatrie
Burnout & Schlaf. Auswirkung und Bedeutung des Schlafes beim Burnout-Syndrom
 Burnout & Schlaf Auswirkung und Bedeutung des Schlafes beim Burnout-Syndrom «BURNOUT-SYNDROM» Mit Burnout wird ein Zustand körperlicher, emotionaler und geistiger Erschöpfung bezeichnet, der über Wochen
Burnout & Schlaf Auswirkung und Bedeutung des Schlafes beim Burnout-Syndrom «BURNOUT-SYNDROM» Mit Burnout wird ein Zustand körperlicher, emotionaler und geistiger Erschöpfung bezeichnet, der über Wochen
Rückbildung von Aphasien und Wirkung von Sprachtherapie
 Rückbildung von Aphasien und Wirkung von Sprachtherapie Medizinische Fakultät Basel 2. Jahreskurs, Major Clinical Medicine Wahlmodul 3 Gehirn und Sprache Dezember 2008 Seraina Locher Medical eduction,
Rückbildung von Aphasien und Wirkung von Sprachtherapie Medizinische Fakultät Basel 2. Jahreskurs, Major Clinical Medicine Wahlmodul 3 Gehirn und Sprache Dezember 2008 Seraina Locher Medical eduction,
Prävalenz und Prädiktoren von schlafbezogenen Atmungsstörungen in der kardiologischen Rehabilitation- Ergebnisse des Reha-Sleep-Register der DGPR
 Prävalenz und Prädiktoren von schlafbezogenen Atmungsstörungen in der kardiologischen Rehabilitation- Ergebnisse des Reha-Sleep-Register der DGPR Dr. med. Wolfram Kamke et al., Burg Die zunehmende Bedeutung
Prävalenz und Prädiktoren von schlafbezogenen Atmungsstörungen in der kardiologischen Rehabilitation- Ergebnisse des Reha-Sleep-Register der DGPR Dr. med. Wolfram Kamke et al., Burg Die zunehmende Bedeutung
Integrative Leistungen des ZNS, kortikale und thalamischer Verschaltung, Elektroenzephalographie (EEG)
 Integrative Leistungen des ZNS, kortikale und thalamischer Verschaltung, Elektroenzephalographie (EEG) Teil 1 Dr. Dr. Marco Weiergräber Sommersemester 2006 1 Übersicht Aufbau des Neokortex Neurophysiologische
Integrative Leistungen des ZNS, kortikale und thalamischer Verschaltung, Elektroenzephalographie (EEG) Teil 1 Dr. Dr. Marco Weiergräber Sommersemester 2006 1 Übersicht Aufbau des Neokortex Neurophysiologische
Das Alter hat nichts Schönes oder doch. Depressionen im Alter Ende oder Anfang?
 Das Alter hat nichts Schönes oder doch Depressionen im Alter Ende oder Anfang? Depressionen im Alter Gedanken zum Alter was bedeutet höheres Alter Depressionen im Alter Häufigkeit Was ist eigentlich eine
Das Alter hat nichts Schönes oder doch Depressionen im Alter Ende oder Anfang? Depressionen im Alter Gedanken zum Alter was bedeutet höheres Alter Depressionen im Alter Häufigkeit Was ist eigentlich eine
Depression und Angst. Komorbidität
 Depression und Angst Komorbidität Geschlechterverteilung der Diagnosen 70 60 50 40 30 W M 20 10 0 Depr. Angst Borderline 11.12.2007 erstellt von: Dr. Walter North 2 Angststörungen Panikstörung mit/ohne
Depression und Angst Komorbidität Geschlechterverteilung der Diagnosen 70 60 50 40 30 W M 20 10 0 Depr. Angst Borderline 11.12.2007 erstellt von: Dr. Walter North 2 Angststörungen Panikstörung mit/ohne
PATIENTENINFORMATION. Caregiver Burden bei betreuenden Angehörigen schwer betroffener Parkinsonpatienten
 Version 1.2 Neurologische Klinik mit Klinischer Neurophysiologie Kommissarischer Direktor: Prof. Dr. med. M. Stangel PD Dr. med. F. Wegner Telefon: (0511) 532-3110 Fax: (0511) 532-3115 Carl-Neuberg-Straße
Version 1.2 Neurologische Klinik mit Klinischer Neurophysiologie Kommissarischer Direktor: Prof. Dr. med. M. Stangel PD Dr. med. F. Wegner Telefon: (0511) 532-3110 Fax: (0511) 532-3115 Carl-Neuberg-Straße
Leben nach erworbener Hirnschädigung
 Leben nach erworbener Hirnschädigung Akutbehandlung und Rehabilitation Prim. Univ. Prof. Dr. Andreas Kampfl Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried Abteilung für f Neurologie mit Stroke Unit Schlaganfall
Leben nach erworbener Hirnschädigung Akutbehandlung und Rehabilitation Prim. Univ. Prof. Dr. Andreas Kampfl Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried Abteilung für f Neurologie mit Stroke Unit Schlaganfall
Was wird aus Versicherten mit abgelehntem Reha-Antrag?
 Rehabilitationswissenschaftliches Seminar Würzburg 2016 Was wird aus Versicherten mit abgelehntem Reha-Antrag? Ruth Deck Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie Universität Lübeck Mögliche Probleme:
Rehabilitationswissenschaftliches Seminar Würzburg 2016 Was wird aus Versicherten mit abgelehntem Reha-Antrag? Ruth Deck Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie Universität Lübeck Mögliche Probleme:
Psychische Störungen bei Hypophysenerkrankungen: Wie erkennen? Wie behandeln? Dr. med. Elisabeth Frieß Max-Planck-Institut für Psychiatrie
 Psychische Störungen bei Hypophysenerkrankungen: Wie erkennen? Wie behandeln? Dr. med. Elisabeth Frieß Max-Planck-Institut für Psychiatrie Wie finde ich heraus, wie es mir psychisch geht? allgemeine Lebensqualität
Psychische Störungen bei Hypophysenerkrankungen: Wie erkennen? Wie behandeln? Dr. med. Elisabeth Frieß Max-Planck-Institut für Psychiatrie Wie finde ich heraus, wie es mir psychisch geht? allgemeine Lebensqualität
Wie erkenne ich eine Schlafstörung? Marie-Luise Hansen Interdiziplinäres Schlaflabor der Charite, Eschenallee 3, 14050 Berlin-Charlottenburg
 Wie erkenne ich eine Schlafstörung? Marie-Luise Hansen Interdiziplinäres Schlaflabor der Charite, Eschenallee 3, 14050 Berlin-Charlottenburg Zu wenig Schlaf: Insomnien Insomnien sind durch eine Diskrepanz
Wie erkenne ich eine Schlafstörung? Marie-Luise Hansen Interdiziplinäres Schlaflabor der Charite, Eschenallee 3, 14050 Berlin-Charlottenburg Zu wenig Schlaf: Insomnien Insomnien sind durch eine Diskrepanz
Psychische Störungen Einführung. PD Dr. Peter Schönknecht Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Universitätsklinikum Leipzig
 Psychische Störungen Einführung PD Dr. Peter Schönknecht Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Universitätsklinikum Leipzig Psychopathologische Symptome Psychopathologische Symptome
Psychische Störungen Einführung PD Dr. Peter Schönknecht Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Universitätsklinikum Leipzig Psychopathologische Symptome Psychopathologische Symptome
Vom unklaren Symptomkomplex zur ganzheitlichen Diagnose
 Morbus Fabry - Niereninsuffizienz Kardiomyopathie Neurologische Störungen - Vom unklaren Sympto Morbus Fabry Niereninsuffizienz Kardiomyopathie Neurologische Störungen Vom unklaren Symptomkomplex zur ganzheitlichen
Morbus Fabry - Niereninsuffizienz Kardiomyopathie Neurologische Störungen - Vom unklaren Sympto Morbus Fabry Niereninsuffizienz Kardiomyopathie Neurologische Störungen Vom unklaren Symptomkomplex zur ganzheitlichen
Der Meßplatz wurde speziell für diesen Zweck entwickelt und es findet sich keine direkt vergleichbare Meßeinrichtung.
 für Impuls, Maximalkraft, Gesamt-IEMG und IEMG-Kraft-Quotient deutlich höher und der Wert der elektrischen Effizienz niedriger. Dieses Ergebnis zeigte sich auch bei der Nachuntersuchung. 4. Diskussion
für Impuls, Maximalkraft, Gesamt-IEMG und IEMG-Kraft-Quotient deutlich höher und der Wert der elektrischen Effizienz niedriger. Dieses Ergebnis zeigte sich auch bei der Nachuntersuchung. 4. Diskussion
Eine Analyse des Münchner Schlaganfallregisters: Diagnostik und Therapie bei Patienten mit Diabetes mellitus"
 Aus der Forschergruppe Diabetes e.v. am Helmholtz Zentrum München Vorstand: Professor Dr. med. Oliver Schnell Eine Analyse des Münchner Schlaganfallregisters: Diagnostik und Therapie bei Patienten mit
Aus der Forschergruppe Diabetes e.v. am Helmholtz Zentrum München Vorstand: Professor Dr. med. Oliver Schnell Eine Analyse des Münchner Schlaganfallregisters: Diagnostik und Therapie bei Patienten mit
Messung der subjektiven und objektiven Tagesschläfrigkeit. J. Zeitlhofer, Wien
 Messung der subjektiven und objektiven Tagesschläfrigkeit J. Zeitlhofer, Wien Definitionen: Lost in Translation?? Englisch Deutsch attention Aufmerksamkeit vigilance Vigilanz (Vigilanz: selektive, geteilte)
Messung der subjektiven und objektiven Tagesschläfrigkeit J. Zeitlhofer, Wien Definitionen: Lost in Translation?? Englisch Deutsch attention Aufmerksamkeit vigilance Vigilanz (Vigilanz: selektive, geteilte)
Schmerzen und Schlafstörungen bei HMSN: Welche Möglichkeiten der Therapie gibt es?
 Schmerzen und Schlafstörungen bei HMSN: Welche Möglichkeiten der Therapie gibt es? Matthias Boentert Klinik für Neurologie, Sektion Schlafmedizin Universitätsklinikum Münster mb mb Schmerzen Schmerz ist
Schmerzen und Schlafstörungen bei HMSN: Welche Möglichkeiten der Therapie gibt es? Matthias Boentert Klinik für Neurologie, Sektion Schlafmedizin Universitätsklinikum Münster mb mb Schmerzen Schmerz ist
Wenn Unruhe zum Alltag wird: Das Restless Legs Syndrom quält Millionen
 Wenn Unruhe zum Alltag wird: Das Restless Legs Syndrom quält Millionen Als die Symptome schlimmer wurden, war es für mich unmöglich, ein Konzert zu besuchen. Ich war unfähig still zu sitzen. Die Menschen
Wenn Unruhe zum Alltag wird: Das Restless Legs Syndrom quält Millionen Als die Symptome schlimmer wurden, war es für mich unmöglich, ein Konzert zu besuchen. Ich war unfähig still zu sitzen. Die Menschen
Zentrum für Schlafmedizin
 Chefärztin: Dr. med. Sabine Peter Ärztin für Innere Medizin, Pneumologie, Notfallmedizin, Schlafmedizin, Allergologie Terminvereinbarung/Organisation/Ambulanz Anmeldung: Montag bis Freitag 8.00-17.00 Uhr
Chefärztin: Dr. med. Sabine Peter Ärztin für Innere Medizin, Pneumologie, Notfallmedizin, Schlafmedizin, Allergologie Terminvereinbarung/Organisation/Ambulanz Anmeldung: Montag bis Freitag 8.00-17.00 Uhr
Feldstudie im Umkreis des Flughafens Frankfurt Ausführung Dr. med. Y. Aydin Anleitung Prof. Dr. med. M. Kaltenbach
 Danksagung Wir danken dem Institut für Gesundheitsschutz e. V. Offenbach für die Ermöglichung der Studie Allen Probanden für die sorgfältige Protokollierung und die Durchführung der Messungen Feldstudie
Danksagung Wir danken dem Institut für Gesundheitsschutz e. V. Offenbach für die Ermöglichung der Studie Allen Probanden für die sorgfältige Protokollierung und die Durchführung der Messungen Feldstudie
Therapeutisches Drug Monitoring der Antidepressiva Amitriptylin, Clomipramin, Doxepin und Maprotilin unter naturalistischen Bedingungen
 Aus der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der Universität Würzburg Direktor: Professor Dr. med. J. Deckert Therapeutisches Drug Monitoring der Antidepressiva Amitriptylin,
Aus der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der Universität Würzburg Direktor: Professor Dr. med. J. Deckert Therapeutisches Drug Monitoring der Antidepressiva Amitriptylin,
Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der. Philosophischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität. zu Kiel. vorgelegt von.
 Der Ruhe- und Belastungsblutdruck bei 12- bis 17-Jährigen in der Kieler Kinder EX.PRESS. Studie: Zusammenhang mit weiteren Risikofaktoren und Bedeutung für das kardiovaskuläre Risiko Dissertation zur Erlangung
Der Ruhe- und Belastungsblutdruck bei 12- bis 17-Jährigen in der Kieler Kinder EX.PRESS. Studie: Zusammenhang mit weiteren Risikofaktoren und Bedeutung für das kardiovaskuläre Risiko Dissertation zur Erlangung
Voruntersuchungen. Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin
 Voruntersuchungen ASA Klassifikation Grundlagen für apparative, technische Untersuchungen entscheidende Grundlagen zur Indikation jeder präoperativen technischen Untersuchung: - Erhebung einer sorgfältigen
Voruntersuchungen ASA Klassifikation Grundlagen für apparative, technische Untersuchungen entscheidende Grundlagen zur Indikation jeder präoperativen technischen Untersuchung: - Erhebung einer sorgfältigen
Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Bonn. Schlaflabor. optimale Diagnose und Therapie
 DRK Krankenhaus Neuwied Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Bonn Schlaflabor optimale Diagnose und Therapie Tipps für einen gesunden Schlaf: Gehen Sie möglichst zur gleichen Zeit abends ins Bett
DRK Krankenhaus Neuwied Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Bonn Schlaflabor optimale Diagnose und Therapie Tipps für einen gesunden Schlaf: Gehen Sie möglichst zur gleichen Zeit abends ins Bett
BURNOUT UND SCHLAF. AUS DEM GLEICHGEWICHT GERATEN? ÜBERLASTET? ERSCHÖPFT?
 BURNOUT UND SCHLAF www.photocase.com AUS DEM GLEICHGEWICHT GERATEN? ÜBERLASTET? ERSCHÖPFT? «BURNOUT-SYNDROM» Mit Burnout wird ein Zustand körperlicher, emotionaler und geistiger Erschöpfung bezeichnet,
BURNOUT UND SCHLAF www.photocase.com AUS DEM GLEICHGEWICHT GERATEN? ÜBERLASTET? ERSCHÖPFT? «BURNOUT-SYNDROM» Mit Burnout wird ein Zustand körperlicher, emotionaler und geistiger Erschöpfung bezeichnet,
Schlucken / Verdauung und Darm. Aufmerksamkeit / Gedächtnis
 Parkinson-Tagebuch: Untersuchung Ihrer Symptome Um das Parkinson-Tagebuch auszufüllen, folgen Sie bitte den Anweisungen der vorherigen Seite. Schlafstörungen abe Probleme, nachts einzuschlafen abe Probleme,
Parkinson-Tagebuch: Untersuchung Ihrer Symptome Um das Parkinson-Tagebuch auszufüllen, folgen Sie bitte den Anweisungen der vorherigen Seite. Schlafstörungen abe Probleme, nachts einzuschlafen abe Probleme,
Psychometrische Kriterien der deutschsprachigen Version des Cardiff Wound Impact Schedule / CWIS
 Psychometrische Kriterien der deutschsprachigen Version des Cardiff Wound Impact Schedule / CWIS Eva-Maria Panfil 12, Christine Halbig 2, Herbert Mayer 3 1 Institut für Angewandte Pflegewissenschaft IPW-FHS,
Psychometrische Kriterien der deutschsprachigen Version des Cardiff Wound Impact Schedule / CWIS Eva-Maria Panfil 12, Christine Halbig 2, Herbert Mayer 3 1 Institut für Angewandte Pflegewissenschaft IPW-FHS,
Arbeitsausfälle und Einschränkungen durch psychische Erkrankungen
 Arbeitsausfälle und Einschränkungen durch psychische Erkrankungen Hauptversammlung swisscross 9. Juni 2011 Altstätten Dr. med. Arno Bindl Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FA Vertrauensarzt SGV
Arbeitsausfälle und Einschränkungen durch psychische Erkrankungen Hauptversammlung swisscross 9. Juni 2011 Altstätten Dr. med. Arno Bindl Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FA Vertrauensarzt SGV
Vereinbarung zur Umsetzung einer Screening-Maßnahme. nach 7 Abs. 2 der Anlage 4 des Hausarztvertrages. 2. PAVK-Screening (01.01.2012-30.06.
 Vereinbarung zur Umsetzung einer Screening-Maßnahme nach 7 Abs. 2 der Anlage 4 des Hausarztvertrages 2. PAVK-Screening (01.01.2012-30.06.2012) zwischen der AOK Sachsen-Anhalt (AOK) und dem Hausärzteverband
Vereinbarung zur Umsetzung einer Screening-Maßnahme nach 7 Abs. 2 der Anlage 4 des Hausarztvertrages 2. PAVK-Screening (01.01.2012-30.06.2012) zwischen der AOK Sachsen-Anhalt (AOK) und dem Hausärzteverband
Der normale Wahnsinn in unserem interdisziplinären Schlafzentrum
 Der normale Wahnsinn in unserem interdisziplinären Schlafzentrum Schlafmedizin - Qualitätszirkel Ambulantes Schlafzentrum Osnabrück Herr Dr. med. Christoph Schenk Helene Derksen 14.10.2015 Agenda Anamnese
Der normale Wahnsinn in unserem interdisziplinären Schlafzentrum Schlafmedizin - Qualitätszirkel Ambulantes Schlafzentrum Osnabrück Herr Dr. med. Christoph Schenk Helene Derksen 14.10.2015 Agenda Anamnese
Testleiterbefragung. Einleitung. Fragestellung. Methode. Wie viele Schüler/innen zeigten das folgende Verhalten?
 Testleiterbefragung Einleitung "Ruhe bitte!" Vom Pausenhof schallt Geschrei in die Klasse, in der hinteren Reihe tauschen sich mehrere Schülerinnen und Schüler über die Lösung der letzten Frage aus, ein
Testleiterbefragung Einleitung "Ruhe bitte!" Vom Pausenhof schallt Geschrei in die Klasse, in der hinteren Reihe tauschen sich mehrere Schülerinnen und Schüler über die Lösung der letzten Frage aus, ein
In der Vergangenheit gab es keine klaren Kriterien für die
 Der Psychiater und Depressionsforscher Prof. Dr. Hubertus Himmerich erlebt das Leid, das die Krankheit Depression auslöst, tagtäglich als Oberarzt der Depressionsstation unserer Klinik, der Leipziger Universitätsklinik
Der Psychiater und Depressionsforscher Prof. Dr. Hubertus Himmerich erlebt das Leid, das die Krankheit Depression auslöst, tagtäglich als Oberarzt der Depressionsstation unserer Klinik, der Leipziger Universitätsklinik
Der Schlaf ist für den Menschen, wie das Aufziehen für die Uhr ist. Arthur Schopenhauer
 Der Schlaf ist für den Menschen, wie das Aufziehen für die Uhr ist. Arthur Schopenhauer Sollen wir weniger schlafen? Die Deutschen schlafen zu lange. Eine Kuh beispielsweise kommt mit drei bis vier Stunden
Der Schlaf ist für den Menschen, wie das Aufziehen für die Uhr ist. Arthur Schopenhauer Sollen wir weniger schlafen? Die Deutschen schlafen zu lange. Eine Kuh beispielsweise kommt mit drei bis vier Stunden
Vorschulische Sprachstandserhebungen in Berliner Kindertagesstätten: Eine vergleichende Untersuchung
 Spektrum Patholinguistik 7 (2014) 133 138 Vorschulische Sprachstandserhebungen in Berliner Kindertagesstätten: Eine vergleichende Untersuchung Stefanie Düsterhöft, Maria Trüggelmann & Kerstin Richter 1
Spektrum Patholinguistik 7 (2014) 133 138 Vorschulische Sprachstandserhebungen in Berliner Kindertagesstätten: Eine vergleichende Untersuchung Stefanie Düsterhöft, Maria Trüggelmann & Kerstin Richter 1
Neurofeedback --- Train your brain
 Seminar Brain-Machine Interfaces Neurofeedback --- Train your brain 1 18.11.2009 Biofeedback...bezeichnet eine Methode, bei der eine Person die bewusste Selbstkontrolle über bestimmte Funktionen seines
Seminar Brain-Machine Interfaces Neurofeedback --- Train your brain 1 18.11.2009 Biofeedback...bezeichnet eine Methode, bei der eine Person die bewusste Selbstkontrolle über bestimmte Funktionen seines
Die Macht der Nacht: Schlaf und Leistung
 Die Macht der Nacht: Schlaf und Leistung Professor Dr. Jürgen Zulley Universität Regensburg Chronisch zu wenig Schlaf kann krank dumm dick machen Zulley J (2005) Mein Buch vom guten Schlaf. Zabert Sandmann,
Die Macht der Nacht: Schlaf und Leistung Professor Dr. Jürgen Zulley Universität Regensburg Chronisch zu wenig Schlaf kann krank dumm dick machen Zulley J (2005) Mein Buch vom guten Schlaf. Zabert Sandmann,
Narkolepsie Süchtig nach Schlummer
 Narkolepsie Süchtig nach Schlummer 31. WORKSHOP LUNGE UMWELT ARBEITSMEDIZIN OA DR. ANDREAS KAINDLSTORFER LEITUNG SCHLAFLABOR ABTEILUNG FÜR NEUROLOGIE LANDES - NERVENKLINIK WAGNER JAUREGG LINZ Narkolepsie
Narkolepsie Süchtig nach Schlummer 31. WORKSHOP LUNGE UMWELT ARBEITSMEDIZIN OA DR. ANDREAS KAINDLSTORFER LEITUNG SCHLAFLABOR ABTEILUNG FÜR NEUROLOGIE LANDES - NERVENKLINIK WAGNER JAUREGG LINZ Narkolepsie
Titel der Dissertation Interpersonale Beziehungsgestaltung und Depression: Eine kulturvergleichende Untersuchung in Chile und Deutschland
 Inauguraldissertation zur Erlangung des akademischen Doktorgrades (Dr. phil.) im Fach Psychologie an der Fakultät für Verhaltens- und Empirische Kulturwissenschaften der Ruprecht-Karls-U niversität Heidelberg
Inauguraldissertation zur Erlangung des akademischen Doktorgrades (Dr. phil.) im Fach Psychologie an der Fakultät für Verhaltens- und Empirische Kulturwissenschaften der Ruprecht-Karls-U niversität Heidelberg
Analyse diagnostischer Maßnahmen mit GKV-Routinedaten: Zur Richtlinienkonformität der Stufendiagnostik bei vermuteter Schlafapnoe
 Analyse diagnostischer Maßnahmen mit GKV-Routinedaten: Zur Richtlinienkonformität der Stufendiagnostik bei vermuteter Schlafapnoe AGENS Methodenworkshop 13.-14. Februar 2014 Hannover Schneider U, Linder
Analyse diagnostischer Maßnahmen mit GKV-Routinedaten: Zur Richtlinienkonformität der Stufendiagnostik bei vermuteter Schlafapnoe AGENS Methodenworkshop 13.-14. Februar 2014 Hannover Schneider U, Linder
Diagnose Vorhofflimmern. Wie kann man einem Schlaganfall vorbeugen?
 Diagnose Vorhofflimmern Wie kann man einem Schlaganfall vorbeugen? Liebe Leserin, lieber Leser Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung. Generell steigt die Häufigkeit des Vorhofflimmerns mit
Diagnose Vorhofflimmern Wie kann man einem Schlaganfall vorbeugen? Liebe Leserin, lieber Leser Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung. Generell steigt die Häufigkeit des Vorhofflimmerns mit
TIME IS BRAIN! Aktuelles zur Schlaganfallbehandlung. Marianne Dieterich Klinik und Poliklinik für Neurologie
 TIME IS BRAIN! Aktuelles zur Schlaganfallbehandlung Marianne Dieterich Klinik und Poliklinik für Neurologie Interdisziplinäres Schlaganfallzentrum München (Ludwig-Maximilians-Universität München, Standort
TIME IS BRAIN! Aktuelles zur Schlaganfallbehandlung Marianne Dieterich Klinik und Poliklinik für Neurologie Interdisziplinäres Schlaganfallzentrum München (Ludwig-Maximilians-Universität München, Standort
Faktenbox Medikamentöse Therapie bei Agoraphobie mit und ohne Panikstörung
 Faktenbox Medikamentöse Therapie bei Agoraphobie mit und ohne Panikstörung Nutzen und Risiken im Überblick Jede medizinische Behandlung bringt Nutzen und Risiken mit sich. Diese Faktenbox kann Sie bei
Faktenbox Medikamentöse Therapie bei Agoraphobie mit und ohne Panikstörung Nutzen und Risiken im Überblick Jede medizinische Behandlung bringt Nutzen und Risiken mit sich. Diese Faktenbox kann Sie bei
Medizin im Vortrag. Herausgeber: Prof. Dr. med. Christoph Frank Dietrich. Periphere arterielle Verschlusskrankheit (pavk)
 Medizin im Vortrag Herausgeber: Prof. Dr. med. Christoph Frank Dietrich Periphere arterielle Verschlusskrankheit (pavk) Autoren: Priv.-Doz. Dr. med. Christoph Frank Dietrich Prof. Dr. med. Rupert Martin
Medizin im Vortrag Herausgeber: Prof. Dr. med. Christoph Frank Dietrich Periphere arterielle Verschlusskrankheit (pavk) Autoren: Priv.-Doz. Dr. med. Christoph Frank Dietrich Prof. Dr. med. Rupert Martin
Die Inanspruchnahme ambulanter ärztlicher Leistungen durch ältere Menschen
 Die Inanspruchnahme ambulanter ärztlicher Leistungen durch ältere Menschen Mit der demographischen Alterung ist es absehbar, dass der Bedarf an medizinischen Leistungen weiter anwachsen wird. Eine wesentliche
Die Inanspruchnahme ambulanter ärztlicher Leistungen durch ältere Menschen Mit der demographischen Alterung ist es absehbar, dass der Bedarf an medizinischen Leistungen weiter anwachsen wird. Eine wesentliche
Offene Atemwege Kollaps des weichen Gaumens
 Das Schlafapnoe-Syndrom ein Risiko für das Herzkreislaufsystem. Atmungsstörungen wie Schnarchen oder Atempausen während des Schlafes sind vielen Menschen aus dem Alltag bekannt und weit verbreitet. Erst
Das Schlafapnoe-Syndrom ein Risiko für das Herzkreislaufsystem. Atmungsstörungen wie Schnarchen oder Atempausen während des Schlafes sind vielen Menschen aus dem Alltag bekannt und weit verbreitet. Erst
Schlaganfall. Informationen für Patienten und Angehörige. Alfried Krupp Krankenhaus
 Schlaganfall Informationen für Patienten und Angehörige Alfried Krupp Krankenhaus Sehr geehrte Patienten, sehr geehrte Angehörige, nachdem Sie oder ein Angehöriger von Ihnen einen Schlaganfall erlitten
Schlaganfall Informationen für Patienten und Angehörige Alfried Krupp Krankenhaus Sehr geehrte Patienten, sehr geehrte Angehörige, nachdem Sie oder ein Angehöriger von Ihnen einen Schlaganfall erlitten
Was ist ein Schlaganfall, welche Risken, welche Vorboten gibt es?
 Was ist ein Schlaganfall, welche Risken, welche Vorboten gibt es? Prim. Univ. Prof. Dr. Andreas Kampfl Abteilung für Neurologie mit Stroke Unit Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried im Innkreis
Was ist ein Schlaganfall, welche Risken, welche Vorboten gibt es? Prim. Univ. Prof. Dr. Andreas Kampfl Abteilung für Neurologie mit Stroke Unit Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried im Innkreis
Symposium des HerzZentrum Saar
 Symposium des HerzZentrum Saar Herz im Focus 2008 Für Pflege- und medizinisches Assistenzpersonal 06.Dezember 2008 Das Kard-CT Thorsten Becker Herzkatheterlabor Funktionsweise eines CT s Funktionsweise
Symposium des HerzZentrum Saar Herz im Focus 2008 Für Pflege- und medizinisches Assistenzpersonal 06.Dezember 2008 Das Kard-CT Thorsten Becker Herzkatheterlabor Funktionsweise eines CT s Funktionsweise
Diagnose Vorhofflimmern. Das Risiko eines Schlaganfalls
 Diagnose Vorhofflimmern Das Risiko eines Schlaganfalls Inhalt Einleitung... 4 Das Herz... 4 Herz-Kreislauf-System... 5 Was versteht man unter Vorhofflimmern?... 6 Was können Ursachen des Vorhofflimmerns
Diagnose Vorhofflimmern Das Risiko eines Schlaganfalls Inhalt Einleitung... 4 Das Herz... 4 Herz-Kreislauf-System... 5 Was versteht man unter Vorhofflimmern?... 6 Was können Ursachen des Vorhofflimmerns
kontrolliert wurden. Es erfolgte zudem kein Ausschluss einer sekundären Genese der Eisenüberladung. Erhöhte Ferritinkonzentrationen wurden in dieser S
 5.8 Zusammenfassung Auf der Grundlage der dargestellten Ergebnisse dieser Studie erscheint die laborchemische Bestimmung der Transferrinsättigung zur Abklärung einer unklaren Lebererkrankung und Verdacht
5.8 Zusammenfassung Auf der Grundlage der dargestellten Ergebnisse dieser Studie erscheint die laborchemische Bestimmung der Transferrinsättigung zur Abklärung einer unklaren Lebererkrankung und Verdacht
Arbeitsauftrag 3. Praktikum Puls und Blutdruck
 Arbeitsauftrag 3. Praktikum Puls und Blutdruck Claudia Tischow HEP 9C Inhaltsverzeichnis Fachtermini 2 1 Vorstellung der Personen 3 1.1 Angaben zur Person 1 3 1.1.1 Krankengeschichte 3 1.1.2 Medikation
Arbeitsauftrag 3. Praktikum Puls und Blutdruck Claudia Tischow HEP 9C Inhaltsverzeichnis Fachtermini 2 1 Vorstellung der Personen 3 1.1 Angaben zur Person 1 3 1.1.1 Krankengeschichte 3 1.1.2 Medikation
Restless legs - Syndrom. Stefan Weis, Neckarsulm
 Restless legs - Syndrom Stefan Weis, Neckarsulm Kurzbeschreibung I Das Restless-Legs-Syndrom ist eine chronisch-progrediente Erkrankung mit sehr variabler klinischer Ausprägung von milden, intermittierenden
Restless legs - Syndrom Stefan Weis, Neckarsulm Kurzbeschreibung I Das Restless-Legs-Syndrom ist eine chronisch-progrediente Erkrankung mit sehr variabler klinischer Ausprägung von milden, intermittierenden
Fall x: - weiblich, 37 Jahre. Symptome: - Visusminderung, Gangunsicherheit. Neurologischer Befund: - rechtsbetonte spastische Tetraparese - Gangataxie
 Fall x: - weiblich, 37 Jahre Symptome: - Visusminderung, Gangunsicherheit Neurologischer Befund: - rechtsbetonte spastische Tetraparese - Gangataxie Fall x: Liquorbefund: unauffällig mit 2 Leukos, keine
Fall x: - weiblich, 37 Jahre Symptome: - Visusminderung, Gangunsicherheit Neurologischer Befund: - rechtsbetonte spastische Tetraparese - Gangataxie Fall x: Liquorbefund: unauffällig mit 2 Leukos, keine
Monate Präop Tabelle 20: Verteilung der NYHA-Klassen in Gruppe 1 (alle Patienten)
 Parameter zur Beschreibung der Leistungsfähigkeit Klassifikation der New-York-Heart-Association (NYHA) Gruppe 1 (alle Patienten): Die Eingruppierung der Patienten in NYHA-Klassen als Abbild der Schwere
Parameter zur Beschreibung der Leistungsfähigkeit Klassifikation der New-York-Heart-Association (NYHA) Gruppe 1 (alle Patienten): Die Eingruppierung der Patienten in NYHA-Klassen als Abbild der Schwere
Hintergrund. Kernaussagen. Der Gehwettbewerb der Uni Bonn verfolgte zwei Ziele:
 Hintergrund Der Gehwettbewerb der Uni Bonn verfolgte zwei Ziele: 1. Sensibilisierung der Beschäftigten der Universität Bonn hinsichtlich der eigenen, aktuellen körperlichen Aktivität durch die Erfassung
Hintergrund Der Gehwettbewerb der Uni Bonn verfolgte zwei Ziele: 1. Sensibilisierung der Beschäftigten der Universität Bonn hinsichtlich der eigenen, aktuellen körperlichen Aktivität durch die Erfassung
QUANTITATIVE VS QUALITATIVE STUDIEN
 1 QUANTITATIVE VS QUALITATIVE STUDIEN Q UA N T I TAT I V E ST U D I E (lat. quantitas: Größe, Menge) Q UA L I TAT I V E ST U D I E (lat.: qualitas = Beschaffenheit, Merkmal, Eigenschaft, Zustand) 2 QUANTITATIVES
1 QUANTITATIVE VS QUALITATIVE STUDIEN Q UA N T I TAT I V E ST U D I E (lat. quantitas: Größe, Menge) Q UA L I TAT I V E ST U D I E (lat.: qualitas = Beschaffenheit, Merkmal, Eigenschaft, Zustand) 2 QUANTITATIVES
Neurologische/ Neurogeriatrische Erkrankungen des höheren Lebensalters
 Neurologische/ Neurogeriatrische Erkrankungen des höheren Lebensalters J. Bufler Neurologische Klinik des ISK Wasserburg Präsentation, Stand November 2008, Martin Spuckti Seite 1 Vier Giganten der Geriatrie
Neurologische/ Neurogeriatrische Erkrankungen des höheren Lebensalters J. Bufler Neurologische Klinik des ISK Wasserburg Präsentation, Stand November 2008, Martin Spuckti Seite 1 Vier Giganten der Geriatrie
Zur Problematik der Selbstauskunft über psychische Befindlichkeit in der medizinischen Rehabilitation
 Zur Problematik der Selbstauskunft über psychische Befindlichkeit in der medizinischen Rehabilitation Dipl.-Psych. Nadine Schuster reha Kompetenzzentrum Bad Kreuznach/Bad Münster am Stein-Ebernburg 24.09.2009
Zur Problematik der Selbstauskunft über psychische Befindlichkeit in der medizinischen Rehabilitation Dipl.-Psych. Nadine Schuster reha Kompetenzzentrum Bad Kreuznach/Bad Münster am Stein-Ebernburg 24.09.2009
DEMENZ EIN LEITFADEN FÜR DAS ARZT- PATIENTEN-GESPRÄCH
 ADDITIONAL SLIDE KIT DEMENZ EIN LEITFADEN FÜR DAS ARZT- PATIENTEN-GESPRÄCH Autoren: Der Leitfaden Demenz wurde durch Schweizer Allgemeinmediziner, Geriater, Neurologen, Neuropsychologen und Psychiater
ADDITIONAL SLIDE KIT DEMENZ EIN LEITFADEN FÜR DAS ARZT- PATIENTEN-GESPRÄCH Autoren: Der Leitfaden Demenz wurde durch Schweizer Allgemeinmediziner, Geriater, Neurologen, Neuropsychologen und Psychiater
Gesundheitliche Auswirkungen von Schienenverkehrslärm
 Für Mensch & Umwelt Fortbildung Öffentlicher Gesundheitsdienst Gesundheitliche Auswirkungen von Schienenverkehrslärm Jördis Wothge Fachgebiet I 3.4 Lärmminderung bei Anlagen und Produkten, Lärmwirkungen
Für Mensch & Umwelt Fortbildung Öffentlicher Gesundheitsdienst Gesundheitliche Auswirkungen von Schienenverkehrslärm Jördis Wothge Fachgebiet I 3.4 Lärmminderung bei Anlagen und Produkten, Lärmwirkungen
Bachelorarbeit Sport mit Schlaganfallpatienten: Ein neuer Ansatz - Der Gehweg von SpoMobil
 Universität Paderborn Fakultät der Naturwissenschaften Department Sport und Gesundheit Angewandte Sportwissenschaften Betreuer: Prof. Dr. med. Weiß Zweitprüfer: PD Dr. med. Baum Bachelorarbeit Sport mit
Universität Paderborn Fakultät der Naturwissenschaften Department Sport und Gesundheit Angewandte Sportwissenschaften Betreuer: Prof. Dr. med. Weiß Zweitprüfer: PD Dr. med. Baum Bachelorarbeit Sport mit
Roswitha Wurm. Schlafstörungen. Ursachen und Lösungen
 Roswitha Wurm Schlafstörungen Ursachen und Lösungen Inhalt Kurz und bündig... 5 Vorwort des Herausgebers... 6 Vorwort... 8 I. Theoretische Grundlagen... 11 1. Schlaflosigkeit... 11 2. Schlafforschung...
Roswitha Wurm Schlafstörungen Ursachen und Lösungen Inhalt Kurz und bündig... 5 Vorwort des Herausgebers... 6 Vorwort... 8 I. Theoretische Grundlagen... 11 1. Schlaflosigkeit... 11 2. Schlafforschung...
 Willkommen im Marlborocountry COPD COPD - Einfluss der Noxen auf die Noxen z.b. Zigarettenrauch Pathogenese - Zytokine und chemotaktische Factoren (TNF, IL-8, LTB 4, etc) sensorische Nerven alveolärer
Willkommen im Marlborocountry COPD COPD - Einfluss der Noxen auf die Noxen z.b. Zigarettenrauch Pathogenese - Zytokine und chemotaktische Factoren (TNF, IL-8, LTB 4, etc) sensorische Nerven alveolärer
Depression. Krankheitsbild und Ursachen. 1 Copyright by HEXAL AG, 2008
 Depression - Krankheitsbild und Ursachen 1 Copyright by HEXAL AG, 2008 Inhalt Grundlagen - Was versteht man unter einer Depression - Wer ist betroffen Krankheitsbild Verlauf der Depression Folgen der Depression
Depression - Krankheitsbild und Ursachen 1 Copyright by HEXAL AG, 2008 Inhalt Grundlagen - Was versteht man unter einer Depression - Wer ist betroffen Krankheitsbild Verlauf der Depression Folgen der Depression
