Renditen bei Börseneinführungen am deutschen Kapitalmarkt
|
|
|
- Jacob Küchler
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Renditen bei Börseneinführungen am deutschen Kapitalmarkt von Richard Stehle und Olaf Ehrhardt Fassung: März 999 Prof. Richard Stehle ist Direktor des Instituts für Bank-, Börsen- und Versicherungswesen der Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Spandauer Str., 078 Berlin, Dr. Olaf Ehrhardt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am genannten Institut, E- Mail: Forschungsschwerpunkte: Portefeuille- und Kapitalmarkttheorie, Unternehmenstheorie, Empirische Kapitalmarktforschung.
2 Renditen bei Börseneinführungen am deutschen Kapitalmarkt Überblick Die bisher vorgelegten Studien zu Börseneinführungen am deutschen Kapitalmarkt weisen für die durchschnittliche Emissionsrendite und die kumulierte Überrendite in den ersten 36 Monaten der Börsennotierung stark unterschiedliche Werte auf. Ziel des vorliegenden Beitrages ist es, diese Unterschiede auf Basis eines Datensatzes über alle im Festpreisverfahren zwischen 960 und 995 in Deutschland erfolgten Börseneinführungen zu erklären und nach den Ursachen für die beobachteten Überrenditen zu fragen. Unsere Untersuchungen zeigen, daß die Unterschiede bei der Emissionsrendite mit verschiedenen Betrachtungszeiträumen und der Einbeziehung bzw. ichteinbeziehung von Emissionen des ungeregelten Freiverkehrs zusammenhängen. Die unterschiedlichen Ergebnisse im Hinblick auf die langfristige Performance resultieren vor allem aus der gewählten Form der Zeitreihen- und Querschnittsaggregation. Die langfristige Überrendite in den 36 Monaten nach der otizaufnahme unterscheidet sich in der Gesamtperiode weder ökonomisch noch statistisch signifikant von null. Positive Emissionsrenditen sind somit eher durch Underpricing-Modelle als durch verhaltensorientierte Ansätze zu erklären. Wie bei Ljungqvist (997) ergibt sich allerdings für die langfristige Überrendite nach 988 ein wesentlich geringerer Wert als vor 988.
3 A. Einleitung und Vorgehensweise Von einer Börseneinführung, einem Going public oder einem Initial public offering (IPO) wird gesprochen, wenn Aktien eines Unternehmens zum ersten Mal an der Börse notiert werden. Die Aktien werden zuvor in der Regel entweder öffentlich zum Kauf angeboten oder bei einem ausgewählten Kundenkreis privat plaziert. Vor 995 erfolgten in Deutschland alle Börseneinführungen im Festpreisverfahren. 2 Mit der Abgabe von Kauforders verpflichten sich dabei die Anleger, die nachgefragte Anzahl der Aktien zu dem vor Beginn der Zeichnungsperiode festgelegten Emissionspreis zu übernehmen. Übersteigt die achfrage das traditionell ebenfalls im voraus festgelegte Emissionsvolumen, dann werden die eingegangenen Kaufaufträge rationiert (Repartierung). Die mit Börseneinführungen verbundenen Renditen sind nicht nur für private und institutionelle Anleger, Emittenten sowie Konsortialbanken von großem Interesse, sondern auch für die Institutionen, die die Rahmenbedingungen für Börseneinführungen festlegen, und die verantwortlichen Aufsichtsbehörden. Von besonderem Interesse sind der als Emissions- oder Zeichnungsrendite bezeichnete Unterschied (in %) zwischen dem Zeichnungs- und dem ersten Börsenkurs sowie die langfristige Rendite nach der Börseneinführung, z.b. die Rendite in den ersten 36 Monaten nach der otizaufnahme. Ziel dieses Beitrages ist, die genannten Renditen für den deutschen Markt zu untersuchen. In Abschnitt B werden die Emissionsrenditen aller im traditionellen Festpreisverfahren plazierten deutschen Börseneinführungen zwischen 960 und 995 analysiert, wobei zwischen Emissionen in den amtlichen Handel, den geregelten Markt und in die Freiverkehrssegmente unterschieden wird. 3 Die Analyse zeigt, daß in Deutschland bis Mitte der achtziger Jahre die Emissionskurse häufig viel zu niedrig, selten aber zu hoch angesetzt waren. Zu niedrig angesetzte Emissionskurse sind aus Anlegersicht natürlich wünschenswert, aus der Sicht des Emittenten zählen die damit verbundenen entgangenen Mittelzuflüsse aber zu den Kosten der Emission. Es ist nicht auszuschließen, daß die unter Einbeziehung der entgangenen Mittelzuflüsse berechneten hohen Emissionskosten in Deutschland bis Mitte der achtziger Jahre Unternehmen vom Gang an die Börse abgehalten haben. Der Anteil der Fälle, in denen die Emissionskurse viel zu niedrig angesetzt wurden, ist seit Mitte der achtziger Jahre beträchtlich geringer geworden. In Deutland tätige Emissionsbanken brauchen für die vergangenen zehn Jahre einen internationalen Vergleich nicht zu scheuen. 4 Abschnitt C gilt der langfristigen Rendite nach Börseneinführungen. Auch hier werden die unterschiedlichen Ergebnisse der bisher vorliegenden Studien ausführlich diskutiert und eigene Berechnungen vorgelegt. Die Diskussion zeigt, 2
4 daß das Ergebnis von langfristigen Renditevergleichen durch die Art der Bereinigung um die allgemeine Kursentwicklung, das Kumulationsverfahren und die Art der Mittelwertbildung stark beeinflußt wird. Die in einer Reihe von Studien des US-amerikanischen Marktes gefundene und auch in mehreren Studien des deutschen Marktes berechnete negative langfristige Performance von IPO-Aktien können wir nicht bestätigen. Bei Verwendung eines marktwertgewichteten Vergleichsportefeuilles aller in Frankfurt amtlich notierten Aktien erhalten wir für die ersten 36 Monate der Börsennotierung eine leicht positive, statistisch nicht signifikante kumulierte Überrendite von insgesamt,54 %, bei Verwendung eines gleichgewichteten Portefeuilles dieser Aktien eine leicht negative, ebenfalls statistisch nicht signifikante Überrendite von insgesamt - 5,04 %. Dieses Ergebnis steht in Einklang mit der Hypothese (informations-)effizienter Kapitalmärkte und einer neueren Studie des US-Marktes, die zum Ergebnis kommt, daß die durchschnittliche Underperformance US-amerikanischer IPOs vor allem durch sehr kleine Unternehmen verursacht wird. 5 Deutsche IPOs haben im internationalen Maßstab eine vergleichsweise hohe Marktkapitalisierung und ein hohes Durchschnittsalter. Außerdem werden sie bis auf wenige Ausnahmen von großen Universalbanken bei der Börseneinführung begleitet. Abschnitt D faßt die Ergebnisse zusammen und zeigt offene Probleme. B. Die Emissionsrendite bei deutschen Börseneinführungen In der wissenschaftlichen Literatur werden die mit Börseneinführungen zusammenhängenden Renditen in den USA seit Mitte der siebziger Jahre, in Deutschland seit Ende der achtziger Jahre intensiv diskutiert. Dabei standen in einer ersten Phase jeweils die Emissionsrenditen (Initial returns) im Mittelpunkt. Da zwischen der Zeichnung und dem ersten Börsenhandel in der Regel nur wenige Tage liegen, spielt es bei der Betrachtung von durchschnittlichen Emissionsrenditen nur eine unwesentliche Rolle, ob die zugrundeliegenden Einzelbeobachtungen um die allgemeine Marktentwicklung bereinigt werden oder nicht. 6 Dies gilt insbesondere dann, wenn eine große Zahl von Beobachtungen vorliegt. Auf eine Bereinigung wird in der vorliegenden Untersuchung deshalb verzichtet. Während sich Analysen zur Emissionsrendite in den USA heute auf mehrere tausend, in Großbritannien auf nahezu tausend Beobachtungen stützen können, fanden in Deutschland zwischen 960 und 995 nur 222 Börseneinführungen im Festpreis- 7 und 2 im Bookbuilding-Verfahren statt. [ungefähr hier Abbildung einfügen] 3
5 Abbildung zeigt im Zeitablauf die Emissionsrenditen der hier untersuchten deutschen Börseneinführungen im Festpreisverfahren und gibt für viele Beobachtungen zudem Auskunft über das Marktsegment und den Konsortialführer bzw. die die Einführung begleitende Institution. Die Abbildung illustriert, daß es bis Mitte der achtziger Jahre nur eine verhältnismäßig geringe Anzahl von Börseneinführungen gab, die zum Teil sehr hohe, nie aber negative Emissionsrenditen besaßen. Seit Mitte der achtziger Jahre kommen gelegentlich geringfügig negative Emissionsrenditen vor. Sehr hohe Emissionsrenditen - also Emissionsrenditen über 50 % - sind relativ selten geworden. Circa 20 % der unbereinigten Emissionsrenditen sind im gesamten Betrachtungszeitraum allerdings geringer als %, etwa die Hälfte ist geringer als 6 %. Bei Emissionsrenditen von null oder nahe null spielen sicherlich Kurspflegemaßnahmen eine wichtige Rolle. 8 Weiter verdeutlicht Abbildung, daß es sich bei den Börseneinführungen mit sehr hohen Emissionsrenditen häufig um solche von sehr kleinen, relativ unbekannten Unternehmen in den ungeregelten Freiverkehr oder den geregelten Markt handelt. Zusätzlich wird auch die besondere Rolle der Portfolio Management GmbH (PM) sichtbar. Dieses Emissionshaus ohne Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften brachte Mitte der achtziger Jahre zehn Unternehmen an die Börse, acht davon in den ungeregelten Freiverkehr, wobei die durchschnittliche Emissionsrendite 67 % betrug. Sieben der zehn Unternehmungen gingen später in Konkurs. Fast alle anderen Unternehmen wurden von einem Emissionskonsortium unter Leitung einer Bank an die Börse gebracht. 9 [ungefähr hier Tabelle einfügen] Abbildung erklärt ebenfalls die enormen Unterschiede bei der Schätzung der durchschnittlichen Emissionsrendite des deutschen Marktes in Tabelle. Die Ende der achtziger Jahre erschienenen Studien erstreckten sich meist nur auf die achtziger Jahre, bezogen die PM-Emissionen ein und kamen so auf Durchschnittswerte für die Emissionsrendite von über 20 % (z.b. Schwarz (988) und Dawson/Reiner (988)). euere Studien beziehen auch die siebziger und die neunziger Jahre ein, schließen aber häufig den ungeregelten Freiverkehr (z.b. Ljungqvist (997)), die PM-Emissionen und/oder die nicht von Banken begleiteten Emissionen aus (z.b. Ehrhardt (997)). Die so ermittelten Durchschnittswerte liegen zwischen 0 und 5 %. [ungefähr hier Tabelle 2 einfügen] Tabelle 2 enthält die von uns berechneten Durchschnittswerte für die (unbereinigten) Emissionsrenditen der 222 in Abbildung enthaltenen Börseneinführungen im Festpreisverfahren zwischen Anfang 960 und Ende 995, dazu 4
6 Standardabweichungen sowie Maximal- und Minimalwerte. Die Tabelle zeigt, daß die Emissionsrenditen im amtlichen Handel im Schnitt geringer sind als in den anderen Marktsegmenten und daß die durchschnittliche Emissionsrendite und ihre Standardabweichung im Zeitablauf stark gefallen sind. Zum Beispiel beträgt die durchschnittliche Emissionsrendite für den amtlichen Handel in der gesamten Betrachtungsperiode 6,04 %, von Mai der Einführung des geregelten Marktes - bis Ende 995 nur 7,64 %. Im geregelten Markt beläuft sie sich im letztgenannten Zeitraum auf 8,35 %. Die Durchschnittswerte für den amtlichen Handel nach 987 und den geregelten Markt sind somit eher niedriger als die vergleichbaren Werte für andere Industrieländer. 0 Auch die Werte für den Freiverkehr vor 987 halten einem internationalen Vergleich stand, wenn die von der Portfolio Management GmbH begleiteten Werte nicht einbezogen werden. Allerdings sollten in internationalen Vergleichen von Emissionsrenditen auch die unterschiedlichen Unternehmensstrukturen und institutionellen Gegebenheiten einbezogen werden. Deutsche IPO-Unternehmen sind im Schnitt größer und älter als US-amerikanische. Ljungqvist (997) argumentiert zu Recht, daß es leichter sei, große Unternehmen mit einer langen und stabilen Unternehmensgeschichte zu bewerten als kleine Wachstumswerte mit neuartigen Produkten. Aus Tabelle 2 wird auch die enorme Schiefe der Häufigkeitsverteilung der Emissionsrenditen deutlich. Der Maximalwert liegt fast immer mehrere Standardabweichungen über dem Durchschnittswert, während der Minimalwert meist nur eine Standardabweichung darunter liegt. In Anbetracht der hohen durchschnittlichen Emissionsrendite in allen Marktsegmenten vor 987 und der auch im Zeitraum nach 987 positiven durchschnittlichen Emissionsrendite stellt sich die Frage nach den ökonomischen Ursachen. Die in der Literatur diskutierten Erklärungsansätze lassen sich in drei Gruppen einteilen: Die Kurse am ersten Börsentag sind deshalb im Durchschnitt höher als die Emissionskurse, weil letztere fehlerhaft (d.h. unabsichtlich) zu niedrig angesetzt wurden. Die Emissionskurse werden absichtlich niedriger als die voraussichtlichen wahren Werte am ersten Börsentag festgesetzt (bewußtes Underpricing). Die Kurse am ersten Börsentag sind im Schnitt höher als die jeweiligen wahren Werte, weil die Emissionsbanken vielfach Kurspflege betreiben und/oder die Anleger alle oder manche IPO-Wertpapiere systematisch zu positiv einschätzen (Fads-Hypothese). 5
7 Wegen der enormen Schwierigkeiten bei der Schätzung der wahren Werte der Aktien von Börsenkandidaten, werden sich die Schätzwerte der Banken bzw. Emittenten in der Regel von den wahren Werten unterscheiden. Differenzen, z.b. in Höhe von + oder -20 %, kommen als Folge häufig vor. Wichtig ist, ob diese Differenzen zufällig verteilt und im Durchschnitt gleich null sind oder ob systematische Fehlbewertungen vorliegen. Es ist nicht auszuschließen, daß in Deutschland die hohen Emissionsrenditen der sechziger, siebziger und Anfang der achtziger Jahre mit einer unabsichtlichen Fehlbewertung zusammenhängen. Zu dieser könnten die damals noch vorherrschenden traditionellen Methoden der Unternehmensbewertung (z.b. das Stuttgarter Verfahren) beigetragen haben. Eine systematisch fehlerhafte Bewertung der IPO-Wertpapiere durch Emissionsbanken und Emittenten ist für die letzten zehn Jahre in Deutschland allerdings wenig wahrscheinlich. Alternativ könnten auch die Anleger zum Zeitpunkt der Börseneinführung die wahren Werte der Aktien systematisch überschätzen. Trifft dieser Erklärungsansatz zu, so sollte die Performance der IPO-Wertpapiere nach der Börseneinführung geringer sein als für vergleichbare Wertpapiere. Die diesbezüglichen Forschungsergebnisse sind für Deutschland nicht einheitlich, sie werden im folgenden Abschnitt C diskutiert. Unsere Untersuchungen kommen zum Ergebnis, daß die Performance von neu an der Börse eingeführten Aktien in den ersten 36 Monaten nur geringfügig unter dem Erwartungswert liegt. Die hohen Emissionsrenditen sind deshalb in erster Linie mit der Hypothese eines bewußten Underpricings vereinbar. Hierfür existiert eine Vielzahl von Argumenten bzw. Erklärungsmodellen. 2 Logue (973a) argumentiert, daß es den Konsortialbanken bei mangelndem Wettbewerb eher gelingen wird, niedrige Emissionskurse durchzusetzen. Ein niedriger Emissionskurs verringert für das Bankenkonsortium das bestehende Plazierungsrisiko und erhöht dadurch bei gegebener Provision den erwarteten Gewinn. Der zunehmende Wettbewerb um Konsortialführungen könnte eine mögliche Ursache für die Verringerung der Emissionsrenditen am deutschen Kapitalmarkt sein. 3 Ritter (984) hält einen mangelnden Wettbewerb insbesondere bei extrem risikoreichen und bei kleinen Unternehmen für möglich - auch diese Hypothese steht im Einklang mit den obigen Ergebnissen für Deutschland. Fast alle extrem positiven Emissionsrenditen wurden in der Vergangenheit bei Börseneinführungen sehr kleiner Unternehmen beobachtet. Breuers (993) Verweis auf die hohe Wettbewerbsintensität beim Investment Banking in Deutschland dürfte sich in erster Linie auf die Situation zu Beginn der neunziger Jahre und auf mittlere und große IPO-Unternehmen beziehen. 4 6
8 Aus der Sicht des Emittenten ergeben sich die Gesamtkosten der Emission aus den zu zahlenden Gebühren, Provisionen und Honoraren, den aus dem Underpricing resultierenden entgangenen Mittelzuflüssen sowie den Opportunitätskosten für die Arbeitszeit seiner mit der Emission befaßten Manager und Mitarbeiter. Seit Mitte 983 sind in Deutschland die mit Auszahlungen verbundenen Emissionskosten steuerlich abzugsfähig. Bei gegebenen Gesamtkosten einer Emission werden die Emittenten versuchen, den steuerlich nicht abzugsfähigen Teil - also die entgangenen Mittelzuflüsse - zu minimieren. Eventuell hat diese Steuererleichterung zur Verringerung der deutschen Emissionsrenditen beigetragen. Zu einem bewußten Underpricing in Deutschland und zu dessen Abnahme im Zeitablauf könnte auch beigetragen haben, daß die Übernahme- und Plazierungsprovision im internationalen Vergleich nur in engen Grenzen variiert. Wahrscheinlich waren diese Grenzen in den siebziger und achtziger Jahren noch enger. Stellt die marktübliche Provision keine ausreichende Entschädigung für die vom Bankenkonsortium zu erbringenden Leistungen und das zu tragende Plazierungsrisiko dar - dies dürfte insbesondere bei relativ riskanten Emissionen der Fall sein -, dann können die Banken auch bei starker Konkurrenz nicht auf ein bewußtes, das Plazierungsrisiko beschränkendes Underpricing verzichten. 5 Ist dieses Underpricing für den Emittenten nicht akzeptabel, dann kommt die Emission nicht zustande. Eine Reihe von Modellen abstrahiert deshalb von den bisher genannten Problemen einer unvollkommenen Konkurrenz sowie das Plazierungsrisiko nicht abdeckenden Provisionen und konzentriert sich auf die asymmetrische Information über die wertbestimmenden Eigenschaften der betrachteten Unternehmen. In einer bedeutenden Arbeit differenziert Rock (986) zwischen gut und weniger gut informierten Anlegern. Den besser informierten Anlegern gelingt es, über- und unterbewertete Emissionen zu unterscheiden und entsprechende Zeichnungsanträge abzuleiten. Die weniger gut informierten Anleger zeichnen dagegen alle IPOs auf gleiche Weise. Sie erhalten als Folge bei überbewerteten Emissionen hohe Zuteilungen (Winner s curse), bei unterbewerteten Emissionen werden ihre Kaufaufträge durch die zusätzliche achfrage der informierten Anleger in den meisten Fällen rationiert (Repartierung). Um sie für die Verluste bei überbewerteten Emissionen zu entschädigen, ist ein bewußtes Underpricing erforderlich. Ansonsten kann der Markt für Börseneinführungen nicht funktionieren. Beatty/Ritter (986) zeigen, daß ein kausaler Zusammenhang zwischen der Höhe des Underpricings und der Ex-ante-Unsicherheit über den wahren Wert der Emission besteht. 7
9 Die Hypothese von Rock (986) bzw. deren Erweiterung von Beatty/Ritter (986) wurde durch die empirischen Arbeiten von Michaely/Shaw (994) für die USA und Koh/Walter (989) für Singapur auf originelle Weise bestätigt. Die in diesen Studien verwendeten Daten - in Singapur werden z.b. die Repartierungsdaten veröffentlicht - liegen aber für Deutschland und die meisten anderen Länder nicht vor. In einer Vielzahl von Studien wird deshalb versucht, die Ex-ante-Unsicherheit auf geeignete Weise zu approximieren. Die traditionell populärste Möglichkeit zur Approximation der Ex-ante-Unsicherheit ist die Verwendung der Standardabweichung der täglichen Aktienrendite nach der Börseneinführung. Dieses Maß der Unsicherheit wurde zum Beispiel von Ritter (984, 987) für die USA sowie von Uhlir (989) und Wasserfallen/Wittleder (994) für Deutschland erfolgreich mit der Emissionsrendite in Beziehung gesetzt. Problematisch an dieser Vorgehensweise ist, daß sie bei Kurspflege zu einer fehlerhaften Schätzung der Unsicherheit führt. 6 Hinzu kommt, daß sie auch in Einklang mit anderen Underpricing-Modellen für die Emissionsrendite steht. Beatty/Ritter (986), Ritter (984, 987), Ljungqvist (997) und andere versuchen deshalb, die Unsicherheit über die wertbestimmenden Eigenschaften der IPO-Unternehmung durch das Emissionsvolumen und/oder das Alter der Unternehmung zu approximieren. Je höher dieses Volumen ist, desto geringer ist wahrscheinlich die genannte Unsicherheit. Wasserfallen/Wittleder (994) stellen fest, daß die Höhe der Emissionsrendite tendenziell mit zunehmendem Alter und höherem Emissionsvolumen bzw. höherem Buchwert der Unternehmung sinkt. Ljungqvist (997) ermittelt mit Hilfe einer multiplen linearen Regression, daß die Emissionsrendite positiv mit den Variablen Kehrwert des Emissionserlöses, Anteil der Insider am Eigenkapital nach der Börseneinführung, Performance des Marktes (DAFOX) im Jahr vor der Emission und allgemeines Wirtschaftsklima im Zeitpunkt der Emission, negativ mit einer Dummy-Variablen für die Jahre nach 987 zusammenhängt. Unsere Erfahrungen zeigen, daß das Ergebnis solcher Regressionen in Deutschland stark von der Wahl der Zeitperiode, dem unterstellten funktionalen Zusammenhang, der einbezogenen Marktsegmente und der Art der Berücksichtigung der PM-Emissionen abhängt. Tabelle 3 enthält die Ergebnisse von Regressionen, in denen als exogene Variable das Emissionsjahr und das (buchmäßige) Grundkapital verwendet wird. Hauptgrund für die Verwendung der Variablen Emissionsjahr ist das in Abbildung und Tabelle 2 dokumentierte starke Abfallen der durchschnittlichen Emissionsrendite im Zeitablauf. Mit 8
10 dem Grundkapital soll die Unternehmensgröße bzw. das Emissionsvolumen approximiert werden. Die unterstellte nichtlineare Form der Regressionsgleichung wurde auf systematische Weise aus einer Vielzahl von möglichen nichtlinearen Formen ausgesucht. 7 Sie liegt im Hinblick auf das angepaßte Bestimmtheitsmaß sehr nahe bei der nichtlinearen Regressionsgleichung, die bei diesen beiden unabhängigen Variablen das höchste Bestimmtheitsmaß besitzt. Bei Verwendung der Variablen (/Zeit) anstatt der Variablen Zeit würde z.b. das Bestimmtheitsmaß von 4,26 auf 4,29 ansteigen. Formelmäßig lautet unser Regressionsmodell: ( GKi ) IRi = γ 0 + γ Zeiti + γ 2 e + ε i () IR i = Emissionsrendite des IPO-Wertpapiers i (z.b. 0,22); Zeit i = Erstnotiz des IPO-Wertpapiers i, gemessen als Dezimalzahl des Kalenderjahres (z.b. 994,7); GK i = Grundkapital des Unternehmens i in Mio. DM in Preisen von 985. [ungefähr hier Tabelle 3 einfügen] Das Regressionsergebnis scheint auf den ersten Blick plausibel. Die Zeitvariable ist in den ersten drei Regressionsschätzungen statistisch und ökonomisch höchst signifikant. Im gesamten Betrachtungszeitraum scheint sich die Emissionsrendite pro Jahr um 0,08 bzw.,8 % zu verringern. Für ein Grundkapital in Höhe von 20 Mio. DM in Preisen von 985 ergeben sich z.b. für die Jahre 970, 985 und 990 die folgenden Schätzwerte für die Emissionsrendite: 46,6 %, 9,2 % und 9,96 %. Die vierte Regressionsschätzung zeigt aber, daß ein ausgeprägter Zeiteffekt höchstens im Zeitraum vor 987 bestand. 8 Die Kapitalvariable ist in der ersten Schätzung statistisch hoch signifikant. Die zweite Schätzung zeigt, daß der vermeintliche Größeneffekt nur von der Einbeziehung der PM-Emissionen verursacht wird. Werden diese nicht berücksichtigt, wird der ungeregelte Freiverkehr ausgeschlossen oder nur die Zeit nach 987 betrachtet, so ist die Kapitalvariable statistisch nicht signifikant. Angesichts der zur Verfügung stehenden Daten ist bei Querschnittsregressionen bzw. -untersuchungen also Vorsicht geboten. 9
11 C. Untersuchungen zur langfristigen Performance I. Berechnungsmethodik. Auswahl des Vergleichsmaßstabes Die Untersuchung der langfristigen Performance, d.h. der langfristigen Renditeentwicklung von IPO-Wertpapieren nach der Börseneinführung, erfordert einen größeren Datenumfang und eine höhere Datenqualität als die Analyse der Emissionsrenditen. Bei einer Untersuchung, die sich auf 36 Monate nach der Börseneinführung erstreckt, sind z.b. alle Dividenden, Bezugsrechte und sonstige Vermögensvorteile der Aktionäre in diesem Zeitraum einzubeziehen. 9 Da Aktien im langfristigen Durchschnitt eine jährliche (Gesamt-)Rendite von über 0 % besitzen, 20 die Rendite im Zeitablauf aber starken Schwankungen unterliegt, ist bei der Beurteilung der langfristigen Rendite ein Vergleich mit ihrem Erwartungswert bzw. eine Bereinigung der zugrundeliegenden kurzfristigen Renditen mit ihren Erwartungswerten unerläßlich. Die Zahl der Studien, in denen langfristige Renditen berechnet werden, ist deshalb weitaus geringer als die Zahl der Studien zur Untersuchung von Emissionsrenditen. Für Fragen, die sich auf bereits seit einiger Zeit an der Börse notierte Unternehmen beziehen, bietet sich als Schätzwert für den Erwartungswert der Rendite die erwartete Rendite nach dem Marktmodell oder dem Sharpe-Lintner- Kapitalmarktgleichgewichtsmodell an. 2 Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Durchschnittsrendite aus der Vergangenheit als Schätzwert für die erwartete Rendite zu verwenden. 22 Alle drei Möglichkeiten bestehen bei neu an der Börse eingeführten Unternehmen nicht. Wie auch international werden in den meisten deutschen Studien IPO-Renditen dadurch bereinigt, daß von den Renditen der betrachteten Unternehmen jeweils die Renditen eines Vergleichsportefeuilles bzw. die Änderungsraten eines Indexes abgezogen werden. Die so errechneten Werte bezeichnet man meist als marktbereinigte Überrenditen. 23 Dieser Vorgehensweise liegt die Annahme zugrunde, daß die erwartete Rendite der untersuchten Aktie gleich der tatsächlichen Marktrendite im Beobachtungszeitraum ist. 24 In den ersten deutschen Studien zur Untersuchung der langfristigen Renditen von IPO-Aktien wurden diese um die Änderungsrate eines Kursindexes (FAZ- Index bzw. Index des Statistischen Bundesamtes) bereinigt. Da diese Indizes keine Dividenden einbeziehen, dürfen bei ihrer Verwendung zur Approximation der erwarteten Rendite auch bei der Renditenberechnung des IPO-Wertpapiers keine Dividendenzahlungen berücksichtigt werden. 25 Die so berechnete Renditedifferenz entspricht der wahren Renditedifferenz, falls das Ausschüt- 0
12 tungsverhalten der IPO-Aktien dem Ausschüttungsverhalten der Aktien des verwendeten Kursindexes entspricht. In neueren Untersuchungen werden bei der Berechnung der erwarteten Rendite von IPO-Aktien Performanceindizes verwendet, also Dividenden einbezogen. Kaserer (996) nutzt z.b. den DAX. Da es sich bei Börseneinführungen in der Regel um kleinere oder mittlere Unternehmen handelt, kann die Bereinigung um die Änderungsrate des DAX aufgrund des Size-Effektes zu einer Verzerrung der Überrendite nach oben führen. 26 Unter Size-Effekt wird die im Hinblick auf die gängigen Modelle bestehende empirische Anomalie verstanden, daß die Renditen der Aktien größerer Unternehmen niedriger sind als die Renditen kleinerer Unternehmen. 27 In mehreren neueren Studien (Ljungqvist (997), Ehrhardt (997)) wird auch mit der Rendite des marktwertgewichteten Portefeuilles aller in Frankfurt amtlich gehandelten Aktien bereinigt. Für die Rendite dieses Portefeuilles liegen Schätzungen vor, die auf Göppl/Schütz (992) und Stehle/Hartmond (99) zurückgehen, inzwischen aber zeitlich ergänzt wurden. Wichtigster Unterschied zwischen diesen Schätzungen ist, daß der DAFOX von Göppl/Schütz (992) die Körperschaftsteuergutschrift nicht einbezieht und damit vor 977 eine implizite Einkommensteuerbelastung eines Anlegers von 0 %, für den Zeitraum 977 bis 993 von 36 % und danach von 30 % unterstellt. Bei der von Stehle/Hartmond (99) als Marktportefeuille bezeichneten Reihe wird explizit die Sichtweise eines inländischen steuerpflichtigen Anlegers mit einer Einkommensteuerbelastung von 0 % unterstellt, also nach 977 die Körperschaftsteuergutschrift einbezogen. Auch bei den von Göppl/Schütz (992) und Stehle/Hartmond (99) berechneten Vergleichsmaßstäben ergeben sich wegen der Gewichtung der enthaltenen Renditen einzelner Aktien mit den jeweiligen Marktkapitalisierungen möglicherweise Verzerrungen der Überrenditen nach oben. Eine sinnvolle Alternative bzw. Ergänzung ist deshalb eine Bereinigung mit einem ungewichteten Durchschnitt aller in Frankfurt amtlich gehandelten Aktien. 28 In mehreren neueren Untersuchungen des US-amerikanischen Kapitalmarktes wird die erwartete Rendite des IPO-Wertpapiers durch die Rendite eines im Hinblick auf die Marktkapitalisierung vergleichbaren Wertpapiers im Beobachtungszeitraum approximiert und auf diese Weise der Size-Effekt berücksichtigt. 29 In deutschen IPO-Studien wurde diese Vorgehensweise bisher nicht gewählt. 30 Alternativ können aus den in einem oder in mehreren Marktsegmenten einer Wertpapierbörse gehandelten Aktien auch Size-Portefeuilles gebildet werden. Die Renditen der Untersuchungswertpapiere werden in diesem
13 Fall mit den Renditen der zugeordneten Size-Portefeuilles bereinigt. Diese Vorgehensweise wenden beispielsweise Ehrhardt (997) bei der Untersuchung deutscher IPOs und Aussenegg (997) für österreichische IPOs an. 3 Da über beide zuletzt diskutierten Formen der Bereinigung zur Zeit nur wenige gesicherte Erkenntnisse vorliegen, sollen sie im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht weiter verfolgt werden Berechnung des Durchschnittswertes Bei der Bestimmung von Durchschnittswerten ist sowohl eine Mittelwertbildung über die einzelnen Wertpapiere als auch eine Kumulation über die Zeit vorzunehmen. Dabei ist es keinesfalls gleichgültig, in welcher Reihenfolge die Zeitreihen- und Querschnittsaggregationen vorgenommen werden. Unterschiedliche Reihenfolgen führen in der Regel zu unterschiedlichen Ergebnissen und unterschiedlichen portefeuillemäßigen Interpretationen. Die von Fama/Fisher/Jensen/Roll (969) vorgeschlagene Vorgehensweise findet in vielen Ereignisstudien der siebziger und achtziger Jahre und in einem Großteil der frühen Studien zur langfristigen Performance von IPO-Aktien Verwendung. Bei dieser Vorgehensweise werden in einem ersten Schritt die einzelnen monatlichen Renditen bereinigt. In einem zweiten Schritt wird für jeden Monat nach der Börseneinführung das arithmetische Mittel der bereinigten Renditen aller einbezogenen Beobachtungen berechnet. In einem dritten Schritt wird schließlich die Summe über alle Monate des Betrachtungszeitraumes gebildet, z.b. über die ersten 36 Monate nach der Börseneinführung. Formelmäßig gilt: CAR FFJR T FFJR CAR T R i, t = (2) t= i= = kumulierte Überrendite nach Fama/Fisher/Jensen/Roll (Cumulative abnormal return) bei Marktbereinigung im Zeitraum t= bis T; T M ( R t Ri ) i,, t = Rendite des IPO-Wertpapiers i im t-ten Monat nach der Börseneinführung; M R i, t = Rendite eines Vergleichsportefeuilles in Monat t, ein Schätzwert für die erwartete Rendite von Wertpapier i in Monat t. Kritisch an dieser Vorgehensweise ist vor allem die arithmetische Mittelwertbildung über die Zeit. Werden Rohrenditen arithmetisch gemittelt, so ist der errechnete Durchschnittswert höher als die wahre langfristige Rendite. Deshalb ist zu vermuten, daß auch das arithmetische Mittel von marktbereinigten Renditen höher ist als die wahre langfristige Renditedifferenz. Ein einfaches Beispiel soll diesen Effekt verdeutlichen. Steigt bei einer Aktie im ersten Monat 2
14 [ ] der Kurs von 50 auf 00 und sinkt er im zweiten Monat wieder auf 50, so ergibt sich bei einer Veränderungsrate des zur Bereinigung verwendeten Indexes von 0 % in beiden Monaten als arithmetisches Mittel der beiden (marktbereinigten) monatlichen Renditen 25 % [(+00 % - 50 %) : 2]. ur die Bildung des geometrischen Mittels der beiden Einzelrenditen würde zur korrekten Durch- + 0, 5 führen. 33 schnittsrendite von 0 % ( ) ( ) In einigen Studien des deutschen Marktes wird zudem der API-Index von Scholes (972) und Dimson/Marsh (986) verwendet. Ljungqvist (994) benutzte dieses Verfahren z.b. in der ursprünglichen Version seines Papers. Bei diesem Verfahren werden zuerst die IPO-Renditen bereinigt, dann die bereinigten Renditen über die Zeit multiplikativ kumuliert und schließlich das arithmetische Mittel über alle einbezogene Beobachtungen gebildet. Formelmäßig gilt: CAR SDM T SDM CAR T = T M ( R t R i t + ) i, i= t=, = kumulierte Überrendite nach Scholes (972) und Dimson/Marsh (986) im Zeitraum t= bis T. Dieses Verfahren sollte nach Dimson/Marsh (986) eher zum achweis der Existenz von Überrenditen als zur Messung der Höhe der tatsächlichen langfristigen Abweichungen zwischen den Renditen der untersuchten Wertpapiere und ihren Erwartungswerten verwendet werden. 34 Die multiplikative Verknüpfung über die Zeit ist die richtige Vorgehensweise, sie ähnelt der Bildung des geometrischen Mittels und führt in unserem einfachen Beispiel zur korrekten bereinigten Durchschnittsrendite von 0 %. Ein anderes Beispiel zeigt aber, daß auch die Verwendung dieses Verfahrens für die Beurteilung der langfristigen Performance der IPO-Aktien problematisch sein kann. Der Kurs eines IPO-Wertpapiers (Kurs = 00) verändert sich innerhalb von zwei Perioden nicht. Der zur Approximation des Erwartungswertes verwendete Index fällt in der ersten Periode von 00 auf 90 (-0 %) und steigt in der zweiten Periode von 90 auf 99 (+0%). Für die Renditeberechnung ergibt sich dann: Rendite des IPO-Wertpapiers: (,0,0) - = 0,00 = 0 %; Änderungsrate des Indexes: (0,9,) - = -0,0 = - %; Überrendite (SDM-Methode): (,0-0,9 +) (,0 -, +) - = -0,0 = - %. Obwohl die Rendite des IPO-Wertpapiers um einen Prozentpunkt über der Änderungsrate des Indexes liegt, wird für das IPO-Wertpapier eine Underperformance von einem Prozentpunkt ausgewiesen. (3) 3
15 Das im folgenden dargestellte, von Ritter (99) verwendete Performancemaß Wealth relative führt, ebenso wie die Varianten nach den Formeln (5), (7) und (8), auch für dieses Beispiel zum ökonomisch richtigen Ergebnis. 35 Das Wealth relative wird seitdem sehr häufig bei empirischen Untersuchungen verwendet. Dabei wird zunächst für jedes Wertpapier der Endwert einer Anlage in Höhe einer Geldeinheit nach T Monaten (z.b. nach 36 Monaten) gebildet (Wert in der Klammer im Zähler). In einem zweiten Schritt wird der durchschnittliche Endwert für alle einbezogenen Wertpapiere berechnet (Gesamtwert Zähler) und dem entsprechenden Wert für das Vergleichsportefeuille (enner) gegenübergestellt. Formelmäßig gilt: CAR WR CAR T W i, T M W i, T T ( Ri, t + ) T M ( Ri, t + ) i= t= WR i= t= i= T = = i= W W i, T M i, T = Wealth relative nach Ritter (99) für den Zeitraum t= bis t=t; = Endwert zum Zeitpunkt T einer Kapitalanlage von einer Geldeinheit in Aktie i zum ersten Monatsschlußkurs nach der otizaufnahme (t=); = Endwert zum Zeitpunkt T einer Kapitalanlage von einer Geldeinheit in t= in ein Vergleichsportefeuille für Aktie i. Als Hauptvorteil des Wealth-relative-Verfahrens wird angesehen, daß Endwerte für alternative Anlagestrategien einander gegenübergestellt werden (hier: Anlage in IPO-Wertpapiere und Vergleichsportefeuille). Dieses Ziel wäre auch mit der Formel CAR WR CAR T WR( a) T ( a) = W W i, T M i= i, T = ungewichteter Durchschnitt firmenspezifischer Wealth relatives für den Zeitraum t= bis T. erreichbar, in der die firmenspezifischen Wealth-relative-Terme arithmetisch gemittelt werden. Der ungewichtete Durchschnitt der firmenspezifischen Wealth relatives (Gleichung 5) gibt an, das Wievielfache des Endwertes des Vergleichsportefeuilles der Anleger im Schnitt erzielt hätte, der bei einer Börseneinführung jeweils am ersten Börsentag eine Geldeinheit in die IPO-Aktie investiert hätte. 36 Eine Umformung des ursprünglich von Ritter (99) vorgeschlagenen Wealth relatives (Gleichung 4) zeigt, daß bei dieser Vorgehensweise die firmenspezifischen Wealth-relative-Terme mit dem zugehörigen Endwert des Vergleichsportefeuilles gewichtet werden: (4) (5) 4
16 CAR WR T = W W i, T M i= i, T M W i, T W i= M i, T (6) Firmenspezifische Wealth-relative-Terme, die größer sind als der Durchschnitt aller firmenspezifischen Wealth-relative-Terme, werden damit in Gleichung (4) implizit mit einem Faktor größer eins, solche, die kleiner sind als der genannte Durchschnitt, mit einem Faktor kleiner eins gewichtet. Ein ökonomischer Grund für diese implizite, vom zugehörigen Endwert des Vergleichsportefeuilles abhängige Gewichtung ist nicht bekannt. Deshalb erscheint uns aus Gründen einer einfachen Interpretation die Performancemessung nach Gleichung (5) sinnvoller. Zusätzlich spricht für eine Performancemessung nach Gleichung (5), daß die aus den Termen W, / W, gebildete Standardabweichung eine natürliche Basis für Signifikanztests darstellen. 37 Ljungqvist (997) wandelt das Rittersche Wealth-relative-Verfahren ohne Begründung dadurch ab, daß er die Terme (R i,t +) bzw. ( R M i, t + ) logarithmiert, dann über alle t summiert und anschließend das arithmetische Mittel über alle Börseneinführungen bildet. Das derartig berechnete arithmetische Mittel der logarithmierten firmenspezifischen Wealth relatives ist äquivalent mit dem geometrischen Mittel der zugrundeliegenden firmenspezifischen nicht logarithmierten Wealth relatives, wie eine einfache Umformung zeigt: i T M i T CAR LQ T ( ) T R i, t + M t ln( R i, t ) ln( R i, t ) = = ln + + = T i= t= i= ( R + ) T t= M i, t (7) Geometrische Mittelwerte sind stets geringer als die entsprechenden arithmetischen Mittelwerte, wobei der Unterschied von der Streuung der gemittelten Werte abhängt. Diese ist im betrachteten Fall sehr groß. Die hohen negativen Werte für die langfristige Überrendite bei Ljungqvist (997) könnten zumindest teilweise durch die gewählte Vorgehensweise verursacht werden. In mehreren Studien wird vorschlagen, statt des Quotienten die Differenz der Endwerte zu verwenden. Cusatis/Miles/Woolridge (993) bezeichnen diese Differenz (Formel 8) als Adjusted return auf Basis einer Buy-and-hold investment strategy, in den neuesten Arbeiten hat sich die Bezeichnung Buyand-hold abnormal returns (BHARs) durchgesetzt. 38 Diese Vorgehensweise zeichnet sich zudem dadurch aus, daß sie einzelne Beobachtungen nicht gewichtet. Mit diesem Performancemaß wird die durchschnittliche Differenz der Endwerte einer Kapitalanlage in IPO-Wertpapiere und des Anlegens ins Vergleichsportefeuille von einer Geldeinheit ermittelt. 39 Formelmäßig gilt: 5
17 CAR BHAR T = T i= t= R i, t + T i= t= R M i, t + = M ( W T Wi ) i,, T i=. (8) Die Höhe der berechneten Überrenditen zwischen CAR WR und CAR BHAR dürfte sich bei kleinen CAR WA nur geringfügig unterscheiden, wobei CAR WR stets weiter von eins entfernt ist als CAR BHAR. 40 II. Empirische Ergebnisse. Ausländische Kapitalmärkte Die in Abschnitt B diskutierten Underpricing-Modelle enthalten implizit die Annahme, daß die am Tag der Börseneinführung erzielten positiven Emissionsrenditen nicht durch negative Überrenditen in den folgenden Monaten korrigiert werden. Eine Reihe von empirischen Untersuchungen für den US-amerikanischen Kapitalmarkt kommen zum Ergebnis, daß IPO-Aktien nach der Börseneinführung im Durchschnitt negative Überrenditen erzielen. 4 Auch Studien für Finnland, Frankreich und Österreich liefern ähnliche Untersuchungsresultate. 42 Werden die Ergebnisse der Tabelle 4 jedoch genauer betrachtet, so fällt auf, daß die durchschnittliche Renditeentwicklung von IPO-Aktien in der ersten 36 Monaten für die einzelnen untersuchten Kapitalmärkte sehr unterschiedlich ist. So ist für den britischen Kapitalmarkt die Underperformance von IPO-Aktien deutlich geringer als in den vorher genannten Ländern. 43 In einer Studie für den schweizerischen Kapitalmarkt wird im Durchschnitt eine leicht negative, aber nicht signifikante Überrendite ausgewiesen. 44 In einigen anderen Ländern sind die langfristigen Überrenditen im Durchschnitt fast neutral oder sogar positiv. 45 [ungefähr hier Tabelle 4 einfügen] In den letzten Jahren wurde die von Ritter (99) berechnete stark negative Überrendite US-amerikanischer IPO-Aktien intensiv untersucht. Loughran/ Ritter (995) vermuten aufgrund ihrer Untersuchungsergebnisse, daß die langfristigen negativen Überrenditen von IPO-Aktien Bestandteil eines sogenannten ew issues puzzle sind, da Aktien bereits börsennotierter Unternehmen nach der Durchführung weiterer Kapitalerhöhungen ebenfalls hohe negative Überrenditen aufweisen. 46 Vielversprechend für die Erklärung langfristiger IPO-Renditen sind vor allem die Untersuchungsergebnisse von Brav/Gompers (997). Sie zeigen mit einem fast identischen Datensample, daß die von Loughran/Ritter (995) ausgewiesene stark negative Überrendite von US-amerikanischen IPO-Aktien vorwiegend von Unternehmen mit einer geringen Marktkapitalisierung und einem 6
18 geringen Buchwert/Marktwert-Verhältnis verursacht wird. 47 Sie schlußfolgern: These results indicate that IPO underperformance is not an issuing firm effect. It is a small, low book-to-market effect. 48 Brav/Gompers (997) vermuten, daß vor allem bei Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung die tatsächlichen von den prognostizierten Gewinnen abweichen. Zudem könnten individuelle (zu optimistische) Erwartungen der Anleger die Preisbildung der Aktien dieser Unternehmen stärker beeinflussen und zu nachträglichen Preiskorrekturen führen. Die Hypothese, daß die Gewinnerwartungen bestimmter Gruppen von IPO-Unternehmen von Anlegern zu optimistisch einschätzt werden, findet auch durch die Studie von Teoh/Welch/ Wong (997) Unterstützung. Die Autoren zeigen, daß IPO-Unternehmen, die im Vorfeld der Börseneinführung in einem stärkeren Umfang Bilanzmaßnahmen durchführen und Ansatz- und Bewertungswahlrechte wahrnehmen, in den ersten drei Jahren der Börsennotierung im Durchschnitt Überrenditen von - 25 % erzielen. 49 Die bisherigen Studien deuten also darauf hin, daß firmenspezifische Effekte bei der Erklärung langfristiger Überrenditen eine wichtige Rolle spielen. 2. Deutscher Kapitalmarkt Für den deutschen Kapitalmarkt wurde zunächst in einer Reihe von Studien mit relativ wenigen Beobachtungen die langfristige Performance für Betrachtungszeiträume zwischen 2 und 24 Monaten berechnet. Diese Untersuchungen deuten zunächst ebenfalls auf eine langfristige Underperformance von IPO- Wertpapieren hin. 50 euere Untersuchungen von Ljungqvist (997, 994), 5 Ehrhardt (997) und Kaserer (996) stützen sich auf eine größere Zahl von Beobachtungen. Ein Vergleich der Ergebnisse wird dadurch erleichtert, daß in diesen Studien langfristige Überrenditen jeweils für die ersten 36 Monate nach der Börseneinführung berechnet werden. Bei der Betrachtung der vorgelegten Ergebnisse fällt auf, daß diese sich auf den ersten Blick deutlich voneinander unterscheiden (vgl. Tabelle 5). So kommt Ljungqvist (997) beispielsweise zum Ergebnis, daß die kumulierte marktbereinigte Überrendite bei Verwendung des DAFOX nach 36 Monaten -2, % (t-wert = -2,6) beträgt, Ehrhardt (997) schätzt diese Überrendite bei seinem fast identischen Vergleichsportefeuille auf +5,45 % (t-wert = 0,9), Kaserer (996) kommt bei einer Bereinigung mit dem DAX auf einen Wert von -7,99 % (t-wert = -,44). Auffallend ist auch, daß die berechneten Durchschnittswerte bei Ljungqvist (997) statistisch signifikant sind, bei Ehrhardt (997) und Kaserer (996) hingegen nicht. Ljungqvist (997) verweist zudem darauf, daß die berechneten Durchschnittswerte im 7
19 Zeitablauf stark schwanken. Für den Zeitraum 970 bis 987 berechnet Ljungqvist (997) einen Durchschnittswert von -,8 %, für 988 bis 990 einen Wert von -27,2 %. 52 Unterschiede für die Zeit vor 988 und danach ergeben sich auch bei unseren Untersuchungen. Die durchschnittliche langfristige Überrendite unter Verwendung eines marktwertgewichteten Vergleichsportefeuilles beträgt 6, % ( ) bzw. -3,5 % ( ). Als mögliche Gründe für diese beträchtlichen Unterschiede kommen in Frage: unterschiedliche Betrachtungszeiträume; eine unterschiedliche Sampleabgrenzung, insbesondere bezüglich der PM- Emissionen; unterschiedliche Vergleichsportefeuilles; unterschiedliche Berechnungszeiträume der Renditen (tägliche vs. monatliche Renditen); unterschiedliche Annahmen über die implizite Einkommensteuerbelastung von Anlegern; unterschiedliche Formeln zur Berechnung des Wealth relative; Rechen- bzw. Datenfehler. Diese Gründe sollen im folgenden diskutiert werden. Zusätzlich werden eigene Berechnungen vorgelegt, in denen methodisch die gleiche Vorgehensweise wie bei Ehrhardt (997) gewählt wird, aber zusätzlich die Börseneinführungen der Jahre 99 und 992 in die Untersuchung einbezogen werden. 53 [ungefähr hier Tabelle 5 einfügen] Die Unterschiede zwischen den Betrachtungszeiträumen dürften sich in diesem Zusammenhang nur geringfügig auf die Höhe der berechneten Überrenditen auswirken. So registrierte Ehrhardt (997) für den Zeitraum 960 bis 982 lediglich 9 Börseneinführungen, wovon sechs auf den Zeitraum 960 bis 969 entfielen. Eine unterschiedliche sachliche Abgrenzung des Datensamples führt aufgrund der sieben beobachteten Konkursfälle von Unternehmen, deren Aktien von der Portfolio Management GmbH an der Börse eingeführt wurden, hingegen zu einer erheblichen Beeinflussung der berechneten Überrenditen. Kaserer (996) bezieht PM-Emissionen ein, Ehrhardt (997) und Ljungqvist (994) schließen sie aus. Ljungqvist (997) differenziert zwischen beiden Fällen. In Ljungqvists (997) Studie wird festgestellt, daß bei Einbeziehung von PM-Emissionen die langfristige kumulierte Überrendite von IPO-Aktien im Durchschnitt um 7,74 8
20 Prozentpunkte sinkt. 54 Wird das Untersuchungsergebnis von Kaserer (996) um diesen Wert korrigiert, so ergibt sich eine ökonomisch fast neutrale Performance. Dies bedeutet, daß die Untersuchungsergebnisse von Ehrhardt (997) und Kaserer (996) nach Ausschluß der PM-Emissionen weitgehend übereinstimmen. Die verbleibenden Unterschiede könnten möglicherweise durch den Size-Effekt verursacht werden, da Kaserer (996) zur Bereinigung der IPO- Renditen die Änderungsrate des DAX verwendet. Auch eine Berechnung auf Basis täglicher (Ljungqvist u.a.) oder monatlicher Renditen (Ehrhardt u.a.) scheint keinen wesentlichen Einfluß auf die Untersuchungsergebnisse zu haben, da die zeitlichen Unterschiede bei der Wiederanlage von Wertpapiererträgen in die jeweilige IPO-Aktie und daraus resultierende Zinseszinseffekte vergleichsweise gering sind. Ebenso dürften unterschiedliche Annahmen über die implizite Einkommensteuerbelastung der Anleger bei Verwendung des Konzeptes marktbereinigter Renditen keine Rolle spielen. Die bisher geführte Diskussion deutet an, daß die Unterschiede in den Untersuchungsergebnissen von Ljungqvist (997) und Ehrhardt (997) vor allem auf die Verwendung des geometrischen Mittels bei Ljungqvist (997) zurückzuführen sind. Zusätzlich könnte auch die Qualität der zur Berechnung der unbereinigten Renditen der IPO-Aktien zugrundegelegten Daten von Bedeutung sein. Werden bei der Berechnung der IPO-Renditen nicht alle Bereinigungsfälle (Dividenden, Bezugsrechte, Gratisaktien) einbezogen, so werden die Renditen zu niedrig ausgewiesen. Als Folge entsteht eine Tendenz zur Underperformance, wobei zudem denkbar ist, daß sich durch Zinseszinseffekte die Underperformance noch verstärkt. 55 Unsere vergleichenden Betrachtungen zur langfristigen Renditeentwicklung von IPO-Aktien basieren auf Berechnungen, bei denen die Rendite der IPO- Aktien mit einem marktwertgewichteten Vergleichsportefeuille aller in Frankfurt amtlich notierten Aktien bereinigt wird. In Abschnitt C.I. wurde bereits darauf hingewiesen, daß eine Marktwertgewichtung der Renditen der im Vergleichsportefeuille enthaltenen Aktien möglicherweise eine Verzerrung der Überrenditen nach oben ergibt. Erfolgt die Bereinigung mit dem ungewichteten Durchschnitt der Renditen dieser Aktien, so wird eine negative Überrendite von -5,04 % (t-wert = -0,9) im Untersuchungszeitraum ermittelt. Dieser leicht negative, aber nicht signifikante Durchschnittswert liegt deutlich unter dem vorher berechneten Wert von,54 % (t-wert = 0,4) bei der Bereinigung mit dem marktwertgewichteten Vergleichsportefeuille. Von der Art der Aktien im Vergleichsportefeuille und ihrer Gewichtung scheint also ein wich- 9
21 tiger Einfluß auf die Berechnungsergebnisse auszugehen. Dieser Einfluß sollte in zukünftigen Untersuchungen zur langfristigen Aktienperformance verstärkt untersucht werden. [ungefähr hier Abbildung 2] Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die durchschnittliche Überrendite von IPO-Aktien in den ersten 36 Monaten nach der Börseneinführung besser ist, als bisher für den deutschen Kapitalmarkt angenommen wurde. Im internationalen Vergleich stellt sich die Renditeentwicklung deutscher IPO-Aktien positiv dar. D. Zusammenfassung, offene Probleme Wichtige Ergebnisse dieser Untersuchung sind:. Am deutschen Kapitalmarkt war die Emissionsrendite im Zeitraum 960 bis 995 ökonomisch und statistisch signifikant positiv. Der Durchschnittswert von 5,79 % über alle 222 einbezogenen Börseneinführungen wird stark von einigen wenigen Fällen bestimmt, bei denen die Emissionsrendite 00 % übersteigt (vgl. Abbildung ). Solche Fälle traten zu Beginn der Betrachtungsperiode häufiger auf und hingen oft mit Börseneinführungen zusammen, die in den ungeregelten Freiverkehr erfolgten und/oder von der Firma Portfolio Management begleitet wurden. Da die Emissionsrendite nur selten negativ war, ist die Häufigkeitsverteilung der Emissionsrendite stark schief. 2. Vor 987 ist ein starkes Absinken der Emissionsrenditen im Zeitablauf zu beobachten. ach 987 sind die durchschnittlichen Emissionsrenditen im amtlichen Handel und im geregelten Markt relativ niedrig (7,64 bzw. 8,35 %). 3. Die stark unterschiedlichen Werte für die durchschnittliche Emissionsrendite in anderen Studien (9,22 % bis 32, %) resultieren daraus, daß unterschiedliche Zeitperioden untersucht und in einigen Untersuchungen die PM-Emissionen bzw. die des ungeregelten Freiverkehrs einbezogen werden, in anderen nicht. 4. In der vorliegenden Untersuchung konnten wir für deutsche IPO-Aktien in den ersten 36 Monaten der Börsennotierung bei Zugrundelegung eines gleichgewichteten Portefeuilles aller in Frankfurt amtlich notierten Aktien als Vergleichsgröße eine leicht negative, aber statistisch nicht signifikante Überrendite von -5,04 % berechnen, bei Zugrundelegung eines marktwertgewichteten Portefeuilles dieser Aktien eine leicht positive, ebenfalls nicht signifikante Überrendite von insgesamt,54 %. Auf einem effizienten Ka- 20
22 pitalmarkt sollte diese Überrendite null betragen. Die Renditen deutscher IPO-Aktien liegen somit beträchtlich näher am theoretischen Wert, als nach den bisher vorliegenden Untersuchungsergebnissen für den deutschen Markt angenommen werden konnte. Die Unterschiede bei den langfristigen Durchschnittsrenditen deutscher und US-amerikanischer IPO-Aktien hängen vermutlich damit zusammen, daß in den USA der Anteil sehr kleiner und sehr junger Unternehmen an der Gesamtheit der Börseneinführungen wesentlich höher ist. 5. Ähnlich wie bei den Emissionsrenditen sind die Berechnungswerte für die langfristige Durchschnittsrendite von der Wahl der Zeitperiode und von der Einbeziehung des ungeregelten Freiverkehrs bzw. der PM-Emissionen abhängig. Zusätzlich wirken sich die Datenqualität sowie die gewählte Form der Zeitreihen- und Querschnittsaggregation stark auf das Ergebnis aus. 6. Der nur unwesentlich von null verschiedene Wert für die langfristige Rendite nach Börseneinführungen läßt erhebliche Zweifel an der Hypothese aufkommen, daß die ersten Kurse von neu eingeführten Unternehmen im Schnitt die jeweiligen wahren Werte übersteigen. Das deutliche Abfallen der Emissionsrendite bis Mitte der achtziger Jahre stärkt die Vermutung, daß die Konkurrenz um Konsortialführungen seitdem stark zugenommen hat. In diesem Zusammenhang ist auch das Zusammenspiel zwischen dem Underpricing und der an die Banken zu zahlenden Übernahme- und Plazierungsprovisionen zu beachten. Vermutlich sind auch für Deutschland Erklärungsansätze von zentraler Bedeutung, die positive Emissionsrenditen mit Informationsasymmetrien zwischen den verschiedenen, an einer Börseneinführung beteiligten Gruppen von Marktteilnehmern (Emittenten, Banken, institutionelle und private Anleger) begründen. Zur Überprüfung der letztgenannten Erklärungsansätze wären Querschnittsuntersuchungen, bei denen die Emissionsrenditen mit relevanten Unternehmensund Kapitalmarkteigenschaften in Verbindung gebracht werden, eine nächste wichtige Stufe der Analyse. Unsere in Abschnitt B vorgestellten Erfahrungen deuten allerdings an, daß in Deutschland hierzu zu wenig Daten vorliegen bzw. die Daten nicht die erforderliche Stabilität im Zeitablauf besitzen. Bei der langfristigen Renditeentwicklung wurde insbesondere die Kumulation der Einzelrenditen im Zeitablauf und die Mittelwertbildung über die einbezogenen Wertpapiere ausführlich diskutiert sowie die Stärken und Schwächen der unterschiedlichen Verfahren aufgezeigt. ur am Rande wurde das Problem erörtert, ob mit der Rendite von Vergleichswertpapieren oder Vergleichsportefeuilles bereinigt und wie gegebenenfalls das Vergleichsportefeuille gebildet 2
Der Januar-Effekt in der Schweiz
 Der Januar-Effekt in der Schweiz Bachelorarbeit in Banking & Finance Universität Zürich Institut für Banking & Finance Prof. Dr. Alexander F. Wagner vorgelegt von: Daniel Brändli Ort, Abgabedatum: Zürich,
Der Januar-Effekt in der Schweiz Bachelorarbeit in Banking & Finance Universität Zürich Institut für Banking & Finance Prof. Dr. Alexander F. Wagner vorgelegt von: Daniel Brändli Ort, Abgabedatum: Zürich,
Das empirische Phänomen des Underpricing im Rahmen von Aktienerstmissionen
 Das empirische Phänomen des Underpricing im Rahmen von Aktienerstmissionen Underpricing als ein empirisches Phänomen? Land Stichprobengröße Zeitraum durchschnittliche IPO Rendite in % Quelle Australien
Das empirische Phänomen des Underpricing im Rahmen von Aktienerstmissionen Underpricing als ein empirisches Phänomen? Land Stichprobengröße Zeitraum durchschnittliche IPO Rendite in % Quelle Australien
IV. Würdigung im Hinblick auf Bewertungsgutachten 1. Empirische Untersuchung zu Beta-Faktoren
 1. Empirische Untersuchung zu Beta-Faktoren Untersuchungsgegenstand: Inputparameter: Prüfung statistische Validität: Darstellung Ergebnisse: Erklärungsansätze: Güte und Einflussfaktoren der Beta- Faktoren
1. Empirische Untersuchung zu Beta-Faktoren Untersuchungsgegenstand: Inputparameter: Prüfung statistische Validität: Darstellung Ergebnisse: Erklärungsansätze: Güte und Einflussfaktoren der Beta- Faktoren
IPOs an der Frankfurter-Wertpapier-Börse. Kritische Analyse des Underpricing-Phänomens
 Wirtschaft Irini Varvouzou IPOs an der Frankfurter-Wertpapier-Börse. Kritische Analyse des Underpricing-Phänomens Masterarbeit FOM Hochschule für Oekonomie & Management Studienzentrum Essen Master-Thesis
Wirtschaft Irini Varvouzou IPOs an der Frankfurter-Wertpapier-Börse. Kritische Analyse des Underpricing-Phänomens Masterarbeit FOM Hochschule für Oekonomie & Management Studienzentrum Essen Master-Thesis
Übung 3 zu Financial Management SoSe 2013
 Übung 3 zu Financial Management SoSe 2013 Eigenkapital: IPO, Underpricing, SEO. Meik Scholz Prof. Dr. Martin Ruckes KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der
Übung 3 zu Financial Management SoSe 2013 Eigenkapital: IPO, Underpricing, SEO. Meik Scholz Prof. Dr. Martin Ruckes KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum in der
Kapitel 2. Mittelwerte
 Kapitel 2. Mittelwerte Im Zusammenhang mit dem Begriff der Verteilung, der im ersten Kapitel eingeführt wurde, taucht häufig die Frage auf, wie man die vorliegenden Daten durch eine geeignete Größe repräsentieren
Kapitel 2. Mittelwerte Im Zusammenhang mit dem Begriff der Verteilung, der im ersten Kapitel eingeführt wurde, taucht häufig die Frage auf, wie man die vorliegenden Daten durch eine geeignete Größe repräsentieren
Das Problem signifikanter Betaschätzungen
 Das Problem signifikanter Betaschätzungen Bachelorarbeit Münchener Forschungspreis für 2. Dezember 2010 Gliederung 1. Problemstellung 2. Praktische Anwendung des Beta-Konzepts 3. Theoretische Grundlagen
Das Problem signifikanter Betaschätzungen Bachelorarbeit Münchener Forschungspreis für 2. Dezember 2010 Gliederung 1. Problemstellung 2. Praktische Anwendung des Beta-Konzepts 3. Theoretische Grundlagen
Erwartungswert, Varianz, Standardabweichung Kl./9I
 usammengesetzte ufallsexperimente lasse Erwartungswert, Varianz, Standardabweichung l./i Erwartungswert Seite 33 a) Ergebnis Ausgaben Einnahmen Gewinn(+)/ Verlust(-) rr 3,00,50-0,50 rw,50,50 +,00 wr,50,50
usammengesetzte ufallsexperimente lasse Erwartungswert, Varianz, Standardabweichung l./i Erwartungswert Seite 33 a) Ergebnis Ausgaben Einnahmen Gewinn(+)/ Verlust(-) rr 3,00,50-0,50 rw,50,50 +,00 wr,50,50
Bezugsrechte, IPO, Underpricing. Von Maik Schneppel
 Bezugsrechte, IPO, Underpricing Von Maik Schneppel Inhalt Einleitung Bezugsrechte IPO Underpricing Einleitung Wann werden Bezugsrechte ausgeübt? Einleitung Grundkapital wird als gezeichnetes Kapital bezeichnet
Bezugsrechte, IPO, Underpricing Von Maik Schneppel Inhalt Einleitung Bezugsrechte IPO Underpricing Einleitung Wann werden Bezugsrechte ausgeübt? Einleitung Grundkapital wird als gezeichnetes Kapital bezeichnet
STAR: Kostenstrukturen in Anwaltskanzleien 1994 und 1998
 Quelle: BRAK-Mitteilungen 2/2001 (S. 62-65) Seite 1 STAR: Kostenstrukturen in Anwaltskanzleien 1994 und 1998 Alexandra Schmucker, Institut für Freie Berufe, Nürnberg Im Rahmen der STAR-Befragung wurden
Quelle: BRAK-Mitteilungen 2/2001 (S. 62-65) Seite 1 STAR: Kostenstrukturen in Anwaltskanzleien 1994 und 1998 Alexandra Schmucker, Institut für Freie Berufe, Nürnberg Im Rahmen der STAR-Befragung wurden
Bei näherer Betrachtung des Diagramms Nr. 3 fällt folgendes auf:
 18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
Übungen (HS-2010): Urteilsfehler. Autor: Siegfried Macho
 Übungen (HS-2010): Urteilsfehler Autor: Siegfried Macho Inhaltsverzeichnis i Inhaltsverzeichnis 1. Übungen zu Kapitel 2 1 Übungen zu Kontingenz- und Kausalurteile 1 Übung 1-1: 1. Übungen zu Kapitel 2 Gegeben:
Übungen (HS-2010): Urteilsfehler Autor: Siegfried Macho Inhaltsverzeichnis i Inhaltsverzeichnis 1. Übungen zu Kapitel 2 1 Übungen zu Kontingenz- und Kausalurteile 1 Übung 1-1: 1. Übungen zu Kapitel 2 Gegeben:
Erläuterung des Vermögensplaners Stand: 3. Juni 2016
 Erläuterung des Vermögensplaners 1 Allgemeines 1.1. Der Vermögensplaner stellt die mögliche Verteilung der Wertentwicklungen des Anlagebetrags dar. Diese verschiedenen Werte bilden im Rahmen einer bildlichen
Erläuterung des Vermögensplaners 1 Allgemeines 1.1. Der Vermögensplaner stellt die mögliche Verteilung der Wertentwicklungen des Anlagebetrags dar. Diese verschiedenen Werte bilden im Rahmen einer bildlichen
Tabellenverzeichnis...12 Abbildungsverzeichnis...13 Abkürzungsverzeichnis...14 Symbolverzeichnis...15
 Adrian Hunger IPO-Underpricing und die Besonderheiten des Neuen Marktes. Eine ökonomische Analyse börsenrechtlicher Marktsegmentierung Lang-Verlag, Frankfurt am Main; Berlin, Bruxelles; New York; Oxford;
Adrian Hunger IPO-Underpricing und die Besonderheiten des Neuen Marktes. Eine ökonomische Analyse börsenrechtlicher Marktsegmentierung Lang-Verlag, Frankfurt am Main; Berlin, Bruxelles; New York; Oxford;
BARRIER-HIT-REPORT Q4 2016
 BARRIER-HIT-REPORT Q4 2016 Bonus-Zertifikate nur wenige Barriere-Bruche in Q4 2016 SmartTrade hat für 316.000 Bonus-Zertifikate die Barriere-Brüche und Barriere-Bruch-Wahrscheinlichkeiten im vierten Quartal
BARRIER-HIT-REPORT Q4 2016 Bonus-Zertifikate nur wenige Barriere-Bruche in Q4 2016 SmartTrade hat für 316.000 Bonus-Zertifikate die Barriere-Brüche und Barriere-Bruch-Wahrscheinlichkeiten im vierten Quartal
4.1. Verteilungsannahmen des Fehlers. 4. Statistik im multiplen Regressionsmodell Verteilungsannahmen des Fehlers
 4. Statistik im multiplen Regressionsmodell In diesem Kapitel wird im Abschnitt 4.1 zusätzlich zu den schon bekannten Standardannahmen noch die Annahme von normalverteilten Residuen hinzugefügt. Auf Basis
4. Statistik im multiplen Regressionsmodell In diesem Kapitel wird im Abschnitt 4.1 zusätzlich zu den schon bekannten Standardannahmen noch die Annahme von normalverteilten Residuen hinzugefügt. Auf Basis
Bewertung von Internetunternehmen seit der Dotcom-Blase 2000 im Zeitvergleich
 Universität Zürich Institut für Banking und Finance Prof. Alexander Wagner, Ph.D. Bachelor-Arbeit Bewertung von Internetunternehmen seit der Dotcom-Blase 2000 im Zeitvergleich Betreuer: Dr. Philipp Gamper
Universität Zürich Institut für Banking und Finance Prof. Alexander Wagner, Ph.D. Bachelor-Arbeit Bewertung von Internetunternehmen seit der Dotcom-Blase 2000 im Zeitvergleich Betreuer: Dr. Philipp Gamper
Grundlegende Eigenschaften von Punktschätzern
 Grundlegende Eigenschaften von Punktschätzern Worum geht es in diesem Modul? Schätzer als Zufallsvariablen Vorbereitung einer Simulation Verteilung von P-Dach Empirische Lage- und Streuungsparameter zur
Grundlegende Eigenschaften von Punktschätzern Worum geht es in diesem Modul? Schätzer als Zufallsvariablen Vorbereitung einer Simulation Verteilung von P-Dach Empirische Lage- und Streuungsparameter zur
Asset Management mit OLZ & Partners
 Asset Management mit OLZ & Partners Asset Management mit OLZ & Partners Minimum Varianz als Alternative zum kapitalgewichteten Indexieren Assets under Management in Mio. CHF OLZ & Partners Entwicklung
Asset Management mit OLZ & Partners Asset Management mit OLZ & Partners Minimum Varianz als Alternative zum kapitalgewichteten Indexieren Assets under Management in Mio. CHF OLZ & Partners Entwicklung
Statistische Tests (Signifikanztests)
 Statistische Tests (Signifikanztests) [testing statistical hypothesis] Prüfen und Bewerten von Hypothesen (Annahmen, Vermutungen) über die Verteilungen von Merkmalen in einer Grundgesamtheit (Population)
Statistische Tests (Signifikanztests) [testing statistical hypothesis] Prüfen und Bewerten von Hypothesen (Annahmen, Vermutungen) über die Verteilungen von Merkmalen in einer Grundgesamtheit (Population)
Die Performance. Double-click to Insert Picture. von Aktien und Obligationen in der Schweiz ( ): Update
 DIE PERFORMANCE Die Performance von Aktien und Obligationen in der Schweiz (1926-2016): Update Banque Pictet & Cie SA, Zürich Januar 2017 Double-click to Insert Picture Internet: www.pictet.com/langfriststudie
DIE PERFORMANCE Die Performance von Aktien und Obligationen in der Schweiz (1926-2016): Update Banque Pictet & Cie SA, Zürich Januar 2017 Double-click to Insert Picture Internet: www.pictet.com/langfriststudie
Neuemissionsresearch zum Börsengang: Ursache informationsbedingter Fehlentwicklungen oder Lösungsansatz zu deren Überwindung?
 Stefan Steib Neuemissionsresearch zum Börsengang: Ursache informationsbedingter Fehlentwicklungen oder Lösungsansatz zu deren Überwindung? Eine empirische Untersuchung von Börsengängen an den Neuen Markt
Stefan Steib Neuemissionsresearch zum Börsengang: Ursache informationsbedingter Fehlentwicklungen oder Lösungsansatz zu deren Überwindung? Eine empirische Untersuchung von Börsengängen an den Neuen Markt
Renditemuster von Aktienfonds und deren Prognosegüte für abnormale Preisreaktionen.
 Renditemuster von Aktienfonds und deren Prognosegüte für abnormale Preisreaktionen. Bachelorarbeit in Financial Economics/Banking am Institut für schweizerisches Bankwesen der Universität Zürich bei PROF.
Renditemuster von Aktienfonds und deren Prognosegüte für abnormale Preisreaktionen. Bachelorarbeit in Financial Economics/Banking am Institut für schweizerisches Bankwesen der Universität Zürich bei PROF.
Forschungsstatistik I
 Psychologie Prof. Dr. G. Meinhardt 6. Stock, TB II R. 06-206 (Persike) R. 06-321 (Meinhardt) Sprechstunde jederzeit nach Vereinbarung Forschungsstatistik I Dr. Malte Persike persike@uni-mainz.de http://psymet03.sowi.uni-mainz.de/
Psychologie Prof. Dr. G. Meinhardt 6. Stock, TB II R. 06-206 (Persike) R. 06-321 (Meinhardt) Sprechstunde jederzeit nach Vereinbarung Forschungsstatistik I Dr. Malte Persike persike@uni-mainz.de http://psymet03.sowi.uni-mainz.de/
Statistik-Klausur vom
 Statistik-Klausur vom 09.02.2009 Bearbeitungszeit: 90 Minuten Aufgabe 1 a) Ein Unternehmen möchte den Einfluss seiner Werbemaßnahmen auf den erzielten Umsatz quantifizieren. Hierfür werden die jährlichen
Statistik-Klausur vom 09.02.2009 Bearbeitungszeit: 90 Minuten Aufgabe 1 a) Ein Unternehmen möchte den Einfluss seiner Werbemaßnahmen auf den erzielten Umsatz quantifizieren. Hierfür werden die jährlichen
Statistik-Klausur vom
 Statistik-Klausur vom 27.09.2010 Bearbeitungszeit: 60 Minuten Aufgabe 1 Ein international tätiges Unternehmen mit mehreren Niederlassungen in Deutschland und dem übrigen Europa hat seine überfälligen Forderungen
Statistik-Klausur vom 27.09.2010 Bearbeitungszeit: 60 Minuten Aufgabe 1 Ein international tätiges Unternehmen mit mehreren Niederlassungen in Deutschland und dem übrigen Europa hat seine überfälligen Forderungen
Lehrstuhl für Finanzierung Universitätsprofessor Dr. Jochen Wilhelm
 Lehrstuhl für Finanzierung Universitätsprofessor Dr. Jochen Wilhelm A b s c h l u s s k l a u s u r z u r V o r l e s u n g K a p i t a l m a r k t t h e o r i e W i n t e r s e m e s t e r 1 9 9 9 / 2
Lehrstuhl für Finanzierung Universitätsprofessor Dr. Jochen Wilhelm A b s c h l u s s k l a u s u r z u r V o r l e s u n g K a p i t a l m a r k t t h e o r i e W i n t e r s e m e s t e r 1 9 9 9 / 2
2 für 1: Subventionieren Fahrgäste der 2. Klasse bei der Deutschen Bahn die 1. Klasse?
 2 für 1: Subventionieren Fahrgäste der 2. Klasse bei der Deutschen Bahn die 1. Klasse? Felix Zesch November 5, 2016 Abstract Eine kürzlich veröffentlichte These lautet, dass bei der Deutschen Bahn die
2 für 1: Subventionieren Fahrgäste der 2. Klasse bei der Deutschen Bahn die 1. Klasse? Felix Zesch November 5, 2016 Abstract Eine kürzlich veröffentlichte These lautet, dass bei der Deutschen Bahn die
Gewinnschwellen. Florian Holzapfel. Bezugspunkte beim Ausweis von Gewinnen am deutschen Aktienmarkt. Deutscher Universitäts-Verlag
 Florian Holzapfel Gewinnschwellen Bezugspunkte beim Ausweis von Gewinnen am deutschen Aktienmarkt Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Reinhart Schmidt Deutscher Universitäts-Verlag Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis
Florian Holzapfel Gewinnschwellen Bezugspunkte beim Ausweis von Gewinnen am deutschen Aktienmarkt Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Reinhart Schmidt Deutscher Universitäts-Verlag Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis
Investition und Finanzierung
 - Zusatzfolien zur Portfoliotheorie und CAPM- Portfoliotheorie Die Portfoliotheorie geht auf Harry Markowitz zurück. Sie gibt Anlegern Empfehlungen, wie sie ihr Vermögen auf verschiedenen Anlagemöglichkeiten
- Zusatzfolien zur Portfoliotheorie und CAPM- Portfoliotheorie Die Portfoliotheorie geht auf Harry Markowitz zurück. Sie gibt Anlegern Empfehlungen, wie sie ihr Vermögen auf verschiedenen Anlagemöglichkeiten
Beispiel 2 (Einige Aufgaben zu Lageparametern) Aufgabe 1 (Lageparameter)
 Beispiel (Einige Aufgaben zu Lageparametern) Aufgabe 1 (Lageparameter) 1 Ein Statistiker ist zu früh zu einer Verabredung gekommen und vertreibt sich nun die Zeit damit, daß er die Anzahl X der Stockwerke
Beispiel (Einige Aufgaben zu Lageparametern) Aufgabe 1 (Lageparameter) 1 Ein Statistiker ist zu früh zu einer Verabredung gekommen und vertreibt sich nun die Zeit damit, daß er die Anzahl X der Stockwerke
b) Bestimmen Sie die Varianz der beiden Schätzer. c) Ist ein oder sind beide Schätzer konsistent? Begründen Sie!
 Aufgabe 1 (3 + 3 + 2 Punkte) Ein Landwirt möchte das durchschnittliche Gewicht von einjährigen Ferkeln bestimmen lassen. Dies möchte er aus seinem diesjährigen Bestand an n Tieren schätzen. Er kann dies
Aufgabe 1 (3 + 3 + 2 Punkte) Ein Landwirt möchte das durchschnittliche Gewicht von einjährigen Ferkeln bestimmen lassen. Dies möchte er aus seinem diesjährigen Bestand an n Tieren schätzen. Er kann dies
Übung V Lineares Regressionsmodell
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-WiWi Michael Alpert Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Sommersemester 2007 Übung
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-WiWi Michael Alpert Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Sommersemester 2007 Übung
Die Auswirkungen der Sozialpartnerschaft auf das Wirtschaftswachstum in kleinen offenen Volkswirtschaften Kurzversion
 Prof. Dr. DDr.h.c. Friedrich Schneider Institut für Volkswirtschaftslehre Johannes Kepler Universität Linz A-4040 Linz-Auhof Die Auswirkungen der Sozialpartnerschaft auf das Wirtschaftswachstum in kleinen
Prof. Dr. DDr.h.c. Friedrich Schneider Institut für Volkswirtschaftslehre Johannes Kepler Universität Linz A-4040 Linz-Auhof Die Auswirkungen der Sozialpartnerschaft auf das Wirtschaftswachstum in kleinen
Rendite und Risiko. Burkhard Erke. Letzte Änderung: Donnerstag, 6. März Die Folien orientieren sich an John Heatons Unterrichtsmaterialien
 Rendite und Risiko Burkhard Erke Letzte Änderung: Donnerstag, 6. März 2008 Die Folien orientieren sich an John Heatons Unterrichtsmaterialien (GSB Chicago) Lernziele: Renditekonzepte und -definitionen
Rendite und Risiko Burkhard Erke Letzte Änderung: Donnerstag, 6. März 2008 Die Folien orientieren sich an John Heatons Unterrichtsmaterialien (GSB Chicago) Lernziele: Renditekonzepte und -definitionen
5.6 Empirische Wirtschaftsforschung
 5.6.0 Vorbemerkungen Literatur Winker, P. (2010): Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie. 3. Auflage. Springer. Insbesondere Kapitel 1, 4 und 10. Volltext-Download im Rahmen des LRZ-Netzes. Rinne,
5.6.0 Vorbemerkungen Literatur Winker, P. (2010): Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie. 3. Auflage. Springer. Insbesondere Kapitel 1, 4 und 10. Volltext-Download im Rahmen des LRZ-Netzes. Rinne,
Lage- und Streuungsparameter
 Lage- und Streuungsparameter Beziehen sich auf die Verteilung der Ausprägungen von intervall- und ratio-skalierten Variablen Versuchen, diese Verteilung durch Zahlen zu beschreiben, statt sie graphisch
Lage- und Streuungsparameter Beziehen sich auf die Verteilung der Ausprägungen von intervall- und ratio-skalierten Variablen Versuchen, diese Verteilung durch Zahlen zu beschreiben, statt sie graphisch
VERGLEICH DER BAUWEISEN "MASSIVBAU" VS. "LEICHTBAU" HINSICHTLICH WIRTSCHAFTS- UND ARBEITSMARKTPOLITISCHER ASPEKTE
 VERGLEICH DER BAUWEISEN "MASSIVBAU" VS. "LEICHTBAU" HINSICHTLICH WIRTSCHAFTS- UND ARBEITSMARKTPOLITISCHER ASPEKTE Eine volkswirtschaftlich-empirische Untersuchung für Niederösterreich Kurz-/Pressefassung
VERGLEICH DER BAUWEISEN "MASSIVBAU" VS. "LEICHTBAU" HINSICHTLICH WIRTSCHAFTS- UND ARBEITSMARKTPOLITISCHER ASPEKTE Eine volkswirtschaftlich-empirische Untersuchung für Niederösterreich Kurz-/Pressefassung
Statistisches Testen
 Statistisches Testen Grundlegendes Prinzip Erwartungswert Bekannte Varianz Unbekannte Varianz Differenzen Anteilswert Chi-Quadrat Tests Gleichheit von Varianzen Prinzip des Statistischen Tests Konfidenzintervall
Statistisches Testen Grundlegendes Prinzip Erwartungswert Bekannte Varianz Unbekannte Varianz Differenzen Anteilswert Chi-Quadrat Tests Gleichheit von Varianzen Prinzip des Statistischen Tests Konfidenzintervall
Teil: lineare Regression
 Teil: lineare Regression 1 Einführung 2 Prüfung der Regressionsfunktion 3 Die Modellannahmen zur Durchführung einer linearen Regression 4 Dummyvariablen 1 Einführung o Eine statistische Methode um Zusammenhänge
Teil: lineare Regression 1 Einführung 2 Prüfung der Regressionsfunktion 3 Die Modellannahmen zur Durchführung einer linearen Regression 4 Dummyvariablen 1 Einführung o Eine statistische Methode um Zusammenhänge
2. Referenzindex Allgemein: Vergleichswert; bei einem Fonds auch Referenz- oder Vergleichsindex.
 1. Aktie Mit dem Kauf einer Aktie wird der Anleger Aktionär und erhält somit einen Anteil an der Gesellschaft. Die Aktie gewährt dem Aktionär die gesetzlich und vertraglich festgelegten Rechte. Dazu gehören
1. Aktie Mit dem Kauf einer Aktie wird der Anleger Aktionär und erhält somit einen Anteil an der Gesellschaft. Die Aktie gewährt dem Aktionär die gesetzlich und vertraglich festgelegten Rechte. Dazu gehören
Sophia Schumann Hausarbeit Unternehmensplanspiel
 (A) Rentabilität und Liquidität Gegeben ist die Auftaktstrategie des Unternehmens 29 beim Unternehmensplanspiel Puten und Perlhühner. Diese soll zunächst hinsichtlich ihrer Rentabilität beurteilt werden.
(A) Rentabilität und Liquidität Gegeben ist die Auftaktstrategie des Unternehmens 29 beim Unternehmensplanspiel Puten und Perlhühner. Diese soll zunächst hinsichtlich ihrer Rentabilität beurteilt werden.
Vergleich zweier Erwartungwerte. Wir vereinfachen die Aufgabe zuerst auf einen Einflussfaktor A mit k=2 Stufen: Wir prüfen:
 Vl. 25.7.2012 I. Analyse von Effekten: Ermittlung von Unterschieden Ziel: Wir wollen folgende Fragestellungen untersuchen: Auf eine Zielgröße Y wirken mehrere, z.b. 2 Einflussfaktoren ein, hier A und B.
Vl. 25.7.2012 I. Analyse von Effekten: Ermittlung von Unterschieden Ziel: Wir wollen folgende Fragestellungen untersuchen: Auf eine Zielgröße Y wirken mehrere, z.b. 2 Einflussfaktoren ein, hier A und B.
Nachtrag Nr. 1. nach 16 Abs. 1 Wertpapierprospektgesetz der Nanogate AG, Saarbrücken, vom 11. Oktober 2006
 Nachtrag Nr. 1 nach 16 Abs. 1 Wertpapierprospektgesetz der Nanogate AG, Saarbrücken, vom 11. Oktober 2006 zum Wertpapierprospekt vom 27. September 2006 betreffend das öffentliche Angebot von bis zu 400.000
Nachtrag Nr. 1 nach 16 Abs. 1 Wertpapierprospektgesetz der Nanogate AG, Saarbrücken, vom 11. Oktober 2006 zum Wertpapierprospekt vom 27. September 2006 betreffend das öffentliche Angebot von bis zu 400.000
Klassifikation von Signifikanztests
 Klassifikation von Signifikanztests nach Verteilungsannahmen: verteilungsabhängige = parametrische Tests verteilungsunabhängige = nichtparametrische Tests Bei parametrischen Tests werden im Modell Voraussetzungen
Klassifikation von Signifikanztests nach Verteilungsannahmen: verteilungsabhängige = parametrische Tests verteilungsunabhängige = nichtparametrische Tests Bei parametrischen Tests werden im Modell Voraussetzungen
BARRIER-HIT-REPORT Q3 2016
 BARRIER-HIT-REPORT Q3 2016 SmartTrade hat für 315.000 Bonus-Zertifikate die Barriere-Brüche und Barriere-Bruch-Wahrscheinlichkeiten im dritten Quartal 2016 (Q3) untersucht. Die Auswertung beinhaltet sämtliche
BARRIER-HIT-REPORT Q3 2016 SmartTrade hat für 315.000 Bonus-Zertifikate die Barriere-Brüche und Barriere-Bruch-Wahrscheinlichkeiten im dritten Quartal 2016 (Q3) untersucht. Die Auswertung beinhaltet sämtliche
Überschrift. Titel Prognosemethoden
 Überschrift Prognosemethoden Überschrift Inhalt 1. Einleitung 2. Subjektive Planzahlenbestimmung 3. Extrapolierende Verfahren 3.1 Trendanalyse 3.2 Berücksichtigung von Zyklus und Saison 4. Kausale Prognosen
Überschrift Prognosemethoden Überschrift Inhalt 1. Einleitung 2. Subjektive Planzahlenbestimmung 3. Extrapolierende Verfahren 3.1 Trendanalyse 3.2 Berücksichtigung von Zyklus und Saison 4. Kausale Prognosen
Statistische Randnotizen
 Landkreis /Weser Februar 08 Stabsstelle Regionalentwicklung Az.: 12.01.20 Statistische Randnotizen Geburtenziffern im Landkreis /Weser und den anderen Kreisen im Bezirk Hannover Einleitung Kenntnis über
Landkreis /Weser Februar 08 Stabsstelle Regionalentwicklung Az.: 12.01.20 Statistische Randnotizen Geburtenziffern im Landkreis /Weser und den anderen Kreisen im Bezirk Hannover Einleitung Kenntnis über
4.2 Grundlagen der Testtheorie
 4.2 Grundlagen der Testtheorie Januar 2009 HS MD-SDL(FH) Prof. Dr. GH Franke Kapitel 5 Vertiefung: Reliabilität Kapitel 5 Vertiefung: Reliabilität 5.1 Definition Die Reliabilität eines Tests beschreibt
4.2 Grundlagen der Testtheorie Januar 2009 HS MD-SDL(FH) Prof. Dr. GH Franke Kapitel 5 Vertiefung: Reliabilität Kapitel 5 Vertiefung: Reliabilität 5.1 Definition Die Reliabilität eines Tests beschreibt
Fehler- und Ausgleichsrechnung
 Fehler- und Ausgleichsrechnung Daniel Gerth Daniel Gerth (JKU) Fehler- und Ausgleichsrechnung 1 / 12 Überblick Fehler- und Ausgleichsrechnung Dieses Kapitel erklärt: Wie man Ausgleichsrechnung betreibt
Fehler- und Ausgleichsrechnung Daniel Gerth Daniel Gerth (JKU) Fehler- und Ausgleichsrechnung 1 / 12 Überblick Fehler- und Ausgleichsrechnung Dieses Kapitel erklärt: Wie man Ausgleichsrechnung betreibt
Die wichtigsten Ergebnisse:
 SmartTrade hat für 335.000 Bonus-Zertifikate die Barriere-Brüche und Barriere-Bruch-Wahrscheinlichkeiten im zweiten Quartal 2016 untersucht. Die Auswertung beinhaltet sämtliche Produkte der zwölf größten
SmartTrade hat für 335.000 Bonus-Zertifikate die Barriere-Brüche und Barriere-Bruch-Wahrscheinlichkeiten im zweiten Quartal 2016 untersucht. Die Auswertung beinhaltet sämtliche Produkte der zwölf größten
Statistische Tests. Kapitel Grundbegriffe. Wir betrachten wieder ein parametrisches Modell {P θ : θ Θ} und eine zugehörige Zufallsstichprobe
 Kapitel 4 Statistische Tests 4.1 Grundbegriffe Wir betrachten wieder ein parametrisches Modell {P θ : θ Θ} und eine zugehörige Zufallsstichprobe X 1,..., X n. Wir wollen nun die Beobachtung der X 1,...,
Kapitel 4 Statistische Tests 4.1 Grundbegriffe Wir betrachten wieder ein parametrisches Modell {P θ : θ Θ} und eine zugehörige Zufallsstichprobe X 1,..., X n. Wir wollen nun die Beobachtung der X 1,...,
Statistik II Übung 4: Skalierung und asymptotische Eigenschaften
 Statistik II Übung 4: Skalierung und asymptotische Eigenschaften Diese Übung beschäftigt sich mit der Skalierung von Variablen in Regressionsanalysen und mit asymptotischen Eigenschaften von OLS. Verwenden
Statistik II Übung 4: Skalierung und asymptotische Eigenschaften Diese Übung beschäftigt sich mit der Skalierung von Variablen in Regressionsanalysen und mit asymptotischen Eigenschaften von OLS. Verwenden
Ihr Lotse zum perfekten Portfolio
 Ihr Lotse zum perfekten Portfolio Während die Mehrzahl der privaten, aber auch der professionellen Investoren einem perfekten Timing und der richtigen Einzelauswahl die größte Bedeutung beimessen, liefert
Ihr Lotse zum perfekten Portfolio Während die Mehrzahl der privaten, aber auch der professionellen Investoren einem perfekten Timing und der richtigen Einzelauswahl die größte Bedeutung beimessen, liefert
Tutorium Blatt 8 Offene Volkswirtschaft
 Tutorium Blatt 8 Offene Volkswirtschaft 1. Aufgabe Das einzige Gut in dieser Welt sei ein Hotdog. Ein Hotdog in den USA entspreche von seinen Produkteigenschaften exakt einem Hotdog im Euroraum. Gegeben
Tutorium Blatt 8 Offene Volkswirtschaft 1. Aufgabe Das einzige Gut in dieser Welt sei ein Hotdog. Ein Hotdog in den USA entspreche von seinen Produkteigenschaften exakt einem Hotdog im Euroraum. Gegeben
Wissenschaftlicher Fortschritt und praktische Anlagestrategie: Ein Plädoyer für passive Investments
 1 Wissenschaftlicher Fortschritt und praktische Anlagestrategie: Ein Plädoyer für passive Investments Martin T. Bohl Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Monetäre Ökonomie 2 Wissenschaftliche
1 Wissenschaftlicher Fortschritt und praktische Anlagestrategie: Ein Plädoyer für passive Investments Martin T. Bohl Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Monetäre Ökonomie 2 Wissenschaftliche
Die Regressionsanalyse
 Die Regressionsanalyse Zielsetzung: Untersuchung und Quantifizierung funktionaler Abhängigkeiten zwischen metrisch skalierten Variablen eine unabhängige Variable Einfachregression mehr als eine unabhängige
Die Regressionsanalyse Zielsetzung: Untersuchung und Quantifizierung funktionaler Abhängigkeiten zwischen metrisch skalierten Variablen eine unabhängige Variable Einfachregression mehr als eine unabhängige
1 Messfehler. 1.1 Systematischer Fehler. 1.2 Statistische Fehler
 1 Messfehler Jede Messung ist ungenau, hat einen Fehler. Wenn Sie zum Beispiel die Schwingungsdauer eines Pendels messen, werden Sie - trotz gleicher experimenteller Anordnungen - unterschiedliche Messwerte
1 Messfehler Jede Messung ist ungenau, hat einen Fehler. Wenn Sie zum Beispiel die Schwingungsdauer eines Pendels messen, werden Sie - trotz gleicher experimenteller Anordnungen - unterschiedliche Messwerte
Was sind Bezugsrechte und was underpricing sowie ipo? Florian Hinse 23.April 2007
 Was sind Bezugsrechte und was underpricing sowie ipo? 23.April 2007 1 Gliederung 1. Was sind Bezugsrechte? 1.1 Definition 1.2 Begriffe im Zusammenhang mit Bezugsrechten 1.3 Rechnerischer Wert der Bezugsrechte
Was sind Bezugsrechte und was underpricing sowie ipo? 23.April 2007 1 Gliederung 1. Was sind Bezugsrechte? 1.1 Definition 1.2 Begriffe im Zusammenhang mit Bezugsrechten 1.3 Rechnerischer Wert der Bezugsrechte
Statistik II. II. Univariates lineares Regressionsmodell. Martin Huber 1 / 20
 Statistik II II. Univariates lineares Regressionsmodell Martin Huber 1 / 20 Übersicht Definitionen (Wooldridge 2.1) Schätzmethode - Kleinste Quadrate Schätzer / Ordinary Least Squares (Wooldridge 2.2)
Statistik II II. Univariates lineares Regressionsmodell Martin Huber 1 / 20 Übersicht Definitionen (Wooldridge 2.1) Schätzmethode - Kleinste Quadrate Schätzer / Ordinary Least Squares (Wooldridge 2.2)
Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken Band 39
 Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken Band 39 Herausgegeben von Prof. Dr. Hermann Locarek-Junge, Dresden, Prof. Dr. Klaus Röder, Regensburg, und Prof. Dr. Mark Wahrenburg, Frankfurt Dr. Jan Lehmann
Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken Band 39 Herausgegeben von Prof. Dr. Hermann Locarek-Junge, Dresden, Prof. Dr. Klaus Röder, Regensburg, und Prof. Dr. Mark Wahrenburg, Frankfurt Dr. Jan Lehmann
Optionen. Börsennotierte Finanzanlageprodukte Optionen. Beispiel:
 bieten einerseits die Möglichkeit hochspekulative Geschäfte zu machen, andrerseits aber ist es genauso möglich zur Absicherung einzusetzen. Mit lassen sich z.b. Aktiendepots gegen Kursverluste absichern,
bieten einerseits die Möglichkeit hochspekulative Geschäfte zu machen, andrerseits aber ist es genauso möglich zur Absicherung einzusetzen. Mit lassen sich z.b. Aktiendepots gegen Kursverluste absichern,
Die Auswirkungen von Veränderungen in der Alterszusammensetzung der Migrantenfertilität auf die Erstgenerationengeburten
 3.1.3.2 Die Auswirkungen von Veränderungen in der Alterszusammensetzung der Migrantenfertilität auf die Erstgenerationengeburten Wir haben bislang stets mit einer (nicht ganz) zufällig gewählten Fertilitätsverteilung
3.1.3.2 Die Auswirkungen von Veränderungen in der Alterszusammensetzung der Migrantenfertilität auf die Erstgenerationengeburten Wir haben bislang stets mit einer (nicht ganz) zufällig gewählten Fertilitätsverteilung
Wahrscheinlichkeitsverteilungen
 Universität Bielefeld 3. Mai 2005 Wahrscheinlichkeitsrechnung Wahrscheinlichkeitsrechnung Das Ziehen einer Stichprobe ist die Realisierung eines Zufallsexperimentes. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung betrachtet
Universität Bielefeld 3. Mai 2005 Wahrscheinlichkeitsrechnung Wahrscheinlichkeitsrechnung Das Ziehen einer Stichprobe ist die Realisierung eines Zufallsexperimentes. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung betrachtet
Trim Size: 176mm x 240mm Lipow ftoc.tex V1 - March 9, :34 P.M. Page 11. Über die Übersetzerin 9. Einleitung 19
 Trim Size: 176mm x 240mm Lipow ftoc.tex V1 - March 9, 2016 6:34 P.M. Page 11 Inhaltsverzeichnis Über die Übersetzerin 9 Einleitung 19 Was Sie hier finden werden 19 Wie dieses Arbeitsbuch aufgebaut ist
Trim Size: 176mm x 240mm Lipow ftoc.tex V1 - March 9, 2016 6:34 P.M. Page 11 Inhaltsverzeichnis Über die Übersetzerin 9 Einleitung 19 Was Sie hier finden werden 19 Wie dieses Arbeitsbuch aufgebaut ist
Klausur zur Vorlesung. Finanzwirtschaft II (SS 2010) 27. Juli 2010
 Prof. Dr. Siegfried Trautmann Lehrstuhl für Finanzwirtschaft / FB 03 Johannes Gutenberg-Universität 55099 Mainz Klausur zur Vorlesung Finanzwirtschaft II (SS 2010) 27. Juli 2010 Herr/Frau Name: Vorname:
Prof. Dr. Siegfried Trautmann Lehrstuhl für Finanzwirtschaft / FB 03 Johannes Gutenberg-Universität 55099 Mainz Klausur zur Vorlesung Finanzwirtschaft II (SS 2010) 27. Juli 2010 Herr/Frau Name: Vorname:
Phillips Kurve. Einführung in die Makroökonomie. 10. Mai 2012 SS Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Phillips Kurve 10.
 Phillips Kurve Einführung in die Makroökonomie SS 2012 10. Mai 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Phillips Kurve 10. Mai 2012 1 / 23 Hintergrund 1958 stellte A. W. Phillips die Inflationsrate
Phillips Kurve Einführung in die Makroökonomie SS 2012 10. Mai 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Phillips Kurve 10. Mai 2012 1 / 23 Hintergrund 1958 stellte A. W. Phillips die Inflationsrate
) auf dem Band auf Osiris zu, während Osiris sich auf dem Weg in die Unterwelt mit der Geschwindigkeit 0.35 Schoinen pro Stunde (v 2 = 1 m s
 1 Das Rätsel vom Käfer auf dem Gummiband Die alten Ägypter glaubten angeblich, Osiris habe am Tempel in Luor ein unsichtbares Gummiband der Länge L = 1m befestigt, auf dessen Anfang er einen Scarabaeus
1 Das Rätsel vom Käfer auf dem Gummiband Die alten Ägypter glaubten angeblich, Osiris habe am Tempel in Luor ein unsichtbares Gummiband der Länge L = 1m befestigt, auf dessen Anfang er einen Scarabaeus
Kapitel VII - Konzentration von Merkmalswerten
 Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON) Lehrstuhl für Ökonometrie und Statistik Kapitel VII - Konzentration von Merkmalswerten Deskriptive Statistik Prof. Dr. W.-D. Heller Hartwig Senska Carlo Siebenschuh
Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON) Lehrstuhl für Ökonometrie und Statistik Kapitel VII - Konzentration von Merkmalswerten Deskriptive Statistik Prof. Dr. W.-D. Heller Hartwig Senska Carlo Siebenschuh
Vorlesung 3: Schätzverfahren
 Vorlesung 3: Schätzverfahren 1. Beispiel: General Social Survey 1978 2. Auswahl einer Zufallsstichprobe und Illustration des Stichprobenfehlers 3. Stichprobenverteilung eines Regressionskoeffizienten 4.
Vorlesung 3: Schätzverfahren 1. Beispiel: General Social Survey 1978 2. Auswahl einer Zufallsstichprobe und Illustration des Stichprobenfehlers 3. Stichprobenverteilung eines Regressionskoeffizienten 4.
Statistik Testverfahren. Heinz Holling Günther Gediga. Bachelorstudium Psychologie. hogrefe.de
 rbu leh ch s plu psych Heinz Holling Günther Gediga hogrefe.de Bachelorstudium Psychologie Statistik Testverfahren 18 Kapitel 2 i.i.d.-annahme dem unabhängig. Es gilt also die i.i.d.-annahme (i.i.d = independent
rbu leh ch s plu psych Heinz Holling Günther Gediga hogrefe.de Bachelorstudium Psychologie Statistik Testverfahren 18 Kapitel 2 i.i.d.-annahme dem unabhängig. Es gilt also die i.i.d.-annahme (i.i.d = independent
Seminar zur Energiewirtschaft:
 Seminar zur Energiewirtschaft: Ermittlung der Zahlungsbereitschaft für erneuerbare Energien bzw. bessere Umwelt Vladimir Udalov 1 Modelle mit diskreten abhängigen Variablen 2 - Ausgangssituation Eine Dummy-Variable
Seminar zur Energiewirtschaft: Ermittlung der Zahlungsbereitschaft für erneuerbare Energien bzw. bessere Umwelt Vladimir Udalov 1 Modelle mit diskreten abhängigen Variablen 2 - Ausgangssituation Eine Dummy-Variable
Technische Marktanalyse
 Privat- und Unternehmerkunden CIO/Investmentstrategie Technische Marktanalyse DAX - Jahresausblick 2018 DAX Nach Phasenverschiebung läuft alles nach Plan Der Technische Analyst wird sich, wie bekannt sein
Privat- und Unternehmerkunden CIO/Investmentstrategie Technische Marktanalyse DAX - Jahresausblick 2018 DAX Nach Phasenverschiebung läuft alles nach Plan Der Technische Analyst wird sich, wie bekannt sein
Größte Studie zum Thema Beitragsentwicklung bestätigt: Beiträge in PKV und GKV entwickeln sich auf gleichem Niveau
 IGES-Studie zur Beitragsentwicklung in der PKV Größte Studie zum Thema Beitragsentwicklung bestätigt: Beiträge in PKV und GKV entwickeln sich auf gleichem Niveau Ältere zahlen im Durchschnitt nicht mehr
IGES-Studie zur Beitragsentwicklung in der PKV Größte Studie zum Thema Beitragsentwicklung bestätigt: Beiträge in PKV und GKV entwickeln sich auf gleichem Niveau Ältere zahlen im Durchschnitt nicht mehr
VERBESSERUNG FREIWILLIGEN ÖFFENTLICHEN ANGEBOTS
 VERBESSERUNG des FREIWILLIGEN ÖFFENTLICHEN ANGEBOTS gemäß 4 ff Übernahmegesetz der AIRPORTS GROUP EUROPE S.À R.L. 6C, rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach Luxemburg (die "Bieterin") an die Aktionäre der
VERBESSERUNG des FREIWILLIGEN ÖFFENTLICHEN ANGEBOTS gemäß 4 ff Übernahmegesetz der AIRPORTS GROUP EUROPE S.À R.L. 6C, rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach Luxemburg (die "Bieterin") an die Aktionäre der
Lösungshinweiseshinweise zur Einsendearbeit 2 zum Kurs 41520, Banken und Börsen, SS 2008
 1 Lösungshinweise zur Einsendearbeit 2: SS 2008 Banken und Börsen, Kurs 41520 Aufgabe 1: Value at Risk a) Die UNIVERSALBANK möchte den Value at Risk als Risikokennzahl zur Messung bankspezifischer Risiken
1 Lösungshinweise zur Einsendearbeit 2: SS 2008 Banken und Börsen, Kurs 41520 Aufgabe 1: Value at Risk a) Die UNIVERSALBANK möchte den Value at Risk als Risikokennzahl zur Messung bankspezifischer Risiken
8. Statistik Beispiel Noten. Informationsbestände analysieren Statistik
 Informationsbestände analysieren Statistik 8. Statistik Nebst der Darstellung von Datenreihen bildet die Statistik eine weitere Domäne für die Auswertung von Datenbestände. Sie ist ein Fachgebiet der Mathematik
Informationsbestände analysieren Statistik 8. Statistik Nebst der Darstellung von Datenreihen bildet die Statistik eine weitere Domäne für die Auswertung von Datenbestände. Sie ist ein Fachgebiet der Mathematik
Beispiel 4 (Einige weitere Aufgaben)
 1 Beispiel 4 (Einige weitere Aufgaben) Aufgabe 1 Bestimmen Sie für die folgenden Zweierstichproben, d. h. Stichproben, die jeweils aus zwei Beobachtungen bestehen, a) den Durchschnitt x b) die mittlere
1 Beispiel 4 (Einige weitere Aufgaben) Aufgabe 1 Bestimmen Sie für die folgenden Zweierstichproben, d. h. Stichproben, die jeweils aus zwei Beobachtungen bestehen, a) den Durchschnitt x b) die mittlere
1. Einführung in die induktive Statistik
 Wichtige Begriffe 1. Einführung in die induktive Statistik Grundgesamtheit: Statistische Masse, die zu untersuchen ist, bzw. über die Aussagen getroffen werden soll Stichprobe: Teil einer statistischen
Wichtige Begriffe 1. Einführung in die induktive Statistik Grundgesamtheit: Statistische Masse, die zu untersuchen ist, bzw. über die Aussagen getroffen werden soll Stichprobe: Teil einer statistischen
Einführung in die Statistik für Wirtschaftswissenschaftler für Betriebswirtschaft und Internationales Management
 Einführung in die Statistik für Wirtschaftswissenschaftler für Betriebswirtschaft und Internationales Management Sommersemester 2013 Hochschule Augsburg Regression: 4 eindimensionale Beispiele Berühmte
Einführung in die Statistik für Wirtschaftswissenschaftler für Betriebswirtschaft und Internationales Management Sommersemester 2013 Hochschule Augsburg Regression: 4 eindimensionale Beispiele Berühmte
Meravest Capital Aktiengesellschaft Karlsruhe
 Meravest Capital Aktiengesellschaft Karlsruhe Zwischenbericht 1. Halbjahr 2012 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Der wirtschaftliche Aufschwung in Deutschland hat sich im Berichtszeitraum (1. Halbjahr
Meravest Capital Aktiengesellschaft Karlsruhe Zwischenbericht 1. Halbjahr 2012 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Der wirtschaftliche Aufschwung in Deutschland hat sich im Berichtszeitraum (1. Halbjahr
Prognoseverfahren von Michaela Simon 7.Semester Spezialisierung Finanzwirtschaft
 Prognoseverfahren von Michaela Simon 7.Semester Spezialisierung Finanzwirtschaft Inhaltsverzeichnis I. Allgemeine Aussagen II. Subjektive Planzahlenbestimmung III. Extrapolierende Verfahren 1. Trendanalyse:
Prognoseverfahren von Michaela Simon 7.Semester Spezialisierung Finanzwirtschaft Inhaltsverzeichnis I. Allgemeine Aussagen II. Subjektive Planzahlenbestimmung III. Extrapolierende Verfahren 1. Trendanalyse:
Skript zum Kurz-Referat:
 Prof. Dr. Klaus-Jürgen Tillmann/ Michael Lenz WS 2001/02 Fakultät für Pädagogik (AG 4) der Universität Bielefeld Seminar: Anlage und : Der pädagogische Streit seit den 50er-Jahren 7. Sitzung: Die Erblichkeit
Prof. Dr. Klaus-Jürgen Tillmann/ Michael Lenz WS 2001/02 Fakultät für Pädagogik (AG 4) der Universität Bielefeld Seminar: Anlage und : Der pädagogische Streit seit den 50er-Jahren 7. Sitzung: Die Erblichkeit
1) Warum ist die Lage einer Verteilung für das Ergebnis einer statistischen Analyse von Bedeutung?
 86 8. Lageparameter Leitfragen 1) Warum ist die Lage einer Verteilung für das Ergebnis einer statistischen Analyse von Bedeutung? 2) Was ist der Unterschied zwischen Parametern der Lage und der Streuung?
86 8. Lageparameter Leitfragen 1) Warum ist die Lage einer Verteilung für das Ergebnis einer statistischen Analyse von Bedeutung? 2) Was ist der Unterschied zwischen Parametern der Lage und der Streuung?
VS PLUS
 VS PLUS Zusatzinformationen zu Medien des VS Verlags Statistik II Inferenzstatistik 2010 Übungsaufgaben und Lösungen Inferenzstatistik 2 [Übungsaufgaben und Lösungenn - Inferenzstatistik 2] ÜBUNGSAUFGABEN
VS PLUS Zusatzinformationen zu Medien des VS Verlags Statistik II Inferenzstatistik 2010 Übungsaufgaben und Lösungen Inferenzstatistik 2 [Übungsaufgaben und Lösungenn - Inferenzstatistik 2] ÜBUNGSAUFGABEN
Statistik-Klausur vom
 Statistik-Klausur vom 09.02.2010 Bearbeitungszeit: 60 Minuten Aufgabe 1 a) Bei einer Umfrage unter FH-Studierenden ergaben sich die folgenden Anreisezeiten (in Min) zur FH: von... bis unter... Anzahl 0-20
Statistik-Klausur vom 09.02.2010 Bearbeitungszeit: 60 Minuten Aufgabe 1 a) Bei einer Umfrage unter FH-Studierenden ergaben sich die folgenden Anreisezeiten (in Min) zur FH: von... bis unter... Anzahl 0-20
Random Walk Theorie und Empirie
 Random Walk Theorie und Empirie Lassen sich Aktienkurse nun vorhersagen oder doch nicht? Bo Liu 04.06.2007 1 Inhaltverzeichnis 1. Definition der Random-walk 2. Fundamentalisten VS. Random walk Theorie
Random Walk Theorie und Empirie Lassen sich Aktienkurse nun vorhersagen oder doch nicht? Bo Liu 04.06.2007 1 Inhaltverzeichnis 1. Definition der Random-walk 2. Fundamentalisten VS. Random walk Theorie
Einführung Fehlerrechnung
 Einführung Fehlerrechnung Bei jeder Messung, ob Einzelmessung oder Messreihe, muss eine Aussage über die Güte ( Wie groß ist der Fehler? ) des Messergebnisses gemacht werden. Mögliche Fehlerarten 1. Systematische
Einführung Fehlerrechnung Bei jeder Messung, ob Einzelmessung oder Messreihe, muss eine Aussage über die Güte ( Wie groß ist der Fehler? ) des Messergebnisses gemacht werden. Mögliche Fehlerarten 1. Systematische
WS 2010/11. Risikomanagement II. Übung zum Thema: Value at Risk. (Lösung)
 Risikomanagement II Übung zum Thema: Value at Risk (Lösung) 1 Aufgabe 1 Erläutern Sie die Struktur der Value at Risk Risikobemessung! 2 Grundlagen: Value at Risk (VaR) Zentrales Messkonzept zur Quantifizierung
Risikomanagement II Übung zum Thema: Value at Risk (Lösung) 1 Aufgabe 1 Erläutern Sie die Struktur der Value at Risk Risikobemessung! 2 Grundlagen: Value at Risk (VaR) Zentrales Messkonzept zur Quantifizierung
Schließende Statistik
 Schließende Statistik [statistical inference] Sollen auf der Basis von empirischen Untersuchungen (Daten) Erkenntnisse gewonnen und Entscheidungen gefällt werden, sind die Methoden der Statistik einzusetzen.
Schließende Statistik [statistical inference] Sollen auf der Basis von empirischen Untersuchungen (Daten) Erkenntnisse gewonnen und Entscheidungen gefällt werden, sind die Methoden der Statistik einzusetzen.
Aufgaben. zu Inhalten der 5. Klasse
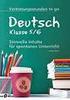 Aufgaben zu Inhalten der 5. Klasse Universität Klagenfurt, Institut für Didaktik der Mathematik (AECC-M) September 2010 Zahlbereiche Es gibt Gleichungen, die (1) in Z, nicht aber in N, (2) in Q, nicht
Aufgaben zu Inhalten der 5. Klasse Universität Klagenfurt, Institut für Didaktik der Mathematik (AECC-M) September 2010 Zahlbereiche Es gibt Gleichungen, die (1) in Z, nicht aber in N, (2) in Q, nicht
Übungsaufgaben zu Kapitel 6: Finanzmärkte und Erwartungen
 Kapitel 6 Übungsaufgaben zu Kapitel 6: Finanzmärkte und Erwartungen Übungsaufgabe 6-1a 6-1a) Welche Typen von Zinsstrukturkurven kennen Sie? Stellen Sie die Typen graphisch dar und erläutern Sie diese.
Kapitel 6 Übungsaufgaben zu Kapitel 6: Finanzmärkte und Erwartungen Übungsaufgabe 6-1a 6-1a) Welche Typen von Zinsstrukturkurven kennen Sie? Stellen Sie die Typen graphisch dar und erläutern Sie diese.
Vergleich von aktiven und passiven Investmentstrategien bei Aktienfonds
 Wirtschaft Barbara Claus Vergleich von aktiven und passiven Investmentstrategien bei Aktienfonds Bachelorarbeit Vergleich von aktiven und passiven Investmentstrategien am Beispiel von Aktienfonds Bachelor
Wirtschaft Barbara Claus Vergleich von aktiven und passiven Investmentstrategien bei Aktienfonds Bachelorarbeit Vergleich von aktiven und passiven Investmentstrategien am Beispiel von Aktienfonds Bachelor
Beurteilende Statistik
 Beurteilende Statistik Wahrscheinlichkeitsrechnung und Beurteilende Statistik was ist der Unterschied zwischen den beiden Bereichen? In der Wahrscheinlichkeitstheorie werden aus gegebenen Wahrscheinlichkeiten
Beurteilende Statistik Wahrscheinlichkeitsrechnung und Beurteilende Statistik was ist der Unterschied zwischen den beiden Bereichen? In der Wahrscheinlichkeitstheorie werden aus gegebenen Wahrscheinlichkeiten
Klausur zu Methoden der Statistik II (mit Kurzlösung) Sommersemester Aufgabe 1
 Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie der Otto-Friedrich-Universität Bamberg Prof. Dr. Susanne Rässler Klausur zu Methoden der Statistik II (mit Kurzlösung) Sommersemester 2013 Aufgabe 1 In einer Urne
Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie der Otto-Friedrich-Universität Bamberg Prof. Dr. Susanne Rässler Klausur zu Methoden der Statistik II (mit Kurzlösung) Sommersemester 2013 Aufgabe 1 In einer Urne
Garantiekosten in der Altersvorsorge 2017 Update der Garantiekostenstudie
 Garantiekosten in der Altersvorsorge 2017 Update der Garantiekostenstudie Autor der Studie Prof. Dr. Olaf Stotz Professur für Asset Management Frankfurt School of Finance & Management Sonnemannstr. 9 11
Garantiekosten in der Altersvorsorge 2017 Update der Garantiekostenstudie Autor der Studie Prof. Dr. Olaf Stotz Professur für Asset Management Frankfurt School of Finance & Management Sonnemannstr. 9 11
ZUM UMGANG MIT MESSUNSICHERHEITEN IM PHYSIKUNTERRICHT. 25. Oktober Didaktik der Physik Julia Glomski und Burkhard Priemer
 ZUM UMGANG MIT MESSUNSICHERHEITEN IM PHYSIKUNTERRICHT 25. Oktober 2010 und Burkhard Priemer Was sind Messfehler? Was ist Fehlerrechnung? Warum misst man etwas? Wann ist eine Messung gut gelaufen? 2 4 Dimensionen
ZUM UMGANG MIT MESSUNSICHERHEITEN IM PHYSIKUNTERRICHT 25. Oktober 2010 und Burkhard Priemer Was sind Messfehler? Was ist Fehlerrechnung? Warum misst man etwas? Wann ist eine Messung gut gelaufen? 2 4 Dimensionen
Die ABSOLUTE HÄUFIGKEIT einer Merkmalsausprägung gibt an, wie oft diese in der Erhebung eingetreten ist.
 .3. Stochastik Grundlagen Die ABSOLUTE HÄUFIGKEIT einer Merkmalsausprägung gibt an, wie oft diese in der Erhebung eingetreten ist. Die RELATIVE HÄUFIGKEIT einer Merkmalsausprägung gibt an mit welchem Anteil
.3. Stochastik Grundlagen Die ABSOLUTE HÄUFIGKEIT einer Merkmalsausprägung gibt an, wie oft diese in der Erhebung eingetreten ist. Die RELATIVE HÄUFIGKEIT einer Merkmalsausprägung gibt an mit welchem Anteil
