Abbildung variabel verzinslicher Produkte im Zinsbuch-Cashflow
|
|
|
- Jesko Günther
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Abbildung variabel verzinslicher Produkte im Zinsbuch-Cashflow Peter Hager Rendite-/Risiko-Analyse... 2 Abbildung unsicherer Cashflows... Optimierte Dispositionsvorschrift...7 Rendite-/Risiko-Analyse Im Rahmen der Cashflow-Generierung werden alle zinstragenden Positionen identifiziert und in das Zinsbuch einer Bank integriert. Ziel ist es, einen Cashflow zu generieren, der sämtliche relevanten Positionen berücksichtigt. Dabei sollte der Gesamtbank-Cashflow idealerweise aus den Cashflows der Einzelgeschäfte abgeleitet werden. Nicht bei allen zinstragenden Geschäften lässt sich der Grundsatz der einzelgeschäftsbezogenen Cashflow-Generierung jedoch verwirklichen. Für Festzinsgeschäfte wird zur Cashflow-Generierung die Fristenablaufbilanz ausgewertet, die für die Zinsbuchsteuerung akzeptable Ergebnisse liefert. Bei den variabel verzinslichen Geschäften mit unbekannter Kapitalbindung muss auf modelltheoretische Abbildungsvorschriften zurückgegriffen werden. Der aus den Einzelpositionen resp. Produktaggregaten erzeugte Gesamtbank-Cashflow besteht aus Nominalwerten in den jeweiligen Laufzeitbändern, aus denen ein Zahlungsstrom abgeleitet werden kann. Der Saldo der Barwerte der Aktiv- und Passivseite ergibt den Zinsbuch-Barwert, der die zentrale Steuerungsgröße für die Rendite-/Risiko-Analyse und den Steuerungsprozess bildet (vgl. Abb. ).
2 Nominal- Cashflow Laufzeit (Jahre) Aktiva Passiva Barwert der zinstragenden Aktiva Barwert der zinstragenden Passiva Barwert des Zinsbuchs Abb. : Gesamtbank-Cashflow und Barwertbilanz Alle Positionen des Zinsbuchs sind, unabhängig davon, ob es sich um Kundenoder Eigengeschäfte handelt, in gleichem Maße Zinsrisiken ausgesetzt. Für eine barwertige Zinsbuchsteuerung gilt es, die potenziellen Barwertänderungen mit Blick auf die mögliche Rendite in Gestalt der Performance und mit Blick auf das mögliche Risiko in Gestalt des Value at Risk auf den Planungshorizont zu erfassen. Das Ziel der strategischen Zinsbuchsteuerung ist es, Risiken im Zinsgeschäft bewusst einzugehen, um daraus Erträge zu generieren. Das im Zinsbuch gebundene Vermögen stellt hierbei das Risikokapital dar. Es ist eine knappe Ressource und sollte daher optimal gemanagt werden. Die integrative Sicht von Rendite und Risiko spiegelt sich in der wertorientierten Kennzahl RORAC (return on risk adjusted capital) wider. Diese Rendite-/Risiko- Kennzahl dient auch zur Beurteilung der Vorteilhaftigkeit von Zinspositionen und steht im Mittelpunkt der wertorientierten Steuerung. Sie verbindet die Performancemessung mit der Quantifizierung des Zinsrisikos (vgl. Abb. 2). 2
3 Performance Value at Risk Erwartete Barwertveränderung auf den Planungshorizont Performance Value at Risk RORAC Potenzieller Barwertverlust innerhalb der Haltedauer (= Planungshorizont der Performance-Berechnung) bei einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit Abb. 2: Integrierte Rendite-/Risikobetrachtung des Zinsbuch-Barwerts Die RORAC-Kennzahl spiegelt die Positionierung des Zinsbuchs einer Bank unter Rendite-/Risikogesichtspunkten wider. Um die Vorteilhaftigkeit der gewählten resp. aktuellen Ausrichtung des Zinsbuchs beurteilen zu können, ist ein Vergleichsmaßstab (eine Benchmark) erforderlich, die ein effizientes Marktportefeuille abbilden sollte. Die Positionierung einer Bank ist immer dann besser als die der Benchmark, wenn bei gleichem Risiko eine höhere Performance erzielt wird bzw. bei gleicher Performance ein niedrigeres Risiko eingegangen wird. Mit Hilfe der barwertigen Value at Risk-Ermittlung werden die eingegangenen Zinsrisiken offen gelegt und können anschließend limitiert werden (WIEDEMANN 2). Die Limite legen die Verlustgrenze fest und bestimmen damit die Risikoneigung der Bank in Bezug auf ihr Risikotragfähigkeitspotenzial (sowohl barwertig als auch GuV-orientiert). Der Ermittlung des Rendite-/Risikostatus des Zinsbuchs schließt sich der Steuerungsprozess an. Dieser beinhaltet die Maßnahmenplanung zur Überführung des Ist-Cashflows einer Bank in einen angestrebten Ziel-Cashflow. Hierbei gilt es, die Wirkung alternativer Steuerungsmaßnahmen sowohl aus Barwert- als auch aus GuV-Sicht zu analysieren.
4 2 Abbildung unsicherer Cashflows Das wesentliche Fundament der barwertigen Steuerung eines Zinsbuchs bildet die Datengenerierung. Eine besondere Problematik ergibt sich bei der Abbildung von Produkten mit unsicheren Cashflows. Dazu gehören sämtliche Produkte mit unbekannter Kapital- und Zinsbindung. VR-Control empfiehlt zur Generierung dieser Cashflows das Konzept der gleitenden Durchschnitte. Dieses basiert im Grundmodell auf einer Kapitalbindungs- und einer Zinsanpassungsprämisse: Kapitalbindungsprämisse: Das Gesamtvolumen der jeweiligen Produkte bleibt im Zeitablauf konstant. Zinsanpassungsprämisse: Die Marge der jeweiligen Produkte soll durch entsprechende Konstruktion einer Opportunität möglichst konstant sein. Die Kapitalbindungsprämisse stützt sich auf die Bodensatztheorie, nach der trotz permanenter Einzelverfügungen ein bestimmtes Volumen auch bei Produkten mit unsicheren Cashflows dauerhaft zur Verfügung steht. Die Zinsanpassungsprämisse strebt zu einem gegebenen Kundengeschäft die Bildung eines Opportunitätsgeschäftes an, das ein ähnliches (bestenfalls sogar identisches) Zinsanpassungsverhalten aufweist. Auf Basis dieser beiden Modellprämissen werden mittels gleitender Durchschnittszinsen Opportunitätsgeschäfte konstruiert. Die revolvierende Cashflow-Struktur der gleitenden Durchschnitte erfüllt die Forderung nach einer permanenten Prolongation der Kapitalbindung. Die gleitende Durchschnittsbildung erfüllt weiterhin den Anspruch einer trägen Zinsanpassung, die bei Kundengeschäften mit variabler Verzinsung zu beobachten ist. Das gewählte Mischungsverhältnis bestimmt den Bewertungszins und gleichzeitig die Ablauffiktion im Zinsbuch und damit auch das produktspezifische Cashflow-Profil für die Zinsbuchsteuerung. Im Grundkonzept der gleitenden Durchschnitte wird das Zinsanpassungsverhalten einer Bank mithilfe von Vergangenheitsdaten analysiert. Basierend auf der Produktzinsentwicklung in einem festgelegten Vergangenheitszeitraum werden alter-
5 native Mischungsverhältnisse aus gleitenden Durchschnittszinsen untersucht, mit dem Ziel, solche zu finden, die eine möglichst konstante Marge generieren. Da eine völlig konstante Marge kaum realistisch ist, wird die Zielfunktion durch die Bedingung einer minimalen Standardabweichung innerhalb des untersuchten Zeitraums operationalisiert. Die Weiterentwicklung des aufgezeigten Grundmodells setzt an der Frage an, ob das Mischungsverhältnis, das auf Basis der skizzierten Modellannahmen zustande gekommen ist, das Zinsanpassungsverhalten einer Bank schon hinreichend korrekt abbildet. Auch ist zu prüfen, ob es mit Blick auf die zukünftige Preispolitik im Vertrieb das einzige richtige Zinsanpassungsverhalten ist. Grundsätzlich ist auch denkbar, dass eine konstante Marge auf Basis eines Mischungsverhältnisses erzielt wird, das von dem auf Basis der historischen Daten ermittelten abweicht. Zwingend ist für die Generierung einer konstanten Marge lediglich, dass die Produktzinsanpassung durchgängig gemäß der vorgeschriebenen Dispositionsvorschrift erfolgt. Ferner ist zu beachten, dass die Standardabweichung der Marge als Maß für die Schwankung der Marge das Zinsanpassungsverhalten einer Bank lediglich in verdichteter Form widerspiegelt. Die Margenänderung erfasst gleichzeitig die Bewegung des Opportunitätszinses und die darauf folgende Reaktion des Produktzinses. Dieser Zusammenhang kann direkter auch durch eine andere Kennzahl, die Korrelation, beschrieben werden. Die Margenberechnung kann hierbei entfallen. Eine hohe positive Korrelation zwischen Opportunitäts- und Produktzinsänderung signalisiert eine gute Abbildung des Zinsanpassungsverhaltens. Demzufolge können neben dem Mischungsverhältnis mit der geringsten Standardabweichung auch Mischungsverhältnisse auf Basis der Korrelation gefunden werden, die als Dispositionsvorschriften geeignet sind und damit alternative Ablauffiktionen darstellen. Die Kombination beider Kennzahlen fächert die Bandbreite der Alternativen weiter auf. Auch bezüglich des Produktvolumens sind weitergehende Analysen erforderlich. Für eine genaue Produktkalkulation ist die Annahme eines konstanten Produktvo-
6 lumens insbesondere dann nicht ausreichend, wenn in der Praxis hohe Volumenschwankungen zu beobachten sind. Beispiele hierfür können neue oder auslaufende Produkte sein. Volumenänderungen bei Produkten mit unsicheren Cashflows lösen zwingend dispositive Maßnahmen aus, um das neue Produktvolumen weiterhin in der festgelegten revolvierenden Struktur gemäß der Ablauffiktion zu halten. Da die Volumenschwankungen nur zu aktuellen Marktzinsen und nicht zu historischen disponiert werden können, hat dies zwangsläufig Margenschwankungen zufolge. Die Margenschwankungen können sowohl zu negativen als auch zu positiven Ergebniseffekten führen. Während die negativen vermieden werden sollten, erscheint es nicht zwingend, auch die positiven zu verhindern. Darüber hinaus verkennt die ausschließliche Betrachtung der Standardabweichung als Entscheidungskriterium für die Ablauffiktion die Tatsache, dass die Mischungsverhältnisse nicht nur als Dispositionsvorschrift zur zinsrisikofreien Glattstellung der Kundengeschäfte dienen, sondern auch eine entscheidende Rolle für die Generierung des Zinsergebnisses spielen. Es ist daher erforderlich, neben den Effekten aus dem abfließenden resp. hinzukommenden Volumen das Ergebnispotenzial des gesamten Produktbestands bei der Festlegung der Ablauffiktion zu berücksichtigen. Dieser Gedanke ist konform mit dem für die barwertige Zinsbuchsteuerung definierten Ziel der optimalen Rendite-/Risikopositionierung. Aus den bisherigen Überlegungen leitet sich die Motivation ab, neben dem Mischungsverhältnis mit der geringsten Standardabweichung weitere Alternativen zu untersuchen, um zu einem Ergebnis zu kommen, das die aufgeführten Kriterien am besten berücksichtigt. Dabei werden die infrage kommenden Mischungsverhältnisse sowohl mithilfe der Standardabweichung als auch der Korrelation bewertet. Die erweiterte Analyse der Dispositionsvorschrift unter dem Aspekt des Ertragspotenzials erfordert, über die bisher angewandte ausschließliche Vergangenheitsbetrachtung hinaus, die Einbeziehung von Zukunftsszenarien für die Zinsentwicklung. Das Ziel der erweiterten Analyse ist es, eine Dispositionsvorschrift zu finden, die zukünftige Entwicklungen antizipiert und damit eine verlässliche Grundlage für die barwertige Zinsbuchsteuerung liefert. 6
7 Optimierte Dispositionsvorschrift In einem ersten Schritt ist festzulegen, wie das Spektrum der infrage kommenden Mischungsverhältnisse erweitert werden kann, wenn von dem bereits bekannten Mischungsverhältnis mit der geringsten Standardabweichung ausgegangen wird. Da die Ablauffiktion durch Kombination gleitender Durchschnitte unterschiedlicher Fristigkeiten iterativ bestimmt wird, existieren grundsätzlich beliebig viele Lösungsvarianten, die nach dem Kriterium der Standardabweichung aufsteigend geordnet werden können. Neben der Lösung mit der geringsten Standardabweichung gibt es in der Praxis noch weitere Lösungen (d.h. andere Mischungsverhältnisse), die ebenfalls eine geringe Standardabweichung aufweisen und daher grundsätzlich als gleichwertig betrachtet werden können. Praktische Erfahrungen zeigen, dass sich mindestens die ersten Mischungsverhältnisse allesamt für weitergehende Untersuchungen eignen, wenn die Gewichtsverteilung zwischen den einzelnen Zinsbindungsfristen während des Iterationsprozesses in %-Schritten erfolgt. Innerhalb dieser besten Mischungsverhältnisse liegt in aller Regelmäßigkeit auch das Mischungsverhältnis mit der höchsten Korrelation. Wird zuerst nach dem Kriterium der höchsten Korrelation sortiert, dann findet sich das Mischungsverhältnis mit der geringsten Standardabweichung ebenfalls unter den besten wieder. Da sich diese zwei Kriterien nicht gegenseitig ausschließen, wird auch deutlich, dass das Optimum in einer bestimmten Bandbreite liegt. Die gesamte Bandbreite der Mischungsverhältnisse zu analysieren, ist sicherlich nicht effektiv, denn die Optimierung liefert nur dann eindeutige Ergebnisse, wenn die untersuchten Objekte relativ heterogen sind. Wenn die Unterschiede in der Zusammensetzung der Fristen nur marginal sind, ist es schwierig, aus der Vielzahl der Mischungsverhältnisse ein eindeutiges Ergebnis zu erzielen. Neben den Mischungsverhältnissen mit der geringsten Standardabweichung und der höchsten Korrelation empfiehlt es sich, eine weitere Selektion auf dem Weg zu einer optimalen Ablauffiktion vorzunehmen. In einem zweiten Filter werden, ausgehend von den Mischungsverhältnissen mit der geringsten Standardabweichung und der höch- 7
8 sten Korrelation, weitere Konstellationen gesucht, die sich in ihrer Zusammensetzung deutlich von diesen Mischungsverhältnissen abheben. Ein Kriterium für die Auswahl im zweiten Filter kann die durchschnittliche Laufzeit des Mischungsverhältnisses sein, die über den Fristentransformationshebel entscheidet. Eine Variation der Fristentransformation schlägt sich besonders stark im Ergebnis nieder. Um die Wirkung dieser Variation aufzuzeigen, können ausgehend von dem zentralen Mischungsverhältnis mit der geringsten Standardabweichung zwei Grenzkonstellationen gewählt werden: das Mischungsverhältnis mit der kürzesten Laufzeit und das Mischungsverhältnis mit der längsten Laufzeit. Da die Ertragsperspektive das bindende Kriterium für die Optimierung der Mischungsverhältnisse darstellt, empfiehlt es sich ferner aus der Vorauswahl der Mischungsverhältnisse mit einer geringen Standardabweichung dasjenige mit der historisch höchsten Marge auszusuchen. Damit würde sich die engere Auswahl der repräsentativen Mischungsverhältnisse auf fünf verschiedene Konstellationen erstrecken. Für die Ermittlung der alternativen Dispositionsvorschriften kann das Excel-Tool Optimix eingesetzt werden (vgl. Abb. ) (CCFB CONSULTING 2a). Das Programm rechnet iterativ die relevanten Mischungsverhältnisse aus und sortiert sie anschließend nach den vorgegebenen Kriterien (Standardabweichung, Korrelation, kürzeste und längste Laufzeit, höchste Marge). Durch die Fokussierung auf eine weiterhin geringe Standardabweichung wird das historische Risikoprofil der Kundengeschäfte beibehalten. Ein Wechsel des Mischungsverhältnisses in eine völlig andere Dimension hätte ein anderes Risikoprofil zufolge. Dies sollte solange nicht angestrebt werden, wie die Vergangenheit weiterhin die Basis für die Wahl der Ablauffiktion bilden soll. Ein abrupter Wechsel des Pricing-Verhaltens könnte auf Ablehnung und Widerstand bei den Kunden stoßen und zu ungewünschten Bestandsveränderungen führen. 8
9 Abb. : Excel-Tool Optimix In einem nächsten Schritt werden die ausgewählten Mischungsverhältnisse mithilfe alternativer Marktzins- und Bestandsentwicklungsszenarien auf ihre Eignung für die Zukunft überprüft. Die aus der historischen Analyse gewonnenen Erkenntnisse können dadurch entweder verifiziert und damit bestätigt werden oder es ergeben sich Hinweise auf zukünftige Änderungen, die sich jetzt schon antizipieren lassen. Damit gibt die erweiterte Analyse mehr Planungssicherheit für den Block der variablen Geschäfte des Gesamtbank-Cashflows. Stärkere Schwankungen des Cashflow-Profils, die durch eine Veränderung der Mischungsverhältnisse zwischen zwei Auswertungsstichtagen ausgelöst würden, können damit vermindert oder sogar verhindert werden. Im Kern strebt die erweiterte Analyse folgendes Ziel an: Es soll ein optimales Mischungsverhältnis ermittelt werden, das unabhängig von der zukünftigen Produktzinsanpassung unter Berücksichtigung zukünftiger Marktzinsentwicklungen und Bestandsveränderungen ein möglichst stabiles Zinsergebnis generiert. Damit gelingt es, das Ergebnispotenzial der Kundengeschäfte mit unsicheren Cashflows 9
10 besser auszuschöpfen, ohne dass zwangsläufig höhere Risiken eingegangen werden. Das Ergebnispotenzial eines vorgegebenen Mischungsverhältnisses lässt sich durch die beiden nachfolgenden Ergebniskomponenten beschreiben: Produktspezifisches Fristentransformationsergebnis: Renditevorteile/-nachteile, die sich aus der mit dem gewählten Mischungsverhältnis (und damit zugleich der Dispositionsvorschrift) verbundenen Fristentransformation der Anlage- resp. Refinanzierungsgelder bei einer zugrunde liegenden Zinsstrukturkurve ergeben. Ausgleichszahlung: Positive resp. negative Ausgleichszahlungen, die bei Bestandsveränderungen anfallen und die die von der ermittelten Marge abweichenden Zinsüberschüsse infolge außerplanmäßiger Verfügungen erfassen. Aus dem produktspezifischen Fristentransformationsergebnis und der Ausgleichszahlung errechnet sich ein Nettoergebnis, das für das produktspezifische Ergebnispotenzial und damit auch für die Auswahl des optimalen Mischungsverhältnisses die relevante Größe darstellt. Die zukünftige Zinsentwicklung und die mögliche Bestandsveränderung sind die maßgeblichen Bewertungsparameter für das Nettoergebnis. Da diese heute noch unbekannt sind, werden sie durch eine Simulation diverser Zukunftsszenarien abgebildet. Die Prognose der Bestandsentwicklung kann z.b. aus der Bilanzstrukturplanung abgeleitet werden. Die Simulation der zukünftigen Zinsentwicklung wird mit Hilfe von Zinsentwicklungsszenarien durchgeführt. Entscheidend ist, dass bei der Auswahl der Zinsentwicklungsszenarien die Simulation die gesamte Breite möglicher Veränderungen der Zinsstrukturkurve abgreift. Damit wird eine fundierte Entscheidungsgrundlage, die frei von subjektiven Einflüssen ist, gewonnen. Das festzulegende Mischungsverhältnis soll unabhängig von der zukünftigen Zinsentwicklung gute Ergebnisse liefern. Hilfreich können hierfür auch aus der Vergangenheit abgeleitete Zinsszenarien sein.
11 Das von der ccfb Prof. Dr. Wiedemann Consulting GmbH & Co. KG entwickelte Excel-Tool Szenario-Analyse ermöglicht die Simulation der Nettoergebnisse bei alternativen Zinsentwicklungsszenarien und Bestandsveränderungen auf einen Planungshorizont von bis zu vier Jahren (vgl. Abb. ) (CCFB CONSULTING 2b). Abb. : Excel-Tool Szenario-Analyse Für jedes analysierte Mischungsverhältnis werden entsprechend der gewählten Zins- und Bestandsentwicklungsszenarien die zukünftigen Nettoergebnisse berech-
12 net und gespeichert. Diese bilden im sich anschließenden Auswahlprozess die Entscheidungsgrundlage für das optimale Mischungsverhältnis (vgl. Abb. ). Die Vorgehensweise sei abschließend anhand eines Beispiels demonstriert. Analysiert werden soll eine Spareinlage mit gesetzlicher Kündigungsfrist. Das Produkt- Simulationsergebnisse Simulation von Zins- und Bestandsentwicklungsszenarien für jedes Mischungsverhältnis Produktspezifisches Fristentransformationsergebnis Ausgleichszahlung + Nettoergebnis Entscheidungsmatrix Gesucht wird das Mischungsverhältnis mit den besten Netto-Ergebnissen! Abb. : Entscheidungsfindung im optimierten Lösungsansatz Der Auswahlprozess vollzieht sich mit Hilfe einer Entscheidungsmatrix, in der sämtliche Ergebnisse sortiert und verglichen werden. Angestrebt wird ein Mischungsverhältnis, das stabile und hohe Nettoergebnisse unabhängig von externen Einflüssen (Zins- und Bestandsentwicklungen) generiert. Ein solches Ergebnis gewährleistet gleichzeitig eine geringe Schwankung der Marge und nutzt das Ergebnispotenzial eines Produkts optimal aus. 2
13 volumen beträgt Mio. EUR. Nachdem die erforderlichen Daten zusammengetragen wurden, beginnt die historische Analyse mithilfe von Optimix (vgl. Abb. 6). Produkt Spar Zeitraum (Beginn) Jan 999 Zeitraum (Ende) Dez 2 Bestand: Mio. Mischungsverhältnis 2 STD Marge Korrelation Laufzeit Laufzeit (geringste) (höchste) (höchste) (längste) (kürzeste) M 7 M 6 M J 2 J J J J 6 J 7 J 8 J 9 J J Standardabweichung,286,7,289,7,8 Marge,27,,26,, Korrelation,989,989,9897,989,989 Laufzeit,7,6,6292,6,8 Abb. 6: Berechnung der Kennzahlen mit Optimix Als Analysezeitraum wurde die Periode von Januar Dezember 2 festgelegt. Optimix berechnet für die fünf definierten Kennzahlen die jeweiligen Mischungsverhältnisse. Zum Vergleich werden für jedes Mischungsverhältnis die Standardabweichung, die Marge, die Korrelation und die Laufzeit in Gestalt der Duration ausgewiesen. Es zeigt sich, dass alle fünf Varianten bezüglich der Standardabweichung recht eng beieinander liegen und die Mischungsverhältnisse trotzdem Unterschiede aufweisen. Die Unterschiede bei den Mischungsverhältnissen lassen sich auch an der Marge deutlich machen, die im schlechtesten Fall, % und im besten Fall, % beträgt. Zentral für die historische Analyse ist, dass die identifizierten Mischungsverhältnisse (gemessen an der Standardabweichung) ein weitestgehend identisches Zinsrisikoprofil aufweisen.
14 Zins 6,,,, 2,,, Apr. Aug. Dez. Apr. Aug. Dez. Apr. 2 Aug. 2 Dez. 2 Apr. Aug. Dez. Produktzins Opportunitätszins Marge Abb. 7: Grafische Darstellung des Zinsanpassungsverhaltens Datum Abb. 7 visualisiert das Zinsanpassungsverhalten am Beispiel des Mischungsverhältnisses mit der geringsten Standardabweichung. Die anderen vier Mischungsverhältnisse weisen den gleichen Verlauf auf. Da es sich bei dem analysierten Produkt um ein Passivprodukt handelt, verläuft der Opportunitätszins oberhalb des Produktzinses. Die Bank kauft gemäß der Logik der Marktzinsmethode das Geld vom Kunden billiger ein als am Geld- und Kapitalmarkt. Die Marge oszilliert mit geringen Schwankungen um den Mittelwert von,27 %. Im Anschluss an die historische Analyse des Zinsanpassungsverhaltens der Bank wird mithilfe der Szenarioanalyse eine Projektion in die Zukunft vorgenommen (vgl. Abb. 8). Der Anwender kann hierbei Szenarien über potenzielle Bestandsveränderungen und mögliche Zinsentwicklungen simulieren. Im Beispiel wird für den Planungszeitraum von vier Jahren im ersten Jahr eine Bestandserhöhung von, %, im zweiten Jahr von 2, %, im dritten Jahr von 2, % und im vierten Jahr von, % angenommen.
15 7, 6, aktuell SZ SZ 2 SZ SZ SZ,,, 2,,, SZ SZ 2 SZ SZ SZ Bestandsentwicklung Jahr:,% 2 Jahr: 2,% Jahr: 2,% Jahr:,% Hausmeinung Sinkend Steigend Invers Konstant J (in BP) J (in BP) J (in BP) - -2 Abb. 8: Definition der Parameter für die Szenarioanalyse Wie bereits beschrieben, sollten die Zinsszenarien ein möglichst breites Spektrum abdecken und auch nicht nur in eine Richtung gehen. Dies ist insbesondere dann von besonderer Bedeutung, wenn die Bank als Managementstil eine passive Steuerung favorisiert, denn diese kommt ohne eigene Zinsprognosen aus. Die im Beispiel verwendeten Zinsszenarien reichen von sinkend bis steigend und von invers bis konstant. Zusätzlich ist auch noch die Hausmeinung aufgenommen worden. Nachdem die für die Analyse erforderlichen Daten ermittelt worden sind, können mithilfe der Szenarioanalyse die Simulationen durchgeführt werden. Abb. 9 zeigt die Ergebnisse.
16 Produkt Spar 2 Zeitraum (Beginn) Jan 999 STD Marge Korrelation Laufzeit Laufzeit Zeitraum (Ende) Dez 2 (geringste) (höchste) (höchste) (längste) (kürzeste) Nettoergebnis SZ (absolut) SZ SZ SZ SZ Nettoergebnis SZ (Rang) SZ 2 SZ SZ SZ Rang-Matrix 2 Abb. 9: Simulation möglicher zukünftiger Ergebnisse Die Szenarioanalyse stellt die Ergebnisse in Form von Entscheidungsmatrizen bereit. Ausgewiesen werden neben den absoluten Nettoergebnissen auch die jeweiligen Rangfolgen sowie eine Rangmatrix. Darüber hinaus ermöglicht die Szenarioanalyse auch vielfältige Detailanalysen, so dass sämtliche Ergebnisse im Einzelnen nachvollzogen und interpretiert werden können. Im Beispiel ergibt sich unabhängig vom analysierten Zinsentwicklungsszenario ein eindeutiges Ergebnis für das Mischungsverhältnis mit der höchsten Marge. Solch eindeutige Ergebnisse können auftreten, sind aber nicht die Regel. Sie hängen vielmehr von dem analysierten Produkt, dem gewählten Zeitraum sowie den festgelegten Parametern für die Szenarioanalyse ab. Auf Basis der ermittelten Ergebnisse kann mit dem Vorstand über die Mischungsverhältnisse diskutiert werden. Aufgrund der erfahrungsgemäß sehr guten Kommunikationseigenschaften der Szenarioanalyse lässt sich Verständnis und Vertrauen in die festgelegten Mischungsverhältnisse erzeugen. Dies ist wichtig, denn aufgrund des erheblichen Volumens dieser Produkte kommt den variabel verzinsli- 6
17 chen Geschäften mit unbekannter Kapitalbindung für die Ergebnisse der Zinsbuchsteuerung erhebliche Bedeutung zu. Literaturverzeichnis: CCFB CONSULTING (2a): Zukunftsorientierte Bestimmung von Mischungsverhältnissen für das variabel verzinsliche Geschäft, Siegen, Download unter: CCFB CONSULTING (2b): Rendite-/Risikosteuerung von Kreditinstituten: Zukunftsorientierte Bestimmung von Mischungsverhältnissen unter Berücksichtigung von Bestandsschwankungen, Siegen, Download unter: WIEDEMANN, A. 2: Risikotriade - Zins-, Kredit- und operationelle Risiken, Band der Schriftenreihe ccfb - competence center finanz- und bankmanagement, hrsg. von A. Wiedemann, Frankfurt am Main. Beitrag entnommen aus: Integrierte Rendite-/Risikosteuerung, hrsg. von Arnd Wiedemann und Uwe Lüders, 2. Aufl., Münster 26, S
Der Fristentransformationserfolg aus der passiven Steuerung
 Der Fristentransformationserfolg aus der passiven Steuerung Die Einführung einer barwertigen Zinsbuchsteuerung ist zwangsläufig mit der Frage nach dem zukünftigen Managementstil verbunden. Die Kreditinstitute
Der Fristentransformationserfolg aus der passiven Steuerung Die Einführung einer barwertigen Zinsbuchsteuerung ist zwangsläufig mit der Frage nach dem zukünftigen Managementstil verbunden. Die Kreditinstitute
1 Einleitung. 1.1 Motivation und Zielsetzung der Untersuchung
 1 Einleitung 1.1 Motivation und Zielsetzung der Untersuchung Obgleich Tourenplanungsprobleme zu den am häufigsten untersuchten Problemstellungen des Operations Research zählen, konzentriert sich der Großteil
1 Einleitung 1.1 Motivation und Zielsetzung der Untersuchung Obgleich Tourenplanungsprobleme zu den am häufigsten untersuchten Problemstellungen des Operations Research zählen, konzentriert sich der Großteil
QM: Prüfen -1- KN16.08.2010
 QM: Prüfen -1- KN16.08.2010 2.4 Prüfen 2.4.1 Begriffe, Definitionen Ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung ist das Prüfen. Sie wird aber nicht wie früher nach der Fertigung durch einen Prüfer,
QM: Prüfen -1- KN16.08.2010 2.4 Prüfen 2.4.1 Begriffe, Definitionen Ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung ist das Prüfen. Sie wird aber nicht wie früher nach der Fertigung durch einen Prüfer,
Banken und Börsen, Kurs 41520 (Inhaltlicher Bezug: KE 1)
 1 Lösungshinweise zur Einsendearbeit 1: SS 2012 Banken und Börsen, Kurs 41520 (Inhaltlicher Bezug: KE 1) Fristentransformation 50 Punkte Die Bank B gibt im Zeitpunkt t = 0 einen Kredit mit einer Laufzeit
1 Lösungshinweise zur Einsendearbeit 1: SS 2012 Banken und Börsen, Kurs 41520 (Inhaltlicher Bezug: KE 1) Fristentransformation 50 Punkte Die Bank B gibt im Zeitpunkt t = 0 einen Kredit mit einer Laufzeit
Ermittlung kalkulatorischer Zinsen nach der finanzmathematischen Durchschnittswertmethode
 Ermittlung r finanzmathematischen (von D. Ulbig, Verfahrensprüfer der SAKD) 1. Einleitung Die n Zinsen können gemäß 12 SächsKAG nach der oder der ermittelt werden. Bei Anwendung der sind die n Zinsen nach
Ermittlung r finanzmathematischen (von D. Ulbig, Verfahrensprüfer der SAKD) 1. Einleitung Die n Zinsen können gemäß 12 SächsKAG nach der oder der ermittelt werden. Bei Anwendung der sind die n Zinsen nach
Rente = laufende Zahlungen, die in regelmäßigen Zeitabschnitten (periodisch) wiederkehren Rentenperiode = Zeitabstand zwischen zwei Rentenzahlungen
 1 3.2. entenrechnung Definition: ente = laufende Zahlungen, die in regelmäßigen Zeitabschnitten (periodisch) wiederkehren entenperiode = Zeitabstand zwischen zwei entenzahlungen Finanzmathematisch sind
1 3.2. entenrechnung Definition: ente = laufende Zahlungen, die in regelmäßigen Zeitabschnitten (periodisch) wiederkehren entenperiode = Zeitabstand zwischen zwei entenzahlungen Finanzmathematisch sind
Erfolg und Vermögensrückgänge angefertigt im Rahmen der Lehrveranstaltung Nachrichtentechnik von: Eric Hansen, eric-hansen@gmx.de am: 07.09.
 Abstract zum Thema Handelssysteme Erfolg und Vermögensrückgänge angefertigt im Rahmen der Lehrveranstaltung Nachrichtentechnik von: Eric Hansen, eric-hansen@gmx.de am: 07.09.01 Einleitung: Handelssysteme
Abstract zum Thema Handelssysteme Erfolg und Vermögensrückgänge angefertigt im Rahmen der Lehrveranstaltung Nachrichtentechnik von: Eric Hansen, eric-hansen@gmx.de am: 07.09.01 Einleitung: Handelssysteme
einfache Rendite 0 145 85 1 160 90 2 135 100 3 165 105 4 190 95 5 210 110
 Übungsbeispiele 1/6 1) Vervollständigen Sie folgende Tabelle: Nr. Aktie A Aktie B Schlusskurs in Schlusskurs in 0 145 85 1 160 90 2 135 100 3 165 105 4 190 95 5 210 110 Arithmetisches Mittel Standardabweichung
Übungsbeispiele 1/6 1) Vervollständigen Sie folgende Tabelle: Nr. Aktie A Aktie B Schlusskurs in Schlusskurs in 0 145 85 1 160 90 2 135 100 3 165 105 4 190 95 5 210 110 Arithmetisches Mittel Standardabweichung
Lösungshinweise zur Einsendearbeit 2 SS 2011
 Lösungshinweise zur Einsendearbeit 2 zum Kurs 41500, Finanzwirtschaft: Grundlagen, SS2011 1 Lösungshinweise zur Einsendearbeit 2 SS 2011 Finanzwirtschaft: Grundlagen, Kurs 41500 Aufgabe Finanzierungsbeziehungen
Lösungshinweise zur Einsendearbeit 2 zum Kurs 41500, Finanzwirtschaft: Grundlagen, SS2011 1 Lösungshinweise zur Einsendearbeit 2 SS 2011 Finanzwirtschaft: Grundlagen, Kurs 41500 Aufgabe Finanzierungsbeziehungen
14. Minimale Schichtdicken von PEEK und PPS im Schlauchreckprozeß und im Rheotensversuch
 14. Minimale Schichtdicken von PEEK und PPS im Schlauchreckprozeß und im Rheotensversuch Analog zu den Untersuchungen an LDPE in Kap. 6 war zu untersuchen, ob auch für die Hochtemperatur-Thermoplaste aus
14. Minimale Schichtdicken von PEEK und PPS im Schlauchreckprozeß und im Rheotensversuch Analog zu den Untersuchungen an LDPE in Kap. 6 war zu untersuchen, ob auch für die Hochtemperatur-Thermoplaste aus
Güte von Tests. die Wahrscheinlichkeit für den Fehler 2. Art bei der Testentscheidung, nämlich. falsch ist. Darauf haben wir bereits im Kapitel über
 Güte von s Grundlegendes zum Konzept der Güte Ableitung der Gütefunktion des Gauss im Einstichprobenproblem Grafische Darstellung der Gütefunktionen des Gauss im Einstichprobenproblem Ableitung der Gütefunktion
Güte von s Grundlegendes zum Konzept der Güte Ableitung der Gütefunktion des Gauss im Einstichprobenproblem Grafische Darstellung der Gütefunktionen des Gauss im Einstichprobenproblem Ableitung der Gütefunktion
Gewinnvergleichsrechnung
 Gewinnvergleichsrechnung Die Gewinnvergleichsrechnung stellt eine Erweiterung der Kostenvergleichsrechnung durch Einbeziehung der Erträge dar, die - im Gegensatz zu der Annahme bei der Kostenvergleichsrechnung
Gewinnvergleichsrechnung Die Gewinnvergleichsrechnung stellt eine Erweiterung der Kostenvergleichsrechnung durch Einbeziehung der Erträge dar, die - im Gegensatz zu der Annahme bei der Kostenvergleichsrechnung
Leseauszug DGQ-Band 14-26
 Leseauszug DGQ-Band 14-26 Einleitung Dieser Band liefert einen Ansatz zur Einführung von Prozessmanagement in kleinen und mittleren Organisationen (KMO) 1. Die Erfolgskriterien für eine Einführung werden
Leseauszug DGQ-Band 14-26 Einleitung Dieser Band liefert einen Ansatz zur Einführung von Prozessmanagement in kleinen und mittleren Organisationen (KMO) 1. Die Erfolgskriterien für eine Einführung werden
AUTOMATISIERTE HANDELSSYSTEME
 UweGresser Stefan Listing AUTOMATISIERTE HANDELSSYSTEME Erfolgreich investieren mit Gresser K9 FinanzBuch Verlag 1 Einsatz des automatisierten Handelssystems Gresser K9 im Portfoliomanagement Portfoliotheorie
UweGresser Stefan Listing AUTOMATISIERTE HANDELSSYSTEME Erfolgreich investieren mit Gresser K9 FinanzBuch Verlag 1 Einsatz des automatisierten Handelssystems Gresser K9 im Portfoliomanagement Portfoliotheorie
DIPLOM. Abschlussklausur der Vorlesung Bank I, II:
 Seite 1 von 9 Name: Matrikelnummer: DIPLOM Abschlussklausur der Vorlesung Bank I, II: Bankmanagement und Theory of Banking Seite 2 von 9 DIPLOM Abschlussklausur der Vorlesung Bank I, II: Bankmanagement
Seite 1 von 9 Name: Matrikelnummer: DIPLOM Abschlussklausur der Vorlesung Bank I, II: Bankmanagement und Theory of Banking Seite 2 von 9 DIPLOM Abschlussklausur der Vorlesung Bank I, II: Bankmanagement
Orderarten im Wertpapierhandel
 Orderarten im Wertpapierhandel Varianten bei einer Wertpapierkauforder 1. Billigst Sie möchten Ihre Order so schnell wie möglich durchführen. Damit kaufen Sie das Wertpapier zum nächstmöglichen Kurs. Kurs
Orderarten im Wertpapierhandel Varianten bei einer Wertpapierkauforder 1. Billigst Sie möchten Ihre Order so schnell wie möglich durchführen. Damit kaufen Sie das Wertpapier zum nächstmöglichen Kurs. Kurs
Berechnung der Erhöhung der Durchschnittsprämien
 Wolfram Fischer Berechnung der Erhöhung der Durchschnittsprämien Oktober 2004 1 Zusammenfassung Zur Berechnung der Durchschnittsprämien wird das gesamte gemeldete Prämienvolumen Zusammenfassung durch die
Wolfram Fischer Berechnung der Erhöhung der Durchschnittsprämien Oktober 2004 1 Zusammenfassung Zur Berechnung der Durchschnittsprämien wird das gesamte gemeldete Prämienvolumen Zusammenfassung durch die
infach Geld FBV Ihr Weg zum finanzellen Erfolg Florian Mock
 infach Ihr Weg zum finanzellen Erfolg Geld Florian Mock FBV Die Grundlagen für finanziellen Erfolg Denn Sie müssten anschließend wieder vom Gehaltskonto Rückzahlungen in Höhe der Entnahmen vornehmen, um
infach Ihr Weg zum finanzellen Erfolg Geld Florian Mock FBV Die Grundlagen für finanziellen Erfolg Denn Sie müssten anschließend wieder vom Gehaltskonto Rückzahlungen in Höhe der Entnahmen vornehmen, um
Funktion Erläuterung Beispiel
 WESTFÄLISCHE WILHELMS-UNIVERSITÄT WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT BETRIEBLICHE DATENVERARBEITUNG Folgende Befehle werden typischerweise im Excel-Testat benötigt. Die Beispiele in diesem Dokument
WESTFÄLISCHE WILHELMS-UNIVERSITÄT WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT BETRIEBLICHE DATENVERARBEITUNG Folgende Befehle werden typischerweise im Excel-Testat benötigt. Die Beispiele in diesem Dokument
Studie zu unabhängige Vermögensverwalter Die Großen erwirtschaften die Erträge, die Kleinen sind effizient
 Studie zu unabhängige Vermögensverwalter Die Großen erwirtschaften die Erträge, die Kleinen sind effizient Eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft App Audit zeigt, wie sich die Geschäftsmodelle
Studie zu unabhängige Vermögensverwalter Die Großen erwirtschaften die Erträge, die Kleinen sind effizient Eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft App Audit zeigt, wie sich die Geschäftsmodelle
SS 2014 Torsten Schreiber
 SS 2014 Torsten Schreiber 204 Diese Lücken sollten nicht auch bei Ihnen vorhanden sein: Bei der Rentenrechnung geht es um aus einem angesparten Kapital bzw. um um das Kapital aufzubauen, die innerhalb
SS 2014 Torsten Schreiber 204 Diese Lücken sollten nicht auch bei Ihnen vorhanden sein: Bei der Rentenrechnung geht es um aus einem angesparten Kapital bzw. um um das Kapital aufzubauen, die innerhalb
Pension Liability Management. Ein Konzept für die Liquiditätsplanung in der betrieblichen Altersversorgung. BAV Ludwig
 Ein Konzept für die Liquiditätsplanung in der betrieblichen Altersversorgung Gesellschaft für betriebliche Altersversorgung university-logo Problematik Ziele interne Finanzierung Vorteile der internen
Ein Konzept für die Liquiditätsplanung in der betrieblichen Altersversorgung Gesellschaft für betriebliche Altersversorgung university-logo Problematik Ziele interne Finanzierung Vorteile der internen
Übungsaufgaben Tilgungsrechnung
 1 Zusatzmaterialien zu Finanz- und Wirtschaftsmathematik im Unterricht, Band 1 Übungsaufgaben Tilgungsrechnung Überarbeitungsstand: 1.März 2016 Die grundlegenden Ideen der folgenden Aufgaben beruhen auf
1 Zusatzmaterialien zu Finanz- und Wirtschaftsmathematik im Unterricht, Band 1 Übungsaufgaben Tilgungsrechnung Überarbeitungsstand: 1.März 2016 Die grundlegenden Ideen der folgenden Aufgaben beruhen auf
Risikodiversifikation. Birgit Hausmann
 diversifikation Birgit Hausmann Übersicht: 1. Definitionen 1.1. 1.2. diversifikation 2. messung 2.1. messung im Überblick 2.2. Gesamtaktienrisiko und Volatilität 2.3. Systematisches und Betafaktor 2.4.
diversifikation Birgit Hausmann Übersicht: 1. Definitionen 1.1. 1.2. diversifikation 2. messung 2.1. messung im Überblick 2.2. Gesamtaktienrisiko und Volatilität 2.3. Systematisches und Betafaktor 2.4.
Unsere vier hilfreichsten Tipps für szenarienbasierte Nachfrageplanung
 Management Briefing Unsere vier hilfreichsten Tipps für szenarienbasierte Nachfrageplanung Erhalten Sie die Einblicke, die Sie brauchen, um schnell auf Nachfrageschwankungen reagieren zu können Sales and
Management Briefing Unsere vier hilfreichsten Tipps für szenarienbasierte Nachfrageplanung Erhalten Sie die Einblicke, die Sie brauchen, um schnell auf Nachfrageschwankungen reagieren zu können Sales and
Die drei Kernpunkte der modernen Portfoliotheorie
 Die drei Kernpunkte der modernen Portfoliotheorie 1. Der Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite Das Risiko einer Anlage ist die als Varianz oder Standardabweichung gemessene Schwankungsbreite der Erträge
Die drei Kernpunkte der modernen Portfoliotheorie 1. Der Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite Das Risiko einer Anlage ist die als Varianz oder Standardabweichung gemessene Schwankungsbreite der Erträge
Wesentliche Bilanzierungsunterschiede zwischen HGB und IFRS dargestellt anhand von Fallbeispielen
 www.boeckler.de Juli 2014 Copyright Hans-Böckler-Stiftung Christiane Kohs Wesentliche Bilanzierungsunterschiede zwischen und dargestellt anhand von Fallbeispielen Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien
www.boeckler.de Juli 2014 Copyright Hans-Böckler-Stiftung Christiane Kohs Wesentliche Bilanzierungsunterschiede zwischen und dargestellt anhand von Fallbeispielen Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien
geben. Die Wahrscheinlichkeit von 100% ist hier demnach nur der Gehen wir einmal davon aus, dass die von uns angenommenen
 geben. Die Wahrscheinlichkeit von 100% ist hier demnach nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Gehen wir einmal davon aus, dass die von uns angenommenen 70% im Beispiel exakt berechnet sind. Was würde
geben. Die Wahrscheinlichkeit von 100% ist hier demnach nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Gehen wir einmal davon aus, dass die von uns angenommenen 70% im Beispiel exakt berechnet sind. Was würde
2. Mai 2011. Geldtheorie und -politik. Die Risiko- und Terminstruktur von Zinsen (Mishkin, Kapitel 6)
 Geldtheorie und -politik Die Risiko- und Terminstruktur von Zinsen (Mishkin, Kapitel 6) 2. Mai 2011 Überblick Bestimmung des Zinssatzes im Markt für Anleihen Erklärung der Dynamik von Zinssätzen Überblick
Geldtheorie und -politik Die Risiko- und Terminstruktur von Zinsen (Mishkin, Kapitel 6) 2. Mai 2011 Überblick Bestimmung des Zinssatzes im Markt für Anleihen Erklärung der Dynamik von Zinssätzen Überblick
Kurs 00091: Finanzierungs- und entscheidungstheoretische Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre
 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, Kurs 00091, KE 3, 4, 5 und 6, SS 2012 1 Kurs 00091: Finanzierungs- und entscheidungstheoretische Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre Einsendearbeit 2 (SS 2012)
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, Kurs 00091, KE 3, 4, 5 und 6, SS 2012 1 Kurs 00091: Finanzierungs- und entscheidungstheoretische Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre Einsendearbeit 2 (SS 2012)
Binäre Bäume. 1. Allgemeines. 2. Funktionsweise. 2.1 Eintragen
 Binäre Bäume 1. Allgemeines Binäre Bäume werden grundsätzlich verwendet, um Zahlen der Größe nach, oder Wörter dem Alphabet nach zu sortieren. Dem einfacheren Verständnis zu Liebe werde ich mich hier besonders
Binäre Bäume 1. Allgemeines Binäre Bäume werden grundsätzlich verwendet, um Zahlen der Größe nach, oder Wörter dem Alphabet nach zu sortieren. Dem einfacheren Verständnis zu Liebe werde ich mich hier besonders
Würfelt man dabei je genau 10 - mal eine 1, 2, 3, 4, 5 und 6, so beträgt die Anzahl. der verschiedenen Reihenfolgen, in denen man dies tun kann, 60!.
 040304 Übung 9a Analysis, Abschnitt 4, Folie 8 Die Wahrscheinlichkeit, dass bei n - maliger Durchführung eines Zufallexperiments ein Ereignis A ( mit Wahrscheinlichkeit p p ( A ) ) für eine beliebige Anzahl
040304 Übung 9a Analysis, Abschnitt 4, Folie 8 Die Wahrscheinlichkeit, dass bei n - maliger Durchführung eines Zufallexperiments ein Ereignis A ( mit Wahrscheinlichkeit p p ( A ) ) für eine beliebige Anzahl
Vorsorgestiftung für Gesundheit und Soziales. Reglement über die Bildung und Auflösung von technischen Rückstellungen
 Vorsorgestiftung für Gesundheit und Soziales Reglement über die Bildung und Auflösung von technischen Rückstellungen Sarnen, 1. Januar 2006 Inhaltsverzeichnis 1. Grundsätze und Ziele 1 1.1 Einleitung 1
Vorsorgestiftung für Gesundheit und Soziales Reglement über die Bildung und Auflösung von technischen Rückstellungen Sarnen, 1. Januar 2006 Inhaltsverzeichnis 1. Grundsätze und Ziele 1 1.1 Einleitung 1
Prof. Dr. Arnd Wiedemann Methodische Grundlagen des Controlling und Risikomanagements
 Prof. Dr. Arnd Wiedemann Methodische Grundlagen des Controlling und Risikomanagements Prof. Dr. Arnd Wiedemann Methoden CRM / WS 12-13 1 Agenda Teil A: Teil B: Teil C: Finanzmathematisches Basiswissen
Prof. Dr. Arnd Wiedemann Methodische Grundlagen des Controlling und Risikomanagements Prof. Dr. Arnd Wiedemann Methoden CRM / WS 12-13 1 Agenda Teil A: Teil B: Teil C: Finanzmathematisches Basiswissen
Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren
 Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als
Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als
Welche Unterschiede gibt es zwischen einem CAPAund einem Audiometrie- Test?
 Welche Unterschiede gibt es zwischen einem CAPAund einem Audiometrie- Test? Auch wenn die Messungsmethoden ähnlich sind, ist das Ziel beider Systeme jedoch ein anderes. Gwenolé NEXER g.nexer@hearin gp
Welche Unterschiede gibt es zwischen einem CAPAund einem Audiometrie- Test? Auch wenn die Messungsmethoden ähnlich sind, ist das Ziel beider Systeme jedoch ein anderes. Gwenolé NEXER g.nexer@hearin gp
CHECKLISTE zum Fremdwährungskredit
 CHECKLISTE zum Fremdwährungskredit Diese Checkliste ist eine demonstrative Aufzählung von Tipps und Hinweisen für die Aufnahme und nachträgliche Kontrolle eines Fremdwährungskredites. I. Aufnahme 1. Aufnahme/Vergabe
CHECKLISTE zum Fremdwährungskredit Diese Checkliste ist eine demonstrative Aufzählung von Tipps und Hinweisen für die Aufnahme und nachträgliche Kontrolle eines Fremdwährungskredites. I. Aufnahme 1. Aufnahme/Vergabe
Mean Time Between Failures (MTBF)
 Mean Time Between Failures (MTBF) Hintergrundinformation zur MTBF Was steht hier? Die Mean Time Between Failure (MTBF) ist ein statistischer Mittelwert für den störungsfreien Betrieb eines elektronischen
Mean Time Between Failures (MTBF) Hintergrundinformation zur MTBF Was steht hier? Die Mean Time Between Failure (MTBF) ist ein statistischer Mittelwert für den störungsfreien Betrieb eines elektronischen
Fremdwährungsanteil bei Tilgungsträgerkrediten bei 86 % eine Analyse der Fremdwährungskreditstatistik 1
 Fremdwährungsanteil bei strägerkrediten bei 86 % eine Analyse der Fremdwährungskreditstatistik 1 Christian Sellner 2 Im europäischen Vergleich ist das Volumen der Fremdwährungskredite in Österreich sehr
Fremdwährungsanteil bei strägerkrediten bei 86 % eine Analyse der Fremdwährungskreditstatistik 1 Christian Sellner 2 Im europäischen Vergleich ist das Volumen der Fremdwährungskredite in Österreich sehr
Monitoring-Service Anleitung
 Anleitung 1. Monitoring in CrefoDirect Wie kann Monitoring über CrefoDirect bestellt werden? Bestellung von Monitoring beim Auskunftsabruf Beim Auskunftsabruf kann das Monitoring direkt mitbestellt werden.
Anleitung 1. Monitoring in CrefoDirect Wie kann Monitoring über CrefoDirect bestellt werden? Bestellung von Monitoring beim Auskunftsabruf Beim Auskunftsabruf kann das Monitoring direkt mitbestellt werden.
Virtuelle Fotografie (CGI)
 (CGI) Vorteile und Beispiele Das ist (k)ein Foto. Diese Abbildung ist nicht mit einer Kamera erstellt worden. Was Sie sehen basiert auf CAD-Daten unserer Kunden. Wir erzeugen damit Bilder ausschließlich
(CGI) Vorteile und Beispiele Das ist (k)ein Foto. Diese Abbildung ist nicht mit einer Kamera erstellt worden. Was Sie sehen basiert auf CAD-Daten unserer Kunden. Wir erzeugen damit Bilder ausschließlich
U N I V E R S I T Ä T S I E G E N Prüfungsamt Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
 Diplomprüfung Matrikel-Nr.: Prüfungsfach: Finanz- und Bankmanagement / Controlling 2. Prüfungstermin Erstprüfer: Wiedemann Zweitprüfer: Moog Erlaubte Hilfsmittel: Nicht programmierbarer, netzunabhängiger
Diplomprüfung Matrikel-Nr.: Prüfungsfach: Finanz- und Bankmanagement / Controlling 2. Prüfungstermin Erstprüfer: Wiedemann Zweitprüfer: Moog Erlaubte Hilfsmittel: Nicht programmierbarer, netzunabhängiger
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Übungsbuch für den Grundkurs mit Tipps und Lösungen: Analysis
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Übungsbuch für den Grundkurs mit Tipps und Lösungen: Analysis Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Übungsbuch für den Grundkurs mit Tipps und Lösungen: Analysis Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
Was ist clevere Altersvorsorge?
 Was ist clevere Altersvorsorge? Um eine gute Altersvorsorge zu erreichen, ist es clever einen unabhängigen Berater auszuwählen Angestellte bzw. Berater von Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften und
Was ist clevere Altersvorsorge? Um eine gute Altersvorsorge zu erreichen, ist es clever einen unabhängigen Berater auszuwählen Angestellte bzw. Berater von Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften und
Studie über die Bewertung von Wissen in kleinen und mittleren Unternehmen in Schleswig-Holstein
 Studie über die Bewertung von Wissen in kleinen und mittleren Unternehmen in Schleswig-Holstein Sehr geehrte Damen und Herren, in der heutigen Wissensgesellschaft sind die zentralen Ressourcen erfolgreicher
Studie über die Bewertung von Wissen in kleinen und mittleren Unternehmen in Schleswig-Holstein Sehr geehrte Damen und Herren, in der heutigen Wissensgesellschaft sind die zentralen Ressourcen erfolgreicher
Dynamische Investitionsrechnung Umsetzung und Beispiele. Teil 3
 Dynamische Investitionsrechnung Umsetzung und Beispiele Teil 3 Eingrenzung: Es werden ausschliesslich die Methoden der Pflichtliteratur ab Seite 135 bis Beispiel 12 besprochen. Kapitalwertverfahren (NPV
Dynamische Investitionsrechnung Umsetzung und Beispiele Teil 3 Eingrenzung: Es werden ausschliesslich die Methoden der Pflichtliteratur ab Seite 135 bis Beispiel 12 besprochen. Kapitalwertverfahren (NPV
Prof. Dr. Arnd Wiedemann Finanz- und Bankmanagement Universität Siegen www.uni-siegen.de/~banken www.zinsrisiko.de
 Aufgabenteil a) Der Cash Flow kann entweder mit den gerundeten Forward Rates aus der Aufgabe oder mit den exakten Forward Rates aus dem ZB-Master 1.0 berechnet werden. Abb. 1 zeigt den durch den ZB-Master
Aufgabenteil a) Der Cash Flow kann entweder mit den gerundeten Forward Rates aus der Aufgabe oder mit den exakten Forward Rates aus dem ZB-Master 1.0 berechnet werden. Abb. 1 zeigt den durch den ZB-Master
Behörde für Bildung und Sport Abitur 2008 Lehrermaterialien zum Leistungskurs Mathematik
 Abitur 8 II. Insektenpopulation LA/AG In den Tropen legen die Weibchen einer in Deutschland unbekannten Insektenpopulation jedes Jahr kurz vor Beginn der Regenzeit jeweils 9 Eier und sterben bald darauf.
Abitur 8 II. Insektenpopulation LA/AG In den Tropen legen die Weibchen einer in Deutschland unbekannten Insektenpopulation jedes Jahr kurz vor Beginn der Regenzeit jeweils 9 Eier und sterben bald darauf.
Eckpfeiler der neuen Regelung:
 Zertifikate-Emittenten weisen im Produktinformationsblatt (PIB) bereits seit einigen Jahren Performance-Szenarien aus. Während die konkrete Bestimmung dieser Szenarien bislang den Emittenten überlassen
Zertifikate-Emittenten weisen im Produktinformationsblatt (PIB) bereits seit einigen Jahren Performance-Szenarien aus. Während die konkrete Bestimmung dieser Szenarien bislang den Emittenten überlassen
SOZIALVORSCHRIFTEN IM STRAßENVERKEHR Verordnung (EG) Nr. 561/2006, Richtlinie 2006/22/EG, Verordnung (EU) Nr. 165/2014
 LEITLINIE NR. 7 Gegenstand: Die Bedeutung von innerhalb von 24 Stunden Artikel: 8 Absätze 2 und 5 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 Leitlinien: Nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung muss innerhalb von
LEITLINIE NR. 7 Gegenstand: Die Bedeutung von innerhalb von 24 Stunden Artikel: 8 Absätze 2 und 5 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 Leitlinien: Nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung muss innerhalb von
Rente = laufende Zahlungen, die in regelmäßigen Zeitabschnitten (periodisch) wiederkehren Rentenperiode = Zeitabstand zwischen zwei Rentenzahlungen
 5.2. entenrechnung Definition: ente = laufende Zahlungen, die in regelmäßigen Zeitabschnitten (periodisch) wiederkehren entenperiode = Zeitabstand zwischen zwei entenzahlungen Finanzmathematisch sind zwei
5.2. entenrechnung Definition: ente = laufende Zahlungen, die in regelmäßigen Zeitabschnitten (periodisch) wiederkehren entenperiode = Zeitabstand zwischen zwei entenzahlungen Finanzmathematisch sind zwei
Das große ElterngeldPlus 1x1. Alles über das ElterngeldPlus. Wer kann ElterngeldPlus beantragen? ElterngeldPlus verstehen ein paar einleitende Fakten
 Das große x -4 Alles über das Wer kann beantragen? Generell kann jeder beantragen! Eltern (Mütter UND Väter), die schon während ihrer Elternzeit wieder in Teilzeit arbeiten möchten. Eltern, die während
Das große x -4 Alles über das Wer kann beantragen? Generell kann jeder beantragen! Eltern (Mütter UND Väter), die schon während ihrer Elternzeit wieder in Teilzeit arbeiten möchten. Eltern, die während
SS 2014 Torsten Schreiber
 SS 2014 Torsten Schreiber 221 Diese Lücken sollten nicht auch bei Ihnen vorhanden sein: Wird im Bereich der Rentenrechnung die zugehörige zu Beginn eines Jahres / einer Zeitperiode eingezahlt, so spricht
SS 2014 Torsten Schreiber 221 Diese Lücken sollten nicht auch bei Ihnen vorhanden sein: Wird im Bereich der Rentenrechnung die zugehörige zu Beginn eines Jahres / einer Zeitperiode eingezahlt, so spricht
Das Vermögen der privaten Haushalte in Nordrhein-Westfalen ein Überblick auf der Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
 Sozialberichterstattung NRW. Kurzanalyse 02/2010 09.07.2010 12.07.2010 Das Vermögen der privaten Haushalte in Nordrhein-Westfalen ein Überblick auf der Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008
Sozialberichterstattung NRW. Kurzanalyse 02/2010 09.07.2010 12.07.2010 Das Vermögen der privaten Haushalte in Nordrhein-Westfalen ein Überblick auf der Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008
Modellbildungssysteme: Pädagogische und didaktische Ziele
 Modellbildungssysteme: Pädagogische und didaktische Ziele Was hat Modellbildung mit der Schule zu tun? Der Bildungsplan 1994 formuliert: "Die schnelle Zunahme des Wissens, die hohe Differenzierung und
Modellbildungssysteme: Pädagogische und didaktische Ziele Was hat Modellbildung mit der Schule zu tun? Der Bildungsplan 1994 formuliert: "Die schnelle Zunahme des Wissens, die hohe Differenzierung und
Finanzwirtschaft. Teil II: Bewertung. Zinssätze und Renten
 Zinssätze und Renten 1 Finanzwirtschaft Teil II: Bewertung Zinssätze und Renten Agenda Zinssätze und Renten 2 Effektivzinsen Spot-Zinsen Forward-Zinsen Bewertung Kennziffern Zusammenfassung Zinssätze und
Zinssätze und Renten 1 Finanzwirtschaft Teil II: Bewertung Zinssätze und Renten Agenda Zinssätze und Renten 2 Effektivzinsen Spot-Zinsen Forward-Zinsen Bewertung Kennziffern Zusammenfassung Zinssätze und
Inhalt 1. Was wird gefördert? Bausparverträge
 Inhalt 1. Was wird gefördert? 2. Wie viel Prozent bringt das? 3. In welchem Alter ist das sinnvoll? 4. Wie viel muss man sparen? 5. Bis zu welchem Einkommen gibt es Förderung? 6. Wie groß sollten die Verträge
Inhalt 1. Was wird gefördert? 2. Wie viel Prozent bringt das? 3. In welchem Alter ist das sinnvoll? 4. Wie viel muss man sparen? 5. Bis zu welchem Einkommen gibt es Förderung? 6. Wie groß sollten die Verträge
QuickInfo Dienstplanerstellungund Dienstplanänderung. Erstellung eines Dienstplan bzw. Arbeitszeitmodell
 Erstellung eines Dienstplan bzw. Arbeitszeitmodell Mitarbeiter-Dienstplan Verwaltung von Arbeitszeitmodellen Im Managementportal können Dienstpläne bzw. Arbeitszeitmodelle für die Mitarbeiterinnen und
Erstellung eines Dienstplan bzw. Arbeitszeitmodell Mitarbeiter-Dienstplan Verwaltung von Arbeitszeitmodellen Im Managementportal können Dienstpläne bzw. Arbeitszeitmodelle für die Mitarbeiterinnen und
Nachkalkulation. Hat sich das Objekt CVO Auxilium hilden im Juni rentiert?
 Die bietet sehr viele Informationsmöglichkeiten, die durch exakte Fragestellungen abgerufen werden können. Um die jeweilige Frage zu beantworten, ist es ggf. notwendig, mehrere Abfragen zu starten und
Die bietet sehr viele Informationsmöglichkeiten, die durch exakte Fragestellungen abgerufen werden können. Um die jeweilige Frage zu beantworten, ist es ggf. notwendig, mehrere Abfragen zu starten und
Änderung des IFRS 2 Anteilsbasierte Vergütung
 Änderung IFRS 2 Änderung des IFRS 2 Anteilsbasierte Vergütung Anwendungsbereich Paragraph 2 wird geändert, Paragraph 3 gestrichen und Paragraph 3A angefügt. 2 Dieser IFRS ist bei der Bilanzierung aller
Änderung IFRS 2 Änderung des IFRS 2 Anteilsbasierte Vergütung Anwendungsbereich Paragraph 2 wird geändert, Paragraph 3 gestrichen und Paragraph 3A angefügt. 2 Dieser IFRS ist bei der Bilanzierung aller
Unterschiede bei den Produktionsfunktionen zurückzuführen und können sich auf partielle Produktivitäten (Arbeitsproduktivität, Kapitalproduktivität,
 20 Etappe 1: Reale Außenwirtschaft Unterschiede bei den Produktionsfunktionen zurückzuführen und können sich auf partielle Produktivitäten (Arbeitsproduktivität, Kapitalproduktivität, Bodenproduktivität
20 Etappe 1: Reale Außenwirtschaft Unterschiede bei den Produktionsfunktionen zurückzuführen und können sich auf partielle Produktivitäten (Arbeitsproduktivität, Kapitalproduktivität, Bodenproduktivität
4.2.5 Wie berücksichtigt man den Einsatz und die Abnutzung der Anlagen?
 Seite 1 4.2.5 4.2.5 den Einsatz und die Bei der Erzeugung von Produkten bzw. der Erbringung von Leistungen sind in der Regel Anlagen (wie zum Beispiel Gebäude, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung)
Seite 1 4.2.5 4.2.5 den Einsatz und die Bei der Erzeugung von Produkten bzw. der Erbringung von Leistungen sind in der Regel Anlagen (wie zum Beispiel Gebäude, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung)
Hochschule Rhein-Main. Sommersemester 2015
 Vorlesung Hochschule Rhein-Main Sommersemester 2015 Dr. Roland Stamm 29. Juni 2015 Erinnerung Bewertung eines Bonds mit Kupon k, Nominal N, Laufzeit t n: n Π(t) = N k δ(t i 1, t i ) P (t, t i ) + N P (t,
Vorlesung Hochschule Rhein-Main Sommersemester 2015 Dr. Roland Stamm 29. Juni 2015 Erinnerung Bewertung eines Bonds mit Kupon k, Nominal N, Laufzeit t n: n Π(t) = N k δ(t i 1, t i ) P (t, t i ) + N P (t,
Der Leverage-Effekt wirkt sich unter verschiedenen Umständen auf die Eigenkapitalrendite aus.
 Anhang Leverage-Effekt Leverage-Effekt Bezeichnungs- Herkunft Das englische Wort Leverage heisst Hebelwirkung oder Hebelkraft. Zweck Der Leverage-Effekt wirkt sich unter verschiedenen Umständen auf die
Anhang Leverage-Effekt Leverage-Effekt Bezeichnungs- Herkunft Das englische Wort Leverage heisst Hebelwirkung oder Hebelkraft. Zweck Der Leverage-Effekt wirkt sich unter verschiedenen Umständen auf die
Umsatz-Kosten-Treiber-Matrix. 2015 Woodmark Consulting AG
 Umsatz-Kosten-Treiber-Matrix Die Alpha GmbH ist ein Beratungsunternehmen mit 43 Mitarbeitern. Der Umsatz wird zu 75% aus IT-Beratung bei Kunden vor Ort und vom Betrieb von IT-Applikationen erwirtschaftet.
Umsatz-Kosten-Treiber-Matrix Die Alpha GmbH ist ein Beratungsunternehmen mit 43 Mitarbeitern. Der Umsatz wird zu 75% aus IT-Beratung bei Kunden vor Ort und vom Betrieb von IT-Applikationen erwirtschaftet.
«Eine Person ist funktional gesund, wenn sie möglichst kompetent mit einem möglichst gesunden Körper an möglichst normalisierten Lebensbereichen
 18 «Eine Person ist funktional gesund, wenn sie möglichst kompetent mit einem möglichst gesunden Körper an möglichst normalisierten Lebensbereichen teilnimmt und teilhat.» 3Das Konzept der Funktionalen
18 «Eine Person ist funktional gesund, wenn sie möglichst kompetent mit einem möglichst gesunden Körper an möglichst normalisierten Lebensbereichen teilnimmt und teilhat.» 3Das Konzept der Funktionalen
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzierung. Klausur "Finanzmanagement" 14. März 2002
 1 Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzierung Klausur "Finanzmanagement" 14. März 2002 Bearbeitungshinweise: - Die Gesamtbearbeitungsdauer beträgt 60 Minuten. - Schildern Sie ihren
1 Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzierung Klausur "Finanzmanagement" 14. März 2002 Bearbeitungshinweise: - Die Gesamtbearbeitungsdauer beträgt 60 Minuten. - Schildern Sie ihren
Beschreibung der einzelnen Berechnungsarten
 Beschreibung der einzelnen Berechnungsarten 1.0 Historische Wertentwicklungen 1.1 Berechnung einer Einzelanlage in Prozent Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach den Vorgaben des BVI: Die Berechnung
Beschreibung der einzelnen Berechnungsarten 1.0 Historische Wertentwicklungen 1.1 Berechnung einer Einzelanlage in Prozent Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach den Vorgaben des BVI: Die Berechnung
Ihre Interessentendatensätze bei inobroker. 1. Interessentendatensätze
 Ihre Interessentendatensätze bei inobroker Wenn Sie oder Ihre Kunden die Prozesse von inobroker nutzen, werden Interessentendatensätze erzeugt. Diese können Sie direkt über inobroker bearbeiten oder mit
Ihre Interessentendatensätze bei inobroker Wenn Sie oder Ihre Kunden die Prozesse von inobroker nutzen, werden Interessentendatensätze erzeugt. Diese können Sie direkt über inobroker bearbeiten oder mit
Abituraufgabe zur Stochastik, Hessen 2009, Grundkurs (TR)
 Abituraufgabe zur Stochastik, Hessen 2009, Grundkurs (TR) Eine Firma stellt USB-Sticks her. Sie werden in der Fabrik ungeprüft in Packungen zu je 20 Stück verpackt und an Händler ausgeliefert. 1 Ein Händler
Abituraufgabe zur Stochastik, Hessen 2009, Grundkurs (TR) Eine Firma stellt USB-Sticks her. Sie werden in der Fabrik ungeprüft in Packungen zu je 20 Stück verpackt und an Händler ausgeliefert. 1 Ein Händler
AUF LETZTER SEITE DIESER ANLEITUNG!!!
 BELEG DATENABGLEICH: Der Beleg-Datenabgleich wird innerhalb des geöffneten Steuerfalls über ELSTER-Belegdaten abgleichen gestartet. Es werden Ihnen alle verfügbaren Belege zum Steuerfall im ersten Bildschirm
BELEG DATENABGLEICH: Der Beleg-Datenabgleich wird innerhalb des geöffneten Steuerfalls über ELSTER-Belegdaten abgleichen gestartet. Es werden Ihnen alle verfügbaren Belege zum Steuerfall im ersten Bildschirm
PTV VISWALK TIPPS UND TRICKS PTV VISWALK TIPPS UND TRICKS: VERWENDUNG DICHTEBASIERTER TEILROUTEN
 PTV VISWALK TIPPS UND TRICKS PTV VISWALK TIPPS UND TRICKS: VERWENDUNG DICHTEBASIERTER TEILROUTEN Karlsruhe, April 2015 Verwendung dichte-basierter Teilrouten Stellen Sie sich vor, in einem belebten Gebäude,
PTV VISWALK TIPPS UND TRICKS PTV VISWALK TIPPS UND TRICKS: VERWENDUNG DICHTEBASIERTER TEILROUTEN Karlsruhe, April 2015 Verwendung dichte-basierter Teilrouten Stellen Sie sich vor, in einem belebten Gebäude,
Wirtschaftsstrafrecht Besonderer Teil Juniorprofessor Dr. Isfen
 Wirtschaftsstrafrecht Besonderer Themenbereich Bankenstrafrecht Leitlinien aus der BGH-Rechtsprechung (insbesondere BGHSt 46, 30 und BGHSt 47, 148) Jede Kreditbewilligung ist ihrer Natur nach ein mit einem
Wirtschaftsstrafrecht Besonderer Themenbereich Bankenstrafrecht Leitlinien aus der BGH-Rechtsprechung (insbesondere BGHSt 46, 30 und BGHSt 47, 148) Jede Kreditbewilligung ist ihrer Natur nach ein mit einem
Grundlagen für den erfolgreichen Einstieg in das Business Process Management SHD Professional Service
 Grundlagen für den erfolgreichen Einstieg in das Business Process Management SHD Professional Service Der BPM-Regelkreis Im Mittelpunkt dieser Übersicht steht die konkrete Vorgehensweise bei der Einführung
Grundlagen für den erfolgreichen Einstieg in das Business Process Management SHD Professional Service Der BPM-Regelkreis Im Mittelpunkt dieser Übersicht steht die konkrete Vorgehensweise bei der Einführung
LAS PROGRAMM- ANPASSUNGEN
 LAS PROGRAMM- ANPASSUNGEN Auf Basis der Änderungen des Reisekostenrechts zum 01.01.2014 Zum 1. Januar 2014 treten Änderungen zum steuerlichen Reisekostenrecht in Kraft, die im BMF Schreiben zur Reform
LAS PROGRAMM- ANPASSUNGEN Auf Basis der Änderungen des Reisekostenrechts zum 01.01.2014 Zum 1. Januar 2014 treten Änderungen zum steuerlichen Reisekostenrecht in Kraft, die im BMF Schreiben zur Reform
Statistische Auswertung:
 Statistische Auswertung: Die erhobenen Daten mittels der selbst erstellten Tests (Surfaufgaben) Statistics Punkte aus dem Punkte aus Surftheorietest Punkte aus dem dem und dem Surftheorietest max.14p.
Statistische Auswertung: Die erhobenen Daten mittels der selbst erstellten Tests (Surfaufgaben) Statistics Punkte aus dem Punkte aus Surftheorietest Punkte aus dem dem und dem Surftheorietest max.14p.
Finanzwirtschaft Teil III: Budgetierung des Kapitals
 Finanzmärkte 1 Finanzwirtschaft Teil III: Budgetierung des Kapitals Kapitalwertmethode Agenda Finanzmärkte 2 Kapitalwertmethode Anwendungen Revolvierende Investitionsprojekte Zusammenfassung Kapitalwertmethode
Finanzmärkte 1 Finanzwirtschaft Teil III: Budgetierung des Kapitals Kapitalwertmethode Agenda Finanzmärkte 2 Kapitalwertmethode Anwendungen Revolvierende Investitionsprojekte Zusammenfassung Kapitalwertmethode
IT-Governance und Social, Mobile und Cloud Computing: Ein Management Framework... Bachelorarbeit
 IT-Governance und Social, Mobile und Cloud Computing: Ein Management Framework... Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B.Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft
IT-Governance und Social, Mobile und Cloud Computing: Ein Management Framework... Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B.Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft
Nur wer seine Risken kennt, kann sie auch steuern
 Nur wer seine Risken kennt, kann sie auch steuern 28.10.2010 Mag. Rainer Bacher / Kommunalkredit Austria ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR Agenda 1) Wirtschaftliches Umfeld 2) Zinsabsicherung: Lösungen
Nur wer seine Risken kennt, kann sie auch steuern 28.10.2010 Mag. Rainer Bacher / Kommunalkredit Austria ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR Agenda 1) Wirtschaftliches Umfeld 2) Zinsabsicherung: Lösungen
1. Voraussetzungen a. Generelle Voraussetzungen
 1. Voraussetzungen a. Generelle Voraussetzungen Alle Lieferanten, für die NOS Bestellungen erstellt werden sollen, müssen in der EDI Parametrisierung als NOS Lieferanten gekennzeichnet werden. Die Parametrisierung
1. Voraussetzungen a. Generelle Voraussetzungen Alle Lieferanten, für die NOS Bestellungen erstellt werden sollen, müssen in der EDI Parametrisierung als NOS Lieferanten gekennzeichnet werden. Die Parametrisierung
Senatsverwaltung für Finanzen
 Senatsverwaltung für Finanzen 1 Senatsverwaltung für Finanzen, Klosterstraße 59, D-10179 Berlin (Postanschrift) An die Vorsitzende des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses von Berlin über den Präsidenten
Senatsverwaltung für Finanzen 1 Senatsverwaltung für Finanzen, Klosterstraße 59, D-10179 Berlin (Postanschrift) An die Vorsitzende des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses von Berlin über den Präsidenten
FINANZWISSEN UND VORSORGEPRAXIS
 FINANZWISSEN UND VORSORGEPRAXIS Burgenland Eine Studie von GfK-Austria im Auftrag von s Versicherung, Erste Bank und Sparkassen 13. Juli 2011 Daten zur Untersuchung Thema Befragungszeitraum Grundgesamtheit
FINANZWISSEN UND VORSORGEPRAXIS Burgenland Eine Studie von GfK-Austria im Auftrag von s Versicherung, Erste Bank und Sparkassen 13. Juli 2011 Daten zur Untersuchung Thema Befragungszeitraum Grundgesamtheit
Das. TOP-Zins- Konto. TOP Vermögensverwaltung AG. 100% Einlagensicherung
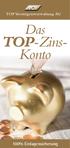 TOP Vermögensverwaltung AG Das TOP-Zins- Konto 100% Einlagensicherung n Schluss mit der Jagd nach den besten Zinsen K ennen Sie das? Ihre Bank bietet attraktive Zinsen allerdings nicht für Sie als treuen
TOP Vermögensverwaltung AG Das TOP-Zins- Konto 100% Einlagensicherung n Schluss mit der Jagd nach den besten Zinsen K ennen Sie das? Ihre Bank bietet attraktive Zinsen allerdings nicht für Sie als treuen
Lebensversicherung. http://www.konsument.at/cs/satellite?pagename=konsument/magazinartikel/printma... OBJEKTIV UNBESTECHLICH KEINE WERBUNG
 Seite 1 von 6 OBJEKTIV UNBESTECHLICH KEINE WERBUNG Lebensversicherung Verschenken Sie kein Geld! veröffentlicht am 11.03.2011, aktualisiert am 14.03.2011 "Verschenken Sie kein Geld" ist der aktuelle Rat
Seite 1 von 6 OBJEKTIV UNBESTECHLICH KEINE WERBUNG Lebensversicherung Verschenken Sie kein Geld! veröffentlicht am 11.03.2011, aktualisiert am 14.03.2011 "Verschenken Sie kein Geld" ist der aktuelle Rat
Abb. 30: Antwortprofil zum Statement Diese Kennzahl ist sinnvoll
 Reklamationsquote Stornierungsquote Inkassoquote Customer-Lifetime-Value Hinsichtlich der obengenannten Kennzahlen bzw. Kontrollgrößen für die Neukundengewinnung wurden den befragten Unternehmen drei Statements
Reklamationsquote Stornierungsquote Inkassoquote Customer-Lifetime-Value Hinsichtlich der obengenannten Kennzahlen bzw. Kontrollgrößen für die Neukundengewinnung wurden den befragten Unternehmen drei Statements
Aufgabenset 1 (abzugeben 16.03.2012 an LK@wacc.de)
 Aufgabenset 1 (abzugeben 16.03.2012 an LK@wacc.de) Aufgabe 1 Betrachten Sie die Cashflows der Abbildung 1 (Auf- und Abwärtsbewegungen finden mit gleicher Wahrscheinlichkeit statt). 1 Nehmen Sie an, dass
Aufgabenset 1 (abzugeben 16.03.2012 an LK@wacc.de) Aufgabe 1 Betrachten Sie die Cashflows der Abbildung 1 (Auf- und Abwärtsbewegungen finden mit gleicher Wahrscheinlichkeit statt). 1 Nehmen Sie an, dass
Aufgaben Brealey/Myers [2003], Kapitel 21
![Aufgaben Brealey/Myers [2003], Kapitel 21 Aufgaben Brealey/Myers [2003], Kapitel 21](/thumbs/25/5752225.jpg) Quiz: 1, 2, 4, 6, 7, 10 Practice Questions: 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13 Folie 0 Lösung Quiz 7: a. Das Optionsdelta ergibt sich wie folgt: Spanne der möglichen Optionspreise Spanne der möglichen Aktienkurs
Quiz: 1, 2, 4, 6, 7, 10 Practice Questions: 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13 Folie 0 Lösung Quiz 7: a. Das Optionsdelta ergibt sich wie folgt: Spanne der möglichen Optionspreise Spanne der möglichen Aktienkurs
Tangentengleichung. Wie lautet die Geradengleichung für die Tangente, y T =? Antwort:
 Tangentengleichung Wie Sie wissen, gibt die erste Ableitung einer Funktion deren Steigung an. Betrachtet man eine fest vorgegebene Stelle, gibt f ( ) also die Steigung der Kurve und somit auch die Steigung
Tangentengleichung Wie Sie wissen, gibt die erste Ableitung einer Funktion deren Steigung an. Betrachtet man eine fest vorgegebene Stelle, gibt f ( ) also die Steigung der Kurve und somit auch die Steigung
TOP SELECT PLUS Newsletter Nr.2
 TOP SELECT PLUS Newsletter Nr.2 Anspruch und Wirklichkeit - TOP SELECT PLUS Montag, 4. Juni 2012 Vermögensverwaltungen gibt es wie Sand am Meer. Darunter befinden sich solche, die ihrem Namen alle Ehre
TOP SELECT PLUS Newsletter Nr.2 Anspruch und Wirklichkeit - TOP SELECT PLUS Montag, 4. Juni 2012 Vermögensverwaltungen gibt es wie Sand am Meer. Darunter befinden sich solche, die ihrem Namen alle Ehre
Leitlinien. über die bei Sanierungsplänen zugrunde zu legende Bandbreite an Szenarien EBA/GL/2014/06. 18. Juli 2014
 EBA/GL/2014/06 18. Juli 2014 Leitlinien über die bei Sanierungsplänen zugrunde zu legende Bandbreite an Szenarien 1 Leitlinien der EBA u ber die bei Sanierungspla nen zugrunde zu legende Bandbreite an
EBA/GL/2014/06 18. Juli 2014 Leitlinien über die bei Sanierungsplänen zugrunde zu legende Bandbreite an Szenarien 1 Leitlinien der EBA u ber die bei Sanierungspla nen zugrunde zu legende Bandbreite an
Tilgungsplan im NTCS Controlling
 im Der bietet die Möglichkeit, neue oder bestehende Darlehen und Kredite in übersichtlicher Form zu erfassen. Ebenso können gewährte Darlehen dargestellt werden. Neue Darlehen und Kredite Der Einstieg
im Der bietet die Möglichkeit, neue oder bestehende Darlehen und Kredite in übersichtlicher Form zu erfassen. Ebenso können gewährte Darlehen dargestellt werden. Neue Darlehen und Kredite Der Einstieg
Lohnt sich immer mehr: Solarstrom, den man selbst verbraucht
 Lohnt sich immer mehr: Solarstrom, den man selbst verbraucht Warum sich eine PV-Anlage auch heute noch rechnet Auch nach den letzten Förderungskürzungen sind PV- Anlagen weiterhin eine gewinnbringende
Lohnt sich immer mehr: Solarstrom, den man selbst verbraucht Warum sich eine PV-Anlage auch heute noch rechnet Auch nach den letzten Förderungskürzungen sind PV- Anlagen weiterhin eine gewinnbringende
Die Abbildung variabler. Zukunftsorientiert mischen. Banksteuerung. 36 Titelthema: Im Einklang
 36 Titelthema: Im Einklang Banksteuerung Zukunftsorientiert mischen Gerade im aktuellen Zinsumfeld kommt der Steuerung der variablen Passivprodukte eine erhebliche Bedeutung zu. Die zukunftsorientierte
36 Titelthema: Im Einklang Banksteuerung Zukunftsorientiert mischen Gerade im aktuellen Zinsumfeld kommt der Steuerung der variablen Passivprodukte eine erhebliche Bedeutung zu. Die zukunftsorientierte
Informatik 2 Labor 2 Programmieren in MATLAB Georg Richter
 Informatik 2 Labor 2 Programmieren in MATLAB Georg Richter Aufgabe 3: Konto Um Geldbeträge korrekt zu verwalten, sind zwecks Vermeidung von Rundungsfehlern entweder alle Beträge in Cents umzuwandeln und
Informatik 2 Labor 2 Programmieren in MATLAB Georg Richter Aufgabe 3: Konto Um Geldbeträge korrekt zu verwalten, sind zwecks Vermeidung von Rundungsfehlern entweder alle Beträge in Cents umzuwandeln und
Wie wird ein Jahreswechsel (vorläufig und endgültig) ausgeführt?
 Wie wird ein (vorläufig und endgültig) ausgeführt? VORLÄUFIGER JAHRESWECHSEL Führen Sie unbedingt vor dem eine aktuelle Datensicherung durch. Einleitung Ein vorläufiger Jahresabschluss wird durchgeführt,
Wie wird ein (vorläufig und endgültig) ausgeführt? VORLÄUFIGER JAHRESWECHSEL Führen Sie unbedingt vor dem eine aktuelle Datensicherung durch. Einleitung Ein vorläufiger Jahresabschluss wird durchgeführt,
Frauen-Männer-Studie 2012 der DAB Bank Männer und Frauen liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen
 Frauen-Männer-Studie 2012 der DAB Bank Männer und Frauen liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen Die DAB Bank hat zum fünften Mal das Anlageverhalten von Frauen und Männern umfassend untersucht. Für die Frauen-Männer-Studie
Frauen-Männer-Studie 2012 der DAB Bank Männer und Frauen liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen Die DAB Bank hat zum fünften Mal das Anlageverhalten von Frauen und Männern umfassend untersucht. Für die Frauen-Männer-Studie
AZK 1- Freistil. Der Dialog "Arbeitszeitkonten" Grundsätzliches zum Dialog "Arbeitszeitkonten"
 AZK 1- Freistil Nur bei Bedarf werden dafür gekennzeichnete Lohnbestandteile (Stundenzahl und Stundensatz) zwischen dem aktuellen Bruttolohnjournal und dem AZK ausgetauscht. Das Ansparen und das Auszahlen
AZK 1- Freistil Nur bei Bedarf werden dafür gekennzeichnete Lohnbestandteile (Stundenzahl und Stundensatz) zwischen dem aktuellen Bruttolohnjournal und dem AZK ausgetauscht. Das Ansparen und das Auszahlen
Mathematik-Klausur vom 4.2.2004
 Mathematik-Klausur vom 4.2.2004 Aufgabe 1 Ein Klein-Sparer verfügt über 2 000, die er möglichst hoch verzinst anlegen möchte. a) Eine Anlage-Alternative besteht im Kauf von Bundesschatzbriefen vom Typ
Mathematik-Klausur vom 4.2.2004 Aufgabe 1 Ein Klein-Sparer verfügt über 2 000, die er möglichst hoch verzinst anlegen möchte. a) Eine Anlage-Alternative besteht im Kauf von Bundesschatzbriefen vom Typ
Derivate und Bewertung
 . Dr. Daniel Sommer Marie-Curie-Str. 30 60439 Franfurt am Main Klausur Derivate und Bewertung.......... Wintersemester 2008/09 Klausur Derivate und Bewertung Wintersemester 2008/09 Aufgabe 1: Zinsurven,
. Dr. Daniel Sommer Marie-Curie-Str. 30 60439 Franfurt am Main Klausur Derivate und Bewertung.......... Wintersemester 2008/09 Klausur Derivate und Bewertung Wintersemester 2008/09 Aufgabe 1: Zinsurven,
(1) Problemstellung. (2) Kalman Filter
 Inhaltsverzeichnis (1) Problemstellung...2 (2) Kalman Filter...2 Funktionsweise... 2 Gleichungen im mehrdimensionalen Fall...3 Schätzung des Systemzustands...3 Vermuteter Schätzfehler... 3 Aktualisierung
Inhaltsverzeichnis (1) Problemstellung...2 (2) Kalman Filter...2 Funktionsweise... 2 Gleichungen im mehrdimensionalen Fall...3 Schätzung des Systemzustands...3 Vermuteter Schätzfehler... 3 Aktualisierung
