Übersicht zu Stated Preference- Studien in der Schweiz und Abschätzung von Gesamtelastizitäten
|
|
|
- Gotthilf Salzmann
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Übersicht zu Stated Preference- Studien in der Schweiz und Abschätzung von Gesamtelastizitäten Statusbericht 2012
2 Impressum Herausgeber Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) Auftraggeber Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) Bundesamt für Strassen (ASTRA) Bundesamt für Verkehr (BAV) Auftragnehmer Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme, ETH Zürich, CH-8093 Zürich Bearbeitung Prof. Dr. Kay Axhausen (Projektleitung) Dr.sc. ETH Philipp Fröhlich Beratung Dr. Helmut Honermann (ARE) Produktion Stabstelle Information ARE Zitierweise Bundesamt für Raumentwicklung ARE (2012), Übersicht zu Stated Preference-Studien in der Schweiz und Abschätzung von Gesamtelastizitäten, Statusbericht 2012 Bezugsquelle Januar 2012
3 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... I 1 Einleitung Aufgabenstellung Definitionen Aufbau des Berichtes SP-Befragungen zum Verkehrsverhalten in der Schweiz Übersicht Schweizer SP-Befragungen Vergleich Modellergebnisse und Interpretation Abschätzung von Gesamtelastizitäten Der Begriff Elastizität Methoden und Daten zur Berechnung von Elastizitäten Vorher-Nachher-Untersuchungen Gebietsmodelle ÖV Zeitreihenanalysen Benzinverbrauch Gebietsmodelle für den MIV mit Näherungswerten Verkehrsmodelle Regressionsanalyse aus Verkehrsverhaltensdaten Elastizitäten aus diskreten Entscheidungsmodellen Empfehlungen Elastizitäten Weitere Forschung Literaturverzeichnis I
4 Abstract Der Bericht beschäftigt sich mit dem Vergleich der Stated Preference (SP)-Befragung 2010 zum Verkehrsverhalten zu den früher durchgeführten Schweizer SP-Studien und gibt Empfehlungen für Gesamtelastizitäten zur Aktualisierung der Energieperspektiven Die unterschiedlichen Elastizitätsbegriffe werden erklärt und die Untersuchungsmethoden beschrieben. Abrégé Le rapport traite de la comparaison du sondage SP 2010 aux sondages effectués antérieurement, et donne des recommandations pour les élasticités générales de la demande à utiliser pour le calcul des perspectives énergétiques Les différents termes relatifs à l élasticité sont expliqués, et les méthodes d analyse sont décrites. II
5 Zusammenfassung Unter Federführung des Bundesamtes für Raumentwicklung (ARE) wurde 2010/2011 eine Stated Preference (SP)-Befragung 2010 zum Verkehrsverhalten (SP-B 2010) durchgeführt. Die ersten Ergebnisse dieser Studie sollen vorab in Bezug auf schon früher durchgeführte SP- Befragungen eingeordnet werden. Dabei werden Eigenschaften und Kennzahl für lineare Modellformulierungen der insgesamt fünf SP-Befragungen mit einander verglichen. Es konnte festgestellt werden, dass die Anzahl von Beobachtungen in der SP-B 2010 weit über den bisherigen SP-Befragungen in der Schweiz liegt. Auch die Ausdifferenzierung der Situationen mit den zusätzlichen Alternativen Velo und zu Fuss sowie der Einbezug von Wegen an Wochenenden sind hervorzuheben. Die ermittelte Modellgüte zeigt, dass die Erklärungskraft im oberen Erwartungsbereich liegt. Die Zeitwerte (VTTS) für den MIV und ÖV liegen im Bereich der voran gegangenen Studien. Die SP-B 2010 ist eine solide und umfangreiche Datengrundlage für verschiedene Modellschätzungen, deren Resultate für unterschiedliche Fragestellungen in der Verkehrsplanung und -politik anwendbar sein werden. Für die Aktualisierung der Energieperspektiven im Rahmen der neuen Energiestrategie 2050 des Bundesrates werden Empfehlungen für Gesamtelastizitäten für kurz- und langfristige Entwicklungen bezüglich Preis und Zeit gegeben. Zusätzlich sind die verschiedenen Elastizitätsbegriffe erklärt und die Methoden zur Ableitung von Elastizitäten dargestellt. Aufgrund der durchgeführten Literaturstudie verschiedener inländischer und ausländischer Projekte muss festgestellt werden, dass keine Untersuchung die spezifischen Anforderungen der Aufgabenstellung nach Gesamtelastizitäten der Fahrleistung nach Kosten und Zeit vollumfänglich erfüllt. Hier ist insbesondere anzumerken, dass bei den bisherigen Schweizer Studien die Elastizitäten auf Basis von Wegen (Verkehrsaufkommen) untersucht wurden und nur in einer Studie ein Näherungswert für die gesuchte Gesamtelastizität der Fahrleistung (Fahrzeug-Kilometer, Fzkm) abgeleitet wurde. Folgende Empfehlungen für grobe Richtwerte der kurz- und langfristigen Gesamtelastizitäten für die Schweiz können basierend auf der Analyse gegeben werden: MIV Gesamtelastizität bezüglich MIV-Zeit: -0.40/-0.90 MIV Gesamtelastizität bezüglich MIV-variable Kosten: -0.15/-0.35 ÖV Gesamtkreuzelastizität bezüglich MIV-Zeit: 0.50/0.60 ÖV Gesamtkreuzelastizität bezüglich MIV-variable Kosten: 0.15/0.20 III
6 Dies bedeutet zum Beispiel, wenn die MIV-Zeit um 10 % steigt, dann geht die MIV- Fahrleistung kurzfristig um 4% und langfristig um 9% zurück. Andererseits steigt die ÖV- Verkehrsleistung kurzfristig um 5% und langfristig um 6%. Résumé Sous la direction de l office fédéral du développement territorial (ARE), un sondage SP (S-SP 2010) sur le comportement en matière de transports a été effectué en 2010/2011. Les premiers résultats de cette étude doivent être préalablement comparés à des résultats d études antérieures. À cette fin, les propriétés et les nombres caractéristiques des modèles linéaires sont comparés pour 5 sondages. Le nombre d observations du S-SP 2010 dépasse de loin ceux des sondages antérieurs. Il faut également mettre en valeur la différentiation des situations prenant en compte les alternatives «à pied» et «vélo» ainsi que l inclusion de trajets effectué en fin de semaine. La qualité des modèles estimés atteint des valeurs très satisfaisantes. Les valeurs du temps (VTTS) pour les transports individuel et en commun sont proches des valeurs trouvées dans les études antérieures. Le S-SP 2010 est donc une base de données solide et de grande échelle qui peut être utilisé pour l estimation d une pluralité de modèles, dont les résultats pourront être appliqués sur différents problèmes de la planification et de la politique en matière des transports de personnes. Pour l actualisation de perspectives énergétiques dans le cadre de la nouvelle stratégie énergétique 2050 du conseil fédéral, des recommandations pour des élasticités générales de la demande sont données à court et à long terme, relatives aux prix et aux temps de trajet. De plus, les différents termes relatifs à l élasticité sont expliqués, et les méthodes d analyse sont décrites. Sur la base d une recherche de littérature sur différents projets Suisses et internationaux, aucune étude ne remplit les exigences spécifiques du problème posé. Il faut noter en particulier que les études en Suisse ont examiné les élasticités basées sur les trajets effectués et qu une seule étude donne des valeurs approximatives pour l élasticité cherchée qui est celle de la demande totale (des kilométrages totaux effectués). Les recommandations suivantes pour des valeurs indicatives des élasticités de la demande sont données pour la Suisse, sur la base des analyses présentées : en transports individuels, relative au temps de parcours en transports individuels: /-0.90 en transports individuels, relative aux coûts variables en transports individuels: -0.15/ IV
7 en transports en commun, relative au temps de parcours en transports individuels: 0.50/0.60 en transports en commun, relative aux coûts variables en transports individuels: 0.15/0.20 Par exemple, si les temps de parcours en transport individuels augmentaient de 10%, la demande totale en transports individuels diminuerait de 4% à court terme, et de 9% à long terme. Par contre, la demande en transports en commun augmenterait de 5% à court terme et de 6% à long terme. V
8 1 Einleitung 1.1 Aufgabenstellung Unter Federführung des Bundesamtes für Raumentwicklung (ARE) wurde 2010/2011 eine Stated Preference 1 (SP)-Befragung 2010 zum Verkehrsverhalten (SP-B 2010) durchgeführt. Die ersten Ergebnisse dieser Studie sollen vorab in Bezug auf schon früher durchgeführte SP- Befragungen eingeordnet werden. Endgültige Modellschätzungen erfolgen erst in einem späteren Projekt und deren volle Tragweite wird erst in dem neu kalibrierten Nationalen Personenverkehrsmodell (2013/2014) sichtbar werden. Für die Aktualisierung der Energieperspektiven im Rahmen der neuen Energiestrategie 2050 des Bundesrates benötigt das Bundesamt für Energie (BFE) Empfehlungen für Gesamtelastizitäten für kurz- und langfristige Entwicklungen bezüglich Preis und eventuell Zeit, falls möglich mit den zugehörigen Kreuzelastizitäten. Die Gesamtelastizität sollte sich dabei auf die Fahrleistung (Fahrzeugkilometer, Fzkm) beziehen. Zusätzlich sollen die verschiedenen Elastizitätsbegriffe erklärt, die Methoden zur Ableitung von Elastizitäten dargestellt und möglicher Forschungsbedarf formuliert werden. 1.2 Definitionen In der Verkehrsnachfrageberechnung wird grundsätzlich unterschiedenen zwischen Gesamtelastizitäten, Verkehrsmittelelastizitäten und Zeitwerten. Deren Merkmale sind: Die Gesamtelastizität gibt die relativen Gesamtnachfrageveränderung (meist als Fahrleistung) einer Alternative aufgrund der relativen Veränderung eines Attributes (meist Preis oder Zeit) an. Die Gesamtnachfragereaktionen umfasst dabei alle möglichen Veränderungen wie: Besitz von Mobilitätswerkzeugen, Zielwahl, Verkehrsmittelwahl oder Routenwahl. 1 Bei SP-Befragungen werden den Befragten hypothetische Situationen vorgelegt, dadurch werden mögliche Verhaltensänderungen durch die Vorgabe mehrerer Alternativen mit veränderten Rahmenbedingungen ermittelt. Bei Revealed Preference (RP)-Befragungen werden hingegen Entscheidungen unter realen Bedingungen erhoben. 1
9 Die Elastizität der Verkehrsmittelwahl gibt die relative Veränderung der Marktanteile eines Verkehrsmittels (meist auf Wegeniveau) bei einer relativen Veränderung eines Attributes an. Es wird also nur von Umsteigern von einem Verkehrsmittel auf ein anderes ausgegangen. Der Zeitwert (Value of Travel Times Savings, VTTS) gibt für ein Verkehrsmittel die Zahlungsbereitschaft der Nutzer für Fahrzeiteinsparung an und zeigt somit den Abwägungsprozess z.b. zwischen Fahrtzeit und Kosten. 1.3 Aufbau des Berichtes Der Bericht ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil (Kapitel 2) wird die Stated Preference (SP)-Befragung 2010 zum Verkehrsverhalten (SP-B 2010) mit den früheren SP-Studien und die wichtigsten Ergebnisse verglichen. Im zweiten Teil (Kapitel 3) wird auf den Begriff Elastizität eingegangen, die verschiedenen Methoden ihrer Berechnung erklärt und Richtwerte für Gesamtelastizitäten für die Energieperspektiven 2050 angegeben. 2
10 2 SP-Befragungen zum Verkehrsverhalten in der Schweiz SP-Befragungen werden in der Schweiz seit rund 10 Jahren durchgeführt und haben heute einen festen Stellenwert in der Verkehrsplanung. Nachfolgend wird eine Übersicht über die durchgeführten landesweiten SP-Befragungen gegeben. 2.1 Übersicht Schweizer SP-Befragungen Folgende SP-Befragungen wurden in den letzten Jahren in der Schweiz durchgeführt und werden hier bezüglich ihrer Eigenschaften und Resultate verglichen: Die Zielsetzung der SP-Befragung 2010 zum Verkehrsverhalten im Personenverkehr (hier kurz SP-B 2010 genannt) war, eine SP-Befragung zu konzipieren und durchzuführen, welche bezüglich der Wegecharakteristiken und der räumlichen und soziodemographischen Merkmale der Befragten, die Stichprobe des Mikrozensus 2010 (MZMV) repräsentativ widerspiegelt. Diese Befragung (Fröhlich, Weiss, Vrtic und Axhausen, 2011) wurde vom ARE federführend mit Unterstützung der Bundesämter für Strassen (ASTRA), für Verkehr (BAV), für Energie (BFE) und für Umwelt (BAFU) sowie acht Kantonen (ZH, BE, LU, ZG, SO, BS, AG, TI) und der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) gemeinsam in Auftrag gegeben. Es wurden Verkehrsmittel- und Routenwahlentscheidungen abgefragt. Die Studie Benzinpreis und Bahnnutzung (kurz SBB) wurde im Auftrag der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) durchgeführt (Weis und Axhausen, 2009). Der Fokus der Befragung lag einerseits beim Verkehrsmittelwahlverhalten bei hohen Benzinpreisen und andererseits bei der strategischen Wahl zum Mobilitätswerkzeugbesitz. Der Durchführungszeitraum war im September und Oktober 2008 als der Benzinpreis recht hoch und im Blickfeld der Medienberichterstattung war. Die Befragung umfasste Verkehrsmittelund Mobilitätswerkzeugbesitzexperimente. Das Projekt Einbezug der Reisekosten bei der Modellierung des Mobilitätsverhaltens (kurz MP für Mobility Pricing genannt) (Vrtic, Schüssler, Erath, Bürgle, Axhausen, Frejinger, Bierlaire, Rudel, Scagnolari und Maggi, 2008) wurde im Rahmen des Forschungsprojektes Mobility Pricing im Auftrag der Vereinigung Schweizerischer Verkehrsingenieure (SVI) durchgeführt. Die Zielsetzung war, umfassende Erkenntnisse zu den Folgen einer möglichen Einführung verschiedener Mautstrategien zu generieren. Ein kombiniertes Routen-, 3
11 Abfahrtszeit- und zwei Verkehrsmittelwahlexperimente, wovon eines mit einer Abfahrtszeitwahl kombiniert wurde, bilden hier die Datengrundlage. Die Studie Zeitkostenansätze im Personenverkehr (hier in Kurzform SVI genannt) (König und Axhausen, 2004) wurde im Auftrag der Vereinigung Schweizerischer Verkehrsingenieure (SVI) durchgeführt. Die SVI SP-Befragung diente zur Erstellung der Schweizer Kosten-Nutzennorm (VSS, 2006) und wurde zur Schätzung der monetären Bewertung von Reisezeitgewinnen entworfen. Der Fragebogen umfasste Routen- und Verkehrsmittelwahlexperimente. Die SP-Befragung im Rahmen des Projektes Verifizierung von Prognosemethoden im Personenverkehr: Ergebnisse einer Vorher-/Nachher Untersuchung auf der Grundlage eines netzbasierten Verkehrsmodells, welches nachstehend mit ICN bezeichnet wird, wurde erhoben um die erwarteten Nachfrageveränderungen aufgrund der Einführung von Neigezügen zwischen Zürich und Lausanne (Jurasüdfusslinie) zu berechnen (Vrtic, Axhausen, Maggi und Rossera, 2003). Dieser Datensatz umfasst Verkehrsmittel- und Routenwahlexperimente. Die Auftraggeber waren die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) und das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE). Bei allen Befragungen wurden die Experimente als Stated Choice Situation abgefragt, dies bedeutet dass der Befragte aus einer Alternativenmenge eine auswählen muss. In Tabelle 1 sind wichtige Eigenschaften und soziodemographische Kennzahlen der verschiedenen SP- Befragungen zusammengefasst. 4
12 Tabelle 1 Eigenschaften und Kennzahlen der verschiedenen SP-Befragungen SP-B 2010 SBB MP SVI ICN Berichteter Weg MZMV KEP KEP KEP KEP Zeitraum 9-11/ /2008 8/05-1/ / /2001 Anzahl Befragte Wochentage Alle Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Rücklauf 71% 58% 47% 53% 68% Versuchsdesign* ED ED OD OD OD Alternativen Verkehrsmittel MIV, ÖV, Fuss, Velo MIV, ÖV MIV, ÖV MIV, ÖV MIV, ÖV Median Weglänge 11km 38km 56km 43km 46km Männlich 48% 48% 56% 59% 51% HalbTax 27% 45% 42% 52% 43% GA 6% 13% 13% 11% 11% PW immer 79% 77% 67% 73% 59% PW gelegentlich 16% 16% 20% 14% 22% PW nie 5% 7% 13% 13% 19% Jahreseinkommen (CHF)** n.a. Anmerkungen: * Erstellungsmethodik des Versuchsdesigns: OD Orthogonal Design, ED Efficient Design ** Aufgrund der unterschiedlichen Einteilung der Einkommensklassen in den Studien wurde mit den Besetzungsprozenten und den Klassemittelwerten ein Durchschnittseinkommen berechnet. Die Schwankungen zwischen den Studien dürfen aber nicht überinterpretiert werden, da diese Variable von den Befragten oft verweigert wird und deshalb schon einige, wenige Antworten den Mittelwert beeinflussen können. Die SP-B 2010 wurde im Gegensatz zu den anderen Arbeiten für eine Vielzahl von Auftraggebern auf Kantons- und Bundesebene erstellt und nicht für ein spezifisches Projekt bzw. Zweck durchgeführt. Zusätzlich war explizit gefordert, dass die SP-B 2010 die Stichprobe des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010 (MZMV) repräsentativ widerspiegelt. Erstmals wurden dabei nicht nur Experimente zu Wegen an Werktagen sondern auch an Wochenendtagen abgefragt, daraus können sich insbesondere zu den Freizeitwegen am Wochenende neue Erkenntnisse ergeben. Ihr Rücklauf liegt mit 71% höher als bei den anderen Studien. Bei den Verkehrsmittelwahlexperimenten konnte aufgrund des höheren Anteils kürzerer Wege in der MZMV Stichprobe gegenüber den Daten aus der Kontinuierlichen Erhebung Personenverkehr (KEP) von der SBB auch die Alternativen Velo und Fuss abgefragt werden. Die durchschnittliche Wegelänge der berichteten Wege ist mit 11 km um mindestens zwei 5
13 Drittel geringer als bei den anderen Studien basierend auf den KEP-Daten, wo auch aufgrund des jeweiligen Fokus längere Wege im Vordergrund standen. Die Besitzraten der Mobilitätswerkzeuge (PW, Halbtax und GA) zeigen, dass die SP-B 2010 nicht mit dem bekannten Problem einer Übergewichtung von bahnaffinen Personen, wie in den KEP-Daten, behaftet ist. 2.2 Vergleich Modellergebnisse und Interpretation Die nachfolgende Tabelle 2 zeigt eine Zusammenfassung von wichtigen Kennzahlen der Schätzungen von linearen Modellformen der Verkehrsmittelwahl mit den unterschiedlichen SP-Daten. Die jeweiligen Modellformulierungen der Schätzungen sind zwar nicht ident, aber ähnlich genug, um Aussagen zur Einordnung der SP-B 2010 zu den früheren SP-Befragungen zu machen. Eine Neuschätzung mit einheitlicher Modellformulierung aller SP-Befragungen ist nur mit entsprechendem Aufwand möglich und kann hier nicht durchgeführt werden. Tabelle 2 Schätzresultate und Zeitwerte für lineare Modellformen der verschiedenen SP SP-B 2010 SBB MP SVI ICN Beobachtungen Anzahl Parameter Adj. Rho VTTS MIV (CHF/h) VTTS ÖV (CHF/h) Die Anzahl der Beobachtungen der SP-B 2010 entspricht etwas mehr als die Gesamtanzahl aller anderen SP-Befragungen zusammen. Damit wurde mit der SP-B 2010 eine reichhaltige Grundlage für methodisch, fortschrittliche aber auch regional bzw. zeitlich differenzierte Schätzungen gelegt. Auch im Vergleich zu Studien im Ausland ist diese Befragung als umfangreich zu bezeichnen. Die Modelle sind zwar alle in linearer Form, aber die Anzahl der berücksichtigten Attribute und damit der geschätzten Parameter ist unterschiedlich. Bei der Schätzung der SP-B 2010 wurden z.b. Dummy-Variablen für die Wegezwecke (Arbeit, Bildung, Einkauf, Geschäft und Freizeit) als auch für die Raumtypen verwendet. Bei der MP-Befragung wurden kombinierte Entscheidungen (Verkehrsmittel- und Routenwahl) analysiert und auch die Anzahl der Preisvariablen beim MIV unterscheiden sich bei den Studien. 6
14 Für die SP-B 2010 liegen bisher nur Testmodelle vor, welche im Rahmen des Erhebungsprojektes geschätzt wurden, aber die dabei ermittelte Modellgüte (adjusted Rho 2, auch adjusted Pseudo-R 2 genannt) zeigt, dass die Erklärungskraft im oberen Erwartungsbereich liegt. Der adjusted Rho 2 -Wert zeigt das Verhältnis des Loglikelihood- Werts des geschätzten Modells mit dem Wert des Basismodells, in dem alle Parameter auf Null gesetzt sind, unter Beachtung der Anzahl Parameter. Die Ermittlung der Zeitwerte (VTTS, Value of Travel Time Savings) kann direkt aus den Parametern der Modelle mit den SP-Daten erfolgen, da dabei allgemeine Skalierungsunterschiede, anders als bei den Elastizitäten, keine Rolle spielen. Die Zeitwerte (VTTS) für den MIV und ÖV liegen im Durchschnittsbereich der voran gegangenen Studien. Dabei zeigt sich, dass die MIV-Nutzer eine höhere Zahlungsbereitschaft für Fahrtzeitreduktionen als ÖV-Nutzer haben. Die Variation der VTTS-Werte in den verschiedenen Studien können unterschiedlicher Ursache haben, wie z.b. Verteilung der Fahrtweiten, Fahrzweckanteile, Einkommen, Attributsausprägungen und Versuchsplandesign. Die Ermittlung der Elastizitäten der Verkehrsmittelwahl kann hier noch nicht gezeigt werden, da sie aus gemeinsamen SP und RP-Daten erfolgen sollte. Die Gründe für diese Vorgangsweise liegen einerseits bei möglichen Verzerrungen der Parameter aufgrund unterschiedlicher Marktanteile (z.b. ÖV Wahlanteil in SP-Daten versus ÖV Wahlanteil in RP-Daten) und andererseits in Verzerrungen bei den Variablenmittelwerte in den SP-Daten gegenüber den berichteten Wegen (RP). Als Beispiel für das letztere Argument sei daran erinnert, dass in der SP-Studie Nutzwege und längere Wege gegenüber den berichteten Wegen übergewichtet wurden. Dies ist für die SP-Befragung sinnvoll und vorteilhaft gewesen, bei der Berechnung von Elastizitäten führt es aber aufgrund der direkten Berücksichtigung der Variablenmittelwerte zu Verzerrungen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Anzahl von Beobachtungen in der SP- B 2010 weit über den bisherigen SP-Befragungen in der Schweiz liegt. Auch die Ausdifferenzierung der Situationen mit den zusätzlichen Alternativen Velo und zu Fuss sowie der Einbezug von Wegen an Wochenenden sind hervorzuheben. Die SP-B 2010 ist eine solide und umfangreiche Datengrundlage für verschiedene Modellschätzungen, deren Resultate für unterschiedliche Fragestellungen in der Verkehrsplanung und -politik anwendbar sein werden. 7
15 3 Abschätzung von Gesamtelastizitäten 3.1 Der Begriff Elastizität In der Ökonomie gibt die Elastizität die Reaktion der relativen Marktanteile auf die relativen Änderungen eines Attributes der Alternative an. In der Verkehrsplanung werden vorwiegend folgende Elastizitäten verwendet: - Zeitelastizität: Welchen Einfluss haben Zeitänderungen (Reisezeit, Fahrtzeit, ) auf die Verkehrsnachfrage? - Preiselastizität: Welchen Einfluss haben Preisänderungen auf die Verkehrsnachfrage? - Einkommenselastizität: Welchen Einfluss haben Änderungen des Einkommens auf die Verkehrsnachfrage? Andere in der Ökonomie verwendete, aber für die Verkehrsplanung irrelevanten Elastizitätsbegriffe, sind z.b. die Steuerertragselastizität (die Reaktion des Steuerertrags bei einer relativen Veränderung der Bemessungsgrundlage), oder Zinselastizität (wie eine Obligation auf eine relative Veränderung des Zinssatzes reagiert). Weiters wird der Begriff Elastizität in der Werkstoffwissenschaft, Elektronik und im Motorenbau verwendet. Die Eigenelastizität misst die relative Veränderung in Prozenten der Marktanteile einer bestimmten Alternative in Bezug auf die relative Veränderung eines Attributes derselben Alternative. Die Kreuzelastizität misst die relative Veränderung in Prozenten der Marktanteile einer bestimmten Alternative in Bezug auf die relative Veränderung eines Attributes einer konkurrierenden Alternative. Als Formel ausgedrückt, wird die Eigenelastizität i k Alternative i bezüglich der Änderung des Attributes k zwischen dem Zustand 0 und dem Zustand 1 bzw. die dazugehörige Kreuzelastizität folgendermassen berechnet: der Bei kleinen Attributsveränderungen wird die Methode der Punktelastizität, also die Steigung an einem Punkt der Nachfragekurve verwendet. Für grosse Attributsveränderungen wird die Bogenelastizität, die Steigung zwischen zwei Punkten der unbekannten Nachfragekurve, angewendet. Mit kurz- und langfristiger Elastizität wird die unterschiedliche Anpassungszeit 8
16 auf den veränderungsauslösenden Impuls beschrieben. Die Grenze zwischen kurz- und langfristiger Elastizität wird in der Literatur meist bei einem Jahr gelegt. Die Motivation für die Verwendung der Elastizität liegt einerseits in der guten Beschreibung der Struktur der Nachfragereaktion und andererseits in der klaren und kompakten Aussage zu sehr komplexen Verhaltensänderungen. Natürlich liegt hier auch das inhärente Problem begründet, dass einfache Konzepte für komplexe Sachverhalte leicht falsch eingesetzt werden. Eine vertiefende Diskussion findet sich in Cerwenka (2002). Grundsätzlich muss in der Verkehrsplanung unterschieden werden, ob bei Elastizitäten von aggregierten oder von disaggregierten Daten gesprochen wird. Bei aggregierten Daten, wie z.b. der Elastizität des Treibstoff- und Benzinverbrauchs einer Region oder Landes werden verschiedene Entscheidungsebenen im Verkehrsverhalten einer Population summiert und die Schätzung der Gesamtelastizität aller Modellschritte erfolgt mit linearer Regression bzw. darauf aufbauende verfeinerte Zeitreihenmethoden. Bei disaggregierten Daten, bei welchen Entscheidungen von Individuen auf einer Entscheidungsebene (insbesondere Verkehrsmittelwahl) abgebildet sind, beziehen sich die ermittelten Elastizitäten nur auf diese Entscheidungsebene, z.b. Elastizität der Verkehrsmittelwahl. Sie berücksichtigt bei einer konstanten Wegeanzahl auf einer Relation die relative Veränderung der Marktanteile der Alternative hervorgerufen durch eine relative Veränderung eines ihrer Attribute. Die Nachfrage wird dabei im Normalfall als Wege (Verkehrsaufkommen) angegeben. Bei Gesamtelastizitäten muss genau unterschieden werden, ob es sich bei der Bezugsgrösse um Wege (Verkehrsaufkommen) oder Fahrzeugkilometer bzw. Personenkilometer (Fahrbzw. Verkehrsleistung) handelt. 3.2 Methoden und Daten zur Berechnung von Elastizitäten Nachfolgend werden die verschiedenen Methoden und Datengrundlagen zur Elastizitätsberechnung zusammengefasst, ihre Vor- und Nachteile aufgeführt und Beispiele für Untersuchungen gegeben Vorher-Nachher-Untersuchungen Die meisten Vorher-Nachher-Untersuchungen vergleichen Verkehrsaufkommen vor und nach einer Massnahme. Ihnen wird aufgrund der schwierigen Isolierung von Wirkungen aber eine geringe Aussagekraft zugesprochen, sie haben aber eine hohe Transparenz und werden von Entscheidungsträgern geschätzt. Viele solcher Untersuchungen beinhalten die Probleme der 9
17 Trennung von verschiedenen Nachfrageveränderungen, die zeitliche Entwicklung und externe Einflüsse, wie z.b. Konjunkturschwankungen. Insbesondere für den städtischen ÖV mit grossangelegten, aber klar definierten Änderungen (Betriebskilometer) und umfangreichen Fahrgastzählungen, können kurzfristige Gesamtelastizitäten auf dem Wegeniveau im ÖV abgeschätzt werden, dabei sind Wechselwirkungen zum MIV aber schwierig zu beurteilen Gebietsmodelle ÖV Zeitreihenanalysen dienen zur Untersuchung der Abfolgen von Datenpunkten, welche nicht kontinuierlichen sondern diskret aber mit gleichen wiederkehrenden Zeitintervallen vorliegen. Sie kann als Spezialfall der Regressionsanalyse angesehen werden. In Schweden wurden für sechs Städte (Tegnér und Jarlebring, 2004) nichtlineare Box-Cox Zeitreihenanalysen durchgeführt, dabei lagen Datenreihen für einen längeren Zeitraum (5-30 Jahre) vor und die Verkehrsnachfrage wurde meist aus den Billettverkäufen (Wegebasis) bestimmt. Damit konnten kurz- und langfristige Gesamtelastizitäten von ÖV-Fahrten im Nahverkehr bestimmt werden. Die nachfolgenden Abbildung 1 und Abbildung 2 zeigen die Gesamtnachfrageelastizität auf Wegeebene bezüglich der wichtigsten Variablen und die interessanteste Schlussfolgerungen der stark unterschiedlichen Preiselastizitäten nach Billettart. 10
18 Abbildung 1 Zeitreihenanalysen ÖV: Gesamtelastizitäten auf Wegebasis der Haupteinflussvariablen für sechs schwedische Städte Fares -2,7-1,3-0,3 Supply (Veh. Km) 0,1 0,7 0,45 Shopping Act. 0,4 0,15 0,7 Employment Population High Average Low 0,2 0,2 0,5 0,5 0,8 1,2-3 -2,5-2 -1,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Quelle: Tegnér und Jarlebring (2004) Anmerkung: High, average bzw. low bezieht sich auf den höchsten, mittleren bzw. niedrigsten Wert von den sechs Städten. Abbildung 2 Zeitreihenanalysen ÖV: Unterschiedliche Gesamtelastizitäten auf Wegebasis nach Billettart -0,3 Cards -0,6-1,1-1,0 Pre-paid coupons -2,0-2,7 Cash coupons High Average Low -1,3-0,7-2,0-3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 Quelle: Tegnér und Jarlebring (2004) Anmerkung: High, average bzw. low bezieht sich auf den höchsten, mittleren bzw. niedrigsten Wert von den sechs Städten. 11
19 Die Gesamtelastizität der Nachfrage im ÖV reagiert auf die verschiedenen Variablen unterschiedlich. Auf eine Erhöhung des ÖV-Angebots um 10% nimmt die ÖV-Nachfrage um durchschnittlich 4.5% zu. Die Gesamtelastizitäten bezüglich Arbeitsplätze und Einwohner liegen im Durchschnitt bei jeweils 0.5. Die Passagiere reagieren sehr preissensibel mit durchschnittlich 13% Nachfragereduktion bei einer 10% ÖV-Preiserhöhung. In der zweiten Abbildung ist zusätzlich ersichtlich, dass die Nachfrage von Zeitkartenbesitzern unelastischer reagiert als diejenige der Passagiere mit Einzelkarten Zeitreihenanalysen Benzinverbrauch Ein weiteres Anwendungsgebiet der Zeitreihenanalyse ist der Benzinverbrauch. Daten zum Benzinverbrauch sind meist über lange Zeiträume und von sehr feiner zeitlichen Auflösung (z. B. monatlich oder quartalsweise), für grosse Gebietseinheiten (z.b. für die ganze Schweiz) in den Statistiken enthalten, daher muss für Zeitreihenanalysen kein grosser Datenerhebungsaufwand veranschlagt werden. Bei solchen Zeitreihenanalysen werden meist keine Verkehrsangebotsvariablen berücksichtigt und es bleibt zu diskutieren, ob man damit Aussagen zu kausalen Zusammenhänge für die Verkehrsplanung machen kann. In der Schweiz wurden mehrere Zeitreihenanalysen mit Benzinverbrauchsdaten durchgeführt und die wichtigsten Ergebnisse der aktuellsten Untersuchung von Baranzini, Neto und Weber (2009) werden in Tabelle 3 wiedergegeben: Tabelle 3 Gesamtelastizitäten des Treibstoff- und Benzinverbrauchs in der Schweiz Kurzf. Treibstoff* Kurzf. Benzin Langf. Treibstoff* Langf. Benzin Preiselastizität Elastizität BIP/EW Elastizität PW-Besitz Quelle: Baranzini, Neto und Weber (2009); Datenreihe: ; * Benzin und Diesel Der Begriff Treibstoff umfasst sowohl Benzin als auch Diesel. Da in der Schweiz der Diesel vorwiegend für LKW im Güterverkehr eingesetzt wird, kann man die Treibstoffelastizitäten als Proxy für den Personen- und Güterverkehr auf der Strasse verwenden. Andererseits können die Werte für Benzin als Proxy für den Personenverkehr auf der Strasse gesehen werden. Es muss weiters beachtet werden, dass weder die Veränderung des Benzinverbrauchs noch des Besetzungsgrades explizit abgebildet wurden sondern diese Effekte teilweise in anderen Variablen (z.b. Trendvariablen) abgefangen sind. 12
20 Die kurzfristige Benzinnachfrage reagiert mit einer Abnahme von 0.92% auf eine Preiserhöhung von 10%. Langfristig ist die Reaktion ca. 3.5-mal so stark als die kurzfristige Reaktion. Auf Veränderungen der Wirtschaftsleistung (BIP) pro Person und der PW- Besitzrate reagiert die Benzinnachfrage langfristig stark elastisch. In Dänemark wurde für das aggregierte Prognosemodell 2004 mit Update 2009 (Fosgerau, Holmblad und Pilegaard, 2009) ein ähnlicher aber verfeinerter Ansatz verfolgt, wobei auch der PW-Bestand, Besetzungsgrad und nach fixen und variablen Kosten unterschieden wurde. In der nachfolgenden Tabelle 4 sind die Gesamtnachfrageelastizitäten angegeben. Tabelle 4 Gesamtelastizitäten Dänemark Kurzfristige Elastizität Langfristige Elastizität Elastizität PW-Bestand BIP pro Einwohner Variable Kosten Fixe Kosten Elastizität Fahrleistung je PW BIP pro Einwohner Variable Kosten Abgeleitete Elastizität für MIV Fahrleistung BIP pro Einwohner Variable Kosten Quelle: Fosgerau, Holmblad und Pilegaard (2009) Die Werte aus Dänemark sind höher als die Werte aus Baranzini, Neto und Weber (2009) für die Schweiz, wobei berücksichtigt werden muss, dass in den dänischen Zahlen unter variablen Kosten nicht nur der Benzinpreis sondern auch andere Kostenelemente berücksichtigt wurden und der Benzinpreis rund zwei Drittel der variablen Kosten ausmacht. Neben den methodischen Unterschieden muss noch das spezielle Steuersystem für PW in Dänemark, welches sehr hohe Steuersätze für den PW Erwerb vorsieht, bei der Übertragbarkeit der Resultate beachtet werden. Zum Beispiel reagiert die MIV Fahrtleistung bezüglich variabler Kosten mit einer Gesamtelastizität kurzfristig von und langfristig von weit elastischer als in der Schweiz (Tabelle 3). Andererseits ist die Reaktion des PW-Bestand auf Erhöhungen der variablen Kosten unelastischer als die Werte in der Schweiz. 13
21 3.2.4 Gebietsmodelle für den MIV mit Näherungswerten Für Gebietsmodelle müssen die Angebots- und Nachfragebeschreibung für mehrere regionale Einheiten (meist auf Kantonsniveau oder noch höher aggregiert) und als Zeitreihe vorliegen. Diese hohen Datenerfordernisse werden in vielen Studien mit Vereinfachungen umgangen und Näherungswerte verwendet. Z.B. wurden oft die Fahrstreifen-km als Proxy für die Angebotsverhältnisse im MIV verwendet. Durch die vielen unterschiedlichen Datenpunkte (verschiedene Jahre und Regionen) sind sehr gute Grundlagen für ausgefeilte Zeitreihenmethoden möglich. Hier können Gesamtelastizitäten für die Fahrleistung gewonnen werden, eine Separation nach Entscheidungsebene (Verkehrsmittelwahl, Zielwahl, Routenwahl, ) ist nicht möglich. In den USA wurden verschiedene derartige Untersuchungen im Hinblick auf den induzierten Verkehr durchgeführt (z.b. Hansen und Huang, 1997; Noland und Cowart, 2000; Fulton, Meszler, Noland und Thomas, 2000; Noland, 2001, Cervero und Hansen, 2002; Cervero, 2003), wobei der ÖV in diesen Studien nicht berücksichtigt wurde. Die berichteten Benzinpreiselastizitäten können aber aufgrund der unterschiedlichen Benzinpreisniveaus in den USA und Europa nicht einfach übertragen werden. Eine analoge Untersuchung mit Daten aus Europa wurde bisher nicht veröffentlicht Verkehrsmodelle Mit multimodalen Verkehrsmodellen können Gesamtelastizitäten (über alle Modellstufen) für kurzfristige und langfristige Entwicklungen bezüglich Zeit und Preis mit Modellläufen ermittelt werden, wobei insbesondere die Verwendung der vorteilhaften Messgrösse, die Verkehrsleistung in Pkm oder Fahrleistung in Fzkm gegenüber den Personenwegen bei den meisten anderen Methoden hervorzuheben ist. Dabei kann auch eine Ermittlung der Gesamtelastizitäten nach Nah- und Fernverkehr, Fahrtweitenklassen, Regionstyp oder nach Region erfolgen. Für die Berechnung von langfristigen Gesamtelastizitäten sollten auch die Reaktionen des Mobilitätswerkzeugbesitzes und eventuell der Raumnutzungsänderung abgebildet bzw. abgeschätzt werden. Die methodischen Grundlagen zur Raumnutzungsmodellierung sind noch in Entwicklung begriffen, ihr Anteil am Gesamtresultat sollte aber gering sein. Andererseits ist es aber sehr wichtig, dass das Zielwahlmodell im Verkehrsmodell die Realität gut beschreibt. Man muss sich aber auch bewusst sein, dass die Elastizitäten ein Verkehrsmodell auf sehr aggregiertem Niveau beschreiben und daher sollten diese die Beschreibung der Charakteristiken eines Modells für Vergleichszwecke verwendet werden und nicht als Modell an sich. 14
22 In de Jong und Gunn (2001) wird eine Literaturanalyse von ca. 50 Arbeiten und Ergebnisse aus Modellläufen mit dem italienischen, holländischen und Brüsseler Verkehrsmodell für MIV Gesamteigenelastizitäten, für MIV-Kosten und -Fahrtzeit sowie die dazugehörige ÖV Gesamtkreuzelastizität zusammengefasst. In der nachfolgenden Tabelle 5 sind die wichtigsten Ergebnisse wiedergegeben. Die italienischen Resultate wurden weggelassen, da dort der Fernverkehr im Vordergrund steht und keine Resultate über alle Fahrtzwecke vorliegen. Die Brüsseler Ergebnisse beziehen sich nur auf die Arbeitspendler im Nahverkehr und wurden deshalb auch nicht aufgeführt. Mit dem Schwedischen Nationalen Verkehrsmodell Sampers (Beser Hugosson und Algers, 2002), indem auch der PW-Besitz berücksichtigt wird, wurden langfristige Gesamtelastizitäten für den Fernverkehr und den Regionalverkehr in Südschweden gerechnet. Tabelle 5 MIV Eigenelastizität zu Überblick Gesamtelastizitäten für die Fahrleistung in Europa Literatur Holland Schweden FV Schweden NV MIV-Fahrtzeit -0.20/ / / /-0.75 MIV-Kosten -0.16/ / / /-0.33 ÖV Kreuzelastizität zu MIV-Fahrtzeit -/ /0.65 -/0.61 -/0.15 MIV-Kosten 0.07/ /0.14 -/0.14 -/0.06 Quelle: de Jong und Gunn (2001), Beser Hugosson und Algers (2002) Anmerkung: kurzfristige Elastizität/langfristige Elastizität, - bedeutet kein Wert In Schweden gibt es aufgrund der Landesgeographie mehr längere Fahrten als in der Schweiz und das Flugzeug ist eine wichtige Alternative im Fernverkehr. Die Werte für den Regionalverkehr wurden nur für Südschweden berechnet, wo das ÖV-System nicht mit der Qualität des Schweizer ÖV-Systems vergleichbar ist. Daher sind die Elastizitäten aus Schweden nicht direkt auf die Schweiz zu übertragen, aber da es eine sehr umfassende Studie ist, werden die gefundenen Wirkungen in die Vorschläge einfliessen. Die Resultate aus Holland sind aus Schweizer Sicht aufgrund der ähnlichen Verkehrsverhältnisse (hohe Einwohnerdichte, gutes ÖV-Angebot, keine Bedeutung des Luftverkehrs im nationalen Fernverkehr) besonders interessant. Die umfangreiche Literaturstudie liefert Erfahrungswerte aus einer Vielzahl von Arbeiten. 15
23 3.2.6 Regressionsanalyse aus Verkehrsverhaltensdaten Mit Regressionaanalysen können Gesamtelastizitäten (meist auf Wegebasis) geschätzt werden, wobei insbesondere die geringe Variation der Daten als nachteilig zu betrachten sind. Die Ergebnisse werden von der Richtung und der Grössenausprägung der beschreibenden Variablen beeinflusst, dass heisst z.b., wenn im betrachteten Zeitraum hauptsächlich Geschwindigkeitserhöhungen stattfanden, sind die Ergebnisse verzerrt. Dies wurde auch in Vrtic, Meyer-Rühle, Rommerskirchen, Cerwenka und Stobbe (2000) festgestellt und dabei die Ergebnisse mit der 10 Jahre davor erstellten Studie von Basys/Brains (1990) verglichen. Die Daten aus dem MZMV und der KEP-Befragung sind daher aufgrund der methodenbedingten mangelten Variabilität der Angebotsdaten (z.b. Kosten) nur mit Einschränkungen für Gesamtnachfrageelastizitäten zu verwenden. Eine andere Datenquelle zur Schätzung von Regressionsmodellen sind Paneldaten, wobei eine kontinuierliche Datenerhebung mit konstanter Stichprobe über einen längeren Zeitraum durchgeführt wird. Solche Daten liegen für die Schweiz nicht vor. In Deutschland wird seit 1994 das Deutsche Mobilitätspanel (MOP) betrieben, eine Schätzung von Gesamtelastizitäten ist aber nicht bekannt. Weis und Axhausen (2011) haben mit sogenannten Pseudopaneldaten, generiert aus verschiedenen Erhebungen des MZMV, Elastizitäten mit Strukturgleichungsmodellen (Structural equation modeling, SEM) für die Verkehrserzeugung berechnet Elastizitäten aus diskreten Entscheidungsmodellen Bei disaggregierten Verhaltensdaten, welche Entscheidungen von Individuen auf einer Entscheidungsebene abbilden, werden Elastizitäten für die Verkehrsmittelwahl zur Interpretation der Ergebnisse standardmässig ausgewiesen. Als Datenquelle für solche Schätzungen auf Wegebasis kommen Revealed-Preference-Daten (RP), Stated-Preference-Daten (SP) oder eine Kombination von RP und SP-Daten in Frage. Revealed-Preference-Daten (RP), werden durch Observationen von Entscheidungen unter realen Bedingungen (aktuelle Marktbedingungen) gewonnen, wie z. B. im Mikrozensus Mobilität und Verkehr. Somit ist die Variation der Angebotsdaten normalerweise gering, daher kann z.b. die Reaktion der Entscheider auf eine Benzinpreiserhöhung von 50% nicht beobachtet werden, wenn diese Spannweite von Benzinpreisen nicht in der Realität vorkommt. Ein Vorteil der RP-Daten ist die Erhebung von realen Entscheidungen mit den umweltseitigen und technologischen Beschränkungen und individuellen Sachzwängen (z.b. Einkommen) der Befragten. 16
24 Die Stated-Preference-Daten (SP) haben den Vorteil, unter Laborbedingungen, als sogenanntes Experiment, erhoben zu werden. Dabei werden den Befragten hypothetische Situationen vorgelegt und somit ist natürlich eine grössere Variation der Angebotsvariablen möglich. Somit sind die umweltseitigen und technologischen Beschränkungen und auch die individuellen Sachzwänge gering. Um möglichst realitätsnahe Elastizitäten für die Verkehrsmittelwahl aus disaggregierten Daten zu erhalten, sollten RP oder besser RP und SP-Daten kombiniert verwendet werden. Bei Schätzungen mit reinen SP-Daten besteht die Gefahr einer Verzerrung, die aufgrund von unterschiedlichen Marktanteilen sowie Attributmittelwerten gegenüber den wirklichen Verhältnissen und von möglichen Skalierungsdifferenzen der Parameter verursacht sein kann. Hierzu gibt es einige Publikationen zu Schweizer Projekten mit geschätzten Elastizitäten der Verkehrsmittelwahl (Vrtic, Schüssler, Erath und Axhausen, 2011; Hess, Erath und Axhausen, 2008; Vrtic und Fröhlich, 2006). In der nachfolgend Tabelle 6 sind die Verkehrsmittelwahl- Elastizitäten aus dem ICN-Projekt (Vrtic, Axhausen, Maggi und Rossera, 2003) für Wege über 10 km aufgeführt, hierbei wurde bei der Elastizitätsberechnung die RP- Variablenmittelwerte und Marktanteile verwendet. Bei den anderen Schweizer Studien (vergleiche Kapitel 2.1) wurden keine vollständigen Elastizitätsberechnungen durchgeführt, daher sind sie nicht vergleichbar und sollen hier auch nicht angeführt werden. 17
25 Tabelle 6 Verkehrsmittelwahl-Elastizitäten auf Wegebasis aus dem ICN-Projekt (2003) Quelle: Vrtic, Axhausen, Maggi und Rossera, 2003 In Weis und Axhausen (2010) wird von einer SP-Studie berichtet, die explizit mit hohen, über dem Erfahrungsbereich der Befragten liegenden, Preiserhöhungen arbeitet. Im ersten Teil wurden Verkehrsmittelwahlsituationen abgefragt und in einem zweiten Teil lag der Fokus auf langfristige Entscheidungen zum Besitz von Mobilitätswerkzeugen. Bei letzteren wurde der Abwägungsprozess zwischen verschiedenen Mobilitätswerkzeugsbesitzvarianten inkl. Jahresfahrleistung forciert. Die Resultate zeigen, dass auch bei grossen Benzinpreiserhöhungen sowohl auf Ebene Verkehrsmittelwahl als auch beim Besitz von Mobilitätswerkzeugen ein Beharrungsverhalten festzustellen ist. Auch sind die ÖV-Nutzer stärker preissensibel als MIV-Nutzer. Der Anteil der ÖV-Jahreskartenbesitzer steigt bei Benzinpreiserhöhungen, wenn der Preis für den ÖV konstant gehalten wird. 18
26 3.3 Empfehlungen Elastizitäten Aufgrund der durchgeführten Literaturstudie verschiedener inländischer und ausländischer Projekte muss festgestellt werden, dass keine Untersuchung die spezifischen Anforderungen der Aufgabenstellung nach Gesamtelastizitäten der Fahrleistung (Fahrzeugkilometer, Fzkm) nach Kosten und Zeit vollumfänglich erfüllt. Hier ist insbesondere anzumerken, dass bei den bisherigen Schweizer Studien die Elastizitäten auf Wegebasis (Verkehrsaufkommen) untersucht wurden und nur in der Studie von Baranzini, Neto und Weber (2009) ein Näherungswert für die gesuchte Gesamtelastizität der Fahrleistung abgeleitet wurde. Folgende Empfehlungen für grobe Richtwerte der kurz- und langfristigen Gesamtelastizitäten für die Schweiz können basierend auf der Analyse gegeben werden: MIV Gesamtelastizität bezüglich MIV-Zeit: -0.40/-0.90 MIV Gesamtelastizität bezüglich MIV-variable Kosten: -0.15/-0.35 ÖV Gesamtkreuzelastizität bezüglich MIV-Zeit: 0.50/0.60 ÖV Gesamtkreuzelastizität bezüglich MIV-variable Kosten: 0.15/0.20 Dies bedeutet, wenn die MIV-Zeit um 10 % steigt, dann geht MIV-Fahrleistung (Fzkm) kurzfristig um 4% und langfristig um 9% zurück. Andererseits steigt die ÖV-Verkehrsleistung kurzfristig um 5% und langfristig um 6%. Bei einer Erhöhung der MIV-variable Kosten um 10% reduziert sich die MIV-Fahrleistung kurzfristig um 1.5% und langfristig um 3.5%. Die ÖV-Verkehrsleistung nimmt gleichzeitig kurzfristig um 1.5% und langfristig um 2.0% zu. Die kurzfristige MIV-Gesamtelastizität bezüglich MIV-Zeit wurde am oberen Ende der Vergleichswerte aus de Jong und Gunn, 2001angeordnet, da ein sehr gutes ÖV-System im dichtbesiedelten Gebiet der Schweiz besteht und auch die Verkehrsmittelwahl-Elastizität aus der ICN-Studie, welche ein guter Richtwert für die kurzfristige Elastizität bietet (de Jong und Gunn, 2001), in diesem Bereich liegt. Die langfristige MIV-Gesamtelastizität bezüglich Zeit wurde mehr als doppelt so hoch liegend wie die kurzfristige Elastizität angenommen, ein Umstand der sich bei vielen Untersuchungen zeigt. Auch liegt der Wert in etwa in der Mitte vom Wert aus Holland bei einem guten ÖV-Angebot und sehr dichter Besiedlung sowie Schweden mit einem guten ÖV-Angebot aber dünner Besiedlung. Die Besiedlungsdichte hat 19
27 Einfluss auf die Möglichkeit zur Zielwahländerung. Auch zeigt der relativ grosse Unterschied zwischen den kurz- und langfristigen MIV Gesamtelastizitäten das Beharrungsverhalten beim Besitz von Mobilitätswerkzeugen (vergleiche Weis und Axhausen, 2010). Die MIV Gesamtelastizität bezüglich der variablen Kosten sind bei allen Untersuchungen in einem ähnlichen Bereich (bis auf die dänische Studie mit deutlich höheren Werten) und daher wurde in diesem Erfahrungsbereich festgelegt. Die dänischen Werte sind durch die Eigenheiten der Besteuerung von PW nicht direkt übertragbar. Die ÖV Gesamtkreuzelastizitäten bezüglich MIV Zeit wurde bei den kurzfristigen Werten unterhalb der ICN-Studie gewählt, da MIV-Fahrten kürzer als ÖV-Fahrten sind und auf manchen Relationen eher Fahrten komplett unterbleiben würden oder andere Ziele gewählt werden als auf den ÖV umzusteigen, was aber bei Elastizitäten der Verkehrsmittelwahl angenommen wird. Der Wert über die langfristige Elastizität ist in Gleichklang mit den Ergebnissen aus Holland und Schweden (Fernverkehr). Gegenüber den Werten aus der europäischen Literaturanalyse sind diese Werte höher, da aber in weiten Teilen der Schweiz ein signifikant besseres ÖV-Angebot vorliegt und somit der ÖV zum MIV konkurrenzfähiger ist als in vielen anderen Ländern, ist die Annahme zu vertreten. Ähnlich ist die Situation bei der ÖV Kreuzelastizität zu den MIV Kosten. Für den ÖV können keine Werte angegeben werden, da internationale Vergleichswerte fast vollständig fehlen und aufgrund der Erfahrungen mit stark unterschiedlichen ÖV Preiselastizitäten nach Billettart (Jahreskarte versus Einzelbillett) ein allgemeiner Wert nicht sinnvoll abgeleitet werden kann. Auch sind die ÖV-Eigenelastizitäten für die Energieperspektiven nur von untergeordneter Bedeutung Weitere Forschung Um die erkannten Wissenslücken zur Elastizität der Verkehrsnachfrage im Bezug auf die Schweiz zu schliessen, kann für folgende Themen ein Forschungsbedarf aufgezeigt werden: - Die Ermittlung von Gesamtelastizitäten aus dem Nationalen Personenverkehrsmodell (NPVM) nach verschiedenen Klassifizierungen - Vertiefende Untersuchungen der Nachfragereaktionen von Preisänderungen im ÖV, insbesondere bezüglich Billettart im Nah- und Fernverkehr - Schätzung von Elastizitäten zur Verkehrsmittelwahl aus dem Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010 und der SP-Befragung 2010 zum Verkehrsverhalten mit verschiedenen kombinierten Modellformulierungen und Elastizitätsberechnungsmethoden (Durchschnittswerte, Naive-Pooling-Ansatz und Probability Weighted Sample Enumeration, PWSE) 20
28 21
29 Literaturverzeichnis Baranzini, A., D. Neto und S. Weber (2009) Élasticité-prix de la demande d essence en Suisse, Bericht, Bundesamt für Energie, Bern. Beser Hugosson, M., Algers, S., (2002) SAMPERS - The new Swedish National Travel Demand Forecasting Tool, in Lundqvist, L., Mattsson, L.-G., (eds.), National Transport Models - Recent Developments and Prospects, Advances in Spatial Science, Springer- Verlag, Berlin, 9, BASYS und BRAINS (1990) Elastizitäten des Personenverkehrs der Schweiz , GVF-Auftrag Nr. 4/A110 und Nr. 4/A119, Bern. Cerwenka, P. (2002) Glanz und Elend der Elastizität. Eine ingenieurdidaktische Handreichung. Der Nahverkehr 20 (6). Cervero, R. (2003) Road expansion, urban growth, and induced Travel: A path analysis, Journal of the American Planning Association, 69 (2) Cervero, R. und M. Hansen (2002) Induced travel demand and induced road investment, Journal of Transport Economics and Policy, 36 (3) De Jong, G. und H. Gunn (2001) Recent Evidence on Car Cost and Time Elasticities of Travel demand in Europe, Journal of Transport Economics and Policy, 35 (2) Fosgerau, M., M. Holmblad und N. Pilegaard (2009) Update von ART: En aggregeret prognosemodel for dansk vejtrafik 2004, persönliche Mitteilung. Fröhlich, P., C. Weiss, M. Vrtic und K.W. Axhausen (2011) Stated Preference Befragung 2010 zum Verkehrsverhalten, IVT der ETH Zürich, TransSol GmbH und TransOptima GmbH, im Auftrag der Bundesämter für Raumentwicklung, Strassen und Verkehr (UVEK), Bern. Fulton, L., D. Meszler, R. Noland und J. Thomas (2000) A statistical analysis of induced travel effects in the U.S. Mid-Atlantic region, Journal of Transportation and Statistics, 3 (1) Hansen, M und Y. Huang (1997) Road supply and traffic in California urban areas, Transportation Research A, 31 (3) Hess, S., A. Erath und K.W. Axhausen (2008) Zeitwerte im Personenverkehr: Wahrnehmungs- und Distanzabhängigkeit, Endbericht für SVI 2005/007, IVT, ETH Zürich, Zürich. König, A. und K.W. Axhausen (2004) Zeitkostenansätze im Personenverkehr, Endbericht für SVI 2001/534, Schriftenreihe, 1065, Bundesamt für Strassen, UVEK, Bern. Noland, R. (2001) Relationships between highway capacity and induced vehicle travel, Transportation Research A, 35 (1) Noland, R. und W. Cowart (2000) Analysis of metropolitan highway capacity and the growth in vehicle miles of travel, Vortrag, 79th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington D.C. 22
30 Tegnér, G. und I. Jarlebring (2004) Coupled Transit Demand and Mode-of-Payment Models in Swedish Cities: Estimates and Forecasts, Vortrag, Montréal, Canada, Oktober, Vrtic, M., O. Meyer-Rühle, S. Rommerskirchen, P. Cerwenka und W. Stobbe (2000) Sensitivitäten von Angebots- und Preisänderungen im Personenverkehr, Bericht an die Vereinigung der Schweizerischen Verkehrsingenieure (SVI) und Bundesamt für Strassenbau (ASTRA), Prognose AG, Basel. Vrtic, M., K.W. Axhausen, R. Maggi und F. Rossera (2003) Verifizierung von Prognosemethoden im Personenverkehr, im Auftrag der SBB und dem Bundesamt für Raumentwicklung (ARE), IVT, ETH Zürich und USI Lugano, Zürich und Lugano. Vrtic, M. und P. Fröhlich (2006) Was beeinflusst die Wahl der Verkehrsmittel?, Der Nahverkehr, 24 (4) Vrtic, M., N. Schüssler, A. Erath, M. Bürgle, K.W. Axhausen, E. Frejinger, M. Bierlaire, R. Rudel, S. Scagnolari und R. Maggi (2008) Einbezug der Reisekosten bei der Modellierung des Mobilitätsverhaltens, Endbericht für SVI 2005/004, Schriftenreihe, 1191, Bundesamt für Strassen, UVEK, Bern. Vrtic, M., N. Schüssler, A. Erath und K.W. Axhausen (2011) Mobility Pricing: Zahlungsbereitschaft und Verhaltensreaktionen, Strassenverkehrstechnik, 55 (11). VSS (2006) SN Kosten-Nutzen-Analysen (KNA) bei Massnahmen im Strassenverkehr, VSS, Zürich. Weis, C. und K.W. Axhausen (2009) Benzinpreis und Bahnnutzung, Studie im Auftrag der Schweizerischen Bundesbahnen, IVT, ETH Zürich, Zürich. Weis, C., K.W. Axhausen, R. Schlich und R. Zbinden (2010) Models of mode choice and mobility tool ownership beyond 2008 fuel prices, Transportation Research Record, 2157, Weis, C. und K.W. Axhausen (2011) Aktivitätenorientierte Analyse des Neuverkehrs, Bericht, SVI 2004/012, IVT, ETH Zürich, Zürich. 23
Kurzfassung. Einbezug von Reisekosten bei der Modellierung des Mobilitätsverhaltens
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation / Bundesamt für Strassen Forschungspaket Mobility Pricing: Projekt B1 Einbezug von Reisekosten bei der Modellierung des Mobilitätsverhaltens
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation / Bundesamt für Strassen Forschungspaket Mobility Pricing: Projekt B1 Einbezug von Reisekosten bei der Modellierung des Mobilitätsverhaltens
Einflussfaktoren der Verkehrsmittelwahl in der Agglomeration
 Einflussfaktoren der Verkehrsmittelwahl in der Agglomeration M. Vrtic 04. Mai 2012 Verkehrs-Club der Schweiz Überblick Verkehrsmittelwahl im Entscheidungsprozess Determinante der Verkehrsmittelwahl Verhaltensparameter
Einflussfaktoren der Verkehrsmittelwahl in der Agglomeration M. Vrtic 04. Mai 2012 Verkehrs-Club der Schweiz Überblick Verkehrsmittelwahl im Entscheidungsprozess Determinante der Verkehrsmittelwahl Verhaltensparameter
Leitfaden 2012/02. Aktivitätenorientierte Analyse des Neuverkehrs SVI
 Leitfaden 2012/02 Aktivitätenorientierte Analyse des Neuverkehrs SVI Impressum Datum 27.12.2012 Version 1.1 Grundlagen SVI 2004/012 Aktivitätenorientierte Analyse des Neuverkehrs IVT, ETH Zürich, Zürich
Leitfaden 2012/02 Aktivitätenorientierte Analyse des Neuverkehrs SVI Impressum Datum 27.12.2012 Version 1.1 Grundlagen SVI 2004/012 Aktivitätenorientierte Analyse des Neuverkehrs IVT, ETH Zürich, Zürich
Zusammenfassung: FE-Projekt-Nr. 96.996/2011
 Zusammenfassung: FE-Projekt-Nr. 96.996/2011 Ermittlung von Bewertungsansätzen für Reisezeiten und Zuverlässigkeit auf der Basis eines Modells für modale Verlagerungen im nicht-gewerblichen und gewerblichen
Zusammenfassung: FE-Projekt-Nr. 96.996/2011 Ermittlung von Bewertungsansätzen für Reisezeiten und Zuverlässigkeit auf der Basis eines Modells für modale Verlagerungen im nicht-gewerblichen und gewerblichen
Bevorzugter Zitierstil für diesen Vortrag
 Bevorzugter Zitierstil für diesen Vortrag Axhausen, K.W. (2008) Erfassung der Nutzenfaktoren Zeit und Zuverlässigkeit über Zahlungsbereitschaftsanalysen, Expertenworkshop zur Bewertungsmethodik für Verkehrsinfrastrukturanalysen,
Bevorzugter Zitierstil für diesen Vortrag Axhausen, K.W. (2008) Erfassung der Nutzenfaktoren Zeit und Zuverlässigkeit über Zahlungsbereitschaftsanalysen, Expertenworkshop zur Bewertungsmethodik für Verkehrsinfrastrukturanalysen,
Emissionsbericht: Firma Muster AG hat 960 Tonnen CO₂- Emissionen vermieden. Januar Dezember 2015
 Emissionsbericht: Firma Muster AG hat 960 CO₂- Emissionen vermieden. Januar 2015 - Dezember 2015 Emissionsbericht - Pendlermobilität CO2 Einsparung Abonnement Mitarbeitende km/tag Tage km/ma/jahr Km Total/Jahr
Emissionsbericht: Firma Muster AG hat 960 CO₂- Emissionen vermieden. Januar 2015 - Dezember 2015 Emissionsbericht - Pendlermobilität CO2 Einsparung Abonnement Mitarbeitende km/tag Tage km/ma/jahr Km Total/Jahr
Preferred citation style for this presentation
 Preferred citation style for this presentation Simma, A. (2002) Ziel- und Verkehrsmittelwahl für Wege zum Skifahren in der Schweiz, 3. AMUS-Konferenz, Aachen, Juli 2002. 1 Ziel - und Verkehrsmittelwahl
Preferred citation style for this presentation Simma, A. (2002) Ziel- und Verkehrsmittelwahl für Wege zum Skifahren in der Schweiz, 3. AMUS-Konferenz, Aachen, Juli 2002. 1 Ziel - und Verkehrsmittelwahl
Mobility Pricing Anders Bezahlen für Mobilität. Berner Verkehrstag 21. Aug. 2008
 Mobility Pricing Anders Bezahlen für Mobilität Berner Verkehrstag 21. Aug. 2008 Dr. Matthias Rapp Projektleiter Forschungspaket Mobility pricing des ASTRA Inhalt: 1. Warum Mobility Pricing? 2. Inhalt des
Mobility Pricing Anders Bezahlen für Mobilität Berner Verkehrstag 21. Aug. 2008 Dr. Matthias Rapp Projektleiter Forschungspaket Mobility pricing des ASTRA Inhalt: 1. Warum Mobility Pricing? 2. Inhalt des
Mikroökonomie I Kapitel 4 Die individuelle Nachfrage und die Marktnachfrage WS 2004/2005
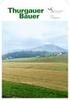 Mikroökonomie I Kapitel 4 Die individuelle Nachfrage und die Marktnachfrage WS 2004/2005 Themen in diesem Kapitel Die individuelle Nachfrage Einkommens- und Substitutionseffekte Die Marktnachfrage Die
Mikroökonomie I Kapitel 4 Die individuelle Nachfrage und die Marktnachfrage WS 2004/2005 Themen in diesem Kapitel Die individuelle Nachfrage Einkommens- und Substitutionseffekte Die Marktnachfrage Die
Innovation im Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010: Erfassung der Routen während der Befragung
 Innovation im Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010: Erfassung der Routen während der Befragung Kathrin Rebmann (BFS) Matthias Kowald (ARE) Inhalt Eidgenössisches Departement des Innern EDI 1. Einleitung
Innovation im Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010: Erfassung der Routen während der Befragung Kathrin Rebmann (BFS) Matthias Kowald (ARE) Inhalt Eidgenössisches Departement des Innern EDI 1. Einleitung
Ökonomische Bewertung: Hintergrund und Methodenüberblick
 Ökonomische Bewertung: Hintergrund und Methodenüberblick Prof. Dr. Frank Wätzold (Brandenburgische Technische Universität Cottbus) Vilm 8.11.2011 SEITE 1 SEITE 2 Einleitung Einleitung 1. Vom Dessert zur
Ökonomische Bewertung: Hintergrund und Methodenüberblick Prof. Dr. Frank Wätzold (Brandenburgische Technische Universität Cottbus) Vilm 8.11.2011 SEITE 1 SEITE 2 Einleitung Einleitung 1. Vom Dessert zur
Lösungen zur Prüfung in diskreter Mathematik vom 15. Januar 2008
 Lösungen zur Prüfung in diskreter Mathematik vom. Januar 008 Aufgabe (a) Wir bezeichnen mit A i die Menge der natürlichen Zahlen zwischen und 00, welche durch i teilbar sind (i {,,, }). Wir müssen die
Lösungen zur Prüfung in diskreter Mathematik vom. Januar 008 Aufgabe (a) Wir bezeichnen mit A i die Menge der natürlichen Zahlen zwischen und 00, welche durch i teilbar sind (i {,,, }). Wir müssen die
Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend
 Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend oder eindeutig, wenn keine alternativen Interpretationsmöglichkeiten
Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend oder eindeutig, wenn keine alternativen Interpretationsmöglichkeiten
VO Grundlagen der Mikroökonomie
 Institut für Wirtschaftsmathematik Ökonomie VO 105.620 Grundlagen der Mikroökonomie Elastizität von Angebot und Nachfrage (Kapitel 2) ZIEL: Definition und Berechnung der Elastizität Preiselastizität der
Institut für Wirtschaftsmathematik Ökonomie VO 105.620 Grundlagen der Mikroökonomie Elastizität von Angebot und Nachfrage (Kapitel 2) ZIEL: Definition und Berechnung der Elastizität Preiselastizität der
Französisch (fliessend in Schrift und Sprache)
 LEBENSLAUF DR. CLAUDE WEIS ANGABEN ZUR PERSON Geschlecht: Männlich Geburtsdatum: 13. Juni 1981 Geburtsort: Luxemburg Zivilstand: Ledig Staatsbürgerschaften: Luxemburger und Schweizer Sprachen: Luxemburgisch
LEBENSLAUF DR. CLAUDE WEIS ANGABEN ZUR PERSON Geschlecht: Männlich Geburtsdatum: 13. Juni 1981 Geburtsort: Luxemburg Zivilstand: Ledig Staatsbürgerschaften: Luxemburger und Schweizer Sprachen: Luxemburgisch
Preferred citation style for this presentation
 Preferred citation style for this presentation Raphael Fuhrer und Veronika Killer (2013) Erreichbarkeitsveränderungen in Raum und Zeit: Vom historischen Strassennetzwerk zum aggregierten Potentialansatz,
Preferred citation style for this presentation Raphael Fuhrer und Veronika Killer (2013) Erreichbarkeitsveränderungen in Raum und Zeit: Vom historischen Strassennetzwerk zum aggregierten Potentialansatz,
Anzahl der Kreditabschlüsse. Jahr (Mittel. Monat. Nombre de contrats de crédit. Année (moyenne des valeurs mensuelles) Mois
 E3c Zinssätze von neuen Kreditabschlüssen nach Produkten und Kreditbetrag / Taux d intérêt appliqués aux nouveaux, selon le produit et le montant aus swerten) r Kreditabschlüsse aus swerten) r Kreditabschlüsse
E3c Zinssätze von neuen Kreditabschlüssen nach Produkten und Kreditbetrag / Taux d intérêt appliqués aux nouveaux, selon le produit et le montant aus swerten) r Kreditabschlüsse aus swerten) r Kreditabschlüsse
2. Datenvorverarbeitung
 Kurzreferat Das Ziel beim Clustering ist es möglichst gleich Datensätze zu finden und diese in Gruppen, sogenannte Cluster zu untergliedern. In dieser Dokumentation werden die Methoden k-means und Fuzzy
Kurzreferat Das Ziel beim Clustering ist es möglichst gleich Datensätze zu finden und diese in Gruppen, sogenannte Cluster zu untergliedern. In dieser Dokumentation werden die Methoden k-means und Fuzzy
Mobilität in der Schweiz Ergebnisse des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010
 Mobilität in der Schweiz Ergebnisse des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010 Dr. Jürg Marti, Direktor BFS Dr. Maria Lezzi, Direktorin ARE Medienkonferenz Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010 Erste
Mobilität in der Schweiz Ergebnisse des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010 Dr. Jürg Marti, Direktor BFS Dr. Maria Lezzi, Direktorin ARE Medienkonferenz Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010 Erste
Pressekonferenz. Thema: Vorstellung des Geburtenbarometers - Eine neue Methode zur Messung der Geburtenentwicklung
 Pressekonferenz mit Bundesministerin Ursula Haubner, Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz und Prof. Dr. Wolfgang Lutz, Direktor des Instituts für Demographie der
Pressekonferenz mit Bundesministerin Ursula Haubner, Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz und Prof. Dr. Wolfgang Lutz, Direktor des Instituts für Demographie der
Teil IV: Abweichungen vom Wettbewerbsmarkt und Marktversagen
 Teil IV: Abweichungen vom Wettbewerbsmarkt und Marktversagen 1 Kapitel 11: Monopol Hauptidee: Ein Unternehmen mit Marktmacht nimmt den Marktpreis nicht als gegeben hin. Es maximiert seinen Gewinn indem
Teil IV: Abweichungen vom Wettbewerbsmarkt und Marktversagen 1 Kapitel 11: Monopol Hauptidee: Ein Unternehmen mit Marktmacht nimmt den Marktpreis nicht als gegeben hin. Es maximiert seinen Gewinn indem
Berechnung des LOG-RANK-Tests bei Überlebenskurven
 Statistik 1 Berechnung des LOG-RANK-Tests bei Überlebenskurven Hans-Dieter Spies inventiv Health Germany GmbH Brandenburger Weg 3 60437 Frankfurt hd.spies@t-online.de Zusammenfassung Mit Hilfe von Überlebenskurven
Statistik 1 Berechnung des LOG-RANK-Tests bei Überlebenskurven Hans-Dieter Spies inventiv Health Germany GmbH Brandenburger Weg 3 60437 Frankfurt hd.spies@t-online.de Zusammenfassung Mit Hilfe von Überlebenskurven
KURS EINFÜHRUNG IN DIE ABSCHÄTZUNG UND PROGNOSE DER VERKEHRSNACHFRAGE. 13.-15. Oktober 2010 25.-26. November 2010
 KURS EINFÜHRUNG IN DIE ABSCHÄTZUNG UND PROGNOSE DER VERKEHRSNACHFRAGE 13.-15. Oktober 2010 25.-26. November 2010 ETH Hönggerberg Gebäude HIL 8093 Zürich Einführung in die Abschätzung und Prognose der Verkehrsnachfrage
KURS EINFÜHRUNG IN DIE ABSCHÄTZUNG UND PROGNOSE DER VERKEHRSNACHFRAGE 13.-15. Oktober 2010 25.-26. November 2010 ETH Hönggerberg Gebäude HIL 8093 Zürich Einführung in die Abschätzung und Prognose der Verkehrsnachfrage
Verkehr und Demografie 2020: Aktuelle Erkenntnisse zum Verkehrsverhalten im Stadtverkehr und Möglichkeiten zur Abschätzung der künftigen Entwicklung
 Verkehr und Demografie 2020: Aktuelle Erkenntnisse zum Verkehrsverhalten im Stadtverkehr und Möglichkeiten zur Abschätzung der künftigen Entwicklung Prof. Dr.-Ing. Gerd-Axel Ahrens Folie 1 Entwicklung
Verkehr und Demografie 2020: Aktuelle Erkenntnisse zum Verkehrsverhalten im Stadtverkehr und Möglichkeiten zur Abschätzung der künftigen Entwicklung Prof. Dr.-Ing. Gerd-Axel Ahrens Folie 1 Entwicklung
Mobilität in der Schweiz. Wichtigste Ergebnisse des Mikrozensus 2005 zum Verkehrsverhalten
 Mobilität in der Schweiz Wichtigste Ergebnisse des Mikrozensus 2005 zum Verkehrsverhalten Neuchâtel, 2007 Jahresmobilität: 19 000 Kilometer pro Jahr Eine halbe Erdumrundung pro Person Jahresmobilität 19
Mobilität in der Schweiz Wichtigste Ergebnisse des Mikrozensus 2005 zum Verkehrsverhalten Neuchâtel, 2007 Jahresmobilität: 19 000 Kilometer pro Jahr Eine halbe Erdumrundung pro Person Jahresmobilität 19
Exemplar für Prüfer/innen
 Exemplar für Prüfer/innen Kompensationsprüfung zur standardisierten kompetenzorientierten schriftlichen Reifeprüfung AHS Juni 2015 Mathematik Kompensationsprüfung Angabe für Prüfer/innen Hinweise zur Kompensationsprüfung
Exemplar für Prüfer/innen Kompensationsprüfung zur standardisierten kompetenzorientierten schriftlichen Reifeprüfung AHS Juni 2015 Mathematik Kompensationsprüfung Angabe für Prüfer/innen Hinweise zur Kompensationsprüfung
Mobilitätsverhalten und Unfallrisiko von Kindern und Jugendlichen Zahlen, Daten, Fakten
 1 Mobilitätsverhalten und Unfallrisiko von Kindern und Jugendlichen Zahlen, Daten, Fakten 2. Hessisches Verkehrsicherheitsforum 31.8./1.9.2010, Rotenburg an der Fulda VERKEHRSLÖSUNGEN BLEES Beratung und
1 Mobilitätsverhalten und Unfallrisiko von Kindern und Jugendlichen Zahlen, Daten, Fakten 2. Hessisches Verkehrsicherheitsforum 31.8./1.9.2010, Rotenburg an der Fulda VERKEHRSLÖSUNGEN BLEES Beratung und
Wirtschaftlichkeit von Power-to-Gas durch Kombination verschiedener Anwendungsfelder
 Wirtschaftlichkeit von Power-to-Gas durch Kombination verschiedener Anwendungsfelder 14. Symposium Energieinnovation Graz Andreas Zauner, MSc Dr. Robert Tichler Dr. Gerda Reiter Dr. Sebastian Goers Graz,
Wirtschaftlichkeit von Power-to-Gas durch Kombination verschiedener Anwendungsfelder 14. Symposium Energieinnovation Graz Andreas Zauner, MSc Dr. Robert Tichler Dr. Gerda Reiter Dr. Sebastian Goers Graz,
Grafiken der Gesamtenergiestatistik 2013 Graphiques de la statistique globale suisse de l énergie 2013
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Energie BFE Grafiken der Gesamtenergiestatistik 213 Graphiques de la statistique globale suisse de l énergie
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Energie BFE Grafiken der Gesamtenergiestatistik 213 Graphiques de la statistique globale suisse de l énergie
Hotel Finance Forum 2011. perspectives macro-économiques à l EPFZ
 Hotel Finance Forum 2011 Yngve Abrahamsen, responsable pour les perspectives macro-économiques à l EPFZ Conséquences des modifications des cours de change sur la branche hôtelière suisse Quelle influence
Hotel Finance Forum 2011 Yngve Abrahamsen, responsable pour les perspectives macro-économiques à l EPFZ Conséquences des modifications des cours de change sur la branche hôtelière suisse Quelle influence
Steuerung des Projektes Pilotage du projet
 armasuisse Steuerung des Projektes Pilotage du projet Workshop ÖREB-Kataster und Nutzungsplanung Séminaire cadastre RDPPF et plans d affectation Marc Nicodet Direction fédérale des mensurations cadastrales
armasuisse Steuerung des Projektes Pilotage du projet Workshop ÖREB-Kataster und Nutzungsplanung Séminaire cadastre RDPPF et plans d affectation Marc Nicodet Direction fédérale des mensurations cadastrales
Überschrift. Titel Prognosemethoden
 Überschrift Prognosemethoden Überschrift Inhalt 1. Einleitung 2. Subjektive Planzahlenbestimmung 3. Extrapolierende Verfahren 3.1 Trendanalyse 3.2 Berücksichtigung von Zyklus und Saison 4. Kausale Prognosen
Überschrift Prognosemethoden Überschrift Inhalt 1. Einleitung 2. Subjektive Planzahlenbestimmung 3. Extrapolierende Verfahren 3.1 Trendanalyse 3.2 Berücksichtigung von Zyklus und Saison 4. Kausale Prognosen
2 für 1: Subventionieren Fahrgäste der 2. Klasse bei der Deutschen Bahn die 1. Klasse?
 2 für 1: Subventionieren Fahrgäste der 2. Klasse bei der Deutschen Bahn die 1. Klasse? Felix Zesch November 5, 2016 Abstract Eine kürzlich veröffentlichte These lautet, dass bei der Deutschen Bahn die
2 für 1: Subventionieren Fahrgäste der 2. Klasse bei der Deutschen Bahn die 1. Klasse? Felix Zesch November 5, 2016 Abstract Eine kürzlich veröffentlichte These lautet, dass bei der Deutschen Bahn die
Bevorzugter Zitierstil für diesen Vortrag
 Bevorzugter Zitierstil für diesen Vortrag Axhausen, K.W. (2004) Mobilität der Zukunft - Zukunft der Mobilität, Vortrag, Swiss Mobility Day, Bern, Juni 2004. 1 Mobilität der Zukunft - Zukunft der Mobilität
Bevorzugter Zitierstil für diesen Vortrag Axhausen, K.W. (2004) Mobilität der Zukunft - Zukunft der Mobilität, Vortrag, Swiss Mobility Day, Bern, Juni 2004. 1 Mobilität der Zukunft - Zukunft der Mobilität
Statistik II Übung 2: Multivariate lineare Regression
 Statistik II Übung 2: Multivariate lineare Regression Diese Übung beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Flugpreisen und der Flugdistanz, dem Passagieraufkommen und der Marktkonzentration. Verwenden
Statistik II Übung 2: Multivariate lineare Regression Diese Übung beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Flugpreisen und der Flugdistanz, dem Passagieraufkommen und der Marktkonzentration. Verwenden
 Verwenden Sie nur Original-KRONE-Ersatzteile! Das gibt Sicherheit und spart Kosten! Use Original-KRONE parts only This will increase operational reliability and help to save costs! N'utiliser que des piéces
Verwenden Sie nur Original-KRONE-Ersatzteile! Das gibt Sicherheit und spart Kosten! Use Original-KRONE parts only This will increase operational reliability and help to save costs! N'utiliser que des piéces
 Verwenden Sie nur Original-KRONE-Ersatzteile! Das gibt Sicherheit und spart Kosten! Use Original-KRONE parts only This will increase operational reliability and help to save costs! N'utiliser que des piéces
Verwenden Sie nur Original-KRONE-Ersatzteile! Das gibt Sicherheit und spart Kosten! Use Original-KRONE parts only This will increase operational reliability and help to save costs! N'utiliser que des piéces
 Verwenden Sie nur Original-KRONE-Ersatzteile! Das gibt Sicherheit und spart Kosten! Use Original-KRONE parts only This will increase operational reliability and help to save costs! N'utiliser que des piéces
Verwenden Sie nur Original-KRONE-Ersatzteile! Das gibt Sicherheit und spart Kosten! Use Original-KRONE parts only This will increase operational reliability and help to save costs! N'utiliser que des piéces
 Verwenden Sie nur Original-KRONE-Ersatzteile! Das gibt Sicherheit und spart Kosten! Use Original-KRONE parts only This will increase operational reliability and help to save costs! N'utiliser que des piéces
Verwenden Sie nur Original-KRONE-Ersatzteile! Das gibt Sicherheit und spart Kosten! Use Original-KRONE parts only This will increase operational reliability and help to save costs! N'utiliser que des piéces
8. Statistik Beispiel Noten. Informationsbestände analysieren Statistik
 Informationsbestände analysieren Statistik 8. Statistik Nebst der Darstellung von Datenreihen bildet die Statistik eine weitere Domäne für die Auswertung von Datenbestände. Sie ist ein Fachgebiet der Mathematik
Informationsbestände analysieren Statistik 8. Statistik Nebst der Darstellung von Datenreihen bildet die Statistik eine weitere Domäne für die Auswertung von Datenbestände. Sie ist ein Fachgebiet der Mathematik
Vorschulkinder vor dem Fernseher
 Peter Wilhelm, Michael Myrtek und Georg Brügner Vorschulkinder vor dem Fernseher Ein psychophysiologisches Feldexperiment Verlag Hans Huber Bern Göttingen Toronto Seattle Inhaltsverzeichnis /. Einleitung
Peter Wilhelm, Michael Myrtek und Georg Brügner Vorschulkinder vor dem Fernseher Ein psychophysiologisches Feldexperiment Verlag Hans Huber Bern Göttingen Toronto Seattle Inhaltsverzeichnis /. Einleitung
Verkehrsmittelwahl bei Freizeitwegen Analyse auf Basis von Modalgruppen
 www.dlr.de Folie 1 > Verkehrsmittelwahl bei Freizeitwegen > Dr. Claudia Nobis > 24.09.2015 Verkehrsmittelwahl bei Freizeitwegen Analyse auf Basis von Modalgruppen Nahverkehrs-Tage 2015 Kassel, 24. September
www.dlr.de Folie 1 > Verkehrsmittelwahl bei Freizeitwegen > Dr. Claudia Nobis > 24.09.2015 Verkehrsmittelwahl bei Freizeitwegen Analyse auf Basis von Modalgruppen Nahverkehrs-Tage 2015 Kassel, 24. September
H O R I Z O N T E NUMMER 39 MÄRZ 2011. Die neuen technischen Grundlagen BVG 2010
 H O R I Z O N T E NUMMER 39 MÄRZ 2011 Die neuen technischen Grundlagen BVG 2010 Roland Kirchhofer, dipl. phys., eidg. dipl. Pensionsversicherungsexperte, Libera Zürich. Er kennt ein breites Spektrum an
H O R I Z O N T E NUMMER 39 MÄRZ 2011 Die neuen technischen Grundlagen BVG 2010 Roland Kirchhofer, dipl. phys., eidg. dipl. Pensionsversicherungsexperte, Libera Zürich. Er kennt ein breites Spektrum an
Alle WGKT-Empfehlungen können unter www.wgkt.de eingesehen und heruntergeladen werden.
 WGKT-Empfehlung Betriebswirtschaftliche Kennzahlen von Krankenhäusern Stand: 05.11.2009 Arbeitskreismitglieder: Prof. Dr. K. Lennerts (Leitung), Karlsruhe; Prof. Dr. C. Hartung, Hannover; Dr. T. Förstemann,
WGKT-Empfehlung Betriebswirtschaftliche Kennzahlen von Krankenhäusern Stand: 05.11.2009 Arbeitskreismitglieder: Prof. Dr. K. Lennerts (Leitung), Karlsruhe; Prof. Dr. C. Hartung, Hannover; Dr. T. Förstemann,
Conditions de travail Arbeitsbedingungen
 Conditions de travail 39 Conditions de travail Emissions Conditions de travail Industriel: une profession 3 fois plus sûr! 9627 personnes sont assurées dans le domaine industriel en Valais. Le nombre d
Conditions de travail 39 Conditions de travail Emissions Conditions de travail Industriel: une profession 3 fois plus sûr! 9627 personnes sont assurées dans le domaine industriel en Valais. Le nombre d
Abstract. Titel: Performancevergleich von aktiven und passiven Fondsanlagestrategien
 Abstract Titel: Performancevergleich von aktiven und passiven Fondsanlagestrategien Kurzzusammenfassung: Die Auswahl an Anlageprodukte hat sich insbesondere in der jüngsten Vergangenheit stark gewandelt
Abstract Titel: Performancevergleich von aktiven und passiven Fondsanlagestrategien Kurzzusammenfassung: Die Auswahl an Anlageprodukte hat sich insbesondere in der jüngsten Vergangenheit stark gewandelt
prix pegasus: Die Nominierten für den Mobilitätpreis Schweiz sind bekannt.
 prix pegasus: Die Nominierten für den Mobilitätpreis Schweiz sind bekannt. Zum zweiten Mal wird der prix pegasus der grosse Förderpreis von EnergieSchweiz für nachhaltige Mobilität verliehen (Preissumme
prix pegasus: Die Nominierten für den Mobilitätpreis Schweiz sind bekannt. Zum zweiten Mal wird der prix pegasus der grosse Förderpreis von EnergieSchweiz für nachhaltige Mobilität verliehen (Preissumme
Dr. Olivier Kern und Marc-André Röthlisberger Eidg. dipl. Pensionsversicherungsexperten. Pittet Associates AG Bern
 Viscom syndicom Syna Studie zur flexiblen Pensionierung in der Grafischen Industrie vom 14. Januar 2015 Etude sur la retraite anticipée dans l'industrie graphique du 14 janvier 2015 Dr. Olivier Kern und
Viscom syndicom Syna Studie zur flexiblen Pensionierung in der Grafischen Industrie vom 14. Januar 2015 Etude sur la retraite anticipée dans l'industrie graphique du 14 janvier 2015 Dr. Olivier Kern und
Überblick über den Energieverbrauch der Schweiz im Jahr 2012 Aperçu de la consommation d'énergie en suisse au cours de l année 2012
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Energie BFE Juni/Juin 2013 Überblick über den Energieverbrauch der Schweiz im Jahr 2012 Aperçu de la consommation
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Energie BFE Juni/Juin 2013 Überblick über den Energieverbrauch der Schweiz im Jahr 2012 Aperçu de la consommation
1IDSal DF PRAKTIKUM 1 Collège Calvin
 Lernziele (TP ) - die Messgrösse ph und deren Bedeutung kennen lernen - ph-werte messen und diskutieren können - die naturwissenschaftliche Arbeits- und Denkweise in der Praxis anwenden (Messungen durchführen
Lernziele (TP ) - die Messgrösse ph und deren Bedeutung kennen lernen - ph-werte messen und diskutieren können - die naturwissenschaftliche Arbeits- und Denkweise in der Praxis anwenden (Messungen durchführen
Einführung in die Mikroökonomie
 Einführung in die Mikroökonomie Übungsaufgaben (6) 1. Erklären Sie jeweils den Unterschied zwischen den folgenden Begriffen: eine Preis-Konsumkurve und eine Nachfragekurve Eine Preis-Konsumkurve bestimmt
Einführung in die Mikroökonomie Übungsaufgaben (6) 1. Erklären Sie jeweils den Unterschied zwischen den folgenden Begriffen: eine Preis-Konsumkurve und eine Nachfragekurve Eine Preis-Konsumkurve bestimmt
1 Einleitung. 1.1 Was ist Ökonometrie und warum sollte man etwas darüber lernen?
 1 Einleitung 1.1 Was ist Ökonometrie und warum sollte man etwas darüber lernen? Idee der Ökonometrie: Mithilfe von Daten und statistischen Methoden Zusammenhänge zwischen verschiedenen Größen messen. Lehrstuhl
1 Einleitung 1.1 Was ist Ökonometrie und warum sollte man etwas darüber lernen? Idee der Ökonometrie: Mithilfe von Daten und statistischen Methoden Zusammenhänge zwischen verschiedenen Größen messen. Lehrstuhl
Integration von Ökosystemleistungen in landschaftsplanerische Instrumente
 Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung IRL Professur für Planung von Landschaft und Urbanen Systemen PLUS Masterarbeit Integration von Ökosystemleistungen in landschaftsplanerische Instrumente Benjamin
Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung IRL Professur für Planung von Landschaft und Urbanen Systemen PLUS Masterarbeit Integration von Ökosystemleistungen in landschaftsplanerische Instrumente Benjamin
Hier eine Zusammenfassung des Gutachtens
 Die BI-Queichtal hat mit der BI-Landau ein Gutachten erstellen lassen, um Korrektheit der Verkehrsuntersuchungen der Firma Modus Consult von 2003 bis 2014, die der Landesregierung als Planungsgrundlage
Die BI-Queichtal hat mit der BI-Landau ein Gutachten erstellen lassen, um Korrektheit der Verkehrsuntersuchungen der Firma Modus Consult von 2003 bis 2014, die der Landesregierung als Planungsgrundlage
Löhne in der Stadt Zürich. 12. November 2015, Dr. Tina Schmid
 Löhne in der 12. November 2015, Dr. Tina Schmid Inhalt 1. Warum Löhne analysieren? 2. Fragestellungen 3. Daten: Schweizerische Lohnstrukturerhebung 4. Ergebnisse 5. Zusammenfassung & Fazit um 12 «Löhne
Löhne in der 12. November 2015, Dr. Tina Schmid Inhalt 1. Warum Löhne analysieren? 2. Fragestellungen 3. Daten: Schweizerische Lohnstrukturerhebung 4. Ergebnisse 5. Zusammenfassung & Fazit um 12 «Löhne
Tables pour la fixation des allocations journalières APG
 Tabellen zur Ermittlung der EO-Tagesentschädigungen Tables pour la fixation des allocations journalières APG Gültig ab 1. Januar 2009 Valable dès le 1 er janvier 2009 318.116 df 10.08 Als Normaldienst
Tabellen zur Ermittlung der EO-Tagesentschädigungen Tables pour la fixation des allocations journalières APG Gültig ab 1. Januar 2009 Valable dès le 1 er janvier 2009 318.116 df 10.08 Als Normaldienst
Testleiterbefragung. Einleitung. Fragestellung. Methode. Wie viele Schüler/innen zeigten das folgende Verhalten?
 Testleiterbefragung Einleitung "Ruhe bitte!" Vom Pausenhof schallt Geschrei in die Klasse, in der hinteren Reihe tauschen sich mehrere Schülerinnen und Schüler über die Lösung der letzten Frage aus, ein
Testleiterbefragung Einleitung "Ruhe bitte!" Vom Pausenhof schallt Geschrei in die Klasse, in der hinteren Reihe tauschen sich mehrere Schülerinnen und Schüler über die Lösung der letzten Frage aus, ein
PAG en vigueur partie graphique
 WAS IST EIN PAG? PAG en vigueur partie graphique «Le plan d aménagement général est un ensemble de prescriptions graphiques et écrites à caractère réglementaire qui se complètent réciproquement et qui
WAS IST EIN PAG? PAG en vigueur partie graphique «Le plan d aménagement général est un ensemble de prescriptions graphiques et écrites à caractère réglementaire qui se complètent réciproquement et qui
Wiederbeschaffungswerte Wasserversorgungen Erhebung 2014 (Zwischenbericht)
 Wiederbeschaffungswerte Wasserversorgungen Erhebung 2014 (Zwischenbericht) Rund 130 Wasserversorgungen beliefern heute die Solothurner Einwohner mit Trinkwasser. Sie betreiben und unterhalten dazu umfangreiche
Wiederbeschaffungswerte Wasserversorgungen Erhebung 2014 (Zwischenbericht) Rund 130 Wasserversorgungen beliefern heute die Solothurner Einwohner mit Trinkwasser. Sie betreiben und unterhalten dazu umfangreiche
Aufgabe 1: Investitionscontrolling Statische Verfahren der Investitionsrechnung Interne Zinsfuß-Methode. Dr. Klaus Schulte. 20.
 Aufgabe 1: Investitionscontrolling Statische Verfahren der Investitionsrechnung Interne Zinsfuß-Methode Dr. Klaus Schulte 20. Januar 2009 Aufgabe 1 a), 6 Punkte Die statischen Verfahren der Investitionsrechnung
Aufgabe 1: Investitionscontrolling Statische Verfahren der Investitionsrechnung Interne Zinsfuß-Methode Dr. Klaus Schulte 20. Januar 2009 Aufgabe 1 a), 6 Punkte Die statischen Verfahren der Investitionsrechnung
Energieabrechnungs-Optimierung zur Endverbrauchermotivation
 Energieabrechnungs-Optimierung zur Endverbrauchermotivation 29. November 2012 Andrea Kollmann Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Linz Partner Forschungspartner: EnCT GmbH (www.enct.de)
Energieabrechnungs-Optimierung zur Endverbrauchermotivation 29. November 2012 Andrea Kollmann Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Linz Partner Forschungspartner: EnCT GmbH (www.enct.de)
DIE PERFORMANCE DER GRÖSSTEN SCHWEIZER STÄDTE IM INTERNATIONALEN VERGLEICH
 DIE PERFORMANCE DER GRÖSSTEN SCHWEIZER STÄDTE IM INTERNATIONALEN VERGLEICH Kurzpublikation im Rahmen des «Internationalen Benchmarking Programms für den Schweizer Tourismus: Projektphase 2014-2015» September
DIE PERFORMANCE DER GRÖSSTEN SCHWEIZER STÄDTE IM INTERNATIONALEN VERGLEICH Kurzpublikation im Rahmen des «Internationalen Benchmarking Programms für den Schweizer Tourismus: Projektphase 2014-2015» September
Umfassende Untersuchung zur wirtschaftlichen Situation von IV-Rentnern
 Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Sozialversicherungen BSV Medienmitteilung 3. April 2012 Umfassende Untersuchung zur wirtschaftlichen Situation von IV-Rentnern IV-Rentner leben
Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Sozialversicherungen BSV Medienmitteilung 3. April 2012 Umfassende Untersuchung zur wirtschaftlichen Situation von IV-Rentnern IV-Rentner leben
Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie (MKS) Wissenschaftliche Begleitforschung
 Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie (MKS) Wissenschaftliche Begleitforschung MKS-Studie: Verkehrsverlagerungspotenzial auf den Schienenpersonenfernverkehr in Deutschland Dr. Tobias Kuhnimhof, Dr. Christian
Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie (MKS) Wissenschaftliche Begleitforschung MKS-Studie: Verkehrsverlagerungspotenzial auf den Schienenpersonenfernverkehr in Deutschland Dr. Tobias Kuhnimhof, Dr. Christian
EXTERNE KOSTEN DES VERKEHRS IN DEUTSCHLAND AUFDATIERUNG 2005
 EXTERNE KOSTEN DES VERKEHRS IN DEUTSCHLAND AUFDATIERUNG 2005 Schlussbericht Zürich, März 2007 Christoph Schreyer INFRAS Markus Maibach INFRAS Daniel Sutter INFRAS Claus Doll ISI Peter Bickel IER B1669A1_BERICHT_V1.1.DOC
EXTERNE KOSTEN DES VERKEHRS IN DEUTSCHLAND AUFDATIERUNG 2005 Schlussbericht Zürich, März 2007 Christoph Schreyer INFRAS Markus Maibach INFRAS Daniel Sutter INFRAS Claus Doll ISI Peter Bickel IER B1669A1_BERICHT_V1.1.DOC
Städtevergleich zur Verkehrssicherheit Verkehrsverunfallte in den zehn grössten Städten der Schweiz
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Strassen ASTRA Weltpoststrasse 5, 315 Standortadresse: Weltpoststrasse 5, 315 Postadresse: Städtevergleich
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Strassen ASTRA Weltpoststrasse 5, 315 Standortadresse: Weltpoststrasse 5, 315 Postadresse: Städtevergleich
Gesellschaftliche Akzeptanz von Windkraft in Urnäsch
 Gesellschaftliche Akzeptanz von Windkraft in Urnäsch + Zusammenfassung der Ergebnisse einer Masterarbeit Fabio Weithaler Student Universität St. Gallen Juli 2015 + Agenda 1 Forschungsziele Methodik Ergebnisse
Gesellschaftliche Akzeptanz von Windkraft in Urnäsch + Zusammenfassung der Ergebnisse einer Masterarbeit Fabio Weithaler Student Universität St. Gallen Juli 2015 + Agenda 1 Forschungsziele Methodik Ergebnisse
Exemplar für Prüfer/innen
 Exemplar für Prüfer/innen Kompensationsprüfung zur standardisierten kompetenzorientierten schriftlichen Reifeprüfung AHS Juni 2016 Mathematik Kompensationsprüfung 3 Angabe für Prüfer/innen Hinweise zur
Exemplar für Prüfer/innen Kompensationsprüfung zur standardisierten kompetenzorientierten schriftlichen Reifeprüfung AHS Juni 2016 Mathematik Kompensationsprüfung 3 Angabe für Prüfer/innen Hinweise zur
Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse
 Rasch, Friese, Hofmann & Naumann (006). Quantitative Methoden. Band (. Auflage). Heidelberg: Springer. Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse Berechnen der Teststärke a priori bzw. Stichprobenumfangsplanung
Rasch, Friese, Hofmann & Naumann (006). Quantitative Methoden. Band (. Auflage). Heidelberg: Springer. Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse Berechnen der Teststärke a priori bzw. Stichprobenumfangsplanung
Ein Integriertes Berichtswesen als Führungshilfe
 Ein Integriertes Berichtswesen als Führungshilfe Begleitung eines kennzahlgestützten Berichtswesens zur Zielerreichung Tilia Umwelt GmbH Agenda 1. Was bedeutet Führung? 2. Was bedeutet Führung mit Hilfe
Ein Integriertes Berichtswesen als Führungshilfe Begleitung eines kennzahlgestützten Berichtswesens zur Zielerreichung Tilia Umwelt GmbH Agenda 1. Was bedeutet Führung? 2. Was bedeutet Führung mit Hilfe
Lage- und Streuungsparameter
 Lage- und Streuungsparameter Beziehen sich auf die Verteilung der Ausprägungen von intervall- und ratio-skalierten Variablen Versuchen, diese Verteilung durch Zahlen zu beschreiben, statt sie graphisch
Lage- und Streuungsparameter Beziehen sich auf die Verteilung der Ausprägungen von intervall- und ratio-skalierten Variablen Versuchen, diese Verteilung durch Zahlen zu beschreiben, statt sie graphisch
Nachhaltige Mobilität durch geteilte Verkehrsmittel
 Nachhaltige Mobilität durch geteilte Verkehrsmittel Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrssysteme Universität Kassel 12. Hessischer Mobilitätskongress 2014, 17.09.2014, House of Logistics and Mobility
Nachhaltige Mobilität durch geteilte Verkehrsmittel Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrssysteme Universität Kassel 12. Hessischer Mobilitätskongress 2014, 17.09.2014, House of Logistics and Mobility
1. Angebot und Nachfrage
 1. Angebot und Nachfrage Georg Nöldeke WWZ, Universität Basel Intermediate Microeconomics (HS 10) Angebot und Nachfrage 1 / 39 1. Gleichgewicht in Wettbewerbsmärkten 1.1 Marktnachfrage Wir betrachten einen
1. Angebot und Nachfrage Georg Nöldeke WWZ, Universität Basel Intermediate Microeconomics (HS 10) Angebot und Nachfrage 1 / 39 1. Gleichgewicht in Wettbewerbsmärkten 1.1 Marktnachfrage Wir betrachten einen
Ist Mobilität ein Menschenrecht
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Verkehr BAV Ist Mobilität ein Menschenrecht Referat bei der Schweiz. Evangelischen Allianz von 25. Juni 2011
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Verkehr BAV Ist Mobilität ein Menschenrecht Referat bei der Schweiz. Evangelischen Allianz von 25. Juni 2011
Mobilität in der Schweiz. Wichtigste Ergebnisse des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010. Mobilität und Verkehr 899-1000.
 11 Mobilität und Verkehr 899-1000 Mobilität in der Schweiz Wichtigste Ergebnisse des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010 Bundesamt für Statistik BFS Bundesamt für Raumentwicklung ARE Neuchâtel, 2012
11 Mobilität und Verkehr 899-1000 Mobilität in der Schweiz Wichtigste Ergebnisse des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010 Bundesamt für Statistik BFS Bundesamt für Raumentwicklung ARE Neuchâtel, 2012
Neue Datensätze zum Verkehrsverhalten IVT-Seminar vom 5. Dezember 2002
 Neue Datensätze zum Verkehrsverhalten IVT-Seminar vom 5. Dezember 22 Datensätze zum Verkehrsverhalten bilden die Grundlage jeglicher Analysen und Strategien im Mobilitätsbereich. An einem Seminar am Institut
Neue Datensätze zum Verkehrsverhalten IVT-Seminar vom 5. Dezember 22 Datensätze zum Verkehrsverhalten bilden die Grundlage jeglicher Analysen und Strategien im Mobilitätsbereich. An einem Seminar am Institut
Top Panama Farbkarte Carte de couleurs 10.2014
 Farbkarte Carte de couleurs 10.2014 Planenmaterial: Technische Angaben und Hinweise Matière de la bâche : Données techniques et remarques Planenstoff aus Polyester-Hochfest-Markengarn, beidseitig PVC beschichtet
Farbkarte Carte de couleurs 10.2014 Planenmaterial: Technische Angaben und Hinweise Matière de la bâche : Données techniques et remarques Planenstoff aus Polyester-Hochfest-Markengarn, beidseitig PVC beschichtet
Mehr-Ebenen-Analyse I. Regressionsmodelle für Politikwissenschaftler
 Mehr-Ebenen-Analyse I Regressionsmodelle für Politikwissenschaftler Was sind strukturierte Daten? Was ist Struktur? Probleme Bisher sind wir stets von einfachen Zufallsstichproben ausgegangen (Registerstichprobe)
Mehr-Ebenen-Analyse I Regressionsmodelle für Politikwissenschaftler Was sind strukturierte Daten? Was ist Struktur? Probleme Bisher sind wir stets von einfachen Zufallsstichproben ausgegangen (Registerstichprobe)
Das Preisniveau und Inflation
 Das Preisniveau und Inflation MB Preisindex für die Lebenshaltung Preisindex für die Lebenshaltung (Consumer Price Index, CPI) Bezeichnet für eine bestimmte Periode die Kosten eines typischen Warenkorbs
Das Preisniveau und Inflation MB Preisindex für die Lebenshaltung Preisindex für die Lebenshaltung (Consumer Price Index, CPI) Bezeichnet für eine bestimmte Periode die Kosten eines typischen Warenkorbs
Euler-Verfahren. exakte Lösung. Euler-Streckenzüge. Folie 1
 exakte Lösung Euler-Verfahren Folie 1 Euler-Streckenzüge Ein paar grundlegende Anmerkungen zur Numerik Die Begriffe Numerik bzw. Numerische Mathematik bezeichnen ein Teilgebiet der Mathematik, welches
exakte Lösung Euler-Verfahren Folie 1 Euler-Streckenzüge Ein paar grundlegende Anmerkungen zur Numerik Die Begriffe Numerik bzw. Numerische Mathematik bezeichnen ein Teilgebiet der Mathematik, welches
Grundlagen und Grenzen zur Berechnung von Road Pricing
 Grundlagen und Grenzen zur Berechnung von Road Pricing Schweizerische Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft Forum zum Thema Mobility Pricing 17. April 2008, Bern Stefan Suter Partner Ecoplan Bern 1 Einstieg
Grundlagen und Grenzen zur Berechnung von Road Pricing Schweizerische Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft Forum zum Thema Mobility Pricing 17. April 2008, Bern Stefan Suter Partner Ecoplan Bern 1 Einstieg
Raumgeometrie WORTSCHATZ 1
 Raumgeometrie WORTSCHATZ 1 Video zur Raumgeometrie : http://www.youtube.com/watch?v=qbqbd0b3vzu VOKABEL : eine Angabe ; angeben ; was angegeben ist : ce qui est donné (les données) eine Annahme ; annehmen
Raumgeometrie WORTSCHATZ 1 Video zur Raumgeometrie : http://www.youtube.com/watch?v=qbqbd0b3vzu VOKABEL : eine Angabe ; angeben ; was angegeben ist : ce qui est donné (les données) eine Annahme ; annehmen
Standalone D/E/F/I (Version Upgrade not included) Upgrade from Titanium 2004, 2005 or Platinum 7 to Titanium 2006
 STANDALONE Panda OEM STANDARD License Fee per User in CHF Type of OEM Price per CD/License Minimum Order Value Type 1 user 2 and more users Reseller Enduser 50 copies New Business New Business Titanium
STANDALONE Panda OEM STANDARD License Fee per User in CHF Type of OEM Price per CD/License Minimum Order Value Type 1 user 2 and more users Reseller Enduser 50 copies New Business New Business Titanium
Forschungsbündel Erhebung verkehrsplanerischer Grundlagedaten:
 Forschungsbündel Erhebung verkehrsplanerischer Grundlagedaten: Synthesebericht Paquet de projets de recherche conjoints Recensements dans les transports: Synthèse Research package Survey of basic traffic
Forschungsbündel Erhebung verkehrsplanerischer Grundlagedaten: Synthesebericht Paquet de projets de recherche conjoints Recensements dans les transports: Synthèse Research package Survey of basic traffic
Leitung: Betreuung: Sven Erik. Zürich, 1. Juli
 Standortpotentiale der Schweiz für erneuerbare Energie in Masterarbeit in Raumentwicklung und Infrastruktursysteme von Philipp Renggli Leitung: Betreuung: Prof. Dr. Adrienne Grêt Regamey Bettina Weibel,
Standortpotentiale der Schweiz für erneuerbare Energie in Masterarbeit in Raumentwicklung und Infrastruktursysteme von Philipp Renggli Leitung: Betreuung: Prof. Dr. Adrienne Grêt Regamey Bettina Weibel,
Personicx Typologie in der best for planning 2016
 Personicx Typologie in der best for planning 2016 In der best for planning (b4p) 2016 steht interessierten Nutzern die Personicx Typologie von Acxiom Deutschland zur Verfügung. Wie alle in der b4p enthaltenen
Personicx Typologie in der best for planning 2016 In der best for planning (b4p) 2016 steht interessierten Nutzern die Personicx Typologie von Acxiom Deutschland zur Verfügung. Wie alle in der b4p enthaltenen
IG / CE Smart City Suisse 5. Workshop 10.6.2015 / Bern. Herzlich willkommen
 IG / CE Smart City Suisse 5. Workshop 10.6.2015 / Bern Herzlich willkommen Programme 14.15 Begrüssung und Einleitung / Accueil et Introduction Benjamin Szemkus, SC Schweiz 14.20 IG Smart City / Communauté
IG / CE Smart City Suisse 5. Workshop 10.6.2015 / Bern Herzlich willkommen Programme 14.15 Begrüssung und Einleitung / Accueil et Introduction Benjamin Szemkus, SC Schweiz 14.20 IG Smart City / Communauté
Un projet phare, basé sur la norme ISO 50001, pour Buchs, Cité de l énergie GOLD Hagen Pöhnert, Directeur des SI de Buchs SG
 Un projet phare, basé sur la norme ISO 50001, pour Buchs, Cité de l énergie GOLD Hagen Pöhnert, Directeur des SI de Buchs SG 9.5.2014 Mitgliederversammlung Trägerverein Energiestadt, Lausanne 1 9.5.2014
Un projet phare, basé sur la norme ISO 50001, pour Buchs, Cité de l énergie GOLD Hagen Pöhnert, Directeur des SI de Buchs SG 9.5.2014 Mitgliederversammlung Trägerverein Energiestadt, Lausanne 1 9.5.2014
Road Pricing Modelle auf Autobahnen und in Stadtregionen
 Schweizerische Eidgenossenschaft Confederation sutsse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Departement federal de
Schweizerische Eidgenossenschaft Confederation sutsse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Departement federal de
Zyklisch evaluieren 1 (Auszug aus dem Leitfaden zur Selbstevaluation )
 Zyklisch evaluieren 1 (Auszug aus dem Leitfaden zur Selbstevaluation ) Auf Basis des Qualitätsrahmens für Schulen in Baden-Württemberg lassen sich die unterschiedlichen Bereiche mit dem hier dargestellten
Zyklisch evaluieren 1 (Auszug aus dem Leitfaden zur Selbstevaluation ) Auf Basis des Qualitätsrahmens für Schulen in Baden-Württemberg lassen sich die unterschiedlichen Bereiche mit dem hier dargestellten
Bathymetrische Untersuchen in CH Seen Analyses bathymétriques dans les lacs CH. Kolloquium Colloque / 20.02.2009
 armasuisse Bathymetrische Untersuchen in CH Seen Analyses bathymétriques dans les lacs CH Kolloquium Colloque / 20.02.2009 F. Anselmetti / R. Artuso / M. Rickenbacher / W. Wildi Agenda Einführung 10, Introduction
armasuisse Bathymetrische Untersuchen in CH Seen Analyses bathymétriques dans les lacs CH Kolloquium Colloque / 20.02.2009 F. Anselmetti / R. Artuso / M. Rickenbacher / W. Wildi Agenda Einführung 10, Introduction
4.Wie gut haben Sie im letzten Jahr(1997) Ihre Ziele bezüglich der Neukundengewinnung erreicht? 1 = gar nicht erreicht 7 = voll erreicht
 2.2.4.1. Antwortprofil Anhand einer siebenstufigen Ratingskala 1 konnten die Unternehmen den Zielerreichungsgrad bezüglich der einzelnen vorgegebenen Ziele ankreuzen. Abbildung 33 zeigt das Antwortprofil
2.2.4.1. Antwortprofil Anhand einer siebenstufigen Ratingskala 1 konnten die Unternehmen den Zielerreichungsgrad bezüglich der einzelnen vorgegebenen Ziele ankreuzen. Abbildung 33 zeigt das Antwortprofil
Schulabsentismus in der Schweiz Ein Phänomen und seine Folgen Eine empirische Studie zum Schulschwänzen Jugendlicher im Schweizer Bildungssystem
 Schulabsentismus in der Schweiz Ein Phänomen und seine Folgen Eine empirische Studie zum Schulschwänzen Jugendlicher im Schweizer Bildungssystem Zusammenfassung der wichtigsten Forschungsergebnisse Prof.
Schulabsentismus in der Schweiz Ein Phänomen und seine Folgen Eine empirische Studie zum Schulschwänzen Jugendlicher im Schweizer Bildungssystem Zusammenfassung der wichtigsten Forschungsergebnisse Prof.
Der Berner Weg zum Veloverleihsystem
 Direktion für Tiefbau Verkehr und Stadtgrün Der Berner Weg zum Veloverleihsystem Roland Pfeiffer, Fachstelle Fuss- und Veloverkehr, Verkehrsplanung Bern Seite 1 Stadt Bern Ausgangslage: Ein paar Worte
Direktion für Tiefbau Verkehr und Stadtgrün Der Berner Weg zum Veloverleihsystem Roland Pfeiffer, Fachstelle Fuss- und Veloverkehr, Verkehrsplanung Bern Seite 1 Stadt Bern Ausgangslage: Ein paar Worte
Umrechnung von Nettolöhnen in Bruttolöhne AHV/IV/EO/ALV. Conversion des salaires nets en salaires bruts AVS/AI/APG/AC
 Umrechnung von Nettolöhnen in Bruttolöhne AHV/IV/EO/ALV Conversion des salaires s en salaires s AVS/AI/APG/AC Gültig ab 1. Januar 2014 Valable dès le 1 er janvier 2014 318.115 df 11.13 1 2 Erläuterungen:
Umrechnung von Nettolöhnen in Bruttolöhne AHV/IV/EO/ALV Conversion des salaires s en salaires s AVS/AI/APG/AC Gültig ab 1. Januar 2014 Valable dès le 1 er janvier 2014 318.115 df 11.13 1 2 Erläuterungen:
Der Einfluss monovalenter Strom- Wärmepumpen auf den Bedarf an gesicherter Kraftwerksleistung. Michael Bräuninger. Nr. 5
 RESULTS ERGEBNISSE Der Einfluss monovalenter Strom- Wärmepumpen auf den Bedarf an gesicherter Kraftwerksleistung Michael Bräuninger Nr. 5 Hamburg, August 2015 Der Einfluss monovalenter Strom- Wärmepumpen
RESULTS ERGEBNISSE Der Einfluss monovalenter Strom- Wärmepumpen auf den Bedarf an gesicherter Kraftwerksleistung Michael Bräuninger Nr. 5 Hamburg, August 2015 Der Einfluss monovalenter Strom- Wärmepumpen
Der Minergie-Boom unter der Lupe
 Der Minergie-Boom unter der Lupe Hauptergebnisse der ZKB-Marktanalyse Dr. Marco Salvi Leiter Immobilien- und Kreditrisiken Financial Engineering Zürcher Kantonalbank WWF-Tagung, Ittingen Zwei Nachrichten
Der Minergie-Boom unter der Lupe Hauptergebnisse der ZKB-Marktanalyse Dr. Marco Salvi Leiter Immobilien- und Kreditrisiken Financial Engineering Zürcher Kantonalbank WWF-Tagung, Ittingen Zwei Nachrichten
Grundlegende Eigenschaften von Punktschätzern
 Grundlegende Eigenschaften von Punktschätzern Worum geht es in diesem Modul? Schätzer als Zufallsvariablen Vorbereitung einer Simulation Verteilung von P-Dach Empirische Lage- und Streuungsparameter zur
Grundlegende Eigenschaften von Punktschätzern Worum geht es in diesem Modul? Schätzer als Zufallsvariablen Vorbereitung einer Simulation Verteilung von P-Dach Empirische Lage- und Streuungsparameter zur
