Dichtheitsprüfung an Biogasbehältern mit Membrandichtung
|
|
|
- Ina Färber
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Dichtheitsprüfung an Biogasbehältern mit Membrandichtung Roland Stehle, Heilbronn 1 ARTEN VON BIOGASBEHÄLTERN MIT MEMBRANDICHTUNG 1 2 REGELWERKE UND NORMEN ZUR DICHTHEITSPRÜFUNG 1 3 DICHTHEITSPRÜFUNG AN BIOGASBEHÄLTERN MIT GEWICHTSBELASTUNG 3 4 DICHTHEITSPRÜFUNG AN BIOGASBEHÄLTERN MIT DRUCKLUFTBELASTUNG 6 1 ARTEN VON BIOGASBEHÄLTERN MIT MEMBRANDICHTUNG Biogasbehälter mit Membrandichtung gibt es in einer großen Variantenzahl. Sie unterscheiden sich einerseits in ihrer Funktionsart: Niederdruckgasbehälter mit Gewichtsbelastung Niederdruckgasbehälter mit Druckluftbelastung Druckloser Gasbehälter Andererseits unterscheiden sie sich in der Bauform des Gehäuses. Die Form des Gehäuses ist nicht zwingend mit der Funktionsart verbunden. Einige Beispiele von Gasbehältergehäusen möchte ich hier zeigen: Gasdicht verschweißte Stahlbleche Gasdicht verschraubte Stahlbleche Durch falzen verbundene Stahlbleche Stahlskelettkonstruktion mit Verkleidung Äußeres Stahlskelett mit Membranhülle Erdversenktes Betonbauwerk Doppelmembranbehälter Landwirtschaftliche Biogasbehälter So vielfältig wie die Variantenzahl der Biogasbehälter ist, so vielfältig sind die Probleme bei deren Dichtheitsprüfung. 2 REGELWERKE UND NORMEN ZUR DICHTHEITSPRÜFUNG Die Grundlagen zur Dichtheitsprüfung eines Biogasbehälters sind in Anhang A.2 des Merkblatts DWA-M 376 Sicherheitsregeln für Biogasbehälter mit Membrandichtung beschrieben. Die Technische Information 4 Sicherheitsregeln für landwirtschaftliche Biogasanlagen (Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften) enthält Angaben zur zulässigen Gaskonzentration in der Abluft landwirtschaftlicher Biogasbehälter. DWA 2011, Hennef Seite 1/10
2 Ein hoch aktuelles Merkblatt des Sachverständigenkreises Biogas Merkblatt zur Überprüfung der Gasdichtigkeit von Biogastraglufthauben macht weitergehende Angaben zur Durchführung von Dichtheitsprüfungen an Biogasbehältern landwirtschaftlicher Anlagen. Ein Niederdruckgasbehälter mit Gewichtsbelastung erfüllt die entscheidende Prüfbedingung der Norm DIN EN 1779 Dichtheitsprüfung. An der zu prüfenden Oberfläche liegt eine Druckdifferenz an. Durch die Druckdifferenz wird eine Strömung des Prüfgases durch eine eventuell vorhandene Leckstelle erzeugt. Bild 1 Leckstellen können an allen das Gas einschließenden Oberflächen auftreten. Dies sind die Gehäuseteile und deren Verbindungen z. B. die Schweißnähte oder Schraubverbindungen, die Membran und deren Abdichtung zum Gehäuse sowie die Flanschdichtungen. Insbesondere die Membran weist eine nicht zu vernachlässigende Durchlässigkeit für Gas auf. Letztendlich kann ein Biogasbehälter nicht absolut dicht sein sondern nur technisch dicht. Das heißt, ein gewisser Gasverlust des Gasbehälters ist zulässig. Die Prüfung der Gasdurchlässigkeit der Membran erfolgt im Labor nach der Norm DIN Teil 1 oder 2. Die Prüfapparaturen sind hier abgebildet. Bild 2 Bild 3 DWA 2011, Hennef Seite 2/10
3 Die Prüfkammern sind in beiden Teilnormen sehr ähnlich aufgebaut. Das Probestück der Membran liegt auf der aufgerauten Prüffläche des Unterteils der Prüfkammer. Der Außenrand ist zur Abdichtung glatt. Das Oberteil der Prüfkammer wird dicht aufgeschraubt. Der Hohlraum im Prüfkammeroberteil wird vom Prüfgas unter Atmosphärendruck durchströmt. Im Unterteil erzeugt eine Vakuumpumpe einen Unterdruck. Die Höhe des Unterdrucks muss der Gasdurchlässigkeit des Prüfstücks angepasst werden. Das heißt, je geringer die Gasdurchlässigkeit ist, desto höher ist die Prüfdruckdifferenz. Die Prüfdruckdifferenz erzeugt eine Kraft die das Prüfgas durch die Mikroporen der Membran drückt. In der Teilnorm 1 wird die Gasdurchlässigkeit durch Änderung des Volumens unter der Prüfkammer ermittelt. In der Teilnorm 2 durch die Änderung des Drucks. Die Gasdurchlässigkeit wird in cm 3 /(m 2 *d*bar) angegeben, sodass für einen Biogasbehälter der Gasverluststrom durch die Membran berechnet werden kann: Gasverluststrom = Gasdurchlässigkeit * Membranfläche * Prüfdruck (1) Die Flächen der Membranen die in Niederdruckgasbehältern typischer Größe von 100 bis 5000 m 3 Inhalt eingebaut sind liegen im Bereich von m 2. Mit Betriebsdrucken von mbar und einer Gasdurchlässigkeit von maximal cm 3 /(m 2 *d*bar) beträgt der Gasverluststrom durch die gesamten Membran infolge deren Gasdurchlässigkeit 1 25 l/d. Dieser Gasverluststrom ist zu gering um in der Praxis an Biogasbehältern der genannten Größe nachweisbar zu sein. Relevante Gasverluste können an Biogasbehältern also nur durch Leckstellen verursacht werden. Um den Gasverluststrom durch Leckstellen zu ermitteln haben wir an einem technisch dichten Behälter definierte Bohrungen angebracht. Die Versuchsergebnisse sind: Bohrung Ø Leckagefläche Prüfdruck Gasverlust Prüfdruck Gasverlust 1,0 mm 0,79 mm 2 18,7 mbar 2,81 m 3 /d 35,7 mbar 3,90 m 3 /d 1,5 mm 1,77 mm 2 18,7 mbar 5,88 m 3 /d 35,7 mbar 8,40 m 3 /d 2,0 mm 3,14 mm 2 18,7 mbar 10,88 m 3 /d 35,7 mbar 15,71 m 3 /d Mittelwert Gasverluststromdichte bei 20 mbar: 3,2 m 3 /(d* mm 2 ) Die gesamte Membranfläche entspricht einer Leckstellenfläche < 0,01 mm 2 Die Versuchsergebnisse zeigen, dass der Gasverluststrom über die gesamte Membranfläche vernachlässigbar ist gegenüber dem Gasverluststrom durch eine Leckstelle mit einer Fläche weit unter einem Quadratmillimeter. 3 DICHTHEITSPRÜFUNG AN BIOGASBEHÄLTERN MIT GEWICHTSBELASTUNG In Anhang A.2 des Merkblatts DWA-M 376 wird zum Nachweis der technischen Dichtheit zwischen einer unmittelbaren und einer mittelbaren Prüfung unterschieden. Die Durchführung der unmittelbaren Prüfung erfordert den Nachweis, dass die gesamte Oberfläche des Biogasbehälters frei von Leckstellen ist. Als Prüfverfahren hierzu eignen sich die Benetzung der Oberfläche mit schaumbildenden Mitteln oder die Detektion des austretenden Prüfgases mit einem geeigneten Gassensor. DWA 2011, Hennef Seite 3/10
4 Eine Leckanzeige mit schaumbildenden Mittel zeigt Bild 4: Bild 4 Das Prüfverfahren ist hoch sensibel und geeignet kleinste Leckstellen zu detektieren. Aus der Geschwindigkeit mit der sich der Schaumteppich bildet kann der Gasverluststrom abgeschätzt werden. Zur Durchführung des Dichtheitsnachweises mit schaumbildenden Mitteln oder mit einem Gassensor muss die Oberfläche unter den Prüfbedingungen uneingeschränkt zugänglich sein. Die Zugänglichkeit der Oberfläche ist aber nur bei den wenigsten Bauformen von Biogasbehältern gegeben. Möglich ist die Durchführung der unmittelbaren Dichtheitsprüfung z. B. bei dieser Bauform: Bild 5 Die Mehrheit der auf Kläranlagen eingesetzten Biogasbehälter weist jedoch nicht zugängliche Oberflächen auf, zum Beispiel ein auf dem Fundament aufliegendes Bodenblech. Oder der Biogasbehälter ist einfach zu groß, um die unmittelbare Dichtheitsprüfung anzuwenden. DWA 2011, Hennef Seite 4/10
5 Bild 6 zeigt ein Beispiel: Bild 6 Wenn eine unmittelbare Dichtheitsprüfung nicht möglich ist, muss die technische Dichtheit durch eine mittelbare Prüfung nachgewiesen werden. Das heißt es muss nachgewiesen werden, dass der Gasverluststrom eine zulässige Grenze nicht übersteigt. Der zulässige Gasverluststrom (Leckagerate) wird in Anhang A.2 des Merkblatts DWA-M 376 mit 2 des Nenninhalts pro Tag angegeben. Abhängig vom Nenninhalt des Biogasbehälters können somit Leckstellen erkannt werden, die entweder einzeln oder in ihrer Summe die Fläche von 0,2-3 mm 2 übersteigen. In der Praxis wird zur Prüfung der technischen Dichtheit der Biogasbehälter mit Luft oder einem Prüfgas gefüllt. Danach wird der Biogasbehälter dicht verschlossen und die Abnahme des Prüfgasvolumens über die Prüfzeit gemessen. Der Biogasbehälter ist während der Prüfung den äußeren Witterungseinflüssen ausgesetzt. Eine Erwärmung durch Sonneneinstrahlung führt zur Ausdehnung des Volumens, eine Änderung des umgebenden Luftdrucks führt zur Kompression oder Ausdehnung des Volumens. Dieses Verhalten wird durch die Zustandsgleichung von Gasen beschrieben. Hieraus abgeleitet ergibt sich für die Abnahme des Volumens: ΔV N = V A p A /p N T N / T A V E p E /p N T N / T E (2) Während die Messung des Luftdrucks noch einfach durchzuführen ist, kann die Messung der Temperatur mit großen Messfehlern behaftet sein. Sobald der Biogasbehälter durch Sonneneinstrahlung einseitig erwärmt wird, kann eine einheitliche Temperatur innerhalb des Prüfgasvolumens nicht mehr erwartet werden. Das Merkblatt DWA-M 376 empfiehlt daher an sonnigen Tagen den Start und das Ende der Messung vor Beginn der Sonneneinstrahlung am Morgen vorzunehmen. Die Messung wird durch eine dazwischen liegende Erwärmung oder Abkühlung des Biogasbehälters nicht beeinträchtigt. Ein messtechnischer Vorteil ist es, die Messung an einem nur mit geringem Volumen befüllten Biogasbehälter vorzunehmen. Dies ist möglich, da auch bei geringem Füllstand alle zu prüfenden Oberflächen mit dem Prüfgasdruck belastet sind. Vorteil dieses Vorgehens ist, dass die durch die äußeren Bedingungen verursachten Volumenänderungen proportional mit der Verringerung des Prüfgasvolumens abnehmen und somit die Abnahme des Füllvolumens durch den Gasverluststrom mit höherer Genauigkeit gemessen werden kann. Die Bestimmung des Prüfgasvolumens ist in diesem Zustand jedoch nicht einfach wie diese Darstellung des Prüfgasvolumens zeigt. DWA 2011, Hennef Seite 5/10
6 Das Bild stellt die das Gasvolumen begrenzenden Flächen des Biogasbehältermantels, der Belastungsscheibe und der Membran dar. Bild 7 Die Volumenberechnung dieses Körpers mit Mitteln der Stereometrie ist schwierig und nur näherungsweise möglich. Mithilfe eines 3-D Konstruktionsprogramms ist die Berechnung dagegen schnell und mit hoher Genauigkeit durchführbar. Die Ungenauigkeit der Temperaturmessung ist der dominierende Fehler des Verfahrens. Die im Merkblatt angegebene zulässige Leckagerate von 2 des Nenninhalts pro Tag ist so gewählt, dass im Allgemeinen ein verlässliches Ergebnis in längstens 24 Stunden erzielt werden kann. Mit diesen Maßnahmen ist ein Nachweis der technischen Dichtheit des Biogasbehälters entsprechend der Vorgaben des Merkblatts DWA-M 376 möglich. Nach bestandener Dichtheitsprüfung kann der Biogasbehälter mit dem Zertifikat technisch dicht versehen werden. Lautet das Prüfergebnis nicht technisch dicht beginnt eine schwierige Suche nach einer sehr kleinen Leckstelle in einem sehr großen Gasbehälter. 4 DICHTHEITSPRÜFUNG AN BIOGASBEHÄLTERN MIT DRUCKLUFTBELASTUNG Nun wenden wir uns der schwierigeren Aufgabe zu, die Dichtheit eines Biogasbehälters mit Membrandichtung ohne Prüfdruck nachzuweisen. Eine wesentliche Voraussetzung zur Anwendung der Norm DIN EN 1779 ist ohne Prüfdruck nicht erfüllt. Der Sachverständigenkreise Biogas hat im März diesen Jahres ein Merkblatt zur Überprüfung der Gasdichtigkeit von Biogastraglufthauben vorgestellt, das eine Lösung für dieses Problem aufzeigen möchte. Die im Merkblatt vorgestellte Prüfmethode möchte ich im Folgenden diskutieren. DWA 2011, Hennef Seite 6/10
7 Zentraler Punkt im Merkblatt ist die Gleichung: Gleichung (3) ist analog zu Gleichung (1) aufgebaut. In beiden Gleichungen ist der Gasverluststrom gleich dem Produkt aus der Gasdurchlässigkeit der Membran, deren Fläche und einer Druckdifferenz. Im Merkblatt des SVK Biogas wird erläutert dass die Druckdifferenz durch den Partialdruck des Gases erzeugt wird und das Gas infolge Diffusion die Membran durchdringt. Den in meinem Vortrag bereits erwähnten Begriffen Druck, Partialdruck und Diffusion möchte ich noch einen weiteren hinzufügen, die Permeation. Zum besseren Verständnis der Begriffe möchte ich mit Ihnen einen kurzen Exkurs in die Physik der Gase machen. Zuerst betrachten wir eine mit Gas gefüllte Zelle. Bild 8 Die Moleküle des Gases sind in ständiger Bewegung und stoßen gegeneinander. Bekannt ist dies als brownsche Molekularbewegung. Im mikroskopischen Maßstab betrachtet ändert jedes Molekül ständig seine Position im Raum. Im makroskopischen Maßstab ist die Summe über die Bewegungen aller Moleküle jedoch zu jedem Zeitpunkt exakt 0. Von außen ist keine Bewegung zu beobachten. Die Häufigkeit der Stöße nimmt zu mit der Abnahme des Wegs zwischen den Stößen und Zunahme der Geschwindigkeit der Gasmoleküle. Das heißt mit Zunahme der Dichte und der Temperatur des Gases. Die Stöße der Gasmoleküle gegen eine Wand verursachen eine Kraft gegen die Wand. Diese Kraft ist der messbare Gasdruck und hiervon abgeleitet der Differenzdruck und der Prüfdruck. Nun unterteilen wir die Zelle mit einer Membran die aufgrund von Mikroporen nicht vollständig dicht ist. Bild 9 Der Druck in den beiden Zellen soll nicht gleich sein damit ein Differenzdruck auf die Membran wirkt. Folge hiervon ist ein Gasstrom gemäß Gleichung (1) von der Zelle mit höherem Druck in die Zelle mit niedrigerem Druck. DWA 2011, Hennef Seite 7/10
8 Dieser Prozess der Durchdringung eines Gases durch einen Festkörper infolge eines Differenzdrucks wird Permeation genannt. In einem weiteren Experiment füllen wir in die nicht mit einer Membran unterteilte Zelle zwei verschiedene Gase, die sich jeweils in einer Hälfte der Zelle befinden sollen. Natürlich herrscht dann in der gesamten Zelle derselbe Druck. Bild 10 Aufgrund der Druckverhältnisse besteht kein Anlass zu einer Änderung des Zustands in der Zelle. Trotzdem wird man beobachten, dass sich die beiden Gase gegenseitig mischen bis letztendlich beide Gase gleichmäßig in der Zelle verteilt sind. Ursache dieses Prozesses ist die brownsche Molekularbewegung. Ein Molekül wird sich während seiner ständigen Bewegung mit höherer Wahrscheinlichkeit aus dem Raum höherer Konzentration in den Raum geringerer Konzentration bewegen als in umgekehrte Richtung. Erst wenn die Gleichverteilung erreicht ist sind alle Bewegungsrichtungen mit gleicher Wahrscheinlichkeit versehen und ein stabiler Zustand erreicht. Von außen betrachtet sieht es aus, als ob die Gase sich aufgrund eines Differenzdrucks bewegen, allerdings mit sehr viel geringerer Geschwindigkeit als unter der Wirkung eines realen Differenzdrucks. Der diesen Prozess bewirkende Druck wird daher Partialdruck genannt, die Proportionalitätskonstante ist die Diffusionskonstante. Die Geschwindigkeit des Gastransports durch Diffusion ist gegenüber dem Gastransport durch einen Differenzdruck sehr gering. Dies kann man sehr gut verdeutlichen durch folgenden Gedankenversuch: Anstelle des zweiten Gases befindet sich in der Zelle nichts, das heißt ein Vakuum. Der Druck des Gases ist genau so hoch wie zuvor sein Partialdruck. Bild 11 Das Gas wird sich im Gegensatz zum zuvor geschilderten langsamen Diffusionsprozess nun in extrem kurzer Zeit gleichmäßig im Raum verteilen. Obwohl Druck und Partialdruck in der gleichen Maßeinheit gemessen werden sind sie physikalisch unterschiedlich zu bewerten. DWA 2011, Hennef Seite 8/10
9 Nun zurück zum Merkblatt des SVK Biogas. In Gleichung (3) wird die mit einem Differenzdruck nach DIN gemessene Gasdurchlässigkeit der Membran mit der Partialdruckdifferenz an der Membran multipliziert. Dies ist falsch wie wir gesehen haben und entsprechend falsch sind auch alle weiteren hieraus gezogenen Schlüsse. Korrekt wäre es, die Diffusionskonstante der Membran in der Weise zu bestimmen, dass auf einer Seite der Membran Methan und der anderen Seite Luft unter gleichem Druck ansteht. Bild 12 Allerdings erwarte ich bei diesem Versuch einen nachweisbaren Gasdurchgang erst nach sehr langer Messzeit und eine entsprechend geringe Diffusionskonstante des Methans durch die Membran. Es scheint, dass diese Messung bisher noch nicht durchgeführt wurde, denn Messwerte habe ich nicht gefunden. Tatsächlich wird in der Abluft von Biogastraglufthauben häufig eine nicht unerhebliche Methankonzentration gemessen. Die Ursache der Methankonzentration kann nicht, wie im Merkblatt angegeben, die Diffusion von Methan durch die Membran sein. Der auf diesem Weg mögliche Gasstrom ist viel zu gering um die Ursache der messbaren Methankonzentration zu sein. Ein denkbarer Weg für den Methanübertritt in den Zwischenmembranraum ist die Diffusion an Grenzflächen an denen Methan in unmittelbarem Kontakt mit der Stützluft steht. Diese Grenzflächen sind Löcher in der Membran. Bei einer Begutachtung nach einem Unfall einer Biogasanlage wurden Löcher dieser Größe an der Biogasspeichermembran festgestellt: Bild 13 DWA 2011, Hennef Seite 9/10
10 Wir haben gesehen, dass das Merkblatt des SVK Biogas an entscheidender Stelle einen schwerwiegenden Fehler enthält. Folge ist, dass mit dem im Merkblatt geschilderten Verfahren nicht die Gasdichtigkeit von Biogastraglufthauben geprüft werden kann. Die diesbezügliche Aussage im Merkblatt DWA-M 376: Eine Prüfung der technischen Dichtheit kann in der Regel aufgrund der Bauart solcher Behälter nicht durchgeführt werden ist nicht widerlegt sondern betätigt worden. Die Dichtheitsprüfung hat einen hohen sicherheitstechnischen Stellenwert. Sobald die Biogasspeichermembran einer Biogastraglufthaube an die Grenze ihres Füllstands gerät wird durch nicht erkannte Leckstellen bei Überfüllung Biogas in großer Menge in den Stützluftraum gedrückt oder bei vollständiger Entleerung Luft in den Biogasraum. Folge ist die Bildung eines zündfähigen Gemischs. In Fachkreisen ist bekannt, dass Biogasanlagen ein hohes Unfallrisiko aufweisen. Das Unfallrisiko ist wesentlich höher als das vergleichbarer Kläranlagen. Ich möchte die Vermutung äußern, dass das falsche Verständnis der Eigenschaften von Gasen zu einer falschen Beurteilung der Sicherheit von Biogasanlagen führt. Die angenommene Sicherheit ist tatsächlich nicht vorhanden. Dies könnte der Grund für einige schwere Explosionsunfälle mit Biogasanlagen sein. Fermenter mit Biogastraglufthauben werden seit vielen Jahren gebaut. Die Diskussion um ein geeignetes Verfahren zur Prüfung der technischen Dichtheit wird seit über 10 Jahren in Fachausschüssen der DWA, dem Fachverband Biogas und anderen geführt. In dieser Zeit konnte keine anerkannte praktikable Methode zur Feststellung der Eigenschaft technisch dicht für Biogastraglufthauben gefunden werden, wie im Entwurf des Merkblatts zu lesen war. Nun ist es an der Zeit die Frage zu stellen ob der Bau und der Betrieb dieser Anlagen weiterhin zu verantworten ist. Alternative, prüfbare und daher sichere Technologien die auf Kläranlagen eingesetzt werden, stehen zur Verfügung. Bildquellennachweis: Bild 1: DIN EN 1779 Bild 2: DIN Teil 1 Bild 3: DIN Teil 2 Bild 4: Eisenbau Heilbronn GmbH Bild 5: Eisenbau Heilbronn GmbH Bild 6: Eisenbau Heilbronn GmbH Bild 7: Eisenbau Heilbronn GmbH Bild 8: Eisenbau Heilbronn GmbH Bild 9: Eisenbau Heilbronn GmbH Bild 10: Eisenbau Heilbronn GmbH Bild 11: Eisenbau Heilbronn GmbH Bild 12: Eisenbau Heilbronn GmbH Bild 13: DAS-IB GmbH Tagungsbuch 7. April 2008 ISBN-Nr.: DWA 2011, Hennef Seite 10/10
Speicherung von Biogasen
 DWA Biogas- und Energietage Marburg 20. 22. Juni 2006 Speicherung von Biogasen Roland Stehle, Heilbronn 1 EINLEITUNG 2 ENTWICKLUNG DER GASBEHÄLTERTECHNIK 3 ARTEN VON BIOGASBEHÄLTERN MIT MEMBRANDICHTUNG
DWA Biogas- und Energietage Marburg 20. 22. Juni 2006 Speicherung von Biogasen Roland Stehle, Heilbronn 1 EINLEITUNG 2 ENTWICKLUNG DER GASBEHÄLTERTECHNIK 3 ARTEN VON BIOGASBEHÄLTERN MIT MEMBRANDICHTUNG
2.4 Kinetische Gastheorie - Druck und Temperatur im Teilchenmodell
 2.4 Kinetische Gastheorie - Druck und Temperatur im Teilchenmodell Mit den drei Zustandsgrößen Druck, Temperatur und Volumen konnte der Zustand von Gasen makroskopisch beschrieben werden. So kann zum Beispiel
2.4 Kinetische Gastheorie - Druck und Temperatur im Teilchenmodell Mit den drei Zustandsgrößen Druck, Temperatur und Volumen konnte der Zustand von Gasen makroskopisch beschrieben werden. So kann zum Beispiel
Gase, Flüssigkeiten, Feststoffe
 Gase, Flüssigkeiten, Feststoffe Charakteristische Eigenschaften der Aggregatzustände Gas: Flüssigkeit: Feststoff: Nimmt das Volumen und die Form seines Behälters an. Ist komprimierbar. Fliesst leicht.
Gase, Flüssigkeiten, Feststoffe Charakteristische Eigenschaften der Aggregatzustände Gas: Flüssigkeit: Feststoff: Nimmt das Volumen und die Form seines Behälters an. Ist komprimierbar. Fliesst leicht.
Hydr. Druck, Luftdruck
 Hydr. Druck, Luftdruck Den Begriff Druck verwenden wir oft im täglichen Leben. Wir hören im Zusammenhang mit den Wettervorhersagen täglich vom. oder. (z.b.oder..). Wir haben einen bestimmten.in unseren
Hydr. Druck, Luftdruck Den Begriff Druck verwenden wir oft im täglichen Leben. Wir hören im Zusammenhang mit den Wettervorhersagen täglich vom. oder. (z.b.oder..). Wir haben einen bestimmten.in unseren
Teilchenmodell: * Alle Stoffe bestehen aus Teilchen (Atomen, Molekülen). * Die Teilchen befinden sich in ständiger Bewegung.
 Teilchenmodell Teilchenmodell: * Alle Stoffe bestehen aus Teilchen (Atomen, Molekülen). * Die Teilchen befinden sich in ständiger Bewegung. *Zwischen den Teilchen wirken anziehende bzw. abstoßende Kräfte.
Teilchenmodell Teilchenmodell: * Alle Stoffe bestehen aus Teilchen (Atomen, Molekülen). * Die Teilchen befinden sich in ständiger Bewegung. *Zwischen den Teilchen wirken anziehende bzw. abstoßende Kräfte.
Biogasanlage Riedlingen Ein Beitrag zur Klärung der Unfallursache
 Biogasanlage Riedlingen Ein Beitrag zur Klärung der Unfallursache Roland Stehle, Heilbronn Der Anwendungsbereich des Merkblatt DWA-M 376 Sicherheitsregeln für Biogasbehälter mit Membrandichtung ist auf
Biogasanlage Riedlingen Ein Beitrag zur Klärung der Unfallursache Roland Stehle, Heilbronn Der Anwendungsbereich des Merkblatt DWA-M 376 Sicherheitsregeln für Biogasbehälter mit Membrandichtung ist auf
Behälter- und Apparatebau
 Stellungnahme der Firma Eisenbau Heilbronn GmbH zu drucklosen Gasbehältern (ohne Gewichtsbelastung) unter besonderer Berücksichtigung von Sicherheits- und Kostenaspekten Drucklose Gasbehälter stellen bei
Stellungnahme der Firma Eisenbau Heilbronn GmbH zu drucklosen Gasbehältern (ohne Gewichtsbelastung) unter besonderer Berücksichtigung von Sicherheits- und Kostenaspekten Drucklose Gasbehälter stellen bei
4 Thermodynamik mikroskopisch: kinetische Gastheorie makroskopisch: System:
 Theorie der Wärme kann auf zwei verschiedene Arten behandelt werden. mikroskopisch: Bewegung von Gasatomen oder -molekülen. Vielzahl von Teilchen ( 10 23 ) im Allgemeinen nicht vollständig beschreibbar
Theorie der Wärme kann auf zwei verschiedene Arten behandelt werden. mikroskopisch: Bewegung von Gasatomen oder -molekülen. Vielzahl von Teilchen ( 10 23 ) im Allgemeinen nicht vollständig beschreibbar
Physikalisches Praktikum I
 Fachbereich Physik Physikalisches Praktikum I W21 Name: Verdampfungswärme von Wasser Matrikelnummer: Fachrichtung: Mitarbeiter/in: Assistent/in: Versuchsdatum: Gruppennummer: Endtestat: Folgende Fragen
Fachbereich Physik Physikalisches Praktikum I W21 Name: Verdampfungswärme von Wasser Matrikelnummer: Fachrichtung: Mitarbeiter/in: Assistent/in: Versuchsdatum: Gruppennummer: Endtestat: Folgende Fragen
1 Atmosphäre (atm) = 760 torr = 1013,25 mbar = Pa 760 mm Hg ( bei 0 0 C, g = 9,80665 m s -2 )
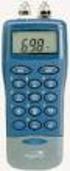 Versuch Nr.51 Druck-Messung in Gasen (Bestimmung eines Gasvolumens) Stichworte: Druck, Druckeinheiten, Druckmeßgeräte (Manometer, Vakuummeter), Druckmessung in U-Rohr-Manometern, Gasgesetze, Isothermen
Versuch Nr.51 Druck-Messung in Gasen (Bestimmung eines Gasvolumens) Stichworte: Druck, Druckeinheiten, Druckmeßgeräte (Manometer, Vakuummeter), Druckmessung in U-Rohr-Manometern, Gasgesetze, Isothermen
Unterschiede zwischen der DIN EN ISO 9972 und DIN EN Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von Gebäuden Differenzdruckverfahren
 Unterschiede zwischen der DIN EN ISO 9972 und DIN EN 13829 Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von Gebäuden Differenzdruckverfahren Im Folgenden wird auf einige Unterschiede zwischen den beiden Normen eingegangen.
Unterschiede zwischen der DIN EN ISO 9972 und DIN EN 13829 Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von Gebäuden Differenzdruckverfahren Im Folgenden wird auf einige Unterschiede zwischen den beiden Normen eingegangen.
Versuch V1 - Viskosität, Flammpunkt, Dichte
 Versuch V1 - Viskosität, Flammpunkt, Dichte 1.1 Bestimmung der Viskosität Grundlagen Die Viskosität eines Fluids ist eine Stoffeigenschaft, die durch den molekularen Impulsaustausch der einzelnen Fluidpartikel
Versuch V1 - Viskosität, Flammpunkt, Dichte 1.1 Bestimmung der Viskosität Grundlagen Die Viskosität eines Fluids ist eine Stoffeigenschaft, die durch den molekularen Impulsaustausch der einzelnen Fluidpartikel
1. Wärmelehre 1.1. Temperatur. Physikalische Grundeinheiten : Die Internationalen Basiseinheiten SI (frz. Système international d unités)
 1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Physikalische Grundeinheiten : Die Internationalen Basiseinheiten SI (frz. Système international d unités) 1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Ein Maß für die Temperatur Prinzip
1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Physikalische Grundeinheiten : Die Internationalen Basiseinheiten SI (frz. Système international d unités) 1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Ein Maß für die Temperatur Prinzip
Thermodynamik 1. Typen der thermodynamischen Systeme. Intensive und extensive Zustandsgröße. Phasenübergänge. Ausdehnung bei Erwärmung.
 Thermodynamik 1. Typen der thermodynamischen Systeme. Intensive und extensive Zustandsgröße. Phasenübergänge. Ausdehnung bei Erwärmung. Nullter und Erster Hauptsatz der Thermodynamik. Thermodynamische
Thermodynamik 1. Typen der thermodynamischen Systeme. Intensive und extensive Zustandsgröße. Phasenübergänge. Ausdehnung bei Erwärmung. Nullter und Erster Hauptsatz der Thermodynamik. Thermodynamische
Dichtheit von Containments Vorstellung VDI 2083 Blatt 19 (Entwurf)
 Inhalt Dichtheit von Containments Vorstellung VDI 2083 Blatt 19 (Entwurf) Vortrag im Rahmen des 12. Swiss Cleanroom Community Events in Pratteln Benjamin Pfändler B.Sc. Projektleiter Reinraumtechnik /
Inhalt Dichtheit von Containments Vorstellung VDI 2083 Blatt 19 (Entwurf) Vortrag im Rahmen des 12. Swiss Cleanroom Community Events in Pratteln Benjamin Pfändler B.Sc. Projektleiter Reinraumtechnik /
Grundpraktikum A T7 Spezifische Wärmekapazität idealer Gase
 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Institut für Physik Grundpraktikum A T7 Spezifische Wärmekapazität idealer Gase 16.6.217 Studenten: Tim Will Betreuer: Raum: Messplatz: M. NEW14-2.15 Links
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Institut für Physik Grundpraktikum A T7 Spezifische Wärmekapazität idealer Gase 16.6.217 Studenten: Tim Will Betreuer: Raum: Messplatz: M. NEW14-2.15 Links
Der atmosphärische Luftdruck
 Gasdruck Der Druck in einem eingeschlossenen Gas entsteht durch Stöße der Gasteilchen (Moleküle) untereinander und gegen die Gefäßwände. In einem Gefäß ist der Gasdruck an allen Stellen gleich groß und
Gasdruck Der Druck in einem eingeschlossenen Gas entsteht durch Stöße der Gasteilchen (Moleküle) untereinander und gegen die Gefäßwände. In einem Gefäß ist der Gasdruck an allen Stellen gleich groß und
Bestimmung des Spannungskoeffizienten eines Gases
 Bestimmung des Spannungskoeffizienten eines Gases Einleitung Bei diesem Experiment wollen wir den Spannungskoeffizienten α eines Gases möglichst genau bestimmen und in Folge mit dem Spannungskoeffizienten
Bestimmung des Spannungskoeffizienten eines Gases Einleitung Bei diesem Experiment wollen wir den Spannungskoeffizienten α eines Gases möglichst genau bestimmen und in Folge mit dem Spannungskoeffizienten
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Physik kompetenzorientiert: Mechanik 1
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Physik kompetenzorientiert: Mechanik 1 Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Eigenschaften von Körpern
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Physik kompetenzorientiert: Mechanik 1 Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Eigenschaften von Körpern
Pumpen Fördern Flüssigkeiten
 Anwendungen Bauformen Pumpen Fördern Flüssigkeiten Flüssigkeiten sind inkompressibel Physik der Flüssigkeiten Gewichtsdruck / Höhendruck Stömungspumpen Verdrängerpumpen Energieumwandlung Strömende Flüssigkeiten
Anwendungen Bauformen Pumpen Fördern Flüssigkeiten Flüssigkeiten sind inkompressibel Physik der Flüssigkeiten Gewichtsdruck / Höhendruck Stömungspumpen Verdrängerpumpen Energieumwandlung Strömende Flüssigkeiten
Rahmenbedingungen zur Dichtheit von Kälteanlagen
 Fachforum IKK Nürnberg 2006 Rahmenbedingungen zur Dichtheit von Kälteanlagen Bernhard Schrempf TÜV SÜD Industrie Service 1 Inhalt DIN EN 378 NEU Teil 2 Methoden der Dichtheitsprüfung Verfahren der Dichtheitsprüfung
Fachforum IKK Nürnberg 2006 Rahmenbedingungen zur Dichtheit von Kälteanlagen Bernhard Schrempf TÜV SÜD Industrie Service 1 Inhalt DIN EN 378 NEU Teil 2 Methoden der Dichtheitsprüfung Verfahren der Dichtheitsprüfung
Merkblatt zur Gasdichtigkeit von Biogastragluftdächern (sog. Doppelmembran-Biogasspeicher) im Normalbetrieb
 Stand 8.XII.2010 Merkblatt - Entwurf Seite 1 / 13 Merkblatt zur Gasdichtigkeit von Biogastragluftdächern (sog. Doppelmembran-Biogasspeicher) im Normalbetrieb Die Vermeidung von gasförmigen Emissionen aus
Stand 8.XII.2010 Merkblatt - Entwurf Seite 1 / 13 Merkblatt zur Gasdichtigkeit von Biogastragluftdächern (sog. Doppelmembran-Biogasspeicher) im Normalbetrieb Die Vermeidung von gasförmigen Emissionen aus
Härtbarkeit von Stahl in Abhängigkeit vom Kohlenstoffgehalt
 Experimentelle Werkstoffkunde Versuch 3.5 113 Versuch 3.5 Härtbarkeit von Stahl in Abhängigkeit vom Kohlenstoffgehalt Dieses Experiment zeigt, dass bei einer in sehr kurzer Zeit erzwungenen Gitterumwandlung
Experimentelle Werkstoffkunde Versuch 3.5 113 Versuch 3.5 Härtbarkeit von Stahl in Abhängigkeit vom Kohlenstoffgehalt Dieses Experiment zeigt, dass bei einer in sehr kurzer Zeit erzwungenen Gitterumwandlung
Akatherm FIP GmbH Steinzeugstraße 50 D Mannheim /Hh/Os/Gue PP Membranventil vom Typ VM/EPDM/FPM. 2 xakatherm FIP GmbH
 Postfach 801140 D-70511 Stuttgart DAP - PL - 2907.99 Prüfungsbericht Auftraggeber: Akatherm FIP GmbH Steinzeugstraße 50 D-68229 Mannheim Auftrags-Nr. (Kunde): Auftrags-Nr. (MPA): Prüfgegenstand: 901 2600
Postfach 801140 D-70511 Stuttgart DAP - PL - 2907.99 Prüfungsbericht Auftraggeber: Akatherm FIP GmbH Steinzeugstraße 50 D-68229 Mannheim Auftrags-Nr. (Kunde): Auftrags-Nr. (MPA): Prüfgegenstand: 901 2600
Biogasspeichermembranen
 Verseidag-Indutex GmbH Biogasspeichermembranen Methandurchlässigkeit/Reißfestigkeit DLG-Prüfbericht 5883 F Kurzbeschreibung Hersteller/Anmelder Verseidag-Indutex GmbH Geschäftsbereich duraskin Postfach
Verseidag-Indutex GmbH Biogasspeichermembranen Methandurchlässigkeit/Reißfestigkeit DLG-Prüfbericht 5883 F Kurzbeschreibung Hersteller/Anmelder Verseidag-Indutex GmbH Geschäftsbereich duraskin Postfach
1. Ziel des Versuchs. 2. Theorie. Dennis Fischer Gruppe 9 Magdalena Boeddinghaus
 Versuch Nr. 12: Gasthermometer 1. Ziel des Versuchs In diesem Versuch soll die Temperaturmessung durch Druckmessung erlernt werden. ußerdem soll der absolute Nullpunkt des Thermometers bestimmt werden.
Versuch Nr. 12: Gasthermometer 1. Ziel des Versuchs In diesem Versuch soll die Temperaturmessung durch Druckmessung erlernt werden. ußerdem soll der absolute Nullpunkt des Thermometers bestimmt werden.
 Sinkt ein Körper in einer zähen Flüssigkeit mit einer konstanten, gleichförmigen Geschwindigkeit, so (A) wirkt auf den Körper keine Gewichtskraft (B) ist der auf den Körper wirkende Schweredruck gleich
Sinkt ein Körper in einer zähen Flüssigkeit mit einer konstanten, gleichförmigen Geschwindigkeit, so (A) wirkt auf den Körper keine Gewichtskraft (B) ist der auf den Körper wirkende Schweredruck gleich
1. STOFFE UND STOFFEIGENSCHAFTEN ARBEITSBLATT 1.1 MATERIE UND IHRE KLEINSTEN BAUSTEINE VORÜBERLEGUNGEN
 1. STOFFE UND STOFFEIGENSCHAFTEN ARBEITSBLATT 1.1 MATERIE UND IHRE KLEINSTEN BAUSTEINE Chemie beschäftigt sich mit Materie. Die Aggregatzustände (s, l und g) sind Formen der Materie. Materie besteht aus
1. STOFFE UND STOFFEIGENSCHAFTEN ARBEITSBLATT 1.1 MATERIE UND IHRE KLEINSTEN BAUSTEINE Chemie beschäftigt sich mit Materie. Die Aggregatzustände (s, l und g) sind Formen der Materie. Materie besteht aus
Skript zur Vorlesung
 Skript zur Vorlesung 1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Physikalische Grundeinheiten : Die Internationalen Basiseinheiten SI (frz. Système international d unités) 1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Ein Maß für
Skript zur Vorlesung 1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Physikalische Grundeinheiten : Die Internationalen Basiseinheiten SI (frz. Système international d unités) 1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Ein Maß für
Physikalisches Praktikum
 Physikalisches Praktikum Viskosität von Flüssigkeiten Laborbericht Korrigierte Version 9.Juni 2002 Andreas Hettler Inhalt Kapitel I Begriffserklärungen 5 Viskosität 5 Stokes sches
Physikalisches Praktikum Viskosität von Flüssigkeiten Laborbericht Korrigierte Version 9.Juni 2002 Andreas Hettler Inhalt Kapitel I Begriffserklärungen 5 Viskosität 5 Stokes sches
Arbeitsblatt zum Thema Einfache Messinstrumente
 Arbeitsblatt zum Thema Einfache Messinstrumente Das Flüssigkeitsthermometer dient zur Messung der Temperatur, welche in der Einheit Grad Celsius gemessen wird. Materialien: Chemikalien: Heizplatte, Stativ,
Arbeitsblatt zum Thema Einfache Messinstrumente Das Flüssigkeitsthermometer dient zur Messung der Temperatur, welche in der Einheit Grad Celsius gemessen wird. Materialien: Chemikalien: Heizplatte, Stativ,
Methoden der Werkstoffprüfung Kapitel I Grundlagen. WS 2009/2010 Kapitel 1.0
 Methoden der Werkstoffprüfung Kapitel I Grundlagen WS 2009/2010 Kapitel 1.0 Grundlagen Probenmittelwerte ohne MU Akzeptanzbereich Probe 1 und 2 liegen im Akzeptanzbereich Sie sind damit akzeptiert! Probe
Methoden der Werkstoffprüfung Kapitel I Grundlagen WS 2009/2010 Kapitel 1.0 Grundlagen Probenmittelwerte ohne MU Akzeptanzbereich Probe 1 und 2 liegen im Akzeptanzbereich Sie sind damit akzeptiert! Probe
Maxwell-Boltzmann Verteilung. Mykola Zotko Frankfurt am Main
 Maxwell-Boltzmann Verteilung James Clerk Maxwell 1831-1879 Ludwig Boltzmann 1844-1906 Maxwell-Boltzmann Verteilung 1860 Geschwindigkeitsverteilung - eine Verteilungsfunktion, die angibt, mit welcher relativen
Maxwell-Boltzmann Verteilung James Clerk Maxwell 1831-1879 Ludwig Boltzmann 1844-1906 Maxwell-Boltzmann Verteilung 1860 Geschwindigkeitsverteilung - eine Verteilungsfunktion, die angibt, mit welcher relativen
DICHTHEITSPRÜFUNG von KLEINKLÄRANLAGEN
 DWA-Landesverband Sachsen / Thüringen 11. Workshop Wartung von Kleinkläranlagen 15. Oktober 2014 in Glauchau DICHTHEITSPRÜFUNG von KLEINKLÄRANLAGEN Dipl.-Ing. Bernd Goldberg DICHTHEITSPRÜFUNG KLEINKLÄRANLAGEN
DWA-Landesverband Sachsen / Thüringen 11. Workshop Wartung von Kleinkläranlagen 15. Oktober 2014 in Glauchau DICHTHEITSPRÜFUNG von KLEINKLÄRANLAGEN Dipl.-Ing. Bernd Goldberg DICHTHEITSPRÜFUNG KLEINKLÄRANLAGEN
Kernaussagen zum Teilchenmodell
 Kernaussagen zum Teilchenmodell Lernbereich 2: Stoffe und ihre Eigenschaften Von beobachtbaren Stoffeigenschaften zum Teilchenmodell Kompetenzerwartung 8 (NTG) und 9 (SG): Die Schülerinnen und Schüler
Kernaussagen zum Teilchenmodell Lernbereich 2: Stoffe und ihre Eigenschaften Von beobachtbaren Stoffeigenschaften zum Teilchenmodell Kompetenzerwartung 8 (NTG) und 9 (SG): Die Schülerinnen und Schüler
Fachhochschule Flensburg. Dichte von Flüssigkeiten
 Fachhochschule Flensburg Fachbereich Technik Institut für Physik und Werkstoffe Name : Name: Versuch-Nr: M9 Dichte von Flüssigkeiten Gliederung: Seite Einleitung 1 Messung der Dichte mit der Waage nach
Fachhochschule Flensburg Fachbereich Technik Institut für Physik und Werkstoffe Name : Name: Versuch-Nr: M9 Dichte von Flüssigkeiten Gliederung: Seite Einleitung 1 Messung der Dichte mit der Waage nach
Grundlagen und Anwendungen der Lecksuche mit Trägergasverfahren
 7. Fachseminar Dichtheitsprüfung und Lecksuche Vortrag 3 Grundlagen und Anwendungen der Lecksuche mit Trägergasverfahren Klaus HERRMANN 1, Daniel WETZIG 1 1 INFICON GmbH, Köln Kontakt E-Mail: Klaus.Herrmann@inficon.com
7. Fachseminar Dichtheitsprüfung und Lecksuche Vortrag 3 Grundlagen und Anwendungen der Lecksuche mit Trägergasverfahren Klaus HERRMANN 1, Daniel WETZIG 1 1 INFICON GmbH, Köln Kontakt E-Mail: Klaus.Herrmann@inficon.com
W2 Gasthermometer. 1. Grundlagen: 1.1 Gasthermometer und Temperaturmessung
 W2 Gasthermometer Stoffgebiet: Versuchsziel: Literatur: Temperaturmessung, Gasthermometer, Gasgesetze Mit Hilfe eines Gasthermometers sind der Ausdehnungs- und Druckkoeffizient von Luft zu bestimmen. Beschäftigung
W2 Gasthermometer Stoffgebiet: Versuchsziel: Literatur: Temperaturmessung, Gasthermometer, Gasgesetze Mit Hilfe eines Gasthermometers sind der Ausdehnungs- und Druckkoeffizient von Luft zu bestimmen. Beschäftigung
O. Sternal, V. Hankele. 5. Thermodynamik
 5. Thermodynamik 5. Thermodynamik 5.1 Temperatur und Wärme Systeme aus vielen Teilchen Quelle: Wikimedia Commons Datei: Translational_motion.gif Versuch: Beschreibe 1 m 3 Luft mit Newton-Mechanik Beschreibe
5. Thermodynamik 5. Thermodynamik 5.1 Temperatur und Wärme Systeme aus vielen Teilchen Quelle: Wikimedia Commons Datei: Translational_motion.gif Versuch: Beschreibe 1 m 3 Luft mit Newton-Mechanik Beschreibe
8.4.5 Wasser sieden bei Zimmertemperatur ******
 8.4.5 ****** 1 Motivation Durch Verminderung des Luftdrucks siedet Wasser bei Zimmertemperatur. 2 Experiment Abbildung 1: Ein druckfester Glaskolben ist zur Hälfte mit Wasser gefüllt, so dass die Flüsigkeit
8.4.5 ****** 1 Motivation Durch Verminderung des Luftdrucks siedet Wasser bei Zimmertemperatur. 2 Experiment Abbildung 1: Ein druckfester Glaskolben ist zur Hälfte mit Wasser gefüllt, so dass die Flüsigkeit
Einführungspraktikum F0 Auswertung und Präsentation von Messdaten
 Einführungspraktikum F0 Auswertung und Präsentation von Messdaten Julien Kluge 20. Februar 2015 Student: Julien Kluge (564513) Partner: Emily Albert (564536) Betreuer: Pascal Rustige Raum: 217 INHALTSVERZEICHNIS
Einführungspraktikum F0 Auswertung und Präsentation von Messdaten Julien Kluge 20. Februar 2015 Student: Julien Kluge (564513) Partner: Emily Albert (564536) Betreuer: Pascal Rustige Raum: 217 INHALTSVERZEICHNIS
VORSCHAU. zur Vollversion. Inhaltsverzeichnis
 Inhaltsverzeichnis Körpereigenschaften Volumen (1)... 1 Volumen (2)... 2 Masse, Volumen und Dichte (1)... 3 Masse, Volumen und Dichte (2)... 4 Dichte... 5 messen (1)... 6 messen (2)... 7 Wirkungen von
Inhaltsverzeichnis Körpereigenschaften Volumen (1)... 1 Volumen (2)... 2 Masse, Volumen und Dichte (1)... 3 Masse, Volumen und Dichte (2)... 4 Dichte... 5 messen (1)... 6 messen (2)... 7 Wirkungen von
Arbeitsweisen der Physik
 Übersicht Karteikarten Klasse 7 - Arbeitsweisen - Beobachten - Beschreiben - Beschreiben von Gegenständen, Erscheinungen und Prozessen - Beschreiben des Aufbaus und Erklären der Wirkungsweise eines technischen
Übersicht Karteikarten Klasse 7 - Arbeitsweisen - Beobachten - Beschreiben - Beschreiben von Gegenständen, Erscheinungen und Prozessen - Beschreiben des Aufbaus und Erklären der Wirkungsweise eines technischen
der physikalischen Eigenschaften Randverbund von Mehrscheiben-Isolierglas nach DIN EN
 Nachweis der physikalischen Eigenschaften für den Randverbund von Mehrscheiben-Isolierglas nach DIN EN 1279-4 Prüfbericht 601 34667/3 Auftraggeber Kömmerling Chemische Fabrik GmbH Zweibrücker Str. 200
Nachweis der physikalischen Eigenschaften für den Randverbund von Mehrscheiben-Isolierglas nach DIN EN 1279-4 Prüfbericht 601 34667/3 Auftraggeber Kömmerling Chemische Fabrik GmbH Zweibrücker Str. 200
Kapitel 10 - Gase. Kapitel 10 - Gase. Gase bestehen aus räumlich weit voneinander getrennten Atome/Moleküle in schneller Bewegung
 Kapitel 0 - Gase Gase bestehen aus räumlich weit voneinander getrennten Atome/Moleküle in schneller ewegung Druck Kraft pro Fläche in Pa(scal) oder bar Normdruck = 760mm = 0,35 KPa =,035 bar = atm Messung
Kapitel 0 - Gase Gase bestehen aus räumlich weit voneinander getrennten Atome/Moleküle in schneller ewegung Druck Kraft pro Fläche in Pa(scal) oder bar Normdruck = 760mm = 0,35 KPa =,035 bar = atm Messung
Grundlagen der statistischen Physik und Thermodynamik
 Grundlagen der statistischen Physik und Thermodynamik "Feuer und Eis" von Guy Respaud 6/14/2013 S.Alexandrova FDIBA 1 Grundlagen der statistischen Physik und Thermodynamik Die statistische Physik und die
Grundlagen der statistischen Physik und Thermodynamik "Feuer und Eis" von Guy Respaud 6/14/2013 S.Alexandrova FDIBA 1 Grundlagen der statistischen Physik und Thermodynamik Die statistische Physik und die
Kinetische Gastheorie - Die Gauss sche Normalverteilung
 Kinetische Gastheorie - Die Gauss sche Normalverteilung Die Gauss sche Normalverteilung Die Geschwindigkeitskomponenten eines Moleküls im idealen Gas sind normalverteilt mit dem Mittelwert Null. Es ist
Kinetische Gastheorie - Die Gauss sche Normalverteilung Die Gauss sche Normalverteilung Die Geschwindigkeitskomponenten eines Moleküls im idealen Gas sind normalverteilt mit dem Mittelwert Null. Es ist
Aktuelle Anforderungen an Blowerdoor-Messungen
 Aktuelle Anforderungen an Blowerdoor-Messungen Holger Merkel bionic3 GmbH Zwei unverzichtbare Dinge für den Bauablauf Zwei der wichtigsten Dinge für den Bauablauf Regelwerke EnEV DIN-EN 13829 EN ISO 9972
Aktuelle Anforderungen an Blowerdoor-Messungen Holger Merkel bionic3 GmbH Zwei unverzichtbare Dinge für den Bauablauf Zwei der wichtigsten Dinge für den Bauablauf Regelwerke EnEV DIN-EN 13829 EN ISO 9972
Technische Thermodynamik
 Thermodynamik 1 Technische Thermodynamik 2. Semester Versuch 2 Thermodynamik Namen : Datum : Abgabe : Fachhochschule Trier Studiengang Lebensmitteltechnik Prof. Dr. Regier / PhyTa Vera Bauer 02/2010 Thermodynamik
Thermodynamik 1 Technische Thermodynamik 2. Semester Versuch 2 Thermodynamik Namen : Datum : Abgabe : Fachhochschule Trier Studiengang Lebensmitteltechnik Prof. Dr. Regier / PhyTa Vera Bauer 02/2010 Thermodynamik
Dokumentation von Dichtheitsnachweisen
 Dokumentation von Dichtheitsnachweisen Ist ein Dichtheitsnachweis bei Grundstücksentwässerungsanlagen überhaupt möglich? 2. Deutscher Tag der Grundstücksentwässerung, 5. und 6. Mai 2010 Grundlagen Normen
Dokumentation von Dichtheitsnachweisen Ist ein Dichtheitsnachweis bei Grundstücksentwässerungsanlagen überhaupt möglich? 2. Deutscher Tag der Grundstücksentwässerung, 5. und 6. Mai 2010 Grundlagen Normen
Merkblatt zur Überprüfung der Gasdichtigkeit von Biogastraglufthauben (so genannte Doppelmembran-Biogasspeicher) im Normalbetrieb
 Stand 11.III.2011 Seite 1 / 17 Merkblatt zur Überprüfung der Gasdichtigkeit von Biogastraglufthauben (so genannte Doppelmembran-Biogasspeicher) im Normalbetrieb Stand: 11.III.2011 Stand 11.III.2011 Seite
Stand 11.III.2011 Seite 1 / 17 Merkblatt zur Überprüfung der Gasdichtigkeit von Biogastraglufthauben (so genannte Doppelmembran-Biogasspeicher) im Normalbetrieb Stand: 11.III.2011 Stand 11.III.2011 Seite
Klasse : Name : Datum :
 Gasgesetze (Boyle-Mariotte, Gay-Lussac, Amontons) Klasse : Name : Datum : Hinweis: Sämtliche Versuche werden vom Lehrer durchgeführt (Lehrerversuche). Die Protokollierung und Auswertung erfolgt durch den
Gasgesetze (Boyle-Mariotte, Gay-Lussac, Amontons) Klasse : Name : Datum : Hinweis: Sämtliche Versuche werden vom Lehrer durchgeführt (Lehrerversuche). Die Protokollierung und Auswertung erfolgt durch den
W07. Gasthermometer. (2) Bild 1: Skizze Gasfeder
 W07 Gasthermometer Das Gasthermometer ist zur Untersuchung der Gesetzmäßigkeiten idealer Gase geeignet. Insbesondere ermöglicht es eine experimentelle Einführung der absoluten Temperaturskala und gestattet
W07 Gasthermometer Das Gasthermometer ist zur Untersuchung der Gesetzmäßigkeiten idealer Gase geeignet. Insbesondere ermöglicht es eine experimentelle Einführung der absoluten Temperaturskala und gestattet
Vergleich Auslaufbecher und Rotationsviskosimeter
 Vergleich Auslaufbecher und Rotationsviskosimeter Die Viskositätsmessung mit dem Auslaufbecher ist, man sollte es kaum glauben, auch in unserer Zeit der allgemeinen Automatisierung und ISO 9 Zertifizierungen
Vergleich Auslaufbecher und Rotationsviskosimeter Die Viskositätsmessung mit dem Auslaufbecher ist, man sollte es kaum glauben, auch in unserer Zeit der allgemeinen Automatisierung und ISO 9 Zertifizierungen
Gasthermometer. durchgeführt am von Matthias Dräger, Alexander Narweleit und Fabian Pirzer
 Gasthermometer 1 PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN durchgeführt am 21.06.2010 von Matthias Dräger, Alexander Narweleit und Fabian Pirzer 1 Physikalische Grundlagen 1.1 Zustandgleichung des idealen Gases Ein ideales
Gasthermometer 1 PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN durchgeführt am 21.06.2010 von Matthias Dräger, Alexander Narweleit und Fabian Pirzer 1 Physikalische Grundlagen 1.1 Zustandgleichung des idealen Gases Ein ideales
Nachweis Luftdurchlässigkeit
 Nachweis Prüfbericht Nr. 15-000488-PR01 (PB-F10-02-de-01) Auftraggeber Produkt/Bauteil Bezeichnung Material Fugenlänge Ergebnisse *) kein messbarer Luftdurchgang. Der gemessene Luftdurchgang ist bis einschließlich
Nachweis Prüfbericht Nr. 15-000488-PR01 (PB-F10-02-de-01) Auftraggeber Produkt/Bauteil Bezeichnung Material Fugenlänge Ergebnisse *) kein messbarer Luftdurchgang. Der gemessene Luftdurchgang ist bis einschließlich
Weiterführende Informationen. 5. DIN EN (Februar 2001) Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von Gebäuden
 BlowerDoor Weiterführende Informationen 1. Aktuelle gesetzliche Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden 2. Normen und Grenzwerte für die Messung der Luftdurchlässigkeit n 50 mit der BlowerDoor
BlowerDoor Weiterführende Informationen 1. Aktuelle gesetzliche Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden 2. Normen und Grenzwerte für die Messung der Luftdurchlässigkeit n 50 mit der BlowerDoor
Physikalische Chemie Physikalische Chemie I SoSe 2009 Prof. Dr. Norbert Hampp 1/9 1. Das Ideale Gas. Thermodynamik
 Prof. Dr. Norbert Hampp 1/9 1. Das Ideale Gas Thermodynamik Teilgebiet der klassischen Physik. Wir betrachten statistisch viele Teilchen. Informationen über einzelne Teilchen werden nicht gewonnen bzw.
Prof. Dr. Norbert Hampp 1/9 1. Das Ideale Gas Thermodynamik Teilgebiet der klassischen Physik. Wir betrachten statistisch viele Teilchen. Informationen über einzelne Teilchen werden nicht gewonnen bzw.
Vakuum (VAK)
 Inhaltsverzeichnis TUM Anfängerpraktikum für Physiker Vakuum (VAK) 25.2.26. Einleitung...2 2. Ideale Gase...2 3. Verwendetes Material...2 4. Versuchsdurchführung...2 4.. Eichung der Pirani-Manometer...2
Inhaltsverzeichnis TUM Anfängerpraktikum für Physiker Vakuum (VAK) 25.2.26. Einleitung...2 2. Ideale Gase...2 3. Verwendetes Material...2 4. Versuchsdurchführung...2 4.. Eichung der Pirani-Manometer...2
Kühlt der Kühlschrank schlechter, wenn die Sonne auf die Lüftungsgitter scheint?
 Kühlt der Kühlschrank schlechter, wenn die Sonne auf die Lüftungsgitter scheint? Diese Untersuchung wurde an einem Kühlschrank durchgeführt, an dem ein Lüfter zur Verbesserung der Kühlwirkung eingebaut
Kühlt der Kühlschrank schlechter, wenn die Sonne auf die Lüftungsgitter scheint? Diese Untersuchung wurde an einem Kühlschrank durchgeführt, an dem ein Lüfter zur Verbesserung der Kühlwirkung eingebaut
Grundpraktikum M6 innere Reibung
 Grundpraktikum M6 innere Reibung Julien Kluge 1. Juni 2015 Student: Julien Kluge (564513) Partner: Emily Albert (564536) Betreuer: Pascal Rustige Raum: 215 Messplatz: 2 INHALTSVERZEICHNIS 1 ABSTRACT Inhaltsverzeichnis
Grundpraktikum M6 innere Reibung Julien Kluge 1. Juni 2015 Student: Julien Kluge (564513) Partner: Emily Albert (564536) Betreuer: Pascal Rustige Raum: 215 Messplatz: 2 INHALTSVERZEICHNIS 1 ABSTRACT Inhaltsverzeichnis
Formel X Leistungskurs Physik 2001/2002
 Versuchsaufbau: Messkolben Schlauch PI Barometer TI 1 U-Rohr-Manometer Wasser 500 ml Luft Pyknometer 2 Bild 1: Versuchsaufbau Wasserbad mit Thermostat Gegeben: - Länge der Schläuche insgesamt: 61,5 cm
Versuchsaufbau: Messkolben Schlauch PI Barometer TI 1 U-Rohr-Manometer Wasser 500 ml Luft Pyknometer 2 Bild 1: Versuchsaufbau Wasserbad mit Thermostat Gegeben: - Länge der Schläuche insgesamt: 61,5 cm
Technische Thermodynamik
 Gernot Wilhelms Übungsaufgaben Technische Thermodynamik 6., überarbeitete und erweiterte Auflage 1.3 Thermische Zustandsgrößen 13 1 1.3.2 Druck Beispiel 1.2 In einer Druckkammer unter Wasser herrscht ein
Gernot Wilhelms Übungsaufgaben Technische Thermodynamik 6., überarbeitete und erweiterte Auflage 1.3 Thermische Zustandsgrößen 13 1 1.3.2 Druck Beispiel 1.2 In einer Druckkammer unter Wasser herrscht ein
Umgang mit Formeln Was kann ich?
 Umgang mit ormeln Was kann ich? ufgabe 1 (Quelle: DV Ph 010 5) In der Grafik werden einige Messpunkte der I-U- Kennlinie einer elektrischen Energiequelle dargestellt. a) Bei welchem der Messpunkte, B,
Umgang mit ormeln Was kann ich? ufgabe 1 (Quelle: DV Ph 010 5) In der Grafik werden einige Messpunkte der I-U- Kennlinie einer elektrischen Energiequelle dargestellt. a) Bei welchem der Messpunkte, B,
Thermodynamik (Wärmelehre) III kinetische Gastheorie
 Physik A VL6 (07.1.01) Thermodynamik (Wärmelehre) III kinetische Gastheorie Thermische Bewegung Die kinetische Gastheorie Mikroskopische Betrachtung des Druckes Mawell sche Geschwindigkeitserteilung gdes
Physik A VL6 (07.1.01) Thermodynamik (Wärmelehre) III kinetische Gastheorie Thermische Bewegung Die kinetische Gastheorie Mikroskopische Betrachtung des Druckes Mawell sche Geschwindigkeitserteilung gdes
Laborübung der Mess- und Automatisierungstechnik Druckmessung
 Laborübung der Mess- und Automatisierungstechnik Druckmessung Versuch III: Druckmessung in einer Rohrströmung Bearbeiter: Betreuer: Dr. Schmidt Übungsgruppe: / C Versuchsdatum: 21. November 2003 Laborübung
Laborübung der Mess- und Automatisierungstechnik Druckmessung Versuch III: Druckmessung in einer Rohrströmung Bearbeiter: Betreuer: Dr. Schmidt Übungsgruppe: / C Versuchsdatum: 21. November 2003 Laborübung
Grundlagen der Gasabrechnung
 Grundlagen der Gasabrechnung Version 2.0 Stand: 01. November 2016 Netze-Gesellschaft Südwest mbh Ein Unternehmen der Erdgas Südwest Inhaltsverzeichnis... I 1 Grundlagen der Abrechnung Gas... 1 2 Netznutzungsabrechnung
Grundlagen der Gasabrechnung Version 2.0 Stand: 01. November 2016 Netze-Gesellschaft Südwest mbh Ein Unternehmen der Erdgas Südwest Inhaltsverzeichnis... I 1 Grundlagen der Abrechnung Gas... 1 2 Netznutzungsabrechnung
Merkblatt Nr. 4.3/10 Stand:
 Bayerisches Landesamt für Umwelt Merkblatt Nr. 4.3/10 Stand: 30.03.2011 Ansprechpartner: Referat 66 Hinweise zur Anwendung des Arbeitsblattes DWA-A 139 Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen
Bayerisches Landesamt für Umwelt Merkblatt Nr. 4.3/10 Stand: 30.03.2011 Ansprechpartner: Referat 66 Hinweise zur Anwendung des Arbeitsblattes DWA-A 139 Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen
Versuch Nr. 1. Durchschlagfestigkeit in Gasen (Luft) bei Wechselspannungsbeanspruchungen
 1 Aufgabenstellung: Versuch Nr. 1 Durchschlagfestigkeit in Gasen (Luft) bei Wechselspannungsbeanspruchungen 1.1 Kalibrierung einer Kugelfunkenstrecke durch Messung der Durchschlagspannung U d als Funktion
1 Aufgabenstellung: Versuch Nr. 1 Durchschlagfestigkeit in Gasen (Luft) bei Wechselspannungsbeanspruchungen 1.1 Kalibrierung einer Kugelfunkenstrecke durch Messung der Durchschlagspannung U d als Funktion
(VIII) Wärmlehre. Wärmelehre Karim Kouz WS 2014/ Semester Biophysik
 Quelle: http://www.pro-physik.de/details/news/1666619/neues_bauprinzip_fuer_ultrapraezise_nuklearuhr.html (VIII) Wärmlehre Karim Kouz WS 2014/2015 1. Semester Biophysik Wärmelehre Ein zentraler Begriff
Quelle: http://www.pro-physik.de/details/news/1666619/neues_bauprinzip_fuer_ultrapraezise_nuklearuhr.html (VIII) Wärmlehre Karim Kouz WS 2014/2015 1. Semester Biophysik Wärmelehre Ein zentraler Begriff
Physik 4 Praktikum Auswertung Zustandsdiagramm Ethan
 Physik 4 Praktikum Auswertung Zustandsdiagramm Ethan Von J.W., I.G. 2014 Seite 1. Kurzfassung......... 2 2. Theorie.......... 2 2.1. Zustandsgleichung....... 2 2.2. Koexistenzgebiet........ 3 2.3. Kritischer
Physik 4 Praktikum Auswertung Zustandsdiagramm Ethan Von J.W., I.G. 2014 Seite 1. Kurzfassung......... 2 2. Theorie.......... 2 2.1. Zustandsgleichung....... 2 2.2. Koexistenzgebiet........ 3 2.3. Kritischer
Berechnen Sie die Körpergröße eines Mannes, dessen Oberschenkelknochen eine Länge von 50 cm aufweist!
 Aufgabe 1 Archäologie In der Archäologie gibt es eine empirische Formel, um von der Länge eines entdeckten Oberschenkelknochens auf die Körpergröße der zugehörigen Person schließen zu können. Für Männer
Aufgabe 1 Archäologie In der Archäologie gibt es eine empirische Formel, um von der Länge eines entdeckten Oberschenkelknochens auf die Körpergröße der zugehörigen Person schließen zu können. Für Männer
WS 17/18 1. Sem. B.Sc. Catering und Hospitality Services
 2 Physik 1. Fluide. WS 17/18 1. Sem. B.Sc. Catering und Hospitality Services Diese Präsentation ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung Nicht-kommerziell Weitergabe unter gleichen Bedingungen
2 Physik 1. Fluide. WS 17/18 1. Sem. B.Sc. Catering und Hospitality Services Diese Präsentation ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung Nicht-kommerziell Weitergabe unter gleichen Bedingungen
Methoden der Werkstoffprüfung Kapitel II Statistische Verfahren I. WS 2009/2010 Kapitel 2.0
 Methoden der Werkstoffprüfung Kapitel II Statistische Verfahren I WS 009/010 Kapitel.0 Schritt 1: Bestimmen der relevanten Kenngrößen Kennwerte Einflussgrößen Typ A/Typ B einzeln im ersten Schritt werden
Methoden der Werkstoffprüfung Kapitel II Statistische Verfahren I WS 009/010 Kapitel.0 Schritt 1: Bestimmen der relevanten Kenngrößen Kennwerte Einflussgrößen Typ A/Typ B einzeln im ersten Schritt werden
Physik-Vorlesung SS Fluide.
 Physik Fluide 3 Physik-Vorlesung SS 2016. Fluide. SS 16 2. Sem. B.Sc. Oec. und B.Sc. CH Diese Präsentation ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung Nichtkommerziell Weitergabe unter gleichen
Physik Fluide 3 Physik-Vorlesung SS 2016. Fluide. SS 16 2. Sem. B.Sc. Oec. und B.Sc. CH Diese Präsentation ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung Nichtkommerziell Weitergabe unter gleichen
Über den Gas-Fluss durch Leckkanäle Eine Einführung in die quantitative Lecksuche
 Über den Gas-Fluss durch Leckkanäle Eine Einführung in die quantitative Lecksuche On the Gas Flow through Leak Channels An Introduction into quantitative Leak Detection Gerhard Voss Zusammenfassung In
Über den Gas-Fluss durch Leckkanäle Eine Einführung in die quantitative Lecksuche On the Gas Flow through Leak Channels An Introduction into quantitative Leak Detection Gerhard Voss Zusammenfassung In
Dampfdruck von Flüssigkeiten (Clausius-Clapeyron' sche Gleichung)
 Versuch Nr. 57 Dampfdruck von Flüssigkeiten (Clausius-Clapeyron' sche Gleichung) Stichworte: Dampf, Dampfdruck von Flüssigkeiten, dynamisches Gleichgewicht, gesättigter Dampf, Verdampfungsenthalpie, Dampfdruckkurve,
Versuch Nr. 57 Dampfdruck von Flüssigkeiten (Clausius-Clapeyron' sche Gleichung) Stichworte: Dampf, Dampfdruck von Flüssigkeiten, dynamisches Gleichgewicht, gesättigter Dampf, Verdampfungsenthalpie, Dampfdruckkurve,
Vakuum und Gastheorie
 Vakuum und Gastheorie Jan Krieger 9. März 2005 1 INHALTSVERZEICHNIS 0.1 Formelsammlung.................................... 2 0.1.1 mittlere freie Weglänge in idealen Gasen................... 3 0.1.2 Strömungsleitwerte
Vakuum und Gastheorie Jan Krieger 9. März 2005 1 INHALTSVERZEICHNIS 0.1 Formelsammlung.................................... 2 0.1.1 mittlere freie Weglänge in idealen Gasen................... 3 0.1.2 Strömungsleitwerte
Allgemeines Gasgesetz. PV = K o T
 Allgemeines Gasgesetz Die Kombination der beiden Gesetze von Gay-Lussac mit dem Gesetz von Boyle-Mariotte gibt den Zusammenhang der drei Zustandsgrößen Druck, Volumen, und Temperatur eines idealen Gases,
Allgemeines Gasgesetz Die Kombination der beiden Gesetze von Gay-Lussac mit dem Gesetz von Boyle-Mariotte gibt den Zusammenhang der drei Zustandsgrößen Druck, Volumen, und Temperatur eines idealen Gases,
Flüssigkeitsthermometer Bimetallthermometer Gasthermometer Celsius Fahrenheit
 Wärme Ob etwas warm oder kalt ist können wir fühlen. Wenn etwas wärmer ist, so hat es eine höhere Temperatur. Temperaturen können wir im Bereich von etwa 15 Grad Celsius bis etwa 45 Grad Celsius recht
Wärme Ob etwas warm oder kalt ist können wir fühlen. Wenn etwas wärmer ist, so hat es eine höhere Temperatur. Temperaturen können wir im Bereich von etwa 15 Grad Celsius bis etwa 45 Grad Celsius recht
b ) den mittleren isobaren thermischen Volumenausdehnungskoeffizienten von Ethanol. Hinweis: Zustand 2 t 2 = 80 C = 23, kg m 3
 Aufgabe 26 Ein Pyknometer ist ein Behälter aus Glas mit eingeschliffenem Stopfen, durch den eine kapillarförmige Öffnung führt. Es hat ein sehr genau bestimmtes Volumen und wird zur Dichtebestimmung von
Aufgabe 26 Ein Pyknometer ist ein Behälter aus Glas mit eingeschliffenem Stopfen, durch den eine kapillarförmige Öffnung führt. Es hat ein sehr genau bestimmtes Volumen und wird zur Dichtebestimmung von
Wechselwirkung Umwelt, Packmittel und Füllgut: Stofftransporte
 Wechselwirkung Umwelt, Packmittel und Füllgut: Stofftransporte Diffusion, Strömung (Strahlung) Desorption Permeation: Adsorption, Lösung Diffusion Füllgut Migration Packstoff, Packmittel Stofftransport
Wechselwirkung Umwelt, Packmittel und Füllgut: Stofftransporte Diffusion, Strömung (Strahlung) Desorption Permeation: Adsorption, Lösung Diffusion Füllgut Migration Packstoff, Packmittel Stofftransport
Wie kommt das rohe Ei in die Flasche?
 Wie kommt das rohe Ei in die Flasche? Themenbereich: Wärme/ Kälte Überdruck, Kalk wird aufgelöst Alter der Kinder: Dieses Experiment eignet sich für Kinder ab ca. 5 Jahren. Dabei ist zu beachten, dass
Wie kommt das rohe Ei in die Flasche? Themenbereich: Wärme/ Kälte Überdruck, Kalk wird aufgelöst Alter der Kinder: Dieses Experiment eignet sich für Kinder ab ca. 5 Jahren. Dabei ist zu beachten, dass
Praktikum I PE Peltier-Effekt
 Praktikum I PE Peltier-Effekt Florian Jessen, Hanno Rein, Benjamin Mück Betreuerin: Federica Moschini 27. November 2003 1 Ziel der Versuchsreihe Der Peltier Effekt und seine Umkehrung (Seebeck Effekt)
Praktikum I PE Peltier-Effekt Florian Jessen, Hanno Rein, Benjamin Mück Betreuerin: Federica Moschini 27. November 2003 1 Ziel der Versuchsreihe Der Peltier Effekt und seine Umkehrung (Seebeck Effekt)
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg
 TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg GRUNDLAGEN Modul: Versuch: Gießen von Metallen (Änderung von Volumen und
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg GRUNDLAGEN Modul: Versuch: Gießen von Metallen (Änderung von Volumen und
Praktikum Physik. Protokoll zum Versuch 4: Schallwellen. Durchgeführt am Gruppe X
 Praktikum Physik Protokoll zum Versuch 4: Schallwellen Durchgeführt am 03.11.2011 Gruppe X Name 1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuer: Wir bestätigen hiermit, dass wir das Protokoll
Praktikum Physik Protokoll zum Versuch 4: Schallwellen Durchgeführt am 03.11.2011 Gruppe X Name 1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuer: Wir bestätigen hiermit, dass wir das Protokoll
Protokoll Grundpraktikum: F5 Dichte fester Körper
 Protokoll Grundpraktikum: F5 Dichte fester Körper Sebastian Pfitzner 6. Februar 013 Durchführung: Sebastian Pfitzner (553983), Jannis Schürmer (5589) Arbeitsplatz: 4 Betreuer: Anicó Kulow Versuchsdatum:
Protokoll Grundpraktikum: F5 Dichte fester Körper Sebastian Pfitzner 6. Februar 013 Durchführung: Sebastian Pfitzner (553983), Jannis Schürmer (5589) Arbeitsplatz: 4 Betreuer: Anicó Kulow Versuchsdatum:
1. Klausur ist am 5.12.! (für Vets sowie Bonuspunkte für Zahni-Praktikum) Jetzt lernen!
 1. Klausur ist am 5.12.! (für Vets sowie Bonuspunkte für Zahni-Praktikum) Jetzt lernen! http://www.physik.uni-giessen.de/dueren/ User: duerenvorlesung Password: ****** Druck und Volumen Gesetz von Boyle-Mariotte:
1. Klausur ist am 5.12.! (für Vets sowie Bonuspunkte für Zahni-Praktikum) Jetzt lernen! http://www.physik.uni-giessen.de/dueren/ User: duerenvorlesung Password: ****** Druck und Volumen Gesetz von Boyle-Mariotte:
KGS-Stoffverteilungsplan RS-Zweig Mathematik 7 (Grundlage Kerncurricula) Lehrbuch: Schnittpunkt 7, Klett
 erläutern die Notwendigkeit der Zahlbereichserweiterung auf die rationalen Zahlen anhand von Beispielen besitzen Vorstellungen negativer Zahlen als Abstraktion verschiedener Sachverhalte des täglichen
erläutern die Notwendigkeit der Zahlbereichserweiterung auf die rationalen Zahlen anhand von Beispielen besitzen Vorstellungen negativer Zahlen als Abstraktion verschiedener Sachverhalte des täglichen
Bewertung direkt anzeigender Messgeräte Anforderungen, Möglichkeiten und Grenzen
 Bewertung direkt anzeigender Messgeräte Anforderungen, Möglichkeiten und Grenzen A.Gluschko 21.September 2015 Inhalt Anforderungen der DIN EN 45544 Vorgehensweise im IFA Beispiel: Messen von Kohlenstoffmonoxid
Bewertung direkt anzeigender Messgeräte Anforderungen, Möglichkeiten und Grenzen A.Gluschko 21.September 2015 Inhalt Anforderungen der DIN EN 45544 Vorgehensweise im IFA Beispiel: Messen von Kohlenstoffmonoxid
Versuchsprotokoll: Chromatographie. Gelchromatographische Trennung eines Proteingemischs
 Versuchsprotokoll: Chromatographie Gelchromatographische Trennung eines Proteingemischs 1.1. Einleitung Das Ziel der Gelchromatographie ist es ein vorhandenes Proteingemisch in die einzelnen Proteine zu
Versuchsprotokoll: Chromatographie Gelchromatographische Trennung eines Proteingemischs 1.1. Einleitung Das Ziel der Gelchromatographie ist es ein vorhandenes Proteingemisch in die einzelnen Proteine zu
Exemplar für Prüfer/innen
 Exemplar für Prüfer/innen Kompensationsprüfung zur standardisierten kompetenzorientierten schriftlichen Reifeprüfung AHS Mai 2017 Mathematik Kompensationsprüfung 1 Angabe für Prüfer/innen Hinweise zur
Exemplar für Prüfer/innen Kompensationsprüfung zur standardisierten kompetenzorientierten schriftlichen Reifeprüfung AHS Mai 2017 Mathematik Kompensationsprüfung 1 Angabe für Prüfer/innen Hinweise zur
WIEDERKEHRENDE PRÜFUNGEN INSPEKTIONS- UND WARTUNGSVERTRAG
 WIEDERKEHRENDE PRÜFUNGEN INSPEKTIONS- UND WARTUNGSVERTRAG Kläranlage «SuchbegriffL» «Titel» - Werk-Nr. «Auftragsnummer» Zwischen «Bez1» «Bez2» «Bez3» «Straße» «PLZ» «Ort» Telefon/Fax:* Email:*... vertreten
WIEDERKEHRENDE PRÜFUNGEN INSPEKTIONS- UND WARTUNGSVERTRAG Kläranlage «SuchbegriffL» «Titel» - Werk-Nr. «Auftragsnummer» Zwischen «Bez1» «Bez2» «Bez3» «Straße» «PLZ» «Ort» Telefon/Fax:* Email:*... vertreten
Versuch Nr.53. Messung kalorischer Größen (Spezifische Wärmen)
 Versuch Nr.53 Messung kalorischer Größen (Spezifische Wärmen) Stichworte: Wärme, innere Energie und Enthalpie als Zustandsfunktion, Wärmekapazität, spezifische Wärme, Molwärme, Regel von Dulong-Petit,
Versuch Nr.53 Messung kalorischer Größen (Spezifische Wärmen) Stichworte: Wärme, innere Energie und Enthalpie als Zustandsfunktion, Wärmekapazität, spezifische Wärme, Molwärme, Regel von Dulong-Petit,
Dichtheitsprüfung von Abwasseranlagen
 Kanton Zürich Baudirektion AWEL Gewässerschutz Siedlungsentwässerung Dichtheitsprüfung von Abwasseranlagen Anstehende Änderungen von Normen und Richtlinien Thoralf Thees, Gewässerschutzinspektor 1 Inhalt
Kanton Zürich Baudirektion AWEL Gewässerschutz Siedlungsentwässerung Dichtheitsprüfung von Abwasseranlagen Anstehende Änderungen von Normen und Richtlinien Thoralf Thees, Gewässerschutzinspektor 1 Inhalt
Modelle zur Beschreibung von Gasen und deren Eigenschaften
 Prof. Dr. Norbert Hampp 1/7 1. Das Ideale Gas Modelle zur Beschreibung von Gasen und deren Eigenschaften Modelle = vereinfachende mathematische Darstellungen der Realität Für Gase wollen wir drei Modelle
Prof. Dr. Norbert Hampp 1/7 1. Das Ideale Gas Modelle zur Beschreibung von Gasen und deren Eigenschaften Modelle = vereinfachende mathematische Darstellungen der Realität Für Gase wollen wir drei Modelle
Club Apollo Wettbewerb Musterlösung zu Aufgabe 3. Diese Musterlösung beinhaltet Schülerlösungen aus dem 11. Wettbewerb (2011/2012).
 Club Apollo 13-14. Wettbewerb Musterlösung zu Aufgabe 3 Diese Musterlösung beinhaltet Schülerlösungen aus dem 11. Wettbewerb (2011/2012). Aufgabe a) 1) 70000,0000 Temperatur 60000,0000 50000,0000 40000,0000
Club Apollo 13-14. Wettbewerb Musterlösung zu Aufgabe 3 Diese Musterlösung beinhaltet Schülerlösungen aus dem 11. Wettbewerb (2011/2012). Aufgabe a) 1) 70000,0000 Temperatur 60000,0000 50000,0000 40000,0000
