Sprachkultur und Identität
|
|
|
- Sigrid Kerner
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Timm Albers Sprachkultur und Identität Beziehungsfähigkeit und Persönlichkeit entwickeln Wo und von wem wir geboren werden, lässt sich zumindest aus Kindersicht nicht auswählen. Jedes Kind sozialisiert sich in die ihn unmittelbar umgebende Welt, ob afrikanisch, europäisch oder asiatisch usw. Welche Bedeutung hierbei die jeweilige Sprachkultur auf die eigene Identität haben kann, zeigt sich in aller Vielfalt, im Kontext der frühpädagogische Arbeit in den Kindertageseinrichtungen. Sprache wird oft einseitig hinsichtlich ihrer Bedeutung als Schlüsselqualifikation für Bildungsprozesse diskutiert. Dieser Argumentationslinie folgen Forderungen nach einer möglichst frühzeitigen Diagnostik und Förderung von Teilkompetenzen, beispielsweise der phonologischen Bewusstheit. Im vorliegenden Beitrag wird Sprache einerseits im Stellenwert für das einzelne Kind und seine Identitätsentwicklung betrachtet, andererseits aber auch als Ausdruck einer Sprachkultur in der Gemeinschaft der Kindertageseinrichtung analysiert. Im Vordergrund stehen dabei nicht die formalen Elemente von Sprache (Grammatik, Wortschatz, Aussprache), sondern die kommunikativen Aspekte in den Gesprächen zwischen Kindern mit Gleichaltrigen und Erwachsenen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Identitätsentwicklung einnehmen. Sprachbildung im Kindergarten ist somit eingebunden in ein Bedingungsgefüge sozialer, emotionaler und kognitiver Entwicklung. Hintergrund Die Kenntnisse der deutschen Sprache werden in der aktuellen Diskussion um Benachteiligungen im Bildungssystem als die entscheidende Schlüsselqualifikation beschrieben, dem Unterricht folgen zu können und ein Kompetenzniveau zu erreichen, welches einen erfolgreichen Schulbesuch und in der Folge die Teilhabe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben im Erwachsenenalter ermöglicht: Das zentrale Medium schulischen Lernens ist die Sprache; wenn also sprachliche Probleme bzw. Sprachentwicklungsauffälligkeiten vorliegen, lässt sich daraus beinahe zwingend die Entstehung allgemeiner schulischer Probleme ableiten (Holler 2005, 25). Als bildungspolitische Folge sollen möglichst frühzeitig Maßnahmen der Sprachbildung (die Bereitstellung einer anregungsreichen sprachlichen Umwelt für alle Kinder) und Sprachförderung (die fokussierte Förderung einzelner Kinder mit einem Förderbedarf) in Kindertageseinrichtungen umgesetzt werden (vgl. Jungmann/Albers 2013). Die Dialoge zwischen Erwachsenen und Kindern und Gespräche in der Gruppe der Gleichaltrigen nehmen nicht nur eine große Bedeutung für die Sprachkompetenz ein, sondern stellen auch eine zentrale Grundlage für die Identitätsentwicklung dar. Im Folgenden soll auf der Basis der Erkenntnisse zur frühen Eltern-Kind- Interaktion zunächst der Zusammenhang zwischen 16 TPS
2 Sprachkultur KONTEXT Die Erzieherin ist Dialog-Partnerin Foto: Barbara Fahle Dialogen und der Identitätsentwicklung herausgearbeitet werden. Auf dieser Grundlage werden dann Konsequenzen für eine Sprachkultur in Kindertageseinrichtungen abgeleitet, die die Sprachentwicklung von Kindern in Zusammenhang mit ihrer Identitätsentwicklung stellt. Die ersten Dialoge Im Dialog mit ihren Säuglingen folgen Eltern intuitiv Kommunikationsregeln, die komplementär zu den sich entwickelnden kommunikativen Kompetenzen der Kinder angelegt sind. In wiederholten, von wechselseitiger Responsivität gekennzeichneten Kontexten erkennt der Säugling den Zusammenhang zwischen seinem Verhalten und der Reaktion der Bezugsperson. Diese zur Routine gewordenen Situationen werden von Bruner (2008) als Formate bezeichnet, die es dem Erwachsenen ermöglichen, die Elemente der Sprache in Abstimmung auf das kindliche Sprachsystem zu akzentuieren. Umgekehrt gelingt es dem Kind in diesen Situationen schon sehr früh, das Verhalten des Erwachsenen zu beeinflussen, da die intuitive elterliche Didaktik offenbar eine verstärkte Aufmerksamkeit für die Interessen, Bedürfnisse und Emotionen des Säuglings bereithält (vgl. Papoušek 2006). Diese frühen Eltern-Kind- Interaktionen haben, neben der Bedeutung für den Sprach erwerb, auch eine wichtige beziehungsstiftende und persönlichkeitsbildende Funktion. Bruner (2008) stellt einen Zusammenhang zwischen den Mutter-Kind-Dialogen und der sprachlichen Kommunikation dar, indem er die Parallelen zwischen dem Aktivitätswechsel im vorsprachlichen Spiel und dem Sprecherwechsel in sprachlicher Kommunikation betont. In diesen wiederkehrenden Situationen entwickelt sich ein stabiler Rahmen, innerhalb dessen das Kind lernt, kommunikative Absichten deutlich zu machen. Der Zugang zur Sprache als Kommunikationssystem erschließt sich somit über sozialkognitive Fähigkeiten, mit denen der Säugling von Geburt an ausgestattet ist: Die ersten affektiven Erwachsenen-Kind-Interaktionen spiegeln sich in der Aufmerksamkeitsausrichtung des Neugeborenen beispielsweise auf die Mutter wider, die den Säugling anlächelt und ihre Stimme prosodisch stark moduliert. Im Alter von neun bis zwölf Monaten erwirbt das Kind dann die Fähigkeit, die zuvor nichtintentionalen Signale bewusst einzusetzen, um ein TPS
3 Foto: Doris Leuschner Gespräche unter Kindern bilden einen Zugang in die Sprachkultur bestimmtes Verhalten zu erreichen (vgl. Tomasello 2005). Dabei stellen die primären Bezugspersonen die wichtigste Sozialisationsinstanz für das Kind dar: Damit das eigene Verhalten und die Versuche, in einen Dialog einzutreten, als bedeutsam erlebt werden, ist das Kind auf Erwachsene angewiesen, die feinfühlig auf dessen Signale reagieren und einen für das Kind verlässlichen Rahmen schaffen, in dem Kinder ihre Identität bilden können. Identitätsbildung Erikson (1973) bezeichnet Identität als Maß der Persönlichkeitsentwicklung, die ein Individuum im Verlauf seiner Sozialisation erfährt. Die Identitätsbildung beginnt wie dargestellt in der Auseinandersetzung des Säuglings mit seiner Umwelt und den Erfahrungen mit seinen primären Bezugspersonen (primäre Sozialisation). Mit dem Übergang in eine Kindertageseinrichtung (sekundäre Sozialisation) erweitert sich der Rahmen, in dem diese Erfahrungen gesammelt werden, durch pädagogische Bezugspersonen und Gleichaltrige in der Spielgruppe (tertiäre Sozialisation). Auf der Grundlage seiner Erfahrungen, die das Kind mit seinen Eltern gesammelt hat, bildet es internale Arbeitsmodelle heraus, die im Sinne einer Erwartungshaltung auf Beziehungen zu anderen Erwachsenen und gleichaltrigen Spielpartnern herangezogen werden. Hat das Kind Selbstwirksamkeit und Wertschätzung im Umgang mit seinen Eltern erlebt, tritt es mit positiven Erwartungen auch in die Interaktion mit den pädagogischen Fachkräften ein. Sind Erfahrungen mit Bezugspersonen von Abweisung geprägt, bildet sich ein negatives Selbstbild heraus. Die Hypothesen des Kindes sind jedoch veränderbar: So können frühpädagogische Fachkräfte zu einem wertvollen Schutzfaktor für Kinder werden, wenn sie mit ihrem responsiven und kontingenten Verhalten negative Erwartungsmuster der Kinder durchbrechen. Damit tragen sie dazu bei, dass sich das Kind Anforderungen mit einer Erwartung stellt, diese auch bewältigen zu können. Frühpädagogische 18 TPS
4 Sprachkultur KONTEXT Fachkräfte haben es in diesem Zusammenhang mit Kindern zu tun, die mit völlig unterschiedlichen Vorerfahrungen, sozialen und kommunikativen Kompetenzen, aber auch mit unterschiedlichen Sprachen in eine Kindertageseinrichtung eintreten. Sie stehen damit in der Verantwortung, sensibel für die individuellen Unterschiede der Kinder zu sein, den unterschiedlichen Sprachen Wertschätzung entgegenzubringen und einen Rahmen bereitzustellen, den die Kinder zur Erweiterung ihrer Fähigkeiten nutzen können. Die Kontinuität in der Interaktion zu Erwachsenen stellt dabei eine wesentliche Grundlage für die Identitätsbildung und für die Entwicklung kommunikativer Kompetenzen, wie der Dialog- und Erzählfähigkeit, dar. Dies soll im Folgenden spezifiziert werden. Sprachgebrauch und Sprachkultur Mit der Dialog- und der Erzählfähigkeit sind eine Vielzahl an Regeln und Konventionen verbunden, die das Kind im Verlauf der Sprachentwicklung lernen muss (vgl. Karmiloff & Karmiloff-Smith 2001). Der Erwerb dieser Kompetenzen kennzeichnet sich somit durch den zunehmend situations- und kontextadäquaten Gebrauch von Sprache und umfasst ebenso den Aufbau soziokultureller Kenntnisse und das Wissen um die Gefühle und Bedürfnisse anderer, wie die kommunikativen Regeln, die eine sprachliche Interaktion gelingen lassen. Die Hauptaufgabe des Kindes besteht aus dieser Perspektive in der Anpassung von Formen und Funktionen, indem sprachliche Ausdrücke der Muttersprache in Bezug zu deren Verwendung für kommunikative Absichten gesetzt werden. Dies bezieht auch die Fähigkeit zur Strukturierung von Diskursen ein, welche sich durch ein In-Beziehung-Setzen sprachlicher Äußerungen mit dem jeweiligen Kontext kennzeichnet. Somit ist der Dialog und die damit verbundene Frage, wie das Kind Formen und Regeln des Dialogs lernt und wie es im und über den Dialog Sprache erwirbt (vgl. Zollinger 2004) als zentral für die Betrachtung von Sprache in Kindertageseinrichtungen anzusehen. Sprache begegnet dem Kind also nicht allein als Symbol für die Dingwelt, sondern als Medium sozialen Handelns, in dem sich eine Sprachkultur widerspiegelt. Dabei wird das sprachliche Lernen initiiert durch einen für das Kind sinnvollen, handlungsbezogenen und dialoggerichteten Sprachgebrauch der sozialen Umwelt in einem verlässlichen Rahmen. Der Rahmen, der Kindern in der Kindertageseinrichtung für Sprachhandlungen und Identitätsbildung zur Verfügung gestellt wird, kann im Zusammenspiel mit den unterschiedlichen Erwartungen, Kompetenzen und Vorerfahrungen von Kindern und Fachkräften als Sprachkultur bezeichnet werden. Sie organisiert die dynamische Interaktion der Sprachhandelnden, die sich aus den jeweils unterschiedlichen Erwartungen an kommunikative Situationen ergeben und stellt Kontinuität im Sinne fester Erwartbarkeiten sicher. Dialoggerichtete Sprachkultur Grundlage der Interaktion zwischen Kind und pädagogischer Fachkraft ist eine stabile Beziehung, die durch Akzeptanz, Offenheit und aufrichtiges Interesse am Kind bestimmt ist, da Kinder nicht von Personen lernen, die sie ablehnen oder nicht verstehen. Als wirksame Strategie zur Förderung der sprachlichen und kommunikativen Entwicklung der Kinder erweist sich dabei das lang andauernde gemeinsame Denken in der verbalen Interaktion zwischen Fachkraft und Kind oder in der dyadischen Peer-Interaktion (vgl. Siraj-Blatchford & Sylva 2004). Derartige Interaktionsprozesse setzen ein Mindestmaß an gemeinsamer Sprache voraus, die auf gleicher Wertigkeit der Äußerungen beruht und durch wechselseitigen Bezug gekennzeichnet ist. Sie finden sich insbesondere beim Versuch, ein Problem gemeinsam zu lösen, in Rollenspielen und bei der Klärung und Absprache gemeinsamer Aktivitäten wieder. Den Erwachsenen kommt dabei die Aufgabe zu, den Kontext so zu planen und zu gestalten, dass Situationen des gemeinsamen Denkens ermöglicht werden und ein Gleichgewicht zwischen kindinitiierter und erwachseneninitiierter Interaktion hergestellt wird. Die dialogische Bilderbuchbetrachtung kann vor diesem Hintergrund als eine exemplarische Situation dialoggerichteter Sprachkultur gesehen werden. Bilderbücher haben den Vorteil, dass sie in kindgerechter Form eine Atmosphäre herstellen, in dem die Sprache in den Mittelpunkt der Interaktion zwischen Erwachsenem und Kind gerückt wird. Die Sprache in den Büchern unterscheidet sich in ihrer Komplexität von der Alltagssprache. Die Kinder erweitern in der Auseinandersetzung mit dekontextualisierten Inhalten darüber hinaus ihren Wortschatz und kommen mit der typischen Erzählstruktur in Berührung. Während das klassische Vorlesen dadurch gekennzeichnet ist, dass die Kinder in einer passiv-rezipierenden Rolle die Geschichte hören und dabei die Bilder betrachten, stellt das dialogische Lesen die Beteiligung der Kinder bei der gemeinsamen Bilderbuchbetrachtung in den Vordergrund. Der Vorteil dieser dialogisch ausgerichteten Interaktionsform gegenüber dem Vorlesen besteht darin, dass individuell und flexibel auf die Fragen und Interessen der Kinder eingegangen werden kann und die Eigenbeteiligung des Kindes im Vordergrund steht. Die Erfahrungen, die Kinder beim dialogischen Lesen sammeln, stellen eine wichtige Grundlage für die Erweiterung ihrer Erzählkompetenz dar. Die Erwachsenen fordern durch den Einsatz spezifischer Sprachlehrstrategien die kindlichen Äußerungen zu einer Geschichte heraus. TPS
5 AUF einen Blick Sprache ist einerseits für das einzelne Kind und seine Identitätsentwicklung bedeutsam, andererseits aber auch als Ausdruck einer Sprachkultur in der Gemeinschaft der Kindertageseinrichtung zu sehen. Im Vordergrund stehen nicht Grammatik, Wortschatz oder Aussprache, sondern die kommunikativen Aspekte in den Gesprächen zwischen Kindern, mit Gleichaltrigen und Erwachsenen. Zugleich bilden die Eltern-Kind-Interaktionen das Fundament an Kenntnissen eines Kindes über die Art und Weise des dialogischen Miteinanders. Die Sprachkultur in den Kindertageseinrichtungen sollte von wechselseitiger Responsivität und Kontingenz gekennzeichnet sein, unter Anerkennung dessen, was das Kind in der eigenen Familie erfahren hat. Für den Zugang zur Sprache als Kommunikationssystem sind frühpädagogische Fachkräfte wertvolle Dialog-Partner und bieten zugleich Schutz für Kinder, die bislang negative sprachliche Erwartungsmuster verinnerlicht haben. Sprache begegnet dem Kind nicht allein als Symbol für die Dingwelt, sondern als Medium sozialen Handelns, in dem sich eine Sprachkultur widerspiegelt. Fazit Um Brüche in der Identitätsbildung zu verhindern, erfordert der Umgang mit sprachlicher Vielfalt eine differenzierte Auseinandersetzung mit den Spracherwerbsbedingungen in der Einrichtung und der Familie des Kindes. Innerhalb der Orientierungspläne für Bildung und Erziehung im Elementarbereich kommt den frühpädagogischen Fachkräften der Auftrag zu, die sprachlichen Kompetenzen der Kinder entwicklungsadäquat zu begleiten und zu fördern. Die prozessbegleitende Unterstützung des Spracherwerbs erfordert jedoch das Wissen um spracherwerbstheoretische Grundlagen, Sprachkultur, sowie die Reflexion der Rolle der frühpädagogischen Fachkraft für die Identitätsbildung von Kindern. Dass ein bewusster Einsatz der Sprache von pädagogischen Fachkräften, sowie die Dialogbereitschaft und Aufmerksamkeit gegenüber kindlichen Interessen, positive Auswirkungen auf die Gestaltung von sprachlich-kommunikativen Situationen hat, lässt sich anhand von Beispielen gelingender Interaktionsprozesse im Kindergarten nachzeichnen, die auf die Bedeutung der Berücksichtigung kindlicher Interessen für die frühe sprachliche Bildung und Förderung verweisen (vgl. Albers 2009). Diese bisher weitgehend in der pädagogischen Praxis des Elementarbereichs vernachlässigte Erkenntnis erfordert eine Verknüpfung sprachlicher Kompetenzen mit dem Interesse der Kinder im Interaktionsprozess mit Erwachsenen und Gleichaltrigen. Auf der Basis vorhandener spracherwerbstheoretischer Erkenntnisse zur Mehrsprachigkeit lässt sich die zentrale Aussage ableiten, dass es nicht an der Mehrzahl der Sprachen als solcher liegt, sondern am Zusammentreffen ungünstiger Umstände, wenn sich statt der bereichernden Effekte in mehrsprachigen Biografien Schwierigkeiten auftun. (List 2005) Betrachtet man unter systematischen Gesichtspunkten die Vielzahl an Größen, die den Spracherwerb beeinflussen, kann man in diesem Zusammenhang folgende Faktoren gruppieren, die bei einer Analyse von Mehrsprachigkeit berücksichtigt werden müssen: Das Verhältnis der Kompetenz in der Familiensprache zu der Umgebungssprache, die Strukturen und Regeln der zu lernenden Sprache, die biologischen und psychologischen Mechanismen und Strategien im Erwerbs prozess, sowie das sprachliche Handeln der Lernenden in der Kommunikation mit Sprechern der Umgebungssprache. Literatur Albers, T. (2009): Sprache und Interaktion im Kindergarten. Eine quantitativ-qualitative Analyse der sprachlichen und kommunikativen Kompetenzen von drei- bis sechsjährigen Kindern. Bad Heilbrunn: Klinkhardt Forschung Bruner, J. (2008): Wie das Kind sprechen lernt. Bern: Verlag Hans Huber Erikson, E. H. (1973): Identität und Lebenszyklus. Frankfurt / Main: Suhrkamp Holler, D. (2005): Bedeutung sprachlicher Fähigkeiten für Bildungserfolge. In: Jampert, K., Best, P., Guadatiello, A., Holler, D. & Zehnbauer, A. (Hrsg.). Schlüsselkompetenz Sprache. Sprachliche Bildung und Förderung im Kindergarten. Berlin: Verlag Das Netz Jungmann, T. & Albers, T (2013): Frühe sprachliche Bildung und Förderung. München. Basel: Ernst Reinhardt Verlag Karmiloff-Smith, A. & Karmiloff, K. (2001): Pathways to Language. From Fetus to Adolescent. Harvard: Harvard University Press. List, G. (2005): Zur Anbahnung mehr- und quersprachiger Kompetenzen in vorschulischen Bildungseinrichtungen. In: Jampert, K., Best, P., Guadatiello, A., Holler, D. & Zehnbauer, A. (Hrsg.): Schlüsselkompetenz Sprache. Sprachliche Bildung und Förderung im Kindergarten. Berlin: Verlag Das Netz Papoušek, M. (2006): Adaptive Funktionen der vorsprachlichen Kommunikations- und Beziehungserfahrungen. In: Frühförderung interdisziplinär 1, Siraj-Blatchford, I. & Sylva, K. (2004): Researching Pedagogy in English Preschools. In: British Educational Research Journal, 30, 5, Tomasello, M. (2005): Constructing a Language: A Usage-Based Theory of Language Acquisition. Harvard University Press. Zollinger, B. (2004). Die Entdeckung der Sprache. Bern: Haupt 20 TPS
3. infans-steg- Kongress am 19. Mai 2017 in BAD KROZINGEN Beziehung gestalten Bildungsprozesse sichern
 3. infans-steg- Kongress am 19. Mai 2017 in BAD KROZINGEN Beziehung gestalten Bildungsprozesse sichern Workshop 5 infans- und Sprachförderprogramme? Alltagsintegrierte Sprachförderung durch Beziehungs-und
3. infans-steg- Kongress am 19. Mai 2017 in BAD KROZINGEN Beziehung gestalten Bildungsprozesse sichern Workshop 5 infans- und Sprachförderprogramme? Alltagsintegrierte Sprachförderung durch Beziehungs-und
SPRACHE und ihre Bedeutung für die Bildung. Ist eine institutionelle Förderung von Sprache zur Zeit notwendig, bzw. möglich?
 SPRACHE und ihre Bedeutung für die Bildung Ist eine institutionelle Förderung von Sprache zur Zeit notwendig, bzw. möglich? Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt! Wittgenstein sprachlos
SPRACHE und ihre Bedeutung für die Bildung Ist eine institutionelle Förderung von Sprache zur Zeit notwendig, bzw. möglich? Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt! Wittgenstein sprachlos
Unser Bild vom Menschen
 Das pädagogische Konzept t des ELKI Naturns: Unser Bild vom Menschen Wir sehen den Menschen als ein einzigartiges, freies und eigenständiges Wesen mit besonderen physischen, emotionalen, psychischen und
Das pädagogische Konzept t des ELKI Naturns: Unser Bild vom Menschen Wir sehen den Menschen als ein einzigartiges, freies und eigenständiges Wesen mit besonderen physischen, emotionalen, psychischen und
OHREN SPITZEN. in der Krippe. Judith Schönicke * Claudia Wirts * Elisabeth Utz
 OHREN SPITZEN in der Krippe Judith Schönicke * Claudia Wirts * Elisabeth Utz Inhalt Vorwort... 5 Einleitung... 6 Zuhören von Anfang an... 8 Zuhörtagebuch... 14 Umgang mit dem Material... 16 Die Hör- und
OHREN SPITZEN in der Krippe Judith Schönicke * Claudia Wirts * Elisabeth Utz Inhalt Vorwort... 5 Einleitung... 6 Zuhören von Anfang an... 8 Zuhörtagebuch... 14 Umgang mit dem Material... 16 Die Hör- und
Wie findet Sprachförderung in der Kindertageseinrichtung statt?
 Wie findet Sprachförderung in der Kindertageseinrichtung statt? Zitat: Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt Der Sprachbaum Sprachkompetenz ist eine Schlüsselkompetenz Kommunikation durchzieht
Wie findet Sprachförderung in der Kindertageseinrichtung statt? Zitat: Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt Der Sprachbaum Sprachkompetenz ist eine Schlüsselkompetenz Kommunikation durchzieht
EMOTIONALITAT, LERNEN UND VERHALTEN. Ein heilpadagogisches Lehrbuch
 EMOTIONALITAT, LERNEN UND VERHALTEN Ein heilpadagogisches Lehrbuch von Konrad Bundschuh 2003 VERLAG JULIUS KLINKHARDT BAD HEILBRUNN / OBB. Inhalt Vorwort 9 Einleitung 13 1. Die Bedeutung der Emotionalitat
EMOTIONALITAT, LERNEN UND VERHALTEN Ein heilpadagogisches Lehrbuch von Konrad Bundschuh 2003 VERLAG JULIUS KLINKHARDT BAD HEILBRUNN / OBB. Inhalt Vorwort 9 Einleitung 13 1. Die Bedeutung der Emotionalitat
Prestige der Sprachen
 Prestige der Sprachen geringe Prestige der Erstsprache ungünstige Auswirkungen auf Sprecher (Kreppel 2006) Akzeptanz der Erstsprache in sozialer Umgebung Psychologische Bedeutung der Erstsprache Erstsprache
Prestige der Sprachen geringe Prestige der Erstsprache ungünstige Auswirkungen auf Sprecher (Kreppel 2006) Akzeptanz der Erstsprache in sozialer Umgebung Psychologische Bedeutung der Erstsprache Erstsprache
Referentin: Paula Ott. Spracherwerb Gisela Klann-Delius
 Referentin: Paula Ott Spracherwerb Gisela Klann-Delius Gliederung: Grundzüge des Interaktionismus Kompetenzen des Säuglings Kompetenzen der Betreuungsperson Zusammenspiel im Eltern-Kind-Dialog Übergang
Referentin: Paula Ott Spracherwerb Gisela Klann-Delius Gliederung: Grundzüge des Interaktionismus Kompetenzen des Säuglings Kompetenzen der Betreuungsperson Zusammenspiel im Eltern-Kind-Dialog Übergang
Gelebte Mehrsprachigkeit im Ganztag
 DIE RAA IN IHRER REGION Gelebte Mehrsprachigkeit im Ganztag Workshop 07.06.2017 LISUM Lena Fleck, RAA Brandenburg Waltraud Eckert-König, RAA Brandenburg Was ist Mehrsprachigkeit? Laut sprachwissenschaftlicher
DIE RAA IN IHRER REGION Gelebte Mehrsprachigkeit im Ganztag Workshop 07.06.2017 LISUM Lena Fleck, RAA Brandenburg Waltraud Eckert-König, RAA Brandenburg Was ist Mehrsprachigkeit? Laut sprachwissenschaftlicher
Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Teamqualifizierungen
 Sprache ist der Schlüssel zur Welt Teamqualifizierungen Für Sie... Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, der Erwerb von Sprache ist einer der elementarsten kindlichen Entwicklungsprozesse, der jedoch sehr
Sprache ist der Schlüssel zur Welt Teamqualifizierungen Für Sie... Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, der Erwerb von Sprache ist einer der elementarsten kindlichen Entwicklungsprozesse, der jedoch sehr
Kindersprache stärken: Das Konzept der AlltagsIntegrierten Sprachlichen Bildung und die Verbindung zum Hessischen Bildungs- und ErziehungsPlan
 Kindersprache stärken: Das Konzept der AlltagsIntegrierten Sprachlichen Bildung und die Verbindung zum Hessischen Bildungs- und ErziehungsPlan 17.März 2015 Julia Held (IFP) & Michaela Hopf (DJI) 17. März
Kindersprache stärken: Das Konzept der AlltagsIntegrierten Sprachlichen Bildung und die Verbindung zum Hessischen Bildungs- und ErziehungsPlan 17.März 2015 Julia Held (IFP) & Michaela Hopf (DJI) 17. März
Inhaltsverzeichnis 1 Wie fing alles an? Von den Anfängen der Schriftsprache bis zu den ersten Ansätzen des formalen Lese- und Schreibunterrichts
 Inhaltsverzeichnis 1 Wie fing alles an? Von den Anfängen der Schriftsprache bis zu den ersten Ansätzen des formalen Lese- und Schreibunterrichts... 1 1.1 Wie entwickelte sich die Schriftsprache von der
Inhaltsverzeichnis 1 Wie fing alles an? Von den Anfängen der Schriftsprache bis zu den ersten Ansätzen des formalen Lese- und Schreibunterrichts... 1 1.1 Wie entwickelte sich die Schriftsprache von der
Sprachliche Voraussetzungen für einen guten Schulstart schaffen - Vorkurs Deutsch -
 Sprachliche Voraussetzungen für einen guten Schulstart schaffen - Vorkurs Deutsch - Workshop Oberbayerischer Schulentwicklungstag am 12.12.2015 Ilona Peters Ilona Peters Beraterin Migration LH München
Sprachliche Voraussetzungen für einen guten Schulstart schaffen - Vorkurs Deutsch - Workshop Oberbayerischer Schulentwicklungstag am 12.12.2015 Ilona Peters Ilona Peters Beraterin Migration LH München
Einstieg: Fallbeispiel. Einstieg: Fallbeispiel Sprache und Interaktion im pädagogischen Alltag. Verknüpfung von Bildungsbereichen
 Sprache und Interaktion im pädagogischen Alltag Ablauf Jun. Prof. Fallstudie Was wirkt in der Sprachförderung? Sprache und Interaktion im Alltag unterstützen Verknüpfung von Bildungsbereichen Stiftung
Sprache und Interaktion im pädagogischen Alltag Ablauf Jun. Prof. Fallstudie Was wirkt in der Sprachförderung? Sprache und Interaktion im Alltag unterstützen Verknüpfung von Bildungsbereichen Stiftung
Bildung ab Geburt?! Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung
 Bildung ab Geburt?! Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung 14. März 2013, Winterthur Dr. Heidi Simoni und Dipl.- Päd. Corina Wustmann Seiler Marie Meierhofer Institut für
Bildung ab Geburt?! Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung 14. März 2013, Winterthur Dr. Heidi Simoni und Dipl.- Päd. Corina Wustmann Seiler Marie Meierhofer Institut für
Sprachliche Bildung als Querschnittsaufgabe in elementaren Bildungseinrichtungen. Michaela Hajszan Graz, 26. Mai 2011
 Sprachliche Bildung als Querschnittsaufgabe in elementaren Bildungseinrichtungen Michaela Hajszan Graz, 26. Mai 2011 Sprachkompetenz als Schlüsselkompetenz durchzieht die gesamte Persönlichkeit jedes Menschen
Sprachliche Bildung als Querschnittsaufgabe in elementaren Bildungseinrichtungen Michaela Hajszan Graz, 26. Mai 2011 Sprachkompetenz als Schlüsselkompetenz durchzieht die gesamte Persönlichkeit jedes Menschen
Auf Buchstaben springen und Wörter erhopsen. Wortschätze mobil Bewegungsorientierte Sprachförderung vor Ort mit Spiel und Spaß
 Auf Buchstaben springen und Wörter erhopsen Wortschätze mobil Bewegungsorientierte Sprachförderung vor Ort mit Spiel und Spaß Pädagogische Verankerung Das Projekt Wortschätze mobil greift die Bedeutung
Auf Buchstaben springen und Wörter erhopsen Wortschätze mobil Bewegungsorientierte Sprachförderung vor Ort mit Spiel und Spaß Pädagogische Verankerung Das Projekt Wortschätze mobil greift die Bedeutung
Entdecker der Sprache. Begleitung von Kindern unter 3
 Entdecker der Sprache Vor- und frühsprachliche Begleitung von Kindern unter 3 Beziehung ist Grundlage menschlicher Entwicklung Über soziale Resonanzen entsteht Kommunikation und Sprache Spiegelneurone
Entdecker der Sprache Vor- und frühsprachliche Begleitung von Kindern unter 3 Beziehung ist Grundlage menschlicher Entwicklung Über soziale Resonanzen entsteht Kommunikation und Sprache Spiegelneurone
Timm Albers. Timm Albers. Das Bilderbuch- Buch. Sprache, Kreativität und Emotionen in der Kita fördern
 Timm Albers Das Bilderbuch- Buch Timm Albers Sprache, Kreativität und Emotionen in der Kita fördern verkehrt herum gehalten werden, wenn ein Kind so tut, als ob es den anderen Kindern etwas vorliest. Kinder
Timm Albers Das Bilderbuch- Buch Timm Albers Sprache, Kreativität und Emotionen in der Kita fördern verkehrt herum gehalten werden, wenn ein Kind so tut, als ob es den anderen Kindern etwas vorliest. Kinder
Von Hans Rudolf Leu und Anna von Behr 11
 Inhalt 1 Neuentdeckung der Krippe - Herausforderungen für Ausbildung, Praxis und Forschung Von Hans Rudolf Leu und Anna von Behr 11 1.1 Welche Rolle spielt die neuronale Ausstattung für frühkindliches
Inhalt 1 Neuentdeckung der Krippe - Herausforderungen für Ausbildung, Praxis und Forschung Von Hans Rudolf Leu und Anna von Behr 11 1.1 Welche Rolle spielt die neuronale Ausstattung für frühkindliches
Sprachförderung an der Evangelischen J.-H.-Wichern- Kindertagesstätte in Heppenheim
 Sprachförderung an der Evangelischen J.-H.-Wichern- Kindertagesstätte in Heppenheim 1. Allgemeine Grundlagen 1.1. Was bedeutet Sprache? Sprache ist die wichtigste Form des wechselseitigen Verständnisses
Sprachförderung an der Evangelischen J.-H.-Wichern- Kindertagesstätte in Heppenheim 1. Allgemeine Grundlagen 1.1. Was bedeutet Sprache? Sprache ist die wichtigste Form des wechselseitigen Verständnisses
Frühe Förderung - was ist das?
 Aufbau des Referats! Frühe Förderung: Ihre Grundlagen und ihre Ziele! Das Fundament der frühen Förderung! Begriffe der frühen Förderung! Leitprinzipien am Kindswohl ausgerichtetem Handeln! Umsetzungsbeispiele!
Aufbau des Referats! Frühe Förderung: Ihre Grundlagen und ihre Ziele! Das Fundament der frühen Förderung! Begriffe der frühen Förderung! Leitprinzipien am Kindswohl ausgerichtetem Handeln! Umsetzungsbeispiele!
Frühpädagogische Didaktik. Ein offener Erfahrungsraum für vielfältige Perspektiven, Medien und Möglichkeiten. Prof. Dr. Stefan Brée HAWK Hildesheim
 Frühpädagogische Didaktik Ein offener Erfahrungsraum für vielfältige Perspektiven, Medien und Möglichkeiten Prof. Dr. Stefan Brée HAWK Hildesheim Was kann man bei Kindern beobachten? Z.B. Engagiertheit,
Frühpädagogische Didaktik Ein offener Erfahrungsraum für vielfältige Perspektiven, Medien und Möglichkeiten Prof. Dr. Stefan Brée HAWK Hildesheim Was kann man bei Kindern beobachten? Z.B. Engagiertheit,
Sprachliche Bildung: So früh wie möglich, aber wie?
 Prof. Dr. Yvonne Anders Freie Universität Berlin Department of Education and Psychology Early Childhood Education Sprachliche Bildung: So früh wie möglich, aber wie? Yvonne Anders 05.10.2016 Bildungspolitisches
Prof. Dr. Yvonne Anders Freie Universität Berlin Department of Education and Psychology Early Childhood Education Sprachliche Bildung: So früh wie möglich, aber wie? Yvonne Anders 05.10.2016 Bildungspolitisches
Erfolgreiche Bildungskooperation aus Sicht einer Trägervertreterin
 Erfolgreiche Bildungskooperation aus Sicht einer Trägervertreterin Vortrag am 17.9.2016 ARGE Singen-Bewegen -Sprechen Übersicht Einführung Paradigmawechsel in der Frühpädagogik durch den Orientierungsplan
Erfolgreiche Bildungskooperation aus Sicht einer Trägervertreterin Vortrag am 17.9.2016 ARGE Singen-Bewegen -Sprechen Übersicht Einführung Paradigmawechsel in der Frühpädagogik durch den Orientierungsplan
Umgang mit schwierigen Schüler/innen. Ilshofen
 Umgang mit schwierigen Schüler/innen Ilshofen 16.11.2017 Ziel für heute: Wie kann ich die Arbeit mit schwierigen Schülern gestalten mit dem Ziel, Störungen zu vermindern und selbst handlungsfähig zu bleiben.
Umgang mit schwierigen Schüler/innen Ilshofen 16.11.2017 Ziel für heute: Wie kann ich die Arbeit mit schwierigen Schülern gestalten mit dem Ziel, Störungen zu vermindern und selbst handlungsfähig zu bleiben.
Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter
 Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter Bearbeitet von, Sabina Pauen 4. Auflage 2016. Buch. XVII, 691 S. Hardcover ISBN 978 3 662 47027 5 Format (B x L): 21 x 27,9 cm Weitere Fachgebiete > Psychologie
Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter Bearbeitet von, Sabina Pauen 4. Auflage 2016. Buch. XVII, 691 S. Hardcover ISBN 978 3 662 47027 5 Format (B x L): 21 x 27,9 cm Weitere Fachgebiete > Psychologie
Niedersächsisches Kultusministerium. Frühpädagogische Anforderungen an die betriebliche Tagesbetreuung Empfehlungen des Orientierungsplans
 Frühpädagogische Anforderungen an die betriebliche Tagesbetreuung Empfehlungen des Orientierungsplans Dr. Monika Lütke-Entrup, 26.11.2012 Der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung - ist die Konkretisierung
Frühpädagogische Anforderungen an die betriebliche Tagesbetreuung Empfehlungen des Orientierungsplans Dr. Monika Lütke-Entrup, 26.11.2012 Der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung - ist die Konkretisierung
Wie uns Kinder das Lernen lehren
 9. Landeskongress der Musikpädagogik Pädagogische Hochschule Freiburg 11.- 14.10.2007 Wie uns Kinder das Lernen lehren Markus Cslovjecsek Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) Pädagogische Hochschule p
9. Landeskongress der Musikpädagogik Pädagogische Hochschule Freiburg 11.- 14.10.2007 Wie uns Kinder das Lernen lehren Markus Cslovjecsek Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) Pädagogische Hochschule p
Sprachliche Bildung Mehrsprachigkeit in der Kita Berlin, DJI-Jahrestagung 2016 Ganz ähnlich ganz anders.
 Sprachliche Bildung Mehrsprachigkeit in der Kita Berlin, DJI-Jahrestagung 2016 Ganz ähnlich ganz anders. Prof. in Dr. Anke König Deutsches Jugendinstitut e.v., München Thesen Sprache ist verwoben mit Partizipation
Sprachliche Bildung Mehrsprachigkeit in der Kita Berlin, DJI-Jahrestagung 2016 Ganz ähnlich ganz anders. Prof. in Dr. Anke König Deutsches Jugendinstitut e.v., München Thesen Sprache ist verwoben mit Partizipation
Theorien des Erstspracherwerbs
 Präsentation:Cl audia Kolb 10.05.2011 Quelle: Milupa 1 Theorien des Erstspracherwerbs Goethe-Universität Frankfurt am Main Institut für Psycholinguistik und Didaktik der deutschen Sprache Veranstaltung:
Präsentation:Cl audia Kolb 10.05.2011 Quelle: Milupa 1 Theorien des Erstspracherwerbs Goethe-Universität Frankfurt am Main Institut für Psycholinguistik und Didaktik der deutschen Sprache Veranstaltung:
I. Vorschulischer Bereich und Übergang in die Schule
 I. Vorschulischer Bereich und Übergang in die Schule I.1 Gemeinsame pädagogische Grundlagen von Kindertageseinrichtungen und Schulen (Grundschulen, Sonderschulen) Tageseinrichtungen und Schulen tragen
I. Vorschulischer Bereich und Übergang in die Schule I.1 Gemeinsame pädagogische Grundlagen von Kindertageseinrichtungen und Schulen (Grundschulen, Sonderschulen) Tageseinrichtungen und Schulen tragen
Spracherwerb bei Migranten - was soll der Kinderarzt raten? Corina Reber Braun, Logopädin Bern
 Spracherwerb bei Migranten - was soll der Kinderarzt raten? Corina Reber Braun, Logopädin Bern Beratungskriterien Aus den Spracherwerbstheorien Aus der Zweitspracherwerbsforschung Aus der Praxis SE-Theorien
Spracherwerb bei Migranten - was soll der Kinderarzt raten? Corina Reber Braun, Logopädin Bern Beratungskriterien Aus den Spracherwerbstheorien Aus der Zweitspracherwerbsforschung Aus der Praxis SE-Theorien
Mehrsprachigkeit -Tatsachen und Meinungen
 Mehrsprachigkeit -Tatsachen und Meinungen Barbara Zollinger Mittagsveranstaltung Netzwerk Frühförderung 23. Mai 2017 Zentrum für kleine Kinder GmbH Pionierstrasse 10 CH-8400 Winterthur Tel. +41 52 213
Mehrsprachigkeit -Tatsachen und Meinungen Barbara Zollinger Mittagsveranstaltung Netzwerk Frühförderung 23. Mai 2017 Zentrum für kleine Kinder GmbH Pionierstrasse 10 CH-8400 Winterthur Tel. +41 52 213
Workshop Mit Kindern unter drei Jahren feinfühlig kommunizieren
 Profis für die Arbeit mit Säuglingen und Kleinkindern Bildung von Anfang an (III) Fachtagung des PARITÄTISCHEN Baden-Württemberg, am 26.04.2013 in Stuttgart Workshop Mit Kindern unter drei Jahren feinfühlig
Profis für die Arbeit mit Säuglingen und Kleinkindern Bildung von Anfang an (III) Fachtagung des PARITÄTISCHEN Baden-Württemberg, am 26.04.2013 in Stuttgart Workshop Mit Kindern unter drei Jahren feinfühlig
Susanne Mahlstedt. Zweisprachigkeitserziehung in gemischtsprachigen Familien
 Susanne Mahlstedt Zweisprachigkeitserziehung in gemischtsprachigen Familien Eine Analyse der erfolgsbedingenden Merkmale PETER LANG Frankfurt am Main Berlin Bern New York Paris Wien Inhaltsverzeichnis
Susanne Mahlstedt Zweisprachigkeitserziehung in gemischtsprachigen Familien Eine Analyse der erfolgsbedingenden Merkmale PETER LANG Frankfurt am Main Berlin Bern New York Paris Wien Inhaltsverzeichnis
Sprachförderung im Elementarbereich Grundlagen und Ansätze für gute Praxis
 Sprachförderung im Elementarbereich Grundlagen und Ansätze für gute Praxis Fachtagung am 02.09.2010 im Congresszentrum Hannover Sprachförderung im Elementarbereich niedersächsischer Kindertageseinrichtungen
Sprachförderung im Elementarbereich Grundlagen und Ansätze für gute Praxis Fachtagung am 02.09.2010 im Congresszentrum Hannover Sprachförderung im Elementarbereich niedersächsischer Kindertageseinrichtungen
Sprache beginnt ohne Worte. Vorsprachliche Entwicklung und die Bedeutung der frühen Elternarbeit
 Sprache beginnt ohne Worte Vorsprachliche Entwicklung und die Bedeutung der frühen Elternarbeit Grundeigenschaften menschlicher Sprache gesprochene Sprache ist akustisch vermittelt kleine Zahl von Lauten
Sprache beginnt ohne Worte Vorsprachliche Entwicklung und die Bedeutung der frühen Elternarbeit Grundeigenschaften menschlicher Sprache gesprochene Sprache ist akustisch vermittelt kleine Zahl von Lauten
Integrative Schulung Beitrag der Logopädie
 Integrative Schulung Beitrag der Logopädie Internationaler Tag der Logopädie 6. März 2009 Susanne Kempe Preti lic. phil., Logopädin Dozentin HfH Inhalte Integration als Ziel und als Weg integrative Sprachförderung
Integrative Schulung Beitrag der Logopädie Internationaler Tag der Logopädie 6. März 2009 Susanne Kempe Preti lic. phil., Logopädin Dozentin HfH Inhalte Integration als Ziel und als Weg integrative Sprachförderung
SELBSTBILDUNG+BRAUCHT+ BEZIEHUNG++
 SELBSTBILDUNG+BRAUCHT+ BEZIEHUNG++ Fachtagung)zum)gemeinsamen) Bildungsverständnis)in)Kita)und) Grundschule,)27.3.2014) Dr.)phil.)Sonja)Damen+ + SELBSTBILDUNG+BRAUCHT+ BEZIEHUNG+ Ausgangslage+ Was+meint+Bildung+
SELBSTBILDUNG+BRAUCHT+ BEZIEHUNG++ Fachtagung)zum)gemeinsamen) Bildungsverständnis)in)Kita)und) Grundschule,)27.3.2014) Dr.)phil.)Sonja)Damen+ + SELBSTBILDUNG+BRAUCHT+ BEZIEHUNG+ Ausgangslage+ Was+meint+Bildung+
dbl Deutscher Bundesverband für Logopädie e.v.
 Sprachförderkonzept "Haus für Kinder" Vallendar: Alltagsintegrierte Sprachbildung = inklusive Sprachbildung "Alltagsintegrierte Sprachförderung bedeutet, dass die frühpädagogischen Fachkräfte sich in allen
Sprachförderkonzept "Haus für Kinder" Vallendar: Alltagsintegrierte Sprachbildung = inklusive Sprachbildung "Alltagsintegrierte Sprachförderung bedeutet, dass die frühpädagogischen Fachkräfte sich in allen
Indikatoren für Sprachauffälligkeiten im Übergang Kindergarten Schule. Einschulung 20 /
 Indikatoren für Sprachauffälligkeiten im Übergang Kindergarten Schule Einschulung 20 / Vor- und Zuname des Kindes zuständige Grundschule geboren am Ansprechpartner Migrationshintergrund? Falls ja: Erstsprache
Indikatoren für Sprachauffälligkeiten im Übergang Kindergarten Schule Einschulung 20 / Vor- und Zuname des Kindes zuständige Grundschule geboren am Ansprechpartner Migrationshintergrund? Falls ja: Erstsprache
Konzept für Mehrsprachigkeit
 AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL Italienisches Bildungsressort Pädagogischer Bereich PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE Dipartimento istruzione e formazione italiana Area Pedagogica Konzept für
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL Italienisches Bildungsressort Pädagogischer Bereich PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE Dipartimento istruzione e formazione italiana Area Pedagogica Konzept für
Kooperationsvereinbarung zwischen
 Deutsche Kinder- und Jugendstiftung Programm: Bildung braucht Sprache ABa, Stand 19.09.2016 Kooperationsvereinbarung zwischen Kindertageseinrichtung (Kita) und Offene Ganztagsgrundschule () zur Ausgestaltung
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung Programm: Bildung braucht Sprache ABa, Stand 19.09.2016 Kooperationsvereinbarung zwischen Kindertageseinrichtung (Kita) und Offene Ganztagsgrundschule () zur Ausgestaltung
Die pädagogische Wirksamkeit vorschulischer Förderung des Schriftspracherwerbs
 Pädagogik Dirk Kranz Die pädagogische Wirksamkeit vorschulischer Förderung des Schriftspracherwerbs Bachelorarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 3 2. Spracherwerb und Schriftspracherwerb... 3 2.1.
Pädagogik Dirk Kranz Die pädagogische Wirksamkeit vorschulischer Förderung des Schriftspracherwerbs Bachelorarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 3 2. Spracherwerb und Schriftspracherwerb... 3 2.1.
Grundlagen für einen gelingenden Anfangsunterricht
 Grundlagen für einen gelingenden Anfangsunterricht Schuleingangsphase 2 8. November 2014 Brigitte Wolf Gelingensbedingungen! aus gesellschaftlicher Perspektive: Sächsischer Leitfaden für die öffentlich
Grundlagen für einen gelingenden Anfangsunterricht Schuleingangsphase 2 8. November 2014 Brigitte Wolf Gelingensbedingungen! aus gesellschaftlicher Perspektive: Sächsischer Leitfaden für die öffentlich
Überblick. Spracherwerb und sprachliche Bildung in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen
 Überblick Spracherwerb und sprachliche Bildung in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen Zwischen PISA und dem Kind als Akteur Sprachliche Bildung und Sprachförderung Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen
Überblick Spracherwerb und sprachliche Bildung in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen Zwischen PISA und dem Kind als Akteur Sprachliche Bildung und Sprachförderung Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen
Sprachentwicklungsvoraussetzungen und Voraussetzungen der Sprachanwendung
 Sprachentwicklungsvoraussetzungen und Voraussetzungen der Sprachanwendung Seminar: Sprachen lernen: Psychologische Perspektiven (WS 08/09) Dozentin: Dr. Anna Chr. M. Zaunbauer-Womelsdorf Datum: 04.12.2008
Sprachentwicklungsvoraussetzungen und Voraussetzungen der Sprachanwendung Seminar: Sprachen lernen: Psychologische Perspektiven (WS 08/09) Dozentin: Dr. Anna Chr. M. Zaunbauer-Womelsdorf Datum: 04.12.2008
Inhaltsverzeichnis Vorwort... 8 Theoretische Grundlagen Bildung aus der Perspektive des transaktionalen Ansatzes... 10
 Inhaltsverzeichnis Vorwort... 8 Theoretische Grundlagen... 10 1 Bildung aus der Perspektive des transaktionalen Ansatzes... 10 1.1 Der transaktionale Ansatz... 10 1.2 Das kompetente Kind... 12 1.3 Bildung
Inhaltsverzeichnis Vorwort... 8 Theoretische Grundlagen... 10 1 Bildung aus der Perspektive des transaktionalen Ansatzes... 10 1.1 Der transaktionale Ansatz... 10 1.2 Das kompetente Kind... 12 1.3 Bildung
Vielfalt begegnen ein Haus für alle Kinder. Begegnungen und Erfahrungen mit Vielfalt reflektieren
 Vielfalt begegnen ein Haus für alle Kinder Begegnungen und Erfahrungen mit Vielfalt reflektieren Die Umsetzung von Inklusion in der Kindertageseinrichtung setzt vorurteilsbewusste Pädagogik voraus. Ziele
Vielfalt begegnen ein Haus für alle Kinder Begegnungen und Erfahrungen mit Vielfalt reflektieren Die Umsetzung von Inklusion in der Kindertageseinrichtung setzt vorurteilsbewusste Pädagogik voraus. Ziele
Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren?
 Geisteswissenschaft Anonym Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren? Essay Friedrich-Schiller-Universität
Geisteswissenschaft Anonym Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren? Essay Friedrich-Schiller-Universität
Kleine Wörter grosse Geschichten
 Kleine Wörter grosse Geschichten A. Holenstein Erzählfähigkeit verbessern mit Kernwortschatz «Zweckmässige Geschichten werden vom Zuhörer ohne viel Nachfragen verstanden. Diese Geschichten sind systematisch
Kleine Wörter grosse Geschichten A. Holenstein Erzählfähigkeit verbessern mit Kernwortschatz «Zweckmässige Geschichten werden vom Zuhörer ohne viel Nachfragen verstanden. Diese Geschichten sind systematisch
Vorwort 8. Theoretische Grundlagen Bildung aus der Perspektive des transaktionalen Ansatzes Der transaktionale Ansatz 10
 Inhaltsverzeichnis Vorwort 8 Theoretische Grundlagen 10 1 Bildung aus der Perspektive des transaktionalen Ansatzes 10 1.1 Der transaktionale Ansatz 10 1.2 Das kompetente Kind 12 1.3 Bildung durch Selbst-Bildung
Inhaltsverzeichnis Vorwort 8 Theoretische Grundlagen 10 1 Bildung aus der Perspektive des transaktionalen Ansatzes 10 1.1 Der transaktionale Ansatz 10 1.2 Das kompetente Kind 12 1.3 Bildung durch Selbst-Bildung
Vorlesen und Lesen im Kindergartenalter
 Published on Lesen in Tirol (http://lesen.tibs.at) Startseite > Printer-friendly PDF > Printer-friendly PDF Vorlesen und Lesen im Kindergartenalter Die Kultur des Lesens und des Umgangs mit Büchern aber
Published on Lesen in Tirol (http://lesen.tibs.at) Startseite > Printer-friendly PDF > Printer-friendly PDF Vorlesen und Lesen im Kindergartenalter Die Kultur des Lesens und des Umgangs mit Büchern aber
Handlungsschritte Alltagsintegrierte Sprachbildung und Beobachtung
 Jugendamt - Handlungsschritte Welche Aufgaben nimmt das Jugendamt Bielefeld bei der Neuausrichtung der Sprachbildung (Vgl. 22, 45 SGB VIII, 13 KiBiz) wahr? Abstimmung der Zusammenarbeit mit den Trägern
Jugendamt - Handlungsschritte Welche Aufgaben nimmt das Jugendamt Bielefeld bei der Neuausrichtung der Sprachbildung (Vgl. 22, 45 SGB VIII, 13 KiBiz) wahr? Abstimmung der Zusammenarbeit mit den Trägern
Begriffsdefinitionen
 Begriffsdefinitionen Sozialisation: Unter Sozialisation versteht man die Entstehung und Bildung der Persönlichkeit aufgrund ihrer Interaktion mit einer spezifischen materiellen, kulturellen und sozialen
Begriffsdefinitionen Sozialisation: Unter Sozialisation versteht man die Entstehung und Bildung der Persönlichkeit aufgrund ihrer Interaktion mit einer spezifischen materiellen, kulturellen und sozialen
Übergang Kindergarten- Grundschule. Eva Hammes-Di Bernardo Saarbrücken
 Übergang Kindergarten- Grundschule Eva Hammes-Di Bernardo Saarbrücken Kindertageseinrichtungen sind laut Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG des 8. Sozialgesetzbuches Einrichtungen zur Erziehung, Bildung
Übergang Kindergarten- Grundschule Eva Hammes-Di Bernardo Saarbrücken Kindertageseinrichtungen sind laut Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG des 8. Sozialgesetzbuches Einrichtungen zur Erziehung, Bildung
prachfö rderung in lltag nd piel Studie zur Förderung von Sprache und Kommunikation in der Familie und in der Kita*
 prachfö rderung in lltag nd piel Studie zur Förderung von Sprache und Kommunikation in der Familie und in der Kita* *gefördert von der Univ. Gießen und dem Gesundheitsamt Region Kassel Gesellschaft, Forschung
prachfö rderung in lltag nd piel Studie zur Förderung von Sprache und Kommunikation in der Familie und in der Kita* *gefördert von der Univ. Gießen und dem Gesundheitsamt Region Kassel Gesellschaft, Forschung
Vorwort von Gerhard Roth Einleitung: Was wollen w ir?... 15
 Inhalt Vorwort von Gerhard Roth... 11 1 Einleitung: Was wollen w ir?... 15 2 Das Gehirn und das Ich: Ein Überblick... 23 2.1 Gene und Erfahrungen beeinflussen die Hirnentwicklung... 29 Gene und Erfahrungen
Inhalt Vorwort von Gerhard Roth... 11 1 Einleitung: Was wollen w ir?... 15 2 Das Gehirn und das Ich: Ein Überblick... 23 2.1 Gene und Erfahrungen beeinflussen die Hirnentwicklung... 29 Gene und Erfahrungen
Sprachbildung und DaZ mit Zebra. Dr. Christina Hein
 Sprachbildung und DaZ mit Zebra 1 Sprachkompetenz Hörverstehen Leseverstehen rezeptiv Sprechen Schreiben produktiv Wortschatz Grammatik kognitiv (vgl. Nodari, 2002) 2 Bedeutung der Sprache Sprache ist
Sprachbildung und DaZ mit Zebra 1 Sprachkompetenz Hörverstehen Leseverstehen rezeptiv Sprechen Schreiben produktiv Wortschatz Grammatik kognitiv (vgl. Nodari, 2002) 2 Bedeutung der Sprache Sprache ist
Sozialisationsmodelle
 Sozialisationsmodelle 16 Def. von Sozialisation von Hurrelmann (1986, S. 14): Im heute allgemein vorherrschenden Verständnis wird mit Sozialisation der Prozeß der Entstehung und Entwicklung der menschlichen
Sozialisationsmodelle 16 Def. von Sozialisation von Hurrelmann (1986, S. 14): Im heute allgemein vorherrschenden Verständnis wird mit Sozialisation der Prozeß der Entstehung und Entwicklung der menschlichen
ETZ-Gruppe Kleve e.v. MUK
 ETZ-Gruppe MUTTER UND KIND Begleitung In den letzten Jahren haben sich immer häufiger schwangere Frauen und junge Mütter bei der Netzgruppe gemeldet, die auf der Suche nach einer Unterkunft waren und Unterstützung
ETZ-Gruppe MUTTER UND KIND Begleitung In den letzten Jahren haben sich immer häufiger schwangere Frauen und junge Mütter bei der Netzgruppe gemeldet, die auf der Suche nach einer Unterkunft waren und Unterstützung
Individuen Interessen Interaktion
 Das element-i-leitbild Wie wir denken. Grundlagen unserer Arbeit. Individuen Interessen Interaktion Verbundenheit Autonomie Resilienz Intellekt Intuition Pragmatismus element-i: Leitbild für unser Handeln
Das element-i-leitbild Wie wir denken. Grundlagen unserer Arbeit. Individuen Interessen Interaktion Verbundenheit Autonomie Resilienz Intellekt Intuition Pragmatismus element-i: Leitbild für unser Handeln
Referentin: Sibylle Sock-Schweitzer
 Kinder l(i)eben Vielfalt Zukunft braucht weltoffene Persönlichkeiten Kulturelle Vielfalt in der Kitapraxis Referentin: Sibylle Sock-Schweitzer 23.02.2018 www.biwe-bbq.de Kompetenzen für kulturelle Vielfalt
Kinder l(i)eben Vielfalt Zukunft braucht weltoffene Persönlichkeiten Kulturelle Vielfalt in der Kitapraxis Referentin: Sibylle Sock-Schweitzer 23.02.2018 www.biwe-bbq.de Kompetenzen für kulturelle Vielfalt
Materialien für die interne Evaluation zum Berliner Bildungsprogramm
 Materialien für die interne Evaluation zum Berliner Bildungsprogramm Aufgabenbereich A1 Das pädagogische Handeln basiert auf einem Bildungsverständnis, das allen Kindern die gleichen Rechte auf Bildung
Materialien für die interne Evaluation zum Berliner Bildungsprogramm Aufgabenbereich A1 Das pädagogische Handeln basiert auf einem Bildungsverständnis, das allen Kindern die gleichen Rechte auf Bildung
Deutsche Sprache, schwere Sprache: Ursachen für die Problematik beim Erwerb der Zweitsprache Deutsch bei türkischen Kindern
 Deutsche Sprache, schwere Sprache: Ursachen für die Problematik beim Erwerb der Zweitsprache Deutsch bei türkischen Kindern von Nese Kilinc Erstauflage Diplomica Verlag 2014 Verlag C.H. Beck im Internet:
Deutsche Sprache, schwere Sprache: Ursachen für die Problematik beim Erwerb der Zweitsprache Deutsch bei türkischen Kindern von Nese Kilinc Erstauflage Diplomica Verlag 2014 Verlag C.H. Beck im Internet:
Voraussetzungen und Bedingungen für einen erfolgreichen Spracherwerb. Voraussetzungen und Bedingungen für einen erfolgreichen Spracherwerb
 Voraussetzungen und Bedingungen für einen erfolgreichen Spracherwerb Voraussetzungen und Bedingungen für einen erfolgreichen Spracherwerb Neurophysiologische Grundlagen Kirstin Kognitive Voraussetzungen
Voraussetzungen und Bedingungen für einen erfolgreichen Spracherwerb Voraussetzungen und Bedingungen für einen erfolgreichen Spracherwerb Neurophysiologische Grundlagen Kirstin Kognitive Voraussetzungen
Kindertageseinrichtungen auf dem Weg
 Vielfalt begegnen ein Haus für alle Kinder Kindertageseinrichtungen auf dem Weg von der Integration zur Inklusion Von der Integration zur Inklusion den Blickwinkel verändern 2 Von der Integration zur Inklusion
Vielfalt begegnen ein Haus für alle Kinder Kindertageseinrichtungen auf dem Weg von der Integration zur Inklusion Von der Integration zur Inklusion den Blickwinkel verändern 2 Von der Integration zur Inklusion
Emotionale Entwicklung
 Emotionale Entwicklung Die Entwicklung der emotionalen Kompetenz und ihre Bedeutung Die eigenen Gefühle verstehen, sie anderen erklären, Strategien entwickeln, wie negative Emotionen überwunden werden
Emotionale Entwicklung Die Entwicklung der emotionalen Kompetenz und ihre Bedeutung Die eigenen Gefühle verstehen, sie anderen erklären, Strategien entwickeln, wie negative Emotionen überwunden werden
Elementardidaktische Methoden im Bereich MINT
 Elementardidaktische Methoden im Bereich MINT Annette Schmitt Kompetenzzentrum Frühe Bildung Hochschule Magdeburg-Stendal Weimar, den 22. November 2018 MINT in der Erzieherinnenausbildung unter der Lupe
Elementardidaktische Methoden im Bereich MINT Annette Schmitt Kompetenzzentrum Frühe Bildung Hochschule Magdeburg-Stendal Weimar, den 22. November 2018 MINT in der Erzieherinnenausbildung unter der Lupe
Bilderbücher dialogisch betrachten
 Bilderbücher dialogisch betrachten Sprachliche Bildung im Kita-Alltag umsetzen Eine Produktion des Staatsinstituts für Frühpädagogik (IFP) und AV1 Pädagogikfilme In der kindlichen Sprachentwicklung spielen
Bilderbücher dialogisch betrachten Sprachliche Bildung im Kita-Alltag umsetzen Eine Produktion des Staatsinstituts für Frühpädagogik (IFP) und AV1 Pädagogikfilme In der kindlichen Sprachentwicklung spielen
Zielsetzung der Materialien
 Zielsetzung der Materialien Die sprachliche Entwicklung von Kindern am Schulanfang führt zu vielen Besorgnissen bei Eltern und Pädagogen. Jedes vierte Kind hat im letzten Kindergartenjahr und in der ersten
Zielsetzung der Materialien Die sprachliche Entwicklung von Kindern am Schulanfang führt zu vielen Besorgnissen bei Eltern und Pädagogen. Jedes vierte Kind hat im letzten Kindergartenjahr und in der ersten
3. In welchen Sprachen spricht das Kind mit der Mutter, dem Vater, Geschwistern und anderen Bezugspersonen?
 A. Erfassung biografischer Daten 1. Was ist die Erst- und ggf. Zweit- und Familiensprache des Kindes? Deutsch als Erstsprache: weiter mit Frage 5: 2. Seit wann hat das Kind Kontakt mit Deutsch als Zweitsprache?
A. Erfassung biografischer Daten 1. Was ist die Erst- und ggf. Zweit- und Familiensprache des Kindes? Deutsch als Erstsprache: weiter mit Frage 5: 2. Seit wann hat das Kind Kontakt mit Deutsch als Zweitsprache?
Die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements für eine gelingende Integration
 Die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements für eine gelingende Integration Engagement für alle! Kooperation zwischen Engagementförderung und Integrationsarbeit Fachtagung des Hessischen Ministeriums
Die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements für eine gelingende Integration Engagement für alle! Kooperation zwischen Engagementförderung und Integrationsarbeit Fachtagung des Hessischen Ministeriums
Kleine Wörter grosse Geschichten
 Kleine Wörter grosse Geschichten Erzählfähigkeit verbessern mit Kernwortschatz «Erzählen ist wie Kommunizieren ein interaktiver Prozess, an dem das Kind und der/die ZuhörerIn beteiligt sind. Zum Erzählen
Kleine Wörter grosse Geschichten Erzählfähigkeit verbessern mit Kernwortschatz «Erzählen ist wie Kommunizieren ein interaktiver Prozess, an dem das Kind und der/die ZuhörerIn beteiligt sind. Zum Erzählen
Mehrsprachigkeit - Chance und Herausforderung im pädagogischen Alltag
 Gute Perspektiven für Sprache, Teilhabe und Integration: Fachtag Rucksack Kita und Griffbereit Dienstag, 14.März 2017 Mehrsprachigkeit - Chance und Herausforderung im pädagogischen Alltag Referentin: Karin
Gute Perspektiven für Sprache, Teilhabe und Integration: Fachtag Rucksack Kita und Griffbereit Dienstag, 14.März 2017 Mehrsprachigkeit - Chance und Herausforderung im pädagogischen Alltag Referentin: Karin
(Sprach-)Vielfalt im pädagogischen Alltag gestalten
 (Sprach-)Vielfalt im pädagogischen Alltag gestalten Timm Albers Hannover, den 29.11.2016 Begriffsbestimmung 2 Überblick Zwischen PISA und dem Kind als Akteur Sprachliche Bildung und Sprachförderung Mehrsprachigkeit
(Sprach-)Vielfalt im pädagogischen Alltag gestalten Timm Albers Hannover, den 29.11.2016 Begriffsbestimmung 2 Überblick Zwischen PISA und dem Kind als Akteur Sprachliche Bildung und Sprachförderung Mehrsprachigkeit
Der Beitrag der Frühf. hförderung zu Inklusion
 Der Beitrag der Frühf hförderung zu Inklusion Entwicklungsförderung und Familienbegleitung als Befähigung zur Teilhabe Symposium Gemeinsame Bildung für f r alle Kinder 23. März M 2012 Kreis Offenbach März
Der Beitrag der Frühf hförderung zu Inklusion Entwicklungsförderung und Familienbegleitung als Befähigung zur Teilhabe Symposium Gemeinsame Bildung für f r alle Kinder 23. März M 2012 Kreis Offenbach März
Kindliche Sprachentwicklung und Mehrsprachigkeit: Einführende Überlegungen
 Vorwort Kapitel 1 Kindliche Sprachentwicklung und Mehrsprachigkeit: Einführende Überlegungen Kindliche Mehrsprachigkeit als gesellschaftliche Herausforderung und Bereicherung Wie stehen die Betroffenen
Vorwort Kapitel 1 Kindliche Sprachentwicklung und Mehrsprachigkeit: Einführende Überlegungen Kindliche Mehrsprachigkeit als gesellschaftliche Herausforderung und Bereicherung Wie stehen die Betroffenen
Von der Interaktion. zur Co-Konstruktion
 Deutsches Bildungsressort Bereich Innovation und Beratung Dipartimento istruzione e formazione tedesca Area innovazione e consulenza Von der Interaktion zur Co-Konstruktion Gestaltung der Bildungsprozesse
Deutsches Bildungsressort Bereich Innovation und Beratung Dipartimento istruzione e formazione tedesca Area innovazione e consulenza Von der Interaktion zur Co-Konstruktion Gestaltung der Bildungsprozesse
Hilf mir, es selbst zu sagen! Susanne Kühn Workshop 6 Fachtag Sprache bewegt Hamburg!
 Hilf mir, es selbst zu sagen! Susanne Kühn Workshop 6 Fachtag Sprache bewegt Hamburg! 2.11.2018 And who are you? Traumreise in die eigene Praxis Kinder äußern sich Warum? Wie? Wann und mit wem? Selbsterfahrung
Hilf mir, es selbst zu sagen! Susanne Kühn Workshop 6 Fachtag Sprache bewegt Hamburg! 2.11.2018 And who are you? Traumreise in die eigene Praxis Kinder äußern sich Warum? Wie? Wann und mit wem? Selbsterfahrung
Literacy in Verbindung zu Mehrsprachigkeit und Vielfalt. Livia Daveri Landesweite Koordinierungsstelle Kommunale Integrationszentren
 Literacy in Verbindung zu Mehrsprachigkeit und Vielfalt Livia Daveri Landesweite Koordinierungsstelle Kommunale Integrationszentren www.kommunale-integrationszentren-nrw.de 23.11.2018 Mehrsprachigkeit
Literacy in Verbindung zu Mehrsprachigkeit und Vielfalt Livia Daveri Landesweite Koordinierungsstelle Kommunale Integrationszentren www.kommunale-integrationszentren-nrw.de 23.11.2018 Mehrsprachigkeit
Individuen Interessen. Interaktion
 Das element-i-leitbild Wie wir denken. Grundlagen unserer Arbeit. Individuen Interessen Interaktion Verbundenheit Autonomie Resilienz Intellekt Intuition Pragmatismus element-i: Leitbild für unser Handeln
Das element-i-leitbild Wie wir denken. Grundlagen unserer Arbeit. Individuen Interessen Interaktion Verbundenheit Autonomie Resilienz Intellekt Intuition Pragmatismus element-i: Leitbild für unser Handeln
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) - ein aktuelles Unterrichtsprinzip -
 Deutsch als Zweitsprache (DaZ) - ein aktuelles Unterrichtsprinzip - Christiane Bainski Leiterin der Hauptstelle der RAA in NRW Beitrag Kongress: Unterricht im Wandel 13. April 2005 in Köln Gliederung Bildungspolitischer
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) - ein aktuelles Unterrichtsprinzip - Christiane Bainski Leiterin der Hauptstelle der RAA in NRW Beitrag Kongress: Unterricht im Wandel 13. April 2005 in Köln Gliederung Bildungspolitischer
Werkstatt Naturwissenschaft und Sprache
 Deutsches Bildungsressort Bereich Innovation und Beratung Dipartimento Istruzione e formazione in lingua tedesca Area innovazione e consulenza Werkstatt Naturwissenschaft und Sprache 1. Treffen Bereich
Deutsches Bildungsressort Bereich Innovation und Beratung Dipartimento Istruzione e formazione in lingua tedesca Area innovazione e consulenza Werkstatt Naturwissenschaft und Sprache 1. Treffen Bereich
Herzlich willkommen zur Informationsveranstaltung. Dez. II 09/18
 Herzlich willkommen zur Informationsveranstaltung für Eltern der 4 jährigen Kinder Übergang Kita Schule Herr Aguirre-Ramke (Familienzentrum am Bollenberg) Frau Schlaack (GGS Bollenberg) Ziel: Brücken bauen
Herzlich willkommen zur Informationsveranstaltung für Eltern der 4 jährigen Kinder Übergang Kita Schule Herr Aguirre-Ramke (Familienzentrum am Bollenberg) Frau Schlaack (GGS Bollenberg) Ziel: Brücken bauen
Magie der Aufmerksamkeit
 Magie der Aufmerksamkeit oder -was kleine Leute wirklich stark macht Silvia Bender Bad Orb, 2011 1 Interaktions und Resonanzphänomene nomene Das Erleben und Übertragen von eigenen Gefühlen und Gedanken
Magie der Aufmerksamkeit oder -was kleine Leute wirklich stark macht Silvia Bender Bad Orb, 2011 1 Interaktions und Resonanzphänomene nomene Das Erleben und Übertragen von eigenen Gefühlen und Gedanken
Neugier braucht Sicherheit
 Neugier braucht Sicherheit Die Bedeutung der Bindungsqualität für die Entwicklungschancen Vortrag beim Fachtag der Frühförderstellen Mecklenburg-Vorpommern am 3.9.2011 Bindungen und ihre Entwicklungen
Neugier braucht Sicherheit Die Bedeutung der Bindungsqualität für die Entwicklungschancen Vortrag beim Fachtag der Frühförderstellen Mecklenburg-Vorpommern am 3.9.2011 Bindungen und ihre Entwicklungen
PARTIZIPATION. Leitgedanken
 Bei benachteiligten Kindern in der Kindertagesstätte Christine Sperling, Partizipation, 24.06.2010 Leitgedanken Kinder haben das Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend ihrem Entwicklungsstand
Bei benachteiligten Kindern in der Kindertagesstätte Christine Sperling, Partizipation, 24.06.2010 Leitgedanken Kinder haben das Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend ihrem Entwicklungsstand
Entdeckungen im Alltag! Bildungsarbeit mit Mädchen und Jungen im Kindesalter
 Dr. phil. Vera Bamler, Technische Universität Dresden Entdeckungen im Alltag! Bildungsarbeit mit Mädchen und Jungen im Kindesalter Wie Natur Wissen Schafft Ansätze mathematischer und naturwissenschaftlicher
Dr. phil. Vera Bamler, Technische Universität Dresden Entdeckungen im Alltag! Bildungsarbeit mit Mädchen und Jungen im Kindesalter Wie Natur Wissen Schafft Ansätze mathematischer und naturwissenschaftlicher
Die Grundbedürfnisse des Kindes
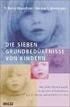 Die Grundbedürfnisse des Kindes Kinder streben nach Selbständigkeit und Autonomie Eigenständigkeit und Unabhängigkeit Anerkennung, Zuwendung und Zärtlichkeit vermitteln dem Kind Sicherheit und Zufriedenheit
Die Grundbedürfnisse des Kindes Kinder streben nach Selbständigkeit und Autonomie Eigenständigkeit und Unabhängigkeit Anerkennung, Zuwendung und Zärtlichkeit vermitteln dem Kind Sicherheit und Zufriedenheit
ANSÄTZE ZUR SPRACHFÖRDERUNG: GANZHEITLICH ODER LINGUISTISCH ORIENTIERT.
 1 ANSÄTZE ZUR SPRACHFÖRDERUNG: GANZHEITLICH ODER LINGUISTISCH ORIENTIERT. Präsentiert von: Konstantinidou, Maria-Eleni Seminar: Sprachstandsdiagnose und Sprachförderung Seminarleiterin: Schuler, Rebecca
1 ANSÄTZE ZUR SPRACHFÖRDERUNG: GANZHEITLICH ODER LINGUISTISCH ORIENTIERT. Präsentiert von: Konstantinidou, Maria-Eleni Seminar: Sprachstandsdiagnose und Sprachförderung Seminarleiterin: Schuler, Rebecca
INTERNATIONALE AKADEMIE. FREIEN UNIVERSITÄT BERLIN Königin-Luise-Str , Berlin Institut für den Situationsansatz
 INTERNATIONALE AKADEMIE für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie ggmbh (INA) an der FREIEN UNIVERSITÄT BERLIN Königin-Luise-Str. 24-26, 14195 Berlin Institut für den Situationsansatz Konzeptionelle
INTERNATIONALE AKADEMIE für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie ggmbh (INA) an der FREIEN UNIVERSITÄT BERLIN Königin-Luise-Str. 24-26, 14195 Berlin Institut für den Situationsansatz Konzeptionelle
Bilderbuchbetrachtung und dialogisches Lesen. Nikola Determann Logopädin / Lehrlogopädin Fachtag Sprachbildung
 Bilderbuchbetrachtung und dialogisches Lesen Einführung und Hintergrund Agenda Bilderbuchanschauen zur Sprach - und Kommunikationsanregung wie geht das? Dialog statt Monolog - wie gelingt dialogisches
Bilderbuchbetrachtung und dialogisches Lesen Einführung und Hintergrund Agenda Bilderbuchanschauen zur Sprach - und Kommunikationsanregung wie geht das? Dialog statt Monolog - wie gelingt dialogisches
Vorhaben heute. Einstieg kurze Vorstellungsrunde
 Vorhaben heute Einstieg kurze Vorstellungsrunde Umgang mit Mehrsprachigkeit Mythen und Fakten über Mehrsprachigkeit Umsetzungsmethoden der Mehrsprachigkeit/Wege zur Mehrsprachigkeit Die Funktion der Kita
Vorhaben heute Einstieg kurze Vorstellungsrunde Umgang mit Mehrsprachigkeit Mythen und Fakten über Mehrsprachigkeit Umsetzungsmethoden der Mehrsprachigkeit/Wege zur Mehrsprachigkeit Die Funktion der Kita
Theorien des Erstspracherwerbs
 Goethe Universität Frankfurt am Main Institut für Psycholinguistik und Didaktik der deutschen Sprache Seminar: Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen Dozentin: Frau Rebecca Schuler Theorien des Erstspracherwerbs
Goethe Universität Frankfurt am Main Institut für Psycholinguistik und Didaktik der deutschen Sprache Seminar: Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen Dozentin: Frau Rebecca Schuler Theorien des Erstspracherwerbs
