ZÜRCHER HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN DEPARTEMENT LIFE SCIENCES UND FACILITY MANAGEMENT INSTITUT FÜR UMWELT UND NATÜRLICHE RESSOURCEN
|
|
|
- Paul Linden
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Anhang B ZÜRCHER HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN DEPARTEMENT LIFE SCIENCES UND FACILITY MANAGEMENT INSTITUT FÜR UMWELT UND NATÜRLICHE RESSOURCEN Lebensraumanalyse für Hermelin (Mustela erminea ), Mauswiesel (Mustela nivalis ) und Iltis (Mustela putorius ) am Zimmerberg Tutorial 2 von Nils Ratnaweera Masterstudiengang Life Sciences 2014 Abgabedatum: Korrektoren: Dr. Roland Felix Graf Leitung Forschungsgruppe Wildtiermanagement ZHAW Life Sciences und Facility Management, Schloss, 8820 Wädenswil Stefan Suter Wissenschaftliche Mitarbeiter Forschungsgruppe Wildtiermanagement ZHAW Life Sciences und Facility Management, Schloss, 8820 Wädenswil
2 Impressum Zitiervorschlag Ratnaweera, N. (2015): Lebensraumanalyse für Hermelin (Mustela erminea), Mauswiesel (Mustela nivalis) und Iltis (Mustela putorius) am Zimmerberg. Projektarbeit. Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW, Wädenswil. Autor Nils Ratnaweera Eichmüli Wädenswil Titelbild Hermelin (Mustela erminea) in Kilchberg. Bild: S. Heusser (Wiesel & Co am Zimmerberg), 2014
3 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 2 Vorgehen 1 3 Geodatengrundlage 5 4 Resultate 7 5 Diskussion 7 Literaturverzeichnis 14 Abbildungsverzeichnis 15 Tabellenverzeichnis 16
4 1 Einleitung Die Mauswiesel- und Hermelinbestände (Mustela nivalis und M. erminea) scheinen seit den 1960er Jahren im intensiv genutzten, Schweizer Mittelland rückläug zu sein. An einigen Orten sind sie wahrscheinlich sogar verschwunden (Müri, 2012a,b) und auch der Iltis (M. putorius) ist im Rückgang begrien (Nägeli, 2014). Das Mauswiesel ist auf der Roten Liste der gefährdeten Tierarten der Schweiz (Duelli, 1994) und gehört zusammen mit dem Iltis zu den National prioritären Arten (BAFU, 2011). Um die Populationen dieser Tierarten langfristig zu stärken und erhalten, entwickelte die Stiftung Wieselnetz ein Förderkonzept (siehe Müri, 2012b). Nach diesem Vorbild realisierte der Naturschutzverein Schönenberg bereits 2009 erfolgreich ein Wieselförderprojekt auf ihrem Gemeindegebiet. Das Projekt Wiesel & Co am Zimmerberg das Ziel, den Erfolg des schönenberger Wieselprojektes auf den gesamten Bezirksperimeter Horgen auszuweiten und setzt sich für die Aufwertung und Erweiterung von Lebensräumen für die Tierarten Hermelin (Mustela erminea), Mauswiesel (Mustela nivalis) und Iltis (Mustela putorius) ein. Das Projekt wird in zwei Etappen durchgeführt: Die erste Etappe bildet die konzeptionelle Phase wo die Grundlagen für die Phase zwei - die Umsetzung - erarbeitet werden. Die vorliegende Lebensraumanalyse bildet ein Bestandteil der ersten Etappe. Der Ziel der Lebensanalyse besteht darin, für die drei Tierarten potentielle Kerngebiete und sogenannte Patches (Inselbiotope) zu erkennen. Darauf aufbauend kann in einem weiteren Schritt eine sinvolle Strategie für die Förderung der drei Tierarten entwickelt werden. 2 Vorgehen 2.1 Methodenwahl Für eine geobasierte Analyse eines Lebensraumes einer Tierart werden grundsätzlich zwei verschiedene Herangehensweisen unterschieden: Der assoziative Ansatz (associative based approach) sowie der Prozess-basierte Ansatz (process based approach). Im assoziativem Ansatz wird die Verbreitung einer Art ausschliesslich auf das Vorhandensein bzw. Fehlen spezischen Landschaftselementen reduziert. Im Prozess-basiertem Ansatz wird versucht die Schlüsselprozesse Geburt, Dispersal und Tod in der Landschaft zu simulieren und dadurch die Verbreitung abzuleiten (Gough & Rushton, 2000). Der assoziative Ansatz ist nach Gough & Rushton (2000) für Habitatgeneralisten wie Wiesel und Hermelin sowie für Arten mit einem grossen Raumbedarf wie der Iltis nicht optimal. Für ein Prozess-basiertes Modell fehlen für die Tierarten jedoch grundlegende Kenntnisse, insbesondere über das Verhalten im Dispersal (Gough & Rushton, 2000). Aus diesem Grund muss auf einen assoziativen Ansatz zurückgegrien werden. Bei Modellen mit dem assoziativem Ansatz können wiederum in zwei unterschiedliche Modelltypen unterschieden werden: Expertenmodelle sowie statistische Modelle. Bei Expertenmodellen werden Landschaftselemente aufgrund ihrer Habitateignung in Klassen unterteilt und gewichtet (Beier et al., 2007). Dieser Prozess basiert auf dem Wissen vorhandener Literatur und/oder Expertenmeinung. Im zweiten Verfahren werden Präsenz- und falls vorhanden Absenzdaten genutzt, um in einem statistischen Verfahren signikante Zusammenhänge mit Landschaftsattributen zu 1
5 eruieren (Beier et al., 2007). Diese Zusammenhänge werden mathematisch festgehalten auf weitere Gebiete zu extrapoliert. Statistische Modelle sind auf eine grosse Menge an Daten in hoher Qualität angewiesen. Solche Daten sind für die in Frage kommenden Tierarten nicht vorhanden, da die Habitatnutzung von Musteliden bisher nur für wenige Arten über eine kurze Zeitspanne mit wenigen Individuen untersucht worden ist (Gough & Rushton, 2000). Die endgültige Wahl fällt somit auf die Umsetzung eines Expertenmodells. Im nachstehenden Kapitel (Umsetzung) wird in 4 Schritten die Erstellung des Habitatmodells beschrieben: 1. Wahl der Parameter 2. Kategorisierung der Geodaten 3. Gewichtung der Daten und Nachbarschaftsanalyse 4. Interpretation Die 4 Schritte bauen zwar aufeinander auf, sie sind jedoch als iterativ zu verstehen. Bei der Bearbeitung der Daten werden Annahmen getroen, die nicht immer auf Literaturwerte gestützt werden können. Erst eine Überprüfung des Endprodukes zeigt, ob die getroenen Annahmen eine sinnvolles Resultat ergibt. 2.2 Umsetzung Wahl der Parameter Zahlreiche biotische und abiotische Faktoren beeinussen die Verbreitung einer Art in der Landschaft. Es ist kaum möglich, alle Komponenten einer ökologischen Nische zu beschreiben und in eine GIS zu integrieren. Es ist deshalb notwendig, eine vereinfachte Darstellung (d.h. ein Modell) der ökologischen Nische zu erstellen indem die wichtigsten Faktoren erkannt werden (Gough & Rushton, 2000). Für Musteliden werden drei Faktoren als besonders relevant erachtet (Gough & Rushton, 2000): Kleinstrukturen bieten Musteliden den nötigen Schutz vor Prädatoren. Exponierte Flächen werden gemieden (Gough & Rushton, 2000). Ruhe- und Aufzuchtsplätze bieten Schutz vor Prädatoren und vor Kälte. Die langen, dünnen Körper der Musteliden erweisen sich als thermisch ungünstig (Gough & Rushton, 2000). Das Fehlen von geeigneten Ruhe- und Aufzuchtsplätzen gilt als limitierender Faktor bei der Verbreitung und Häugkeit von Iltissen (Weber, 1989). Nahrungsangebot gilt ebenfalls als wichtiger Faktor bei Musteliden. Die starke Korrelation zwischen Verbreitung und Dichte von Wiesel und Wühlmausen wurde von zahlreichen Autoren festgestellt (Oksanen et al., 1992). Auch für Iltisse konnte dieser Zusammenhang festgestellt werden (Lodé, 1994). 2
6 Als Deckung können bereits sehr kleine Strukturen wie Krautsäume, Gräben oder Gebüschgruppen ausreichen. Die Geodatengrundlage ist in Bezug auf solche Strukuren unzureichend. Auch die Datengrundlage in Bezug auf die Ruche- und Aufzuchtsplätze ist nur spärlich. Aus diesem Grund beschränkt sich die die vorliegende Lebensraumanalyse auf die Bewertung der Landschaft in Bezug auf das Nahrungsangebot für die oben genannten Tierarten. Das Vernachlässigen der Komponente Deckung muss für die Interpretation der Resultate berücksichtgt werden Kategorisierung der Geodaten Die verfügbaren Geodaten werden aufgrund der zu erwartenden Verfügbarkeit an Beutetieren in 5 Kategorien (0-4) unterteilt. 0. keine Nahrung zu erwarten 1. geringe Nachrungsverfügbarkeit 2. mässige Nahrungsverfügbarkeit 3. ausreichende Nahrungsverfügbarkeit 4. hohe Nahrungsverfügbarkeit Die eektive Bewertung der Geodaten ist in Anhang I ersichtlich. Die Geodaten wurden für jede Tierart individuell bewertet da sich die Beutewahl teilweise unterscheidet. Die Bewertung basiert auf den Erkenntnissen der Literaturrecherche, die bereits im Vorfeld getätigt wurde (Ratnaweera, 2014, unveröentlicht). Die verfügbaren Geodaten stammen aus unterschiedlicher Herkunft und überlagern sich teilweise. Dies trit vor allem auf die Daten aus kommunaler Stufe (Daten von der Gemeinde, aus Vernetzungsprojekt usw.) zu. Sie überlagert sich mit den Daten des Kantons (Fachstelle Naturschutz) und des Bundes (Bundesamt für Topograe, Bundesamt für Umwelt). Diese Mehrspurigkeit entsteht dadurch, dass auf der Kantons- und Bundesebene zwar ächendeckend Geodaten vorhanden sind, die Genauigkeit der Daten teilweise aber ungenügend ist. Die Daten aus kommunaler Stufe sind nicht ächendeckend vorhanden, liefern dafür punktuell wertvolle Informationen in Bezug auf die Verfügbarkeit an Deckung und Nahrung. Die Bewertung in die beschriebenen 5 Kategorien wird so vorgenommen, dass ungenaue Daten konservativ bzw. vorsichtig und genaue Daten möglichst realitätsnah eingestuft werden. Bei sich überlagernden Daten wird deshalb davon ausgegangen, dass die jeweils höchste Bewertung für eine bestimmte Rasterzelle die Präziseste darstellt. Für Flächen die einem rechtlichen Schutz unterliegen, wie beispielsweise einer Schutzverordnung, wird die Bewertung um 0.5 erhöht. Theoretisch könnte ein solcher Schutz für alle Kategorien bestehen, faktisch besteht er aber nur für Lebensraumtypen ab der Kategorie 3, die Kategorien 0.5, 1.5 und 2.5 existieren somit nicht Gewichtung der Daten und Nachbarschaftsanalyse Das Resultat aus der Beurteilung der Geodaten gemäss Anhang I entspricht einer detaillierten Darstellung der verfügbaren Jagdreviere. Eine Interpretation der Daten über den gesamten Perimeter ist jedoch schwierig, da grössere Ansammlungen von wertvollem Habitaten (Hotspots) 3
7 kaum erkannt werden können. Um dies zu ermöglichen, wird in einem nächsten Schritt eine Nachbarschaftsanalyse durchgeführt. In einer Nachbarschaftsanalyse wird, ausgehend von einem Punkt, in einem denierten Umkreis analysiert, wie wertvoll die benachbarten Rasterzellen sind. Der entsprechende Wert ergibt die Bewertung für den Kreismittelpunkt. Für eine Bewertung eignen sich die Ziern der Kateogorien nicht, da diese Ziern das Wertverhältnis der verschiedenen Landschaftstypen nicht korrekt wiederspiegeln. Aus diesem Grund müssen die Kategorien vorgängig bewertet bzw. gewichtet werden. Die Gewichtung der Kategorien erfolgt anhand eines Abgleichs bekannter Habitate sowie die Betrachtung ungeeigneter Habitate. Daraus geht hervor, dass der Wert einer Kategorie als die 3. Potenz ihrer Zier (0-4.5) betrachtet werden kann. Diese Bewertung ist in Abbildung 1 visualisiert. Abbildung 1: Die Wertung der einzelnen Kategorien (x-achse) für die Nachbarschaftsanalyse. Der Werte auf der y-achse entspricht der (gerundeten) dritten Potenz der Kategorienzier. Nun kann die Nachbarschaftsanalyse durchgeführt und pro Rasterzelle in einem Umkreis die gewichteten Rasterzellen summiert werden. Die Grösse des Kreises, welcher für diese Nachbarschaftsanalyse verwendet wird, hängt mit dem Aktionsradius der Tierart zusammen. Je mobiler die Tierart desto grösser der berücksichtigte Umkreis. In der vorliegenden Nachbarschaftsanalyse wird für das Hermelin ein Radius von 178 m, für das Mauswiesel 126 m und für den Iltis 282 m verwendet. Diese Radien ergeben Flächen, die sich an der durchschnittlichen Streifgebietsgrösse der jeweiligen Tierart orientiert (10, 5 und 25 ha) Interpretation Die Summe der gewichteten Werte (gem. Abbildung 1) der in diesem Umkreis liegenden Rasterzellen wird der Rasterzelle im Kreismittelpunkt zugewiesen. Die so entstehende Bewertung der Landschaft ergibt eine beinahe stufenlose Einteilung des gesamten Perimeters. Um das entstandene Resultat interpretieren zu können, müssen Kategorien gebildet werden. Die Schwellwerte dieser Kategorien können mit unterschiedlichen Methoden deniert werden: Mit xen Intervallen, 4
8 Quantilen, Standartabweichungen, verschiedenen Algorithmen und anderen Methoden. Anhand einer Betrachtung bekannter Wieselhabitate wird der Jenks-Capall-Algorithmus verwendet um jeweils 5 Kategorien zu bilden. Dieser Algorithmus ist ein Verfahren zur automatischen Klassizierung von Werten anhand von natürlichen Unstetigkeiten. Es wird versucht, die Unterschiede innerhalb einer Klasse zu minimieren und die Unterschiede zwischen den Klassen zu maximieren (Jenks & Caspall, 1971). Diese Methode entspricht einer datenspezischen Klassierung und erlaubt keinen Vergleich zwischen Karten unterschiedlicher Datenherkunft (de Smith et al., 2007). 3 Geodatengrundlage Als Datengrundlage für die im letzten Kapitel beschriebene Lebensraumanalyse stammt aus unterschiedlichen Quellen. Im nachstehenden Kapitel werden diese Daten beschrieben. Eine Auflistung der verwendeten Geodaten bendet sich in Tabelle 1 Bezirksübergreifend und lückenlos vorhanden sind die Daten vom Bundesamt für Landestopograe (swisstopo). Das mittlerweile überholte Landschaftsmodell Vector25 besitzt im Vergleich zu seinem Nachfolger (swisstlm3d) einen entscheidenden Vorteil: Vector25 Daten sind ächendeckend vorhanden und weisen keine Überlagerungen auf. Dieser Umstand erlaubt es, eine erste grobe und lückenlose Beurteilung des gesamten Perimeters zu machen. Da die Daten von swisstlm3d aktueller sind, werden diese in dieser ersten Beurteilung mitberücksichtigt. Ebenfalls mitberücksichtigt sind die Lebensrauminventare von Nationaler Bedeutung des Bundesamtes für Umwelt: Das Inventar der Amphibienlaichgebiete, der Auengebiete, der Hoch- und Übergangsmoore, der Flachmoore sowie der Moorlandschaften. Zudem auch die Fliessgewässerabschnitte mit hoher Artenvielfalt oder national prioritären Arten. Folgende Daten von der Fachstelle Naturschutz wurden implementiert: Amphibienzugestellen, Feuchtgebietsinventar, Schutzverordnungen, lichte Wälder, Findlinge und Naturschutzobekte (bestehend aus Trockenwiesen und -weiden, Hoch-, Flach- und Übergangsmoore, Amphibienlaichgebiete u.a.). Die Daten von Bund und Kanton können als Basis für das Habitatmodell angesehen werden, denn sie sind ächendecken und in gleicher Qualität über den gesamten Untersuchungsperimeter vorhanden. Ihre Aussagekraft ist stellenweise aber unzureichend, denn sie beinhalten zwei wesentliche Komponenten nicht: Die landwirtschaftliche Nutzungsart und die kommunalen Naturschutzgebiete. Diese Daten mussten über verschiedenste Kanäle zusammengestellt werden, namentlich Vernetzungsprojekt- und Ackerbaustellenleiter, LEK Kommissionen, Ökobüros und kommunale Behören. Aufgrund der unterschiedlichen Datenherkunft ist die Datenqualität unterschiedlich hoch, dennoch erhöhen diese Daten die Präzision und Aussagekraft des Habitatmodells wesentlich da sie den Detaillierungsgrad der Datenrundlage verbessert. Diese Daten werden an dieser Stelle nicht weiter beschrieben, sie sind aber in Tabelle 1 aufgelistet. 5
9 Tabelle 1: Datenherkuft sämtlicher Geodaten. Die Lizenz für die Geodaten von c swisstopo: (DV084370). Ausdehnung Datenherr Dateiname Stand Datentyp Schweiz swisstlm3d Shapefile Bundesamt für pri25_a_clip.shp 2008 Shapefile Landestopografie Vector200 Herbst 2006 Raster (swisstopo) swissboundries3d Shapefile Bundesinventar der Auen von nat. Bed Shapefile Schweiz Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nat. Bed Shapefile Bundesamt für Umwelt Bundesinventar der Flachmoore von nat. Bed Shapefile (BAFU) Bundesinventar der Hochmoore von nat. Bed Shapefile Fliessgew.abschnitte mit hoher Artenvielfalt / nat. prio. Arten 2013 Shapefile Amphibienzugstellen und -schutzanlagen Shapefile Überkom. Naturschutzobj. und schützenswerte Gebiete im Kt. ZH Shapefile Kt. Zürich Feuchtgebietsinventar Shapefile Fachstelle Naturschutz Inv. der geologischen und geomorphologischen Objekte des Kt. ZH Shapefile (FNS) Lichte Wälder Kanton Zürich Shapefile Lebensraum- und Vegetationskartierungen Shapefile SVO über Natur- und Landschaftsschutzgeb. von überkomm. Bed Shapefile Stadt Adliswil Pflegeplan - internes Arbeitsinstrument 1:5' Druck Adliswil S. Heusser / S. Keller Naturnahe Flächen Winter 2014/15 Mündlich J. Läng Extensiv genutzte Flächen in Adliswil Tabelle Hirzel Gemeinde Hirzel Oekoflächenplan Herbst 2011 Druck Horgen Wädenswil Schlitner Landschaftsplanung (SLP) Schlitner Landschaftsplanung Kommunales Inventar Shapefile Kommunales Inventar - Erratische Blöcke Shapefile Kommunales Inventar - Polygone Shapefile Hecken und Feldgehölze (ÖAF)? Shapefile Hochstammfeldobstbäume 2008 Shapefile Hochstammfeldobstbäume 2010 Shapefile Kleinstrukturen? Shapefile Ökologische Ausgleichsflächen 2008 Shapefile Altgrasstreifen Shapefile Ausdohlung Shapefile Stadt Wädenswil Ried- und Nassstandorte 1982 Druck Hütten Gemeinde Hütten Kommunales Inventar der Natur- und Landschaftsschutzobjekte Druck SLP Ökologische Ausgleichsflächen? Shapefile Kilchberg S. Heusser / S. Keller Ökologische Ausgleichsflächen Winter 2014/15 Mündlich Langnau a. A. Naturschutzinventar Shapefile Extensive Wiesen Dez 14 Mündlich Oberrieden H. Amsler / S. Keller Ufergehölz Dez 14 Mündlich Hochstamm Obstanlagen Dez 14 Mündlich Streuflächen Dez 14 Mündlich Ökologische Ausgleichsflächen Shapefile Richterswil Quadra GmbH Ökologische Ausgleichsflächen Shapefile Kommunales Schutzinventar Shapefile Rüeschlikon Quadra GmbH Vernetzungsgebiete Apr 14 Shapefile Schönenberg Gemeinde Schönenberg Ökoflächenplan Herbst 2011 Druck Thalwil B. Gabriel / S. Keller Schützenswürdige Objekte Winter 2014/15 Mündlich Keusch Ökologische Ausgleichsflächen Dez 14 Mündlich 6
10 4 Resultate Die Lebensraumanalyse wird in Form von Habitateignungskarten dargestellt, für jede Tierart eine eigene Karte (Abbildungen 2, 3 und 4). Für eine bessere Übersicht werden von den 5 Kategorien jeweils nur die zwei höchsten Kategorien eingefärbt, die restlichen drei Kategorien werden nicht angezeigt. 5 Diskussion Für wissenschaftliche verizierung des Habitatmodells wäre eine aufwendige Feldstudie mittels Foto- und Spurenfallen nötig. Bisher wurde keine solche Studie durchgeführt, es sind aber Beobachtungsmeldungen aus der Bevölkerung verfügbar (siehe Anhang II). Diese Meldungen eignen sich nur bedingt für eine Verizierung: Die Daten wurden weder ächendeckend noch nach wissenschaftlichen Methoden erhoben. Da zu diesem Zeitpunkt aber keine anderen Daten zur Verfügung stehen, werden diese Beobachtungsmeldungen verwendet. Die Daten stammen einerseits von einem Aufruf vom Naturschutzverein Schönenberg 2009 und andererseits von einer Aktion vom Projekt Wiesel & Co am Zimmerberg Von den drei Tierarten sind lediglich für das Hermelin genügend gesicherte Meldungen verfügbar um einen Vergleich mit dem Habitatmodell machen zu können (n = 212). Es wird angenommen, dass das Habitatmodell die Beobachtungswahrscheinlichkeit eines Hermelins wiederspiegelt. In diesem Sinne: Je höher die Kategorie, desto wahrscheinlicher eine Hermelin- Beobachtung. In Abbildung 5 ist die relative Häugkeit der Beobachtungen innerhalb der 5 Kategorien dargestellt. Es ist ersichtlich, dass in der Kategorie 2 am häugsten Hermeline beobachtet wurde. Diese Tatsache scheint die formulierte Annahme, je höher die Kategorie desto höher die die Beobachtungswahrscheinlichtkeit, zu wiederlegen. Diese Darstellung ist aber nur bedingt aussagekräftig da die relativen Flächenanteilen der 5 Kategorien nicht berücksichtigt werden. Die Flächenanteile sind unterschiedlich hoch und entsprechen (in %) 21, 25, 36, 13 und 4 für die Kategorien 0-4. Werden die Beobachtungen mit den relativen Flächenanteilen dividiert und die Summe aller Beobachtungen weiterhin als 100 % betrachtet, ergibt sich ein anderes Bild: In Abbildung 6 ist eine positive Korrelation zwischen Kategorie und Beobachtungswahrscheinilchkeit erkennbar. Dieser Umstand spricht für die Korrektheit des Habitatmodells und bestätigt die oben getroene Annahme. 7
11 Abbildung 2: Die Lebensraumanalyse für die Tierart Hermelin. Die am höchsten bewerteten Habitate liegen im Süden des Bezirkes, insbesondere in den Gemeinde Hirzel und Schönenberg. Diese, wie auch die umliegenden Gemeinden Horgen, Wädenswil, Richterswil und Hütten weisen weitläuge Landwirtschaftächen auf, welche für das Hermelin von hoher Bedeutung sind. Massstab: 1:100'000. Geodaten c swisstopo (DV084370) 8
12 Abbildung 3: Die Lebensraumanalyse für die Tierart Mauswiesel. Da diese Tierart auch in Wälder vorkommen kann, liegen weitläuge Habitate im Sihlwald sowie Langenberg (bei Langnau a.a.). Weitere Habitate liegen Nordöstlich von der Siedlung Hirzel und um den Aabach (bei Arn). Massstab: 1:100'000. Geodaten c swisstopo (DV084370) 9
13 Abbildung 4: Die Lebensraumanalyse für die Tierart Iltis. Ähnlich wie das Mauswiesel kommt der Iltis ebenfalls im Wald vor, so wird auch hier der Sihlwald als ein hochwertiges Habitat bewertet. Die hohe Wertung der Sihl, des Aabachs und des Mülitobels wiederspiegelt die stärkere Abhängigkeit an Feuchtgebiete und Gewässer. Massstab: 1:100'000. Geodaten c swisstopo (DV084370) 10
14 Abbildung 5: Die relative Häugkeit der Hermelin-Beobachtungen in Relation zum absoluten Flächenanteil der jeweiligen Kategorie (n = 212, = 1) Abbildung 6: Die relative Häugkeit der Hermelin-Beobachtungen im Verhältnis zum relativen Flächenanteil der jeweiligen Kategorie (n = 212, = 1). 11
15 Anhang Anhang I Tabelle 2: Bewertung der Geodaten anhand der Kategorien 0 bis 4. Die kursiv gedruckten Zeilen werden Prioritär behandelt, d.h. bei sich überlagernden Daten gilt diese Wertung vorrangig. Zusammenfassung1 Hermelin Mauswiesel Iltis Ast- und Streuhaufen Buntbrache / Saum Gehölz Altgras Rebächen Feuchtgebiet Obstgarten Extensive Grünächen Waldrand Parkanlage Amphibienobjekten Lichter Wald Fliesgewässer Puer Obstanlage Wald Einzelbaum Steinstrukturen Übriges Gebiet Magerwiesen / -weiden Felsstruktur Siedlung Ruderal- und Kiesächen Dachs- / Fuchsbau Fluss Gebäude Hartbelag See Anhang II (auf nachfolgender Seite) 12
16 Abbildung 7: Die Lebensraumanalyse für die Tierart Hermelin mit den Beobachtungsmeldung der selben Tierart. Massstab: 1:100'000. Geodaten c swisstopo (DV084370) 13
17 Literatur Beier, P., Majka, D. & Jenness, J. (2007): Conceptual steps for designing wildlife corridors. Bundesamt für Umwelt (BAFU) (2011): Liste der National Prioritären Arten. Arten mit nationaler Priorität für die Erhaltung und Förderung. Bundesamt für Umwelt (BAFU). de Smith, M., Goodchild, M. F. & Longley, P. A. (2007): Geospatial Analysis - A Comprehensive Guide. Matador, Leicester, UK. Duelli, P. [Hrsg.] (1994): Rote Listen der gefährdeten Tierarten der Schweiz. Bundesamt für Umwelt (BAFU). Gough, M. C. & Rushton, S. P. (2000): The application of GIS-modelling to mustelid landscape ecology. In: Mammal Review, 30, 3-4: Jenks, G. F. & Caspall, F. C. (1971): Error on Choroplethic Maps: Denition, Measurement, Reduction. In: Annals of the Association of American Geographers, 61, 2: Lodé, T. (1994): Environmental factors inuencing habitat exploitation by the Polecat Mustela putorius in western France. In: Journal of Zoology, 234, 1: Müri, H. (2012a): Konzept zur Wieselförderung. In: WildInfo - Schweizerisches wildtierbiologisches Informationsblatt, 4: 12. Müri, H. (2012b): Wieselförderung - Ein Konzept zur Stärkung der Wieselpopulationen im Mittelland. Stiftung WIN Wieselnetz. Nägeli, S. (2014): Kleinraubtiere: Heimliche Verfechter einer naturnahen KultNOurlandschaft. In: Magazin Umweltdes Bundesamtes für Umwelt (BAFU), 1: Oksanen, L., Oksanen, T. & Norberg, M. (1992): Habitat use of small mustelids in north Fennoscandian tundra: a test of the hypothesis of patchy exploitation ecosystems. In: Ecography, 15, 2: Ratnaweera, N. (2014): Auf wertung und Vernetzung von bestehenden Habitaten für Iltis, Mauswiesel und Hermelin. Eine Zusammenstellung des aktuellen Wissensstandes. Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW. Weber, D. (1989): The ecological signicance of resting sites and seasonal habitat change in Polecats Mustela putorius. In: Journal of Zoology, 217, 4:
18 Abbildungsverzeichnis 1 Die Wertung der einzelnen Kategorien (x-achse) für die Nachbarschaftsanalyse. Der Werte auf der y-achse entspricht der (gerundeten) dritten Potenz der Kategorienzier Die Lebensraumanalyse für die Tierart Hermelin. Die am höchsten bewerteten Habitate liegen im Süden des Bezirkes, insbesondere in den Gemeinde Hirzel und Schönenberg. Diese, wie auch die umliegenden Gemeinden Horgen, Wädenswil, Richterswil und Hütten weisen weitläuge Landwirtschaftächen auf, welche für das Hermelin von hoher Bedeutung sind. Massstab: 1:100'000. Geodaten c swisstopo (DV084370) Die Lebensraumanalyse für die Tierart Mauswiesel. Da diese Tierart auch in Wälder vorkommen kann, liegen weitläuge Habitate im Sihlwald sowie Langenberg (bei Langnau a.a.). Weitere Habitate liegen Nordöstlich von der Siedlung Hirzel und um den Aabach (bei Arn). Massstab: 1:100'000. Geodaten c swisstopo (DV084370) Die Lebensraumanalyse für die Tierart Iltis. Ähnlich wie das Mauswiesel kommt der Iltis ebenfalls im Wald vor, so wird auch hier der Sihlwald als ein hochwertiges Habitat bewertet. Die hohe Wertung der Sihl, des Aabachs und des Mülitobels wiederspiegelt die stärkere Abhängigkeit an Feuchtgebiete und Gewässer. Massstab: 1:100'000. Geodaten c swisstopo (DV084370) Die relative Häugkeit der Hermelin-Beobachtungen in Relation zum absoluten Flächenanteil der jeweiligen Kategorie (n = 212, = 1) Die relative Häugkeit der Hermelin-Beobachtungen im Verhältnis zum relativen Flächenanteil der jeweiligen Kategorie (n = 212, = 1) Die Lebensraumanalyse für die Tierart Hermelin mit den Beobachtungsmeldung der selben Tierart. Massstab: 1:100'000. Geodaten c swisstopo (DV084370)
19 Tabellenverzeichnis 1 Datenherkuft sämtlicher Geodaten. Die Lizenz für die Geodaten von c swisstopo: (DV084370) Bewertung der Geodaten anhand der Kategorien 0 bis 4. Die kursiv gedruckten Zeilen werden Prioritär behandelt, d.h. bei sich überlagernden Daten gilt diese Wertung vorrangig
Dateiname auf Folienmaster 1
 Ökologischen Infrastruktur: Diemtigtal / Gantrisch / Mittelland Ökologische Infrastruktur: Ansätze und Erfahrungen - in den Pärken - im Projekt ÖI Mittelland Christian Hedinger, UNA (ARGE UNA / Hintermann
Ökologischen Infrastruktur: Diemtigtal / Gantrisch / Mittelland Ökologische Infrastruktur: Ansätze und Erfahrungen - in den Pärken - im Projekt ÖI Mittelland Christian Hedinger, UNA (ARGE UNA / Hintermann
Mit Vielfalt punkten. Bauern beleben die Natur. Medienorientierung 19. Mai Sperrfrist: Uhr
 Medienorientierung 19. Mai 2011 Sperrfrist: 19.5.2011 12.00 Uhr Mit Vielfalt punkten Bauern beleben die Natur Ein Projekt des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) und der Schweizerischen
Medienorientierung 19. Mai 2011 Sperrfrist: 19.5.2011 12.00 Uhr Mit Vielfalt punkten Bauern beleben die Natur Ein Projekt des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) und der Schweizerischen
Forstrevier Schauenburg. Waldrandpflegekonzept. gemäss Anhang Betriebsplan Forstrevier Schauenburg
 Forstrevier Schauenburg Waldrandpflegekonzept gemäss Anhang Betriebsplan Forstrevier Schauenburg Im Auftrag des Forstrevier Schauenburg erarbeitet durch: Raphael Häner, Guaraci. raphael.haener@guaraci.ch
Forstrevier Schauenburg Waldrandpflegekonzept gemäss Anhang Betriebsplan Forstrevier Schauenburg Im Auftrag des Forstrevier Schauenburg erarbeitet durch: Raphael Häner, Guaraci. raphael.haener@guaraci.ch
Geoportal des Kantons Bern
 Richtplan-Informationssystem des Kantons Bern Kartenherr: Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern Stand: 20.07.2017 Quellen- / Grundlagenvermerk Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von
Richtplan-Informationssystem des Kantons Bern Kartenherr: Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern Stand: 20.07.2017 Quellen- / Grundlagenvermerk Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von
Auf dem Weg zum naturnahen Zustand? Herausforderungen und Chancen bei der Umsetzung des revidierten Gewässerschutzgesetzes
 Annina Joost Auf dem Weg zum naturnahen Zustand? Herausforderungen und Chancen bei der Umsetzung des revidierten Gewässerschutzgesetzes Bachelorarbeit Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich
Annina Joost Auf dem Weg zum naturnahen Zustand? Herausforderungen und Chancen bei der Umsetzung des revidierten Gewässerschutzgesetzes Bachelorarbeit Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich
Teil 2: Auswertung der Projektuntergruppe im Auftrag der deutsch schweizerischen Arbeitsgruppe Flughafen Zürich
 Teil 2: Auswertung der Projektuntergruppe im Auftrag der deutsch schweizerischen Arbeitsgruppe Flughafen Zürich a) Zusätzliche Lärmbelastungskarten - Dokumentation zu den Karten - Karte 1: Wolkendarstellung
Teil 2: Auswertung der Projektuntergruppe im Auftrag der deutsch schweizerischen Arbeitsgruppe Flughafen Zürich a) Zusätzliche Lärmbelastungskarten - Dokumentation zu den Karten - Karte 1: Wolkendarstellung
Melde- und bewilligungspflichtige Veranstaltungen gemäss Waldgesetz - Merkblatt Schutzgebiete im Geoportal
 Kanton St.Gallen Volkswirtschaftsdepartement Kantonsforstamt St.Gallen, August 2016 Melde- und bewilligungspflichtige Veranstaltungen gemäss Waldgesetz - Merkblatt Schutzgebiete im Geoportal Die Melde-
Kanton St.Gallen Volkswirtschaftsdepartement Kantonsforstamt St.Gallen, August 2016 Melde- und bewilligungspflichtige Veranstaltungen gemäss Waldgesetz - Merkblatt Schutzgebiete im Geoportal Die Melde-
Quell-Lebensräume: Bedeutung aus nationaler Sicht und aktuelle Projekte des Bundes
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Arten, Ökosysteme, Landschaften Quell-Lebensräume: Bedeutung aus nationaler Sicht und
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Arten, Ökosysteme, Landschaften Quell-Lebensräume: Bedeutung aus nationaler Sicht und
Kriterienkatalog 2016
 Kanton St.Gallen Amt für Umwelt und Energie Kriterienkatalog 2016 Evaluation von neuen Deponiestandorten zur Aufnahme in den Richtplan Impressum Herausgeber Amt für Umwelt und Energie (AFU) Lämmlisbrunnenstrasse
Kanton St.Gallen Amt für Umwelt und Energie Kriterienkatalog 2016 Evaluation von neuen Deponiestandorten zur Aufnahme in den Richtplan Impressum Herausgeber Amt für Umwelt und Energie (AFU) Lämmlisbrunnenstrasse
Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Artenmanagement Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung Datenherr:
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Artenmanagement Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung Datenherr:
Inventar der schützenswerten Naturobjekte (Naturinventar)
 Inventar der schützenswerten Naturobjekte (Naturinventar) GeoForum BS 3. Mai 2012 Yvonne Reisner Claudia Farrèr Kanton Basel-Stadt Stadtgärtnerei - Fachbereich Natur Landschaft Bäume 1 Inhalt 1. Ziel des
Inventar der schützenswerten Naturobjekte (Naturinventar) GeoForum BS 3. Mai 2012 Yvonne Reisner Claudia Farrèr Kanton Basel-Stadt Stadtgärtnerei - Fachbereich Natur Landschaft Bäume 1 Inhalt 1. Ziel des
Richtlinien für ÖQV-Qualitätsbeiträge
 Departement Volkswirtschaft und Inneres Richtlinien für ÖQV-Qualitätsbeiträge auf der Grundlage der Verordnung über die regionale Förderung der Qualität und der Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen
Departement Volkswirtschaft und Inneres Richtlinien für ÖQV-Qualitätsbeiträge auf der Grundlage der Verordnung über die regionale Förderung der Qualität und der Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen
Landschaft und Windturbinen. Ein Vorgehen für die gesamte Schweiz Yves Leuzinger / bureau Natura
 Landschaft und Windturbinen Ein Vorgehen für die gesamte Schweiz Yves Leuzinger / bureau Natura Landschaft - Begriffsdefinition Die Landschaft bildet die heutigen wie die früheren Beziehungen zwischen
Landschaft und Windturbinen Ein Vorgehen für die gesamte Schweiz Yves Leuzinger / bureau Natura Landschaft - Begriffsdefinition Die Landschaft bildet die heutigen wie die früheren Beziehungen zwischen
Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD Bundesamt für Landwirtschaft BLW. Ökologische Vernetzung in der Landwirtschaft
 Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD Bundesamt für Landwirtschaft BLW Ökologische Vernetzung in der Landwirtschaft Entstehung Neuorientierung der Agrarpolitik 1992 Anreiz für besondere ökologische
Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD Bundesamt für Landwirtschaft BLW Ökologische Vernetzung in der Landwirtschaft Entstehung Neuorientierung der Agrarpolitik 1992 Anreiz für besondere ökologische
Welche Weiher für Amphibien?
 Welche Weiher für Amphibien? Benedikt Schmidt karch benedikt.schmidt@unine.ch Weiher für Amphibien. Weiher für Amphibien bauen hat Tradition ( Biotop ). Das ist gut. Aber warum braucht es Weiher? Und welche?
Welche Weiher für Amphibien? Benedikt Schmidt karch benedikt.schmidt@unine.ch Weiher für Amphibien. Weiher für Amphibien bauen hat Tradition ( Biotop ). Das ist gut. Aber warum braucht es Weiher? Und welche?
Kantonaler Richtplan - Koordinationsblatt
 Kantonaler Richtplan - Koordinationsblatt Natur, Landschaft und Wald Natur- und Landschaftsschutzzonen auf Stufe Gemeinde Stand: 23.11.1999 Siehe auch Blätter Nr. D.4 / F.1 / F.6 / F.10 Instanzen zuständig
Kantonaler Richtplan - Koordinationsblatt Natur, Landschaft und Wald Natur- und Landschaftsschutzzonen auf Stufe Gemeinde Stand: 23.11.1999 Siehe auch Blätter Nr. D.4 / F.1 / F.6 / F.10 Instanzen zuständig
Ergänzungen zu Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der Seen
 Ergänzungen zu Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der Seen PR et al./23.01.2017 Niederberger, K, Rey, P., Reichert, P., Schlosser, J., Helg, U., Haertel-Borer, S., Binderheim, E. 2016: Methoden
Ergänzungen zu Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der Seen PR et al./23.01.2017 Niederberger, K, Rey, P., Reichert, P., Schlosser, J., Helg, U., Haertel-Borer, S., Binderheim, E. 2016: Methoden
Leitfaden kantonales Vernetzungskonzept
 Leitfaden kantonales Vernetzungskonzept Modular aufgebautes Vernetzungskonzept ab 2013 (2. Vertragsperiode) Die Vertragsperiode des ersten Vernetzungsprojektes endete 2012. Infolge dessen beschloss der
Leitfaden kantonales Vernetzungskonzept Modular aufgebautes Vernetzungskonzept ab 2013 (2. Vertragsperiode) Die Vertragsperiode des ersten Vernetzungsprojektes endete 2012. Infolge dessen beschloss der
Naturschutz in der Gemeinde Pflicht und Kür!
 Naturschutz in der Gemeinde Pflicht und Kür! Théophile Robert, La vielle Aar, 1898 Roter Faden Weshalb überhaupt Naturschutz? Aktuelle Biodiversitätsverluste, (zu) viele Gründe Pflichten der Gemeinde Handlungsmöglichkeiten
Naturschutz in der Gemeinde Pflicht und Kür! Théophile Robert, La vielle Aar, 1898 Roter Faden Weshalb überhaupt Naturschutz? Aktuelle Biodiversitätsverluste, (zu) viele Gründe Pflichten der Gemeinde Handlungsmöglichkeiten
Bachelorarbeit Camilla Philipp FS 2014
 Game Engines in der Landschaftsplanung Ermittlung des Nutzens anhand eines Vergleichs zwischen Standbildern und bewegten Game Engine- Visualisierungen Leitung: Prof. Dr. Adrienne Grêt-Regamey Betreut durch:
Game Engines in der Landschaftsplanung Ermittlung des Nutzens anhand eines Vergleichs zwischen Standbildern und bewegten Game Engine- Visualisierungen Leitung: Prof. Dr. Adrienne Grêt-Regamey Betreut durch:
Einwohnergemeinde Jegenstorf. Beitragsverordnung für ökologische Leistungen und die gestalterische Aufwertung des Ortsbildes
 Einwohnergemeinde Jegenstorf Beitragsverordnung für ökologische Leistungen und die gestalterische Aufwertung des Ortsbildes 01. Januar 2012 Der Gemeinderat, gestützt auf - Art. 431 des Gemeindebaureglementes
Einwohnergemeinde Jegenstorf Beitragsverordnung für ökologische Leistungen und die gestalterische Aufwertung des Ortsbildes 01. Januar 2012 Der Gemeinderat, gestützt auf - Art. 431 des Gemeindebaureglementes
INVENTARE IM KANTON BERN
 Inhalt Einleitung und Grundlagen Inventare im Kanton Bern Bundesinventare Kantonsinventare Datenbezug Einleitung Die Grundlage für eine fachlich fundierte und effiziente Naturschutzarbeit bilden die Inventare.
Inhalt Einleitung und Grundlagen Inventare im Kanton Bern Bundesinventare Kantonsinventare Datenbezug Einleitung Die Grundlage für eine fachlich fundierte und effiziente Naturschutzarbeit bilden die Inventare.
Baummarder-Monitoring Kanton Aargau - Bericht 2010
 Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Wald Sektion Jagd und Fischerei 10. November 2010 Baummarder-Monitoring Kanton Aargau - Bericht 2010 Einleitung Die Fotofallen der Sektion Jagd und Fischerei
Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Wald Sektion Jagd und Fischerei 10. November 2010 Baummarder-Monitoring Kanton Aargau - Bericht 2010 Einleitung Die Fotofallen der Sektion Jagd und Fischerei
Faktenblatt BLN Juni 2017
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Arten, Ökosysteme, Landschaften Sektion Landschaftsmanagement Faktenblatt BLN Juni 2017
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Arten, Ökosysteme, Landschaften Sektion Landschaftsmanagement Faktenblatt BLN Juni 2017
Kommunales Vernetzungsprojekt Neunkirch
 Kommunales Vernetzungsprojekt Neunkirch 2014-2021 Das Projekt kurz vorgestellt Die Gemeinde Neunkirch hat sich entschlossen, ein kommunales Vernetzungsprojekt über das gesamte Gemeindegebiet zu erstellen.
Kommunales Vernetzungsprojekt Neunkirch 2014-2021 Das Projekt kurz vorgestellt Die Gemeinde Neunkirch hat sich entschlossen, ein kommunales Vernetzungsprojekt über das gesamte Gemeindegebiet zu erstellen.
Fläche der Schutzgebiete
 Fläche der Schutzgebiete Rechtlich verbindliche Schutzgebiete sind wichtige, langfristig wirksame Instrumente des Naturschutzes. Solche Gebiete fördern die Biodiversität, indem sie Lebensräume gefährdeter
Fläche der Schutzgebiete Rechtlich verbindliche Schutzgebiete sind wichtige, langfristig wirksame Instrumente des Naturschutzes. Solche Gebiete fördern die Biodiversität, indem sie Lebensräume gefährdeter
Faktenblatt BLN / Nr. 1 September 2014
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Arten, Ökosysteme, Landschaften Sektion Landschaftsmanagement Faktenblatt BLN / Nr. 1
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Arten, Ökosysteme, Landschaften Sektion Landschaftsmanagement Faktenblatt BLN / Nr. 1
Zur Erarbeitung eines Naturschutzinventars hat sich folgendes Vorgehen bewährt: Naturschutzkommission: Projektvorbereitung, -planung
 Kanton Zürich Baudirektion Amt für Landschaft und Natur Fachstelle Naturschutz Erarbeitung eines kommunalen Inventars Kommunale Naturschutzinventare dokumentieren und erfassen die schutzwürdigen Biotope
Kanton Zürich Baudirektion Amt für Landschaft und Natur Fachstelle Naturschutz Erarbeitung eines kommunalen Inventars Kommunale Naturschutzinventare dokumentieren und erfassen die schutzwürdigen Biotope
PROGRAMM KLEINWASSERKRAFTWERKE
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Energie BFE PROGRAMM KLEINWASSERKRAFTWERKE Potenzialanalyse Kleinwasserkraftwerke - Vorstudie zu Kraftwerken
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Energie BFE PROGRAMM KLEINWASSERKRAFTWERKE Potenzialanalyse Kleinwasserkraftwerke - Vorstudie zu Kraftwerken
Inventar der Natur- und Landschaftsschutzgebiete von überkommunaler Bedeutung
 Inventar der Natur- und Landschaftsschutzgebiete von überkommunaler Bedeutung Basisinformation zum Datenbestand Kurzbeschreibung Räumliche Darstellungsart Zeichensatz Im Planungs- und Baugesetz von 1975
Inventar der Natur- und Landschaftsschutzgebiete von überkommunaler Bedeutung Basisinformation zum Datenbestand Kurzbeschreibung Räumliche Darstellungsart Zeichensatz Im Planungs- und Baugesetz von 1975
NIEDERSCHLAG. Hausübung 1
 Hausübung 1 NIEDERSCHLAG Abgabe: 25.10.2017 Niederschlag wird nahezu weltweit mit einem Netz von Messstationen erfasst. Dabei handelt es sich um punktuelle Messungen. Für grundlegende Fragen der Ingenieurhydrologie
Hausübung 1 NIEDERSCHLAG Abgabe: 25.10.2017 Niederschlag wird nahezu weltweit mit einem Netz von Messstationen erfasst. Dabei handelt es sich um punktuelle Messungen. Für grundlegende Fragen der Ingenieurhydrologie
Wie viele ökologische Ausgleichsflächen braucht es zur Erhaltung und Förderung typischer Arten des Kulturlands?
 Wie viele ökologische Ausgleichsflächen braucht es zur Erhaltung und Förderung typischer Arten des Kulturlands? Dr. Markus Jenny Die Suche nach einfachen Antworten in einem komplexen System Welche Arten
Wie viele ökologische Ausgleichsflächen braucht es zur Erhaltung und Förderung typischer Arten des Kulturlands? Dr. Markus Jenny Die Suche nach einfachen Antworten in einem komplexen System Welche Arten
Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis... 8 Tabellenverzeichnis...12 Abkürzungsverzeichnis...14 Vorwort...17 Einleitung...19
 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis... 8 Tabellenverzeichnis...12 Abkürzungsverzeichnis...14 Vorwort...17 1 Einleitung...19 1.1 Anlass...19 1.2 Ziel und Aufgabenstellung... 21 2 Material und Methoden...
Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis... 8 Tabellenverzeichnis...12 Abkürzungsverzeichnis...14 Vorwort...17 1 Einleitung...19 1.1 Anlass...19 1.2 Ziel und Aufgabenstellung... 21 2 Material und Methoden...
Rosa elliptica im Regionalen Naturpark Diemtigtal
 Rosa elliptica im Regionalen Naturpark Diemtigtal Ein Projekt von Pro Natura (PN) und WWF Bern, Stand Juni 2012 Ausgangslage Besondere Rosenvielfalt im regionalen Naturpark (RNP) Diemtigtal: Stichprobenartigen
Rosa elliptica im Regionalen Naturpark Diemtigtal Ein Projekt von Pro Natura (PN) und WWF Bern, Stand Juni 2012 Ausgangslage Besondere Rosenvielfalt im regionalen Naturpark (RNP) Diemtigtal: Stichprobenartigen
Beeinflussung der Tageszeiten in der Landschaftsbildbewertung
 Beeinflussung der Tageszeiten in der Landschaftsbildbewertung Verfasser: Joe Theis Leitung: Prof. Dr. Adrienne Grêt-Regamey Betreuung: Bachelorarbeit, Juni 2012 Dr. Ulrike Wissen Hayek Institut für Raum-
Beeinflussung der Tageszeiten in der Landschaftsbildbewertung Verfasser: Joe Theis Leitung: Prof. Dr. Adrienne Grêt-Regamey Betreuung: Bachelorarbeit, Juni 2012 Dr. Ulrike Wissen Hayek Institut für Raum-
Lebensraumansprüche. Das große Rasenstück Albrecht Dürer Biologe, Büro NATUR&GESCHICHTE, Biel
 Kurs Vernetzungsberatung Lebensraumansprüche Luc Lienhard FLORA Biologe, Büro NATUR&GESCHICHTE, Biel Geschichte Das große Rasenstück Albrecht Dürer 1503 1 Die Schweiz vor 20 Millionen Jahren Luzern vor
Kurs Vernetzungsberatung Lebensraumansprüche Luc Lienhard FLORA Biologe, Büro NATUR&GESCHICHTE, Biel Geschichte Das große Rasenstück Albrecht Dürer 1503 1 Die Schweiz vor 20 Millionen Jahren Luzern vor
Biodiversität im Siedlungsraum: Zustand und Potenziale
 Biodiversität im Siedlungsraum: Zustand und Potenziale Manuela Di Giulio Natur Umwelt Wissen GmbH Siedlungen: Himmel oder Hölle? Wirkungsmechanismen unklar, Aussagen teilweise widersprüchlich Methodische
Biodiversität im Siedlungsraum: Zustand und Potenziale Manuela Di Giulio Natur Umwelt Wissen GmbH Siedlungen: Himmel oder Hölle? Wirkungsmechanismen unklar, Aussagen teilweise widersprüchlich Methodische
Faktenblatt BLN / Nr. 1 Oktober 2009
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Natur und Landschaft Sektion Landschaften von nationaler Bedeutung Faktenblatt BLN /
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Natur und Landschaft Sektion Landschaften von nationaler Bedeutung Faktenblatt BLN /
Profitiert die Juraviper von Biotopaufwertungen im Wald?
 Profitiert die Juraviper von Biotopaufwertungen im Wald? Beispiel einer rfolgskontrolle aus dem Kanton Basel-Landschaft Aspisviper-Tagung der KARCH in Leysin, 26. September 2015 Christoph Bühler, Hintermann
Profitiert die Juraviper von Biotopaufwertungen im Wald? Beispiel einer rfolgskontrolle aus dem Kanton Basel-Landschaft Aspisviper-Tagung der KARCH in Leysin, 26. September 2015 Christoph Bühler, Hintermann
(Thema) Optimierung von künstlichen neuronalen Netzen zur Ausfallvorhersage mit Sensordaten. Masterarbeit
 (Thema) Optimierung von künstlichen neuronalen Netzen zur Ausfallvorhersage mit Sensordaten Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Master of Science (M.Sc.) im Studiengang Wirtschaftsingenieur
(Thema) Optimierung von künstlichen neuronalen Netzen zur Ausfallvorhersage mit Sensordaten Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Master of Science (M.Sc.) im Studiengang Wirtschaftsingenieur
GIS Einsatz in einem Ökobüro
 GIS Einsatz in einem Ökobüro UNI-GIS Tag Schweiz 2013 Lilian Kronauer, Agrofutura Ablauf Vorstellung Büro Agrofutura 3 Projektbeispiele genauer angeschaut: Vernetzungsprojekte Stoffeinsatzerhebung Bienenstandorte
GIS Einsatz in einem Ökobüro UNI-GIS Tag Schweiz 2013 Lilian Kronauer, Agrofutura Ablauf Vorstellung Büro Agrofutura 3 Projektbeispiele genauer angeschaut: Vernetzungsprojekte Stoffeinsatzerhebung Bienenstandorte
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de SCHOOL-SCOUT Statistiken analysieren
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de SCHOOL-SCOUT Statistiken analysieren
Bilder auf Wichtige Oasen
 Kanton Zürich Baudirektion Bilder auf www.news.zh.ch Generalsekretariat Kommunikation 1/10 Wichtige Oasen Im dicht besiedelten Kanton Zürich sind intakte Naturlandschaften wichtige Oasen der Erholung und
Kanton Zürich Baudirektion Bilder auf www.news.zh.ch Generalsekretariat Kommunikation 1/10 Wichtige Oasen Im dicht besiedelten Kanton Zürich sind intakte Naturlandschaften wichtige Oasen der Erholung und
Verordnung über das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz
 Verordnung über das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (VIVS) vom 14. April 2010 Der Schweizerische Bundesrat, gestützt auf die Artikel 5 Absatz 1 und 26 des Bundesgesetzes vom 1.
Verordnung über das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (VIVS) vom 14. April 2010 Der Schweizerische Bundesrat, gestützt auf die Artikel 5 Absatz 1 und 26 des Bundesgesetzes vom 1.
Qualitative Fortschreibung des Niedersächsischen Moorschutzprogramms
 Auftrag des MU vom 13.03.2012: Erhebung von Grundlagen für die qualitative Aufwertung der Lebensräume der Hoch- und Übergangsmoore 0. Erhebung von Flächen, die keine Relevanz für den Moorschutz (mehr)
Auftrag des MU vom 13.03.2012: Erhebung von Grundlagen für die qualitative Aufwertung der Lebensräume der Hoch- und Übergangsmoore 0. Erhebung von Flächen, die keine Relevanz für den Moorschutz (mehr)
IT Mitarbeiter Identifikation mit der Unternehmensmarke als strategischer Erfolgsfaktor
 Wirtschaft Marcel Piller IT Mitarbeiter Identifikation mit der Unternehmensmarke als strategischer Erfolgsfaktor Wie kann eine hohe IT Mitarbeiter Identifikation erreicht werden? Masterarbeit Executive
Wirtschaft Marcel Piller IT Mitarbeiter Identifikation mit der Unternehmensmarke als strategischer Erfolgsfaktor Wie kann eine hohe IT Mitarbeiter Identifikation erreicht werden? Masterarbeit Executive
Neuere Ansätze zur Auswahl von Prädiktionsmodellen. Von Veronika Huber
 Neuere Ansätze zur Auswahl von Prädiktionsmodellen Von Veronika Huber Gliederung Anwendungsbereiche von Prädiktionsmodellen Traditionelle Methoden zur Prüfung der Wirksamkeit Neuere Ansätze zur Prüfung
Neuere Ansätze zur Auswahl von Prädiktionsmodellen Von Veronika Huber Gliederung Anwendungsbereiche von Prädiktionsmodellen Traditionelle Methoden zur Prüfung der Wirksamkeit Neuere Ansätze zur Prüfung
Rothirschbesiedlung des nördlichen Jurabogens mit Hilfe von Übersiedlungen an der A1
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Artenmanagement Rothirschbesiedlung des nördlichen Jurabogens mit Hilfe von Übersiedlungen
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Artenmanagement Rothirschbesiedlung des nördlichen Jurabogens mit Hilfe von Übersiedlungen
Zellweger & Stöckli Biodiversität messen
 Warum ein Punktesystem? Biodiversität messen: Entwicklung und Evaluation des MVP-Punktesystems Judith Zellweger-Fischer & Sibylle Stöckli gesamtheitliche Erfasssung Artenvielfalt zu aufwendig Biodiversität
Warum ein Punktesystem? Biodiversität messen: Entwicklung und Evaluation des MVP-Punktesystems Judith Zellweger-Fischer & Sibylle Stöckli gesamtheitliche Erfasssung Artenvielfalt zu aufwendig Biodiversität
Konzept Biber - Vollzugshilfe des BAFU zum Bibermanagement in der Schweiz. Rückmeldeformular. Name / Firma / Organisation / Amt
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Konzept Biber Vollzugshilfe des BAFU zum Bibermanagement in der Schweiz Rückmeldeformular Name
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Konzept Biber Vollzugshilfe des BAFU zum Bibermanagement in der Schweiz Rückmeldeformular Name
Studie über bestehende und potentielle Nationalparke in Deutschland
 , ] Angewandte Landschaftsökologie Heft 10 Föderation der Natur- und Nationalparke Europas, Sektion-Deutschland e.v. (FÖNAD) Studie über bestehende und potentielle Nationalparke in Deutschland Ergebnisse
, ] Angewandte Landschaftsökologie Heft 10 Föderation der Natur- und Nationalparke Europas, Sektion-Deutschland e.v. (FÖNAD) Studie über bestehende und potentielle Nationalparke in Deutschland Ergebnisse
NACHFÜHRUNG GEFAHRENKARTE HOCHWASSER SURBTAL
 DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT Abteilung Landschaft und Gewässer Wasserbau NACHFÜHRUNG GEFAHRENKARTE HOCHWASSER SURBTAL Gemeinde Döttingen Uznach, 28.09.2015 Niederer + Pozzi Umwelt AG Burgerrietstrasse
DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT Abteilung Landschaft und Gewässer Wasserbau NACHFÜHRUNG GEFAHRENKARTE HOCHWASSER SURBTAL Gemeinde Döttingen Uznach, 28.09.2015 Niederer + Pozzi Umwelt AG Burgerrietstrasse
Artenschutz und Genetik der Aspisviper (Vipera aspis) im Schweizer Mittelland und dem Jura
 Artenschutz und Genetik der Aspisviper (Vipera aspis) im Schweizer Mittelland und dem Jura Silvia Nanni Geser Betreuer: Dr. Sylvain Ursenbacher Master: Laura Kaiser, Valerie Zwahlen Kulturlandschaft Mitteleuropa
Artenschutz und Genetik der Aspisviper (Vipera aspis) im Schweizer Mittelland und dem Jura Silvia Nanni Geser Betreuer: Dr. Sylvain Ursenbacher Master: Laura Kaiser, Valerie Zwahlen Kulturlandschaft Mitteleuropa
Arten und Lebensräume Landwirtschaft Vielfalt in der Agrarlandschaft
 Arten und Lebensräume Landwirtschaft Vielfalt in der Agrarlandschaft erfassen ALL-EMA 3. 2015 4 ALL-EMA Monitoringprogramm «Arten und Lebensräume Landwirtschaft» Die Landwirtschaft ist auf eine intakte
Arten und Lebensräume Landwirtschaft Vielfalt in der Agrarlandschaft erfassen ALL-EMA 3. 2015 4 ALL-EMA Monitoringprogramm «Arten und Lebensräume Landwirtschaft» Die Landwirtschaft ist auf eine intakte
Melde- und bewilligungspflichtige Veranstaltungen gemäss Waldgesetz - Merkblatt Schutzgebiete im Geoportal
 Kanton St.Gallen Volkswirtschaftsdepartement Kantonsforstamt St.Gallen, November 2014 Melde- und bewilligungspflichtige Veranstaltungen gemäss Waldgesetz - Merkblatt Schutzgebiete im Geoportal Die Melde-
Kanton St.Gallen Volkswirtschaftsdepartement Kantonsforstamt St.Gallen, November 2014 Melde- und bewilligungspflichtige Veranstaltungen gemäss Waldgesetz - Merkblatt Schutzgebiete im Geoportal Die Melde-
Daten- u. Darstellungsmodell DDM Strukturverbesserungen / GIS-Services BLW
 Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Bundesamt für Landwirtschaft suissemelio Fachtagung 16.06.2015 Daten- u. Darstellungsmodell DDM Strukturverbesserungen / GIS-Services
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Bundesamt für Landwirtschaft suissemelio Fachtagung 16.06.2015 Daten- u. Darstellungsmodell DDM Strukturverbesserungen / GIS-Services
Anhang g) Inventar der Trinkwasserfassungen als Grundlage regionaler Planung. Inhalt
 Anhang g) Inventar der Trinkwasserfassungen als Grundlage regionaler Planungen 22.04.2016 / S.1 Anhang g) Inventar der Trinkwasserfassungen als Grundlage regionaler Planung Ein Beitrag des Bundesamts für
Anhang g) Inventar der Trinkwasserfassungen als Grundlage regionaler Planungen 22.04.2016 / S.1 Anhang g) Inventar der Trinkwasserfassungen als Grundlage regionaler Planung Ein Beitrag des Bundesamts für
Integration von Ökosystemleistungen in landschaftsplanerische Instrumente
 Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung IRL Professur für Planung von Landschaft und Urbanen Systemen PLUS Masterarbeit Integration von Ökosystemleistungen in landschaftsplanerische Instrumente Benjamin
Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung IRL Professur für Planung von Landschaft und Urbanen Systemen PLUS Masterarbeit Integration von Ökosystemleistungen in landschaftsplanerische Instrumente Benjamin
Aktionsplan Strategie Biodiversität Schweiz
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt tfü für rum Umwelt BAFU Aktionsplan Strategie Biodiversität Schweiz, BAFU BÖA Jahrestagung, 20. November 2012 Langfristiges
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt tfü für rum Umwelt BAFU Aktionsplan Strategie Biodiversität Schweiz, BAFU BÖA Jahrestagung, 20. November 2012 Langfristiges
WISKI Benutzerkonferenz CH. Aktueller Stand BAFU
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Hydrologie WISKI Benutzerkonferenz CH Aktueller Stand BAFU 5. November 2015 Einleitung
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Hydrologie WISKI Benutzerkonferenz CH Aktueller Stand BAFU 5. November 2015 Einleitung
356 Statistisches Jahrbuch Bezirk Aarau. Bezirk Baden
 356 Statistisches buch 2016 Bezirk Aarau Fläche Total 10 448 ha davon 3 004 ha Acker, Wiese 4 953 ha Wald 2006 67 105 34 373 14 007 13 809 42 238 11 058 39 5 505 4 925 532 2007 67 616 34 612 14 260 13
356 Statistisches buch 2016 Bezirk Aarau Fläche Total 10 448 ha davon 3 004 ha Acker, Wiese 4 953 ha Wald 2006 67 105 34 373 14 007 13 809 42 238 11 058 39 5 505 4 925 532 2007 67 616 34 612 14 260 13
ART Jahrestagung Erhaltungszustand der Gelbbauchunken-Population in Thüringen und daraus abzuleitende Handlungsempfehlungen IBIS
 Erhaltungszustand der Gelbbauchunken-Population in Thüringen und daraus abzuleitende Handlungsempfehlungen INGENIEURE FÜR BIOLOGISCHE STUDIEN, INFORMATIONSSYSTEME UND STANDORTBEWERTUNG An der Kirche 5,
Erhaltungszustand der Gelbbauchunken-Population in Thüringen und daraus abzuleitende Handlungsempfehlungen INGENIEURE FÜR BIOLOGISCHE STUDIEN, INFORMATIONSSYSTEME UND STANDORTBEWERTUNG An der Kirche 5,
Abstract. Titel: Performancevergleich von aktiven und passiven Fondsanlagestrategien
 Abstract Titel: Performancevergleich von aktiven und passiven Fondsanlagestrategien Kurzzusammenfassung: Die Auswahl an Anlageprodukte hat sich insbesondere in der jüngsten Vergangenheit stark gewandelt
Abstract Titel: Performancevergleich von aktiven und passiven Fondsanlagestrategien Kurzzusammenfassung: Die Auswahl an Anlageprodukte hat sich insbesondere in der jüngsten Vergangenheit stark gewandelt
Vernetzungs- projekt. Blumenwiesen und Buntbrachen in Vernetzungsgebieten. Thurgau. Nutzen für die Thurgauerinnen und Thurgauer!
 Blumenwiesen und Buntbrachen in Vernetzungsgebieten Mit dem Landschaftsentwicklungskonzept hat der Kanton wesentliche Impulse zur Aufwertung und zum Schutz seiner schönen Landschaft ausgelöst. Durch den
Blumenwiesen und Buntbrachen in Vernetzungsgebieten Mit dem Landschaftsentwicklungskonzept hat der Kanton wesentliche Impulse zur Aufwertung und zum Schutz seiner schönen Landschaft ausgelöst. Durch den
Presseinformation Seite 1 von 5
 Seite 1 von 5 20. Juli 2016 Hochwasserschutz und Ökologie verbinden Bayerische Elektrizitätswerke starten EU-weites Pilotprojekt zur ökologischen Sanierung von Dämmen an der Donau Effiziente Dammsanierung
Seite 1 von 5 20. Juli 2016 Hochwasserschutz und Ökologie verbinden Bayerische Elektrizitätswerke starten EU-weites Pilotprojekt zur ökologischen Sanierung von Dämmen an der Donau Effiziente Dammsanierung
Wildnis und Natura 2000 im Nationalen Naturerbe Konflikte und Synergieeffekte. PD Dr. Heike Culmsee DBU Naturerbe GmbH Osnabrück
 Wildnis und Natura 2000 im Nationalen Naturerbe Konflikte und Synergieeffekte PD Dr. Heike Culmsee DBU Naturerbe GmbH Osnabrück 1 Der Europäische Wildnis-Qualitätsindex Basisdaten: - Populationsdichte
Wildnis und Natura 2000 im Nationalen Naturerbe Konflikte und Synergieeffekte PD Dr. Heike Culmsee DBU Naturerbe GmbH Osnabrück 1 Der Europäische Wildnis-Qualitätsindex Basisdaten: - Populationsdichte
Bachelorarbeit. Was ist zu tun?
 Bachelorarbeit Was ist zu tun? Titelseite Zusammenfassung/Summary Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Einleitung Material und Methoden Ergebnisse Diskussion Ausblick Literaturverzeichnis Danksagung
Bachelorarbeit Was ist zu tun? Titelseite Zusammenfassung/Summary Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Einleitung Material und Methoden Ergebnisse Diskussion Ausblick Literaturverzeichnis Danksagung
Gottlieb Duttweiler Lehrstuhl für Internationales Handelsmanagement. Für die Erstellung von Bachelor-Arbeiten massgeblich ist das allgemeine Merkblatt
 Gottlieb Duttweiler Lehrstuhl für Internationales Handelsmanagement Für die Erstellung von Bachelor-Arbeiten massgeblich ist das allgemeine Merkblatt für Bachelor-Arbeiten, das unter http://www.unisg.ch
Gottlieb Duttweiler Lehrstuhl für Internationales Handelsmanagement Für die Erstellung von Bachelor-Arbeiten massgeblich ist das allgemeine Merkblatt für Bachelor-Arbeiten, das unter http://www.unisg.ch
GEMEINDE EVERSWINKEL
 GEMEINDE EVERSWINKEL Eingriffsbewertung/-bilanzierung zum Bebauungsplan 56 Königskamp II Vorentwurf, Mai 2014 In Zusammenarbeit mit der Verwaltung: Büro für Stadtplanung und Kommunalberatung Tischmann
GEMEINDE EVERSWINKEL Eingriffsbewertung/-bilanzierung zum Bebauungsplan 56 Königskamp II Vorentwurf, Mai 2014 In Zusammenarbeit mit der Verwaltung: Büro für Stadtplanung und Kommunalberatung Tischmann
BIOTOP KARTIERUNG BAYERN
 BIOTOP KARTIERUNG BAYERN Biotope sind Lebensräume. Der Begriff Biotop setzt sich aus den griechischen Wörtern bios, das Leben und topos, der Raum zusammen, bedeutet also Lebensraum. Lebensraum für eine
BIOTOP KARTIERUNG BAYERN Biotope sind Lebensräume. Der Begriff Biotop setzt sich aus den griechischen Wörtern bios, das Leben und topos, der Raum zusammen, bedeutet also Lebensraum. Lebensraum für eine
Biodiversität im Wald was ist zu tun? Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz Werner Müller / Christa Glauser
 Biodiversität im Wald was ist zu tun? Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz Werner Müller / Christa Glauser Schematischer Zyklus in einem Naturwald mit den wichtigen Strukturelementen für die Biodiversität
Biodiversität im Wald was ist zu tun? Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz Werner Müller / Christa Glauser Schematischer Zyklus in einem Naturwald mit den wichtigen Strukturelementen für die Biodiversität
Vernetzung ein Schlüssel zur Bereitstellung von Ökosystemleistungen. Bedeutung von Landschaftsstrukturen für Ökosystemleistungen von Trockenwiesen
 Bedeutung von Landschaftsstrukturen für Ökosystemleistungen von Trockenwiesen Sven Erik Rabe Prof. Dr. Adrienne Grêt Regamey Vernetzung ein Schlüssel zur Bereitstellung von Ökosystemleistungen 2 Unter
Bedeutung von Landschaftsstrukturen für Ökosystemleistungen von Trockenwiesen Sven Erik Rabe Prof. Dr. Adrienne Grêt Regamey Vernetzung ein Schlüssel zur Bereitstellung von Ökosystemleistungen 2 Unter
BHKW Gysenbergpark. Hochschule Ruhr West. Projektarbeit. Bachelormodul Projektmanagement Studiengang Energie- und Umwelttechnik
 Hochschule Ruhr West Bachelormodul Studiengang Energie- und Umwelttechnik Erstprüfer: Prof. Dr.-Ing. Sylvia Schädlich Kooperationspartner: Gebäudetechnik Molke GmbH Ansprechpartner: Dipl. Ing. Bernd Molke
Hochschule Ruhr West Bachelormodul Studiengang Energie- und Umwelttechnik Erstprüfer: Prof. Dr.-Ing. Sylvia Schädlich Kooperationspartner: Gebäudetechnik Molke GmbH Ansprechpartner: Dipl. Ing. Bernd Molke
Landwirtschaftliche Bewässerung Bewilligungen
 24. September 2015 Landwirtschaftliche Bewässerung Bewilligungen Bewässerung Wasserbezug braucht eine Bewilligung Kanton: Einhaltung der Vorschriften zum Gewässerschutz, zur Fischerei, zu Natur- und Heimatschutz.
24. September 2015 Landwirtschaftliche Bewässerung Bewilligungen Bewässerung Wasserbezug braucht eine Bewilligung Kanton: Einhaltung der Vorschriften zum Gewässerschutz, zur Fischerei, zu Natur- und Heimatschutz.
Vernetzte Agrarlandschaft
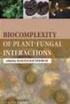 Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR Agroscope Vernetzte Agrarlandschaft Felix Herzog, Valérie Coudrain, Christoph Schüepp, Martin Entling 29.04.2014 www.agroscope.ch
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR Agroscope Vernetzte Agrarlandschaft Felix Herzog, Valérie Coudrain, Christoph Schüepp, Martin Entling 29.04.2014 www.agroscope.ch
Der Einsatz der Six Sigma-Methode zur Qualitätssteigerung in Unternehmen
 Technik Gerhard Gütl Der Einsatz der Six Sigma-Methode zur Qualitätssteigerung in Unternehmen Bachelorarbeit 2. Bachelorarbeit Six Sigma FH-Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieur Vertiefung Produktions-
Technik Gerhard Gütl Der Einsatz der Six Sigma-Methode zur Qualitätssteigerung in Unternehmen Bachelorarbeit 2. Bachelorarbeit Six Sigma FH-Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieur Vertiefung Produktions-
Halbzeitbewertung von PROFIL. Teil II Kapitel 14. Beihilfe für nichtproduktive Investitionen (ELER-Code 216)
 Halbzeitbewertung von PROFIL Teil II Kapitel 14 Beihilfe für nichtproduktive Investitionen (ELER-Code 216) Autor: Manfred Bathke Braunschweig, Dezember 2010 Teil II - Kapitel 14 Beihilfe für nichtproduktive
Halbzeitbewertung von PROFIL Teil II Kapitel 14 Beihilfe für nichtproduktive Investitionen (ELER-Code 216) Autor: Manfred Bathke Braunschweig, Dezember 2010 Teil II - Kapitel 14 Beihilfe für nichtproduktive
Strategie Invasive gebietsfremde Arten : Umsetzung und konkrete Massnahmen
 Strategie Invasive gebietsfremde Arten : Umsetzung und konkrete Massnahmen Sibyl Rometsch, Info Flora 3. Naturschutz-Kafi Münsigen, 15.02.2013 Inhalt Kurze Präsentation der Stiftung Info Flora Invasive
Strategie Invasive gebietsfremde Arten : Umsetzung und konkrete Massnahmen Sibyl Rometsch, Info Flora 3. Naturschutz-Kafi Münsigen, 15.02.2013 Inhalt Kurze Präsentation der Stiftung Info Flora Invasive
Steckbrief Biogeographische Regionen
 Steckbrief Biogeographische Regionen Dirk Hinterlang November 2015 Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Lizenz.
Steckbrief Biogeographische Regionen Dirk Hinterlang November 2015 Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Lizenz.
Committed to Burnout?
 Wirtschaft Stefan Reischl Committed to Burnout? Eine Untersuchung über den Zusammenhang von Organizational Commitment und Burnout Diplomarbeit Committed to Burnout? Eine Untersuchung über den Zusammenhang
Wirtschaft Stefan Reischl Committed to Burnout? Eine Untersuchung über den Zusammenhang von Organizational Commitment und Burnout Diplomarbeit Committed to Burnout? Eine Untersuchung über den Zusammenhang
Die neue Agrarpolitik und ihre Wechselwirkungen mit dem Wald
 Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Bundesamt für Landwirtschaft BLW Die neue Agrarpolitik und ihre Wechselwirkungen mit dem Wald Jahresversammlung des Schweizerischen
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Bundesamt für Landwirtschaft BLW Die neue Agrarpolitik und ihre Wechselwirkungen mit dem Wald Jahresversammlung des Schweizerischen
Titre. Forum e-geo.ch 2013. Geobasisdaten. Stand Modellierung und FIG Herausforderungen. K. Spälti, IKGEO und D. Angst, BAFU (abwesend)
 Forum e-geo.ch 2013 Geobasisdaten Stand Modellierung und FIG Herausforderungen K. Spälti, IKGEO und D. Angst, BAFU (abwesend) 1 Themen FIG Zusammensetzung, Aufgabe, Herausforderungen MGDM Auftrag, was
Forum e-geo.ch 2013 Geobasisdaten Stand Modellierung und FIG Herausforderungen K. Spälti, IKGEO und D. Angst, BAFU (abwesend) 1 Themen FIG Zusammensetzung, Aufgabe, Herausforderungen MGDM Auftrag, was
"Certificate of Advanced Studies in Naturbezogene Umweltbildung" (CAS in Naturbezogene Umweltbildung)
 Anhang zur Rahmenstudienordnung für Diplom- und Zertifikatslehrgänge an der ZHAW (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften) vom 1. August 2008 für den Zertifikatslehrgang "Certificate of Advanced
Anhang zur Rahmenstudienordnung für Diplom- und Zertifikatslehrgänge an der ZHAW (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften) vom 1. August 2008 für den Zertifikatslehrgang "Certificate of Advanced
Ausdolungen und ökologische Vernetzung in Rothenfluh und Anwil
 Natur- und Vogelschutzverein Rothenfluh Anwil / NUVRA Ausdolungen und ökologische Vernetzung in Rothenfluh und Anwil Schlussbericht Diesen Frühling konnte mit der Ausdolung des Langmattbächlis die letzte
Natur- und Vogelschutzverein Rothenfluh Anwil / NUVRA Ausdolungen und ökologische Vernetzung in Rothenfluh und Anwil Schlussbericht Diesen Frühling konnte mit der Ausdolung des Langmattbächlis die letzte
Projektentwicklung mit dem. Logical Framework Approach
 Projektentwicklung mit dem Logical Framework Approach Jens Herrmann, 06/2014 Der Logical Framework Approach Der Logical Framework Ansatz ist ein Werkzeug zur Erstellung, Monitoring und der Evaluation von
Projektentwicklung mit dem Logical Framework Approach Jens Herrmann, 06/2014 Der Logical Framework Approach Der Logical Framework Ansatz ist ein Werkzeug zur Erstellung, Monitoring und der Evaluation von
Erfahrungsaustausch und konkrete Zusammenarbeit
 Projekt Erfahrungsaustausch und konkrete Zusammenarbeit GeoIG / ÖREBK: Braucht es den Raumplaner noch? Beat Rey ERR Raumplaner FSU SIA Kurzvorstellung Wer sind wir? Raumplanungsbüro mit knapp 30 Mitarbeiter/innen
Projekt Erfahrungsaustausch und konkrete Zusammenarbeit GeoIG / ÖREBK: Braucht es den Raumplaner noch? Beat Rey ERR Raumplaner FSU SIA Kurzvorstellung Wer sind wir? Raumplanungsbüro mit knapp 30 Mitarbeiter/innen
Theoretisches Modell, praxisbewährte Instrumente, messbare Vorteile
 Controlling in der Immobilienwirtschaft und Rating nach Basel II und III Theoretisches Modell, praxisbewährte Instrumente, messbare Vorteile 2 Segmentierung des Wohnungsbestandes 2.1 Vermietungserfolg
Controlling in der Immobilienwirtschaft und Rating nach Basel II und III Theoretisches Modell, praxisbewährte Instrumente, messbare Vorteile 2 Segmentierung des Wohnungsbestandes 2.1 Vermietungserfolg
Zweckmässigkeitsbeurteilung Umfahrungsstrasse Uznach
 Zweckmässigkeitsbeurteilung Umfahrungsstrasse Uznach Zusammenfassung und Kommentare zum Schlussbericht von Ernst Basler + Partner vom 13. Dezember 2011 Aufgabenstellung Erstellen einer Zweckmässigkeitsbeurteilung
Zweckmässigkeitsbeurteilung Umfahrungsstrasse Uznach Zusammenfassung und Kommentare zum Schlussbericht von Ernst Basler + Partner vom 13. Dezember 2011 Aufgabenstellung Erstellen einer Zweckmässigkeitsbeurteilung
Analyse eines zweistufigen, regionalen Clusteralgorithmus am Beispiel der Verbundenen Wohngebäudeversicherung
 Analyse eines zweistufigen, regionalen Clusteralgorithmus am Beispiel der Verbundenen Wohngebäudeversicherung Zusammenfassung der Diplomarbeit an der Hochschule Zittau/Görlitz Maria Kiseleva Motivation
Analyse eines zweistufigen, regionalen Clusteralgorithmus am Beispiel der Verbundenen Wohngebäudeversicherung Zusammenfassung der Diplomarbeit an der Hochschule Zittau/Görlitz Maria Kiseleva Motivation
Wandsbek und seine Natur Amt und Ehrenamt sind aktiv
 Wandsbek und seine Natur Amt und Ehrenamt sind aktiv Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung Abteilung Landschaftsplanung Hans-Harald Rakelbusch, stellvertretender Abteilungsleiter Stadtlandschaft ist kein
Wandsbek und seine Natur Amt und Ehrenamt sind aktiv Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung Abteilung Landschaftsplanung Hans-Harald Rakelbusch, stellvertretender Abteilungsleiter Stadtlandschaft ist kein
Anleitung Version 1/2016. Swiss Map Vector Shape mit ArcMap Anleitung
 Anleitung Version 1/2016 Swiss Map Vector Shape mit ArcMap Anleitung Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 3 2 Datenbezug... 3 3 Vorab-Installationen... 3 4 Aufbau der Karte... 4 4.1 Erstellen eines neuen
Anleitung Version 1/2016 Swiss Map Vector Shape mit ArcMap Anleitung Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 3 2 Datenbezug... 3 3 Vorab-Installationen... 3 4 Aufbau der Karte... 4 4.1 Erstellen eines neuen
Ökologische Potentialanalyse
 K M B Kerker, Müller + Braunbeck Freie Architekten Stadtplaner und beratende Ingenieure Architektur, Stadtplanung, Innenarchitektur, Vermessung, Landschaftsarchitektur, Tiefbauplanung, Strassenplanung
K M B Kerker, Müller + Braunbeck Freie Architekten Stadtplaner und beratende Ingenieure Architektur, Stadtplanung, Innenarchitektur, Vermessung, Landschaftsarchitektur, Tiefbauplanung, Strassenplanung
Vom Nutzen der Wildblumen
 Vom Nutzen der Wildblumen Katja Jacot Agroscope ART 8046 Zürich Kurs 11.212 Ökologische Ausgleichsflächen haben viele Funktionen! BÖA Jahrestagung 2011 Strickhof Wülflingen, 23. März 2011 1 Eidgenössisches
Vom Nutzen der Wildblumen Katja Jacot Agroscope ART 8046 Zürich Kurs 11.212 Ökologische Ausgleichsflächen haben viele Funktionen! BÖA Jahrestagung 2011 Strickhof Wülflingen, 23. März 2011 1 Eidgenössisches
swissalti 3D Ausgabebericht 2013 Allgemeines über swissalti 3D Migration DTM-AV / DHM25 nach DTM-TLM
 Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS armasuisse Bundesamt für Landestopografie swisstopo swissalti 3D Ausgabebericht 2013 Allgemeines über swissalti 3D Im Rahmen
Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS armasuisse Bundesamt für Landestopografie swisstopo swissalti 3D Ausgabebericht 2013 Allgemeines über swissalti 3D Im Rahmen
Benutzer-Dokumentation V
 IRM@ Benutzer-Dokumentation V 6.05.7 Stand: 27.11.2008 Inhaltsverzeichnis: 1 EINLEITUNG... 3 2 AUFRUF ERWEITERTE HÜL... 4 2.1 BENUTZER-MENÜ... 4 2.2 BERECHTIGUNGEN FÜR DIE ERWEITERTE HÜL... 4 2.3 ERWEITERTE
IRM@ Benutzer-Dokumentation V 6.05.7 Stand: 27.11.2008 Inhaltsverzeichnis: 1 EINLEITUNG... 3 2 AUFRUF ERWEITERTE HÜL... 4 2.1 BENUTZER-MENÜ... 4 2.2 BERECHTIGUNGEN FÜR DIE ERWEITERTE HÜL... 4 2.3 ERWEITERTE
Betretungsrecht und Nutzungskonflikte im Lebensraum von Pflanzen und Tieren
 Betretungsrecht und Nutzungskonflikte im Lebensraum von Pflanzen und Tieren Freiraumentwicklung in Quartier und Gemeinde - auch im Interesse der Gesundheit St.Gallen, Pascal Gmür Forstingenieur Volkswirtschaftsdepartement
Betretungsrecht und Nutzungskonflikte im Lebensraum von Pflanzen und Tieren Freiraumentwicklung in Quartier und Gemeinde - auch im Interesse der Gesundheit St.Gallen, Pascal Gmür Forstingenieur Volkswirtschaftsdepartement
Standortfaktoren bei der Umnutzung von Industriearealen für die Innenentwicklung
 Standortfaktoren bei der Umnutzung von Industriearealen für die Innenentwicklung Leitung: Prof. Dr. Bernd Scholl Betreuung: Dr. Ana Peric, Cecilia Braun Datum: 23. Januar 2017 HS 2016 Institut für Raum-
Standortfaktoren bei der Umnutzung von Industriearealen für die Innenentwicklung Leitung: Prof. Dr. Bernd Scholl Betreuung: Dr. Ana Peric, Cecilia Braun Datum: 23. Januar 2017 HS 2016 Institut für Raum-
Das C-Teile-Management bei KMU
 Wirtschaft Lukas Ohnhaus Das C-Teile-Management bei KMU Identifikation und Analyse der Auswahlkriterien für einen Dienstleister mittels qualitativer Marktstudie Bachelorarbeit Bibliografische Information
Wirtschaft Lukas Ohnhaus Das C-Teile-Management bei KMU Identifikation und Analyse der Auswahlkriterien für einen Dienstleister mittels qualitativer Marktstudie Bachelorarbeit Bibliografische Information
Online Feldbuch Neophyten. Benutzeranleitung
 Benutzeranleitung Mai 2016 1 Inhaltsverzeichnis 1 Wo finden Sie das Online Feldbuch Neophyten auf unserer Website? 3 2 Startseite und Login 4 3 Online Feldbuch Neophyten Übersichtsseite 5 4 Befragung ohne
Benutzeranleitung Mai 2016 1 Inhaltsverzeichnis 1 Wo finden Sie das Online Feldbuch Neophyten auf unserer Website? 3 2 Startseite und Login 4 3 Online Feldbuch Neophyten Übersichtsseite 5 4 Befragung ohne
