Druckmessungen am Vacopedes Vorfußentlastungsschuh
|
|
|
- Stefanie Kohl
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Druckmessungen am Vacopedes Vorfußentlastungsschuh Projekt: Vacopedes Vorfußentlastungsschuh MRI 1 Auftraggeber: Fa. OPED GmbH München Datum: Juni/Juli 2004 Tel.: 089/ Ganglabor: Klinik für Orthopädie und Sportorthopädie der TU München, Direktor Prof. Dr. med. R. Gradinger, Klinikum r. d. Isar, Ismaninger Straße 22, München Tel.: (089)
2 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Einleitung,... 3 Plantare Druckverteilungsmessung... 3 Druckverteilungsmessungen im Schuh... 5 Zeitreihen... 6 Druckmaximaanalyse... 8 Belastungsanalyse Belastungsanalyse mathematisch zusammengefasst Messergebnisse Zusammenfassung Liste der Messungen Anmerkung: Die wesentlichsten Ergebnisse sind im Kapitel Zusammenfassung auf den Seiten 19 bis 22 zusammengefasst. Die vorhergehenden Kapitel dienen in erster Linie der Erläuterung des Mess- und Auswerteverfahrens für den an Details interessierten Leser. Seite 2
3 1 Einleitung In diesem Projekt wurde die Belastung des Fußes beim Gehen in normaler Geschwindigkeit untersucht und welche Veränderung verschiedene Vorfußentlastungsschuhe auf die Verteilung der Last zwischen Rückfuß und Vorfuß bewirken. Als Messinstrument dienten Druckmesssohlen zum Einlegen in den Schuh. Aus der plantaren Druckverteilung an der Fußsohle lässt sich durch Aufintegration über Teilbereiche des Fußes die Belastung in diesen Bereichen ermitteln. Die Messungen wurden auf einem Laufband durchgeführt. Die Messdauer jeder Messung war jeweils 40 Sekunden. In dieser Zeit machte der Proband etwa 28 Doppelschritte, über die in der Auswertung gemittelt wurde. Außer beim normalen Gehen wurden auch Messungen beim Halbschritte-Gehen, beim Treppensteigen und beim Halbschritte-Treppensteigen gemacht. Diese werden aber in diesem Bericht nicht weiter ausgewertet. Die zu vergleichenden Vorfußentlastungsschuhe waren: - Vacopedes - Vacopedes TC - Darco - Bledsoe Diabetikerboot - Sportschuh Die Versorgung mit den therapeutischen Schuhen erfolgte bei den Messungen immer einseitig, der andere Fuß trug immer den Sportschuh. Die Anwendung derartiger Entlastungsschuhe bei Diabetikern verlangt außer der Vorfußentlastung auch eine möglichst gute Gleichverteilung des Drucks. Plantare Druckverteilungsmessung Die gesamte Bodenkraft F (erzeugt vom Gewicht des Probanden und von Trägheitskräften) verteilt sich über die Kontaktfläche der Fußsohle zum Boden. Denkt man sich diese Kontaktfläche aufgeteilt in kleine, z.b. quadratische Flächensegmente, so trifft auf jedes dieser Segmente ein kleiner Teil der gesamten Bodenreaktionskraft. Der Wert der vertikalen Kraftkomponente pro Flächenelement p = wird als Druck bezeichnet und in N/cm² 2 F A angegeben. Der momentane Kraftangriffspunkt ist einfach der Schwerpunkt aller Teilkräfte. Abb. 1, schematisch: lokale Kräfteverteilung an der Fußsohle, resultierende Gesamtkraft und Kraftangriffspunkt 2 Umrechnungsfaktoren häufiger Druckeinheiten: 10 4 Pa = 0,1 bar = 1 N/cm 2 = 75,006 mmhg = 75,006 Torr Die SI-Einheit des Druckes ist Pascal (Pa). Im medizinischen Bereich werden häufig N/cm 2 bzw. mmhg verwendet. Seite 3
4 Die Verteilung des Drucks über die Fläche kann man mit Druckverteilungsmesssystemen sichtbar machen. Verbreitet ist in der Biomechanik die flächendeckende Messung der Druckverteilung unter der Fußsohle mit in den Boden eingebauten Messplattformen und mit Einlegemesssohlen. Im Beispiel Abb. 2 geht der Patient barfuß über die Plattform. Das Pedogramm des Probanden dieser Studie ergibt das typische Druckverteilungsbild bei einem erwachsenen Probanden. (Allerdings können auch bei vollkommen gesunden Probanden die Druckverteilungsbilder unterschiedlich ausfallen.) Typisch: Verlauf der Ganglinie beginnend Mitte Ferse, leicht lateral gebogen, zwischen D1 und D2 endend, kein Verharren der Ganglinie (Markierungen in Abb. 2b gleichmäßig fortschreitend) flächenhafte Druckverteilung im Ballenbereich, einzelne Metatarsaleköpfchen nicht sichtbar, alle Zehen sichtbar Druckmaxima an Ferse, Vorfußballen und Großzehe von vergleichbarer Höhe, Werte bis ca. 40 N/cm² (Druckskala in den Abbildungen), aber abhängig von der Ganggeschwindigkeit, geringe Druckwerte zwischen Ferse und Ballen, kein Aufliegen im medialen mittleren Abb. 2a, Pedogramm, plantare Druckverteilung beim Gehen, links: Druckmaxima, rechts abgeleitete Parameterkurven, vor allem die Vertikalkraft im mittleren Diagramm Abb. 2b, interpolierte Darstellung Seite 4
5 Fußbereich Gerade Linie von Zentrum Ferse Großzehballen - Großzehe Abb. 2c, Abrollen des Fußes Bild für Bild, Messrate ist 72 vollständige Druckverteilungsbilder pro Sekunde Druckverteilungsmessungen im Schuh Für die Versorgung mit orthopädischen Schuhen, Einlegesohlen etc. ist natürlich die Messung der Druckverteilung im Schuh von ausschlaggebender Bedeutung. Die Druckverteilungsmessungen im Schuh wurden in dieser Studie mit Parotec- Druckmesssohlen gemacht. Diese Messsohlen sind nur in Bereichen, die besonders exponierten Stellen der Fußsohle entsprechen, mit Drucksensoren bestückt. Die beiden Druckmesssohlen für linken und rechten Fuß enthalten jeweils 16 derartige integrierte Hydro-Messzellen. Die eigentlichen Drucksensoren sind piezoresistive Sensoren in den Hydrozellen. Abb. 3 zeigt die Positionen und Größen der Messzellen in den Sohlen. Problematisch an diesem Einzelsensorsystem ist offensichtlich ihr Zuschnitt auf einen durchschnittlichen Normalfuß. Bei abweichender Fußform liegen anatomische Strukturen des Fußes möglicherweise außerhalb oder gerade zwischen den Sensoren und werden vom Messgerät übersehen. Geeigneter wären Systeme mit flächenfüllender Sensorik und ausreichend hoher Anzahl Einzelsensoren. Für die Messungen zu dieser Studie an ein und demselben Probanden ist das aber nicht ganz so problematisch. Um eine Verschiebung der Sohlen von Messung zu Messung zu vermeiden, wurden diese an der Fußsohle des Probanden festgeklebt. Die Ergebnisse der ersten Messung (OPED01, vgl. Kapitel Ergebnisse), bei der der Proband an beiden Füßen seine Sportschuhe trägt, zeigen eine hohe Symmetrie von links und rechts, bei ein und demselben Probanden ist also durchaus eine ausreichende Reproduzierbarkeit der Messungen zu erwarten. Seite 5
6 Abb. 3, maßstäblich: Größe und Position der Einzel- Drucksensoren auf den Druckmesssohlen. Die Sensoren sind über Kabel mit einem Controller und einem Rechner verbunden. Auf diese Weise können die Signale der Sensoren in Echtzeit und praktisch unbegrenzt lange ausgelesen werden. Die zeitliche Auflösung der Sensoren liegt bei 1000 Messungen pro Sekunde. Abb. 4, Druckmessungen mit Mess-Einlegesohlen in beiden Schuhen und Kabelverbindung zum Messrechner. Abb. 5, einzelne Hydrozelle mit piezoresistivem Mikrosensor, Kabelanschluss Zeitreihen Abb. 6a zeigt den Druckverlauf für alle 32 Sensoren während 40 Sekunden Messzeit beim Treppensteigen. In Abb. 6b wird ein 5-Sekunden-Zeitausschnitt aus einer anderen Messung vergrößert. Jetzt ist die zeitliche Abfolge in den Druckverläufen der einzelnen Sensoren zu verfolgen. Typischerweise werden im Verlauf des Bodenkontakts zuerst die Sensoren an der Ferse belastet, zum Ende des Bodenkontakts die Sensoren am Vorfuß. Die höchsten Druckwerte treten an der Ferse und am Vorfußballen auf. Im mittleren Fußbereich bleiben die Druckwerte z. T. sehr gering. Seite 6
7 Abb. 6a, Druckverlauf aller 32 Sensoren während 40 Sekunden Messzeit, Treppauf- und Treppabgehen. Sensoren 1 bis 16 (rot) an der linken Messsohle, Sensoren 17 bis 32 an der rechten Sohle. 0 bis 5 Sekunden Treppaufgehen, Wende, bis 11 Sekunden Treppabgehen, Wende, etc. Abb. 6b, 5 Sekunden Ausschnitt aus einer 40-sekündigen Messung auf dem Laufband. Seite 7
8 Abb. 7, Auftrennung der Messdaten in Schrittsequenzen: Beim Auftreten der Ferse beginnt die Bodenkontaktphase (grüne Markierung) beim Abheben der Zehen endet sie wieder (rote Markierung). Über die einzelnen Bodenkontaktphasen kann anschließend gemittelt werden. Druckmaximaanalyse Eine Methode der Datenanalyse (die in ähnlicher Weise bei ganz anderen Fragestellungen und Messverfahren angewendet werden kann, z.b. EMG-Messungen): Die Druckkurven werden auf die Häufigkeit aller vorkommenden Druckwerte untersucht. Während der 40 Sekunden Messzeit wird jeder Drucksensor =16000-mal aufgezeichnet: Alle Messwerte werden in ein Häufigkeitsregister mit 0.1 N/cm² Druckbreite Auflösung eingetragen. Je größer die Druckvariationen sind, desto breiter und flacher wird die Verteilung (z.b. Abb. 8). Je konstanter der Druck ist, desto schmaler und linienartiger wird die Verteilung. Die Häufigkeitsverteilung selbst wird dann auf ihr Maximum hin untersucht (blaue und rote Markierungen in Abb. 8). Um Effekte durch einzelne Mess- Ausreißer zu vermeiden, wird nicht das absolute Druck- Maximum der Verteilung gesucht, sondern der Wert, bei dem noch ein bestimmter Prozentsatz (1 Prozent) aller Messwerte oberhalb der Grenze liegt (vgl. Abb. 9. (Alternativ könnte der Wert als Grenze gewählt werden, bei dem die Verteilung einen bestimmten Prozentsatz des Gesamt-Maximums der Verteilung überschreitet.) Seite 8
9 Abb. 8, zur Ermittlung der Häufigkeitsverteilung der Druckwerte einer Messung: Jeder der Messwerte des Drucks (rechts) wird links in ein Zählregister eingetragen. In der Verteilung wird die Obergrenze bestimmt. Die Häufigkeitsverteilung wird so normiert, dass die Fläche unter der Kurve 1 ist. Abb. 9, Festlegung der Obergrenze der Häufigkeitsverteilung der gemessenen Druckwerte eines Sensors. m = 1 Die so ermittelten Druckbereichsobergrenzen werden zwischen linkem Fuß (Testschuh) und rechtem Fuß (Normalschuh) verglichen, bzw. zwischen verschiedenen Versorgungsfällen des linken Fußes. Diese Druckwerte sind in Abb. 10 links als Druckverteilungen wiedergegeben. Abb. 7 rechts zeigt das plantare Druckverteilungsmuster beim Barfußgehen des Probanden der Messungen. Abb. 10, Darstellung der gemessenen Druckwerte als Druckverteilungen. Hier: links und rechts Normalschuh (Messung OPED01). Höhere Drücke in helleren Farbabstufungen. Ganz rechts: hochauflösende Druckverteilungsmuster unter der Fußsohle beim Barfußgehen, Druckmaximabild (Druckskala rechts) Seite 9
10 Belastungsanalyse Zur weiteren Auswertung ist die Fragestellung entscheidender Wegweiser. In unserem Falle interessiert uns die Eignung verschiedener Hilfsmittel zur Vorfußentlastung. Die Verteilung der Gesamtlast auf die verschiedenen Areale des Fußes soll also vermehrt zu Lasten des Fersenbereichs erfolgen und zur Entlastung des Vorfußes. Zur Analyse werden die Drucksensoren zu vier Gruppen zusammengefasst, Ferse, Mittelfuß, Vorfußballen, Großzehe (vgl. Abb. 11), bzw. weiter vereinfacht zu zwei Gruppen, Rückfuß und Vorfuß (Abb. 12). Abb. 11, Zusammenfassung von Drucksensoren zu vier Gruppen, Ferse, Mittelfuß, Vorfußballen, Großzehe. Abb. 12, Zusammenfassung von Drucksensoren zu zwei Gruppen, Rückfuß und Vorfuß. Geht man den Weg aus Abb. 1 ein Stück zurück und integriert die Druckverteilung über einzelne Areale des Fußes wieder auf, so erhält man die Bodenkraft auf diese ausgewählten Bereiche (genaugenommen die vertikale Komponente der Kraft, die aber der weit überwiegende Teil ist). Im Falle der nicht-flächenfüllenden Messung mit Einzeldrucksensoren darf dabei aber nicht nur über die Fläche der Sensoren selbst integriert werden, sondern auch über die Totflächen zwischen den Sensoren mit unbekannter Höhe des Drucks. Vereinfacht könnte man jeden einzelnen Sensor als repräsentativ für seine ganze Umgebung betrachten und davon ausgehen, dass in Seite 10
11 dieser Umgebung der Druck konstant gleich dem gemessenen Druck des Sensors ist (Abb. 13). Abb. 13, Zuordnung von repräsentativen Flächen zu den einzelnen Drucksensoren. Sensor Fläche (%) 1 8,4 2 7,0 3 5,9 4 8,7 5 6,0 6 5,6 7 4,7 8 5,5 9 4,9 10 5,8 11 4,7 12 4,5 13 5,2 14 4,2 15 2,9 16 2,4 in Prozent der Gesamtfläche einer Sohle Diese Zuordnung von repräsentativen Flächen ist nicht frei von Willkür und die so ermittelte Bodenkraft trifft die Realität vermutlich nur bedingt. Weil der eigentliche Drucksensor im Zentrum seiner repräsentierten Fläche liegt, wird der tatsächliche mittlere Druck in Wirklichkeit meistens geringer sein. Dadurch wird die Bodenkraft tendenziell überschätzt. Zur Verbesserung dieses Verfahrens wird aus der Kurve der für jeden Fuß ermittelten Gesamtkraft über alle Flächensegmente ein weiterer Skalierungsfaktor gewonnen. Dabei wird berücksichtigt, dass die Gesamtkraft im mittleren Teil der Bodenkontaktphase etwa dem bekannten Körpergewicht des Probanden entspricht. Der Proband der Messung in Abb. 14 hat ein Körpergewicht von 78 kg (780 N), die Messung ergibt dagegen ein Gewicht von 1500 N. Der Korrektur-Skalierungsfaktor ist deshalb 780 N / 1500 N = Abb. 14a, in der mittleren Standphase sollte die Gesamtbodenkraft im Mittel genau das Körpergewicht ergeben. Bei fehlender Gewichtsnormierung ergibt sich ein um etwa einen Faktor 2 zu großes Gewicht. Daraus errechnet sich der Kalibrierungsfaktor von etwa 0.5. Abb. 14b, auf Körpergewicht normierte Bodenkraft Seite 11
12 Die Belastungsanalyse mathematisch zusammengefasst: 1. der Sensor i misst den Druck p i (t) in jedem Zeitpunkt t im Verlauf des Abrollens, 2. zu jedem Einzel-Drucksensor i wird rein geometrisch eine repräsentative Fläche a i zugeordnet (vgl. Abb. 13), Druck p i (t) mal Fläche a i ergibt die Kraft auf diese Teilfläche, 3. die Gesamtkraft F gesamt in der Standphase wird durch das Körpergewicht M des Probanden (in kg) bestimmt F gesamt = M g, m g = sec 4. die Aufsummierung der Druckwerte aller Sensoren mal deren repräsentierte Fläche muss im mittleren Teil der Standphase ebenfalls das Körpergewicht ergeben (vgl. Abb. 14), dazu wird ein Skalierungsfaktor s eingeführt, sodass: alle _ Sensoren Fgesamt = M g = s ai pi ( t) i bzw.: alle _ Sensoren s = ( M g) /( ai pi ( t)) i (weil die Gesamtkraft auch in der mittleren Standphase etwas variiert, wird ein Mittelwert gebildet), 5. damit lässt sich jetzt für Teilflächen der Fußsohle die Kraftbelastung zu jedem Zeitpunkt t berechnen: F teil ( t) = s Sensoren _ in _ der _ Teilfläche ai pi ( t) i 6. Integriert man die Teilkraft F teil über die Zeitdauer des Bodenkontaktes, ergibt das die Gesamtbelastung (den Kraftstoß K) in diesem Areal: K teil Abstoßen = F teil t= Auftreten dt 7. die gesamte Messzeit wird in einzelne Schrittzyklen aufgeteilt. Aus diesen Einzelsequenzen wird ein gemittelter Schrittzyklus gebildet. Diese Mittelung kann im Prinzip an fast beliebiger Stelle des gesamten Verfahrens erfolgen: Beispielsweise schon nach Punkt 1., dann erhält man auch mittlere Druckverläufe der einzelnen Sensoren. Seite 12
13 Abb. 15, Teilkräfte in den vier Fußarealen aus Abb. 11 im Verlauf des Abrollens. Anhand der in Abb. 13 beschriebenen repräsentativen Sensorflächen werden den Druckwerten der einzelnen Sensoren zunächst Kräfte zugeordnet und dann über die Gruppen zu lokaler Bodenkraft und über die Sohlen-Gesamtfläche zur gesamten Vertikalkraft aufaddiert. Im oberen Diagramm alle einzelnen Schrittzyklen übereinander gezeichnet und mittlere Kraftkurven in den vier Gruppen gebildet. Im zweiten Diagramm sind nur noch die mittleren Kurven wiedergegeben. Die Graustufenwahl bei den Kraftkurven: von der Fersengruppe zu den Zehen wird der Grauwert schrittweise heller, die Gesamtkraftkurve ist schwarz. Die Gesamtkraftkurve entspricht etwa dem in der Ganganalyse normalen doppelgipfligen Verlauf der Vertikalkraft, das mittlere Maximalniveau dem Körpergewicht des Probanden. Im dritten Diagramm werden nur zwei Gruppen, Vorfuß und Rückfuß wie in Abb. 12 definiert, außerdem die Gesamtkraftkurve. Im vierten Diagramm werden die Flächen unter den Kurven für Vorfuß und Rückfuß zur Verdeutlichung eingefärbt, grün: Rückfuß, rosa: Vorfuß. Im rot markierten Feld rechts oben werden die Größen der farbigen Kurvenflächen wiedergegeben (in Kraft-mal-Zeit-Einheiten, das sind physikalische Kraftstöße in Newtonsekunden). Grüne Flächen bedeuten somit Rückfußbelastung, rote Flächen Vorfußbelastung. Das letzte Diagramm zeigt eine entsprechende Messung an einem Vorfußentlastungsschuh, die Belastung hat sich im Vergleich zum Normalschuh beim vorherigen Diagramm deutlich in Richtung Ferse verschoben. Seite 13
14 2 Messergebnisse Gehen auf dem Laufband, 3 km/h Messung OPED01, Sportschuh (linke und rechte Sohle) Druckmaximabild: Hohe Symmetrie zwischen rechter und linker Sohle, Druck an Ferse und Vorfuß von vergleichbarer Größe, geringer Druck im mittleren Fußbereich (vgl. Abb. 10). Oberes Diagramm: nur linke Sohle, vier Sensorgruppen Ferse, Mittelfuß, Vorfußballen, Großzehe und die Gesamtkraftkurve, unteres Diagramm: nur zwei Sensorgruppen (Rückfuß und Vorfuß), aber beide Füße übereinander dargestellt. Nur geringe Abweichungen der Kurven rechts und links. Verhältnis von Rückfußbelastung zu Vorfußbelastung im Mittel bei ca.: 45% zu 55% (Die Graustufenwahl in den Diagrammen: von der Fersengruppe zu den Zehen wird der Grauwert schrittweise heller, die Gesamtkurve ist schwarz.) Die hohe Symmetrie der Messergebnisse sowohl der Druckverteilung als auch der Belastungsanalyse zwischen linkem und rechtem Fuß zeigt, dass die Messmethode trotz der Bedenken hinsichtlich der Messgenauigkeit für die Anforderungen der Fragestellung dieser Studie durchaus ausreichend ist. Seite 14
15 OPED05, Vacopedes (linke Sohle, rechts Normalschuh) Druckverteilung links gleichmäßiger verteilt als im Normalschuh rechts, kein Großzehabdruck, Druckschwerpunkt auf der Ferse. Druckverteilung im Normalschuh (rechts) bleibt erhalten, Vorfußballen mit verstärkt medialer Belastung das Verhältnis von Rückfußbelastung zu Vorfußbelastung liegt bei: 77% zu 23% OPED09, Darco (linke Sohle, rechts Normalschuh) Druckverteilung links im Vorfuß gleichmäßiger verteilt als im Normalschuh rechts, kein Großzehabdruck, stark erhöhter Druckschwerpunkt auf der Ferse. Anders als beim Vacoped: medial in der Mitte des Fußes kein Aufliegen des Fußes. Druckverteilung im Normalschuh (rechts) bleibt erhalten, ebenfalls Vorfußballen mit verstärkt media- Beim Darco ist die Verschiebung zum Rückfuß geringer als beim Vacopedes, das Verhältnis von Rückfußbelastung zu Vorfußbelastung liegt bei: 62% zu 38% Seite 15
16 ler Belastung OPED13, Vacoped TC (linke Sohle, rechts Normalschuh) Druckverteilung links noch gleichmäßiger als im Vacoped, kein Großzehabdruck, Druckschwerpunkt auf der Ferse. Druckverteilung im Normalschuh (rechts) bleibt erhalten, Vorfußballen mit verstärkt medialer Belastung Beim Vacopedes TC ist das Verhältnis von Rückfußbelastung zu Vorfußbelastung genau gleich wie beim Vacoped: 77% zu 23% OPED17, Bledsoe Diabetikerboot (rechte Sohle! links Normalschuh) sehr geringe Druckmaxima rechts, nicht ganz so gleichmäßig verteilt wie beim Vacoped TC Normalschuh links wieder mit leicht erhöhter medialer Ballenbelastung, leichte distale Erhöhung des Drucks im Vorfuß Beim Bledsoe Diabetikerboot ist das Verhältnis von Rückfußbelastung zu Vorfußbelastung fast gleich wie beim Vacopedes bzw. Vacopedes TC: 76% zu 24% Seite 16
17 OPED21, Sportschuh + Tape (linke Sohle) Zum Vergleich: Messung OPED01 (die beiden defekten Fersensensoren links auf 0 gesetzt!) keine eindeutige Veränderung durch das Tape OPED25, Vacopedes + Tape (linke Sohle) Zum Vergleich Messung OPED05, Vacopedes ohne Tape (die beiden defekten Fersensensoren links auf 0 gesetzt!) Durch das Tape nur geringfügige Veränderungen der Druckverteilung Seite 17
18 OPED31, Darco + Tape (linke Sohle) ohne Tape: das Verhältnis von Rückfußbelastung zu Vorfußbelastung bleibt bei: 62% zu 38% Auch der Kurvenverlauf ändert sich praktisch nicht. praktisch keine Veränderungen der Druckverteilung durch das Tape Seite 18
19 3 Zusammenfassung Mit Druckmesssohlen zum Einlegen in den Schuh wurde die Druckverteilung an der Fußsohle beim normalen Gehen untersucht. Daraus wird die Kraftbelastung in ausgewählten Arealen des Fußes berechnet. Darunter ist das Produkt aus Höhe der Kraft (in Newton [N]) mal Zeitdauer (in Sekunden [sec]) der Kraft zu verstehen (das ist jeweils die Fläche unter den in den anschließenden Diagrammen gezeigten Kurven in [Nsec], im physikalischen Sinne ist das ein sogenannter Kraftstoß). Alle Kurven sind über 40 Sekunden Messzeit (etwa 28 Doppelschritte) gemittelt. Im Folgenden wird die Fußfläche immer wie in der Abbildung rechts in zwei Teile aufgeteilt, Vorfuß (zugeordnete Farbe: lila) und Rückfuß (zugeordnete Farbe: grün). Zusammenfassung von Drucksensoren zu zwei Gruppen, Rückfuß und Vorfuß. Die folgenden Diagramme zeigen jeweils den Verlauf der Kraft auf Rückfuß und Vorfuß und der Gesamtkraft vom ersten Bodenkontakt (t = 0 Sekunden) bis zum Abheben der Zehen. Die Bodenkontaktdauer ist bei allen Therapieschuhen im Vergleich zum Normalschuh verkürzt, vermutlich wegen der reduzierten Plantarflexionsmöglichkeit im Sprunggelenk beim Abstoß. Im Normalschuh liegt das Verhältnis von Rückfußbelastung zu Vorfußbelastung im Mittel bei ca.: 45% zu 55%, die Vorfußbelastung ist folglich höher als die Rückfußbelastung. (im Diagramm rechts sind die Verhältnisse an beiden Füßen wiedergegeben) Seite 19
20 Beim Vacopedes verschiebt sich die Belastung stark zum Rückfuß, das Verhältnis von Rückfußbelastung zu Vorfußbelastung liegt bei: 77% zu 23% Beim Darco ist die Verschiebung zum Rückfuß geringer als beim Vacopedes, das Verhältnis von Rückfußbelastung zu Vorfußbelastung liegt bei: 62% zu 38% In einer Versuchsreihe wurde das Sprunggelenk des Probanden zusätzlich getapet. Die Belastungsverhältnisse änderten sich dadurch nicht messbar. Hier im Beispiel beim Darco bleibt das Verhältnis von Rückfußbelastung zu Vorfußbelastung bei: 62% zu 38% Auch der Kurvenverlauf ändert sich praktisch nicht. Beim Vacopedes TC ist das Verhältnis von Rückfußbelastung zu Vorfußbelastung genau gleich wie beim Vacopedes: 77% zu 23% Sogar bis ganz zum Schluss des Bodenkontakts ist hier die Last im Rückfußbereich immer höher als die im Vorfuß. Seite 20
21 Beim Bledsoe Diabetikerboot ist das Verhältnis von Rückfußbelastung zu Vorfußbelastung fast gleich wie beim Vacopedes bzw. Vacopedes TC: 76% zu 24% Die folgenden Diagramme fassen die Zahlenergebnisse zur Übersicht noch einmal zusammen: Belastungsverhältnisse bei der Unterteilung des Fußes in 4 Bereiche: Prozentanteil Belastungsverhältnisse Rückfuß zu Vorfuß Ferse (%) 80 Mittelfuß (%) Vorfußballen (%) 70 Großzehe (%) Normalschuh (Mittel) Vacopedes Darco Vacopedes TC Bledsoe Diabetikerboot Prozentanteil Belastungsverhältnisse Rückfuß zu Vorfuß 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Normalschuh (Mittel) Vacopedes Darco Ferse Mittelfuß Vorfußballen Großzehe Vacopedes TC Bledsoe Diabetikerboot Belastungsverhältnisse bei der Unterteilung des Fußes in 2 Bereiche, Rückfuß und Vorfuß, Anteil des Rückfußes an der Gesamtlast in grünen Farbtönen dargestellt, Anteil des Vorfußes in rot: Belastungsverhältnisse Rückfuß zu Vorfuß Belastungsverhältnisse Rückfuß zu Vorfuß Prozentanteil Rückfuß Vorfuß Prozentanteil 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% % 20 20% 10 10% 0 0% Normalschuh Vacopedes Darco Vacopedes TC Bledsoe Diabetikerboot Normalschuh Vacopedes Rückfuß Darco Vorfuß Vacopedes TC Bledsoe Diabetikerboot Von den vier Therapieschuhen fällt nur der Darco etwas aus der Reihe, der weniger Lastübernahme im mittleren Fuß ermöglicht und damit auch weniger Entlastung des Vorfußes. Seite 21
22 4. Liste der Messungen am linken Fuß (rechter immer Sportschuh) Datei Sportschuh normal Gehen 3 km/h OPED01 Sportschuh Halbschritte Gehen 2 km/h OPED02 Sportschuh Treppensteigen OPED03 Sportschuh Treppe Halbschritte OPED04 Vacopedes normal Gehen 3 km/h OPED05 Vacopedes Halbschritte Gehen 2 km/h OPED06 Vacopedes Treppensteigen OPED07 Vacopedes Treppe Halbschritte OPED08 Darco normal Gehen 3 km/h OPED09 Darco Halbschritte Gehen 2 km/h OPED10 Darco Treppensteigen OPED11 Darco Treppe Halbschritte OPED12 Vacoped TC normal Gehen 3 km/h OPED13 Vacoped TC Halbschritte Gehen 2 km/h OPED14 Vacoped TC Treppensteigen OPED15 Vacoped TC Treppe Halbschritte OPED16 Bledsoe Diabetikerboot normal Gehen 3 km/h OPED17 Bledsoe Diabetikerboot Halbschritte Gehen 2 km/h OPED18 Bledsoe Diabetikerboot Treppensteigen OPED19 Bledsoe Diabetikerboot Treppe Halbschritte OPED20 Sportschuh + Tape normal Gehen 3 km/h OPED21 Sportschuh + Tape Halbschritte Gehen 2 km/h OPED22 Sportschuh + Tape Treppensteigen OPED23 Sportschuh + Tape Treppe Halbschritte OPED24 Vacopedes + Tape normal Gehen 3 km/h OPED25 Vacopedes + Tape Halbschritte Gehen 2 km/h OPED26 Vacopedes + Tape Treppensteigen OPED27 Vacopedes + Tape Treppe Halbschritte OPED28 Vacopedes + Tape + belüftet normal Gehen 3 km/h OPED29 Vacopedes + Tape + belüftet Halbschritte Gehen 2 km/h OPED30 Darco + Tape normal Gehen 3 km/h OPED31 Darco + Tape Halbschritte Gehen 2 km/h OPED32 Dipl. Phys. Jürgen Mitternacht Orthopädische Abteilung des Klinikums r. d. Isar der Technischen Universität München -Ganglabor- Ismaninger Str. 22, München Tel. (089) Juergen.Mitternacht@lrz.tu-muenchen.de Seite 22
23 Seite 23
Erfüllt VACOdiaped die Voraussetzungen einer Zweischalenorthese?
 Erfüllt VACOdiaped die Voraussetzungen einer Zweischalenorthese? Die Leitlinien des Bundesinnungsverbandes für Orthopädie-Technik für Beinorthesen bei Diabetes mellitus beinhalten einen stadiengerechten
Erfüllt VACOdiaped die Voraussetzungen einer Zweischalenorthese? Die Leitlinien des Bundesinnungsverbandes für Orthopädie-Technik für Beinorthesen bei Diabetes mellitus beinhalten einen stadiengerechten
Moderne Bewegungsanalyse- Aufwand versus Nutzen
 Moderne Bewegungsanalyse- Aufwand versus Nutzen Dr.-Ing. Heiko Tober Leipzig, den 23. 05. 2008 So spielt das Leben STÜSSI hat Untersuchungen durchgeführt, in denen er 219 praktizierenden Ärzten, Physiotherapeuten
Moderne Bewegungsanalyse- Aufwand versus Nutzen Dr.-Ing. Heiko Tober Leipzig, den 23. 05. 2008 So spielt das Leben STÜSSI hat Untersuchungen durchgeführt, in denen er 219 praktizierenden Ärzten, Physiotherapeuten
Untersuchung zur Kratz- und Auflagenbeständigkeit von direkt bebilderten Druckplatten beim Offsetdruck
 Untersuchung zur Kratz- und Auflagenbeständigkeit von direkt bebilderten Druckplatten beim Offsetdruck Kapitelnummer Stichwort 3.3.2 (Langfassung) Druckmessung beim Tragen von Druckplattenpaketen Aufbau
Untersuchung zur Kratz- und Auflagenbeständigkeit von direkt bebilderten Druckplatten beim Offsetdruck Kapitelnummer Stichwort 3.3.2 (Langfassung) Druckmessung beim Tragen von Druckplattenpaketen Aufbau
Kartendienst zur Luftschadstoffbelastung in Deutschland
 Kartendienst zur Luftschadstoffbelastung in Deutschland Eine interaktive Darstellung der räumlichen Verteilung von Feinstaub, Ozon und Stickstoffdioxid sowie Arsen, Blei, Cadmium, Nickel und Benzo(a)pyren
Kartendienst zur Luftschadstoffbelastung in Deutschland Eine interaktive Darstellung der räumlichen Verteilung von Feinstaub, Ozon und Stickstoffdioxid sowie Arsen, Blei, Cadmium, Nickel und Benzo(a)pyren
Gangparameter von verschiedenen Schuhen
 Gangparameter von verschiedenen Schuhen Kinetik & Kinematik Patrick Hiltpold Aline Mühl Dr. Renate List Dr. Dr. Silvio Lorenzetti Vergleich der Bewegungen & Kräfte von: Barfuss - MBT - kyboot - Joya -
Gangparameter von verschiedenen Schuhen Kinetik & Kinematik Patrick Hiltpold Aline Mühl Dr. Renate List Dr. Dr. Silvio Lorenzetti Vergleich der Bewegungen & Kräfte von: Barfuss - MBT - kyboot - Joya -
Bei näherer Betrachtung des Diagramms Nr. 3 fällt folgendes auf:
 18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
Grundlagen und technische Realisierungskonzepte zur Stand- und Bewegungsanalyse
 Grundlagen und technische Realisierungskonzepte zur Stand- und Bewegungsanalyse Dr.-Ing. Heiko Tober Leipzig, den 12. 05. 2006 Vortragsgliederung Historie der Stand- und Bewegungsanalyse Grundlagen der
Grundlagen und technische Realisierungskonzepte zur Stand- und Bewegungsanalyse Dr.-Ing. Heiko Tober Leipzig, den 12. 05. 2006 Vortragsgliederung Historie der Stand- und Bewegungsanalyse Grundlagen der
Mittelpunkt des Sprunggelenks
 IDEAL Technologien IDEAL HEEL Fördert die korrekte Ausrichtung und reduziert Hebelarme Ideal Heel führt dazu, dass sich der Bodenkontakt und Kraftansatzpunkt weiter nach vorn verlagert. Der Läufer landet
IDEAL Technologien IDEAL HEEL Fördert die korrekte Ausrichtung und reduziert Hebelarme Ideal Heel führt dazu, dass sich der Bodenkontakt und Kraftansatzpunkt weiter nach vorn verlagert. Der Läufer landet
V.2 Phasengleichgewichte
 Physikalisch-Chemisches Praktikum II WS 02/03 Josef Riedl BCh Team 4/1 V.2 Phasengleichgewichte V.2.1 Gegenstand des Versuches Als Beispiel für ein Phasengleichgewicht im Einstoffsystem wird die Koexistenzkurve
Physikalisch-Chemisches Praktikum II WS 02/03 Josef Riedl BCh Team 4/1 V.2 Phasengleichgewichte V.2.1 Gegenstand des Versuches Als Beispiel für ein Phasengleichgewicht im Einstoffsystem wird die Koexistenzkurve
Kartendienst zur Luftschadstoffbelastung in Deutschland
 Kartendienst zur Luftschadstoffbelastung in Deutschland Eine interaktive Darstellung der räumlichen Verteilung von Feinstaub, Ozon und Stickstoffdioxid Informationen zur Handhabung I. Datenaufbereitung
Kartendienst zur Luftschadstoffbelastung in Deutschland Eine interaktive Darstellung der räumlichen Verteilung von Feinstaub, Ozon und Stickstoffdioxid Informationen zur Handhabung I. Datenaufbereitung
Elastizität und Torsion
 INSTITUT FÜR ANGEWANDTE PHYSIK Physikalisches Praktikum für Studierende der Ingenieurswissenschaften Universität Hamburg, Jungiusstraße 11 Elastizität und Torsion 1 Einleitung Ein Flachstab, der an den
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE PHYSIK Physikalisches Praktikum für Studierende der Ingenieurswissenschaften Universität Hamburg, Jungiusstraße 11 Elastizität und Torsion 1 Einleitung Ein Flachstab, der an den
Anpassungstests VORGEHENSWEISE
 Anpassungstests Anpassungstests prüfen, wie sehr sich ein bestimmter Datensatz einer erwarteten Verteilung anpasst bzw. von dieser abweicht. Nach der Erläuterung der Funktionsweise sind je ein Beispiel
Anpassungstests Anpassungstests prüfen, wie sehr sich ein bestimmter Datensatz einer erwarteten Verteilung anpasst bzw. von dieser abweicht. Nach der Erläuterung der Funktionsweise sind je ein Beispiel
Die Ganggeschwindigkeit eine zentrale Größe in der Ganganalyse. Dr. phil. Günther Hegewald. T&T medilogic Medizintechnik GmbH Schönefeld
 Die Ganggeschwindigkeit eine zentrale Größe in der Ganganalyse Dr. phil. Günther Hegewald T&T medilogic Medizintechnik GmbH Schönefeld 1. Einführung Um das Gehen zu ermöglichen, muß der Bewegungsapparat
Die Ganggeschwindigkeit eine zentrale Größe in der Ganganalyse Dr. phil. Günther Hegewald T&T medilogic Medizintechnik GmbH Schönefeld 1. Einführung Um das Gehen zu ermöglichen, muß der Bewegungsapparat
Funktion und Anwendung von akustischen Doppler Geräten
 Funktion und Anwendung von akustischen Doppler Geräten Dipl. Ing. Matthias Adler Bundesanstalt für Gewässerkunde Seminar der TU München, 11. und. 12. März 2004 Seite 1 Funktion und Anwendung von akustischen
Funktion und Anwendung von akustischen Doppler Geräten Dipl. Ing. Matthias Adler Bundesanstalt für Gewässerkunde Seminar der TU München, 11. und. 12. März 2004 Seite 1 Funktion und Anwendung von akustischen
MEDILOGIC Bedienungsanleitung
 MEDILOGIC Bedienungsanleitung Das telemetrische medilogic Fußdruckmesssystem ermöglicht eine kabellose Messung der auftretenden Druckbelastungen am Fuß des Patienten während des Gehens und im Stand. Die
MEDILOGIC Bedienungsanleitung Das telemetrische medilogic Fußdruckmesssystem ermöglicht eine kabellose Messung der auftretenden Druckbelastungen am Fuß des Patienten während des Gehens und im Stand. Die
Brückenschaltung (BRÜ)
 TUM Anfängerpraktikum für Physiker II Wintersemester 2006/2007 Brückenschaltung (BRÜ) Inhaltsverzeichnis 9. Januar 2007 1. Einleitung... 2 2. Messung ohmscher und komplexer Widerstände... 2 3. Versuchsauswertung...
TUM Anfängerpraktikum für Physiker II Wintersemester 2006/2007 Brückenschaltung (BRÜ) Inhaltsverzeichnis 9. Januar 2007 1. Einleitung... 2 2. Messung ohmscher und komplexer Widerstände... 2 3. Versuchsauswertung...
Herzlich Willkommen. bei Ihrem Sanitätshaus
 Herzlich Willkommen bei Ihrem Sanitätshaus Orthopädietechnische Versorgung des diabetischen Fußes Referent: Peter Kolar Orthopädie-Techniker-Meister ZIELE einer Versorgung des diabetischen Fußes Risikominimierung
Herzlich Willkommen bei Ihrem Sanitätshaus Orthopädietechnische Versorgung des diabetischen Fußes Referent: Peter Kolar Orthopädie-Techniker-Meister ZIELE einer Versorgung des diabetischen Fußes Risikominimierung
Das neue FDM-System von zebris- Ganganalyse für die Praxis
 Das neue FDM-System von zebris- Ganganalyse für die Praxis The World of Biomechanics Das zebris FDM-System Einfache und schnelle Ganganalyse Das neue zebris FDM-Messsystem arbeitet mit hochwertigen kapazitiven
Das neue FDM-System von zebris- Ganganalyse für die Praxis The World of Biomechanics Das zebris FDM-System Einfache und schnelle Ganganalyse Das neue zebris FDM-Messsystem arbeitet mit hochwertigen kapazitiven
Physikalische Übungen für Pharmazeuten
 Helmholtz-Institut für Strahlen- und Kernphysik Seminar Physikalische Übungen für Pharmazeuten Ch. Wendel Max Becker Karsten Koop Dr. Christoph Wendel Übersicht Inhalt des Seminars Praktikum - Vorbereitung
Helmholtz-Institut für Strahlen- und Kernphysik Seminar Physikalische Übungen für Pharmazeuten Ch. Wendel Max Becker Karsten Koop Dr. Christoph Wendel Übersicht Inhalt des Seminars Praktikum - Vorbereitung
1) Warum ist die Lage einer Verteilung für das Ergebnis einer statistischen Analyse von Bedeutung?
 86 8. Lageparameter Leitfragen 1) Warum ist die Lage einer Verteilung für das Ergebnis einer statistischen Analyse von Bedeutung? 2) Was ist der Unterschied zwischen Parametern der Lage und der Streuung?
86 8. Lageparameter Leitfragen 1) Warum ist die Lage einer Verteilung für das Ergebnis einer statistischen Analyse von Bedeutung? 2) Was ist der Unterschied zwischen Parametern der Lage und der Streuung?
Informationen gefalteter Lichtkurven
 Informationen gefalteter Lichtkurven Lienhard Pagel Lichtkurven entstehen aus vielfältigen Gründen durch Faltung. Dabei wird eine Periode vorgegeben oder gesucht und die Helligkeitswerte werden in der
Informationen gefalteter Lichtkurven Lienhard Pagel Lichtkurven entstehen aus vielfältigen Gründen durch Faltung. Dabei wird eine Periode vorgegeben oder gesucht und die Helligkeitswerte werden in der
Arbeitsweisen der Physik
 Übersicht Karteikarten Klasse 7 - Arbeitsweisen - Beobachten - Beschreiben - Beschreiben von Gegenständen, Erscheinungen und Prozessen - Beschreiben des Aufbaus und Erklären der Wirkungsweise eines technischen
Übersicht Karteikarten Klasse 7 - Arbeitsweisen - Beobachten - Beschreiben - Beschreiben von Gegenständen, Erscheinungen und Prozessen - Beschreiben des Aufbaus und Erklären der Wirkungsweise eines technischen
Autor: Dipl.-Ing. Herbert Trauernicht Stand
 1 Autor: Dipl.-Ing. Herbert Trauernicht Stand 30.10.2013 Der Lüftungslogger von www.luftdicht.de Der Lüftungslogger hat diesen Namen bekommen, weil er zunächst hauptsächlich dazu diente, Raumklimaaufzeichnungen
1 Autor: Dipl.-Ing. Herbert Trauernicht Stand 30.10.2013 Der Lüftungslogger von www.luftdicht.de Der Lüftungslogger hat diesen Namen bekommen, weil er zunächst hauptsächlich dazu diente, Raumklimaaufzeichnungen
Übungen mit dem Applet Vergleich von zwei Mittelwerten
 Vergleich von zwei Mittelwerten 1 Übungen mit dem Applet Vergleich von zwei Mittelwerten 1 Statistischer Hintergrund... 2 1.1 Typische Fragestellungen...2 1.2 Fehler 1. und 2. Art...2 1.3 Kurzbeschreibung
Vergleich von zwei Mittelwerten 1 Übungen mit dem Applet Vergleich von zwei Mittelwerten 1 Statistischer Hintergrund... 2 1.1 Typische Fragestellungen...2 1.2 Fehler 1. und 2. Art...2 1.3 Kurzbeschreibung
Messprotokoll: Aufnahme der Quantenzufallszahl
 Messprotokoll: Aufnahme der Quantenzufallszahl Am 19. Juni 2009 wurden für Max Mustermann um 8:35 Uhr mit Hilfe von einzelnen Photonen 993.097 Zufallszahlen generiert. Der Zufallsgenerator steht im Quantenoptiklabor
Messprotokoll: Aufnahme der Quantenzufallszahl Am 19. Juni 2009 wurden für Max Mustermann um 8:35 Uhr mit Hilfe von einzelnen Photonen 993.097 Zufallszahlen generiert. Der Zufallsgenerator steht im Quantenoptiklabor
Biomechanik des Gehens was kann die Orthopädie(schuh)technik beitragen? Dr. rer. nat. Oliver Ludwig. Initialer Bodenkontakt Lastaufnahme
 Dr. rer. nat. Oliver Ludwig Biomechanik des Gehens was kann die Orthopädie(schuh)technik beitragen? Initialer Bodenkontakt Lastaufnahme Initialer Bodenkontakt Lastaufnahme Muskulärer Steigbügel aktiviert
Dr. rer. nat. Oliver Ludwig Biomechanik des Gehens was kann die Orthopädie(schuh)technik beitragen? Initialer Bodenkontakt Lastaufnahme Initialer Bodenkontakt Lastaufnahme Muskulärer Steigbügel aktiviert
Kenngrößen von Projektoren
 Praktikum Juli 25 Fachgebiet Lichttechnik Bearbeiter: Torsten Maaß Kenngrößen von Projektoren (Lichttechnische Leistungsmerkmale). Ziel des Praktikumsversuches Ziel soll es sein, die lichttechnischen Parameter
Praktikum Juli 25 Fachgebiet Lichttechnik Bearbeiter: Torsten Maaß Kenngrößen von Projektoren (Lichttechnische Leistungsmerkmale). Ziel des Praktikumsversuches Ziel soll es sein, die lichttechnischen Parameter
Zugversuch - Versuchsprotokoll
 Gruppe 13: René Laquai Jan Morasch Rudolf Seiler 16.1.28 Praktikum Materialwissenschaften II Zugversuch - Versuchsprotokoll Betreuer: Heinz Lehmann 1. Einleitung Der im Praktikum durchgeführte Zugversuch
Gruppe 13: René Laquai Jan Morasch Rudolf Seiler 16.1.28 Praktikum Materialwissenschaften II Zugversuch - Versuchsprotokoll Betreuer: Heinz Lehmann 1. Einleitung Der im Praktikum durchgeführte Zugversuch
2 Gleichmässig beschleunigte Bewegung
 2 Gleichmässig beschleunigte Bewegung Ziele dieses Kapitels Du kennst die Definition der Grösse Beschleunigung. Du kannst die gleichmässig beschleunigte Bewegung im v-t- und s-t-diagramm darstellen. Du
2 Gleichmässig beschleunigte Bewegung Ziele dieses Kapitels Du kennst die Definition der Grösse Beschleunigung. Du kannst die gleichmässig beschleunigte Bewegung im v-t- und s-t-diagramm darstellen. Du
1 Atmosphäre (atm) = 760 torr = 1013,25 mbar = Pa 760 mm Hg ( bei 0 0 C, g = 9,80665 m s -2 )
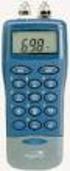 Versuch Nr.51 Druck-Messung in Gasen (Bestimmung eines Gasvolumens) Stichworte: Druck, Druckeinheiten, Druckmeßgeräte (Manometer, Vakuummeter), Druckmessung in U-Rohr-Manometern, Gasgesetze, Isothermen
Versuch Nr.51 Druck-Messung in Gasen (Bestimmung eines Gasvolumens) Stichworte: Druck, Druckeinheiten, Druckmeßgeräte (Manometer, Vakuummeter), Druckmessung in U-Rohr-Manometern, Gasgesetze, Isothermen
Auswertung und Lösung
 Dieses Quiz soll Ihnen helfen, Kapitel 4.7 und 4.8 besser zu verstehen. Auswertung und Lösung Abgaben: 71 / 265 Maximal erreichte Punktzahl: 8 Minimal erreichte Punktzahl: 0 Durchschnitt: 5.65 Frage 1
Dieses Quiz soll Ihnen helfen, Kapitel 4.7 und 4.8 besser zu verstehen. Auswertung und Lösung Abgaben: 71 / 265 Maximal erreichte Punktzahl: 8 Minimal erreichte Punktzahl: 0 Durchschnitt: 5.65 Frage 1
Methoden der Werkstoffprüfung Kapitel II Statistische Verfahren I. WS 2009/2010 Kapitel 2.0
 Methoden der Werkstoffprüfung Kapitel II Statistische Verfahren I WS 009/010 Kapitel.0 Schritt 1: Bestimmen der relevanten Kenngrößen Kennwerte Einflussgrößen Typ A/Typ B einzeln im ersten Schritt werden
Methoden der Werkstoffprüfung Kapitel II Statistische Verfahren I WS 009/010 Kapitel.0 Schritt 1: Bestimmen der relevanten Kenngrößen Kennwerte Einflussgrößen Typ A/Typ B einzeln im ersten Schritt werden
WAS soll dieses Programm?
 WAS soll dieses Programm? Es wird errechnet, welche PRISMATISCHEN BELASTUNGEN ( Nebenwirkungen ) auf das Augenpaar zukommen bei den eingegebenen Brillenglas-Werten. Das ist besonders wichtig bei der Versorgung
WAS soll dieses Programm? Es wird errechnet, welche PRISMATISCHEN BELASTUNGEN ( Nebenwirkungen ) auf das Augenpaar zukommen bei den eingegebenen Brillenglas-Werten. Das ist besonders wichtig bei der Versorgung
VU mathematische methoden in der ökologie: räumliche verteilungsmuster 1/5 h.lettner /
 VU mathematische methoden in der ökologie: räumliche verteilungsmuster / h.lettner / Analyse räumlicher Muster und Verteilungen Die Analyse räumlicher Verteilungen ist ein zentrales Gebiet der ökologischen
VU mathematische methoden in der ökologie: räumliche verteilungsmuster / h.lettner / Analyse räumlicher Muster und Verteilungen Die Analyse räumlicher Verteilungen ist ein zentrales Gebiet der ökologischen
Strahlenbelastung durch Eckert & Ziegler?
 Strahlenbelastung durch Eckert & Ziegler? Radioaktiver Strahlung ist der Mensch täglich ausgesetzt. Diese stammt überwiegend aus natürlichen Strahlungsquellen. Je nach Ort kann diese sehr unterschiedlich
Strahlenbelastung durch Eckert & Ziegler? Radioaktiver Strahlung ist der Mensch täglich ausgesetzt. Diese stammt überwiegend aus natürlichen Strahlungsquellen. Je nach Ort kann diese sehr unterschiedlich
Bedienhandbuch. Modul: GP Balance. Softwareversion 6.0
 Bedienhandbuch Modul: Softwareversion 6.0 GeBioM mbh Johann-Krane-Weg 21 Germany - 48149 Münster Phone +49 251 98724-0 Fax +49 251 98724-22 e-mail info@gebiom.de www.gebiom.de II Inhaltsverzeichnis 4 Kapitel
Bedienhandbuch Modul: Softwareversion 6.0 GeBioM mbh Johann-Krane-Weg 21 Germany - 48149 Münster Phone +49 251 98724-0 Fax +49 251 98724-22 e-mail info@gebiom.de www.gebiom.de II Inhaltsverzeichnis 4 Kapitel
Protokoll Grundpraktikum I: T6 Thermoelement und newtonsches Abkühlungsgesetz
 Protokoll Grundpraktikum I: T6 Thermoelement und newtonsches Abkühlungsgesetz Sebastian Pfitzner 5. Juni 03 Durchführung: Sebastian Pfitzner (553983), Anna Andrle (55077) Arbeitsplatz: Platz 3 Betreuer:
Protokoll Grundpraktikum I: T6 Thermoelement und newtonsches Abkühlungsgesetz Sebastian Pfitzner 5. Juni 03 Durchführung: Sebastian Pfitzner (553983), Anna Andrle (55077) Arbeitsplatz: Platz 3 Betreuer:
Die erhobenen Daten werden zunächst in einer Urliste angeschrieben. Daraus ermittelt man:
 Die erhobenen Daten werden zunächst in einer Urliste angeschrieben. Daraus ermittelt man: a) Die absoluten Häufigkeit: Sie gibt an, wie oft ein Variablenwert vorkommt b) Die relative Häufigkeit: Sie erhält
Die erhobenen Daten werden zunächst in einer Urliste angeschrieben. Daraus ermittelt man: a) Die absoluten Häufigkeit: Sie gibt an, wie oft ein Variablenwert vorkommt b) Die relative Häufigkeit: Sie erhält
Versuch 11 Einführungsversuch
 Versuch 11 Einführungsversuch I Vorbemerkung Ziel der Einführungsveranstaltung ist es Sie mit grundlegenden Techniken des Experimentierens und der Auswertung der Messdaten vertraut zu machen. Diese Grundkenntnisse
Versuch 11 Einführungsversuch I Vorbemerkung Ziel der Einführungsveranstaltung ist es Sie mit grundlegenden Techniken des Experimentierens und der Auswertung der Messdaten vertraut zu machen. Diese Grundkenntnisse
Grundlagen der Elektro-Proportionaltechnik
 Grundlagen der Elektro-Proportionaltechnik Totband Ventilverstärkung Hysterese Linearität Wiederholbarkeit Auflösung Sprungantwort Frequenzantwort - Bode Analyse Der Arbeitsbereich, in dem innerhalb von
Grundlagen der Elektro-Proportionaltechnik Totband Ventilverstärkung Hysterese Linearität Wiederholbarkeit Auflösung Sprungantwort Frequenzantwort - Bode Analyse Der Arbeitsbereich, in dem innerhalb von
Oberstufe (11, 12, 13)
 Department Mathematik Tag der Mathematik 1. Oktober 009 Oberstufe (11, 1, 1) Aufgabe 1 (8+7 Punkte). (a) Die dänische Flagge besteht aus einem weißen Kreuz auf rotem Untergrund, vgl. die (nicht maßstabsgerechte)
Department Mathematik Tag der Mathematik 1. Oktober 009 Oberstufe (11, 1, 1) Aufgabe 1 (8+7 Punkte). (a) Die dänische Flagge besteht aus einem weißen Kreuz auf rotem Untergrund, vgl. die (nicht maßstabsgerechte)
Nichtrealistische Darstellung von Gebirgen mit OpenGL
 Nichtrealistische Darstellung von Gebirgen mit OpenGL Großer Beleg Torsten Keil Betreuer: Prof. Deussen Zielstellung Entwicklung eines Algorithmus, der die 3D- Daten einer Geometrie in eine nichtrealistische
Nichtrealistische Darstellung von Gebirgen mit OpenGL Großer Beleg Torsten Keil Betreuer: Prof. Deussen Zielstellung Entwicklung eines Algorithmus, der die 3D- Daten einer Geometrie in eine nichtrealistische
ORTHOControl Innensohlen-Messung
 ORTHOControl Innensohlen-Messung Funktionsübersicht Auf den folgenden Seiten finden Sie Übersicht über die Programmfunktionen. Erfahren Sie, wie Sie mit ORTHOControl schnell und einfach eine Versorgungskontrolle
ORTHOControl Innensohlen-Messung Funktionsübersicht Auf den folgenden Seiten finden Sie Übersicht über die Programmfunktionen. Erfahren Sie, wie Sie mit ORTHOControl schnell und einfach eine Versorgungskontrolle
1 Messfehler. 1.1 Systematischer Fehler. 1.2 Statistische Fehler
 1 Messfehler Jede Messung ist ungenau, hat einen Fehler. Wenn Sie zum Beispiel die Schwingungsdauer eines Pendels messen, werden Sie - trotz gleicher experimenteller Anordnungen - unterschiedliche Messwerte
1 Messfehler Jede Messung ist ungenau, hat einen Fehler. Wenn Sie zum Beispiel die Schwingungsdauer eines Pendels messen, werden Sie - trotz gleicher experimenteller Anordnungen - unterschiedliche Messwerte
Kapitel 7. Crossvalidation
 Kapitel 7 Crossvalidation Wie im Kapitel 5 erwähnt wurde, ist die Crossvalidation die beste Technik, womit man die Genauigkeit der verschiedenen Interpolationsmethoden überprüft. In diesem Kapitel wurde
Kapitel 7 Crossvalidation Wie im Kapitel 5 erwähnt wurde, ist die Crossvalidation die beste Technik, womit man die Genauigkeit der verschiedenen Interpolationsmethoden überprüft. In diesem Kapitel wurde
Entwicklung spezieller Lösungen für die Messtechnik. Schallgeschwindigkeits-, Viskositäts- und Leitfähigkeitsmessungen an Polymer - Dispersionen
 Mess - und Analysentechnik Dr. Dinger Entwicklung spezieller Lösungen für die Messtechnik Applikationsberatung und technische Untersuchungen MAT Dr. Dinger Ludwig-Erhard-Strasse 12 34131 Kassel Vertrieb
Mess - und Analysentechnik Dr. Dinger Entwicklung spezieller Lösungen für die Messtechnik Applikationsberatung und technische Untersuchungen MAT Dr. Dinger Ludwig-Erhard-Strasse 12 34131 Kassel Vertrieb
Die Summen- bzw. Differenzregel
 Die Summen- bzw Differenzregel Seite Kapitel mit Aufgaben Seite WIKI Regeln und Formeln Level Grundlagen Aufgabenblatt ( Aufgaben) Lösungen zum Aufgabenblatt Aufgabenblatt (7 Aufgaben) Lösungen zum Aufgabenblatt
Die Summen- bzw Differenzregel Seite Kapitel mit Aufgaben Seite WIKI Regeln und Formeln Level Grundlagen Aufgabenblatt ( Aufgaben) Lösungen zum Aufgabenblatt Aufgabenblatt (7 Aufgaben) Lösungen zum Aufgabenblatt
Messbericht. HiFi Raum XX. Erstellt von XX. Datum der Messung: Februar 2015
 Messbericht HiFi Raum XX Erstellt von XX Datum der Messung: Februar 2015 Verwendetes Equipment: - Norsonic Dodekaeder mit Verstärker - Messmikrofon KlarkTeknik 6051 - RME UC Interface - Lautsprecher des
Messbericht HiFi Raum XX Erstellt von XX Datum der Messung: Februar 2015 Verwendetes Equipment: - Norsonic Dodekaeder mit Verstärker - Messmikrofon KlarkTeknik 6051 - RME UC Interface - Lautsprecher des
Expositionsermittlungen kniebelastender Tätigkeiten Vorgehensweise der BG BAU
 Expositionsermittlungen kniebelastender Tätigkeiten Vorgehensweise der BG BAU Chemnitz, 21.05.2015 Dipl.-Ing. Edda Hirschl Agenda 1 WB zur Gonarthrose BK 2112 2 Forschungsprojekt GonKatast 3 CUELA-System
Expositionsermittlungen kniebelastender Tätigkeiten Vorgehensweise der BG BAU Chemnitz, 21.05.2015 Dipl.-Ing. Edda Hirschl Agenda 1 WB zur Gonarthrose BK 2112 2 Forschungsprojekt GonKatast 3 CUELA-System
Physikprotokoll: Fehlerrechnung. Martin Henning / Torben Zech / Abdurrahman Namdar / Juni 2006
 Physikprotokoll: Fehlerrechnung Martin Henning / 736150 Torben Zech / 7388450 Abdurrahman Namdar / 739068 1. Juni 2006 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 2 Vorbereitungen 3 3 Messungen und Auswertungen
Physikprotokoll: Fehlerrechnung Martin Henning / 736150 Torben Zech / 7388450 Abdurrahman Namdar / 739068 1. Juni 2006 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 2 Vorbereitungen 3 3 Messungen und Auswertungen
Technische Universität München Zentrum Mathematik Propädeutikum Diskrete Mathematik. Weihnachtsblatt
 Technische Universität München Zentrum Mathematik Propädeutikum Diskrete Mathematik Prof. Dr. A. Taraz, Dipl-Math. A. Würfl, Dipl-Math. S. König Weihnachtsblatt Aufgabe W.1 Untersuchen Sie nachstehenden
Technische Universität München Zentrum Mathematik Propädeutikum Diskrete Mathematik Prof. Dr. A. Taraz, Dipl-Math. A. Würfl, Dipl-Math. S. König Weihnachtsblatt Aufgabe W.1 Untersuchen Sie nachstehenden
Einfluss der Einstrahlungs-Häufigkeitsverteilung bei der Simulation von PV-Anlagen
 Tel.+49 ()3/ 588 439 Fax+49 ()3/ 588 439 11 email info@valentin.de http://www.valentin.d Einfluss der Einstrahlungs-Häufigkeitsverteilung bei der Simulation von PV-Anlagen G. Valentin, R. Hunfeld, B. Gatzka
Tel.+49 ()3/ 588 439 Fax+49 ()3/ 588 439 11 email info@valentin.de http://www.valentin.d Einfluss der Einstrahlungs-Häufigkeitsverteilung bei der Simulation von PV-Anlagen G. Valentin, R. Hunfeld, B. Gatzka
8. Statistik Beispiel Noten. Informationsbestände analysieren Statistik
 Informationsbestände analysieren Statistik 8. Statistik Nebst der Darstellung von Datenreihen bildet die Statistik eine weitere Domäne für die Auswertung von Datenbestände. Sie ist ein Fachgebiet der Mathematik
Informationsbestände analysieren Statistik 8. Statistik Nebst der Darstellung von Datenreihen bildet die Statistik eine weitere Domäne für die Auswertung von Datenbestände. Sie ist ein Fachgebiet der Mathematik
6 = berechnen (3 aus 6 färben).
 Problemfeld Triaden, Sachanalyse Seite 1 von 6 Zu Problem 1 und 2: Die möglichen 20 Farbmuster mit Spiegelachsen und Farbumkehr systematische Zusammenstellung Farben vertauscht in der Sortierung von Konstantin.
Problemfeld Triaden, Sachanalyse Seite 1 von 6 Zu Problem 1 und 2: Die möglichen 20 Farbmuster mit Spiegelachsen und Farbumkehr systematische Zusammenstellung Farben vertauscht in der Sortierung von Konstantin.
6 Vertiefende Themen aus des Mechanik
 6 Vertiefende Themen aus des Mechanik 6.1 Diagramme 6.1.1 Steigung einer Gerade; Änderungsrate Im ersten Kapitel haben wir gelernt, was uns die Steigung (oft mit k bezeichnet) in einem s-t Diagramm ( k=
6 Vertiefende Themen aus des Mechanik 6.1 Diagramme 6.1.1 Steigung einer Gerade; Änderungsrate Im ersten Kapitel haben wir gelernt, was uns die Steigung (oft mit k bezeichnet) in einem s-t Diagramm ( k=
Deskriptive Statistik Kapitel VII - Konzentration von Merkmalswerten
 Deskriptive Statistik Kapitel VII - Konzentration von Merkmalswerten Georg Bol bol@statistik.uni-karlsruhe.de Markus Höchstötter hoechstoetter@statistik.uni-karlsruhe.de Agenda 1. Einleitung 2. Lorenzkurve
Deskriptive Statistik Kapitel VII - Konzentration von Merkmalswerten Georg Bol bol@statistik.uni-karlsruhe.de Markus Höchstötter hoechstoetter@statistik.uni-karlsruhe.de Agenda 1. Einleitung 2. Lorenzkurve
Überprüfung der Genauigkeit eines Fahrradtachos
 Überprüfung der Genauigkeit eines Fahrradtachos Stand: 26.08.2015 Jahrgangsstufen 7 Fach/Fächer Natur und Technik/ Schwerpunkt Physik Kompetenzerwartungen Die Schülerinnen und Schüler bestimmen experimentell
Überprüfung der Genauigkeit eines Fahrradtachos Stand: 26.08.2015 Jahrgangsstufen 7 Fach/Fächer Natur und Technik/ Schwerpunkt Physik Kompetenzerwartungen Die Schülerinnen und Schüler bestimmen experimentell
Abiturprüfung Physik, Grundkurs. Aufgabe 1: Kräfte auf bewegte Ladungen in Leitern im Magnetfeld
 Seite 1 von 10 Abiturprüfung 2009 Physik, Grundkurs Aufgabenstellung: Aufgabe 1: Kräfte auf bewegte Ladungen in Leitern im Magnetfeld Eine bewegte elektrische Ladung erfährt in Magnetfeldern bei geeigneten
Seite 1 von 10 Abiturprüfung 2009 Physik, Grundkurs Aufgabenstellung: Aufgabe 1: Kräfte auf bewegte Ladungen in Leitern im Magnetfeld Eine bewegte elektrische Ladung erfährt in Magnetfeldern bei geeigneten
Dehnung eines Gummibands und einer Schraubenfeder
 Aufgabe Durch schrittweise Dehnung eines Gummibandes und einer soll der Unterschied zwischen plastischer und elastischer Verformung demonstriert werden. Abb. 1: Versuchsaufbau Material 1 Hafttafel mit
Aufgabe Durch schrittweise Dehnung eines Gummibandes und einer soll der Unterschied zwischen plastischer und elastischer Verformung demonstriert werden. Abb. 1: Versuchsaufbau Material 1 Hafttafel mit
15. Algorithmus der Woche Das Rucksackproblem Die Qual der Wahl bei zu vielen Möglichkeiten
 15. Algorithmus der Woche Das Rucksackproblem Die Qual der Wahl bei zu vielen Möglichkeiten Autoren Rene Beier, MPI Saarbrücken Berthold Vöcking, RWTH Aachen In zwei Monaten startet die nächste Rakete
15. Algorithmus der Woche Das Rucksackproblem Die Qual der Wahl bei zu vielen Möglichkeiten Autoren Rene Beier, MPI Saarbrücken Berthold Vöcking, RWTH Aachen In zwei Monaten startet die nächste Rakete
Mathematische Grundlagen der dynamischen Simulation
 Mathematische Grundlagen der dynamischen Simulation Dynamische Systeme sind Systeme, die sich verändern. Es geht dabei um eine zeitliche Entwicklung und wie immer in der Informatik betrachten wir dabei
Mathematische Grundlagen der dynamischen Simulation Dynamische Systeme sind Systeme, die sich verändern. Es geht dabei um eine zeitliche Entwicklung und wie immer in der Informatik betrachten wir dabei
Walzenvermessung mit PARALIGN. Anwendungsbeispiel Zeitungsdruckmaschine
 Walzenvermessung mit PARALIGN Die Vermessung von Walzen gilt als ganz besondere Kunst. Traditionell kommen z.b. das Stichmaß oder Umschlingungsmessungen zum Einsatz. Mit dem Stichmaß wird die Distanz zwischen
Walzenvermessung mit PARALIGN Die Vermessung von Walzen gilt als ganz besondere Kunst. Traditionell kommen z.b. das Stichmaß oder Umschlingungsmessungen zum Einsatz. Mit dem Stichmaß wird die Distanz zwischen
Archimedische Spiralen
 Hauptseminar: Spiralen WS 05/06 Dozent: Prof. Dr. Deißler Datum: 31.01.2006 Vorgelegt von Sascha Bürgin Archimedische Spiralen Man kann sich auf zwei Arten zeichnerisch den archimedischen Spiralen annähern.
Hauptseminar: Spiralen WS 05/06 Dozent: Prof. Dr. Deißler Datum: 31.01.2006 Vorgelegt von Sascha Bürgin Archimedische Spiralen Man kann sich auf zwei Arten zeichnerisch den archimedischen Spiralen annähern.
Physikalisches Grundpraktikum Technische Universität Chemnitz
 Physikalisches Grundpraktikum Technische Universität Chemnitz Protokoll «A1 - Messung der Lichtgeschwindigkeit» Martin Wolf Betreuer: Dr. Beddies Mitarbeiter: Martin Helfrich
Physikalisches Grundpraktikum Technische Universität Chemnitz Protokoll «A1 - Messung der Lichtgeschwindigkeit» Martin Wolf Betreuer: Dr. Beddies Mitarbeiter: Martin Helfrich
1.1 Graphische Darstellung von Messdaten und unterschiedliche Mittelwerte. D. Horstmann: Oktober
 1.1 Graphische Darstellung von Messdaten und unterschiedliche Mittelwerte D. Horstmann: Oktober 2014 4 Graphische Darstellung von Daten und unterschiedliche Mittelwerte Eine Umfrage nach der Körpergröße
1.1 Graphische Darstellung von Messdaten und unterschiedliche Mittelwerte D. Horstmann: Oktober 2014 4 Graphische Darstellung von Daten und unterschiedliche Mittelwerte Eine Umfrage nach der Körpergröße
Mann-Whitney-U-Test für zwei unabhängige Stichproben
 Mann-Whitney-U-Test für zwei unabhängige Stichproben Wir haben bis jetzt einen einzigen Test für unabhängige Stichproben kennen gelernt, nämlich den T-Test. Wie wir bereits wissen, sind an die Berechnung
Mann-Whitney-U-Test für zwei unabhängige Stichproben Wir haben bis jetzt einen einzigen Test für unabhängige Stichproben kennen gelernt, nämlich den T-Test. Wie wir bereits wissen, sind an die Berechnung
3.2.1 Neurogeneserate der magnetfeldbehandelten Tiere aus restriktiver Haltung
 Eigene Untersuchungen 25 3.2 Ergebnisse 3.2.1 Neurogeneserate der magnetfeldbehandelten Tiere aus restriktiver Haltung Untersucht wurde, ob die Magnetfeldbehandlung mit 1, 8, 12, 29 und 5 Hz einen Einfluss
Eigene Untersuchungen 25 3.2 Ergebnisse 3.2.1 Neurogeneserate der magnetfeldbehandelten Tiere aus restriktiver Haltung Untersucht wurde, ob die Magnetfeldbehandlung mit 1, 8, 12, 29 und 5 Hz einen Einfluss
Grundlegende Eigenschaften von Punktschätzern
 Grundlegende Eigenschaften von Punktschätzern Worum geht es in diesem Modul? Schätzer als Zufallsvariablen Vorbereitung einer Simulation Verteilung von P-Dach Empirische Lage- und Streuungsparameter zur
Grundlegende Eigenschaften von Punktschätzern Worum geht es in diesem Modul? Schätzer als Zufallsvariablen Vorbereitung einer Simulation Verteilung von P-Dach Empirische Lage- und Streuungsparameter zur
Versuch P1-31,40,41 Geometrische Optik. Auswertung. Von Ingo Medebach und Jan Oertlin. 9. Dezember 2009
 Versuch P1-31,40,41 Geometrische Optik Auswertung Von Ingo Medebach und Jan Oertlin 9. Dezember 2009 Inhaltsverzeichnis 1. Brennweitenbestimmung...2 1.1. Kontrolle der Brennweite...2 1.2. Genaue Bestimmung
Versuch P1-31,40,41 Geometrische Optik Auswertung Von Ingo Medebach und Jan Oertlin 9. Dezember 2009 Inhaltsverzeichnis 1. Brennweitenbestimmung...2 1.1. Kontrolle der Brennweite...2 1.2. Genaue Bestimmung
Übungen mit dem Applet Interpolationspolynome
 Interpolationspolynome 1 Übungen mit dem Applet Interpolationspolynome 1 Ziele des Applets... 2 2 Übungen mit dem Applet... 2 2.1 Punkte... 3 2.2 y=sin(x)... 3 2.3 y=exp(x)... 4 2.4 y=x 4 x 3 +2x 2 +x...
Interpolationspolynome 1 Übungen mit dem Applet Interpolationspolynome 1 Ziele des Applets... 2 2 Übungen mit dem Applet... 2 2.1 Punkte... 3 2.2 y=sin(x)... 3 2.3 y=exp(x)... 4 2.4 y=x 4 x 3 +2x 2 +x...
Prüfungsarbeit Mathematik Gymnasium
 Prüfungsteil 1: Aufgabe 1 a) In welchem Maßstab müsste das abgebildete Modellauto vergrößert werden, damit es ungefähr so groß wäre wie das Original? Kreuze an! 1 : 10 1 : 100 1 : 1 000 1 : 10 000 b) Kann
Prüfungsteil 1: Aufgabe 1 a) In welchem Maßstab müsste das abgebildete Modellauto vergrößert werden, damit es ungefähr so groß wäre wie das Original? Kreuze an! 1 : 10 1 : 100 1 : 1 000 1 : 10 000 b) Kann
Univ.-Prof. DDr. Franz Adunka, A
 Univ.-Prof. DDr. Franz Adunka, A Warum die Diskussion über den JMF? EN 1434 legt für die zulässigen Messabweichungen fest: Seite 2 Grundsätzliche Überlegungen Messfehler / Messabweichung ist wichtig für
Univ.-Prof. DDr. Franz Adunka, A Warum die Diskussion über den JMF? EN 1434 legt für die zulässigen Messabweichungen fest: Seite 2 Grundsätzliche Überlegungen Messfehler / Messabweichung ist wichtig für
Ein Lichtstrahl fällt aus der Luft ins Wasser. Man hat den Einfallswinkel α und den Brechungswinkel β gemessen und in folgende Tabelle eingetragen.
 1 Optik 1.1 Brechung des Lichtes Ein Lichtstrahl fällt aus der Luft ins Wasser. Man hat den Einfallswinkel α und den Brechungswinkel β gemessen und in folgende Tabelle eingetragen. α β 0 0 10 8 17 13 20
1 Optik 1.1 Brechung des Lichtes Ein Lichtstrahl fällt aus der Luft ins Wasser. Man hat den Einfallswinkel α und den Brechungswinkel β gemessen und in folgende Tabelle eingetragen. α β 0 0 10 8 17 13 20
Verwandte Begriffe Maxwell-Gleichungen, elektrisches Wirbelfeld, Magnetfeld von Spulen, magnetischer Fluss, induzierte Spannung.
 Verwandte Begriffe Maxwell-Gleichungen, elektrisches Wirbelfeld, Magnetfeld von Spulen, magnetischer Fluss, induzierte Spannung. Prinzip In einer langen Spule wird ein Magnetfeld mit variabler Frequenz
Verwandte Begriffe Maxwell-Gleichungen, elektrisches Wirbelfeld, Magnetfeld von Spulen, magnetischer Fluss, induzierte Spannung. Prinzip In einer langen Spule wird ein Magnetfeld mit variabler Frequenz
E000 Ohmscher Widerstand
 E000 Ohmscher Widerstand Gruppe A: Collin Bo Urbon, Klara Fall, Karlo Rien Betreut von Elektromaster Am 02.11.2112 Inhalt I. Einleitung... 1 A. Widerstand und ohmsches Gesetz... 1 II. Versuch: Strom-Spannungs-Kennlinie...
E000 Ohmscher Widerstand Gruppe A: Collin Bo Urbon, Klara Fall, Karlo Rien Betreut von Elektromaster Am 02.11.2112 Inhalt I. Einleitung... 1 A. Widerstand und ohmsches Gesetz... 1 II. Versuch: Strom-Spannungs-Kennlinie...
2. Grundbegriffe. Literatur. Skript D. Huhnke S emg GEM. emg GEM
 . Grundbegriffe Literatur Skript D. Huhnke S. 10-1 Messung Messwert: Wert, der zur Messgröße gehört und der Ausgabe eines Messgerätes eindeutig zugeordnet ist. Messvoraussetzungen Die Messung soll sein
. Grundbegriffe Literatur Skript D. Huhnke S. 10-1 Messung Messwert: Wert, der zur Messgröße gehört und der Ausgabe eines Messgerätes eindeutig zugeordnet ist. Messvoraussetzungen Die Messung soll sein
Arbeitsblatt : Messung von Beschleunigungen beim Vertikalsprung
 1 Studienwerkstatt Bewegungsanalyse Universität Kassel Arbeitsblatt : Messung von Beschleunigungen beim Vertikalsprung Einleitung : Die Beschleunigung ist neben der Geschwindigkeit eine wichtige Beschreibungsgröße
1 Studienwerkstatt Bewegungsanalyse Universität Kassel Arbeitsblatt : Messung von Beschleunigungen beim Vertikalsprung Einleitung : Die Beschleunigung ist neben der Geschwindigkeit eine wichtige Beschreibungsgröße
Fehler- und Ausgleichsrechnung
 Fehler- und Ausgleichsrechnung Daniel Gerth Daniel Gerth (JKU) Fehler- und Ausgleichsrechnung 1 / 12 Überblick Fehler- und Ausgleichsrechnung Dieses Kapitel erklärt: Wie man Ausgleichsrechnung betreibt
Fehler- und Ausgleichsrechnung Daniel Gerth Daniel Gerth (JKU) Fehler- und Ausgleichsrechnung 1 / 12 Überblick Fehler- und Ausgleichsrechnung Dieses Kapitel erklärt: Wie man Ausgleichsrechnung betreibt
Kapitel 8 Einführung der Integralrechnung über Flächenmaße
 8. Flächenmaße 8.1 Flächenmaßfunktionen zu nicht negativen Randfunktionen Wir wenden uns einem auf den ersten Blick neuen Thema zu, der Ermittlung des Flächenmaßes A von Flächen A, die vom nicht unterhalb
8. Flächenmaße 8.1 Flächenmaßfunktionen zu nicht negativen Randfunktionen Wir wenden uns einem auf den ersten Blick neuen Thema zu, der Ermittlung des Flächenmaßes A von Flächen A, die vom nicht unterhalb
2.5 Funktionen 2.Grades (Thema aus dem Bereich Analysis)
 .5 Funktionen.Grades (Thema aus dem Bereich Analysis) Inhaltsverzeichnis 1 Definition einer Funktion.Grades. Die Verschiebung des Graphen 5.1 Die Verschiebung des Graphen in y-richtung.........................
.5 Funktionen.Grades (Thema aus dem Bereich Analysis) Inhaltsverzeichnis 1 Definition einer Funktion.Grades. Die Verschiebung des Graphen 5.1 Die Verschiebung des Graphen in y-richtung.........................
3D Echtzeit Ganganalyse auf Laufband und Gehstrecke
 3D Echtzeit Ganganalyse auf Laufband und Gehstrecke zebris Medical GmbH Max-Eyth-Weg 43 88316 Isny im Allgäu zebris Medical GmbH Release 04/2006 Tel.: 07562 / 9726-0 Fax: 07562 / 9726-50 E-mail: zebris@zebris.de
3D Echtzeit Ganganalyse auf Laufband und Gehstrecke zebris Medical GmbH Max-Eyth-Weg 43 88316 Isny im Allgäu zebris Medical GmbH Release 04/2006 Tel.: 07562 / 9726-0 Fax: 07562 / 9726-50 E-mail: zebris@zebris.de
Physik 4 Praktikum Auswertung Hall-Effekt
 Physik 4 Praktikum Auswertung Hall-Effekt Von J.W., I.G. 2014 Seite 1. Kurzfassung......... 2 2. Theorie.......... 2 2.1. Elektrischer Strom in Halbleitern..... 2 2.2. Hall-Effekt......... 3 3. Durchführung.........
Physik 4 Praktikum Auswertung Hall-Effekt Von J.W., I.G. 2014 Seite 1. Kurzfassung......... 2 2. Theorie.......... 2 2.1. Elektrischer Strom in Halbleitern..... 2 2.2. Hall-Effekt......... 3 3. Durchführung.........
1 Grundprinzipien statistischer Schlußweisen
 Grundprinzipien statistischer Schlußweisen - - Grundprinzipien statistischer Schlußweisen Für die Analyse zufallsbehafteter Eingabegrößen und Leistungsparameter in diskreten Systemen durch Computersimulation
Grundprinzipien statistischer Schlußweisen - - Grundprinzipien statistischer Schlußweisen Für die Analyse zufallsbehafteter Eingabegrößen und Leistungsparameter in diskreten Systemen durch Computersimulation
Graphische Darstellung einer univariaten Verteilung:
 Graphische Darstellung einer univariaten Verteilung: Die graphische Darstellung einer univariaten Verteilung hängt von dem Messniveau der Variablen ab. Bei einer graphischen Darstellung wird die Häufigkeit
Graphische Darstellung einer univariaten Verteilung: Die graphische Darstellung einer univariaten Verteilung hängt von dem Messniveau der Variablen ab. Bei einer graphischen Darstellung wird die Häufigkeit
Crosstrainer, Laufbänder und Fahrradergometer im Vergleich
 Crosstrainer, Laufbänder und Fahrradergometer im Vergleich Gesamtkoordination Prof. Dr. Ansgar Schwirtz Inhaltliche Verantwortung Dr. Florian Kreuzpointner Technische Universität München Fakultät für Sport-
Crosstrainer, Laufbänder und Fahrradergometer im Vergleich Gesamtkoordination Prof. Dr. Ansgar Schwirtz Inhaltliche Verantwortung Dr. Florian Kreuzpointner Technische Universität München Fakultät für Sport-
1. Schularbeit Gruppe A Seite 1 7E, 7. November 2011
 1. Schularbeit Gruppe A Seite 1 7E, 7. November 2011 NAME Für den Computerteil gilt: Die Verwendung von Excel, Word und GeoGebra (oder vergleichbaren Programmen) ist erlaubt. Das Internet darf verwendet
1. Schularbeit Gruppe A Seite 1 7E, 7. November 2011 NAME Für den Computerteil gilt: Die Verwendung von Excel, Word und GeoGebra (oder vergleichbaren Programmen) ist erlaubt. Das Internet darf verwendet
Einführung in die linearen Funktionen. Autor: Benedikt Menne
 Einführung in die linearen Funktionen Autor: Benedikt Menne Inhaltsverzeichnis Vorwort... 3 Allgemeine Definition... 3 3 Bestimmung der Steigung einer linearen Funktion... 4 3. Bestimmung der Steigung
Einführung in die linearen Funktionen Autor: Benedikt Menne Inhaltsverzeichnis Vorwort... 3 Allgemeine Definition... 3 3 Bestimmung der Steigung einer linearen Funktion... 4 3. Bestimmung der Steigung
Debayeringverfahren. 19. Mai Thomas Noack, Nikolai Kosjar. SE Computational Photography - Debayeringverfahren
 Debayeringverfahren Thomas Noack, Nikolai Kosjar 19. Mai 2010 Was bisher geschah... Reduktion der Herstellungskosten durch Einsatz von nur noch einem CCD-Sensor mit Bayer-Filter Problem: Bayer Image Full
Debayeringverfahren Thomas Noack, Nikolai Kosjar 19. Mai 2010 Was bisher geschah... Reduktion der Herstellungskosten durch Einsatz von nur noch einem CCD-Sensor mit Bayer-Filter Problem: Bayer Image Full
Schülerexperiment: Bestimmung der Geschwindigkeit eines Körpers
 Schülerexperiment: Bestimmung der Geschwindigkeit eines Körpers Stand: 26.08.2015 Jahrgangsstufen 7 Fach/Fächer Benötigtes Material Natur und Technik/ Schwerpunkt Physik Maßbänder, Stoppuhren, Taschenrechner,
Schülerexperiment: Bestimmung der Geschwindigkeit eines Körpers Stand: 26.08.2015 Jahrgangsstufen 7 Fach/Fächer Benötigtes Material Natur und Technik/ Schwerpunkt Physik Maßbänder, Stoppuhren, Taschenrechner,
Entschädigungszahlungen für PV-Anlagen nach Einspeisemanagement-Maßnahmen
 Entschädigungszahlungen für PV-Anlagen nach Einspeisemanagement-Maßnahmen 1. Beschreibung der Berechnungslogik 1.1. Pauschalabrechnungsverfahren Basis für die Berechnung der Soll-Leistung während der Einspeisemanagement-Maßnahme
Entschädigungszahlungen für PV-Anlagen nach Einspeisemanagement-Maßnahmen 1. Beschreibung der Berechnungslogik 1.1. Pauschalabrechnungsverfahren Basis für die Berechnung der Soll-Leistung während der Einspeisemanagement-Maßnahme
Lage- und Streuungsparameter
 Lage- und Streuungsparameter Beziehen sich auf die Verteilung der Ausprägungen von intervall- und ratio-skalierten Variablen Versuchen, diese Verteilung durch Zahlen zu beschreiben, statt sie graphisch
Lage- und Streuungsparameter Beziehen sich auf die Verteilung der Ausprägungen von intervall- und ratio-skalierten Variablen Versuchen, diese Verteilung durch Zahlen zu beschreiben, statt sie graphisch
Grund- und Angleichungsvorlesung Energie, Arbeit & Leistung.
 3 Grund- und Angleichungsvorlesung Physik. Energie, Arbeit & Leistung. WS 16/17 1. Sem. B.Sc. LM-Wissenschaften Diese Präsentation ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung Nichtkommerziell
3 Grund- und Angleichungsvorlesung Physik. Energie, Arbeit & Leistung. WS 16/17 1. Sem. B.Sc. LM-Wissenschaften Diese Präsentation ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung Nichtkommerziell
8.2 Nicht parametrische Tests Vergleich CT/2D/3D. Abb. 28 Mann-Whitney-U-Test
 41 8. Interpretationen der Studienergebnisse Im vorliegenden Kapitel werden die Studienergebnisse mit Hilfe des Mann-Whitney-U-Tests auf signifikante Unterschiede untersucht. Hierfür wurden die vorliegenden
41 8. Interpretationen der Studienergebnisse Im vorliegenden Kapitel werden die Studienergebnisse mit Hilfe des Mann-Whitney-U-Tests auf signifikante Unterschiede untersucht. Hierfür wurden die vorliegenden
3. Das Reinforcement Lernproblem
 3. Das Reinforcement Lernproblem 1. Agierender Agent in der Umgebung 2. Discounted Rewards 3. Markov Eigenschaft des Zustandssignals 4. Markov sche Entscheidung 5. Werte-Funktionen und Bellman sche Optimalität
3. Das Reinforcement Lernproblem 1. Agierender Agent in der Umgebung 2. Discounted Rewards 3. Markov Eigenschaft des Zustandssignals 4. Markov sche Entscheidung 5. Werte-Funktionen und Bellman sche Optimalität
Die Quadratische Gleichung (Gleichung 2. Grades)
 - 1 - VB 003 Die Quadratische Gleichung (Gleichung. Grades) Inhaltsverzeichnis Die Quadratische Gleichung (Gleichung. Grades)... 1 Inhaltsverzeichnis... 1 1. Die Quadratische Gleichung (Gleichung. Grades)....
- 1 - VB 003 Die Quadratische Gleichung (Gleichung. Grades) Inhaltsverzeichnis Die Quadratische Gleichung (Gleichung. Grades)... 1 Inhaltsverzeichnis... 1 1. Die Quadratische Gleichung (Gleichung. Grades)....
Bestimmung der Erdbeschleunigung g
 Laborbericht zum Thema Bestimmung der Erdbeschleuni Erdbeschleunigung g Datum: 26.08.2011 Autoren: Christoph Winkler, Philipp Schienle, Mathias Kerschensteiner, Georg Sauer Friedrich-August Haselwander
Laborbericht zum Thema Bestimmung der Erdbeschleuni Erdbeschleunigung g Datum: 26.08.2011 Autoren: Christoph Winkler, Philipp Schienle, Mathias Kerschensteiner, Georg Sauer Friedrich-August Haselwander
Beurteilung von HD Aufnahmen - Mysterium oder nachvollziehbare Wissenschaft?
 Beurteilung von HD Aufnahmen - Mysterium oder nachvollziehbare Wissenschaft? Die Beurteilung von HD Aufnahmen im Screeningverfahren erscheint häufig willkürlich und wenig nachvollziehbar. Es gibt verschiedene
Beurteilung von HD Aufnahmen - Mysterium oder nachvollziehbare Wissenschaft? Die Beurteilung von HD Aufnahmen im Screeningverfahren erscheint häufig willkürlich und wenig nachvollziehbar. Es gibt verschiedene
Von 21 Fraktursystemen in diesem Bereich gehen 23 Berstungsfrakturen aus. Diese lassen sich in zwei Gruppen einteilen:
 6 6 Ergebnisse 6. Ergebnisse aus den Kumulativskizzen 6.. Frakturen mit Zentrum occipipital Occipital sind 4 Fraktursysteme mit 6 Berstungsfrakturen aufgetreten. Bis auf zwei Ausnahmen verlaufen alle durch
6 6 Ergebnisse 6. Ergebnisse aus den Kumulativskizzen 6.. Frakturen mit Zentrum occipipital Occipital sind 4 Fraktursysteme mit 6 Berstungsfrakturen aufgetreten. Bis auf zwei Ausnahmen verlaufen alle durch
Beilage 1 Zertifikat WAVEEX / W-LAN. A. Morphographische Vermessung der W-LAN-Emission (Verbindung Router-MacBook) ohne und mit WAVEEX
 A. Morphographische Vermessung der W-LAN-Emission (Verbindung Router-MacBook) ohne und mit WAVEEX Grafik A1: Basismessung Folie 1 Diese Grafik stellt das Ergebnis der Messung dar, bei der die neutrale
A. Morphographische Vermessung der W-LAN-Emission (Verbindung Router-MacBook) ohne und mit WAVEEX Grafik A1: Basismessung Folie 1 Diese Grafik stellt das Ergebnis der Messung dar, bei der die neutrale
