Erzeugerring Westfalen Jahresbericht 2013
|
|
|
- Heiko Maier
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Erzeugerring Westfalen Jahresbericht 2013
2 Lange Gas Mit Energie für Sie da! Kraft-Wärme-Kopplung Sie wollen Ihre Energiekosten senken? Energie sparen! Der Dachs Profi. Vorteile auf einen Blick: Sie verringern Ihre Stromkosten bis zu 60 ct pro Betriebsstunde! Sie zahlen keine Energiesteuer! Sie erhalten erhebliche staatliche Zuschüsse! Sie reduzieren den CO 2 - Ausstoß bis zu 25 t/jahr! Informationen Haben wir Ihr Interesse geweckt? Lassen Sie sich beraten! Bereichsleiter Beratung und Vertrieb BHKW Josef Schopohl Tel.: Mobil: Mail: schopohl@lange-gas.de Das eigene BHKW ist die optimale Lösung! Die Antwort auf steigende Strompreise: eigene Stromerzeugung! Die Strompreise sind gestiegen, weitere Steigerungen in erheblichem Umfang sollen folgen. Es ist sicherlich für Sie bereits heute von hoher Priorität eine Alternativlösung zu finden, damit Sie nicht nur weitere Steigerungen vermeiden, sondern auch Ihre aktuellen Energiekosten senken. Eine optimale und sofort zur Verfügung stehende Alternative ist, über ein BHKW (Kraft-Wärme-Kopplung) selber Strom zu produzieren. Mit diesem System wird nicht nur die benötigte Wärme, sondern gleichzeitig Strom erzeugt. Bei richtiger Konstellation des Wärme-/Strom-Bedarfs sind hiermit erhebliche wirtschaftliche Vorteile zu erreichen. Als eindeutiger Marktführer ist der Dachs Profi von SenerTec einzustufen, der bereits langfristig mit großem Erfolg in Deutschland vermarktet wird und technisch ausgereift auf hohem Niveau arbeitet. Nach intensiver Marktanalyse haben wir uns selbst für den Dachs Profi entschieden und bereits in 2011 installiert. Als Antriebsenergie haben wir natürlich Flüssiggas eingesetzt. Aufgrund unserer Erfahrungswerte hat sich dies als ideal erwiesen. Die Standzeit für den Dachs-Motor wird hierdurch erheblich verlängert und somit die Betriebskosten deutlich reduziert. Auch von unserer Regierung wird die Kraft- Wärme-Kopplung als sehr wichtiger Beitrag für die zukünftige Stromerzeugung eingestuft. In Verbindung mit erheblichen staatlichen Zuschüssen soll in Deutschland mit dieser Technik ein Anteil an der Stromgewinnung von mindestens 25 % erreicht werden. Unsere eigenen Erfahrungswerte mit dem Dachs Profi, die eindeutigen Zeichen unserer Regierung, einfach die sehr positive Zukunfts-Perspektive für die Kraft- Wärme-Kopplung haben uns überzeugt, für diesen Bereich ein neues Geschäftsfeld mit einer kompetenten Mannschaft aufzubauen. Unseren Bereichsleiter für die Kraft- Wärme-Kopplung können Sie über die nebenstehenden Kontaktdaten erreichen. Herr Schopohl ist gern bereit, Ihnen alle Fragen rund um den Dachs Profi zu erläutern. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, Ihnen unseren Dachs bei uns im Haus in der Praxis vorzustellen. Das BHKW ist ideal für die Sauenhaltung und Ferkelaufzucht! Weitere Informationen auf Seite
3 Vorwort Franz-Josef Hüppe Erzeugerring Westfalen, Aufsichtsratsvorsitzender BRAUCHEN UNSERE SCHWEINE NOCH MEHR WOHLSEIN? Die Initiative Tierwohl ist das Thema zur Zeit in allen Branchen der Schweinehaltung. Es könnte der Eindruck entstehen, das Tierwohl ganz neu erfunden werden muss, obwohl wir Schweinehalter schon wirklich viel tun, damit es unseren Tieren gut geht. Die Haltung unserer Tiere hat sich in den letzten Jahren schon stark verändert. Die Schweinehaltungsverordnung für 2013 war schon eine große Herausforderung. Gruppenhaltung bei Sauen, Aufstallung und neue Spalten in der Mastschweine- und Sauenhaltung und vieles mehr. Viele Sauenhalter waren diesen Investitionen nicht mehr gewachsen und haben den Stall zu gemacht. Die Landwirte legen immer ein besonderes Augenmerk auf die Fütterung, um ihre Tiere bedarfsgerecht zu füttern. Die moderne Technik der Fütterung (PC) unterstützt uns in besonderer Art und Weise. Es gibt nur wenige Menschen, die eine so gute Ernährungsberatung haben wie unsere Schweine. Ja, und jetzt kommt die Initiative Tierwohl. Politik, Tierschutzverbände, Fleischbranche und der Lebensmitteleinzelhandel wollen noch mehr Tierwohl. Wollen unsere Landwirte und Schweinehalter das auch? Die Tierwohl-Initiative könnte den weltweiten Wettbewerb der deutschen Schweinehalter gefährden. Aber können wir uns diese Chance entgehen lassen? Hier sind alle in einem Boot. Es ist klar, dass diese Initiative viel Geld kostet. Tierwohl kann es nicht zum Nulltarif geben. Für den Verbraucher sind es nur wenige Euros mehr. Es darf aber nicht nur für ein besonderes Klientel Schweinefleisch erzeugt werden. Für 2014 den Beginn der Tierwohl-Initiative müssen noch viele Punkte geklärt werden. Hier ist es wichtig, ein gesundes Augenmerk zu Tage zu legen und das im Einvernehmen aller. Mitarbeiter des ERW sind hier ganz vorn mit dabei, denn gerade unsere Beraterinnen und Berater wissen, was machbar ist und was nicht. Lassen Sie sich schon rechtzeitig von unseren Beraterinnen und Beratern über Möglichkeiten in Ihren Betrieben beraten, um schnell in Sachen Tierwohl dabei zu sein, wenn es denn wirtschaftlich für Sie ist. Ich denke, wir sollten dieser Initiative eine Chance geben. Nein, in der Schweinehaltung wird es nicht langweilig. Es gibt immer neue Herausforderungen, die wir meistern müssen. Ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie und Mitarbeiten gute Preise, Gesundheit und Zufriedenheit und ein gutes neues Jahr Franz-Josef Hüppe Aufsichtsratsvorsitzender Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 03
4 INHALT S. 08 S. 10 S. 14 S. 16 S. 19 S. 22 S. 24 S. 26 S. 29 S. 30 S. 32 S. 34 S. 37 S. 38 S. 40 S. 43 GESCHÄFTSBERICHT 2013 Georg Freisfeld, Erzeugerring Westfalen, kom. Geschäftsführer SCHWEINEMAST JAHRESERGEBNISSE 2012 / 2013 Georg Freisfeld, Erzeugerring Westfalen, kom. Geschäftsführer NEUE ERFAHRUNGEN IN DER EBERMAST Georg Freisfeld, Erzeugerring Westfalen, kom. Geschäftsführer FERKELERZEUGUNG JAHRESERGEBNISSE 2012 / 2013 Reinhard Hinken, Erzeugerring Westfalen WISSEN, WAS IM STALL LÄUFT Heinz-Georg Waldeyer, Landwirtschaftliches Wochenblatt Ausgabe 30 / 2012 ABHOLSERVICE IM PRAXISTEST Heinz-Georg Waldeyer, Landwirtschaftliches Wochenblatt Ausgabe 31 / 2012 FRÜH ERKENNEN SCHNELL REAGIEREN Heinz-Georg Waldeyer, Landwirtschaftliches Wochenblatt Ausgabe 31 / 2012 TIERÄRZTE UND BERATER HAND IN HAND Heinz-Georg Waldeyer, Landwirtschaftliches Wochenblatt Ausgabe 31 / 2012 HYGIENE VERBESSERN, ABER WIE? Gerburgis Brosthaus, Landwirtschaftliches Wochenblatt Ausgabe 33 / 2012 MEHR HYGIENE, MEHR GEWINN Gerburgis Brosthaus, Landwirtschaftliches Wochenblatt Ausgabe 33 / 2012 AN DEN KLEINEN SCHRAUBEN GEDREHT Gerburgis Brosthaus, Landwirtschaftliches Wochenblatt Ausgabe 33 / 2012 LÜFTUNG AUF DEM PRÜFSTAND Gerburgis Brosthaus, Landwirtschaftliches Wochenblatt Ausgabe 34 / 2012 SCHWANZBEISSERN AUF DER SPUR Gerburgis Brosthaus, Landwirtschaftliches Wochenblatt Ausgabe 21 / 2013 EIN WEGWEISENDES PROJEKT Heinz-Georg Waldeyer, Landwirtschaftliches Wochenblatt Ausgabe 29 / 2013 DB.VIKTORIA DIE SAU MIT CHARAKTERSTÄRKE Dr. Barbara Voß, BHZP GEWAGT UND GEWONNEN: ILEITIS-IMPFUNG ZU MASTBEGINN Dipl.-Ing. agr. Maria Maßfeller, freie Agrarjournalistin 04 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
5 Inhalt S. 47 SCHWEINE BRAUCHEN DAUERHAFT BESCHÄFTIGUNG! Dr. Peter Rösmann, AGRAVIS Futtermittel GmbH S. 50 HYGIENE IN TRÄNKEWASSERLEITUNGEN Dieter Jürgens, AGRAVIS Futtermittel GmbH S. 54 HOHE FERKELZAHLEN UND TIERSCHUTZ EIN WIDERSPRUCH? Prof. Dr. Steffen Hoy, Justus-Liebig-Universität Gießen Bernd Schlattmann, Gesing Tierzucht S. 58 VOLLSTÄNDIGER SCHUTZ BEIM ABSETZEN Geoffrey Labarque, PhD; Dr. Astrid Pausenberger, Elanco Animal Health S. 60 DANZUCHT VERMEHRUNG ALS BETRIEBSERFOLG Robert Wenning, Detert Zuchttiere S. 62 LEISTUNGSSTEIGERUNG DURCH TIERISCHE PROTEINBAUSTEINE Christina Münks, Deutsche Tiernahrung Cremer S. 64 TUE GUTES UND REDE DARÜBER Dr. Karl-Heinz Tölle, Geschäftsführer der ISN-Projekt GmbH S. 67 GERMAN PIETRAIN-EBER MIT GENOMISCH OPTIMIERTEN ZUCHTWERTEN Dr. Jan Bielfeldt, Zuchtleiter, German Genetic S. 71 ERTRAGSMAXIMIERUNG ODER KOSTENMINIMIERUNG AUF WELCHES PFERD SETZEN ERFOLGREICHE SCHWEINEMÄSTER? Sven Häuser, DLG / EPP S. 75 FERKEL WASCHEN MIT MENNO TIERWASCHMITTEL TÄ Renate Baur, Menno Chemie, Lieferant von Neopredinol S. 78 AUF ERFOLGSSPUR MIT DER EBERMAST Anne Christin Niggeloh, Topigs-SNW GmbH S PLÄTZE AUF DER GRÜNEN WIESE Jacqueline Weiser, Landwirtschaftsverlag Münster, SUS S. 84 ZUKUNFTSWEISENDE IMPFTECHNOLOGIE JETZT AUCH ZUR PRÄVENTION DER ENZOOTISCHEN PNEUMONIE (FERKELGRIPPE) EINSETZBAR Dr. Hans-Peter Knöppel, Intervet Deutschland GmbH, ein Unternehmen der MSD Tiergesundheit S. 86 BRONZE, SILBER, GOLD UND PLATIN TRANSPARENT, FAIR, LEISTUNGSGERECHT! Dörthe Brandhoff, Sandra Boers, GFS S. 90 MACHEN SIE MIT UNS IHRE EIGENE ENERGIEWENDE! Alfons Sprick, Lange Gas, Lippstadt Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 05
6 Inhalt S. 94 S. 96 S. 101 S. 106 S. 108 S. 114 DIE CIRCO-IMPFUNG: BIS AN S ENDE SCHAUEN! Dr. Thorsten Bekendorf, Zoetis LEISTUNGEN UND KOSTEN TECHNISCHER UND NATÜRLICHER AMMEN IN DER FERKELAUFZUCHT Prof. Dr. Martin Ziron und Andrea Buffen, Fachhochschule Soest PIC-FUTTEREFFIZIENZ AUCH IM SAUENSTALL Barbara Berger, Marketing Manager PIC Western Europe WAS WILL DER VERBRAUCHER WAS LEISTEN DIE ERZEUGER? Dr. Jens Ingwersen, ZDS MITGLIEDER DES VORSTANDES, DES AUFSICHTSRATES UND MITARBEITER IMPRESSUM UNSER GESCHÄFTSBERICHT STEHT AUCH ONLINE FÜR SIE ZUR VERFÜGUNG. Verbindlich. Verlässlich. Westfleisch! 06 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
7 Merial Scharf kalkuliert Profitabel geschützt Überzeugender Schutz in Aufzucht und Mast Millionenfach bewährt Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 07
8 Georg Freisfeld Erzeugerring Westfalen, kom. Geschäftsführer GESCHÄFTSBERICHT 2013 Praktische Beraterfortbildung im Betrieb H. Große Lutermann An dieser Stelle gratulieren wir unseren Mitarbeitern Josef Raming aus Hamm und Reinhard Hinken aus der Geschäftsstelle zu jeweils 30 Jahren, Martin Breuer aus Telgte zu 10 Jahren Arbeit beim Erzeugerring Westfalen. Wir danken ihnen ganz herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz im Sinne der Schweineproduktion. TREUE MITARBEITER! Der Erzeugerring Westfalen kann stolz sein auf seine Mitarbeiter. Jeder Berater steht in seinem Bezirk den Landwirten Tag ein Tag aus mit fachlicher Beratung zur Verfügung. Durch hohe Selbstmotivation werden aktuelle Fragestellungen fachmännisch beantwortet, Neuigkeiten überprüft und mit dem Landwirt gemeinsam, individuell für den Erfolg des einzelnen Betriebes, wohlüberlegt eingesetzt. Der Austausch über gesammelte Erfahrungen, wissenschaftlichen Untersuchungen und persönlichen Erfahrungen zeichnen einen erfolgreichen Berater aus. Das Zusammenspiel zwischen dem Innenund Außendienst, gepaart mit einem großen Erfahrungsschatz der langjährigen Mitarbeiter halten den Erzeugerring Westfalen auf Erfolgskurs! Reinhard Hinken (Jubilar 30 Jahre) 08 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
9 Erzeugerring Westfalen Josef Raming (Jubilar 30 Jahre) ist Rückgang heißt es oft im Unternehmerumfeld. Aber bedeutet erweitern immer nur den quantitativen Wachstumsschritt zu gehen? Die Zukunft der Schweinehalter soll ein Wachstum in Qualität beinhalten. Das Thema Tierwohl scheint für den deutschen Markt die Antwort zu sein. Schauen wir einmal auf die Entwicklungen auf dem Schweinemarkt, so kann man beobachten, dass ein hoher Anteil Tiere aus dem Ausland nach Deutschland zur Mast bzw. zur direkten Schlachtung importiert werden. Wenn nun das Wachstum der Schweinehalter nicht mehr in Menge sondern in Qualität, wie mehr Tierwohl, erfolgen soll, ist es bitter notwendig auch die Importeure aus den Nachbarländern in diese Entwicklung zu integrieren. Dem Verbraucher ist wenig geholfen, wenn er national mehr Wohl für die Nutztiere fordert und das Ausland dabei übersehen wird. Die Produktion würde in andere Länder abwandern und mit gemindertem Tierschutz würden dort mehr Schweine gehalten. Übertriebener Umwelt- und Tierschutz zeigt am Beispiel Englands wohin die Reise führen kann. Wird die Schweineproduktion uneffektiv, werden keine nennenswerten Investitionen in diesen Wirtschaftsbereich mehr getätigt. In der Konsequenz wird das Schweinefleisch in hohem Anteil aus dem Ausland bezogen. Für Deutschland hat die Politik den Hebel in der Hand! Martin Breuer (Jubilar 10 Jahre) DIE LETZTE CHANCE GENUTZT? Viele Betriebe haben in den letzten Jahren in den Stallneubau investiert. Immer größer wurde die Angst, dass politisch bald»nichts mehr geht«! Gerade im letzten Wirtschaftsjahr konkretisierten sich die stärker werdenden Auflagen (Der NRW Filtererlass wurde niedergeschrieben). Das Bauen in den bisher gekannten Kostenrahmen scheint für die Zukunft in vielen Situationen nicht mehr möglich zu sein. Die Nutzung der letzten Chance hat allerdings auf einigen Betrieben Investitionssummen verursacht die in zurückliegenden Jahren ein Finanzvoluminar von zwei Jahrzehnten abgebildet hätten. Sicherlich: Geld ist günstig zu leihen. Der anschließende Kapitaldienst und die Personalkosten sollten aber auch in überschussschwachen Zeiten leistbar sein. Stillstand Unsere Infrastruktur von der Futterproduktion über die Schweinehaltung bis hin zur Verarbeitung ist weltmarktfähig. Die Welt benötigt immer mehr Nahrungsmittel. Laut UN Prognose wird die Weltbevölkerung von derzeit ca. 7 Mrd. Menschen bis 2050 auf 9,3 Mrd. Menschen ansteigen. Der pro Kopfverbrauch je Jahr soll von 40 kg auf 50 kg Fleisch ansteigen, gleichzeitig soll der Getreideverbrauch von derzeit 310 kg auf 330 kg ansteigen. Diese Entwicklungsprognosen scheinen aber einige Landespolitiker auszublenden. Tierschutz ist auch von den Zukunftslandwirten gewollt. Er sollte aber auch wirklich dem Tier nutzen und nicht dem Politiker als willkürliches Instrument dienen, um die Tierhaltung auszudünnen und bezüglich Tierschutz einen rückläufigen Schritt darstellen. Sollte tatsächlich die Verordnung zum Verzicht (ohne Ausnahmen) auf das Schwanzkupieren kommen, ist das aus Sicht der Schweinehalter als ein provokanter Aufruf aus der Politik zur Tierquälerei zu sehen. Mit Vernunft und gegenseitiger Anerkennung haben Tierschützer und Schweinehalter gute Chancen auf verschiedenste Art und Weise zu wachsen! Der Erzeugerring wird Sie dabei, sowohl produktionstechnisch als auch tierwohlmäßig, individuell beraten! Unsere Profis stehen für Sie bereit! Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 09
10 Georg Freisfeld Erzeugerring Westfalen, kom. Geschäftsführer SCHWEINEMAST JAHRESERGEBNISSE 2012 / 2013 Will man das Wirtschaftsjahr 2012 / 13 kurz und knapp beschreiben würde in der polemischen Presse evtl. zu lesen sein: Vier neue Rekorde in einem Jahr! Bereits im Wirtschaftsjahr zuvor konnte der Erzeugerring Westfalen den höchsten Erlös je kg Schlachtgewicht der letzten 21 Jahre beziffern. Doch dieser Rekord hielt nicht lange. Bereits ein Jahresabschluss später wurde ein neuer Rekorderlös von 1,85 / kg SG erstellt. Jeder landwirtschaftliche Unternehmer lernt während seiner Berufsausbildung, dass der Produkterlös allein noch lange keine guten Gewinne verspricht. Die Ferkelkosten sind in der Vergangenheit zwar auch schon deutlich über 2,37 / kg gestiegen, allerdings ist dies bereits 15 Jahre her. Der Ferkelpreis muss auch stabil bleiben, denn auch hier sind steigende Kosten zu verbuchen. Der zweite Rekord aus den Auswertungen der letzten 22 Jahre wird von den Futteraufwendungen je kg Zuwachs gestellt. Bei leicht gestiegenen Tageszunahmen konnte die Futterverwertung auf 1:2,81 verbessert werden. Trotz dieser Leistungssteigerung konnten die Futterkosten je kg Zuwachs nicht gemindert werden. Mit 0,88 / kg Zuwachs wurde sogar ein weiterer Kostenrekord in der Schweinemast aufgestellt. Betrachtet man den Indikator für Tiergesundheit, so findet sich hier ein neuer positiver Rekord, die Verluste sind erstmalig auf 2,3 Prozent abgefallen. Die Schweinemast lebt genauso wie die Industrie von Produktionseffektivität und Kostenminimierungen. Was nutzt uns der hohe Verkaufserlös, wenn die Kosten unsere Produktivität schmälern. Mit einem Überschuss von 22,47 pro verkauftem Schwein liegen wir unter dem 22jährigen Schnitt. Hervorzuheben bleibt, dass Schweinemäster, welche zu den besten 10 Prozent gehören, nach DKFL je Schwein die gleichen Tageszunahmen wie der Durchschnitt aller an der Auswertung beteiligten Mäster hatten. In Wirtschaftsjahren mit hohen Futterkosten und Schlachtschweineerlösen hat es sich immer bewährt die Futterkosten und Schlachtleistungen fest im Griff zu haben. Da verliert die letzte Zunahmeleistung an Bedeutung. Wurden im Schnitt 2,81 kg Futter für ein kg Körpermassebildung benötigt, schafften gerade die besten Betriebe den gleichen Zuwachs mit nur 2,72 kg Futteraufwand und 1,5 billigeren Futterpreisen je dt. Dadurch reduzierten sie die Futterkosten je Schwein um ganze 6. Mit 96,2 kg zu im Schnitt 95,9 kg Schlachtgewicht verkauften die erfolgreichsten Betriebe ihre Schweine nur minimal schwerer. Die Indexpunkte je kg SG waren bei den besten Mästern um 0,05 Punkte besser. Diese kleinen Stellschrauben werden im Preishoch aber mit einem hohen Faktor multipliziert. Dadurch erzielten die besten 10 Prozent der Schweinemäster im Erzeugerring Westfalen 33,21 Überschuss je verkauftem Mastschwein. Sie verdienten damit 10,74 mehr am Schwein als der Schnitt aller ausgewerteten Betriebe. 10 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
11 Erzeugerring Westfalen TABELLE 1: ENTWICKLUNG DER SCHWEINEMAST IN DEN VERGANGENEN 22 JAHREN WJ Der Überschuss je Mastschwein ist trotz deutlicher Niveausteigerung im Ausgaben- wie auch Einnahmenfeld verringert ausgefallen. Der Linienverlauf schildert sehr deutlich die immer weiter steigende Kapitalintensität in der Schweinehaltung! In den Wochen mit Hochpreisnotierungen > 1,93 / kg Schlachtgewicht, kamen sogar einige Händler mit der gegebenen Hermesbürgschaft (Zahlungssicherheit) für die Wochentierzahl an ihre Gren- BE- TRIEBE TIERZAHL MAST- ENDE MAST- PERIODE KG VER- LUSTE % TAGES- ZU- NAHME GR. FUTTER- VER- WER- TUNG 1: FUTTER- KOSTEN / KG ZU- WACHS FERKEL- KOSTEN / KG ERLÖS / KG SG ÜBER- SCHUSS JE SCHWEIN 91 / , ,07 0,68 2,74 1,57 35,00 92 / , ,05 0,65 1,97 1,21 18,00 93 / , ,03 0,58 1,71 1,09 17,00 94 / , ,01 0,55 2,05 1,15 17,00 95 / , ,00 0,54 2,20 1,24 24,00 96 / , ,98 0,57 2,56 1,42 30,00 97 / , ,95 0,55 2,33 1,32 20,00 98 / , ,93 0,47 1,38 0,82 7,00 99 / , ,90 0,47 1,85 1,01 15,00 00 / , ,90 0,50 2,38 1,70 34,00 01 / , ,91 0,50 2,30 1,48 23,00 02 / , ,91 0,47 1,91 1,29 17,50 03 / , ,91 0,51 1,82 1,30 17,70 04 / , ,90 0,45 2,20 1,51 30,80 05 / , ,90 0,44 2,12 1,49 31,50 06 / , ,90 0,49 2,07 1,47 26,40 07 / , ,91 0,73 1,71 1,51 18,78 08 / , ,89 0,63 2,30 1,62 22,61 09 / , ,88 0,54 2,10 1,47 23,74 10 / , ,88 0,69 1,96 1,53 20,38 11 / , ,84 0,75 2,21 1,70 24,55 12 / , ,81 0,88 2,37 1,85 22,47 MITTEL , ,93 0,57 2,11 1,39 22,66 * Die Daten dieser Betriebe sind im ganzen Wirtschaftsjahr erfasst und ausgewertet worden. ÜBERSCHUSS ÜBER FERKEL- UND FUTTERKOSTEN (WJ 01 / 02 BIS 12 / 13) Wie das Diagramm zeigt, treiben Futter- und Ferkelkosten den Umsatz in die Höhe! zen. Vereinzelte Verlängerungen der Zahlungsziele waren die Konsequenz daraus. Futterkosten von 80,6 / Mastschwein haben die Futterkosten je kg Körpermassezuwachs von 0,75 auf 0,88 auf 154 Prozent über dem Mehrjahresschnitt steigen lassen. Auch die Ferkelpreise von 67,80 beinhalten eine deutliche Überschreitung des Mehrjahresschnitts von 112 Prozent. Nur leider liegt der Überschuss um 1 Prozent unter dem Mehrjahresschnitt. Abschließend bleibt festzuhalten, dass Verkaufserlöse in gefühlter Rekordhöhe bitter notwendig sind, um die Preissteigerungen in der Produktion von Schweinefleisch abzufangen. Von»Taschenvollmachen«kann hier überhaupt nicht die Rede sein! Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 11
12 Georg Freisfeld Erzeugerring Westfalen, kom. Geschäftsführer WIR BERATEN TIERWOHL In der Fachpresse ist das Thema»Initiative Tierwohl«überall zu lesen. Wenn Tierwohl kommt, und das wird es wohl, wird es für die Schweinehaltung ein Meilenstein. Mit der Initiative Tierwohl soll eine systematische Honorierung von Tierhaltungsverfahren, welche dem Tier mehr Wohl generieren, direkt über den Lebensmitteleinzelhandel (LEH) erfolgen. Die größten im deutschen Lebensmitteleinzelhandel tätigen Unternehmen haben am 5. September 2013 ihre Absichtserklärung zur Teilnahme unterschrieben. Damit ist der Start noch nicht garantiert. Auch das Kartellamt muss noch zustimmen. Allerdings sollten sich die Betriebe gerade jetzt in der ruhigeren Winterzeit gedanklich darauf vorbereiten, wie sie am sinnvollsten in diesem Tierwohlsystem teilnehmen könnten. Derzeit sind die Definitionen der einzelnen Kriterienpunkte noch nicht ausreichend festgeschrieben. In Fachgruppensitzungen zwischen grüner und roter, bzw. LEH-Seite wird derzeit versucht eine Einigung zu finden. Auch die Seite der Tierschützer will gehört werden. Eine kontroverse Gruppe versucht (in 2014) eine Einigung zu finden. Wir stellen hier die Kriterienpunkte der einzelnen Produktionsstufen Sauenhaltung, Ferkelaufzucht und Mast zur Initiative Tierwohl zur Verfügung. Sprechen Sie mit Ihrem Berater die einzelnen Punkte einmal durch und arbeiten diejenigen heraus, welche in Ihrem Bestand umsetzbar sind. Wie bereits im Dezember 2014 begonnen, werden wir auch in 2014 bei Bedarf in den verschiedenen Regionen Westfalens Workshops auf jeweils einem landwirtschaftlichen Betrieb für Sie anbieten. Jeder Schweinehalter kann teilnehmen und ist herzlich dazu eingeladen. Die Teilnahme kostet 30 netto je Betrieb. Auch hier zählt Mitglieder werben Mitglieder: Wenn ein Erzeugerringmitglied einen Schweinehalter mit zum Workshop anmeldet, der noch keine Mitgliedschaft beim ERW besitzt, dann ist für das Erzeugerringmitglied die Workshop-Teilnahme kostenlos! BONITIERUNGSSCHEMA TIERWOHL FÜR FERKELAUFZUCHT BLOCK A zu erfüllende Grundanforderungen STANDARDPAKET BLOCK B Mind. 1 Kriterium aus B1 + mind. 1,00 aus B1 + B2 Block B1 Block B2 SONDERDPAKET BLOCK C Sonderkriterium»Ringelschwanz«QS-Systemteilnahme Jährliche Audits QS-Antibiotikamonitoring Gesundheitsplan Stallklimacheck Tränkewassercheck Tageslicht 1,5 % Fixer Basisbonus (500,00 / Betrieb / Jahr) P l a t z +10 %, +20 % oder % und / oder Raufutter (Wühlturm, Raufe, usw.) 0, 8 0 1, 2 0 2,40 0,40 Mikroklimabereich Organisches Beschäftigungsmaterial Saufen aus der offenen Fläche Scheuermögl. Komfortliegeflä. Klimareize (Offenfrontstall) Auslauf Individueller Wahlbonus (mind. 1,00 / Ferkel) FERKELAUFZÜCHTERBONUS 0,20 0,30 0,40 0,40 0,50 0,30 0,30 Ferkelerzeuger, -aufzüchter und Mäster bilden Einheit Fachliche Begleitung durch qualifizierten Berater Erfüllung des Standardpaket Meldung der Anzahl Tiere für Block C Zahlung nur bei 70 % Erfüllungsquote Weitere Definitionen noch offen 6,0 0 / Tier (aufzuteilen) Quelle: DBV auf Basis Initiative Tierwohl 12 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
13 Erzeugerring Westfalen BONITIERUNGSSCHEMA TIERWOHL FÜR SCHWEINEMAST BLOCK A zu erfüllende Grundanforderungen STANDARDPAKET BLOCK B Mind. 1 Kriterium aus B1 + mind. 3,00 aus B1 + B2 Block B1 Block B2 SONDERDPAKET BLOCK C Sonderkriterium»Ringelschwanz«QS-Systemteilnahme Jährliche Audits QS-Antibiotikamonitoring Schlachtbefunddatenauswertung, indexiert Stallklimacheck Tränkewassercheck Tageslicht 1,5 % Fixer Basisbonus (500,00 / Betrieb / Jahr) BONITIERUNGSSCHEMA TIERWOHL FÜR SAUENHALTUNG BLOCK A zu erfüllende Grundanforderungen QS-Systemteilnahme Jährliche Audits QS-Antibiotikamonitoring Gesundheitsplan Stallklimacheck Tränkewassercheck Tageslicht 1,5 % Fixer Basisbonus (500,00 / Betrieb / Jahr) P l a t z +10%, +20% oder +40% und / oder Raufutter (Wühlturm, Raufe, usw.) STANDARDPAKET BLOCK B Mind. 1 Kriterium aus B1 + mind. 2,00 aus B1 + B2 Block B1 Platz in der Gruppenhaltung +10%, 1,40 +20% oder 2,20 +40% 2,40 und / oder Raufutter in der Gruppenhaltung (Wühlturm, Raufe, usw.) und 2, 8 0 4, 0 0 8,00 2,00 MÄSTERBONUS organ. Nestbaummaterial 0,90 SAUENHALTERBONUS Jungebermast Autom. Luftkühl. Organisches Beschäftigungsmaterial Saufen aus der offenen Fläche Scheuermögl. Komfortliegeflä. Buchtenstruktur. Klimareize (Offenfrontstall) Auslauf Individueller Wahlbonus (mind. 3,00 / MS) Block B2 Kastration mit wirks. Schmerzaussch. Organisches Beschäftigungsmaterial Saufen aus der offenen Fläche Gruppenh. und/ oder Abferkelber. Scheuermöglichk. Gruppenhaltung ab 6.Tag n. Belegen 4-wöch. Säugezeit abged. Ferkelnest Ferkelschlupf Wühlerde f. Ferkel Komfortliegeflä. (Wartestall) freie Abferkelung Klimar. (Offenfrontst.) Auslauf Individueller Wahlbonus (mind. 2,00 / Ferkel) 1,50 0,20 1,00 0,70 0,60 2,50 0,20 1,00 1,00 1,50 1,15 0,07 0,18 0,05 1,40 1,00 0,10 0,05 0,33 0,80 2,00 0,30 0,60 Ferkelerzeuger, -aufzüchter und Mäster bilden Einheit Fachliche Begleitung durch qualifizierten Berater Erfüllung des Standardpaket Meldung der Anzahl Tiere für Block C Zahlung nur bei 70 % Erfüllungsquote Weitere Definitionen noch offen 6,0 0 / Tier (aufzuteilen) SONDERDPAKET BLOCK C Sonderkriterium»Ringelschwanz«Ferkelerzeuger, -aufzüchter und Mäster bilden Einheit Fachliche Begleitung durch qualifizierten Berater Erfüllung des Standardpaket Meldung der Anzahl Tiere für Block C Zahlung nur bei 70 % Erfüllungsquote Weitere Definitionen noch offen 6,0 0 / Tier (aufzuteilen) Quelle: DBV auf Basis Initiative Tierwohl Quelle: DBV auf Basis Initiative Tierwohl Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 13
14 Georg Freisfeld Erzeugerring Westfalen, kom. Geschäftsführer NEUE ERFAHRUNGEN IN DER EBERMAST Da sich mit der Düsseldorfer Erklärung im Jahr 2008 abzeichnete, dass die betäubungslose Kastration auf kurz oder lang beendet sein wird, hat sich der Erzeugerring Westfalen seitdem in verschiedenen Projekten an Forschungsvorhaben rund um die Ebermast beteiligt und viele Erfahrungen in der Begleitung von Neueinsteigern in die Ebermast gesammelt. Neben Fragen zu Haltung und Management ist die Fütterung wesentlicher Bestandteil der Beratungsleistung. Klar ist mittlerweile, dass Eber einen anderen Anspruch an das Futter haben. Insbesondere die Versorgung mit Aminosäuren sollte auf einem anderen Niveau liegen. EIN FUTTERKONZEPT FÜR EBER UND SAUEN Da in vielen Mitgliedsbetrieben eine getrennte Fütterung von Ebern und Sauen nur schwer umsetzbar ist, wurden in einem Praxisbetrieb die Sauen mit Standard- Mastfutter im Vergleich zu speziellem Ebermastfutter versorgt. Die Eber bekamen alle ein spezielles Ebermastfutter. In der Vormast von zirka 37 Kilogramm bis rund 50 Kilogramm Lebendmasse erhielten alle Gruppen ein Begrüßungsfutter für Eber als Eigenmischung. Anschließend wurden die Sauen der Variante Standard mit dem normalen Mastfutter Dynamic Euromast gefüttert. Die Sauen der Variante Ebermast und die Eber bekamen von 50 Kilogramm Lebendmasse bis etwa 85 Kilogramm Lebendmasse das Ebermastfutter Olympig Verro II und ab 85 Kilogramm Lebendmasse das Ebermastfutter Olympig Verro III. Alle Tiere wurden an einer Sensorfütterung ad-libitum gefüttert. IM VERGLEICH: EIN FUTTERKONZEPT FÜR SAUEN UND EBER SAUEN SAUEN EBER FUTTER- REGIME Mastfutter Standard Ebermastfutter Ebermastfutter TIERZAHL, N TAGES- ZUNAHMEN, G FUTTERAUFWAND JE KILOGRAMM ZUWACHS, KG INDEXPUNKTE JE KILOGRAMM SG, PUNKTE FUTTERKOSTEN JE KILOGRAMM- ZUWACHS, ,75 1,01 0, ,64 1,02 0, ,58 1,01 0,87 14 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
15 Erzeugerring Westfalen AUF EINEN BLICK: EBER IN DER ENDMAST PROTEINREDUZIERT GEFÜTTERT EBER KONTROLLE EBER VERSUCH FUTTER- REGIME Ebermastfutter Ebermastfutter in der Endmast 14 Prozent RP TIER- ZAHL, (N) TAGES- ZUNAH- MEN, (G) FUTTERAUFWAND JE KILOGRAMM ZUWACHS, ( KG) INDEXPUNKTE JE KILOGRAMM SG, ( PUNKTE ) FUTTERKOSTEN JE KILOGRAMM- ZUWACHS, ( ) ,41 1,00 0, ,42 1,00 0,81 EBERMASTFUTTER FÜR SAUEN Das Ebermastfutter war durchschnittlich über alle Futter etwa einen Euro pro Dezitonne teurer als das Standardmastfutter. Trotzdem lagen die Futterkosten je Kilogramm Zuwachs bei der Gruppe»Sauen mit Ebermastfutter «günstiger, da der Futterverbrauch dort geringer war. Die Schlachtkörperqualitäten waren in dieser Gruppe ebenfalls tendenziell besser. Die Eber bestätigten bisherige Erfahrungen, dass sie höhere Tageszunahmen als die Sauen erzielen und den höheren Futterpreis durch eine bessere Futterverwertung mehr als kompensieren. Bei den Schlachtkörperqualitäten erreichten sie das Niveau der Sauen. Dieser Praxistest zeigt, dass in Betrieben in denen eine getrennte Versorgung von Eber und Sauen nicht möglich ist, beide Geschlechter mit einem am Bedarf der Eber ausgerichteten Futter gemästet werden können. NÄHRSTOFFREDUZIERTE FÜTTERUNG das gleiche Mittelmastfutter. In der Endmast erhielt die Kontrollgruppe das Alleinfutter Olympig Verro III mit 16,5 Prozent Rohprotein und die Versuchsgruppe das Alleinfutter Olympig Verro IV mit 14 Prozent Rohprotein. Dieses Futter ist im Rohproteingehalt abgesenkt, der Gehalt an praecaecal verdaulichen Aminosäuren jedoch dem Bedarf der Eber angepasst. Es ergaben sich keine Leistungsdifferenzen und keine Unterschiede im Tierverhalten. Dieser Praxistest zeigt, dass eine proteinreduzierte Fütterung in der Endmast auch bei Mastebern möglich ist. Aufgrund der aktuell hohen Eiweißpreise ergaben sich etwas geringere Futterkosten. Entscheidend für den Masterfolg ist weniger der Gehalt an Rohprotein im Futter, sondern eine für Masteber angepasste Versorgung mit Aminosäuren. Nur gesunde Tiere können sehr gute Leistungen erbringen. Da bei einem beanspruchten Immunsystem der Bedarf an Aminosäuren beziehungsweise Rohprotein steigt sind gesunde Tiere Vorraussetzung für eine stark proteinreduzierte Fütterung. Die Preise für Soja- und Rapsextraktionsschrot befinden sich nach wie vor auf einem hohen Niveau. Das ist neben einer verbesserten Nährstoffbilanz ein Grund mehr über reduzierte Proteingehalte in der Endmast nachzudenken. Bisherige Erfahrungen in der Ebermast zeigen, dass bei Nichtbeachtung des höheren Bedarfs an Aminosäuren die Tiere geringere Leistungen und vermehrt Unruhe zeigen. Darum wurde die proteinreduzierte Fütterung in einem Praxisbetrieb mit Ebermast getestet. Die Tiere wurden mit speziellem Ebermastfutter versorgt. In Vormast und Mittelmast als Eigenmischung und in der Endmast als Alleinfutter. Von 23 Kilogramm bis 37 Kilogramm Lebendmasse bekamen beide Gruppen das gleiche Begrüßungsfutter und anschließend bis 90 Kilogramm Lebendmasse Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 15
16 Reinhard Hinken Erzeugerring Westfalen FERKELERZEUGUNG JAHRESERGEBNISSE 2012 / 2013 Für die Ferkelerzeuger war das Wirtschaftsjahr 2012 / 2013 (WJ 12 / 13) ein überdurchschnittlich gutes Jahr. Die DKfL je Sau lag mit 564, um 57, über dem zehnjährigen Mittel von 507, (siehe Tabelle 1). Die biologischen Leistungen stagnierten auf hohem Niveau. Die Zahl der abgesetzten Ferkel lag bei 27,4 je Sau und erreichte ihren höchsten Stand, wobei sich die aufgezogenen Ferkel je Sau im abgelaufenen Wirtschaftsjahr nicht erhöhten. Die Ferkelverluste stiegen wieder leicht an und konnten an den guten Vorjahreswert nicht anknüpfen. TABELLE 1: ENTWICKLUNG DER FERKELERZEUGUNG IN DEN VERGANGENEN 10 JAHREN WJ Typ I *) je Betr SAUEN Würfe abges. Ferkel aufgez. Ferkel FERKEL- VER- LUSTE gesamt in % kg je Tier EUR je kg dt EUR Aufwand EUR 03 / ,28 21,4 20,5 17,5 29,3 1,71 11,9 232,- 777,- 332,- 04 / ,30 22,0 21,2 17,2 29,4 2,09 11,9 212,- 772,- 614,- 05 / ,30 22,3 21,5 17,3 29,9 2,03 11,9 211,- 780,- 603,- 06 / ,31 22,7 21,9 17,7 29,9 2,00 12,1 229,- 841,- 552,- 07 / ,33 23,7 22,8 17,6 30,2 1,66 12,0 331,- 1007,- 204,- 08 / ,34 24,3 23,5 17,3 29,6 2,24 12,1 301,- 1009,- 637,- 09 / ,35 25,0 24,2 17,2 29,9 2,03 12,1 256,- 960,- 582,- 10 / ,36 25,8 25,0 17,3 30,5 1,87 12,1 318,- 1095,- 411,- 11 / ,36 27,3 26,5 16,6 29,8 2,13 12,3 358,- 1186,- 567,- 12 / ,35 27,4 26,5 17,2 29,8 2,28 12,5 413,- 1322,- 564,- MITTEL 10 JAHRE BETRIEBE JE SAU UND JAHR FERKEL VERKAUF FUTTER JE SAU JE SAU UND JAHR ,33 24,2 23,4 17,3 29,8 2,01 12,1 286,- 975,- 507,- DKfL EUR *) Typ I: Die Daten dieser Betriebe wurden im ganzen Wirtschaftsjahr erfasst und ausgewertet. Nur Ferkelerzeuger mit Ferkelaufzucht. 16 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
17 Erzeugerring Westfalen GRAFIK 1: ENTWICKLUNG DER FERKELNOTIERUNG»NORD-WEST«ÜBER ZWEI WIRTSCHAFTSJAHRE Euro je Ferkel Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun WJ 11 / 12 (Ø 46,78) WJ 12 / 13 (Ø 50,74) DIE ERLÖSSITUATION FÜHRTE ZU EINEM ÜBERDURCHSCHNITTLICHEN ÖKONOMISCHEN ERGEBNIS Die relativ guten Direktkostenfreien Leistungen (DKfL) bei der Sauenhaltung lagen in den guten Ferkelerlösen begründet. In Tabelle 1 zeigt für das WJ 2012 / 2013 mit 2,28 je kg LG den höchsten Ferkelerlös der letzten zehn Jahre. Seit April 2011 gibt es die neue Ferkelnotierung»Nord- West«. In der Grafik 1 sind die Durchschnittsnotierungen der letzten beiden Wirtschaftsjahre monatlich aufgeführt. Als erstes kann man erkennen, dass im WJ 2012 / 2013 der Kurvenverlauf nicht so stark schwankte. Wenig schwankende Notierungen sind für die Ferkelproduzenten wünschenswert. In den Monaten von Juli bis November verliefen die Trends gegensätzlich. Während im WJ 11 / 12 die Ferkelnotierungen sanken und einen Tiefstand von 35, erreichten, stiegen sie im WJ 12 / 13 stetig an, blieben aber ab Januar 2013 unter dem Niveau des Vorjahres. Bemerkenswerter ist, dass der Durchschnitt der Nord-West- Notierung von 50,74 je Ferkel im WJ 12 / 13 um knapp vier Euro höher lag als im WJ 11 / 12 (46,78 ). GUTEN ERLÖSEN STANDEN HOHE KOSTEN GEGENÜBER Mit 1322, Aufwand sind die ( Direkt-)Kosten in der Sauenhaltung so hoch wie noch nie zuvor. Preistreiber waren auch in diesem Jahr die Futterkosten. Mit 877, Gesamtfutterkosten je Sau und Jahr lagen sie noch einmal Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 17
18 um 111, höher als im letzten Jahr. Die insgesamt verbrauchten Mengen an Sauen- und Ferkelkraftfutter sind nicht angestiegen. Die dt-preise sind beim Sauenfutter um 14 Prozent und beim Ferkelfutter um 13,5 Prozent gestiegen. Die Futterkosten machen zur Zeit 66,3 Prozent der gesamten variablen Kosten aus. Hier sind wichtige Ansatzpunkte zur Kostenreduzierung zu suchen. Überlegenswert ist zum Beispiel Einkaufgemeinschaften zu bilden und das Futter ausschreiben zu lassen. Hierbei wurden schon gute Erfahrungen gemacht. Demgegenüber sind andere variable Kosten wie Remontierung, Tierarzt, Besamung unwesentlich gestiegen. ERFOLGREICHE BETRIEBE LAGEN BEI 894, DKFL JE SAU Die zehn Prozent erfolgreichen Betriebe hatten im Schnitt 330, mehr DKfL je Sau und Jahr als der Schnitt aller Erzeugerring-Betriebe. Folgende Parameter verdeutlichen die Unterschiede. Auf der Ertragsseite kann sowohl durch mehr verkaufte Ferkel (+3,3) als auch durch höhere Ferkelerlöse (+1,9 / Ferkel) einen um 272 je Sau verbessertes Ergebnis zugunsten der erfolgreichen Betriebe festgestellt werden. Auf der anderen Seite konnten die variablen Kosten um insgesamt 58 niedriger gehalten werden. Hierbei gab es bei den Futterkosten keine nennenswerten Unterschiede, obwohl bei der Gruppe der erfolgreichen Betriebe mehr Ferkel je Sau gefüttert werden mussten. Beachtenswert sind die Ausgaben für die Tiergesundheit. Die erfolgreichen Betriebe hatten 16 je Sau weniger Ausgaben. Das ist deshalb bemerkenswert, weil der größte Anteil der Tierarztkosten auf Impfkosten entfallen. Diesjährige Auswertungen zeigen, dass die Ausgaben für Tiergesundheit schnell mal auf über 170 je Sau steigen können, wenn die Ferkel u. a. dreifach geimpft werden. FAZIT: Ökonomisch war das WJ 2012 / 2013 ein gutes Jahr, weil die Erlöse stimmten. Die Futterkosten haben ein Rekordhoch erreicht und drückten auf die Margen. Die biologischen Leistungen stagnierten auf hohem Niveau. Die Anzahl der durchschnittlich gehaltenen Sauen stieg auf 227 je Betrieb (+16). Die erfolgreichen Betriebe hatten vor allen Dingen einen höheren Ertrag. Trotz deutlich besserer biologischer Leistungen blieben sie mit ihren variablen Kosten unter dem Ringschnitt. TABELLE 2: VERGLEICH DER ERFOLGREICHEN BETRIEBE MIT DEM DURCHSCHNITT DES ERZEUGERRINGES PARAMETER Ø ERW ERFOLGREICHE BETRIEBE DIFFERENZ Anzahl Sauen Verkaufte Ferkel je Sau 26,5 29,8 +3,3 Erlös je Ferkel(EUR) 68,0 69,9 +1,9 Ges.-Ertrag (EUR / Sau) Ges.-Aufwand (EUR / Sau) davon Futterkosten davon Aufwand f. Tiergesundheit davon sonstige Direktkosten DKfL je Sau (EUR / Sau) Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
19 Erzeugerring Westfalen Heinz-Georg Waldeyer Landwirtschaftliches Wochenblatt Ausgabe 30 / 2012 WISSEN, WAS IM STALL LÄUFT Dr. Theodor Schulze-Horsel vom Schweinegesundheitsdienst der Landwirtschaftskammer NRW berichtet über Fallbeispiele aus dem Verbundprojekt»Gesunde Tiere gesunde Lebensmittel«. Herzstück des Cluster- bzw. Verbundprojektes» Gesunde Tiere gesunde Lebensmittel«ist die regelmäßige Untersuchung von Blutproben und Kotproben aus allen beteiligten Betrieben. Die Proben werden auf die wichtigsten Infektionserreger untersucht, die in heutigen Schweinebeständen vorkommen. Serologisch werden nachgewiesen: PRRS-Virus, APP, Influenzavirus, Mykoplasma hyopneumoniae, Hämophilus parasuis, Salmonellen. Zusätzlich werden per Pool-PCR untersucht, ob PRRS- Virus oder PCV2 (Circovirus) vorhanden ist (die PCR- Untersuchung ist eine molekularbiologische Methode, um zum Beispiel Virusinfektionen anhand ihrer Erbsubstanz nachzuweisen). Kotproben werden in der PCR auf Brachyspiren (Dysenterieerreger ) und Lawsonien, die Erreger der PIA, untersucht. bung ergab sich in einer Ferkelerzeuger-Mäster-Direktbeziehung, das in der Übersicht skizzierte Bild an Salmonellenergebnissen. Während beim Ferkelerzeuger lediglich eine der 15 Proben den offiziellen Cut Off (Grenzwert ) von 40 (OD 40) überstieg, lagen acht weitere Proben in dem Bereich über OD 10, welcher vom Hersteller des verwendeten Testkits als»positiv«angegeben wird. Beim Mäster lagen 11 der 15 Proben über dem offiziellen Cut Off von 40, was 73 Prozent positiver Proben und damit einer Salmonellen-Kategorie III entspricht. PROBEN ZIEHEN ERGEBNISSE AUSWERTEN Die Untersuchungen erfolgten in der ersten Phase des Verbundprojektes in den Mastbetrieben mindestens einmal pro Mastdurchgang, bei den Ferkelerzeugern einmal pro Halbjahr. Es wurden jeweils 15 Tiere am Ende der Ferkelaufzucht (etwa 28 kg schwer), fünf Schweine in der Mittelmast und zehn Tiere in der Endmast untersucht. Pro Betrieb wurden zudem drei Sammelkotproben analysiert. Die Ergebnisse dieser Probenziehungen wurden anschließend zur»standortbestimmung«der Tiergesundheitssituation in den beteiligten Betrieben herangezogen. Dabei ergab sich in mehreren Fällen rasch Handlungsbedarf: Der erste Praxisfall ist gleich ein Negativbeispiel, das aufzeigt, wie die Zusammenarbeit in einem solchen Projekt gerade nicht aussehen sollte. Bereits bei der ersten Bepro- Beim Verbundprojekt»Gesunde Tiere gesunde Lebensmittel«geht es darum, die Tiergesundheitssituation unter die Lupe zu nehmen, um diese bei Bedarf gezielt verbessern zu können; Foto: B. Lütke Hockenbeck Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 19
20 Aufgrund der Ergebnisse erfolgte eine telefonische Beratung beider Betriebe. Es wurde auf die Notwendigkeit hingewiesen, Maßnahmen zu ergreifen. Auch wurde für beide Betriebe ein Maßnahmenpaket aus intensiver Reinigung und Desinfektion, Säurezusatz zum Futter, Verbesserung der Futterstruktur durch Erhöhung des Gerstenanteils in der Ration und weiteren hygienischen Maßnahmen geschnürt. Der Mäster wurde darauf hingewiesen, seine Werte im Salmonellenmonitoring online zeitnah im Auge zu behalten. Einige Wochen später kam überraschend die Reaktion des Mästers, er habe jetzt die Nachricht bekommen, dass er in Kategorie III eingestuft sei und warum er von den Projektbetreuern denn nicht benachrichtigt worden sei. Er werde ab sofort andere Ferkel einstallen. Damit ist der Mastbetrieb leider aus dem Clusterprojekt ausgeschieden, während beim Ferkelerzeuger beim nächsten Betriebsbesuch die Umsetzung der Maßnahmen zur Salmonellenreduktion intensiv diskutiert wurde. zudem, dass aufgrund zu niedrig eingestellter Solltemperaturen die Luftraten in allen Abteilen sehr hoch und die Tag-Nacht-Schwankungen sehr groß waren, was die Tiere belastete. Aufgrund dieser Ergebnisse wurden die folgenden Maßnahmen eingeleitet: Gründliche Entwurmung der nächsten Ferkel gleich nach der Anlieferung Reinigung der Tränkenippel, Entfernung der Siebe, teilweises Aufbohren der Ventile, bis alle Tränken 800 ml / min Flussrate sicher erreichen Erhöhung der Solltemperaturen in allen Abteilen auf 24 C Einmischen von Kochsalz ins Futter. Nach Durchführung all dieser Maßnahmen war beim nächsten Betriebsbesuch fast kein Kannibalismus mehr im Bestand zu sehen und damit auch eigentlich klargestellt, dass nicht die Ferkel allein am Problem»schuld«sind. WAS ALLES SCHIEFLAUFEN KANN... Ein weiteres brisantes und hochaktuelles Thema in Schweinebeständen ist Kannibalismus. Auch hierzu liefert das Verbundprojekt Beispiele und Erfahrungen. So fiel in einem Mastbetrieb mit fester Anbindung an einen Ferkelerzeuger des Projektes beim Betriebs- bzw. Stallrundgang mit der Erzeugerringsberaterin folgendes auf: In vielen Buchten (verteilt über alle Abteile des Betriebes) gab es Ohren-, Schwanz- und Flankenbeißen. Nach einiger Zeit im Stall fiel dann zusätzlich auf, dass in allen Buchten die Tränken intensiv belagert wurden. Der Betriebsleiter glaubte, das alles müsse an den Ferkeln liegen. Um der Sache objektiver auf den Grund zu gehen, wurden aber Blutproben von Tieren aus betroffenen Buchten entnommen. Zusätzlich zum Projekt-Screening wurde ein großes Blutbild angefordert. Dazu gehört die zahlenmäßige Bestimmung der roten und weißen Blutkörperchen, wobei die verschiedenen weißen Blutkörperchen einzeln ausgezählt werden. Es wurde überdies ein Termin für einen Lüftungscheck mit dem Lüftungsberater des Erzeugerrings vereinbart und die Durchflussrate der Tränken wurde stichprobenweise überprüft. Dabei zeigte sich, dass die Testtränken weniger als 200 ml Wasser pro Minute lieferten. Eine anschließende Überprüfung aller Tränken bestätigte dies. Die Auswertung des großen Blutbildes ergab bei vier von fünf Proben einen erhöhten Anteil»eosinophiler Granulozyten«. Dies ist ein Hinweis auf ein allergisches Geschehen oder einen Parasitenbefall. Der Klimacheck zeigte SALMONELLENERGEBNISSE: SALMONELLENWERTE DER IM FERKEL- ERZEUGER- UND IM ANGESCHLOS- SENEN MASTBETRIEB GEZOGENEN PROBEN Ferkelerzeuger* Mäster* 3,83 61,96 10,73 28,26 10,60 21,66 5,52 13,65 1,13 72,28 4,75 55,89 39,54 87,91 26,73 41,67 40,28 24,57 11,02 78,51 0,48 70,64 31,77 61,72 28,99 65,97 2,28 87,87 24,38 79,43 Proben über OD 10 60,0 % 100 % Proben über OD 40 6,6% 73 % * Ergebnisse des ELISA-Antikörpertests im Beispielsfall, angegeben als OD % 20 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
21 Erzeugerring Westfalen FIEBER UND DURCHFALL IN DER AUFZUCHT Der dritte Praxisfall zeigt an einem Betrieb mit 320 Sauen und angeschlossener Mast eines Teils der eigenen Ferkel das Vorgehen in einem sehr komplexen Geschehen. In diesem Betrieb werden die Ferkel mit durchschnittlich 26 Tagen abgesetzt. Gefüttert wurden sie nach dem Absetzen mit einer Pigfit-Fütterung (Carrasfütterung mit Tränkenippeln) oder Pigmix-Fütterung. Etwa vier bis fünf Tage nach Beginn der Verfütterung des Ferkelaufzuchtfutters I (FAZ I) zeigten die Ferkel regelmäßig hohes Fieber, teilweise mit Durchfall. Angesichts dieser Probleme veranlassten Hoftierarzt und Schweinegesundheitsdienst am 23. August 2011 die Untersuchung (Sektion) von sechs Ferkeln im Staatlichen Veterinäruntersuchungsamt Arnsberg. Dabei ergaben sich folgende Befunde: Coli-Enterotoxämie (Ödemkrankheit), Brustfell- und Herzbeutelentzündung durch Hämophilus parasuis, Influenza-A-Virus. Am 29. August gingen elf weitere Ferkel zur Sektion, von denen sieben untersucht wurden. Gefunden wurden Lungenentzündungen, Magenschleimhautentzündungen mit Magengeschwüren, Darmentzündungen sowie eitrige Hirnhaut- und Gelenkentzündungen. Es wurden Streptokoccus suis Typ 2, Hämophilus parasuis und E. coli (O145: K91) nachgewiesen. Die isolierten Keime wurden im Labor asserviert, sodass sie jederzeit für die Herstellung eines stallspezifischen Impfstoffs zur Verfügung stehen. Ein wichtiges Werkzeug des Projektes ist die regelmäßige Untersuchung von Blut- und Kotproben; Foto: Waldeyer Bemerkenswert an diesem Fall ist auch, dass bei den verschiedenen Tieren unterschiedliche Erreger ohne direkten Zusammenhang nachgewiesen wurden. Das nährte den Verdacht auf eine nicht infektiöse Ursache. Dieser Zusammenhang war aber nur zu erkennen, weil eine relativ große Zahl an Ferkeln zur Sektion gegeben wurde. Folgende Maßnahmen wurden dann im Betrieb eingeleitet: Aufgrund eines klinischen Influenza-Geschehens, das sich parallel bei den Sauen abspielte, wurden alle Sauen zweimal im Abstand von drei Wochen gegen Influenza geimpft. Alle zu diesem Zeitpunkt im Betrieb vorhandenen Mastschweine wurden einmal gegen Influenza geimpft. Zudem wurde die einmalige Mykoplasmenimpfung durch eine zweimalige kombinierte Mykoplasmen-Hämophilus-parasuis-Impfung ersetzt. In diesem Fall war das Futter bzw. die Fütterung der Auslöser der Ödemkrankheit. Deshalb erfolgte zunächst ein zusätzlicher Säurezusatz und nachdem der erwünschte Erfolg noch ausblieb ein Futterwechsel. Während die Impfmaßnahmen nur eine geringfügige Besserung brachten, erreichte der Wechsel des Futters schließlich die Wende zum Besseren. Als weitere Option könnte aus den eingelagerten Bakterienstämmen ein stallspezifischer Impfstoff hergestellt werden zum Beispiel, wenn die Impfung mit dem kommerziellen Hämophilus-parasuis-Impfstoff nicht erfolgreich ist. AUF DEN PUNKT GEBRACHT Im Verbundprojekt» Gesunde Tiere gesunde Lebensmittel«werden die Schweinebestände in den beteiligten Betrieben intensiv beprobt, um Einblick in die Gesundheitssituation zu erhalten. Die bisherigen Erfahrungen aus dem Projekt zeigen, dass durch regelmäßige Diagnostik eine Früherkennung von Problemen möglich ist. Auch schwierige Zusammenhänge lassen sich so diagnostisch aufarbeiten allerdings erfordert die Aufarbeitung bzw. Lösung solcher Probleme eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Nur wenn die Beteiligten konstruktiv mitarbeiten, lassen sich die Herausforderungen erfolgreich bewältigen. Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 21
22 Heinz-Georg Waldeyer Landwirtschaftliches Wochenblatt Ausgabe 31 / 2012 ABHOLSERVICE IM PRAXISTEST Im Rahmen des Verbundprojektes»Gesunde Tiere gesunde Lebensmittel«testen die Tierseuchenkasse NRW und das Veterinäruntersuchungsamt in Arnsberg einen Fahrdienst für Sektionstiere. Obwohl eine Sektion betroffener Tiere im Veterinäruntersuchungslabor der beste Weg ist, einem unklaren Krankheitsgeschehen im Schweinebestand auf den Grund zu gehen, wird dieser» Goldstandard«in der Praxis viel zu selten genutzt. Oftmals scheuen die Landwirte den mit dem Transport der Tiere verbundenen Aufwand und / oder die Kosten. Dabei würden häufigere Sektionen sicherlich helfen, die Gesundheitssituation in den Betrieben genauer einzuschätzen und bei Problemen die eigentliche Ursache schneller zu finden. Schließlich kann es sich im schlimmsten Fall bei einem unklaren Krankheitsgeschehen um eine gefährliche Tierseuche handeln, die womöglich erst verspätet entdeckt wird. ABHOLSERVICE GESTARTET Um zu testen, ob an diesem Punkt ein spezieller Abholservice für Sektionstiere weiterhelfen könnte, wurde im Frühjahr 2012 ein Praxisversuch im Rahmen des Verbundprojektes» Gesunde Tiere gesunde Lebensmittel«gestartet, erklärt Dr. Annette vom Schloß, Geschäftsführerin der Tierseuchenkasse (TSK) Nordrhein-Westfalen in Münster. Es handelt sich hierbei um einen gemeinsam von der TSK und dem Veterinäruntersuchungsamt in Arnsberg getragenen Service, bei welchem ein ausgebildeter Mitarbeiter mit einem extra dafür angeschafften Pkw mit Spezialanhänger die am Verbundprojekt beteiligten Ferkelerzeuger- und Schweinemastbetriebe anfährt, dort tote Schweine abholt und diese zur pathologischen Untersuchung (Sektion) zu den Arnsberger Spezialisten bringt. Die bei der Sektion gewonnenen Erkenntnisse stehen anschließend den jeweiligen Betrieben und ihren Hoftierärzten zur Verfügung. Gemeinsam mit dem Schweine- Die Aussagekraft der Sektionsergebnisse hängt auch von der Auswahl der geeigneten Tiere ab gesundheitsdienst und dem Betriebsberater können die Betriebe die Sektionsergebnisse dann zur Verbesserung der Tiergesundheitssituation nutzen. Für die NRW-Tierseuchenkasse geht es bei diesem Projekt in erster Linie darum, zu prüfen, inwieweit ein solcher Abholservice überhaupt logistisch zu meistern ist, und welche Kosten dabei anfallen, so Dr. vom Schloß. Denn das möchte man wissen, bevor man bei der TSK in weitergehende Überlegungen zur Einrichtung und Finanzierung eines generellen Abholdienstes in NRW einsteigt. Denkbar wäre beispielsweise auch, den Abholservice in das NRW-Früherkennungssystem für Tierseuchen einzubinden, so die TSK-Geschäftsführerin. Denn alle Maßnahmen, die dazu beitragen, eine Seuche möglichst früh zu erkennen, sind zu begrüßen. Schließlich ist der durch eine Tierseuche entstehende Schaden umso kleiner, je früher das Problem erkannt und eingegrenzt wird. 22 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
23 Erzeugerring Westfalen EINIGE PUNKTE BEACHTEN Die Erfahrungen aus dem Abholservice-Test kommen insofern langfristig der Allgemeinheit zugute. Das rechtfertigt die Kostenübernahme durch die Tierseuchenkasse der Landwirtschaftskammer NRW. Für die am Projekt beteiligten Landwirte ist diese Dienstleistung derzeit daher kostenlos. Die Betriebe wählen gemeinsam mit ihrem Hoftierarzt bzw. in Zusammenarbeit mit den Fachleuten vom Schweinegesundheitsdienst geeignete Sektionstiere aus, von denen man sich Erkenntnisse zum Tiergesundheitsgeschehen im Bestand verspricht. Sinnvollerweise sind das frisch erkrankte und gerade erst verendete bzw. vom Tierarzt euthanasierte Tiere. Im Einzelfall können nach Absprache mit dem Untersuchungsamt auch lebende Ferkel abgeholt werden, wenn die Diagnosemethode das notwendig erscheinen lässt. Wichtig ist aber in jedem Fall ein begleitender Vorbericht des Tierarztes, damit die Pathologen effizient arbeiten können, erklärt Dr. vom Schloß. Bei einer größeren Anzahl von verendeten Tieren sind maximal drei repräsentative Tiere auszuwählen und einzusenden. Diese Zahl macht indessen auch fachlich Sinn, denn die Sektion eines einzelnen, verendeten Ferkels oder Mastschweines liefert womöglich nur eingeschränkt aussagekräftige Ergebnisse. Einen sicheren Erregernachweis bringt erst die Untersuchung mehrerer Tiere aus dem gleichen Bestand bzw. dem gleichen Abteil. Ferkelerzeuger Rainer Menne aus Warburg-Daseburg übergibt den Begleitschein an den Sektionstiere-Fahrer Thomas Sicheler; Fotos: Waldeyer Vom Ablauf her funktioniert der Fahrservice so, dass der Landwirt die abzuholenden Sektionstiere per Telefon morgens in Arnsberg anmeldet (mit Namen des Tierhalters, exakter Adresse und Handynummer für etwaige Rückfragen sowie Angaben zur Anzahl und zum Gewicht der abzuholenden Tiere). Der Fahrdienst kommt dann sobald wie möglich vorbei. Er meldet sich in der Regel kurz vor der Ankunft noch einmal beim Landwirt, damit zum Zeitpunkt der Abholung eine Person zur Unterstützung vor Ort ist. Dass die»übergabe«der Sektionstiere an einem hygienisch dafür geeigneten Ort stattfindet, versteht sich von selbst: Zwar fährt der Abholservice derzeit jeden Schweine haltenden Betrieb einzeln an. Wenn der Service zukünftig auf alle Betriebe in NRW ausgeweitet werden sollte, werden aber sicherlich mehrere Höfe bei einer Tour angesteuert werden müssen. Und dann gilt es, so sicher und hygienisch wie möglich zu arbeiten Bislang haben sowohl die Tierseuchenkasse als auch die Landwirte und die Fachleute des Veterinäruntersuchungsamtes mit dem Service gute Erfahrungen gesammelt. Deshalb soll der Test fortgesetzt werden, um am Ende auf belastbarer Grundlage beurteilen zu können, ob das System für einen dauerhaften Einsatz infrage kommt. Derzeit stehen die Chancen dafür nicht schlecht, so Dr. vom Schloß. Schließlich lohnt es sich aus verschiedenen Gründen, für eine nachhaltige Verbesserung der Tiergesundheit zu kämpfen. Wenn einmal schwerere Tiere als diese Ferkel abgeholt werden müssen, verfügt der Spezialanhänger auch über eine elektrische Seilwinde Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 23
24 Heinz-Georg Waldeyer Landwirtschaftliches Wochenblatt Ausgabe 31 / 2012 FRÜH ERKENNEN SCHNELL REAGIEREN Hintergrund und Details des NRW-Früherkennungssystems erklärt Dr. Annette vom Schloß, Geschäftsführerin der Tierseuchenkasse Nordrhein-Westfalen in Münster. bekämpfung unverzüglich eingeleitet werden können. Allerdings fällt es den Tierhaltern und Hoftierärzten zuweilen schwer, eine anzeigepflichtige Tierseuche auch frühzeitig als solche zu erkennen, da eine Seuche nicht unbedingt mit klassischen Symptomen verlaufen muss oder weil sie von anderen Krankheiten überlagert sein kann. Daher hat das Land Nordrhein-Westfalen bzw. das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MKULNV) in Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat der Tierseuchenkasse, den Veterinärbehörden (Kreisveterinärämter) und dem Tiergesundheitsdienst der Landwirtschaftskammer ein tiergesundheitliches Früherkennungssystem aufgebaut. Dieses basiert auf sogenannten Ausschlussuntersuchungen zum Auftreten der Aujeszky schen Krankheit (AK) und der Klassischen Schweinepest (KSP) und ist durchzuführen, wenn: Einige Blutproben reichen, um sicherzugehen, dass der Schweinebestand frei von gefährlichen Krankheiten ist; Fotos: Waldeyer Ein zentraler Punkt der Tierseuchenbekämpfung ist das frühzeitige Erkennen der Seuche. Schließlich lässt sich der Schaden, welcher von hoch infektiösen Krankheiten wie beispielsweise der Schweinepest ausgelöst werden kann (beim 2006er-Schweinepestzug in den Kreisen Borken und Recklinghausen betrug dieser rund 40 Mio. ) nur dann begrenzen, wenn der Seuchenausbruch frühzeitig festgestellt wird und geeignete Maßnahme zur Seuchen- der Tierhalter erhöhte Verluste in seiner Schweinehaltung hat. Die Tierseuchenkasse wertet hierzu wöchentlich die Falltierzahlen aus und teilt diese dem jeweiligen Veterinäramt mit. Dieses setzt sich bei Bedarf mit dem Schweinehalter in Verbindung und kann die Entnahme von Proben anordnen; im Schweinebestand eine fieberhafte Erkrankung aufgetreten ist, bei der die antibiotische Behandlung erfolglos war; im Schweinebestand Todesfälle mit unklarer Ursache wie zum Beispiel plötzliche Ferkelverluste oder gehäufte fieberhafte Erkrankungen mit Körpertemperatur über 40 C auftreten (ohne signifikante Erhöhung der Falltierzahlen der Tierkörperbeseitigung) 24 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
25 Erzeugerring Westfalen Diese Regeln entsprechen den Vorschriften der Schweinehaltungshygieneverordnung. Während aber beim Überschreiten bestimmter Verlustraten das Veterinäramt den Tierhalter informiert und eine Tierseuchen-Ausschlussuntersuchung einleitet, hat der Landwirt in den weiteren beschriebenen Fällen wie unklare Erkrankung, Todesfälle oder hohes Fieber nach der Schweinehaltungshygieneverordnung selbstständig geeignete Maßnahmen zu treffen, um das Vorkommen einer anzeigepflichtigen Tierseuche auszuschließen. Damit nun nicht bei jeder Abklärungsuntersuchung der Verdacht einer anzeigepflichtigen Tierseuche ausgesprochen werden muss, kann der Tierhalter im Rahmen des NRW-Früherkennungssystems diese Untersuchung über seinen Hoftierarzt ohne Verdachtsäußerung einleiten. Diese elegante Lösung gilt es häufiger zu nutzen. Zumal die Tierseuchenkasse im Rahmen des Früherkennungssystems sogar folgende Kosten übernimmt: welche die Beihilfe direkt an den Tierarzt auszahlt. Eine Auszahlung an den Tierhalter ist aus EU-rechtlichen Gründen nicht möglich. Ferner trägt die Tierseuchenkasse die Kosten der Laboruntersuchung (AK und KSP) in den staatlichen Untersuchungseinrichtungen NRW. Und auch die Kosten der Sektionen (pathologische Untersuchung von Schweinen) sowie die für gegebenenfalls notwendige weiterführende Untersuchungen in den staatlichen Untersuchungseinrichtungen NRW werden übernommen. Der Tierhalter hat die Möglichkeit, Tierärzte des Schweinegesundheitsdienstes zur Untersuchung und Beratung einer Bestandsproblematik anzufordern. Die Kosten dafür werden von der TSK übernommen. Auch die Kosten der Blutprobenentnahme durch den Hoftierarzt übernimmt die TSK. Dies sind in Mastbetrieben in der Regel 14 Blutproben pro Betrieb und 6 je Blutprobe und in Zucht- bzw. Ferkelerzeugerbetrieben 30 Blutproben pro Betrieb und 4 je Blutprobe. Der Tierarzt beantragt dafür die Beihilfe beim Veterinäramt. Dieses sendet den Antrag nach Prüfung an die Tierseuchenkasse, Mit gezielter Auswahl zum besseren Erfolg Der Tierhalter erhält damit die Ausschlussuntersuchung auf die zwei wichtigsten anzeigepflichtigen Tierseuchen bei Schweinen, ohne dass er oder sein Hoftierarzt den Verdacht auf das Vorliegen einer Tierseuche haben muss. Des Weiteren erhält der Landwirt bei Einlieferung von toten Schweinen in die staatlichen Untersuchungseinrichtungen in NRW eine kostenlose Untersuchung der Krankheits- bzw. Todesursache. Das sind gute Gründe für eine intensive Nutzung des Früherkennungssystems. Zumal jeder einzelne Landwirt hierdurch seinen Beitrag dazu leisten kann, die Schäden eines Seuchenausbruchs für die gesamte Branche so klein wie möglich zu halten. Denn das Frühwarnsystem verhindert zwar keinen Tierseuchenausbruch, es kann aber dazu beitragen, dass sich solche Tragödien und schlimmen Szenen wie 1997 im Raum Paderborn / Delbrück oder 2006 in der Region Borken / Recklinghausen nicht wiederholen: Wenn eine Seuche früh erkannt wird, birgt sie schließlich deutlich weniger Gefahr und Schrecken. Mehrerlös für geprüfte Qualität +20,88 Bronze +37,92 Silber +51,20 Gold +68,52 Platin Die neuen Leistungsklassen der GFS-Eber Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 25
26 Heinz-Georg Waldeyer Landwirtschaftliches Wochenblatt Ausgabe 31 / 2012 TIERÄRZTE UND BERATER HAND IN HAND Im vierten Teil unserer Tiergesundheitsserie berichten wir über einen Betrieb, der durch die Teilnahme am Verbundprojekt» Gesunde Tiere gesunde Lebensmittel«wichtige Informationen zur Optimierung seines Impfkonzeptes gewonnen hat. Wer ein Problem im Anfangsstadium erkennt, kann rechtzeitig reagieren und drohende Schäden abwenden oder zumindest deutlich reduzieren. Diese Erfahrung machen derzeit etliche Ferkelerzeuger- und Schweinemastbetriebe, die am NRW-Verbundprojekt»Gesunde Tiere gesunde Lebensmittel«teilnehmen und die Tiergesundheit in ihren Beständen auf der Basis regelmäßiger Blut- und Kotproben intensiv untersuchen lassen. Dabei bieten vor allem die Beobachtung und Interpretation der Laborergebnisse und Besuchsprotokolle im Zeitverlauf gute Möglichkeiten zur Stabilisierung bzw. Verbesserung der Bestandsgesundheit, wie ein Praxisbeispiel aus dem Kreis Warendorf zeigt. GEFRAGT IST ARBEIT IM TEAM Margret und Paul Stelthove bewirtschaften gemeinsam mit ihrem Sohn Peter in der Bauerschaft Wieningen bei Everswinkel einen kombinierten Ferkelerzeuger- und Schweinemastbetrieb. Die Ferkel ihrer rund 150 Sauen werden bis knapp 30 kg im Flatdeck aufgezogen und wechseln dann in den eigenen oder den zugepachteten Maststall. Die Stelthoves sind Top-Genetik-Prüfbetrieb der GFS-Genossenschaft zur Förderung der Schweinehaltung. Alle Ferkel des Betriebes werden daher mit elektronischen Transponderohrmarken gekennzeichnet, was die Einzeltierverfolgung immens erleichtert. Um die Gesundheit einer Tiergruppe im Zeitverlauf beurteilen zu können, ziehen Henrike Freitag (links mit dem tragbaren Datenerfassungsgerät zur Ohrmarken- Identifikation), Dr. Sandra Sicken und Paul Stelthove bei definierten Tieren in drei verschiedenen Altersstufen Blutproben Über die GFS wurde vor rund zwei Jahren auch der Kontakt zum Verbundprojekt hergestellt. Betreut wird der Betrieb Stelthove diesbezüglich jedoch vor allem vom Schweinegesundheitsdienst der Landwirtschaftskammer (in diesem Fall von Dr. Sandra Sicken) und von Henrike Freitag vom Erzeugerring Westfalen. Erster Ansprechpartner im Bereich der Tiergesundheit ist aber natürlich Hoftierarzt Michael Kalitowitsch von der Tierärztlichen Praxis am Fernmeldeturm in Sendenhorst. Der Tierarzt bildet im Rahmen des Verbundprojektes gemeinsam mit der Landwirtsfamilie, Dr. Sicken und Henrike Freitag ein Team, welches bei Bedarf um weitere Fachleute bzw. am Projekt beteiligte Institutionen ergänzt wird. 26 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
27 Erzeugerring Westfalen STATUS- UND VERLAUFS- UNTERSUCHUNGEN Wie alle anderen am Verbundprojekt beteiligten Schweinehalter hat auch der Betrieb Stelthove vor zwei Jahren zuerst einen Hygienecheck durchlaufen. Kurz darauf erfolgte die sogenannte Statuserhebung, um die Tiergesundheitssituation in den Beständen zu Beginn des Projektes einschätzen zu können. Mittel- und in der Endmast Blut- und Kotproben gezogen und untersucht werden. Das bedeutet zwar pro Tiergruppe drei Betriebsbesuche mit umfangreichen Probenziehungen; dieser Aufwand lohnt sich durchaus, meint Sandra Sicken. IN DIE CIRCO-IMPFUNG EINGESTIEGEN Hoftierarzt Kalitowitsch verdeutlicht den Wert der regelmäßigen Untersuchungen: Im Betrieb Stelthove beispielsweise zeigten sich bereits zu Beginn der Blutprobenziehungen erste Anzeichen einer Circovirus-Problematik. Der durch leichte klinische Symptome genährte Verdacht wurde dann durch die Laborergebnisse der Statuserhebung bestätigt: Der Betrieb stand kurz vor einem massiven Ausbruch der Krankheit mit entsprechenden Leistungseinbußen und Tierverlusten. Deshalb entschloss sich Familie Stelthove, in die Circovirus-Schutzimpfung einzusteigen. Seit knapp zwei Jahren werden alle Ferkel in der dritten Lebenswoche geimpft.»das war gerade Ein Blick in die Datenbank des Projektes verhilft (von links) Hoftierarzt Michael Kalitowitsch, Peter und Margret Stelthove, Dr. Sandra Sicken, Henrike Freitag und Paul Stelthove zu umfangreichen Informationen In dieser ersten Phase wurden bei Stelthove einmal pro Halbjahr jeweils 15 Tiere am Ende der Ferkelaufzucht, fünf Schweine in der Mittelmast und zehn Tiere in der Endmast untersucht. Außerdem wurden drei Sammelkotproben zur Analyse ins Labor geschickt. Das Blut wurde hinsichtlich PRRS, APP, Influenza, Salmonellen, Hämophilus parasuis und Circovirus untersucht, in den Kotproben wurde nach Lawsonien (PIA) und Brachyspiren (Dysenterie) gesucht. Bei Bedarf konnten die Untersuchungen auf weitere Erreger bzw. Krankheiten ausgeweitet werden. Weil die Querschnittsbeprobung des Schweinebestandes aber lediglich eine Stichtagsbetrachtung erlaubt, wurde in einem zweiten Schritt dazu übergegangen, einzelne Tiergruppen im Verlauf der Aufzucht und Mast gezielt im Auge zu behalten. Für diese Zeitreihen- oder Verlaufsuntersuchungen wurden bei Stelthove (und anderen Betrieben im Verbundprojekt) jeweils 15 Ferkel einer Altersgruppe speziell gekennzeichnet, um sie im Verlauf der Mast schnell wiederzuerkennen. Schließlich sollten von diesen 15 Tieren zum Ende der Ferkelaufzucht, in der EINE EIGENE DATENBANK Damit Landwirte, Tierärzte und Berater stets optimal an der Verbesserung der Tiergesundheit arbeiten können, hat der Systempartner IQ-Agrarservice GmbH für das Verbundprojekt eine eigene Datenbank erstellt ( In dieser werden unter anderem sämtliche Laborergebnisse der Blutund Kotprobenuntersuchungen sowie die Ergebnisse der Sektionen verendeter Tiere, aber auch die im Rahmen des Projektes auf den Betrieben gewonnenen Stallklimawerte sowie die Schlachtbefunde archiviert und verarbeitet. Umso mehr Daten im Lauf der Zeit zur Verfügung stehen, umso genauer lässt sich die Tiergesundheitssituation auf den einzelnen Betrieben analysieren. Daher entwickelt sich die Projektdatenbank mit jedem Datenzufluss zum immer wertvolleren Werkzeug. Nach Zugangsfreischaltung durch den Landwirt (bei diesem liegt letztlich die»datenhoheit«) kann sich beispielsweise der Hoftierarzt vor einem Betriebsbesuch in der Datenbank über den aktuellen Stand informieren. Das ermöglicht im Idealfall ein noch effizienteres Arbeiten im Bestand und hilft bei gleichem Betreuungsergebnis, die Kosten im Griff zu behalten. Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 27
28 noch früh genug«, erinnert sich Margret Stelthove:»Insofern hatten wir Glück, dass wir in dieser Zeit zum Verbundprojekt gestoßen sind.seitdem die Ferkel schutzgeimpft werden, läuft der Aufzuchtbereich stabiler «, bestätigt Paul Stelthove und mittlerweile wurde bei den Blutprobenuntersuchungen auch kein Circovirus mehr analysiert, berichtet Kalitowitsch. Mittlerweile impft Margret Stelthove die Ferkel wieder zweimal gegen Mykoplasmen und hofft, die Atemwegsinfektionen damit auf den gewohnt niedrigen Stand reduzieren zu können. Das scheint zu gelingen. Trotzdem will man den Aspekt genauer im Auge behalten. Deshalb werden die ersten wieder zweifach geimpften Ferkel Allerdings fielen Dr. Sicken Anfang dieses Jahres beim Blutprobenziehen im Bestand einzelne hustende Ferkel auf und auch in der Endmast gab es zeitweilig Atemwegsprobleme. Die Tierärztin des Schweinegesundheitsdienstes fuhr daraufhin gemeinsam mit Erzeugerringberaterin Henrike Freitag zum Tönnies-Schlachthof nach Rheda- Wiedenbrück, der wie die Westfleisch am Verbundprojekt teilnimmt. Die Inspektion der Schlachtkörper deutete aufgrund der typischen Lungenveränderungen auf ein Mykoplasmenproblem hin. Dieser Verdacht wurde dann auch durch die Laboruntersuchung der am Schlachtband gewonnenen Proben bestätigt. MYKOPLASMENIMPFUNG UMGESTELLT Schnell kamen Sicken und Freitag im Gespräch mit Familie Stelthove und Hoftierarzt Kalitowitsch zu dem Schluss, dass die Ursache für die Mykoplasmenfunde wohl in der rund ein Jahr zurückliegenden Änderung des Impfkonzepts liegen dürfte: Damals hatte man sich im Zuge des Einstiegs in die Circovirus-Impfung aus arbeitswirtschaftlichen Gründen entschieden, von der zweimaligen Impfung gegen Mykoplasmen (Two-Shot) auf die Einmal-Impfung (One-Shot) umzustellen. Das macht in etlichen Fällen Sinn. Offenbar war das aber für diesen Betrieb nicht die optimale Lösung. Aufgrund der Blutprobenergebnisse wurde im Betrieb Stelthove das Impfkonzept gezielt angepasst; Fotos: Waldeyer intensiv beobachtet. Außerdem werden die Tiere regelmäßig beprobt. Und wenn sie im September geschlachtet werden, ist ein gemeinsamer Besuch von Landwirtsfamilie, Tierärzten und Beraterin am Schlachtband geplant, um sich die Lungen der Tiere genau anzusehen. Auf diesen Termin sind die Stelthoves schon ein wenig gespannt. Schließlich kommt es nicht so oft vor, dass man sich ein detailliertes Bild von der Schlachtkörperqualität der eigenen Schweine machen kann. Und vielleicht gibt es dabei ja noch weitere Erkenntnisse oder Tipps zur Verbesserung der Bestandsgesundheit immer getreu dem Motto des Projektes»Gesunde Tiere gesunde Lebensmittel«. Beim Verbundprojekt arbeiten Landwirtsfamilie, Tierärzte und Berater im Team 28 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
29 Erzeugerring Westfalen Gerburgis Brosthaus Landwirtschaftliches Wochenblatt Ausgabe 33 / 2012 HYGIENE VERBESSERN, ABER WIE? Der Hygienecheck ist ein wichtiger Baustein des Verbundprojekts» Gesunde Tiere gesunde Lebensmittel«. Neben der Schwachstellenanalyse liefert er wertvolle Verbesserungsvorschläge. Wenn es darum geht, Durchfall durch ein neues Diät-Futtermittel zu bekämpfen oder den Immunstatus von Saugferkeln durch eine Energie-Paste aufzupeppen, sind Landwirte meist schnell zu motivieren. Wenn es aber darum geht, durch eine Hygieneschleuse oder Wechsel des Overalls zwischen Abferkel- und Flatdeckstall den Keimdruck von vornherein zu senken, gestaltet sich die Umsetzung schon schwieriger. Für die Tiergesundheit aber spielt die Betriebshygiene eine entscheidende Rolle.»Die meisten Keime werden nicht durch die Luft, sondern durch Kontakt übertragen«, weiß Henrike Freitag, Hygienespezialistin des Erzeugerrings Westfalen, die das Projekt»Gesunde Tiere gesunde Lebensmittel«betreut.»Und das hat der Landwirt meist selbst in der Hand.«Wobei mit Kontakt nicht unbedingt der Viehwagenfahrer oder der Tierarzt gemeint sind, die den Stall betreten. Sondern Kontakt bedeutet Kot und Futterreste, die mit Stiefeln, Overall oder Treibbrett ins nächste Abteil getragen werden. Kontaktkeime werden über die Hände verteilt, die Tierkontakt haben und die Buchtentüren öffnen. Um Verbesserungen bei der Betriebshygiene zu erzielen, gehen die Projektberater in vier Schritten vor: Als Erstes haben Antonia Riedl von der Uni Göttingen und Hygienespezialistin Henrike Freitag mithilfe eines detaillierten Fragebogens gemeinsam mit dem Landwirt den Status quo erhoben. Als zweiter Schritt folgte ein Stallrundgang, bei dem Henrike Freitag mit Kenneraugen die Arbeitsabläufe, Reinigung und Desinfektion, Schadnagerbekämpfung, Futter- und Troghygiene, Erstferkelversorgung usw. beurteilt. Stets griffbereit hat sie ihre Kamera, um kritische Punkte zu dokumentieren. In einem Hygieneprotokoll fasst sie die Schwachstellen zusammen und macht Verbesserungsvorschläge, das Ganze veranschaulicht durch Fotos. Auf Wunsch bietet sie eine Vor-Ort-Beratung an, um betriebsindividuelle Lösungen zu finden, beispielsweise zur Einrichtung der Hygieneschleuse oder zum Standort der Kadaverbox. Zudem analysiert sie bei akutem Krankheitseinbruch, wie der Krankheitserreger in den Stall gekommen sein könnte, um dieses Schlupfloch zu schließen. Da sie zweimal jährlich zur Blutprobennahme auf jedem Betrieb ist, hat sie die Umsetzung der Hygienevorschläge im Blick und kann die Landwirte bei Fragen unterstützen. Wie der Hygienecheck bei den Landwirten ankommt, welche Vorschläge sie umgesetzt haben und was sich bei den Produktionsleistungen getan hat, lesen Sie in den folgenden Reportagen. Die Kamera hat Erzeugerringberaterin Henrike Freitag im Stall immer dabei. Denn anhand der Fotos im Besuchsprotokoll wird der Betriebsleiter eher auf Schwachstellen aufmerksam; Foto: B. Lütke Hockenbeck Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 29
30 Gerburgis Brosthaus Landwirtschaftliches Wochenblatt Ausgabe 33 / 2012 MEHR HYGIENE, MEHR GEWINN DAS INFEKTIONSKARUSSELL STOPPEN Die älteren Mastschweine infizierten die neu eingestallten Ferkel, diese wiederum steckten Kollegen in der Mittelmast an ein Teufelskreis.»Hauptproblem ist die kontinuierliche Belegung des Stalls«, stellte Hygienespezialistin Henrike Freitag fest, die das Projekt betreut. Stolz auf den Leistungssprung im Maststall Bernd Ostermann mit Hygienespezialistin Henrike Freitag, die das Projekt»Gesunde Tiere gesunde Lebensmittel«betreut; Fotos: Brosthaus Am runden Tisch, gemeinsam mit Mäster, Ferkelerzeuger, Tierarzt, Erzeugerring und Schweinegesundheitsdienst, suchten die Beteiligten nach einer Lösung, die alle zufriedenstellte. Das Ergebnis: Die Einstallungen auf maximal z wei A lter sg r uppen i m Sta l l redu zieren, um das I n fek t ionskarussell zu stoppen. Die Bördeferkel GbR, die die Babyferkel lieferte, konnte den Produktionsrhythmus so anpassen, dass 800er-Ferkelpartien möglich wurden. Der Aufzuchtbetrieb Grofe konnte bei dieser Gruppengröße Um knapp 100 g konnte Bernd Ostermann aus Erwitte die Tageszunahmen seiner Schweine steigern. Vier Jahre war der Maststall erst alt, und trotzdem husteten die Schweine ständig, immer wieder fielen Tiere mit Fieber auf. Und das, obwohl Bernd Ostermann aus Erwitte in 160er-Abteilen mästete, die durch die Türlüftung ausreichend mit Frischluft versorgt wurden. Und obwohl die Ferkel aus einer Direktbeziehung zu einem Sauenhalter stammten. Schwache Tageszunahmen, hohe Verluste und reichlich Nachläufer waren die Folge. Für Bernd Ostermann kam das Projekt»Gesunde Tiere gesunde Lebensmittel«wie gerufen, um die Ursachen der Probleme herauszufinden. Blutproben quer durch alle Altersstufen zeigten deutlich, dass Influenzaviren sich im Bestand festgesetzt hatten. Da Ostermann kontinuierlich einstallte, konnten die Erreger problemlos Pingpong spielen. Eine einfache Unterteilung in Schwarz- und Weißbereich durch Ikea-Bänke. Hier wechseln Ostermann und seine Mitarbeiter die Kleidung. In Crocs geht es zur Stiefelgarderobe, um keinen Stallschmutz in die Hygieneschleuse zu tragen 30 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
31 Erzeugerring Westfalen die Belegung im Rein-Raus-Verfahren garantieren. Ostermann musste nach und nach den Stall halb leeren, um Platz für eine so große Einstallpartie zu schaffen. Vorher wurde der Stall intensiv gereinigt und desinfiziert. Doch wie konnte der Mäster verhindern, dass die Influenzaviren von den älteren Mastschweinen in die neue Gruppe verschleppt werden? Um den Kontakt über Stiefel oder Overall auszuschließen, griff Ostermann zu rigorosen Maßnahmen. So sperrte er den Zentralgang in der Mitte durch eine Plane komplett ab. Um zu den jungen Ferkeln zu kommen, mussten Betriebsleiter und Mitarbeiter um den ganzen Stall laufen, den Stall durch den Hintereingang, die ehemalige Fluchttür, betreten und sich komplett umziehen.»das kostete insgesamt bestimmt eine Stunde Mehrarbeit pro Tag«, erinnert sich Mitarbeiter Manuel Kopmeier. Um Verschleppungen über Geräte zu verhindern, stattete Ostermann diesen Stallteil mit neuen Treibebrettern, Spritzen usw. aus. Als auch die Schlachtschweine aus der vorderen Stallhälfte verkauft, die Abteile gereinigt und desinfiziert waren, konnte Ostermann die Folie im Zentralgang entfernen. FUTTERHYGIENE OPTIMIERT Zusätzlich hat Ostermann an weiteren Hygieneschrauben gedreht. So hat er Arbeitspläne für Reinigung und Desinfektion von Abteilen und Fütterung entworfen. Diese hängen laminiert im Stall, sodass jeder Arbeitsschritt auch für neue Mitarbeiter oder Aushilfen klar ist. Bei der Fütterung sieht das Schema folgendermaßen aus: Nach dem Ausstallen Stichleitungen leeren und mit Wasser füllen. Im sauberen Mischbehälter Wasser einfüllen und Natronlauge zugeben. Über einen Bypass wird die Desinfektionsmischung zwischen Behälter und Zentralleitung (vor den Stichventilen) eine Stunde lang umgepumpt. Dabei strömt die Flüssigkeit über die Reinigungsdüsen in den Behälter zurück, der anschließend»blitzblank«ist, wie Ostermann betont. Anschließend wird die Desinfektionsflüssigkeit in die Stichleitungen gepumpt, den Rest entsorgt Ostermann über einen separaten Abfluss in den Güllekeller, sodass keine Verätzungen durch Spritzer gefährlich werden können. Der Mischbehälter wird gründlich mit Wasser gespült. Nach 24 Stunden wird jedes Ventil betätigt, um die Abläufe zu säubern. Die Reinigungsbrühe wird mit dem Hochdruckreiniger aus den Trögen entfernt. Dabei sind Schutzbrille, -handschuhe und -anzug unerlässlich.»wir reinigen jetzt nach Schema F«, erklärt Bernd Ostermann. Mitarbeiter Manuel Kopmeier orientiert sich an den laminierten Ablaufplänen Die sauberen Leitungen werden mit Frischwasser befüllt, das vorm Einstallen abgelassen wird. Zusätzlich unterstützt Ostermann die Futterhygiene durch einen Säurenebler im Anmischbehälter. Der Frischwassertank wird einmal pro Monat gechlort. Flüssige Nebenprodukte und CCM sorgen für einen niedrigen ph-wert der Mischungen. Durch den Wechsel zwischen Säuren und Natronlauge werden auch die säureresistenten Futterkeime regelmäßig ausgedünnt. FUTTERVERWERTUNG VERBESSERT Die strikte Einhaltung der Hygieneregeln hat sich für Bernd Ostermann hundertprozentig ausgezahlt. Hustende Schweine gibt es fast nicht mehr im Stall.»Ich habe den Medikamentenkühlschrank gegen eine Minibar-Variante ausgetauscht«, resümiert der Mäster stolz. Die Schweine wachsen gleichmäßiger, für die Nachmast reicht ein Abteil. Alle 16 Wochen werden die übrigen vier Abteile neu belegt, sodass die Mastplätze sehr effizient ausgenutzt werden. Das funktioniert nur, da die Tageszunahmen bei gleicher Tierherkunft um knapp 100 auf 815 g gestiegen sind. Die Futterverwertung konnte Ostermann um rund 0,15 auf 1 : 2,61 verbessern. Und die Verluste sind um knapp 1 Prozentpunkt auf 1,8 Prozent gesunken.»das hätten wir ohne Blutproben, runden Tisch und Hygienecheck nicht geschafft«, ist Bernd Ostermann überzeugt von der Rundumberatung im Projekt. Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 31
32 Gerburgis Brosthaus Landwirtschaftliches Wochenblatt Ausgabe 33 / 2012 AN DEN KLEINEN SCHRAUBEN GEDREHT Viele Einzelmaßnahmen haben die Sauenleistungen bei Dorothee und Georg Schwienhorst aus Hoetmar nach vorn gebracht. Die Hygiene im Sauenstall verbessern das hört sich einfach an. Die konkrete Umsetzung im eigenen Bestand gestaltet sich oft schwierig, denn die guten Vorsätze stranden im Alltagstrott. Nicht so bei Familie Schwienhorst in Warendorf-Hoetmar. Georg und Dorothee Schwienhorst konnten sich am Hygieneprotokoll orientieren, das Erzeugerringberaterin Henrike Freitag und Antonia Riedl von der Uni Göttingen im Rahmen des Projekts» Gesunde Tiere gesunde Lebensmittel«für ihren Betrieb aufgestellt hatten. Mit der Kamera hatten sie Schwachstellen dokumentiert und Verbesserungsvorschläge gemacht. EIN FOTO SAGT MEHR ALS 1000 WORTE»Speziell die Fotos haben uns und unseren Mitarbeitern in einigen Bereichen die Augen geöffnet«, erinnert sich Georg Schwienhorst. Motivationssteigernd auf die Mitarbeiter wirkte ein Hygieneworkshop, den Beraterin Henrike Freitag organisiert hat. Dabei lernten sie in Theorie und Praxis, wie Stallreinigung und -desinfektion optimal Gute Erfahrungen hat Dorothee Schwienhorst mit der Reinigung des Zahnschleifsteins durch Gebissreiniger gemacht; Fotos: Brosthaus ablaufen und wo die Fallstricke liegen. Seitdem kann sich Georg Schwienhorst darauf verlassen, dass die angerührte Desinfektionsmittellösung passt. Auch Kleinigkeiten wie verstaubte Ferkellampen im frisch gereinigten Stall fallen den Mitarbeitern jetzt eher auf. Zudem haben sie sich dafür stark gemacht, den Stall nach der ersten Runde mit dem Hochdruckreiniger mit Schaumreiniger zu behandeln, um den fetthaltigen Schmierfilm zu lösen. Milch zieht Fliegen magisch an. Deshalb hat Georg Schwienhorst einen Elektro-Fliegenvernichter im Anmischraum aufgehängt Im Abferkelstall stürzte sich Dorothee Schwienhorst voll Eifer auf den Maßnahmenkatalog, um die kleinen Ferkel möglichst keimarm zu behandeln. Als Erstes durchforstete sie die Stallapotheke, richtete Transportkisten 32 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
33 Erzeugerring Westfalen für Medikamente, Spritzen, Spül- und Desinfektionsmittel sowie Papierhandtücher ein. Sie investierte in einen leistungsstärkeren Schwanzkupierer, um die Blutgefäße sicher zu durchtrennen und die Wundfläche zu veröden. Beim Kastrieren arbeitet sie mit der Drei-Messer- Methode ein Messer im Einsatz, das zweite in Desinfektionslösung, das dritte trocknet. Der Schleifstein des Zahnschleifgeräts wird seitdem durch Gebissreinigertabs strahlend sauber. Desinfektionsmittel kommt reichlich zum Einsatz: Zahnschleifer und Kastriermesser, aber auch die Hände werden zwischendurch desinfiziert. Der Ferkelbehandlungswagen wird jetzt wöchentlich bei der Reinigung des Abferkelabteils gesäubert. Im Abferkelstall wird regelmäßig der Kot hinter den Sauen entfernt. Dazu hängt in jedem Abteil eine eigene Schaufel. Stiefel und Overall werden zwischen Sauenstall und Ferkelaufzucht gewechselt. Damit niemand das vergisst, ändert sich die Overallfarbe von Blau zu Kaki. Vor allem aber legt Dorothee Schwienhorst wesentlich mehr Wert auf Handhygiene. Das Tragen von robusten Einweg-Melkhandschuhen, regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der Hände sind heute für sie selbstverständlich.»damit ist es kein Problem, Ferkeltröge zu säubern oder die Nachgeburt wegzuräumen«, ist die junge Frau erleichtert, die Hände bei dieser Arbeit vor Schmutz, Geruch und Keimen zu schützen. Nach einem ersten Waschgang schäumt der Mitarbeiter das Abferkelabteil mit Reiniger ein, sodass auch hartnäckiger Schmutz gelöst wird PROFESSIONELL GEGEN FLIEGEN UND MÄUSE Die Fliegenbekämpfung haben Schwienhorsts professionalisiert. Dadurch hat sich der Verbrauch an Fliegengift und Larventod deutlich verringert. Im Deckzentrum werden die Larven durch regelmäßiges Aufrühren der Gülle ertränkt. Im Abferkelstall bringt Georg Schwienhorst beim Reinigen einen Mikronährstoff aus, der die Schwimmschicht deutlich verringert und so die Larven ihrer Lebensgrundlage beraubt. Im Raum, wo die Ferkelmilch angerührt wird, sorgt ein Fliegentoaster für die zuverlässige Bekämpfung. Zudem landen Nachgeburten, Schwänze und Hoden jetzt in der Kadavertonne, statt in der Gülle zur Attraktion für Fliegen zu werden. Die Verringerung der Schwimmschicht bedeutet gleichzeitig eine effektive Schadnagerbekämpfung, da den Mäusen ein attraktiver Rückzugsort fehlt. Ein Mitarbeiter ist verantwortlich für die Schadnagerbekämpfung. Er legt in Eigenregie Giftköder aus und sprüht Schaumköder auf bevorzugte Laufwege. Dabei wechselt er regelmäßig den Wirkstoff. Jedes Abteil hat seine eigene Schaufel, um den Kot hinter den Sauen wegzuräumen. Das stoppt die Keimübertragung ins nächste Abteil Dass sich eine gute Hygiene auszahlt, haben Schwienhorsts anhand der Sauenplanerauswertung gesehen. Seit sie aufgrund des Hygienechecks im April 2011 viele Maßnahmen verbessert haben, setzen sie mit 12 Ferkeln pro Wurf rund 0,8 Ferkel mehr pro Wurf ab. Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 33
34 Gerburgis Brosthaus Landwirtschaftliches Wochenblatt Ausgabe 34 / 2012 LÜFTUNG AUF DEM PRÜFSTAND Lüftungsfehler erfordern oft Detektivarbeit. Auf umfassende Spurensuche macht sich Elisabeth Sprenker beim Klimacheck des Projekts»Gesunde Tiere gesunde Lebensmittel«. Lüftung ausnebeln, Zuluftquerschnitte berechnen, Klimakurve überprüfen im Normalfall findet das nur als»feuerwehreinsatz«statt, weil es eklatante Probleme im Stall gibt. Beim Projekt»Gesunde Tiere gesunde Lebensmittel«gehört der Lüftungscheck zum Standardbaustein, ebenso wie Blutproben, Sektionsbefunde oder Hygieneberatung. Gerade wenn Blutproben keine Erklärung für Atemwegserkrankungen geben, ist der Klimacheck gefragt. Im Stall von Robert Horstmann hat Elisabeth Sprenker einen Datenlogger installiert, der Temperatur und Luftfeuchte über längere Zeit aufzeichnet; Fotos: Brosthaus SCHWANZBEISSER DURCH TEMPERATURSCHWANKUNGEN? Schwanzbeißer in einzelnen Buchten aber warum gerade dort? Karl-Heinz Schulze zur Wiesch in Bad Sassendorf wollte es genauer wissen. Der Sauenhalter liefert Ferkel an zwei Mastbetriebe und in den eigenen Maststall. In zwei Betrieben trat in unregelmäßigen Abständen Schwanzbeißen in einzelnen Buchten auf, im dritten jedoch nicht. Teils war über Nacht die ganze Bucht betroffen, teilweise entwickelte sich das Geschehen langsam. Daraufhin befestigte Elisabeth Sprenker, Klimaexpertin beim Erzeugerring Westfalen, Langzeitdatenlogger in den Ställen. Parallel dazu notierten die Mäster, wann sich Schwanzbeißen in welchen Buchten zeigte und in welcher Intensität. So trat das Problem am 18. Mai 2012 in einer Bucht auf. Rückblickend zeigte sich aus den aufgezeichneten Daten, dass die Außentemperatur an diesem Tag deutlich sank. Zudem reduzierte sich die Luftfeuchtigkeit im Stall auf 38 Prozent. Beides führt zu Stress bei den Schweinen und könnte so Auslöser für das Schwanzbeißen gewesen sein. Nach Abschluss des Durchgangs will Elisabeth Sprenker die Temperatur- und Luftfeuchtekurven der drei Ställe übereinanderlegen, um das Problem weiter einzukreisen. Noch gibt es keine abschließenden Antworten. Doch ist ein Anschlussprojekt beantragt, um dem Problem des Schwanzbeißens auf die Spur zu kommen. Dabei sollen auf Betrieben, bei denen sich gerade Kannibalismus entwickelt, aktuelle Blutproben gezogen werden. Zudem soll das Futter auf Mykotoxine untersucht werden. Die Lüftung wird überprüft, die Klimadaten werden mit dem Datenlogger analysiert. Die Landwirte sollen Veränderungen und Auffälligkeiten rund um den Ausbruch notieren. Durch die Langzeitaufzeichnungen, die bei den Projektbetrieben»Gesunde Tiere gesunde Lebensmittel«vorhanden sind, das schnelle Eingreifen und die Rundum-Analyse der Daten hoffen die Projektbeteiligten, die Ursachen des Schwanzbeißens betriebsindividuell einkreisen zu können. Daraus wollen sie Aussagen und konkrete Lösungsvorschläge für die Praxis entwickeln. 34 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
35 Erzeugerring Westfalen Dadurch verringerte sich die Zahl der offenen Spaltenschlitze, sodass der»abluftquerschnitt«kleiner wurde. Folge: Die Luftgeschwindigkeit stieg aufgrund der erhöhten Drehzahl der Ventilatoren zu stark, wie Elisabeth Sprenker durch Messungen herausfand. DIE LÜFTUNG CHECKEN Beim Klimacheck werden die einzelnen Komponenten der Lüftung systematisch überprüft. Folgende Elemente gehören zum Standardrepertoire: Strömt die Zuluft zu schnell, werden die Tiere unruhiger. Deshalb misst Elisabeth Sprenker die Zuluftgeschwindigkeit Denn oft ist die Lüftung Ursache für hartnäckigen Husten im Bestand. Auch Kannibalismus in Form von Ohren-, Schwanz- oder Flankenbeißen kann seinen Ursprung in unangenehmer Zugluft im Tierbereich haben oder in starken Temperaturschwankungen. REIZHUSTEN IM STALL Reizhusten in der Ferkelaufzucht und in der Mast war für Karl-Heinz Schulze zur Wiesch aus Bad Sassendorf Anlass, Ursachenforschung mittels Lüftungscheck zu betreiben. Die Temperatur konnte nicht die Ursache sein. Denn durch 100-prozentige Unterflurabsaugung nach dem Einstallen sorgte Schulze zur Wiesch für ein komfortables Wärmepolster im Tierbereich. Erst gegen Ende der Belegung öffnete Schulze zur Wiesch die Oberflur- Absaugklappen. Was er dabei nicht bedachte: Die wachsenden Tiere benötigten mehr Zuluft. Sie belegen aufgrund des zunehmenden Gewichts aber auch mehr Bodenfläche. Zeigt der Regler die Stalltemperatur richtig an oder ist die Werteskala verrutscht? Dies wird mithilfe eines digitalen Thermometers auf Höhe des Raumfühlers überprüft. Bei Abweichungen wird die Temperaturanzeige im Regler oder Lüftungscomputer angepasst. Sind Zu- und Abluftquerschnitte genügend groß dimensioniert für Tierzahl und -gewicht im Stall? Sind alle Stellmotoren gängig? Reagieren sie angemessen auf die Reglerimpulse? Mit welcher Klimakurve arbeitet der Lüftungscomputer? Passen Solltemperatur, Regelbereich und Heizwerte zueinander? Wie hoch ist die Luftgeschwindigkeit am Lufteinlass, wie hoch ist sie im Tierbereich? Gibt es dort Zugluft? Wie gleichmäßig verteilt sich die Luft im Stall? Über eine Nebelprobe lässt sich das gut sichtbar machen. Wie hoch ist die Schadgasbelastung im Abteil? Hier werden insbesondere CO2 und NH3 gemessen. Schwankt die Temperatur im Verlauf von 24 Stunden oder bleibt sie gleichmäßig? Informationen über den Temperaturverlauf liefert ein Datenlogger, der über mehrere Tage oder sogar Wochen im Abteil hängt und regelmäßig Temperatur sowie Luftfeuchte misst und aufzeichnet. Über den Computer werden die Messwerte ausgelesen und ausgewertet. Die Lösung ist einfach und erfordert keinerlei Investition: Schon im Bereich der Mittelmast bzw. auf Mitte der Ferkelaufzucht öffnet Schulze zur Wiesch jetzt die Schieber der Oberflurabsaugung vollständig, sodass die Abluftquerschnitte zu Tierzahl und -gewicht passen. Der Reizhusten der Tiere hat sich dadurch spürbar verringert. Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 35
36 DATENLOGGER ZEIGT TEMPERATUR- VERLAUF Auch für Robert Horstmann aus Westkirchen bei Ennigerloh war akuter Husten im November 2011 Anlass, die Lüftung durch Elisabeth Sprenker checken zu lassen. Beim Überprüfen der Technik stellte sich heraus, dass eine Abluftklappe nicht richtig funktionierte. Der Stellmotor war defekt, sodass die Abluftklappe entweder ganz offen oder komplett geschlossen war. Das war von außen nicht ersichtlich, da die Klappe im Abluftkanal installiert ist, der nicht vom Abteil aus eingesehen werden kann. Doch war das nicht das einzige Ergebnis des Lüftungschecks. Um den Temperaturverlauf aufzuzeichnen, hängte die Lüftungsberaterin eine Woche lang einen Datenlogger im Abteil auf. Ergebnis: Die Luft war mit 40 bis 60 Prozent relativer Luftfeuchte zu trocken, obwohl die Feuchte der Zuluft bei 70 bis 90 Prozent lag. Dadurch entwickelte sich ein Reizhusten bei den Schweinen, auf den Krankheitserreger einfach aufsatteln können. Da Horstmann Wärme kostengünstig aus seiner Biogasanlage bezieht, sparte er nicht an der Heizung. Doch lag der Einschaltpunkt der Heizung zu dicht bei der Solltemperatur, sodass die Heizung ständig ansprang. Heizung und Lüftung spielten Pingpong, die Stallluft trocknete aus. Elisabeth Sprenker setzte den Einschaltpunkt der Heizung 1,5 C unterhalb der Solltemperatur fest, um mehr Ruhe in die Lüftung zu bringen. Zusätzlich stellte sich heraus, dass die Temperatur im Abteil zwischen 19 und 24 C innerhalb eines Tages schwankte deutlich zu viel für kühle Novembertage. Elisabeth Sprenker nahm daraufhin die Einstellungen des Lüftungscomputers unter die Lupe und wurde an mehreren Stellen fündig. Zum einen lag das Minimum der Abluftrate bei 20 Prozent zu hoch für die kalten Nächte. Die Lüftungsspezialistin senkte die Minimumluftrate daher auf 10 Prozent. Zum anderen erhöhte sie die Solltemperatur von 19 auf 23 C. Zudem erweiterte sie den Regelbereich von 3 auf 4 C, sodass die Lüftung langsamer auf Temperaturschwankungen im Abteil reagiert. Karl-Heinz Schulze zur Wiesch öffnet den Schieber der Oberflurlüftung schon zwei bis drei Wochen nach dem Einstallen, da der Abluftquerschnitt der Unterflurabsaugung dann nicht mehr ausreicht Dieses Maßnahmenbündel führte dazu, dass der Datenlogger im Januar nur noch Temperaturschwankungen von 1,2 C anzeigte. Die relative Luftfeuchte hat sich auf 60 bis 80 Prozent eingependelt. Der Reizhusten verschwand, sodass Horstmann sich traute, die nächsten Ferkelpartien ohne medikamentöse Metaphylaxe einzustallen. Bis auf eine Wurmkur erhielten die Tiere keine Behandlung.»Durch Blutproben und Sektionen bleibe ich über den Gesundheitsstatus meines Bestands auf dem Laufenden. Das gibt mir Sicherheit«, stellt der Mäster die Vorteile der ständig aktualisierten Untersuchungen heraus. Da die Temperaturen in Robert Horstmanns Stall zu stark schwankten, hat Elisabeth Sprenker die Solltemperatur im Lüftungscomputer erhöht 36 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
37 Erzeugerring Westfalen Gerburgis Brosthaus Landwirtschaftliches Wochenblatt Ausgabe 21 / 2013 SCHWANZBEISSERN AUF DER SPUR Schwanzbeißen als multifaktorielles Problem / Erste Ergebnisse aus Praxisuntersuchungen / Betroffene Betriebe können sich melden Viele Vermutungen, wenig Fakten das ist bislang der Stand des Wissens beim Thema Schwanzbeißen. Nur eins ist sicher: Schwanzbeißen lässt sich nicht auf eine Ursache zurückführen, sondern es sind immer mehrere Faktoren beteiligt. Aber welche genau? Um Licht ins Dunkel zu bringen, setzt ein Projektteam aus Erzeugerring, Fachhochschule Südwestfalen und Schweinegesundheitsdienst der Landwirtschaftskammer NRW seit vergangenem Herbst auf Praxisuntersuchungen. Ringberaterin Henrike Freitag besucht akut betroffene Betriebe und checkt im Stall systematisch mögliche Schwachstellen bei Genetik, Tieralter, Aufstallung, Stallklima, Fütterung, Hygiene und Gesundheitsstatus. Blutanalysen runden den Gesundheitscheck ab. Das Projekt wird von der Europäischen Union und dem Land NRW finanziell unterstützt. 90 BETRIEBE UNTERSUCHT Bislang wurden rund 90 Betriebe untersucht. Den weitaus größten Anteil machten Mastbetriebe mit 83 Prozent aus, 14 Prozent der Fälle betrafen die Ferkelaufzucht. Erste Auswertungen zeigen ein vielschichtiges Bild. Knapp die Hälfte der Fälle ereignete sich etwa vier bis acht Wochen nach Aufstallung in die Mast, wenn die Tiere zwischen 50 und 80 kg wogen. Auffällig war, dass die gebissenen Tiere sich aggressiv gegenüber Menschen verhielten, die die Bucht betraten. Das Stallklima scheint eine Rolle zu spielen. In 43 Prozent der Betriebe waren Schadgase deutlich spürbar. Breiautomaten und Sensorfütterung waren etwa zu gleichen Teilen betroffen. Allerdings fiel auf, dass bei Flüssigfütterung der Trockensubstanzgehalt des Futters häufig geringer ausfiel als in der Mischanweisung. Bei einem Fünftel der Betriebe wurde das Mykotoxin Desoxynivalenon (DON) mit mehr als 500 Mikrogramm / kg nachgewiesen. Ebenfalls bei einem Fünftel der Betriebe lag die Schwanzbeißen tritt häufig im Gewichtsbereich zwischen 50 und 80 kg auf Durchflussrate der Tränken unterhalb des Sollwerts von 800 ml / min. Offenbar hat die Witterung keinen Einfluss auf das Auftreten von Schwanzbeißen. Auch die Abteilgröße, die von 46 bis 750 Tiere reichte, hatte keine Bedeutung. Schwanzbeißen kam in Buchten mit zwei Tieren vor, aber auch in Buchten mit bis zu 400 Tieren, sodass die Gruppengröße anscheinend kein Auslöser ist. Ebenso scheint Überbelegung kein eindeutiger Indikator zu sein, da nur in 30 Prozent der Fälle die Belegdichte hoch war. In der Praxis trat das Problem in etwa gleicher Anzahl bei weiblichen Schweinen und Kastraten auf. Eber waren nur in vier Fällen betroffen analog zum geringen Anteil Ebermäster. Nicht entscheidend war, ob die Ferkel drei oder vier Wochen lang gesäugt wurden. HILFE BEI PROBLEMEN Die Untersuchungen sind für betroffene Betriebe in NRW kostenlos. Das Projekt läuft noch bis zum 15. Juni Bis dahin können Betriebe mit akuten Schwanzbeißerproblemen Hilfe anfordern unter Tel. ( ) Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 37
38 Heinz-Georg Waldeyer Landwirtschaftliches Wochenblatt Ausgabe 29 / 2013 EIN WEGWEISENDES PROJEKT NRW-Projekt»Gesunde Tiere gesunde Lebensmittel«zeigt, was sich durch vertrauensvolle Zusammenarbeit von Landwirten, Tierärzten und Beratern erreichen lässt / Abschlussveranstaltung in Münster Die nordrhein-westfälische Veredlungswirtschaft hat unter dem Motto»Gesunde Tiere gesunde Lebensmittel«in den vergangenen drei Jahren ein wegweisendes Projekt entwickelt, auf dessen Grundlage die Gesundheit in den Schweinebeständen weiter verbessert und die Qualität und Sicherheit der heimischen Lebensmittel weiter gestärkt werden kann. Auf diesen Nenner lassen sich die Erfahrungen der zahlreichen Projektpartner und -beteiligten bringen, die am Mittwoch vergangener Woche auf Gut Havichhorst bei Münster im Rahmen einer Abschlussveranstaltung drei Jahre Projektarbeit Revue passieren ließen. GEMEINSCHAFTSERFOLG Der Erfolg des Projektes sei auch Ausdruck einer vertrauensvollen und intensiven Zusammenarbeit der verschiedenen Beteiligten im Dienste der Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit, betonten Dr. Bernhard Schlindwein vom Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband (WLV) und Dr. Christoph Sudendey als einer der Sprecher der praktischen Tierärzte. Neben dem WLV und insgesamt knapp 20 Hoftierärzten waren am Verbundprojekt unter anderem der Erzeugerring Westfalen, der Schweinegesundheitsdienst der Landwirtschaftskammer NRW, die GFS-Genossenschaft zur Förderung der Schweinehaltung, der EDV-Dienstleister IQ-Agrar Service GmbH, die beiden Schlachtunternehmen Tönnies und Westfleisch, der Fachbereich Agrarwirtschaft der Fachhochschule Südwest- Beim NRW-Verbundprojekt»Gesunde Tiere gesunde Lebensmittel«haben Landwirte, Tierärzte und Berater gezeigt, wie erfolgreich Teamarbeit sein kann 38 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
39 Erzeugerring Westfalen falen (Soest), die Tierärztliche Hochschule Hannover mit der Außenstelle Bakum sowie die Universität Göttingen beteiligt. Unterstützung erhielt das Vorhaben zudem durch die NRW-Tierseuchenkasse. Finanziell gefördert wurde es durch die EU und durch das Land Nordrhein-Westfalen. ANTIBIOTIKA-DISKUSSION Wie wichtig das Thema Tiergesundheit ist und bleibt, zeigen indessen die jüngsten Auswertungen zum Arzneimitteleinsatz im Rahmen der sogenannten VetCAb-Studie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, der Universität Leipzig, und des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR). Die Forscher kommen in dieser Studie für die Schweinemast auf eine Antibiotika-Einsatzhäufigkeit von durchschnittlich 4,2 Tagen je Mastschwein. Der Mittelwert sage aber wenig aus, so Schlindwein. Vielmehr laufe man damit Gefahr, einen falschen Eindruck zu erwecken: In der heimischen Landwirtschaft werde nicht jedes Mastschwein rund vier Tage lang mit Antibiotika behandelt. Vielmehr würden gezielt Einzeltiere oder Tiergruppen nach Bedarf mit Medikamenten versorgt je nach Erkrankungsart und Genesungsverlauf manche kürzer und manche länger. Hier tragen die Erfahrungen aus dem NRW-Verbundprojekt zu mehr Sachlichkeit in der Tiergesundheitsdiskussion bei.»insofern waren wir zum Start des Projektes im Jahr 2010 der Zeit durchaus ein Stück voraus«, lobte Schlindwein namentlich den Weitblick des ehemaligen WLV-Vizepräsidenten Karl-Heinz Schulze zur Wiesch, der als einer der»väter«des Verbundprojektes gilt. BERATUNG UND BETREUUNG Die Arbeit im Projekt habe sich jedenfalls gelohnt, waren sich rückblickend alle Beteiligten auf Gut Havichhorst einig auch wenn es zwischenzeitlich durchaus Abstimmungs- bzw. Kommunikationsprobleme gab. Das gemeinsame Ziel vor Augen ein Beratungssystem zu entwickeln, welches die Tiergesundheit dauerhaft verbessert und den Medikamenteneinsatz auf ein notwendiges Maß verringert, ohne die Lebensmittelsicherheit zu gefährden habe aber zusammengeschweißt und zu guten Lösungen geführt. Besonders die enge und abgestimmte Zusammenarbeit von Landwirtsfamilie, Hoftierarzt, Schweinegesundheitsdienst und Erzeugerring sei beispielhaft und wegweisend gewesen, so Erzeugerring-Geschäftsführer Ulrich Meierfrankenfeld im Rückblick. Hier konnte Margret Stelthove nur beipflichten, die mit ihrer Familie einen kombinierten Ferkelerzeuger- und Schweinemastbetrieb in Everswinkel bewirtschaftet. Das zielorientierte und abgestimmte Vorgehen unter Einbindung von Hoftierarzt, Schweinegesundheitsdienst und Erzeugerring-Beraterin Henrike Freitag habe dem Betrieb geholfen, die Tiergesundheit weiter zu verbessern. Margret Stelthove lobte zudem den als Pilotprojekt eingerichteten Abholservice der Tierseuchenkasse. Dieser sei eine gute Möglichkeit, trotz der im Veredlungsbetrieb nun mal knappen Zeit, die Ursache von unklaren Erkrankungen durch eine Sektion abklären zu lassen. Zudem lieferten die routinemäßig und anlassbezogen gewonnenen Blut- und Kotproben, die Schlachthofbefunde sowie die Ergebnisse der Hygiene- und Klimachecks ein umfassendes Bild zur Tiergesundheitssituation in den Betrieben. Verknüpft und aufbereitet in einer zentralen Datenbank konnten die teilnehmenden Schweinehalter kompetent und zielgerichtet beraten werden. Und an dieses gelungene System der interdisziplinären Zusammenarbeit will man weiter anknüpfen. Jetzt gehe es darum, auf der Grundlage des Verbundprojektes ein breit aufgestelltes Tiergesundheitssystem für interessierte Landwirte, Berater und Tierärzte zu entwickeln, welches sich finanziell selbst trägt. Ziel sei schließlich die Stärkung der Tiergesundheit und die Verbesserung der Leistungen auf breiter Front. SCHWANZBEISSER-URSACHEN? Ein weiteres Beispiel für die Zusammenarbeit von Praxis, Wissenschaft und Beratung ist die von Prof. Dr. Mechthild Freitag von der Fachhochschule Südwestfalen präsentierte Untersuchung zum Thema Schwanzbeißen und die dazu passenden Blutbild-Auswertungen aus betroffenen Beständen, welche Dr. Theodor Schulze-Horsel vom Schweinegesundheitsdienst der Landwirtschaftskammer vorstellte. Zu dieser Projektergänzung liegen mittlerweile erste Ergebnisse aus 111 von insgesamt 127 besuchten Problembetrieben vor. Diese deuten darauf hin, dass Schwanzbeißen oft mit einem erhöhten allgemeinen Infektionsdruck im Bestand einhergeht und durch hohe Stalltemperaturen (Hitzestress), Schadgasbelastungen und Probleme mit der Tränkwasserversorgung noch forciert werden könnte. Das Phänomen ist aber weder abschließend erforscht, noch gibt es bereits sicher funktionierende Lösungsansätze. Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 39
40 Dr. Barbara Voß BHZP DB.VIKTORIA DIE SAU MIT CHARAKTERSTÄRKE Die Schweinezucht hat in den letzten Jahrzehnten enorme Leistungssteigerungen in den wirtschaftlich bedeutenden Merkmalen (u. a. Wurfgröße, Wachstum, Schlachtkörperqualität) erreicht. Unberücksichtigt blieben weitestgehend Merkmale aus dem Bereich des Verhaltens. Produktionssysteme mit mehr Freiraum für die Sau sowie moderne Gruppenhaltungsvarianten zu allen Zeitpunkten des Produktionszyklus stellen neue Herausforderungen an uns und unsere Tiere. Verhaltenscharakteristika der Sauen sind gerade in diesen Haltungssystemen von großer Bedeutung. Dazu kommen mögliche weitere Entwicklungen in den Haltungsverfahren, z. B. Gruppenabferkelungen, im Sinne einer tiergerechten Produktionsweise Diesen neuen Herausforderungen hat sich das BHZP schon vor Jahren angenommen und hat ein Projekt zur Integration von Verhaltensmerkmalen in das Zuchtprogramm, mit Unterstützung von der Innovationsförderung des BLE sowie der Universität Göttingen, gestartet und die Erkenntnisse für die Entwicklung der db.viktoria genutzt. einem moderatem Bereich, der züchterisch nutzbar ist. Darüber hinaus konnten die Untersuchungen in den verschiedenen Basiszuchtbetrieben zeigen, dass es Umwelt- und Linieneinflüsse auf das Ausmaß der kämpferischen Auseinandersetzungen beim Neugruppieren gibt. Durch den konsequenten Zuchtausschluss von Tieren mit vermehrten Kampfhandlungen konnte eine Reduktion des aggressiven Verhaltens beim Neugruppieren erreicht werden. MÜTTERLICH UND AUFZUCHTSTARK Die Abferkelung ist einer der sensibelsten und zugleich arbeitsintensivsten Bereiche im Produktionszyklus. Daher ist ein weiterer Kernpunkt das Verhalten der Sauen während dieser Phase. Bei steigenden Gruppen- und Bestands- GRUPPENVERHALTEN Ein Aspekt dieses Projektes ist das Verhalten von Sauen in der Gruppe. Um eine möglichst hohe Aussagekraft des Verhaltenstests zu erlangen, wird der Test im BHZP nur bei Jungsauen durchgeführt, die ungefähr gleich alt bzw. schwer sind, da die Körpermasse zu den»argumenten«im Tierreich gehört. Die Jungsauen sind zum Zeitpunkt des Gruppierens von ungefähr gleicher Körperstatur. Im Test wird geschaut, welche Sau sich wie oft mit ihren Artgenossen streitet, und ob es nur»rangeleien«sind oder richtige Zweikämpfe. Jede Kampfhandlung führt zu»minuspunkten«für eine Sau. Es zeigt sich, dass einige Sauen besser mit der neuen Situation umgehen können. Sie zeigen ein geringeres Aggressionspotential (keine»angstbeißer«) und ein erhöhtes Erkundungsverhalten. Die geschätzten Erblichkeiten des Gruppenverhaltens z. B. in der Linie db.03 liegen bei h² = 0,28 bis h² = 0,11 also in größen und immer mehr lebend geborenen Ferkeln muss es das Ziel sein, dass alle Sauen ihre Ferkel alleine und ohne zusätzliche Hilfe zur Welt bringen. In den beiden Reinzuchtlinien db.01 und db.03, also die beiden Ausgangslinien aus denen die db.vikoria besteht, wird schon während der Geburt mittels einer Notenskala von 1 3 bewertet, ob eine Sau ihre Ferkel alleine und ohne jegliche Hilfe geboren hat oder nicht (Beschreibung Tabelle 1). Jährlich werden so über Datensätze für das Merkmal Geburtsverhalten in der Datenbank des BHZP regist- 40 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
41 BHZP riert. Wie man anhand der Abbildung 1 für z. B. die Linie db.03 sehr schön erkennen kann, konnte der Anteil Sauen, die Ihre Ferkel alleine und ohne Hilfe auf die Welt gebracht haben, trotz deutlich gestiegener Leistung im Bereich lebend geborener Ferkel, erhöht werden und nur noch bei ca. 4 Prozent der Würfe sind schwerere Geburten ( Note 3) aufgetreten. Neben der Tatsache, dass die Sauen alleine, ruhig und lieb abferkeln, war die Aufzucht- und Milchleistung ein weiteres Kriterium für die Bewertung der Sauen. Hierfür wurden zum einen die Sauen am ca. 10. Tag pp. im Rahmen der Altsauenmerzung subjektiv hinsichtlich ihrer Leistung in den Parametern»Aufzuchtleistung«,»Gesäugeanlage«und»Arbeitsaufwand«bewertet (Tabelle 1). Die mutterlose Aufzucht mittels technischer Ammen sowie der erhöhte Arbeits- und Kostenaufwand durch Zufütterung von Milchaustauscherpräparaten steht vielfach in der öffentlichen Diskussion. Daher ist es das Ziel, die Leistungen der Sau ohne technische Hilfe oder Zusatzfutter zu bewerten und so eine Sau zu züchten, die in der Lage ist sehr viele Ferkel problemlos aufzuziehen. In der Basiszucht bekommen nur Sauen, die 13 gute entwickelte Ferkel absetzten konnten, in dem Merkmal Aufzuchtleistung die beste Note. Der Anteil von heterogenen Würfen beim Absetzten konnte durch den Zuchtausschluss von Sauen mit der Note 3 deutlich reduziert werden (Abbildung 1). Bei der genetischen Analyse der Verhaltensmerkmale»Abferkelverhalten«,»Aufzuchtleistung«und»Gebrauchsfähigkeit«konnten nur niedrige Erblichkeiten ermittelt werden (Tabelle 2), jedoch sind diese Merkmale alle positiv miteinander korreliert. Die»Gesäugequalität«beschreibt subjektiv ein Exterieurmerkmal und weist eine deutlich höhere Erblichkeit auf. Durch den db-planer können diese Merkmale in der Zuchtstufe flächendeckend erhoben werden. Die Vergangenheit hat uns gelehrt, Grafiken: Zuchtfortschritte bei db.viktoria von 2008 zu 2012 (Reinzuchtwürfe aus der Basiszucht BHZP) Abbildung 1: Entwicklung in der Basiszucht der Linie db.03 von 2008 bis 2012 dass auch mit niedrig erblichen Merkmalen bei einer großen Datengrundlage und mit Hilfe von Verwandteninformationen aus der Zuchtwertschätzung züchterische Erfolge erzielt werden können. Negative, jedoch züchterisch erwünschte, Beziehungen der db-planer gestützten DB-PANER GESTÜTZT MERKMALSERFASSUNG VERHALTEN MERKMAL DEFINITION ABKÜRZUNG ERFASSUNGSZEITPUNKT Abferkelverhalten Aufzuchtleistung Gebrauchsfähigkeit Gesäuge Bonitierung, ob eine Sau alleine abferkelt oder ob Geburtshilfe geleistet wurde. 1 = keine Hilfe, 2 = leichte Hilfe, 3 = viel Hilfe Bonitierung der Ferkel an der Sau. 1 = homogener Wurf, alle Ferkel gut entwickelt, 2 = einzelnes Ferkel fällt ab, 3 = heterogener Wurf Bonitierung des Arbeitsaufwandes. 1 = kein zus. Aufwand, 2 = leichter zus. Aufwand, 3 = Problemsau Bonitur der Aufhängung des Gesäuges. 1 = straffes Gesäuge, der Bauchdecke folgend; 2 = mittlere Aufhängung; 3 = lose Aufhängung, Ziegeneuter ABF AUF GEB GES Während der Geburt ca. Tag 10 pp. ca. Tag 10 pp. ca. Tag 10 pp. Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 41
42 BHZP Verhaltens-Merkmale bestehen zu den lebend geborenen Ferkeln. Dies bedeutet, dass mit einer Erhöhung der lebend geborenen Ferkel bei gleichzeitiger Einbeziehung von Verhaltensmerkmalen ins Zuchtziel, es nicht zwangsweise zu einer Verschlechterung des Geburtsverhaltens oder zu vermehrt heterogenen Würfen kommt. Deutlicher fallen allerdings die Korrelationen zu den tot geborenen Ferkeln aus. Sauen mit weniger TGF haben weniger Geburtskomplikationen und eine bessere Aufzuchtleistung. FAZIT: Mit der db.viktoria hat das BHZP eine sehr mütterliche und fürsorgliche Sau kreiert, die in der Lage ist durch ihre hohe Milchleistung und gute Aufzuchtleistung viele Qualitätsferkel selber aufzuziehen. Dr. Barbara Voß, BHZP GmbH, Ellringen ERBLICHKEITSGRADE (AUF DER DIAGONALEN) UND GENETISCHE KORRELATIONEN ZWISCHEN DEN DB-PLANER GESTÜTZTEN MERKMALEN ZUM SAUENVERHALTEN UND FRUCHTBARKEITSMERKMALEN ABF AUF GEB GES LGF TGF Abferkelverhalten (ABF) 0,08 0,43 0,59 0,05-0,18 0,56 Aufzuchtleistung (AUF) 0,03 0,91 0,77-0,12 0,62 Gebrauchsfähigkeit (GEB) 0,03 0,56-0,09 0,52 Gesäuge (GES) 0,19-0,16 0,46 Lebend geborene Ferkel (LGF) 0,13 0,53 Tot geborene Ferkel(TGF) 0,06 Bei uns läuft s rund! Am Ende siegt die Ausgewogenheit und darum haben wir neben der gezielten Optimierung von Wurfgröße, Aufzuchtleistung, Mastferkelqualität und Stabilität auch intensiv auf einen ausgeglichenen Charakter gezüchtet. Tel / Der direkte Weg in die profitable Schweineproduktion Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
43 Boehringer Ingelheim Dipl.-Ing. agr. Maria Maßfeller freie Agrarjournalistin GEWAGT UND GEWONNEN: ILEITIS-IMPFUNG ZU MASTBEGINN Es traf hauptsächlich die besten Tiere, die kurz vor der Ausstallung standen: Plötzliche Todesfälle in der Endmast, meist bei einem Lebendgewicht von fast 100 kg, das tut weh. Zumal, wenn die Zunahmen bei durchschnittlich 840 g / Tag liegen. Für Christian van Doornick aus Uedem war klar, hier muss Abhilfe geschafft werden, und zwar schnell. Der Verdacht auf Ileitis bestätigte sich, nachdem von tierärztlicher Seite Blutproben gezogen wurden und ein verendetes Tier zur Sektion kam. Da die Impfung der Ferkel beim Ferkelerzeuger als möglicher Lösungsweg ausschied, wagte Christian van Doornick den Sprung ins kalte Wasser und begann mit der Vakzinierung der neu eingestallten Mastschweine. Damit setzt der junge Agraringenieur das noch relativ unbekannte Impfregime als erster Mastschweinehalter im Rheinland ein. Und das mit Erfolg, wie sich bereits nach wenigen Monaten zeigt. LANGJÄHRIGE FERKELLIEFERANTEN- PARTNERSCHAFT Bei 1700 Mastplätzen und 75 ha Ackerfläche mit Wintergerste, Winterweizen, Kartoffeln, Zuckerrüben und Winterraps ist Familie van Doornick froh über die stabile, langjährige Lieferantenpartnerschaft, die seit mehr als zehn Jahren besteht. Vater oder Sohn van Doornick holen bei diesem Ferkelerzeuger alle zwei Wochen zwischen 130 und 160 Ferkel mit einem durchschnittlichen Gewicht von 30 kg mit dem eigenen Transporter ab.»aus diesem Grund legen wir großen Wert drauf, dass unser Ferkelerzeuger aus der Region stammt«, setzt der junge Landwirt auf kurze Transportwege. Die Ferkel werden beim Sauenhalter gegen Mycoplasmen und Circoviren geimpft; die Sauen erhalten eine weitere Vakzine gegen PRRS. Bei van Doornicks stehen bei einer Abteilgröße von 100 bis 160 Plätzen rund 1500 Mastschweine; die übrigen Tiere befinden sich in einem nahegelegenen Pachtstall. Vermarktet werden die Schlachtschweine bei wöchentlicher Anlieferung an einen regionalen Schlachthof mit Auto-FOM-Klassifizierung. Als REMs-Mitglied erfassen van Doornicks die Mastdaten penibel und werten die Ergebnisse regelmäßig mit ihrem Berater aus. Bei besagten 840 g hohen Tageszunahmen und 0,99 Indexpunkten konnten Vater und Sohn eigentlich mehr als zufrieden sein. Der Einsatz sehr hochwertiger, eigener Futterkomponenten zahlt sich aus, ebenso das strenge Hygienemanagement. STEIN DES ANSTOSSES»Eigentlich lief alles rund aber auch nur eigentlich«, sagt Christian rückblickend und kommt auf auseinanderwachsende Gruppen und steigende Verluste zu sprechen. In den letzten beiden Jahren schnellte die Verlustrate in Wellen immer wieder über die 3 Prozent-Marke.»Das ist einfach zu hoch«stand für Vater und Sohn fest. Und sie waren sich einig, dass es auch weiterhin beim Einstallen ohne Meta- und Prophylaxe laufen muss. Schließlich liefert der Ferkelerzeuger Tiere mit hohem Gesundheitsstatus. Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 43
44 NEUES IMPFREGIME ERPROBT Christian von Doornick impft seine Mastschweine seit einem halben Jahr gegen Ileitis. Nun läuft es wieder rund, die Arbeit macht Freude; Foto: Maßfeller Die einfachste Möglichkeit, dem Problem Ileitis Herr zu werden, schied aus, da der Ferkelerzeuger an mehrere Mäster liefert und nur van Doornicks Wert auf die Impfung der Ferkel gegen Ileitis legten. Als gangbare, aber noch recht unbekannte Alternative bot sich die Vakzinierung der gerade eingestallten Mastschweine auf dem Betrieb in Uedem an. Christian zögerte nicht lange und als feststand, dass die Ileitis das Problem ist, machte er die Probe aufs Exempel und begann ab März 2013 mit der Impfung der Mastschweine. Besonders in der Endmast trat Ileitis auf. Ohne vorherige Anzeichen einer Erkrankung und abends beim Kontrollgang noch mit Appetit fressend am Trog stehend, lag immer wieder ein Tier tot im Abteil. Auch die kurzfristige antibiotische Behandlung der Tiere durch den bestandsbetreuenden Tierarzt brachte nicht den gewünschten Erfolg. Familie van Doornick gibt offen zu:»so kurz vor der Vermarktung sind solche Todesfälle in der Endmast nicht nur wirtschaftlich, sondern auch für das Gemüt ein harter Schlag. Die Arbeit macht keinen richtigen Spaß mehr, wenn man merkt, dass es nicht rund läuft und besser sein müsste.«die hohen Tageszunahmen von im Schnitt 840 g je Tier führen Vater und Sohn auf den Einsatz der hofeigenen Futterkomponenten zurück; Foto: Maßfeller Gesagt getan: Die Familie machte sich mit Hilfe von Beratung und Hoftierarzt an die Ursachenforschung, analysierte die plötzlichen Todesfälle von blassen Tieren in der Endmast, rechnete mit dem Auseinanderwachsen der Gruppen eins und eins zusammen und bekam nach Blutprobenauswertung und Sektion eines verendeten Tieres die Bestätigung ihres Verdachts: Ileitis. Die Abteile sind im Schnitt zehn Tage eher geräumt; die Zunahmen liegen bei 840 g täglich; Foto: Maßfeller PRAKTISCHE UMSETZUNG Um zu verhindern, dass sich die neu eingestallten Tiere noch vor der Impfung mit dem Erreger infizieren, muss die Vakzine möglichst schnell verabreicht werden. Bei van Doornicks erfolgt die Impfung am vierten Tag nach Einstallung. Dann haben sich die Schweine an die neue Umgebung gewöhnt und der Wasserverbrauch lässt sich recht genau ermitteln. Da es sich um einen über das Tränkewasser zu verabreichenden Lebensimpfstoff handelt, stellen van Doornicks sicher, dass die Schweine innerhalb von 4 bis 6 Std. die Vakzine in der erforderlichen Dosierung aufnehmen. Zu den Vorarbeiten der Impfung gehört also das abteilweise Erfassen des Wasserverbrauchs, und zwar fixiert auf die gleiche Tageszeit. Sind die einzelnen Wasserverbrauchsmengen über einen Zeitraum von 4 bis 6 Std. erfasst, lässt sich die erforderliche Dosiermenge berechnen, der angemischte Impfstoff wird mit 2 ml pro Tier ins Wasser eingebracht. Das Anmischen der Vakzine ist denkbar einfach, beschreibt der junge Landwirt den Vorgang: Der Impfstoff wird in destilliertem Wasser aufgelöst und über ein Dosiergerät in das Leitungssystem ein- 44 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
45 Boehringer Ingelheim gespeist. Dieses Dosiergerät dient auch der Applikation des Entwurmungsmittels über das Tränkewasser. Dass dem Ileitis-Impfstoff vor Einspeisung in die Wasserleitung blaue Lebensmittelfarbe zugefügt wird, vereinfacht die Anwendung und erhöht damit die Wirksamkeit der Vakzine: Van Doornicks lassen das Wasser in den Tränken so lange laufen, bis das blau eingefärbte»impfwasser«in den Tränken angelangt ist. So ist sichergestellt, dass die Schweine die für einen wirksamen Impfschutz erforderliche Menge an Vakzine aufnehmen. Dazu van Doornick:»Wir waren selbst erstaunt, wie viel Restwasser noch im Leitungssystem steht. Dieses Wasser muss abfließen; es würde die ermittelte Wassermenge sonst erhöhen, so dass die Schweine den Impfstoff nicht komplett in der vorgegebenen Zeit aufnehmen.«angesichts der Impfkosten und ohne Arbeitsstunden-Entlohnung ist der Landwirt höchst daran interessiert, den gewünschten Impferfolg nicht durch mangelnde Sorgfalt bei der Verabreichung zu schmälern. ABTEILE ZEHN TAGE FRÜHER GERÄUMT Ein Blick in die Mastringauswertung bestätigt, was die beiden Landwirte seit einem halben Jahr im Stall beobachten: Die Gruppen sind einheitlich und Todesfälle die redliche Ausnahme. Die Verluste liegen mit 1,4 Prozent erfreulich niedrig, die Abteile sind im Schnitt zehn Tage früher geräumt. Die ersten Schweine werden auch jetzt nach 80 Tagen verkauft, die letzten Tiere aus der Gruppe verlassen heute bereits nach 120 statt vorher 130 Tagen den Hof. Diese eingesparten Tage sind ökonomisch von entscheidender Bedeutung, denn früher blockierten Nachzügler das Abteil für Tage oder Wochen, bis sie mit Ach und Krach endlich aus dem Stall gingen. Die täglichen Zunahmen sind heute im Schnitt unverändert, aber die letzten Schweine im Mastabteil sind deutlich schneller ausgestallt als noch im letzten Winter. Das spart obendrein Futterkosten. Vom Zurückstallen der»resttiere«haben sich van Doornicks mit Einführung der Impfung schleunigst verabschiedet.»diese Tiere gehören in ein separates Abteil und nicht in eine gesunde, frohwüchsige Gruppe«, lautet nun die Devise auf dem Völlingshof in Uedem. NOCH BESSER WERDEN Van Doornicks sind froh, den Schritt hin zu einem neuartigen Impfmanagement in Sachen Ileitis gemacht zu haben.»die Arbeit macht nun wieder Freude, die Gruppen sind homogen. Natürlich sind noch einzelne Tiere auffällig, die dann gezielt antibiotisch behandelt werden. Hier gilt es, weitere Ursachenforschung zu betreiben. Es gibt noch Die Impfung wird mittels Dosierer über das Tränkewasser verabreicht; Foto: von Doornick Luft nach oben und daran muss auch noch dringend gearbeitet werden.«die geimpften Schweine weisen eine belastbare Immunität gegen Ileitis auf; sie sind vital, frohwüchsig und gesund. Dadurch konnten sonst notwenige Behandlungen auf ein Minimum zurückgefahren werden. Auch kostenmäßig geht die Rechnung auf: Die Ausgaben für die früher in größerem Stil erforderlichen antibiotischen Behandlungen halten sich mit den Kosten für die Impfung die Waage und das bei minimalen Verlusten von 1,4 Prozent.»Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen um den Antibiotika-Einsatz in der Tierhaltung war es unser erklärtes Ziel, die Tiergesundheit in unserem Stall so zu verbessern, dass sich antibiotische Behandlungen auf ein Mindestmaß reduzieren lassen. Dass kranke Tiere versorgt werden müssen, steht schon aus Gründen des Tierschutzes und unserer Verantwortung den Tieren gegenüber außer Frage. Wir erzeugen ein hochwertiges Lebensmittel und sind stolz darauf.«jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 45
46 Boehringer Ingelheim Die Einmal-Impfung gegen Circo und Myco Schweineversteher machen keine Kompromisse! Mit den deutschlandweit bevorzugten Impfstoffen gegen Circo und Myco: Hervorragende Wirksamkeit auch in der Mischung Ausgezeichnete Verträglichkeit Wenig Aufwand mit nur einer Impfung gegen zwei Erreger Fragen Sie jetzt Ihren Tierarzt Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
47 Agravis Dr. Peter Rösmann AGRAVIS Futtermittel GmbH SCHWEINE BRAUCHEN DAUERHAFT BESCHÄFTIGUNG! Die Liste eingesetzter Beschäftigungsmaterialien in der Schweinehaltung ist lang. Ob Spielball, Holzklotz, Strohpresswürfel oder Scheuerbalken, die Attraktivität dieser oder ähnlicher Materialien nimmt für das Tier nach anfänglich guter Akzeptanz häufig rasch ab. Grund genug für die CRYSTALYX Products GmbH, eine Beteiligungsgesellschaft der AGRAVIS Raiffeisen AG, durch intensive Forschung und Entwicklung eine völlig neue Beschäftigungsmöglichkeit mit dem Produktnamen PIGLYX zu entwickeln. Diese innovative und organische Beschäftigung steht ab sofort als dauerhaft interessantes Wühl-, Leck- und Spielmaterial zur Verfügung. Grundvoraussetzung für eine wirtschaftliche und nachhaltige Schweineproduktion ist ein gesunder und frohwüchsiger Tierbestand. Dieser basiert zunächst auf einer Vielzahl von betriebsindividuellen Einflussfaktoren. Neben der Tiergenetik und dem Fütterungskonzept sind es oftmals die sogenannten Umweltfaktoren, die den Gesundheitsstatus und das Wohlbefinden der Schweine maßgeblich beeinflussen. Als bedeutende Umweltfaktoren für das Wohlbefinden der Tiere werden in diesem Zusammenhang häufig Belegdichte und Gruppengröße, Schadgaskonzentration im Abteil, Raumlufttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Lichtverhältnisse aber auch das Vorhandensein und die Art des angebotenen Beschäftigungsmaterials genannt. Gerät das sensible Gesamtgefüge all dieser Faktoren aus dem Gleichgewicht, können Leistungsdepressionen, Krankheitseinbrüche oder Verhaltensanomalien die Folge sein. BESCHÄFTIGUNG WIRD VOM GESETZGEBER UND LEBENSMITTEL- EINZELHANDEL GEFORDERT Die aktuelle Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung und auch das QS-System fordern unter anderem, dass jedes Schwein jederzeit Zugang zu gesundheitlich unbedenkli- chem und in ausreichender Menge vorhandenem Beschäftigungsmaterial haben muss. Dieses soll das Schwein untersuchen und bewegen können, es soll veränderbar sein und damit dem Erkundungsverhalten des Tieres dienen. Diese Forderung wird in der Praxis vielfach durch an Ketten befestigte Hölzer, Kettenkreuze oder Bälle in der Bucht umgesetzt. Die zunehmende Forderung nach»raufutter«als organisches Beschäftigungsmaterial stimmt den Schweinehalter oftmals nachdenklich; wurde doch auf Stroh in den vergangenen Jahrzehnten in der konventionellen Schweinehaltung aus hygienischer, arbeitswirtschaftlicher und verfahrenstechnischer Sicht verzichtet. Erwähnt sei in diesem Zusammenhang, dass der Eintrag von Stroh als Beschäftigungsmaterial in den heutigen konventionellen Haltungsverfahren Folgen wie beispielsweise Schwimmdeckenbildung im Güllekeller bei gleichzeitiger Vermehrung von Schadnagern oder Fliegen mit sich bringen kann. Grundsätzlich gilt jedoch, dass das domestizierte Hausschwein als Nachfahre des Wildschweines (Sus scrofa) Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 47
48 diesem im Verhalten sehr ähnlich ist. Wildschweine sind im Allgemeinen für ihr Wühlverhalten bekannt. Sie vollziehen diese Handlung in freier Wildbahn, um Nahrung (Würmer, Knollen) zu finden oder um Suhlen anzulegen. Auch das heutige Hausschwein übt diese Verhaltensweise nach Möglichkeit gerne aus. Beobachten kann man dieses beispielsweise an Schweinen, die in Freilandhaltung gehalten werden und die Wiese nach Fraß durchwühlen. PIGLYX DIE ORGANISCHE BESCHÄFTI- GUNG ZUR DAUERHAFTEN AUSLEBUNG DES ARTTYPISCHEN WÜHL- UND SPIELTRIEBES VON SCHWEINEN Genau dieser Aspekt des arttypischen Wühlverhaltens wurde bei der innovativen Entwicklung des organischen Beschäftigungsmaterials PIGLYX berücksichtigt und umgesetzt. Diese Beschäftigungsmöglichkeit besteht aus zwei Komponenten; einer Edelstahl-Halterung, die auf dem Spaltenboden bei minimalem Platzanspruch in der Bucht mit Spaltenankern befestigt wird und aus einer organischen Wühl- und Leckmasse. Die kontinuierliche Attraktivität der Wühl- und Leckmasse wird durch die spezielle Rezeptur garantiert. Das auf dehydrierter Melasse basierende Produkt wird während des patentierten Kochverfahrens mit Mineralien wie Magnesium und Natrium angereichert. Die bodennahe Darbietung von PIGLYX ermöglicht zudem das Ausleben des ursprünglichen Wühlverhaltens der Schweine. Verro Für ganze Kerle Masteber können mit weniger Futter mehr Fleischwachstum generieren. Mit dem OlymPigVerro Ebermastprogramm schöpfen Sie das hohe Potenzial voll aus. Sie interessieren sich für Ebermast? Wir haben die Erfahrung! Fragen Sie unsere Schweinespezialisten oder kontaktieren Sie uns unter Eine Marke der AGRAVIS Raiffeisen-Gruppe Ebermast 48 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
49 Agravis Zahlreiche Praxisversuche belegen die sehr gute und dauerhafte Akzeptanz dieses neuartigen Produktes. Dabei bietet es sich für Sauen, die in einstreuloser Gruppenhaltung gehalten werden in gleichem Maße als organisches Beschäftigungsmaterial an wie für Ferkel, Läufer und Mastschweine. Die durchschnittliche, tägliche Aufnahme je Tier liegt in der Ferkelaufzucht zwischen 5 und 10 g und in der Schweinemast zwischen 10 und 20 g. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Menge der täglichen Aufnahme von PIGLYX durch betriebsindividuelle Faktoren wie der Gruppengröße, dem Alter der Tiere oder auch der Tiergenetik beeinflusst werden und somit variieren kann. FL-des Allround Die Vorteile dieses Produktes können zusammengefasst folgendermaßen skizziert werden: Es handelt sich bei PIGLYX um ein organisches Beschäftigungsmaterial, welches dauerhaft das Ausleben arttypischer Verhaltensweisen ermöglicht, PIGLYX hat keinerlei Einfluss auf die Flüssigentmistung, PIGLYX ist als Ergänzungsfuttermittel hygienisch und futtermittelrechtlich unbedenklich, PIGLYX ist aufgrund des Herstellungsverfahrens ein organisches Beschäftigungsmaterial definierter Qualität, PIGLYX hat mit 0,075 m² einen minimalen Bedarf an nutzbarer Stallgrundfläche und dadurch einen marginalen Einfluss auf die Tierbesatzdichte, Der Arbeitszeitbedarf für den Einsatz von PIGLYX ist im Vergleich zum Einsatz anderer organischer Beschäftigungsmaterialien wie beispielsweise Stroh äußerst gering, PIGLYX hat aufgrund der geringen täglichen Aufnahmen keine negativen Auswirkungen auf die Futteraufnahmen bzw. Mastleistungen. Bei Fragen rund um das Thema Beschäftigung steht Ihnen Produktmanager Dr. Peter Rösmann gerne zur Verfügung. Mehr Informationen zu diesem neuen Produkt erhalten Sie auch im Internet unter AGRAVIS Futtermittel GmbH Produktmanagement Schwein Dr. Peter Rösmann Tel.: 0251 / Exklusivmarke bei Ihren Raiffeisen Verbundpartnern und BayWa Agrarbetrieben. Gebührenfreie Infohotline: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 49
50 Dieter Jürgens AGRAVIS Futtermittel GmbH HYGIENE IN TRÄNKEWASSER- LEITUNGEN Wasser ist ein wichtiger Baustein zum Leben auch für Tiere. Bei den Tieren ist zu gewährleisten, dass Sie Wasser von hoher Qualität und in ausreichender Menge aufnehmen können. Hygienisch einwandfreies Wasser hat einen Einfluss auf die Stabilisierung der Gesundheit, die Leistung und die Fruchtbarkeit der Tiere. Prinzipiell sollte daher das Tränkewasser den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entsprechen. Bei unzureichender Wasserqualität findet eine Übertragung von unerwünschten Stoffen aus dem Trinkwasser in das Tier statt. Das Immunsystem wird gestört und die Tiere zeigen eine verminderte Wasser- und Futteraufnahme. In Tränkesystemen wird immer häufiger ein Biofilm (Schleimschicht aus Mikroorganismen, eingebettet in organischem Material) beobachtet. Als Haupteintrittsquelle für Mikroorganismen in Wasserleitungssystemen ist der Tränkenippel zu nennen. Durch Speichel, Futterreste und Kot können Mikroorganismen (z. B. E. Coli) ins Tränkewasser gelangen. Hohe Gehalte an anorganischen Wasserinhaltsstoffen (z. B. Eisen, Kalk, oder Mangan) im Wasser erhöhen durch Ihre Ablagerungen die Gefahr einer Biofilmbildung. Tiere werden heute oft mit Vitaminen, Impfstoffen oder Medikamenten, bei Vorhandensein von entsprechender Tränketechnik, über das Medium Wasser versorgt. Durch die Verabreichung von Vitaminen etc. über das Wasserleitungssystem wird durch die Trägersubstanzen (Zucker u. a.) zwangsläufig eine Beschleunigung und Intensivierung der Biofilmbildung innerhalb des Leitungssystems in Gang gesetzt. Dieser Eintrag wird selten beachtet und bleibt im Biosecurity-Konzept oft unberücksichtigt. Visuelle Kontrolle der Tränkeanlagen. In den Wasserleitungen den Biofilm sichtbar machen. Ein Endoskop kann sehr gut zur Veranschaulichung der Biofilmablagerungen herangezogen werden Bei Vernachlässigung der Tränkehygiene kann man in Extremfällen (bei geöffneter Wasserleitung), den fädrigen Biofilm vom Tränkenippel beginnend sogar schon mit dem bloßen Auge hochwachsen sehen. Aus diesem Biofilm werden kontinuierlich Mikroorganismen in das Tränkewasser abgegeben und direkt von den Tieren in hoher Konzentration aufgenommen. Die Höhe der Konzentration steigt mit der Standzeit, der Temperatur des Wassers und der in dem Wasser befindlichen Bestandteile. Sind pathogene Erreger in hoher Konzentration im Wasser vorhanden, besteht die Gefahr, dass tiergesundheitliche Probleme ausgelöst werden. 50 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
51 Agravis Auf landwirtschaftlichen Betrieben werden die Tiere entweder über den eigenen Brunnen oder über Stadtwasser versorgt. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die Keimgehalte des eigenen Brunnenwassers direkt am Tiefbrunnen in der Praxis selten ein Problem darstellen. Bei eigener Wasserversorgung sollten grundsätzlich 1 x jährlich alle wichtigen Parameter (ph-wert, elektrische Leitfähigkeit, Eisen, Oxidierbarkeit etc.) neben der mikrobiologischen Untersuchung ermittelt und bewertet werden. In vielen Regionen wird anhand von chemischen Wasseruntersuchungen ein hoher Eisengehalt bei Brunnenwasser beobachtet. Problematisch: Diese anorganischen Eisenverbindungen können sich in den Leitungen absetzen und die Bildung des Biofilms fördern. Extreme Eisenablagerungen im Tränkesystem verschlechtern die Ringleitungssysteme erleichtern die Reinigung und Desinfektion der Wasserleitungen. Stichleitungen gilt es zu vermeiden MÖGLICHKEITEN ZUR ÜBERPRÜFUNG DER TRÄNKEWASSERQUALITÄT IN STÄLLEN 1. visuelle Kontrolle von Wasserleitungssystemen unter Mithilfe von Endoskopen 2. mikrobiologische Untersuchungen anhand von Wasserproben und Tupferabstrichen 3. chemische + sensorische Wasseruntersuchung (Empfehlung 1 x jährlich bei eigener Wasserversorgung) Eingebaute Klarsichtrohre unterstützen die hygienische Kontrolle der Wasserleitungen Bei der Entnahme von Wasserproben zur mikrobiologischen Untersuchung ist auf das Abflammen der Entnahmestelle und die Verwendung von sterilen Gefäßen zu achten. Nach der Entnahme sind die Proben schnell und kühl zum Labor zu bringen. Mehrere Proben (1 x Probe am Brunnen, 3 x Proben in den Stallabteilen) sind hilfreich um ein aussagekräftiges Ergebnis zu bekommen. Neben der allg. Untersuchung auf die Gesamtkeimzahl ist mindestens die Ermittlung von coliformen und E. Coli Bakterien erforderlich. Parallel hat sich bei Verdacht eine qualitative Untersuchung des Biofilms mittels Tupferabstriche bewährt. Trotzdem gilt es zu bedenken, dass derartige Untersuchungen immer nur Momentaufnahmen sind. Eisenablagerungen im Tränkesystem verschlechtern die Schmackhaftigkeit und sorgen für Verstopfungen von Leitungen und Tränkenippeln Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 51
52 TABELLE: FERKELLEISTUNGEN IM VERSUCH AUF HAUS DÜSSE BEI TRÄNKWASSEREINSATZ MIT UND OHNE CHLORDIOXID Chlordioxid Kontrolle Differenz Tiere aufgestallt, n Tiere ausgewertet, n Geburtsgewicht, kg 1,59 1,56 Aufstallgewicht, kg 7,75 7,74 Alter Versuchsende, Tg Versuchsdauer, Tg Gewicht Versuchende, kg 27,56a 25,96b + 1,60 kg Tägliche Zunahme, g 412a 378b + 34 g Futteraufnahme pro Tag g Futterverbrauch je kg Zuwachs, kg 1,73a 1,78b - 0,05 kg a / b: Unterschiedliche Kleinbuchstaben zeigen statistisch absicherbare Unterschiede an. Quelle: Haus Düsse Schmackhaftigkeit und sorgen für Verstopfungen von Leitungen und Tränkenippeln. Allgemein kann die Wasserversorgung der Tiere bei verstopften Leitungen gefährdet werden. Um dieses Problem zu lösen, werden mittlerweile von vielen Betrieben bei eigener Brunnenwasserversorgung erfolgreich Enteisungsanlagen eingesetzt. Ergebnisse vor und nach der Enteisung zeigen, dass bei richtiger Installation und Wartung der Anlagen die Eisengehalte im Tränkewasser dauerhaft gesenkt werden können. Höhere Keimgehalte direkt am Brunnen werden, wenn überhaupt, fast nur bei Flachbrunnen festgestellt. Ursache ist häufig ein zu beobachtender Oberflächenwassereintrag. Eine Umstellung auf eine Versorgung mit Stadt- bzw. Gemeindewasser ist in solchen Fällen empfehlenswert. Es ist jedoch trügerisch zu glauben, dass Mikroorganismen vor Stadtwasser halt machen und nicht über z. B. Tränkenippel ins Wassersystem wachsen können. Mikroorganismen gelangen häufig rückwärts ins Tränkesystem. Rohrdurchmesser beachten tote Winkel oder schlecht zu reinigende Stichleitungsenden im Tränkewassersystem müssen unbedingt vermieden werden. Möglichkeit zum Ablassen des Wassers kurz vor Einstallung (Alternativ im Schweinestall auf alle Nippel vor dem Einstallen eine Wäscheklammer setzen, abgestandenes Wasser wird so heraustransportiert) keine offenen Wasserbehälter 2. Einbau von Kontrollmechanismen Klarsichtrohr Wasseruhr zur Kontrolle der Wassermenge 3. Wasserleitungssysteme müssen für die Verabreichung von Ergänzungsfuttermitteln etc. geeignet sein Ringleitungen einbauen incl. höherverstellbarer Nippeltränken VORBEUGENDE MASSNAHMEN: 1. Was gilt es bei der Installation von Tränkesystemen zu beachten Nur geeignetes Material (z. B. Edelstahl, PVC und PE- Leitungen) einsetzen Generelles Ziel in der Tierhaltung ist ein verringerter Einsatz von Antibiotika. Die Auslösung von Krankheiten durch qualitativ schlechtes Tränkewasser gilt es zu verhindern. Eine gezielte Tränkewasserhygiene ist eine notwendige Managementmaßnahme. Tränkewasserleitungen und Vorlaufbehälter müssen regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. 52 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
53 Agravis Zur Lösung von starken Ablagerungen (z. B. Eisen) ist eine einmalige Spülung des Leitungssystems mit einer Druckluftspülvorrichtung empfehlenswert. Eine feste Installation einer solchen Drucklufteinheit ist bei Verabreichung von Ergänzungsfuttermitteln etc. über Wasser für viele Betriebe vorteilhaft. Bei der Reinigung und Desinfektion mit chemischen Stoffen ist zu unterscheiden zwischen einer Maßnahme in der Serviceperiode in unbelegten Ställen (siehe Beispiel Grundreinigungsplan für Wasserleitungen unter oder einer permanenten Desinfektion des Tränkewassers in belegten Ställen mit nach der Biozidverordnung registrierten Wirkstoffen. Zur permanenten Entkeimung der Tränkewasserleitungen in belegten Tierställen empfiehlt sich z. B. der in der Praxis weit verbreitete und bewährte Wirkstoff Chlordioxid. In zuvor gründlich gereinigten Wassersystemen wird die Neubildung von Biofilmen durch den täglichen Einsatz von Chlordioxid vermieden. Chlordioxid verfügt über eine lange Depotwirkung, eine Grundvoraussetzung, um den Keimeintrag z. B. am Tränkenippel zu unterbinden. Mit Hilfe eines Schnelltests kann jeder Anwender einfach und schnell den Erfolg der Desinfektionsmaßnahme vor Ort überprüfen. In unbelegten Ställen ist eine optimale Desinfektion der Wasserleitungen nur auf sauberen Oberflächen möglich. Gute Ergebnisse werden erzielt, wenn das Wasserleitungssystem vor dem Einsatz eines Desinfektionsmittels im 1. Schritt in allen Teilen gründlich mit einem alkalischen Reinigungsmittel gereinigt wird. Alkalisch basierende Produkte entfernen zuverlässig organische Verschmutzungen und schleimige Rückstände in den Trinkwassersystemen. Im 2. Schritt kann eine Desinfektion in unbelegten Ställen beispielsweise mit Wirkstoffen wie Peressigsäure oder Kaliumperoxomonosulfat erfolgen. Vor und nach der Desinfektion ist eine gründliche Spülung aller Wasserleitungen mit viel Wasser erforderlich. AUSWAHL VON EINSATZFÄHIGEN WIRKSTOFFEN ZUR PERMANENTEN DESINFEKTION VON TRÄNKEWASSER- SYSTEMEN (OHNE RANGFOLGE): Peressigsäure, Wasserstoffperoxid (z. B. DESINTEC WH-R-aktiv plus) (als biozide Wirkstoffe zur Trinkwasserdesinfektion bei der BauA registriert) Kaliumperoxomonosulfat (z. B. Virkon S) (als biozider Wirkstoff zur Trinkwasserdesinfektion bei der BauA registriert) Chlordioxid (z. B. DESINTEC Chlordioxid) (zugelassen nach TrinkwV / als biozider Wirkstoff zur Trinkwasserdesinfektion bei der BauA registriert) Natriumhypochlorit / Chlorlauge (zugelassen nach TrinkwV / als biozider Wirkstoff zur Trinkwasserdesinfektion bei der BauA registriert) Ein auf Haus Düsse durchgeführter Versuch aus dem Jahr 2007 (siehe Tabelle) zeigt, dass auch bei hygienisch einwandfreiem Stadtwasser eine nachweisbare Steigerung der täglichen Zunahmen und der Futterverwertung durch den permanenten Einsatz von Chlordioxid möglich ist. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Beispiel: eingebaute Chlordioxidanlage zur permanenten Tränkewasserdesinfektion Weitere Informationen erhalten Sie unter oder von Dieter Jürgens unter Tel.: 0251 / Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 53
54 Prof. Dr. Steffen Hoy Justus-Liebig-Universität Gießen Bernd Schlattmann Gesing Tierzucht HOHE FERKELZAHLEN UND TIERSCHUTZ EIN WIDERSPRUCH? Schweinehalter im Spannungsfeld zwischen Leistung und Tierschutz. Auszüge aus der Infoveranstaltung vom 17. September 2013 in Uedem. Nicht erst seit dem Bundestagswahlkampf steht die deutsche Landwirtschaft im Kreuzfeuer verschiedener Interessenparteien. Insbesondere die moderne Schweinehaltung wird mit verzerrenden Vokabeln wie z. B.»Tier-Fabrik«oder»Qualzucht«in der Öffentlichkeit diffamiert. Für einen sachlichen Dialog mit Kritikern ist es notwendig, dass wir uns als Schweinehalter selbstkritisch mit dem eigenen Tun auseinandersetzen. Ist die heutige Schweinehaltung wirklich noch mit den Bedürfnissen unserer Tiere in Einklang zu bringen? Was können wir tun, um von der Öffentlichkeit nicht als kurzweilig-denkende Profitjäger sondern als generationenübergreifende Landwirtsfamilien wahrgenommen zu werden? PROF. DR. STEFFEN HOY BERICHTET: Die bisherigen Diskussionen um den Tierschutz in der Schweinehaltung beschäftigten sich mit den Themen Verbot der Anbindehaltung und dem Gebot der Gruppen- haltung tragender Sauen sowie das Verbot der vollständigen oder teilweisen Amputation von Körperteilen. In der weiterführenden Diskussion stellt sich folgende Frage: Sind hohe Wurfgrößen unweigerlich mit einem Anstieg der Ferkelverluste verbunden und werden damit die Grenzen der Zucht auf Leistung erkennbar? HOHE WURFGRÖSSEN FÜHREN NICHT ZWANGSLÄUFIG ZU STEIGENDEN FERKELVERLUSTEN In den vergangenen Jahren wurden in vielen Ländern die Wurfgrößen gesamt und lebend geborener Ferkel erheblich gesteigert. So erhöhte sich die Wurfgröße lebend geborener Ferkel in Dänemark pro Jahr um 0,3 Ferkel. Auch in Deutschland nahm die mittlere Wurfgröße an lebend geborenen Ferkeln von Jahr zu Jahr zu. Im selben Zeitraum erhöhten sich dagegen die Ferkelverluste nicht oder sie nahmen sogar ab. In den zurückliegenden 10 Jahren erhöhte sich zum Beispiel in den vom VZF betreuten Betrieben die Anzahl lebend geborener Ferkel um 2,8 pro Wurf, die relativen Verluste gingen um 3,1 Prozent zurück. Selbst die absoluten Ferkelverluste blieben fast gleich (1,87 versus 1,96 verendete Ferkel pro Wurf). Für die Ferkelerzeugerbetriebe ist die Anzahl aufgezogener Ferkel ein Merkmal von größter betriebswirtschaftlicher Bedeutung. Ferkelverluste dürfen natürlich auch bei steigenden Wurfgrößen nicht billigend in Kauf genommen werden. Ferkelverluste von deutlich über 15 Prozent sind tierschutzrechtlich und auch ethisch bedenklich. Es ist zu beachten, dass bei Wurfgrößen oberhalb von 16 Ferkeln das mittlere Geburtsgewicht deutlich abnimmt, die Ferkelverluste ansteigen und der Aufwand für die Aufzucht sich erhöht. Für die Ferkelerzeugerbetriebe besteht die Aufgabenstellung somit darin, die Balance zwischen hoher 54 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
55 Gesing Fruchtbarkeitsleistung der Sauen ohne extrem große Würfe und möglichst geringen Ferkelverlusten herzustellen. Somit besteht die Herausforderung für Zucht und Haltung darin, möglichst viele Ferkel an einer Sau (Mutter oder Amme) aufzuziehen. HOHE AUFZUCHTLEISTUNG AN DER SAU GEWÄHRLEISTEN Eine hohe Aufzuchtleistung wird durch viele Faktoren beeinflusst. Eine Grundbedingung ist zunächst eine große Zahl an funktionstüchtigen Zitzen. Zukünftig wird noch stärker das Merkmal Zitzenzahl bereits bei der Geburt der potentiellen Zuchtferkel berücksichtigt werden müssen. Des Weiteren müssen die Zitzen während der Aufzucht und natürlich von Wurf zu Wurf hinweg in einem funktionstüchtigen Zustand bleiben, es dürfen keine Verletzungen mit zunehmendem Alter der Sauen auftreten. Hier spielt die zitzenschonende Gestaltung des Fußbodens im Abferkelstall, sicher aber auch im Besamungs- und Wartestall eine wichtige Rolle. Eine hohe Milchleistung in allen Zitzen ist notwendig, um viele geborene Ferkel erfolgreich aufziehen zu können. Dazu müssen die Sauen auf Milchleistung gefüttert werden. Durch ein geschicktes Umsetzen unmittelbar nach der Geburt erhalten die»kleinen«überhaupt erst die Chance für die Aufzucht, indem Würfe mit kleinen Ferkeln gebildet werden. Schließlich müssen auch alle Möglichkeiten der (Zusatz-)Fütterung der Ferkel in der Abferkelbucht bedacht werden (z. B. Einsatz von Ferkelmilch in Futterschalen oder»ferkeltassen«), um die Milchleistung der Sau zu unterstützen. Allerdings ist dabei auch eine betriebswirtschaftliche Bewertung erforderlich, denn die Ferkelmilch ist ein teures Futtermittel und der arbeitswirtschaftliche Aufwand ist nicht zu unterschätzen. WO LIEGEN DIE GRENZEN DER ZUCHT AUF HOHE WURFGRÖSSEN? Wurfgrößen im Mittel von 16 lebend bzw. 17 gesamt geborenen Ferkeln und 32 bis 33 abgesetzten Ferkeln je Sau und Jahr sind tierschutzrechtlich grundsätzlich kein Problem, wenn 15 bis 16 funktionstüchtige Zitzen vorhanden sind, die Ferkelverluste unter dem Durchschnitt aller Betriebe liegen (z.zt. ca. 14 Prozent), so viel wie möglich Ferkel an der eigenen Mutter aufgezogen werden und demzufolge die Betreuung von Sau und Ferkeln überdurchschnittlich gut ist! Bei einzelnen größeren Würfen ist die mutterlose Aufzucht tierschutzrechtlich gerechtfertigt und notwendig, denn sie dient der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Ferkel. Des Weiteren trägt auch die Tierzucht zu einem besseren Tierschutz bei. Die Selektion auf Zitzenzahl und Gesäugequalität muss auch die Sauen selbst einschließen. BERND SCHLATTMANN, GESING TIERZUCHT BERICHTET: ES SIND GENÜGEND FERKEL DA Eigene Auswertungen von Kundenbetrieben haben gezeigt, dass durch die fokussierte Zucht auf lebend geborene Ferkel am Tag 5 (LG 5) die Zahl der geborenen und überlebensfähigen Ferkel auf einen Niveau von 14,5 16,5 lebend geborenen gestiegen ist. Hier ist ein Optimum aus tierschutzrechtlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht erreicht. Im DanAvl System ist auf diese Entwicklung bereits Ende 2012 reagiert worden. Das Zuchtziel LG 5 von 62 Prozent im Jahr 2004 ist auf zwischenzeitlich 37,5 Prozent bis heute auf 27 Prozent reduziert worden. Es zeigt sich bereits heute, dass die Zahl der geborenen Ferkel nicht mehr so deutlich ansteigt wie in den vergangenen Jahren. Durch die Reduzierung des Zuchtzieles LG5 rücken andere Parameter deutlicher in den Fokus. So spielt heute der Parameter Futterverwertung als betriebswirtschaftlich wichtiger Punkt eine zentrale Rolle im DanAvl Zuchtziel. Weitere wichtige Parameter im DanAvl-Zuchtziel sind Haltbarkeit, Körperbau, Tageszunahmen und Magerfleisch. DURCH EIGENE ZUCHT BESSERE GESÄUGE UND STABILERE FUNDAMENTE Beim neuen Vermehrungsbetrieb Schulze-Pellengahr (Ascheberg) und dem angeschlossenen Aufzuchtbetrieb Miermann (Bottrop) setzt die Gesing Tierzucht neben den Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 55
56 Gesing DanAvl-Zuchtzielen auf zusätzliche Parameter speziell für den deutschen Kunden. So wird bei der Auswahl der Großelterntiere besonders auf die Merkmale Gesäugeausprägung, gutes Fundament und Stabilität geachtet. Darüber hinaus wird auch bei der Exterieur-Beurteilung der Hybrid-Jungsauen im Aufzuchtbetrieb Miermann streng auf die Anzahl funktionsfähiger Zitzen, korrekte Beinstellung sowie eine ausgewogene Konditionierung der Tiere geachtet. Ziel der Gesing-Tierzucht ist es, eine Sau zu züchten, die über eine große Gesamtlebensleistung möglichst viele Ferkel eigenständig aufziehen kann. Bei der DanAvl-Sau sind die Ferkelzahlen ausreichend. Daher wurde im DanAvl-System die Gewichtung des Parameters Fruchtbarkeit in den letzten Jahren sukzessive zu Gunsten anderer Parameter reduziert. Die Gesing Tierzucht hat in der Zuchtarbeit neben den DanAvl-Zuchtparametern eigene Attribute im Bereich Mütterlichkeit und Stabilität definiert. Ziel der Gesing Tierzucht ist es, dem Ferkelerzeuger eine Sau zu liefern, die es ihm ermöglicht, durch eine große Gesamtlebensleistung und möglichst vieler eigenständig aufgezogener Ferkel das große genetische Leistungspotenzial der Dan- Avl-Genetik auszuschöpfen. FAZIT Hohe Ferkelzahlen und Tierschutz stehen nicht im Widerspruch! Insbesondere dann nicht, wenn Ferkelverluste vermieden werden durch a) ein gutes Management vor, während und nach der Geburt der Ferkel, sowie b) durch die Fähigkeit der Sau, möglichst viele Ferkel eigenständig groß zu ziehen. INFOBOX DanZucht ist jetzt DanAvl: Aufgrund der Vereinheitlichung des Namens heißt DanZucht (deutschsprachig) genauso wie DanBred (englischsprachig) ab 2013 einheitlich DanAvl (dänisch) UnSere SAU STeHT IHnen gut! Wir setzen noch einen drauf: dänische Spitzengenetik mit besonderen Attributen. Die gruppentaugliche Sau mit besonders stabilen Fundamenten, besserer Futterverwertung und mindestens 14 funktionsfähigen Zitzen. Dänisches Leistungspotenzial trifft deutschen Qualitätsanspruch! REINHARD GESING Tierzucht Benzstraße Heek Tel Fax Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
57 Elanco Milliardenfach in der Praxis bewährt! Belastbarer Schutz vom Absetzen bis zum Mastende. Der seit Jahren bewährte Einmal-Impfstoff für die frühe Mykoplasmen-Impfung ab der 1. Lebenswoche. Auf den können Sie sich verlassen! Fragen Sie Ihren Tierarzt! DESWISTL00019 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 57
58 Geoffrey Labarque, PhD; Dr. Astrid Pausenberger Elanco Animal Health VOLLSTÄNDIGER SCHUTZ BEIM ABSETZEN Frühzeitiger Schutz gegen Mycoplasma hyopneumoniae. Atemwegserkrankungen zählen zu den größten Herausforderungen in der modernen Schweineproduktion. Sie verursachen beträchtliche wirtschaftliche Verluste durch häufigere Todesfälle und höhere Erkrankungsraten, gesteigerte Behandlungskosten und Einbußen bei der Wachstumsrate, 9, 17 der Futterverwertung sowie der Schlachtkörperqualität. Mycoplasma hyopneumoniae (M.hyo) ist der Primärerreger der Enzootischen Pneumonie (EP) und gehört zu den wichtigsten Erregern von Atemwegserkrankungen beim Schwein. 9 LOKALISATION UND ÜBERTRAGUNG In zahlreichen Untersuchungen wurde M.hyo bei Ferkeln schon vor dem Absetzen im oberen und 3, 7, 12, 14,15, 16, 19 unteren Respirationstrakt nachgewiesen. Das belegt die Übertragung des Erregers von den Muttersauen auf ihren Nachwuchs durch Nasen- 1, 17 kontakt in den ersten Lebenswochen der Ferkel. In einer aktuellen Studie von Elanco, durchgeführt in Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Portugal und Spanien, wurden Abstriche aus Luftröhre und oberen Bronchien von Ferkeln mittels PCR (Polymerasekettenreaktion) auf M.hyo untersucht. Ein positiver Befund ergab sich bei 105 der 255 getesteten Herden (41,2 Prozent) sowie bei 492 der beprobten Ferkel (7,0 Prozent). 7 Von besonderer Bedeutung ist die Infektion der Saugferkel, da die Tiere nach dem Absetzen in andere Buchten verbracht und meist zusammen mit anderen Ferkeln aufgestallt werden. Auf diese Weise kann M.hyo in der Aufzuchtphase leicht von infizierten Ferkeln auf nicht infizierte Tiere übertragen werden. 19 Der Anteil infizierter Tiere zum Zeitpunkt des Absetzens hat entscheidenden Einfluss auf die weitere Ausbreitung der M.hyo-Infektion während der Aufzucht. Untersuchungen zufolge infiziert ein Ferkel, das selbst vor oder zum Zeitpunkt des Absetzens infiziert wurde, im Durchschnitt einen 10 bis vier 11 seiner Buchtgenossen, wenn Ferkel aus unterschiedlichen Würfen zusammen aufgestallt werden. Eine andere Studie zeigte, dass ein direkter Zusammenhang zwischen der Rate der M.hyo-infizierten Ferkel beim Absetzen (im Alter von vier Wochen) mit den Infektionsraten der Ferkel bei Mastbeginn im Alter von 10 und 16 Wochen besteht. 3 Analog ist zu erwarten, dass die Infektionsrate beim Absetzen auch den Grad der M.hyo-Infektion zum Zeitpunkt der Schlachtung beeinflusst. In der Tat wiesen in verschiedenen Studien Schweine, bei denen zum Zeitpunkt des Absetzens eine hohe M.hyo-Infektionsrate bestand, bei der Schlachtung schwere Lungenveränderungen 5, 16 auf, die nachweislich auf M.hyo zurückzuführen waren. Wenn man darüber hinaus berücksichtigt, dass bekanntermaßen die Häufigkeit und das Ausmaß von Lungenveränderungen bei der Schlachtung und das Wachstum in der Mastperiode signifikant in einer negativen Korrelation stehen, 2, 6, 13, 18 wird die enorme Bedeutung klar, die diese Zusammenhänge für eine wirtschaftliche Schweineproduktion haben: Straw und Mitarbeiter 18 konnten zeigen, dass eine durch M.hyo bedingte Pneumonie die 58 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
59 Elanco TABELLE: VARIABLE KOSTEN DER AUFZUCHT SCORE DER LUNGEN- VERÄNDERUNGEN 8 MTGZ* (REDUKTION IN %) ALTER BEI EINEM GEWICHT VON 115 KG 0 (keine Veränderung) (n = 5.241) 638 g / Tag 179,2 Tage 116,8 kg GEWICHT IM ALTER VON 180 TAGEN 1 3 (leicht) (n = 2.196) 626 g / Tag ( 12 %) 182,9 Tage (+ 3,7 Tage) 114,4 kg ( 2,4 kg) 4 8 (mittel) (n = 1.431) 620 g / Tag ( 18 %) 184,7 Tage (+ 5,5 Tage) 113,1 kg ( 3,7 kg) 9 24 (schwer) (n = 456) 594 g / Tag ( 44 %) 193,2 Tage (+ 14 Tage) 107,4 kg ( 9,4 kg) * MTGZ = mittlere tägliche Gewichtszunahme Auch wenn die Tierzahlen in den verschiedenen Kategorien nicht gleichmäßig verteilt waren, so verdeutlichen die Ergebnisse doch eindrucksvoll, welche Auswirkungen Atemwegserkrankungen auf die Mastleistung in der Schweineproduktion haben. mittlere tägliche Gewichtszunahme (MTGZ) um durchschnittlich 17 Prozent und die Futterverwertung um durchschnittlich 14 Prozent verminderte. In einer aktuellen Studie untersuchten Henninger et al 6 den Einfluss von Lungenerkrankungen auf die Mast- und Schlachtleistung von Schweinen. Insgesamt Schweine aus 13 Betrieben gingen in die Auswertung ein. Erfasst wurden die täglichen Zunahmen von der Geburt bis zu einem Gewicht von 115 kg. Am Schlachthof wurden die Lungen der Studientiere mittels eines Scoringsystems nach Madec beurteilt und in 4 Kategorien von 0 (keine Lungenveränderungen) bis 4 (schwere Lungenveränderungen) eingeteilt. Die Tabelle zeigt die Reduktion der Mastleistung in den 4 Kategorien, bezogen auf den Verlust an täglichen Zunahmen in Prozent, die Verlängerung der Mastdauer in Tagen und den Gewichtsunterschied im Alter von 180 Tagen. ZUSAMMENFASSUNG Frühe Infektionen von Ferkeln mit M.hyo haben einen bedeutenden Einfluss auf die Erkrankungsrate in der Mast und verursachen Mindererlöse durch Leistungsdepression. Eine frühzeitige Impfung von Saugferkeln gegen M.hyo sichert vollen Schutz beim Absetzen und trägt in Kombination mit einer Verbesserung des Managements und der Haltungsbedingungen im Betrieb (z. B. Stallklima) dazu bei, Atemwegserkrankungen bei Schweinen zu kontrollieren. 1. Calsamiglia, M., and Pijoan, C. (2000). Colonisation state and colostral immunity to Mycoplasma hyopneumoniae of different parity sows. The Veterinary Record 146, Dohoo, I.R., and Montgomery, M.E. (1996). A field trial to evaluate a Mycoplasma hyopneumoniae vaccine: Effects on lung lesions and growth rates in swine. The Canadian Veterinary Journal 37, Fablet, C., Marois-Créhan, C., Simon, G., Grasland, B., Jestin, A., Kobisch, M., Madec, F., and Rose, N. (2012a). Infectious agents associated with respiratorydiseases in 125 farrow to-finish pig herds: Across-sectional study. Veterinary Microbiology 157, Fablet,C., Dorenlor, V., Eono, F., Eveno, E., Jolly, J.P., Portier, F., Bidan, F., Madec, F., and Rose, N. (2012b). Noninfectious factors associated withpneumonia and pleuritis in slaughtered pigs from 143 pig farms. Preventive Veterinary Medicine 104, Fano, E., Pijoan, C., Dee, S., and Deen, J. (2007). Effect of Mycoplasmahyopneumoniae colonization at weaning on disease severity in growing pigs. The Canadian Journal of Veterinary Research 71, Henninger, M., Dumont, T., Morel-Saives, A., and Auvigne, V. (2013). Relationship between lung lesions at slaughter and performance of pigs. Proceedings of the 5th European Symposium on Porcine Health Management (ESPHM), Edinburgh, United Kingdom. 7. Labarque, G., Vangroenweghe, F., Sanchez Uribe, P.J., Bringas, J.R., Ferro, P., Hanninger, M., Pausenberger, A., and Branco Grosso, T.M. (2013). Prevalence of Mycoplasma hyopneumoniae infections at weaning age in European pig herds. Proceedings of the 5th European Symposium on Porcine Health Management (ESPHM), Edinburgh, United Kingdom. 8. Madec, F., and Kobisch, M. (1982). Bilan lésionnel des poumons de porcs charcutiers à l abattoir. Journées de la Recherche Porcine en France 14, Maes, D., Segalés, J., Meyns, T., Sibila, M., Pieters, M., and Haesebrouck, F. (2008). Control of Mycoplasma hyopneumoniae infections in pigs. Veterinary Microbiology 126, Meyns, T., Maes, D., Dewulf, J., Vicca, J., Haesebrouck, F., and de Kruif, A. (2004). Quantification of the spread of Mycoplasma hyopneumoniae in nursery pigs using transmission experiments. Preventive Veterinary Medicine 66, Meyns, T., Dewulf, J., de Kruif, A., Calus, D., Haesebrouck, F., and Maes, D. (2006). Comparison of transmission of Mycoplasma hyopneumoniae in vaccinated and non-vaccinated populations. Vaccine 24, Nathues, H., Kubiak, R., Tegeler, R., and Grosse Beilage, E. (2010). Occurrence of Mycoplasma hyopneumoniae infections in suckling and nursery pigs in a region of high pig density. The Veterinary Record 166, Pagot, E., Pommier, P., and Keita, A. (2007). Relationship between growth during the fattening period and lung lesions at slaughter in swine. Revue de Médecine Vétérinaire 158, Segalés, J., Valero, O., Espinal, A., López-Soria, S., Nofrarías, M., Calsamiglia, M., and Sibila, M. (2011). Exploratory study on the influence of climatological parameters on Mycoplasma hyopneumoniae infection dynamics. International Journal of Biometeorology DOI /s Sibila, M., Nofrarías, M., López-Soria, S., Segalés, J., Riera, P., Llopart, D., and Calsamiglia, M. (2007a). Exploratory field study on Mycoplasma hyopneumoniae infection in suckling pigs. Veterinary Microbiology 121, Sibila, M., Nofrarías, M., López-Soria, S., Segalés, J., Valero, O., Espinal, A., and Calsamiglia, M. (2007b). Chronological study of Mycoplasma hyopneumoniaeinfection, seroconversion and associated lung lesions in vaccinated and non-vaccinated pigs. Veterinary Microbiology 122, Sibila, M., Pieters, M., Molitor, T., Maes, D., Haesebrouck, F., and Segalés, J. (2009). Current perspectives on the diagnosis and epidemiology of Mycoplasma hyopneumoniae infection. The Veterinary Journal 181, Straw, B.E., Tuovinen, V.K., and Bigras-Poulin, M. (1989). Estimation of the cost of pneumonia in swine herds. Journal of the American Veterinary Association195, Villarreal, I., Vranckx, K., Duchateau, L., Pasmans, F., Haesebrouck, F., Jensen, J., Nanjiani, I., and Maes, D. (2010). Early Mycoplasma hyopneumoniae infections in European suckling pigs in herds with respiratoryproblems: detection rate and risk factors. Veterinarni Medicina 55, Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 59
60 Robert Wenning Detert Zuchttiere DANZUCHT VERMEHRUNG ALS BETRIEBSERFOLG Im Jahr 2010 stellte sich für die Familie Heiermann die Frage wie es weitergeht mit der Babyferkelproduktion auf dem Standort in Herne. Als Ziel wurde der Neubau eines Ferkelaufzuchtstalles in das betriebliche Konzept aufgenommen. Durch den Hoftierarzt Michael Bartholome entstand gleichzeitig der Kontakt zu Detert Zuchttiere, ein expandierendes Unternehmen aus Gronau-Epe, das sich auf die Vermehrung und den Vertrieb von hochgesunder Dan- Zucht Genetik spezialisiert hat. Nach einigen gemeinsamen Gesprächen entschloßen sich die beiden Unternehmen zusammen DanZucht Vermehrung auf dem Betrieb von Stephan Heiermann zu betreiben. Anschließend wurde die ganze Stallanlage gründlich desinfiziert und ausgegast. Gleichzeitig begann der Neubau eines Ferkelaufzuchtstalles mit 2800 Plätzen. Neben einer Ausstattung mit einer Kombination aus Kunststoff und Betonböden wurde eine Schauer Spotmix Fütterung installiert. Stephan Heiermann wollte nichts dem Zufall überlassen und entschiedt sich daher für diese sehr exakt arbeitende Fütterung, die keine Wünsche offen läßt. Im Sommer 2011 wurde nach sorgfältiger Auswahl durch SPF in Dänemark und vorheriger Besichtigung durch Carl Josef Detert die Entscheidung gefällt. Einer der besten Basiszuchtbetriebe Dänemarks, Stendalgaard, konnte für die Belieferung von Heiermann gewonnen werden. Nachdem Stephan Heiermann ein Praktikum auf dem Betrieb absolviert hatte ging es im Sommer 2011 mit der Belieferung von hochgesunden Yorkshire Basissauen los. Der Gesundheitsstatus dieser Top Sauen definiert sich als serologisch negativ hinsichtlich PRRS, Mykoplasma Hyopneumonia und APP. Dieser hohe Status, SPF rot, ist in der schweinefreien Ruhrgebietsregion von Herne auch auf lange Sicht gut zu halten. Denn 12 km rundherum schweinefrei ist eine absolute Ausnahmelage in ganz Nordrhein Westfalen. Der vorhandene Sauenbestand von 600 Sauen wurde nach und nach verkauft. Ein auf Stallreinigung spezialisiertes Unternehmen reinigte in mehreren Wochen die gesamte Stallanlage. Obwohl der Sauenbestand vorher keine Gesundheitsprobleme hatte wurde bei der Reinigung an nichts gespart. Im Abferkelbereich wurden alle Böden demontiert und die Ferkelnester zur Reinigung ausgebaut. Der Deck- und Wartebereich wurde ebenfalls durch das Aufdecken der Spaltenböden und reinigen der Güllekanäle gründlich gesäubert. Zusätzlich wurden alle Zuund Abluftkanäle gereinigt und durchgescheckt. 60 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
61 Detert Nach erfolgreicher Eingliederung begann dann im Herbst 2011 die Belegung mit dänischen Landrasse Sperma. Höchster Index der Eber und eine breite Streuung der eingesetzten Väter garantieren eine Top Nachkommenschaft. Über 30 abgesetzte Ferkel mit höchster Vitalität geben dem dänischen Konzept recht. Montagmorgen werden von Detert Zuchttiere alle weiblichen und männlichen Ferkel abgeholt. Kein fremder Tiertransporter kommt so auf den Betrieb. Auch die Schlachtsauen werden vom Betriebsleiter zu einer Übergabestelle gefahren. Besuchen Sie uns im Internet unter oder auf Facebook! Detert Zuchttiere Brinkerhook Gronau-Epe Tel.: / Fax: / info@detert-zuchttiere.de Auch die weitere Remontierung geschieht dreimal jährlich aus dem Betrieb Stendalgaard. Um den schnellen Zuchtfortschritt zu halten, remontiert Stephan Heiermann seine Herde jährlich zu 50 Prozent. Die Selektion der Sauenherde erfolgt in erster Linie nach Index, dieses ist notwendig um den schnellen Zuchtfortschritt zu halten und im Ranking der Vermehrungsbetriebe einen der oberen Plätze einzunehmen. Die Sauenherde wird im Wochenrythmus gefahren. Es stehen sechs Deckzentren zur Verfügung. Anschließend kommen die Altsauen mit den belegten Jungsauen zusammen in festen Gruppen an die Abruffütterung. Im Abferkelbereich werden die Sauen ebenso wie in den anderen Bereichen mit einer Fütterungsanlage trocken gefüttert. Am fünften Tag erhalten die Saugferkel die Circoimpfung, eine Woche später die Ileitis-Impfung per Drench. Mit 21 Tagen wird abgesetzt und die Ferkel kommen direkt ins Flatdeck. Hier wird nach der Prestarterphase mit engiereduzierten Futter weitergefüttert. Auch hier bringt der hohe Gesundheitstatus starke Vorteile, die Ferkel wachsen in eins durch. Mit etwa 25 kg werden die weiblichen Tiere im geschlossenen Transporter mit Zuluftentkeimung zu den beiden angeschlossenen Aufzuchtbetrieben gefahren. Jeden Das bieten wir Ihnen fruchtbare und stabile DanZucht-Sauen (fester Lieferbetrieb) als deckfähige Jungsau als Zuchtläufer als Paket Jungsauen und Zuchtläufer als angedeckte Jungsau Jungsauen aus deutscher Vermehrung und Aufzucht unkomplizierte Eigenremontierungskonzepte reinrassige Sauen und Eber Sperma von Spitzenebern für Zucht, Vermehrung und Ferkelerzeugung Endstufeneber Unsere Vermehrungs- und Aufzuchtbetriebe sind unverdächtig von PRRS Mykoplasmen und APP Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne! Licensed by Dan Avl DETERT ZUCHTTIERE Brinkerhook 16 Tel. ( ) Gronau-Epe Fax ( ) Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 61
62 Christina Münks Deutsche Tiernahrung Cremer LEISTUNGSSTEIGERUNG DURCH TIERISCHE PROTEIN- BAUSTEINE Das Absetzten stellt die kritischste und anspruchsvollste Phase in der Ferkelaufzucht dar. Eine große Herausforderung ist die Rationsgestaltung. Das Ziel sollte hier eine frühe und gleichmäßige Futteraufnahme sein. Hierdurch werden nicht nur hohe Zuwachsleistungen erreicht, sondern auch eine gesunde Entwicklung der Darmzotten. Nehmen die Ferkel nach dem Absetzten lange kein Futter auf, kommt es zu einer Rückentwicklung der Zotten. Zudem führt eine lange Fresspause meist zu einer anschließenden Mehraufnahme mit dem Problem des Überfressens und den daraus resultierenden Durchfallproblemen. Die Rückentwicklung der Darmzotten kann im Laufe der Aufzucht nicht wieder gutgemacht werden. Die frühe Futteraufnahme ist also entscheidend für die gesamte Futterverwertung in der Aufzucht und auch in der Mast. Hinzu kommt, dass die Darmwand eine natürliche Barriere gegen Krankheitserreger darstellt. Durch eine nicht intakte Darmwand können pathogene Keime in die Blutbahn gelangen und das Immunsystem der Ferkel schwächen. Um dem Ferkel den Übergang von der Sauenmilch auf das Absetzfutter so einfach wie möglich zu machen, sollte das Absetzfutter besonders schmackhafte und hochverdauliche Komponenten enthalten. Dem Proteingehalt kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Denn hohe Proteingehalte sind notwendig um das Wachstumspotenzial der Ferkel voll auszuschöpfen zu können, andererseits steigt aber mit zunehmendem Proteingehalt die Pufferkapazität des Futters. Ein Anstieg der Pufferkapazität bedeutet, dass ein Teil der Magensäure neutralisiert wird. Hierdurch erhöht sich die Krankheitsanfälligkeit der jungen Ferkel. Um das Leistungspotenzial voll ausschöpfen zu können und gleichzeitig den Rohproteingehalt so gering wie möglich zu halten, müssen hochverdauliche Proteinquellen eingesetzt werden. Hierzu stehen in der Ferkelernährung verschiedene Quellen zur Verfügung. Sojaproteinkonzentrat und Kartoffeleiweiß sind hochverdauliche pflanzliche Proteinquellen und werden sehr häufig in der Ferkelernährung eingesetzt. Um die Schmackhaftigkeit aber noch weiter zu steigern, eignen sich besonders tierische Proteinquellen wie z. B. Heringsmehl oder Blutplasma. Nachteilig ist allerdings, dass die Auflagen zum Einsatz tierischer Proteinquellen sehr hoch sind, da diese nicht an Wiederkäuer verfüttert werden dürfen. Eine Ausnahme stellt hier das Proteinhydrolysat vom Schwein dar. Das Proteinhydrolysat vom Schwein ist ein Nebenprodukt der Heparin-Herstellung und wird aus der Dünndarmschleimhaut von Schweinen gewonnen. Bei der Hydrolyse kommt es zu einer Zerkleinerung der Proteine, d.h. das gewonnene Proteinhydrolysat besteht aus freien Aminosäuren und Peptiden. Da es sich also um Proteinbausteine handelt und nicht um vollständige Proteinstrukturen ist das Proteinhydrolysat vom Schwein vom Fütterungsverbot an Wiederkäuer ausgenommen. Der Vorteil des Proteinhydrolysats ist, dass es vom Schwein selber stammt und somit für das Ferkel ein optimales Aminosäurenmuster aufweist. Es kommt somit zu keinem Mangel an einzelnen Aminosäuren. Zudem haben die Aminosäuren eine sehr hohe Verdaulichkeit. Der tierische Geschmack des Proteinhydrolysats fördert die Futteraufnahme der Ferkel zusätzlich. Um zu testen, ob das Proteinhydrolysat andere tierische Proteinquellen wie z. B. Blutplasma ersetzten kann wurde im Juni bis September 2012 ein Fütterungsversuch an der Landesanstalt für Landwirtschaft in Iden durchgeführt. Der Versuch wurde mit 3 Versuchsgruppen (20 Ferkel pro Gruppe) und 5 Wiederholungen durchgeführt (Insgesamt 300 Ferkel). Zu Beginn des Versuches wurden die Gruppen mit unterschiedlichen Ferkelaufzuchtfutter I gefüttert, welche sich durch ihre Proteinquellen unterschieden: 62 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
63 Deutsche Tiernahrung Cremer K o n t r o l l g r u p p e : 5 Prozent Sojaproteinkonzentrat (SPC) Plasmagruppe: 2,5 Prozent Blutplasma + 2,5 Prozent SPC Proteinhydrolysatgruppe: 2,5 Prozent Proteinhydrolysat vom Schwein + 2,5 Prozent SPC Bei dem eingesetzten Proteinhydrolysat handelt es sich um eine Neuentwicklung mit dem Markennamen Muco Digest (Gelamin; Gesellschaft für Tierernährung mbh). Bei diesem Produkt wird in einem sogenannten coating mixing-prozess hydrolysiertes, sprühgetrocknetes Protein aus der Darmmukosa vom Schwein mit Sojaproteinkonzentrat zu einem hochverdaulichen, fließfähigen Produkt verbunden. ABBILDUNG 1: Kontrolle Blutplasma Proteinhydrolysat Im Anschluss an das Ferkelaufzuchtfutter I wurden alle Ferkel mit dem gleichen Ferkelaufzuchtfutter II ohne tierische Proteinquellen gefüttert ABSETZTEN DER FERKEL MIT 26 TAGEN Tag 1 18 nach dem Absetzten: FAZ I Tag nach dem Absetzten: FAZ I und FAZ II verschnitten Ab Tag 21 nach dem Absetzten: FAZ II Die Ergebnisse des Versuches sind der Tabelle 1 zu entnehmen. Anhand der Ergebnisse ist zu erkennen, dass die Plasma-Gruppe nach der 1. Wiegung vorne liegt, dicht gefolgt von der Proteinhydrolysat-Gruppe. Zum Futterwechsel ändert sich diese Entwicklung. Während die Ferkel der Proteinhydrolysat-Gruppe und der Kontrollgruppe 0 Tag 1 19 Tag gleichmäßig weiter fressen, geht die Futteraufnahme der Plasma-Gruppe zurück (siehe Abbildung 1). Am Ende des Versuches erreicht die Proteinhydrolysat-Gruppe die höchsten Gesamttageszunahmen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Proteinhydrolysat vom Schwein zu einer Verbesserung der Zuwachsleistungen und einer nachhaltig hohen Futteraufnahme führt. Die geringeren gesetzlichen Auflagen gegenüber anderen tierischen Eiweißquellen ermöglichen einen breiten Einsatz in der Praxis. TABELLE 1: KONTROLLE BLUTPLASMA PROTEINHYDROLYSAT Ferkel, n Absetzalter, d Absetzgewicht, kg 8,1 8,1 8,1 Gewicht Tag 19, kg 13,5 14,0 13,9 Zunahme, g / d Ausstallgewicht Tag 43 kg 29,9 29,8 30,5 Gesamtzunahme, g / d Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 63
64 Dr. Karl-Heinz Tölle Geschäftsführer der ISN-Projekt GmbH TUE GUTES UND REDE DARÜBER Die Hetzkampagnen gegen die Tierhaltung sind in den vergangenen Monaten immer unerträglicher geworden. So schreibt sich beispielsweise eine Bürgerinitiative aus Niedersachsen auf die Fahne: Unser Ziel ist es» aktiven Widerstand gegen die Menschen, Tiere und Umwelt verachtenden Aktivitäten der industriellen Tierhaltung zu leisten«. Das Ganze wurde im zurückliegenden Bundestagswahlkampf noch einmal spürbar verstärkt. Hat doch beispielsweise der Grünen-Spitzenkandidat Jürgen Trittin die Tierhalter mehrfach des»drogenhandels im Stall«bezichtigt. Wollen Sie als Tierhalter sich das weiter gefallen lassen? Dass es so nicht weiter geht, spüren alle mehr als deutlich, denen Tierhaltung etwas bedeutet. Auch wenn die Hitze des Wahlkampfes nun vorbei ist nach der Wahl ist vor der Wahl! Es darf nicht sein, dass ein kleiner Anteil der Bevölkerung die Meinungshoheit hat und den Rest gegen die Tierhaltung aufwiegelt. Deshalb gilt es gegenzuhalten: Mit guter Arbeit, aber auch mit Präsenz in den Diskussionen und in der Öffentlichkeit. TIERHALTUNG AKTIV WEITERENTWICKELN Ohne Zweifel, die geleistete Arbeit in deutschen Schweineställen ist gut. Es gibt gute Gründe dafür, warum die Schweinehaltung heute so ist, wie sie ist. Viele Veränderungen sind zum Wohl der Tiere erfolgt man schaue sich nur einmal an, wie gut die hygienischen Bedingungen im Stall heutzutage geworden sind. Trotzdem dürfen die Kritikpunkte an der Schweinehaltung nicht ungehört verhallen. Die Branche muss sich aktiv bei der Suche nach Lösungen einbringen, wenn es beispielsweise um den Verzicht auf die Eingriffe am Tier oder die Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes geht. Nur wer sich aktiv und konstruktiv beteiligt, kann die Zukunft mitgestalten. Hier gibt es schon gute Beispiele: zu nennen sind sicherlich die Aktivitäten zum Verzicht auf die betäubungslose Kastration. Auch die Initiative Tierwohl ist ein gutes Beispiel dafür, wie im Dialog mit den Vermarktern, dem Lebensmitteleinzelhandel und den Tierschützern praktikable Lösungen zu noch mehr Tierwohl gefunden werden können. NICHTS ZU VERSTECKEN REALITÄT ZEIGEN Öffentlichkeitsarbeit kann nur erfolgreich sein, wenn sie von der Basis kommt. Das heißt, jeder einzelne Landwirt muss sich aktiv einbringen auch wenn manchmal der Eindruck entsteht, es ist nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Aber auch viele kleine Tropfen können zusammen zu einem festen Wasserstrahl werden. Die Organisationen können Hilfestellung leisten im Vordergrund müssen aber die Tierhalter und ihre Familien stehen. Denn es ist ganz entscheidend, aufzuzeigen, dass Menschen hinter der Tierhaltung stehen und nicht eine anonyme Agrarindustrie. Öffentlichkeitsarbeit fängt im Kleinen an: beim Dialog mit dem Nachbarn, beim Kindergarten auf dem Hof, beim Tag des offenen Hofes usw. Dazu gehören aber auch die vielleicht unangenehmen, aber deswegen nicht weniger wichtigen Dinge, nämlich auch, mit oft ideologisch geprägten Kritikern zu diskutieren. Es geht darum, dieser Minderheit nicht die Mei- So soll es sein: Zeigen statt verstecken! 64 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
65 ISN nungsführerschaft resignierend zu überlassen. Sich mit Sachargumenten beispielsweise bei Veranstaltungen vor Ort für oder gegen Tierhaltungen einzumischen heißt, die Gegner der Tierhaltung bei ihrem Ziel zu stören, die Tierhaltung abzuschaffen. BAUERNHÖFE STATT BAUERNOPFER Kurz vor der Bundestagswahl lief eine groß angelegte Anzeigenkampagne im Münsterland mit dem Schwerpunkt im Raum Coesfeld. Drei unterschiedliche Motive erschienen an drei aufeinanderfolgenden Samstagen in verschiedenen Zeitungen finanziert von Schweinehaltern überwiegend aus der Region! Das erste Motiv ist in einer Zeitungsauflage von ca Exemplaren erschienen. Zusätzlich wurde auch eine halbseitige Anzeige in einem Anzeigenblatt im Kreis Coesfeld veröffentlicht. Ihren Höhepunkt erreichte die Kampagne Mitte September mit einer Anzeige, auf der neun Schweinehalter aus dem Kreis Coesfeld anbieten, die Realität zu zeigen. Es gibt bereits viele gute Aktivitäten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Je mehr es davon gibt, desto besser. Deshalb hat die ISN Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands Mitte Juni die Plattform ins Leben gerufen. Nach dem Motto»Redet mit uns Tierhaltern und nicht nur über uns!«soll ganz selbstbewusst die Realität in den Ställen gezeigt werden und natürlich die Menschen dahinter. Die Plattform soll helfen, bestehende Aktionen zu unterstützen und noch mehr Öffentlichkeitsarbeit zu organisieren. Melden Sie gerne Termine und Veranstaltungen aus Ihrer Region (z.b per an Diese werden über die Plattform verbreitet, damit sich möglichst viele Tierhalter und deren Unterstützer daran beteiligen können. Herzstück der Plattform ist die Projektbörse. Es gibt viele gute Ideen im Lande, aus denen gute Projekte in puncto Öffentlichkeitsarbeit werden könnten. Ein Einzelner kann das aber oftmals nicht leisten, weil er dazu finanzielle Unterstützung benötigt. In die Projektbörse kann nun jeder Interessierte seine Ideen einbringen oder sich freiwillig an den Projekten finanziell beteiligen. Übrigens: Wer sich finanziell beteiligt, bekommt eine Rechnung durch die ISN-Projekt GmbH und kann diese bei seinen Betriebsausgaben steuerlich geltend machen. Anzeigenkampagne Motiv drei, erschienen in den Zeitungen im Kreis Coesfeld Ein weiteres Projekt: Durch Deutschland fahren neuerdings LKWs mit großflächigem Aufkleber, der Werbung für die Tierhaltung macht. Genau wie in den Anzeigen, sollen provokative Sprüche zum Nachdenken anregen. Viele Schweinehalter aus ganz Deutschland haben bereits die Aktionen finanziell und ideell unterstützt. Bis Mitte Oktober wurden bereits Anteile für Öffentlichkeitsarbeit im Wert von rund gezeichnet. So konnten bereits einige interessante Projekte umgesetzt werden. WERBUNG IN ANZEIGEN, AUF LKWS UND PLAKATEN Rollende Blickfänge LKWs mit Werbung zur Tierhaltung beklebt Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 65
66 ISN Umgesetzt ist auch ein drittes Projekt in Schleswig- Holstein, bei dem Wahlwerbeflächen genutzt und nach der Bundestagswahl mit Motiven zur Tierhaltung beklebt wurden. UNTERRICHTSMATERIAL ERSTELLEN UNTERSTÜTZER AUF STATT-BAUERNOPFER.DE GESUCHT! Ein Schulklassenprojekt im Raum Cloppenburg, bei dem es darum geht, Schulklassen in Ställe zu holen, ist bereits finanziert und befindet sich in der Umsetzungsphase. Und ein weiteres Schulprojekt sucht finanzielle Unterstützung. So soll z. B. Unterrichtsmaterial zur Schweinehaltung erstellt werden das Besondere daran: Es wird ein»virtueller Schweinestall aufgebaut«, der auf sog. White Boards (interaktive Schultafeln, die mit Bildern, Kurzfilmen, Erläuterungen usw.) interaktiv von den Lehrern zusammen mit den Schülern erkundet werden kann. Hier geht es direkt zur Projektbörse: Tierhaltung über(k)lebt Wahlkampf Plakatwände weitergenutzt 66 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
67 German Genetic Dr. Jan Bielfeldt Zuchtleiter, German Genetic GERMAN PIETRAIN-EBER MIT GENOMISCH OPTIMIERTEN ZUCHTWERTEN Nach drei Jahren der intensiven Forschungs- und Entwicklungsarbeit wurde die genomisch optimierte Zuchtwertschätzung Mitte 2013 in den Routinebetrieb des German Piétrain-Zuchtprogramms überführt. Neben den Genom- Informationen von mehr als Piétrain-Ebern bilden mittlerweile mehr als Tierinformationen aus der Nachkommen prüfung von German Piétrain KB-Ebern aus dem Feld die Basis für ein Zuchtwertschätz modell, welches in Sachen Zuchtwertgenauigkeit und Zuchtwertqualität seines Gleichen sucht. GenomPlus Eber mit mehr als 130 Zuchtwertpunkten einer speziellen Ohrmarke gekennzeichnet. Neben der exakten Tierkennung wird auch Gewebe des Tieres in einer Spezialhülse einlagert. Ohrmarke mit Spezialhülse zur Gewebeeinlagerung Das Ziel des Verfahrens ist, zu einem möglichst frühen Zeitpunkt, möglichst kostengünstig möglichst genau Kenntnis über die genetische Leistungsveranlagung eines KB-Eberkandidaten zu erlangen. Anhand der vorgeschätzten Zuchtwerte entscheiden die Zuchtbetriebe im Alter von ca. 150 Tagen darüber, welche Jungeber mittels LD-Chip-Technologie genomisch typisiert werden. Nach 14 Tagen chemischer Analyse, eigentlicher Typisierung und Verrechnung von Genominformationen in der Zuchtwertschätzung zeigt sich dann, ob ein Jungeber mit dem Prädikat GenomPlus versehen wird. Diese Eber stellen die Leistungsspitze des Zuchtprogramms dar, d.h. sie verfügen über mehr als 130 Zuchtwertpunkte und sind genomisch typisiert. UMSETZUNG Um diese Ziele miteinander zu vereinen, werden in den 17 zertifizierten German Piétrain-Zuchtbetrieben, die am GOLD-Zuchtprogramm teilnehmen, alle Eberferkel mit SICHERERE ZUCHTWERTE DURCH IMPUTATION Herzstück ist eine Referenzgruppe von Ebervätern, die eine maximale Sicherheit in ihren Zuchtwerten Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 67
68 haben. Anhand dieser Datenbank werden dann die genomischen Informationen der Jungtiere abgeleitet und verglichen. Parallel wurde ein Imputierungsverfahren entwickelt. Durch die Imputierung werden sämtliche Informationen, die durch die Typisierung mit teuren HD-Chips gewonnen werden, für den Routinebetriebe, der mit Chips mit geringeren SNP-Zahlen durchgeführt wird, nutzbar gemacht. Durch den Einsatz der Imputierungstechnologie werden die Genauigkeit und die Aussagekraft der ermittelten Zuchtwerte weiter gesteigert. relevanten Parameter der Mastleistung, der Schlachtleistung sowie der Fleischqualität werden Naturalteilzuchtwerte als Zahl sowie als Balken abgebildet. Weiterhin wird die phänotypische Leistung der Basispopulation in der Zuchtwertschätzung als eine Art»Referenzgröße«hinzugefügt. Die neue Form der Darstellung ermöglicht es, den KB-Ebereinsatz so zu optimieren, dass ganz gezielt Einzeleber oder Eberpools für Wachstum, für Futterverwertung, für AutoFOM-Klassifizierung oder für Fleischqualität ausgewählt werden können. DATENAUSWEISUNG Um eine möglichst große Transparenz der erhobenen Leistungsinformationen sowie der errechneten Zuchtwerte herzustellen, wurde mit der Etablierung der genomisch optimierten Zuchtwertschätzung eine neue Form der Leistungsdarstellung entwickelt. Alle wesentlichen KB-Eberinformationen werden in einem Balkendiagramm dargestellt. Neben dem Gesamtzuchtwert wird die Sicherheit des Zuchtwertes angegeben, die bei GenomPlus-Ebern um bis zu 30 Prozent über dem Niveau von nicht typisierten Ebern liegt. Für alle ökonomisch FAZIT Das Zuchtverfahren der genomisch optimierten Zuchtwertschätzung wird im German Piétrain GOLD (Genomisch Optimierte LeistungsDichte) seit Sommer 2013 routinemäßig eingesetzt. Sämtliche KB-Eberkandidaten werden genomisch typisiert und nach strengen Leistungsvorgaben in das Segment der GenomPlus-Eber kategorisiert. Diese Eber verkörpern die Leistungsspitze der weltgrößten Piétrain-Reinzuchtpopulation. Mit Hilfe der neuen Leistungsdarstellung kann der Ferkelerzeuger gezielt den optimalen Eber für seinen Betrieb auswählen. LEISTUNGSDARSTELLUNG BEI GENOMPLUS-EBERN GZW: 141; R: 46 PROZENT NZW GENETISCHE STANDARDABWEICHUNG PHÄNOTYP. LEISTUNG DER BASIS PTZ FVW + 0,02 2,35 SKL - 0,05 95,50 La + 0,06 6,80 Schi + 0,14 17,70 Bauch % + 0,35 MFA + 0,25 66,00 Phlk + 0,13 6,27 TV + 0,63 3, Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
69 German Genetic / HAG Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 69
70 DLG / EPP Weltweit die Leitmesse für Tierhaltungs-Profis Inspirations for your business November 2014 Hannover inklusive Decentral 70 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
71 DLG / EPP Sven Häuser DLG / EPP ERTRAGSMAXIMIERUNG ODER KOSTENMINIMIERUNG AUF WELCHES PFERD SETZEN ERFOLGREICHE SCHWEINEMÄSTER? Rund 280 Ferkelerzeuger und Schweinemastbetriebe beteiligen sich regelmäßig an der Umfrage zum DLG-Forum Spitzenbetriebe. Auch Betriebe aus dem Erzeugerring Westfalen liefern jedes Jahr Daten, um sich mit Berufskollegen aus ganz Deutschland zu vergleichen. Aber was macht ein»spitzenbetrieb«anders als andere Betriebe? Gibt es in Deutschland einfach nur begünstigte Regionen oder liegt es in erster Linie an der»hardware«, wie z. B. der Genetik, dem Futter oder dem Aufstallungssystem? Welche Qualitäten sollten Mitarbeiter mitbringen und wie ist es um die Eigenschaften erfolgreicher Betriebsleiter bestellt? Wie viel investieren Spitzenbetriebe z. B. in Hygiene oder einen hohen Tiergesundheitsstatus und welche Beratungsleistungen nehmen diese Betriebe in Anspruch? Haben es Spitzenbetriebe leichter oder schwerer wenn es um die Akzeptanz in der Öffentlichkeit geht? Die Aufzählung relevanter Faktoren auf den Betriebserfolg lässt es bereits erahnen: Es ist von allem etwas und ein Patentrezept gibt es nicht. Fakt ist, dass das Sprichwort»Wer schreibt, der bleibt«eine zentrale Voraussetzung für erfolgreiche Betriebe ist. Dokumentieren + Analysieren + Vergleichen = Optimieren diese einfache Formel stellt das Grundprinzip von»benchmarking«dar und nach diesem Prinzip arbeitet das DLG- Forum Spitzenbetriebe seit nunmehr 13 Jahren. Jährlich wechselnde Schwerpunktthemen legen zudem einen Fokus auf aktuelle Fragestellungen. Für die Nutzung relevanter Kenndaten stehen neben den Buchhaltungsprogrammen für die ökonomischen Leistungen mittlerweile auch im Stall viele technische Möglichkeiten zur Verfügung. Ob Fütterungscomputer, vernetzte Tierwaage oder GPS in Verbindung mit einer detaillierten Schlachtauswertung können wir regelmäßig auf eine Reihe von Daten zugreifen, die uns einen Hinweis auf das Leistungsvermögen unserer Herde geben. Es gilt also, wichtige Kenngrößen zu filtern und dem Optimierungsprozess zuzuführen. VORBEUGEN IST BESSER ALS HEILEN 2012 nahmen 127 Schweinemastbetriebe an der Auswertung teil. Sie zeichnen sich durch hohe biologische Leistungen und sehr gute wirtschaftliche Ergebnisse aus, so dass sie innerhalb ihrer Region zu den besten 25 Prozent aller Betriebe zählen. Im Süden und Nordwesten liegt der Anteil an Betrieben, die ihre Mastläufer regional beziehen, bei 78 Prozent. Im Osten ist der Anteil mit 62 Prozent aufgrund der Importe größerer Stückzahlen aus Dänemark geringer. Allerdings stammen diese Ferkel zum überwiegenden Teil aus einem Lieferbetrieb, was zu einem monetären Vorteil bei den Behandlungskosten (1,47 Euro / Tier) führt. Dass die Spitzenbetriebe im Süden ihr Gesundheitsmanagement ebenfalls im Griff haben, zeigen die niedrigen Tierarztkosen von 0,99 Euro / Tier. Zum Vergleich: Der Schnitt der befragten Betriebe liegt bei 1,15 Euro / Tier. Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 71
72 Interessant scheint auch, dass die Tierarzt- und Medikamentenkosten der Spitzenmastbetriebe im Vergleich zum Vorjahr nicht gestiegen sind. Damit bestätigt sich eine Tendenz, die sich schon im Jahr zuvor andeutete: trotz Steigerung der biologischen Leistungen sind die Tierarztund Medikamentenkosten leicht zurückgegangen. Im Rahmen des DLG-Forums werden seit einigen Jahren auch ausgewählte Ergebnisse aus der Erzeugerring- Datenbank vorgestellt. In diese fließen die Daten von über 2000 Mastbetrieben aus dem ganzen Bundesgebiet ein. Diese breite Datenbasis bestätigt ebenfalls diesen Trend: Bezieht man die Ergebnisse der letzten Jahre in die Betrachtung mit ein dann fällt auf, dass neben einer kontinuierlichen Steigerung der biologischen Leistungen auch die Verluste tendenziell gesunken sind (Abbildung 1). Dieser Fakt zeigt, dass wirtschaftliche Zwänge aufgrund steigender Produktionskosten und internationalem Wettbewerb zwar einerseits zu höheren Leistungen in der Mast geführt haben. Gleichzeitig konnte aber auch eine Verbesserung der Tiergesundheit erzielt werden. Die Steigerung beim Gesundheitsstatus wurde aber nicht durch verstärkten Medikamenteneinsatz»erkauft«. Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Veterinärkosten bei den Mastbetrieben um 4,9 Prozent gesenkt werden, zum Jahr davor gar um 15 Prozent.»Vorbeugen ist besser als Heilen«diese Kernaussage steht auch über der Tiergesundheitsstrategie der EU, welche das Ziel verfolgt, die Tiergesundheit durch verstärkte Tierbeobachtung und Prävention zu verbessern. Letzten Endes dient auch ein konsequentes Hygienemanagement dazu, die sensiblen Exportmärkte zu erhalten bzw. auszubauen. POSITIVER TREND BEI DEN BIOLOGISCHEN LEISTUNGEN Seit Beginn des Forums im Jahr 2001 haben sich die biologischen Leistungsdaten in den befragten Betrieben stetig verbessert. Abbildung 1 macht deutlich, dass die Entwicklung der Futterverwertung (FVW) hier nicht mithalten konnte. So stiegen die Tageszunahmen in den letzten 10 Jahren um 9,5 Prozent, die FVW konnte lediglich um 3,2 Prozent verbessert werden. Dennoch: auch wenn bei steigenden Futterkosten schnellere Fortschritte bei der FVW wünschenswert wären, so hat doch bei der aktuellen ABBILDUNG 1: LEISTUNGSPARAMETER UND VERLUSTE BEI DEN DLG-SPITZENBETRIEBEN (MAST) Verluste (%) Tageszunahme (g) Futterverwertung kg pro kg Zuwachs ,89 2,89 2,92 2,89 2,9 2,86 2,9 2,84 2,82 2,82 2,80 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2,3 2,2 2,0 2,0 1, / / / / / / / / / / / Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
73 DLG / EPP ABBILDUNG 2: ÖKONOMISCHE KENNZAHLEN DER DLG-SPITZENBETRIEBE (NETTOWERTE) Kennzahlen ökonomischer Leistung (DkfL je 100 kg Zuw.) WJ 2011 / 2012 bzw. KJ 2011 DLG Forum Spitzenbetriebe + 25 % DLG Forum Spitzen-betriebe TOP 10 DLG Forum Spitzen-betriebe N = 127 N = 32 N = 10 Direktkosten / Zuwachstier ( ) 125,30 119,57 118,10 Futterkosten / Zuwachstier ( ) 60,70 55,98 55,10 DkfL je 100 kg Zuwachs ( ) 27,40 38,32 45,02 Futterverwertung (1 : ) 2,80 2,77 2,78 Tageszunahmen (g / Tier u Tag) TOP Tageszunahmen (g / Tier u Tag) Kostensituation die geringfügige Verbesserung der FVW unterm Strich einen höheren monetären Beitrag geleistet als die Steigerung der Tageszunahmen. Legt man für die ökonomische Einschätzung der Leistungssteigerungen die Bewertung der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen zu Grunde, hat die verbesserte FVW der vergangenen 10 Jahre den Spitzenbetrieben im Schnitt 2,18 Euro / Schwein gebracht, die höheren Tageszunahmen»lediglich«2,05 Euro / Schwein. Die wirtschaftlich erfolgreichsten Mäster unter den DLG- Spitzenbetrieben sind allerdings nicht immer führend bei den biologischen Leistungen. Sie erzielen zwar auch gute Mastergebnisse, diese liegen aber im Vergleich eher im Mittelfeld der Betriebe (siehe Abbildung 2). Die zehn besten Betriebe sortiert nach Tageszunahmen erreichen mit 946 g ein deutlich höheres Niveau. Die wirtschaftlich erfolgreichsten Mäster zeichnen sich dagegen durch höhere Verkaufserlöse und geringere Direktkosten aus. Managementfähigkeiten wie eine marktangepasste, optimale Sortierung kommen ebenso zum Tragen wie Einsparungen bei den Futterkosten auch z. B. durch eine bessere FVW. Diese Konstellation lässt sich seit Beginn der Datenerfassung beobachten und ist ein Beleg dafür, dass jeder Betriebsleiter noch Stellschrauben zur Verfügung hat, um die Schweinemast weiter zu optimieren. Das Thema Ebermast ist bei den befragten Betrieben (noch) kein großes Thema. Lediglich 6 Prozent mästeten 2012 auch unkastrierte Ferkel, was keine Veränderung zum Vorjahr darstellt. Die Spitzenbetriebe verhalten sich also abwartend und haben sich nicht der»euphoriewelle«angeschlossen. Meldungen über Vermarktungsschwierigkeiten und die ungeklärten Fragen im Bezug auf die»elektronische Nase«bestätigen diese Strategie. Die Betriebsleiter warten ab bis mehr Klarheit herrscht. Die Mast in Großgruppen > 20 Tiere scheint hingegen immer beliebter zu werden. Über die letzten Jahre hat der Anteil dieses Haltungssystem in den befragten Betrieben stetig zugenommen und lag 2012 bei 38 Prozent. Arbeitswirtschaftliche Vorteile und ein geringerer Anteil an Baukosten / Platz sprechen für die Großgruppe. Allerdings zeigen die Auswertungen in der Kleingruppenhaltung einen leichten Vorteil bei den Tageszunahmen (+ 7 g) und den Futterkosten ( 2,83 Euro / Tier). Damit sich Betriebe in Deutschland aber auch nachhaltig entwickeln können, gehören neben produktionstechnischem und ökonomischem know how mittlerweile noch weitere Managementfähigkeiten zu den Eigenschaften erfolgreicher Betriebsleiter. Über 40 Prozent der DLG- Spitzenbetriebe betreiben regelmäßig Öffentlichkeitsarbeit in Ihrer Region, überwiegend in Form offener Hoftage, Empfang von Schulklassen und Kindergärten, Leserbriefen oder kommunalpolitische Tätigkeiten. Kommunikation zur Schaffung und Festigung einer breiten, gesellschaftlichen Akzeptanz hat für die befragten Betriebsleiter einen hohen Stellenwert vor allem, wenn die Betriebe sich in der Region weiter entwickeln möchten.»tue Gutes und rede darüber«es gilt vor allem, den zweiten Imperativ dieses Sprichwortes»zu leben«. Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 73
74 DLG / EPP STELLSCHRAUBE EFFIZIENZ Die Umfragen zum Forum machen deutlich, dass zukunftsfähige Betriebe in Deutschland neben einem hohen Gesundheits- und Leistungsniveau auch die Produktionskosten im Blick haben. Ein optimiertes Fütterungsmanagement erhöht die Futtereffizienz und führt letztendlich zu niedrigeren Kosten. Ob über die Verminderung von Futterverlusten oder verbesserte Hygienemaßnahmen in der Futterkette, den Einsatz einer Mehrphasenfütterung oder verbesserte Fütterungsstrategien Spitzenbetriebe suchen und finden immer noch Stellschrauben, mit denen die Produktion weiter verbessert werden kann. Die Zukunftsfähigkeit hängt aber auch zunehmend davon ab, wie die Produktionsverfahren unter Tier- und Umweltschutzgesichtspunkten optimiert werden können. Großen Forschungsbedarf sehen die Teilnehmer des DLG-Forums z. B. noch beim Thema Schwänze kupieren. Ein kleiner Teil der befragten Betriebe hat zumindest probeweise auf das Kupieren der Schwanzspitzen verzichtet, gab aber in der Befragung überwiegend negative Erfahrungen an. Neben dem Tierschutz kommt auch dem Umweltschutz eine wichtige Bedeutung zu. Der Einsatz von nährstoffreduziertem Futter oder eine emissionsarme Gülleausbringtechnik gehören bei den Spitzenbetrieben mittlerweile zum Stand der Technik. Je nach Standort werden darüber hinaus Abluftreinigungsanlagen gefordert, für die es unterschiedliche Anforderungen gibt. Diverse Ländererlasse lassen erahnen, dass diese Techniken zukünftig immer häufiger gefordert werden. FAZIT Die Anforderungen somit auch die Kosten steigen, dementsprechend effizienter muss die Schweineproduktion werden. Ökonomisch angemessen, ökologisch vertretbar unter besonderer Berücksichtigung der Tiergesundheit und des Tierschutzes sozial ausgewogen und im gesellschaftlichen Konsens so könnte man eine nachhaltige Schweineproduktion zusammenfassen. Damit sich dieses Wunschdenken auch im internationalen Wettbewerb durchsetzen kann, sind europäische Lösungen gefragt. Spitzenbetriebe in Deutschland setzen viele Anforderungen bereits um und haben ihre landwirtschaftlichen Unternehmen somit zukunftsfähig aufgestellt. Letzten Endes wird wie immer der Markt entscheiden, welche Schwerpunkte sich durchsetzen. 74 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
75 Menno Chemie TÄ Renate Baur Menno Chemie, Lieferant von Neopredinol FERKEL WASCHEN MIT MENNO TIERWASCHMITTEL In vielen Betrieben nimmt die Keimbelastung bei unseren Tieren immer mehr zu. Sowohl in der Ferkelerzeugung als auch in der Ferkelaufzucht und Mast. In der Ferkelaufzucht wird die Belastung durch Streptokokken und Staphylokokken (Haut, Tonsillen, Lunge, Gelenken) durch die Einstallung aus vielen Herkünften, Stresssituationen, wie Transport, Futterwechsel und Absetzen von der Mutter deutlich verstärkt, das Immunsystem wird geschwächt und die Vermehrung der besagten Erreger nimmt zu. Da ich als Tierärztin viele Ferkelerzeuger und Aufzuchtbetriebe betreue, beobachtete ich die Vermehrung und Belastung mit diesen Erregern seit längerer Zeit. Eine Behandlung mit Amoxicillin in der Aufzucht reichte in der Regel nicht mehr aus, immer häufiger mussten Streptokokkenarthritis- und meningitis, Staphylokokkus hyicus (Ferkelruß) mehrfach behandelt werden mit nur mäßigem Ergebnis, die Behandlung bringt die Infektion kurz zum Stillstand, aber oft war die Infektion nach einer Woche schon wieder am Aufkeimen und musste erneut behandelt werden. Deshalb wurde ein Gespräch mit der VZ, Herrn Götz vereinbart, an dem auch die Firma MENNO zugegen war. Es wurde auf mein Anraten hin besprochen, dass ein Versuch mit»neopredinol«(tierwaschmittel von MENNO CHEMIE) unternommen wurde, bei dem die Ferkel beim Einstallen mit diesem Mittel abgewaschen wurden. Im ersten Betrieb, Aufzuchtbetrieb mit 2200 Aufzuchtferkeln, war natürlich anfangs eine deutliche Skepsis zu spüren, der Betriebsleiter hat sich aber trotzdem bereit erklärt und wir haben die Ferkel beim Abladen im Stallgang gewaschen. Es war sehr erfreulich, dass keinerlei Reaktionen an den Augenbindehäuten zu sehen waren, die Tiere hatten auch keine geröteten Augen. Auch schienen die Tiere sich nach dem ersten anfänglichen Schreck sehr wohl zu fühlen, es gab keine Anzeichen einer deutlichen Fluchtreaktion. Der Zeitaufwand der Waschung ist gering und während des Abladens gut durchführbar. Bis die nächsten Ferkel vom Hänger geladen wurden, war die Gruppe im Stall schon gewaschen Nach dem Waschen wurden die Tiere alle 3 Tage kontrolliert, die Haut blieb relativ lange sehr sauber und auch die Belastung mit Staphylokokkeninfektion (Ferkelruß) blieb komplett aus. In diesem Durchgang war auch kein Aufkeimen von Streptokokkenmeningitis zu sehen. Arthritis ist in diesem Betrieb eher die Ausnahme. Aufgrund dieser ersten Erfahrungen wurden im Laufe der nächsten 4-5 Monate ca Ferkel bei der VZ beim Einstallen gewaschen. Davon machen meine Betriebe ca Tiere aus. In allen Fällen hat sich die hygienische Tierwaschung als sehr nützlich herauskristallisiert, der Streptokokkeninfektionsdruck ist deutlich gesunken, die Fälle von Meningitis sind um ca. 50 Prozent zurückgegangen und Staphylokokken hyicus Infektion ist seitdem nur noch in einem einzigen von (wie vielen) Betrieb aufgetreten. Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 75
76 Menno Chemie Versuchsweise wurde die Waschung auch erst nach 4 Tagen vorgenommen, um die Beobachtung zu überprüfen, wenn die Tiere mit offenen Wunden, aufgrund von Beißereien während der Rangkämpfe an der Haut schon verletzt sind. Meiner Erkenntnis nach ist die Abheilung dieser offenen Wunden durch die hygienische Tierwaschung mit»neopredinol«noch rascher vonstatten gegangen. Auch diese Variante, sprich erst im Stall nach einigen Tagen zu waschen, ist zu empfehlen. die Handhabung mit einer geeigneten Spritze für den Wasserschlauch ( z. B. MENNO Schaumspritze) durch die genau 2 Prozent des Waschmittels eingezogen wird, sehr einfach ist. der Zeitaufwand gering ist und während des Abladens gut durchgeführt werden kann. Bis die nächsten Ferkel vom Hänger geladen wurden, war die Gruppe im Stall schon gewaschen. wichtig ist das sehr enge Zusammenstallen der Tiere beim Waschen, damit sich die Ferkel den gebildeten Schaum des»neopredinol«gegenseitig richtig einmassieren. Jetzt im Winter waschen wir die Tiere erst ca. 3 4 Tage nach dem Einstallen, wenn der Stall auf 30 Grad Celsius aufgeheizt ist, was natürlich einen Mehraufwand an Arbeit bedeutet, trotzdem sind viele Landwirte dazu bereit. Im Ferkelerzeugerbetrieb wird das Mittel zum Einstallen in den Abferkelstall eingesetzt, indem die Sauen damit abgewaschen werden, als auch teilweise zum Abwaschen des Gesäuges bei MMA zur Kühlung und Keimreduktion. Nach dem Waschen wurden die Tiere alle drei Tage kontrolliert, die Haut blieb relativ lange sehr sauber und auch die Belastung mit Staphylokokkeninfektion (Ferkelruß) blieb komplett aus ZUSAMMENFASSEND IST ZU SAGEN, DASS: die Tiere die Waschung sehr gut vertragen haben und nach einer Stunde bereits wieder vollständig trocken waren keine Reizung der Augenbindehäute entsteht die Abheilung offener Wunden durch Beißereien sich positiv erweist und die Waschung die Egalisierung des Hygienestatus verschiedener Herkünfte fördert. die Streptokokkeninfektionen ( Meningitis, Arthritis) um ca Prozent gesenkt werden konnte die Häufigkeit der Staphylokokkus hyicus Infektion (Ferkelruß) um ca. 90 Prozent abgenommen hat. sich auf dem Boden ein Schaum bildet, in dem die Ferkel dann während des Waschens stehen, dadurch werden auch die Klauen wie in einer Art»Klauenbad«gereinigt, was sich positiv auf die Klauengesundheit auswirkt. der Antibiotikaeinsatz von Amoxicillin um ca. 50 Prozent gesenkt wurde. In Zeiten, in denen der Antibiotikaeinsatz und unser Dispensierrecht heftig diskutiert werden, sollten auch wir Tierärzte jede Gelegenheit wahrnehmen, den Antibiotikaeinsatz auf unseren Betrieben zu reduzieren. Damit erreichen wir langfristig, dass unsere Betriebe leistungsstark und dem Ausland gegenüber konkurrenzfähig bleiben. ANWENDUNG: NEOPREDINOL 2 Prozent (Tierwaschmittel von MENNO CHEMIE) vorgemischt mit Skumix direkt Ferkel eingeschäumt. Oder der MENNO Schaumspritze über das Venturi-Prinzip genügend Wasserdruck vorausgesetzt. AUFWANDMENGE: 2000 Ferkel 360 Liter Gebrauchslösung 2 Prozent KOSTEN: ca. 0,035 / Ferkel Renate Baur Praktische Tierärztin Alte Str Ulm Tel: 0731 / Mobil: 0173 / Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
77 Topigs-SNW ES KANN NUR EINE GEBEN DIE MUTTER DER NATION DIE JUNGSAUEN AUS DEM NEUEN TOPIGS + PROGRAMM WIR HABEN, WAS ALLE WOLLEN. Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 77
78 Anne Christin Niggeloh Topigs-SNW GmbH AUF ERFOLGSSPUR MIT DER EBERMAST Gerade für geschlossene Betriebe kann die Ebermast eine interessante Alternative zur Börgemast darstellen. Ein Praxisbeispiel verdeutlicht die Vor- und Nachteile. Auf dem Betrieb von Rainer Hartmann in Hampenhausen werden im geschlossen System TOPIGS 20 Sauen gehalten. Der Betrieb mit 250 Sauen und 2000 Mastplätzen wird von Rainer Hartmann und seinem Schwiegersohn, Michael Niemann geleitet. Gemeinsam hat man sich auf dem Betrieb Hartmann für das TOPIGS Eigenremontierungsprogramm InGene entschieden und so findet nicht nur die Mast der eigenen Ferkel auf dem Betrieb statt, sondern auch die Produktion eigener Jungsauen. Aus Sicht des Gesundheitsmanagements ist dies besonders reizvoll, kommen doch keine fremden Tiere in den eigenen Bestand. Im Jahr 2011 sah Familie Hartmann eine gute Chance in der Ebermast. War es zunächst nur ein Versuch die männlichen Tiere als Eber aufzuziehen und nicht mehr zu kastrieren, so entpuppte sich dieser schnell als Erfolg. Kurze Zeit nach den ersten Versuchsgruppen wurde auf dem Betrieb Hartmann gar nicht mehr kastriert.»einerseits kommt uns die Arbeitszeiteinsparung, die durch den Wegfall des Kastrierens entsteht sehr entgegen, andererseits sehen wir auch hygienische Vorteile. Seitdem wir nicht mehr kastrieren, haben wir weniger Last mit Streptokokken. Gerade im Flatdeck macht sich das sehr stark bemerkbar«, so Rainer Hartmann. Direkt nach dem Absetzen werden die Tiere nach Geschlechtern getrennt und werden so schon in der Aufzucht getrennt aufgestallt. Aus technischen Gründen ist es weder im Aufzuchtstall, noch im Maststall möglich, unterschiedliche Futtermischungen für die weiblichen und die männlichen Tiere anzubieten. Aus diesem Grund entschied man sich die Futterration auf die Eber abzustimmen, mit der nun auch die weiblichen Tiere gefüttert werden. Gemästet werden die Tiere in verschiedenen Mastställen mit unterschiedlichen technischen Voraussetzungen in Hinsicht auf Aufstallung und Fütterungssystem. So findet man in den älteren Ställen Kleingruppen mit jeweils 11 Tieren am Breiautomaten und in einem 2010 neu erbauten Stall Gruppen mit 12 Tieren am Sensortrog.»Wir können allerdings keine großen Unterschiede feststellen, weder in den Mastleistungen noch bei den Schlachtleistungen«, berichtet Rainer Hartmann.»Auch in Punkto Unruhe gibt es bei den unterschiedlichen Fütterungssystemen keine Unterschiede. Generell kann man schon sagen, dass Eber unruhiger sind als Kastrate, da sie immer mal wieder Aufspringen und sich auch generell mehr bewegen. Doch die Verluste sind durch die Ebermast im Vergleich zu der Börgemast nicht gestiegen. Sowohl mit Penisbeißen als auch mit vermehrtem Schwanzbeißen haben wir bei uns in den Ställen keine Probleme. Den Ebern muss allerdings genug Platz gegeben werden, damit sie die Möglichkeit haben miteinander zu spielen, aufzuspringen und sich zu bewegen. Haben sie diesen Platz nicht, so kann man beobachten, dass Agressionen und Beißereien sich häufen.«fügt Michael DURCHSCHNITTLICHE SCHLACHT- ERGEBNISSE EBER UND SAUEN DES BETRIEBES HARTMANN IM VER- GLEICH (CA TIERE VON MAI BIS JULI 2013) Eber Sauen SL-kg 95,44 93,43 Schinken kg 18,92 18,735 Lachs kg 7,47 7,45 Schulter kg 9,25 8,98 Bauch kg 13,31 13,13 Bauch MFL in % 60,39 60,19 IXP / kg 1,018 1, Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
79 Topigs-SNW FUTTERRATIONEN MAST AUF DEM BETRIEB HARTMANN NÄHRSTOFF EINHEIT GEHALT IN VORMAST KG GEHALT IN MITTELMAST KG GEHALT IN ENDMAST > 80 KG ME-Schwein MJ 12,85 13,01 12,95 Rohprotein % 17,36 17,41 16,23 Lysin % 1,21 1,13 1,05 Lysin / MJ ME- S g 0,94 0,87 0,81 Calcium % 0,79 0,74 0,74 Phosphor % 0,46 0,45 0,44 Natrium % 0,38 0,35 0,35 Vitamin A IE Vitamin D IE Vitamin E mg Niemann hinzu. Generell ist es so, dass Jungeber sehr ungeduldig und aggressiv werden, wenn sie Hunger haben. Daher sollten Eber adlibitum gefüttert werden. Die Fütterungssysteme, die ständig frisches Futter nachliefern, wie Breiautomaten und Sensor- Flüssigfütterung, beides auf dem Betrieb Hartmann vorhanden, sind für die Ebermast bestens geeignet.»nach Möglichkeit stallt man die Eber so auf, dass das»futtersignal«bei diesen Tieren zuerst ertönt, denn wenn sie warten müssen, werden diese Tiere sehr unruhig. Ihre Aktivität hält auch länger an als bei den weiblichen Schweinen, die geduldiger sind und darum auch nach den Jungebern gefüttert werden können«, so Georg Freisfeld vom Erzeugerring Westfalen bei dem gemeinsamen Ebermastworkshop von TOPIGS -SNW, Viehhandlung Venneker und dem Erzeugerring Westfalen auf dem Hof Hartmann im Juli diesen Jahres. Die sehr guten Mast- und Schlachtleistungen liegen, neben der Genetik, aber auch in der angepassten Futterzusammensetzung begründet. Beim Anfangsmastfutter wurde das g Lysin je MJ ME um ca. 9 Prozent erhöht und im Endmastfutter um ca. 11 Prozent.»Mit der verbesserten Proteinqualität stiegen die Tageszunahmen der Eber um 50g an und auch die Futterverwertung wurde dadurch merklich verbessert.»da lohnt es sich schon ein hochwertigeres Futter einzusetzen.«berichtet Michael Niemann.»Man kann sagen, dass die Eber im Schnitt höhere Tageszunahmen schaffen als ihre weiblichen Geschwister, aber das war auch schon so, bevor wir das Futter umgestellt haben«, so Niemann weiter.»bedingt durch eine höhere Konzentration an Sexualhormonen fressen Eber im Vergleich zu Börgen Prozent weniger Futter am Tag und setzen weniger Fett- und mehr Muskelmasse an. Somit ist die Futterverwertung der Jungeber deutlich besser als bei den Kastraten. Durch die geringe Futteraufnahme besteht jedoch die Gefahr einer Spurenelementund Vitamin-Unterversorgung. Besonders die Vitamin E und Selenversorgung sollte man im Auge haben. Hier ist es ratsam, im Futter immer die Höchstwerte aus den offiziellen Fütterungsempfehlungen anzustreben«, berichtete Georg Freisfeld. Des Weiteren führt er fort:»eber neigen selbst in der Endmast nicht zum verfetten. So können die Eber während der kompletten Mastperiode adlibitum gefüttert werden. Zum Ende der Mast werden alle Tiere gewogen um Sortierungsverluste einzugrenzen. Die Eber werden mit durchschnittlich 124 kg vermarktet und bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück geschlachtet. Mit den Schlachtleistungen ihrer Tiere zeigen sich Rainer Hartmann und Michael Niemann sehr zufrieden. Unkompliziert bis zur Schlachtung gebracht erzielen sowohl die weiblichen, als auch die männlichen Schlachttiere sehr gute Ergebnisse, auch wenn durchaus Unterschiede zwischen den Geschlechtern erkennbar sind. So ist zum Beispiel die Ausschlachtung der weiblichen Tiere etwas höher. Das liegt daran, dass bei den Ebern Hoden und Nebenhoden entfernt werden und die Harnblase bei Ebern nie ganz leer ist. Dadurch kommen Gewichtsverluste zustande, die sich auf die Ausschlachtung auswirken. Eber punkten dagegen mit im Schnitt 2-4mm weniger Rückenspeck, womit sie vor allem die Börge hinter sich lassen.»wir sind sehr zufrieden mit unserer Entscheidung Eber zu mästen«so das abschließende Resümee von Rainer Hartmann und Michael Niemann. Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 79
80 Jacqueline Weiser Landwirtschaftsverlag Münster, SUS PLÄTZE AUF DER GRÜNEN WIESE Helmut Mühlenbäumer hat die Ferkelaufzucht in zwei Schritten ausgelagert. Das moderne Stallkonzept und das strikte Management sind sein Erfolgsgarant. Wer in der Ferkelaufzucht Spitzenleistungen anstrebt, muss den Tieren optimale Wachstumsbedingungen bieten.»wir achten daher insbesondere darauf, dass im Flatdeck keine Kapazitätsengpässe auftreten«, betont Helmut Mühlenbäumer. Der 45 Jahre alte Landwirt hält im westfälischen Dülmen 280 Sauen. Zusammen mit seinem Vater und einer Halbtagskraft setzt er pro Woche etwa 150 Ferkel ab. STALLBAU IN ZWEI ABSCHNITTEN Vor sechs Jahren hat Mühlenbäumer den ersten Schritt für die Auslagerung seiner Ferkelaufzucht an einen externen Standort vollzogen.»auf dem Stammbetrieb war keine Erweiterung mehr möglich. Außerdem bietet die Trennung von Sauen und Ferkeln gesundheitliche Vorteile«, erläutert der Praktiker. Der erste Bauschritt umfasste 600 Aufzuchtplätze. Wobei sich der Landwirt wegen der besseren Kostenplanung für ein Fertigstallkonzept entschieden hat. Im vergangenen Jahr wurde der Stall dann um 600 Plätze vergrößert. Dies war auch notwendig, weil der Ferkelerzeuger mit dem Umstieg auf eine andere Sauengenetik (AB-Youna) die Fruchtbarkeit verbessert hat. Zudem waren die Aufzuchtkapazitäten im Stammbetrieb stark in die Jahre gekommen. Bereits bei der Planung des neuen Aufzuchtstalls hat der Landwirt darauf geachtet, dass die Tiere optimale Haltungsbedingungen vorfinden. So hat sich der Praktiker trotz der etwas höheren Baukosten bewusst für kleine Buchten mit je 20 bis 25 Tieren entschieden. Jedes der acht Abteile für je 150 Ferkel umfasst somit sechs Buchten.»Der Vorteil der kleinen Buchten ist, dass man die Ferkel besser sortieren kann. Hiervon profitieren besonders die kleinen Ferkel, da sie weniger am Trog weggedrängt werden«, erklärt Berater Heinz-Wilhelm Hagedorn vom Erzeugerring Westfalen. Wichtig ist dem Praktiker zudem ein optimales Stallklima. Trotz des etwas höheren baulichen Aufwandes hat er sich deshalb für eine Lüftung mit Unterflurabsaugung entschieden. Sie sorgt dafür, dass die warme Luft besonders gut zu den Ferkeln gelangt. Außerdem ist der Schadgasgehalt im Tierbereich geringer. Für das Beheizen des Stalls nutzt der Betrieb einfache Gaskanonen. Zusätzlich hat Helmut Mühlenbäumer einen Wärmetauscher eingebaut. Hierdurch kann er etwa 30 Prozent Gas einsparen. 80 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
81 SUS Das Herzstück des Aufzuchtstalls ist die Förster-Flüssigfütterung, die besonders für Absetzferkel geeignet ist. Denn hiermit kann der Landwirt auch besonders kleine Futtermengen für jeden Trog separat anmischen. Alle Ferkel erhalten zunächst als Begrüßungsfutter einen hochwertigen Prestarter. Bei den schwereren Ferkeln wird dieser ab dem zehnten Tag für eine Woche mit dem Ferkelfutter I verschnitten. Ab einem Gewicht von 26 kg wird dieses dann über elf Tage mit dem Vormastfutter verschnitten. Dieses erhalten die Tiere bis zum Ausstallgewicht von ca. 32 kg. Auch über die Güllelagerung hat sich der Bauherr intensiv Gedanken gemacht. Nach jedem Durchgang wird die Gülle abgelassen und direkt ins Güllesilo gepumpt. Das senkt den Keimdruck und mindert den Fliegenbefall. Unter dem Strich hat der Landwirt beim zweiten Bauabschnitt rund 250 pro Ferkelplatz investiert. Der erste Bauabschnitt war teurer, weil zusätzliche Kosten für die Erschließung des Baugrundstücks zu tragen waren. AUSGEFEILTES FUTTERKONZEPT Neben dem Baukonzept hat der Ferkelerzeuger auch das Management im Stall optimiert. Um die mit 24 Tagen abgesetzten Ferkel schnell und stressfrei in den neuen Aufzuchtstall zu bringen, nutzt der Betrieb eine Transportkiste für den Anbau am Schlepper. Die im Schnitt 8 kg schweren Ferkel werden zunächst alle in den beiden mittleren Buchten des Abteils aufgestallt. Dann sortiert der Landwirt die 50 kleinsten Ferkel in die beiden hinteren Buchten. Hier können sie separat gefüttert werden. Die übrigen Ferkel werden auf die anderen Buchten verteilt. Bei Bedarf legt der Landwirt eine weitere Untergruppe mit kleineren Ferkeln an. Bei den kleinen Ferkeln achtet der Landwirt besonders darauf, dass der Verdauungstrakt der Tiere nicht überlastet wird. Daher erhalten sie das Begrüßungsfutter fünf Tage länger. Außerdem ist die Verschnittzeit mit dem Ferkelfutter I mit zehn Tagen länger angelegt. Als weitere Optimierung erhalten die kleineren Ferkel das hochwertige Ferkelfutter I bis zum Aufzuchtende.»Durch diese Maßnahme können die kleineren Ferkel zumindest einen Teil des Gewichtsrückstands aufholen«, unterstreicht Berater Hagedorn. Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 81
82 SUS FERKELKUNDEN SIND ZUFRIEDEN Ein weiterer Erfolgsfaktor ist das Verkaufsmanagement. Beim Ausstallen sortiert der Landwirt alle untergewichtigen Tiere ins Resteabteil. Außerdem werden alle Problemtiere in den angepachteten Maststall umgestallt. Reklamationen gibt es daher so gut wie nie. Als zusätzlichen Service sortiert der Landwirt die verkaufsfähigen Ferkel bereits beim Verladen. So wird jede Verkaufspartie in drei Gewichtsgruppen getrennt auf dem Lkw des Vermarkters untergebracht.»ich liefere nur erste Sahne. Das sichert mir auch in schwierigen Marktphasen einen sicheren Absatz«, betont der Ferkelerzeuger. FAZIT Als Vorteil seines Fütterungssystems sieht der Betrieb auch die bessere Hygiene. Denn die Futterleitungen und Ablaufrohre werden nach jeder Mahlzeit mit Wasser gespült. Auch bei der Wasserversorgung achtet der Ferkelerzeuger ganz besonders auf die Hygiene. So wird vor jedem Einstallen der Ferkel das Wasser aus den Leitungen abgelassen. Außerdem ist das Tränkesystem als Ringleitung angelegt, so dass sich keine Keime bilden können. Zusätzlichen versetzt der Landwirt sowohl das Futter- als auch das Tränkewasser mit Chlordioxid. Helmut Mühlenbäumer hat seine Ferkelaufzucht in zwei Schritten ausgelagert. Das hat die Tiergesundheit deutlich stabilisiert. Herzstück des neuen Stalls ist die Flüssigfütterung, die auch sehr kleine Futtermengen für jeden Trog separat anmischen kann. Die Wasserversorgung und das Klimamanagement sorgen dafür, dass die Ferkel von Beginn an optimal durchstarten. Das bringt dem Landwirt gleichmäßige, gesunde Ferkelpartien, die auch in schwierigen Marktphasen gefragt sind. Damit die Tiere möglichst viel Wasser aufnehmen, hat der Landwirt in jeder Bucht vier Tränkenippel in unterschiedlichen Höhen installiert. Um die Wasseraufnahme noch weiter zu unterstützen, erhalten die Tiere in den ersten vier Tagen dreimal täglich Wasser in einer Tränkeschale.»Wir versetzen das Wasser mit Elektrolyten. Das liefert zusätzliche Mineralstoffe und erhöht die Schmackhaftigkeit«, schildert der Betriebsleiter. Der hohe Aufwand macht sich bezahlt. So liegen die Tageszunahmen mit 453 g und die Futterverwertung mit 1:1,79 auf hohem Niveau. Außerdem ist die Verlustquote bei den Mykoplasmen- und Circo-geimpften Ferkeln mit 1,8 Prozent sehr gering. Die stabile Tiergesundheit führt der Betriebsleiter auch darauf zurück, dass er die Ferkel jetzt abseits der Sauen großzieht. 82 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
83 MSD E. coli C. perfringens SAUGFERKEL- DURCHFALL WEGSPÜLEN IN EINEM FLUSS Moderner Impfschutz in funktionaler Form Dosisvolumen von 2 ml Flexibles Impfschema Zuverlässige Immunitätsausbildung NEU! Sprechen Sie mit Ihrer Tierärztin /Ihrem Tierarzt über den neuen Impfstoff von Intervet*. * Intervet Deutschland GmbH ein Unternehmen der MSD Tiergesundheit Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 83
84 Dr. Hans-Peter Knöppel Intervet Deutschland GmbH, ein Unternehmen der MSD Tiergesundheit ZUKUNFTSWEISENDE IMPFTECHNOLOGIE JETZT AUCH ZUR PRÄVENTION DER ENZOOTISCHEN PNEUMONIE (FERKELGRIPPE) EINSETZBAR Die Enzootische Pneumonie, auch als Ferkelgrippe bekannt, verursacht jährlich wirtschaftliche Schäden in Millionenhöhe. Die Krankheit wird von dem Erreger Mycoplasma hyopneumoniae hervorgerufen. Kennzeichnend für die Enzootische Pneumonie sind hohe Erkrankungsraten vor allem bei Mastschweinen, ein milder aber chronischer Verlauf mit trockenem Husten als Leitsymptom und verringerte Tageszunahmen sowie eine schlechtere Futterverwertung. Häufig wird die Enzootische Pneumonie durch zusätzliche Infektionen mit anderen viralen und bakteriellen Erregern verkompliziert. Es kann dann zu schweren Krankheitsverläufen kommen. Neben hygienischen und haltungstechnischen Maßnahmen spielen Impfungen heutzutage eine der bedeutendsten Rollen zur Verringerung der wirtschaftlichen Verluste durch Mycoplasma hyopneumoniae in der Schweinehaltung. IDAL, DER VAKZINATOR FÜR DIE NADELLOSE INTRADERMALE APPLIKATION, BEWÄHRT SICH In der modernen Schweinehaltung werden spezialisierte Bestände bewirtschaftet. Sie benötigen Systeme und Methoden, mit denen sie den Gesundheitsstatus ihrer Tiere schnell und sicher überwachen und erhalten können. Die intradermale nadellose Impfung vermeidet die Erregerübertragung von Tier zu Tier als auch eine Abszessbildung an der Impfstelle und sorgt so zusätzlich für die Gesunderhaltung des Bestandes und trägt somit zur verbesserten Lebensmittelsicherheit bei. Eine hohe Flexibilität bei der Auswahl der Impfstelle vereinfacht und beschleunigt den Impfvorgang erheblich und spart kostbare Zeit. Der IDAL-Vakzinator Gegenüber anderen nadellosen Systemen zeichnet sich der IDAL-Vakzinator (Intradermal Applikation of Liquids) dadurch aus, dass ausschließlich intradermal geimpft werden kann bei gleichbleibendem Injektionsdruck 84 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
85 MSD Vakzinator deutlich ruhiger sind als beispielsweise nach intramuskulärer Impfung. Somit trägt diese neue Impftechnologie zur Verbesserung des Tierwohls bei. STÄRKUNG DER ZELLULÄREN ABWEHRKRAFT Die Haut des Schweins stellt nicht nur eine schützende Hülle dar, sie spielt auch eine entscheidende Rolle als immunologischer Schutzmechanismus des jeweiligen Tieres. Sie ist das größte Immunorgan des Körpers und eignet sich deshalb sehr gut zur Verabreichung von Impfstoffen. Während die Bildung von Antikörpern bei intradermaler und intramuskulärer Impfung vergleichbar gut war, zeigte eine Studie, dass nach intradermaler Impfung, die zelluläre Immunantwort verstärkt ausfiel. 1 Ein weiterer Vorteil dieser Applikationsform ist, dass hierbei Ferkel bereits ab einem Alter von zwei Wochen erfolgreich immunisiert werden können, ohne in Interferenz mit maternalen Antikörper zu kommen. 2 Mehr Informationen über den neuen Impfstoff gegen die Enzootische Pneumonie und den IDAL-Vakzinator von Intervet Deutschland GmbH, einem Unternehmen der MSD Tiergesundheit, erhalten Betriebe von ihrem Tierarzt oder ihrer Tierärztin. Ferkelimpfung mit IDAL Zulassungsgerechte Impfung einer Sau mit IDAL und fest eingestelltem Dosisvolumen von 0,2 ml. Häufige Fehler, die durch die Möglichkeit der Umstellung auf andere Injektionsarten, wie beispielsweise intramuskulär oder subkutan, und damit verbundener Einstellung variabler Dosisvolumen entstehen können, werden auf diese Weise vermieden. Zudem hat sich gezeigt, dass die Tiere während und nach der Impfung mit dem IDAL- 1 Martelli P et al. Efficacy of a modified live porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) vaccine in pigs naturally exposed to a heterologous European (Italian cluster) field strain: Clinical protection and cell-mediated immunity. Vaccine 2009;27: Nechvatalova K. Possibilities of overcoming the inhibitory effect of colostrum-derived antibodies using intradermal immunization and immunization via mucosae. Proceedings IPVS CONGRESS 2010, Vancouver, Kanada Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 85
86 Dörthe Brandhoff, Sandra Boers GFS BRONZE, SILBER, GOLD UND PLATIN TRANSPARENT, FAIR, LEISTUNGSGERECHT! Nach 23 Jahren gehört die Top Genetik Einstufung Nachkommen geprüfter Eber zur Geschichte der GFS. Seit Februar 2013 gibt es die neuen GFS Leistungsklassen für Bronze, Silber, Gold und Platin. Diese stärkere Differenzierung der Nachkommen geprüften Eber ermöglicht es, den Wünschen der Ferkelerzeuger bzw. den Qualitätsanforderungen der Mäster besser gerecht zu werden. ten Vererber sind unsere Platin Eber. Die darunterliegenden 24 Prozent werden in Gold eingestuft. Die nächsten 13 Prozent erhalten die Silberplakette. Die Bronze-Einstufung wird bei den verbliebenen 17 Prozent vorgenommen (Abbildung 1). HOHE SICHERHEIT DURCH NACHKOMMENPRÜFUNG Im Rahmen der GFS Nachkommenprüfung werden alle neu in den Besamungseinsatz kommenden Prüfeber auf ihre Mast- und Schlachtleistungen überprüft. Darüber hinaus werden auch die Anomalien und die Wurfqualität erfasst. Jeder Prüfeber wird hierzu an Sauen auf mindestens 2 Ferkelerzeugerbetrieben angepaart. Die Landwirte übermitteln uns regelmäßig, per elektronischen Datentransfer, die im Sauenplaner hinterlegten Beleg- und Wurfdaten. Alle geborenen Ferkel werden mit einer individuellen Transponderohrmarke gekennzeichnet. Am Schlachthof werden diese Transponder per Leseantenne am Auto-FOM Gerät ausgelesen. Die dort erfassten Mastund Schlachtleistungsdaten bilden die Basis für die BLUP Zuchtwertschätzung und damit für die Einstufung der Eber in ihre entsprechenden Leistungsklassen. HOHER LEISTUNGSANSPRUCH Die GFS merzt das untere Drittel (33 Prozent) ihrer geprüften Eber und erhöht damit das Leistungsniveau der verbleibenden Eber. Hier differenziert sich die GFS von anderen Spermaanbietern. Die 13 Prozent leistungsstärks- Abbildung 1: GFS-Qualität für Nachkommen geprüfte Eber. Negativvererber werden gemerzt (gemerzt 33 %, Bronze 17 %, Silber 13 %, Gold 24 %, Platin 13 %) SICHERE VERERBUNG DURCH NACHKOMMEN GEPRÜFTE EBER Die Sicherheit des Zuchtwertes eines ungeprüften Jungebers liegt bei ca Prozent. Durch die Nachkommenprüfung erhöht sich die Zuchtwertsicherheit eines Ebers auf Prozent. Die Nachkommen geprüften Eber erreichen deutlich höhere Zuchtwertsicherheiten als ungeprüfte Jungeber, da die Mast- und Schlachtleis- 86 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
87 GFS tungen der Nachkommen die entscheidende Größe für die sichere Berechnung des Zuchtwertes darstellen. Nur die Nachkommenprüfung zeigt das wahre Vererbungspotential eines Ebers. Dies zeigt auch die Abbildung 2. Hier sind die Leistungen bzw. Zuchtwerte von Wurfbrüdern nach Vorliegen der Nachkommenprüfung dargestellt. Diese differieren teilweise sehr stark, obwohl die Wurfbrüder mit gleichen Zuchtwerten als Prüfeber angekauft wurden. EBERSELEKTION AUF VITALITÄT, GEBURTSGEWICHT UND AUSGEGLICHENHEIT DES WURFES Ziel eines jeden Ferkelerzeugers sind große Würfe mit vitalen Ferkeln und gleichmäßigen Geburtsgewichten. Aufgrund der Leistungssteigerungen in den letzten Jahren gewinnt die Beachtung der Wurfqualität immer mehr an Bedeutung. Dies war für uns Ansporn zu prüfen inwieweit Eber nach Wurfqualität rangiert bzw. selektiert werden können. Hieraus ist nach vielen Projekten der Wurfqualitätszuchtwert entstanden. Abbildung 3: Erfassungsmaske für die Wurfbonitierung ABBILDUNG 2: NACHKOMMENPRÜFUNG ZAHLT SICH AUS RASSE EBER GZW VOLLBRÜDER HB-NR. BRÜDER GZW KLASSE GerPi Magreno NP gemerzt 91 Mario NN Gold Vaktor NP gemerzt Valius NN Bronze GerPi Vadun NN gemerzt 44 Vantos NP gemerzt Velox NN gemerzt Veltins NP Bronze SNWPi Dojan NN gemerzt 83 Domingo NN Gold Domestos NP Gold Meridol NN Platin Melmo NN Gold Mariko NP Bronze SNWPi Misery NN gemerzt 84 Miggi NN Bronze Marille NN Silber Midou NP Bronze Mappe NP Bronze BHZP db. 77 BHZP NN gemerzt 106 BHZP NN Silber PicPi Mogger NN gemerzt 97 Mörser NN Gold Mumie NP Gold PicPi 408 MW Elber NN gemerzt Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 87
88 GEMEINSAME ZUCHTWERT- SCHÄTZUNG VON GERMAN GENETIC UND GFS NEU können, eignet sich ausschließlich die Nutzung einer Online-Datenbank. Die Eberdaten in gedruckter Form (Eberkatalog) sind häufig beim Druckauftrag schon veraltet. Unser Ziel war es nun die Eberdaten möglichst übersichtlich und verständlich darzustellen (Abbildung 4). Bisher flossen in die Zuchtwertschätzung der German Pietrain-Population nur die Daten aus der Stationsprüfung (Reinzucht), die Daten aus der Eigenleistungsprüfung und die Daten aus der Feldprüfung der baden-württembergischen Besamungseber ein (ca Datensätze). Die Daten bildeten die Grundlage für die Einschätzung der Prüfeber beim Ankauf z. B. durch die GFS. Neu ist, dass seit August zusätzlich ca Datensätze aus der Nachkommenprüfung der German Pietrain-Eber der GFS, und die genomischen Informationen dieser Tiere mit in die Zuchtwertschätzung der Prüfeber integriert werden. Die Berücksichtigung der Daten bewirkt einen Anstieg der Zuchtwertsicherheiten bei Prüfebern auf durchschnittlich ca Prozent (vorher ca Prozent). Nachkommen geprüfte Eber der GFS erreichen weit höhere Zuchtwertsicherheiten von ca Prozent. Dies bedeutet, dass nur die geprüften Eber sicher in Ihrer Vererbungsleistung beurteilt und gezielt eingesetzt werden können. Es wurde festgestellt, dass 6-10 Prozent der Varianz der Geburtsgewichte dem Eber zuzuschreiben sind. Die Wurfqualitätsbonitierung wird in unseren Prüfbetrieben seit Dezember 2011 durchgeführt. Hierbei werden alle Prüfeberwürfe auf die Merkmale Vitalität, Ausgeglichenheit und Geburtsgewicht hin bonitiert (Abbildung 3). Aktuell sind 467 Eber auf Wurfqualität überprüft. Der Wurfqualitätszuchtwert wird anhand von Sternen (1-3 Sterne) ausgewiesen. Aufgrund schlechter Wurfqualität sind bisher 11 Eber gemerzt worden. NEUE GFS EBERDATENBANK FERTIGGESTELLT Die Vielfalt der Eberherkünfte, die neuen Leistungsklassen und der Zuchtwert für Wurfqualität waren Anlass uns Gedanken über eine übersichtliche Gestaltung der Online-Eberdatenbank zu machen. Um die tagesaktuellen Informationen zu den Ebern zur Verfügung stellen zu DIE WICHTIGSTEN NEUHEITEN AUF EINEN BLICK: 1. Auswahlmaske um Filteroption»Prüfstatus«und»Leistungsklasse«erweitert 2. Eindeutige Kennzeichnung zur Unterscheidung von Prüfebern und geprüften Ebern am Bild des Ebers 3. Navigation durch das Eberstammblatt über das Anklicken der einzelnen Reiter 4. Übersichtliche Darstellung aller fünf Selektionskriterien (Mastleistung, Schlachtleistung, Erbfehler, Wurfqualität, Fruchtbarkeit) und eindeutige Kenn- GENOM PLUS-EBER DER HERKUNFT GERMAN PIETRAIN Am 27. November 2013 standen bei der GFS bereits 82 Genom Plus-Eber. Dies sind Prüfeber mit genomischen Zuchtwerten von > 130 Zuchtwertpunkten. Für diese Genom Plus-Eber fällt ein Tubenzuschlag von 0,50 an, der an die Zuchtorganisation abgeführt wird. GEMEINSAME ZUCHTWERT- SCHÄTZUNG VON TOPIGS UND GFS Die SNW-Pietrain-Select-Eber von Topigs werden bei der Jungeberselektion per Life-Muscle-Scan vermessen. Die dabei gewonnenen Fleisch- und Speckmaße fließen neben den Abstammungsdaten in die Zuchtwertschätzung ein. Neu ist, dass in der gemeinsamen TPI-Zuchtwertschätzung jetzt auch die Daten aus der GFS-Nachkommenprüfung berücksichtigt werden. Es handelt sich hierbei um GFS Mast- und Schlachtleistungsdaten ab dem NEU NEU 88 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
89 GFS zeichnung in welchen Kriterien der Eber überprüft ist (Reiter blau hinterlegt) 5. Schnelle Übersicht über Stärken und Schwächen der Eber durch Vergabe von 1-3 Sternen bei geprüften Ebern 6. Einordnung von Prüfebern in die Gruppen»Fleisch«und»Wuchs«. 7. Neue Darstellung der standardisierten Naturalteilzuchtwerte bei geprüften Ebern 8. Relevante Daten zum ausgewählten Kriterium farblich hervorgehoben 9. Keine gesonderte Zeichenerklärung Bezeichnungen direkt im Datenblatt Nehmen Sie sich einmal die Zeit und stöbern Sie durch die Datenbank auf unserer Homepage unter So behalten Sie die aktuellsten Zuchtwerte Ihrer Eber immer im Blick. Sollten dabei Fragen aufkommen, wenden sie sich gerne an die Mitarbeiter an den GFS-Eberstationen. Abbildung 4: Eberstammblatt»Malmö NP 25407«für natürliches BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL IN AUFZUCHT UND MAST Weitere Informationen in unserem Top-Shop Strohkorb zum Aufhängen Strohraufe für Buchtenwand Telefon Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 89
90 Alfons Sprick Lange Gas, Lippstadt MACHEN SIE MIT UNS IHRE EIGENE ENERGIEWENDE! Die gestiegenen Strompreise der letzten Jahre sowie die fast täglichen Ankündigungen, dass weitere Steigerungen in erheblichem Umfang folgen, haben wir nicht akzeptiert und werden auch Sie nicht einfach akzeptieren. Somit ist auch für Sie bereits heute von hoher Priorität, eine Alternativlösung zu suchen. Hierbei wollen wir Ihnen helfen! Mit Energie für Sie da! UNSERE LEISTUNGEN IHR VORTEIL WIR SIND LANGE GAS! Wir sind ein mittelständisches inhabergeführtes Unternehmen und seit mehr als 60 Jahren im Flüssiggasmarkt tätig. Seit dieser Zeit haben wir uns als Ziel gesetzt, für unsere Kunden ein leistungsfähiger und kompetenter Partner zu sein. Wir verfügen über eines der größten Flüssiggaslager in Deutschland. In Verbindung mit unserer eigenen Tankwagenflotte sorgen wir jederzeit für schnelle, zuverlässige und pünktliche Belieferung, natürlich auch in den Wintermonaten. Zusätzlich haben wir eine eigene Montageabteilung aufgebaut, die rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr im Einsatz ist, um bei Bedarf schnell helfen zu können. Hierdurch haben wir uns mit intensiver Leistung und Marktbearbeitung besonders für unsere Kunden in der Landwirtschaft einen überregional bekannten Markennamen geschaffen. Nach intensiver Marktanalyse haben wir uns für den Dachs Profi von SenerTec mit Flüssiggas als Antriebsenergie entschieden und bereits im Jahr 2011 installiert. SEIT DIESER ZEIT HABEN WIR FOLGENDE WERTE ERREICHT: Laufleistung Stunden eigener Strom erzeugt kwh Wärme erzeugt kwh Einsparung CO kg Der erzeugte Strom wurde ausschließlich in unserem Unternehmen eingesetzt, so dass wir unsere Stromkosten in Verbindung mit dem Dachs Profi erheblich reduzieren konnten und gehen davon aus, dass wir dieses Ergebnis auch in den nächsten Jahren erreichen werden. Zusätzlich ist auch zu berücksichtigen, dass wir mit der enormen CO 2 -Einsparung einen erheblichen Beitrag für die Umwelt leisten. Aufgrund dieser positiven Erfahrungswerte können wir Ihnen bereits heute eine überzeugende Antwort anbieten: EIGENE STROMERZEUGUNG MIT DER KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG Auch von unserer Regierung wird inzwischen die Kraft- Wärme-Kopplung als sehr wichtiger Beitrag für die Stromerzeugung eingestuft. In Verbindung mit erheblichen Zuschüssen als Anreiz soll in Deutschland mit dieser Technik der bisherige Anteil an der Stromgewinnung auf mindestens 25 Prozent ausgebaut werden. Wenn die Konstellation Ihrer Verbrauchswerte passt, ist die Kraft- Wärme-Kopplung in Verbindung mit dem Dachs Profi die ideale Alternative, um die Energiekosten über Jahre hinaus deutlich zu senken. Unsere eigenen Erfahrungswerte mit dem Dachs Profi, die eindeutigen Zeichen unserer 90 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
91 Lange Gas DACHS PROFI-QUALITÄT Seit 1996 produziert und vertreibt die SenerTec, Schweinfurt, den Dachs Profi. Diese Anlage verfügt über eine thermische Leistung von 12,5 kw und eine elektrische Leistung von 5,5 kw. Die Wurzeln von SenerTec liegen ebenso wie die des Dachs im Haus Fichtel & Sachs. Zwei Jahrzehnte Entwicklungsarbeit und mehr als 10 Jahre Praxiserfahrung stecken im Dachs, der den eingesetzten Brennstoff zweimal nutzt und sowohl Wärme als auch Strom erzeugt. Der Dachs beruht somit auf einer Technik, die technisch ausgereift und besonders für einen langfristigen störungsfreien Einsatz optimal geeignet ist. Regierung, einfach die sehr positive Zukunftsperspektive für die Kraft-Wärme-Kopplung, haben uns überzeugt, für diesen Bereich ein neues Geschäftsfeld aufzubauen. Inzwischen erfolgt der Vertrieb, Montage und Wartung mit einer eigenen Mannschaft. Viele unserer Landwirtschafts-Kunden haben inzwischen die enormen Möglichkeiten der Kraft-Wärme-Kopplung mit dem Dachs Profi von SenerTec erkannt und sich für den Einsatz entschieden. Wir haben zwei unserer Kunden besucht, die gern bereit waren, uns ihren Betrieb mit dem Dachs Profi im praktischen Einsatz zu präsentieren und uns auch sehr offen die erreichten Ergebnisse vorzustellen: FAMILIE GOSEJOHANN, RIETBERG Herr Gosejohann betreibt einen Gemischtbetrieb mit ca. 50 Prozent Sauenhaltung und Ferkelaufzucht sowie ca. 50 Prozent Hähnchenmast. Der Dachs wurde hier im Juli 2012 installiert. SEIT DIESER ZEIT HAT ER FOLGENDE ERGEBNISSE ERREICHT: Laufleistung Stunden eigener Strom erzeugt kwh Wärme erzeugt kwh Einsparung CO kg Herr Gosejohann hat von dem selbst erzeugten Strom kwh (= 72 Prozent) im eigenen Betrieb eingesetzt und kwh (= 28 Prozent) in das Leitungsnetz der RWE eingespeist. Da er mit dem erzeugten Strom Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 91
92 Lange Gas seinen Gesamtbedarf nicht decken kann, hat er zusätzlich kwh von der RWE bezogen. Herr Gosejohann hat mit dem Dachs eindeutig sein Ziel erreicht und konnte seine Stromkosten deutlich senken. In Kürze wird sein noch in der Ausbildung befindlicher Sohn in den Betrieb einsteigen, sodass in der Familie Gosejohann auch die Nachfolge geregelt ist. Es ist geplant, den Betrieb weiter auszubauen. Nach der aktuell sehr positiven Erfahrung geht Herr Gosejohann fest davon aus, dass in diesem Zusammenhang ein zweiter Dachs mit ebenfalls erheblichen wirtschaftlichen Vorteilen eingesetzt werden kann. FAMILIE JOHANNESMEIER, DELBRÜCK-WESTENHOLZ Familie Johannesmeier betreibt Sauenhaltung und Ferkelaufzucht. Sie hat in ihrem Betrieb aktuell ca. 350 Sauen inkl. Jungsauen und vermarktet pro Jahr ca Ferkel (26 Ferkel pro Sau). Der Dachs wurde hier bereits Mitte 2009 installiert und hat seit dieser Zeit folgende Ergebnisse erreicht: Familie Johannesmeier hat den gesamten selbst erzeugten Strom im eigenen Betrieb eingesetzt. Das gesetzte Ziel, mit dem Dachs Profi die Stromkosten deutlich zu reduzieren, wurde eindeutig erreicht. Da der gesamte Strombedarf weiterhin deutlich über den erzeugten Strom hinausgeht, wurde in den letzten Wochen eine erneute Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt. Diese hat ergeben, dass es sehr sinnvoll ist, einen weiteren Dachs Profi einzusetzen. Die Entscheidung hierüber wird in der Familie intensiv überlegt. Es ist davon auszugehen, dass Anfang 2014 der 2. Dachs in Betrieb genommen wird. Laufleistung Stunden eigener Strom erzeugt kwh Wärme erzeugt kwh Einsparung CO kg DACHS GEWINNT ENERGIESPAR-PREIS 2012 Deutschland hat entschieden: Der Dachs von SenerTec ist der Gewinner des Deutschen Energiespar-Preises 2012 in der Kategorie Heiztechnik. Dieser Preis bestätigt unsere Informationen und Einschätzung sehr deutlich. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, sind für Sie sicherlich noch viele Fragen offen, die individuell zu klären sind, um festzustellen, ob ein Dachs Profi auch für Sie geeignet ist. In einem persönlichen Gespräch können wir auf Basis Ihrer aktuellen Verbrauchsdaten anhand einer Wirtschaftlichkeitsberechnung ermitteln, ob hiermit auch bei Ihnen eine Reduzierung Ihrer Stromkosten erreicht werden kann. Aus unserer Anzeige auf Seite 2 können Sie die Kontaktdaten unseres Bereichsleiters, Herrn Schopohl, entnehmen. Sie können Herrn Schopohl jederzeit ansprechen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 92 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
93 Zoetis Der Kreis schließt sich: Die Innovation gegen PCV2 NEU! STOPPT PCV2! Fragen Sie Ihren Tierarzt nach dem erweiterten Impfprogramm für Schweine! Zoetis Deutschland GmbH Schellingstraße Berlin Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 93
94 Dr. Thorsten Bekendorf Zoetis DIE CIRCO-IMPFUNG: BIS AN S ENDE SCHAUEN! Die Impfung gegen das Porcine Circovirus 2 (PCV2) hat sich in den letzten Jahren neben der Impfung gegen Mycoplasma hyopneumoniae als Standardimpfung in der Ferkelaufzucht etabliert. Die Effekte nach Einführung dieser Impfung waren deutlich zu sehen: die Anzahl der Schweine mit typischen Hautveränderungen (»Circoflecken«) und Blässe wurde drastisch reduziert ebenso wie das typische PCV2-bedingte Auseinanderwachsen und Kümmern. Die Verluste sanken somit deutlich. Da PCV2 das Immunsystem schwächt, treten häufig parallel zur PCV2-Infektion Sekundärinfektionen mit Bakterien, z. B. Pasteurellen oder Streptokokken auf. Mit der Impfung gegen PCV2 konnten diese sog.»trittbrettfahrer«erfolgreicher behandelt werden oder kamen erst gar nicht zum Ausbruch. Auswertungen bestätigen, dass auf vielen Betrieben der Einsatz von Antibiotika drastisch gesenkt werden konnte. Trotz all der vielen genannten positiven Effekte eines kann die Impfung nicht, nämlich, das Circovirus aus den Beständen eliminieren. Nach Aufbau der Immunität verhindert die Impfung einen Ausbruch der Erkrankung. Das Virus selbst wird laut aktuellem Wissenstand wei- ter in den Beständen kursieren; wie hoch der Infektionsdruck mit PCV2 dabei im Bestand letztendlich ist, hängt von vielen Faktoren ab, z. B. Immunstatus der Tiere generell, Management (Zukauf, Rein-Raus-Verfahren etc.). Das geimpfte Schwein setzt sich mit dem PCV2 auseinander, dies bedeutet: Das Immunsystem versucht, das Virus zu neutralisieren und damit dessen Vermehrung zu blockieren. Im Verlauf der Infektion wird Virus ausgeschieden auch bei geimpften Schweinen. Je nach Belastbarkeit der aufgebauten Immunität kann diese Phase der Virusvermehrung und ausscheidung unterschiedlich lang und stark ausgeprägt sein. Untersuchungen von Opriessnig et al. (Vaccine 27: (2009)) zeigen signifikante Unterschiede bei verschiedenen Impfstoffen sowohl bzgl. der Höhe der produzierten neutralisierenden Antikörper und der damit verbundenen Virusreduktion (Abb. 1 und Abb. 2). Eine effektive Impfung reduziert nachhaltig die Viruslast im Blut (Virämie). Ziel ist es, möglichst wenig Viren im Blut / in den Geweben zu haben um damit die Ausscheidung / Infektionsdruck so gering wie möglich zu halten. Denn nur so werden auch PCV2-bedingte subklini- ABBILDUNG 1: MODIFIZIERT NACH OPRIESSNIG: TITER NEUTRALISIERENDER ANTIKÖRPER IM VERGLEICH Gruppe Anzahl Schweine Impfstoff Zeitpunkt der Impfung 3,5 Wochen alt 6,5 Wochen alt A 10 Impfstoff 1 2 ml - 3,8 ± 0.1 A B 10 Impfstoff 2 1 ml - 2,9 ± 0,2 B Neutralisierende Antikörpertiter mit 15,5 Wochen (log10± Standardabweichung) AB = p < 0,05 94 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
95 Zoetis sche Erkrankungen vermieden. Die große Gefahr dieser subklinischen Erkrankungen sind unerkannte, da nicht augenscheinliche, Leistungseinbußen. Eine neue Untersuchung von Lyoo et al. (The Canadian Journal of Veterinary Research 76: (2012)) gibt dazu interessante Hinweise. Auf 7 Betrieben wurden bei Mastschweinen die Höhe der Antikörper und der Virusgehalt (PCV2) im Blut bestimmt; die Tiere waren mit unterschiedlichen Impfstoffen zu unterschiedlichen Zeitpunkten geimpft worden. Die Blutproben wurden circa 2 Wochen vor der Schlachtung bei den jeweils 30 leichtesten und den 30 schwersten Schweinen in jedem Stall gezogen. Die Tiere zeigten keinerlei Symptome einer PCV2-bedingten Erkrankung. Im Mittel über alle Betriebe wiesen die schweren Tiere signifikant höhere Antikörpertiter im Vergleich zu den leichten Tieren auf. Ebenso war bei den leichten Tieren die Anzahl PCV2-positiver Schweine wie auch der Gehalt an Virus im Blut höher als bei den schweren Tieren. Lyoo et al. folgern daraus, dass starke Gewichtsunterschiede in der Mast und verlängerte Ausstallintervalle durchaus mit einer subklinischen PCV2-Infektion zusammenhängen können. In diesem Fall sollte der bestandsbetreuende Tierarzt mögliche Ursachen abklären und u. a. den Impfzeitpunkt und die Auswahl des PCV2-Impfstoffs (Schutzdauer!) überprüfen. ABBILDUNG 2: ANZAHL DER PCV-POSITIVEN TIERE (PCR-NACHWEIS) AM TAG 7, 14 UND 21 NACH BELASTUNGSINFEKTION Tag 7 Tag 14 Tag 21 Impfstoff A 2 / 10 (0.6 ± 0.4) A 7 / 10 (1.9 ± 0.4) A 0 / 10 (0.0 ± 0.0) A Impfstoff B 3 / 10 (0.9 ± 0.5) A 10 / 10 (3.1 ± 0.1) B 7 / 10 (2.6 ± 0.6) B AB = p < 0,05 Opriessnig et al Vermarktung von: Ferkeln, Mastschweinen und Schlachtsauen Ansprechpartner für alle: Ferkelerzeuger, Mäster und kombinierte Betriebe Schweineerzeuger Nord-West SNW-Handelsgesellschaft mbh Am Dorn Senden Telefon: / Fax: / Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 95
96 Prof. Dr. Martin Ziron und Andrea Buffen, Fachhochschule Soest LEISTUNGEN UND KOSTEN TECHNISCHER UND NATÜRLICHER AMMEN IN DER FERKELAUFZUCHT Die Fruchtbarkeitsleistungen der Zuchtsauen sind in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen und haben ein hohes Niveau erreicht. Würfe von bis zu 18 Ferkeln, nicht nur bei einzelnen Sauen im Betrieb, sind keine Seltenheit mehr. Resultierend aus der größeren Anzahl Ferkel steigt zwar das Gesamtgeburtsgewicht aber das Einzeltiergewicht geht zurück. Die ursprüngliche Zielvorgabe von durchschnittlich 1500 g liegt in der Praxis aufgrund dieser Entwicklung eher bei 1300 g. von 16,5 Prozent. Es konnten 27,7 Ferkel abgesetzt werden. Während des Versuchszeitraums im laufenden Wirtschaftsjahr wurden 35,1 Ferkel lebend geboren und 29,5 abgesetzt. Nach dreiwöchiger Säugedauer erreichen die Ferkel im Durchschnitt 5,8 kg. Durch die hohe Anzahl an Ferkeln reicht die Anzahl der Zitzen und die maximal von der Sau produzierte Milchmenge nicht mehr aus. Üblich sind dann ein Wurfausgleich und das Umsetzen der Ferkel an Sauen mit wenigen Ferkeln. Dies geht allerdings nur solange, wie auch solche Würfe zu Verfügung stehen. Sind die Leistungen im Schnitt so hoch, dass kein Ausgleich mehr vorgenommen werden kann, muss der Ferkelerzeuger auf natürliche oder technische Ammen zurückgreifen. Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen wurden die biologischen und ökonomischen Leistungen beim Einsatz von technischer und natürlicher Ferkelammen auf einem Praxisbetrieb verglichen. DURCHFÜHRUNG DER UNTERSUCHUNGEN Der Versuch fand auf einem Praxisbetrieb mit 450 Sauenund 2300 Ferkelaufzuchtplätzen statt. Als Sauengenetik sind im Betrieb DAN-Sauen aufgestallt, die mit einem Pietrain Top Genetik Eber angepaart werden. Die Anzahl der lebend geborenen Ferkel lag im Wirtschaftsjahr 2011 / 2012 bei 33,1 Ferkel / Sau / Jahr bei Ferkelverlusten Technische Ferkelamme (Pöttkers Ferkelamme der Firma HCP Technology) 96 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
97 Fachhochschule Soest TECHNISCHE FERKELAMMEN Die Aufzucht der Ferkel an der technischen Amme (Pöttkers Ferkelamme der Firma HCP Technology) fand in einem separaten Abteil, mit vier Abferkelbuchten statt. Die technische Ferkelamme wurde auf der Buchtentrennwand zwischen zwei Abferkelbuchten installiert, in denen je 12 bis 14 Ammenferkel pro Bucht waren. In der Mitte der Abferkelbucht befand sich ein Edelstahltrog welcher von beiden Seiten gut für die Ferkel zu erreichen war. Die im Versuch eingesetzte Ferkelamme versorgte zwei Ammengruppen gleichzeitig mit Futter. Sie bietet 22 Fressplätze pro Futtertrog und beinhaltet eine stündliche Futterausdosierung nach Futterkurve. TABELLE 1: ERGEBNISSE DER FERKELWIEGUNGEN AN TECHNISCHEN FERKELAMMEN Gruppe n = 10 Alter (Tage) 6,5 Ferkel n = ,7 Geburt (kg) 1,49 1) Wiegung 1 (kg) 2,81 Wiegung 2 (kg) 3,82 Wiegung 3 (kg) 4,89 Ø TZ (g) 148 Ø 1) Ferkel erst ab Wiegung 1 an Amme, daher hier keine Berücksichtigung an eine produktive Sau, jedoch nicht an Jungsauen. Die Sauen, deren gesamter Wurf versetzt wurde, wurden mit derselben Anzahl Ammenferkel aufgefüllt. Insgesamt beinhalteten die Untersuchung zehn Gruppen mit insgesamt 133 aufgezogenen Ferkeln an der natürlichen Amme. Natürliche Ferkelamme NATÜRLICHE FERKELAMMEN Die Aufzucht der Ferkel an den natürlichen Ammen fand im jeweiligen Stallabteil in der Abferkelbucht der Amme statt. So blieb die Sau in der Bucht und die ausgewählten Ferkel wurden in diese Bucht versetzt. 12 bis 24 Stunden nach der Geburt wurden die größten Ferkel der Abferkelgruppe absortiert und an die Amme versetzt. Als Ammen dienten im Versuchsbetrieb Sauen aus dem dritten oder vierten Wurf der vorrangegangenen Abferkelwoche, die eine gute Aufzuchtleistung zeigten. Die eigenen Ferkel der ausgewählten Ammensau wurden, wenn möglich, an eine Schlachtsau der Absetzgruppe versetzt. War keine Schlachtsau vorhanden, kamen die Ferkel Die Tiere wurden am Umsetztag und anschließend wöchentlich gewogen. Die Abschlusswiegung beendete die Untersuchung nach 21 Tagen Ammenzeit, vor dem Umstallen in den Flatdeckstall. Neben den Tageszunahmen der Ferkel wurden auch die Futterverbräuche der Ferkel sowie der Ammensauen erfasst. Zur Anfütterung bekamen die Ferkeln ab dem siebten Lebenstag in einer separaten Anfütterungsschale Prestarter angeboten. Während des Versuchs sind keine Tiere von den Ammen hinzu- oder wegversetzt worden. Zwölf Ferkel verendeten während des Versuchs. ERGEBNISSE»TECHNISCHE AMMEN«Die Ergebnisse der Ferkelwiegungen (vergleiche Tabelle 1) zeigen, dass die Ferkel mit einem durchschnittlichen Gewicht von 2,81 kg bei einem Alter von 6,5 Tagen an die technische Amme versetzt wurden. Nach 14 Tagen an der Amme wiesen die Ferkel ein durchschnittliches Absetzgewicht von 4,9 kg auf. Dieser Wert lag mit 800 g deutlich unterhalb des durchschnittlichen Absetzgewichts (ø 5,7 kg) der Ferkel im Versuchsbetrieb. Anhand dieser Werte lassen sich durchschnittliche Tageszunahmen über die gesamte Ammenzeit von 148 g Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 97
98 ERGEBNISSE»NATÜRLICHE AMMEN«ABBILDUNG 1: MILCHPULVERVERBRAUCH DER FERKEL BEI 14 TAGEN AMMENZEIT Milchpulver je Ferkel in g Die Ergebnisse der Ferkelwiegungen (vergleiche Tabelle 2) zeigen, dass die Ferkel mit einem durchschnittlichen Gewicht von 1,71 kg an die natürlichen Ammen versetzt wurden. Nach sieben Tagen an der Amme hatten die Ferkel ein durchschnittliches Gewicht von 2,86 kg und nach 14 Tagen von 4,38 kg. Nach 21 Tagen an den natürlichen Ammen, wiesen die Ferkel ein durchschnittliches Ab- TABELLE 2: ERGEBNISSE DER FERKELWIEGUNGEN AN NATÜRLICHEN AMMEN Ferkelalter in Tagen bei Umsetzen an die Amme Gruppe n = 10 Ø Ferkel n = ,3 Verluste n = 12 1,2 Geburt (kg) 1,71 7 Tage (kg) 2,86 14 Tage (kg) 4,38 21 Tage (kg) 5,83 Ø TZ (g) 196 ermitteln. Dieser Wert liegt 12 g unter dem in der Literatur angegebenen Wert von durchschnittlichen 160 g täglichen Zunahmen. In der ersten Woche an der technischen Ferkelamme liegen die täglichen Zunahmen bei 144 g. In der zweiten Ammenwoche liegen die durchschnittlichen Zunahmen bei 153 g / Tag. Abhängig vom Alter mit dem die Ferkel an die Amme gesetzt wurden, variiert der Futterverbrauch. So starteten Ferkel bei einem Alter von sechs Tagen mit 45 g / Tag / Ferkel, bei einem Alter von sieben Tagen mit 50 g / Tag / Ferkel und bei einem Alter von acht Tagen mit 56 g / Tag / Ferkel. Insgesamt wurden für den Versuch 190 kg Traedu-Milk verbraucht. Abbildung 1 zeigt die Milchpulververbräuche der Ferkel in Abhängigkeit ihres Alters in den ersten 14 Tagen an der Amme. Die 190 kg Milchpulver, die in der Versuchszeit verfüttert wurden, ergeben auf die Ferkelanzahl einen durchschnittlichen Milchpulververbrauch von 1,5 kg / Ferkel. Daraus ergibt sich eine Futterverwertung von 1:1,4. Während des Versuchs wurden insgesamt 65 kg Prestarter verbraucht. Umgerechnet auf die 127 Ferkel die während des Versuchs gefüttert wurden, ergibt sich daraus ein Prestarterverbrauch von 0,5 kg pro Ferkel. ABBILDUNG 2: TÄGLICHE ZUNAHMEN (G) DER FERKEL AN NATÜRLICHEN AMMEN Ferkelalter in Tagen Durchschnitt Tägliche Zunahme in g 98 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
99 Fachhochschule Soest setzgewicht von 5,83 kg auf. Es wurden 133 Ferkel an die natürlichen Ammen versetzt. Dabei wurden Verluste von 12 Ferkeln verzeichnet. Es konnten nach einer dreiwöchigen Ammenzeit 121 Ferkel abgesetzt werden. unterscheiden sich nur geringfügig und liegen bei 5,47 technische Amme und 5,10 natürliche Amme (ausführliche Berechnungen hierzu können beim Autor angefordert werden). Die Kostendifferenz bei den variablen Aus diesen Ergebnissen ergeben sich durchschnittliche Tageszunahmen über die gesamte Ammenzeit von 196 g. In der ersten Woche an der natürlichen Amme lagen die täglichen Zunahmen bei 164 g. In der zweiten Woche lagen diese bei 217 g und in der dritten Woche bei 207 g (vergleiche Abbildung 2). Auffällig ist hier, dass die täglichen Zunahmen in der letzten Ammenwoche im Vergleich zu denen in der Woche davor zu sinken scheinen. So fallen die täglichen Zunahmen von durchschnittlich 217 g in der zweiten Ammenwoche auf durchschnittlich 201 g in der dritten Ammenwoche. Bei den einzelnen Würfe fällt auf, dass es bei drei Würfen zu einem deutliche Rückgang der Zunahmen kommt, welche den Mittelwert der gesamten Gruppe beeinflussen. Diese Ammensauen hatten eine deutlich schlechtere Milchleistung. Während des Versuchs wurden 50 kg Prestarter und 1,3 t Sauenfutter verbraucht. Umgerechnet auf die 121 abgesetzten Ferkel macht dies eine Futteraufnahme von 410 g Prestarter und 10,7 kg verbrauchtes Sauenfutter pro Ferkel. ABBILDUNG 3: DURCHSCHNITTLICHE TÄGLICHE ZUNAHMEN VON FERKELN / WOCHE AUFGEZOGEN AN TECHNISCHEN VERSUS NATÜRLICHEN AMMEN *** *** Alter der Ferkel Ø tägl. Zunahmen (g) VERGLEICH VON TECHNISCHER UND NATÜRLICHER AMME Tage Tage Während der Vor- sowie der Hauptuntersuchung konnten die zehn Ferkelgruppen pro Ammensystem gewogen und miteinander verglichen werden. Zusätzlich fand eine wöchentlich Wiegung von Geburt bis zum Absetzen von zehn Ferkelgruppen statt, die von der eigenen Muttersau aufgezogen wurden (Kontrollgruppe). technische Amme n = 127 natürliche Amme n = 133 *** höchst signifikant verschieden, p<0,0001; Fehlerbalken = Standardabweichung Nach sieben Tagen unterscheiden sich die Gewichte der Ferkel der technischen und natürlichen Amme nur gering voneinander. Mit zunehmendem Alter konnte ein besseres Wachstum bei den Ferkeln an der natürlichen Amme beobachtet werden (vergleiche Abbildung 3). Kosten ergibt sich in erster Line aus den hohen Kosten für das Milchpulver im Vergleich zum Sauenfutter. Bei der technischen Amme kommt noch der höhere Stromverbrauch für die Technik hinzu. KOSTEN IM VERGLEICH Die Kosten bis zum Absetzen der Tiere unter Berücksichtigung der fixen und variablen Kosten ergeben sich bei der technischen Amme Kosten von 16,38 pro Ferkel. Im Vergleich dazu liegen die Kosten bei der natürlichen Amme bei 13,80. Die fixen Kosten pro Ferkel Durch den Einsatz anderer Milchpulver oder Prestarter können die Kosten gerade bei der technischen Amme noch deutlich reduziert werden. Hierbei muss aber auf die Qualität bzw. die Inhaltsstoffe geachtet werden. Im Versuchsbetrieb wurde im Anschluss an die Untersuchungen ein deutlich günstigeres Milchpulver eingesetzt. Dies erbrachte aber nicht die gewünschten Tageszunahmen bei den Ferkeln. Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 99
100 Fachhochschule Soest ZUSAMMENFASSUNG Im Versuch wurde deutlich, dass die Ferkel, die an den natürlichen Ammen aufgezogen wurden, bessere biologische Aufzuchtleistungen aufweisen. Ebenfalls zeigten diese Ferkel in der Ökonomie die besseren Ergebnisse, da die Ferkel während der Aufzucht an den natürlichen Ammen geringere Kosten verursachen und somit einen höheren Gewinn pro Ferkel erzielen. Es ist weiterhin wichtig zu berücksichtigen, dass der Einsatz einer natürlichen Ferkelamme in der Öffentlichkeit bei weitem nicht so umstritten ist, wie der Einsatz einer technischen Ferkelamme. Unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Aspekte ist der Einsatz natürlicher Ferkelammen gegenüber dem Einsatz technischer Ferkelammen zu empfehlen. Sollte allerdings keine natürliche Ferkelamme zum Beispiel durch hohe biologische Leistungen vorhanden sein, ist der Einsatz einer technischen Ferkelamme sinnvoll, um Ferkelverluste zu verhindern. TABELLE 3: VARIABLE KOSTEN DER AUFZUCHT VARIABLE KOSTEN TECHNISCHE AMME / FERKEL NATÜRLICHE AMME / FERKEL VARIABLE KOSTEN Milchpulver 4 / kg 1,5 kg / Ferkel 6,00 4,25 Sauenfutter (inkl. 7% MwSt.)* Prestarter 1,40 / kg 0,5 kg / Ferkel 0,70 0,57 Prestarter 1,4 0 / kg 0,41 kg / Ferkel Strom und Heizung 2,00 1,05 Strom und Heizung Medikamentenkosten 2,20 2,20 Medikamentenkosten Zinsansatz für Umaufvermögen 0,01 0,01 Zinsansatz für Umlaufvermögen Summe variable Kosten 10,91 8,08 Summe variable Kosten Summe fixe Kosten 5,47 5,10 Summe fixe Kosten GESAMTKOSTEN / FERKEL / FERKEL GESAMTKOSTEN Summe fixe und variable Kosten 16,38 13,18 Summe fixe und variable Kosten * 39,59 /dt, 1,3 dt / Sau, 12,1 Ferkel / Sau Ihr Partner für Untersuchung und Beratung Dienstleistungen der LUFA NRW: Düngemittel, Lebensmittel, Futtermittel, Boden, Saatgut, Wasser Nevinghoff Münster Fon lufa@lwk.nrw.de Web Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
101 PIC Barbara Berger Marketing Manager PIC Western Europe PIC-FUTTEREFFIZIENZ AUCH IM SAUENSTALL Ergebnisse des Versuchs»Analyse von Managementaspekten der PIC-Sau«, Lehr- und Versuchszentrum der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Futterkamp Unbestritten ist heutzutage die Aussage, dass sehr gute Fruchtbarkeitsleistungen Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Ferkelerzeugung sind. Unbestritten ist sicherlich auch die Tatsache, dass für hohe Leistungen ein entsprechendes Management und der effiziente Einsatz der Betriebsmittel erforderlich sind, um die hohen biologischen Leistungen in entsprechende wirtschaftliche Ergebnisse ummünzen zu können. Hier gilt es insbesondere die kostenintensiven Faktoren zu optimieren. Unter den Direktkosten machen die Futterkosten mit über 60 Prozent den größten Anteil aus. Davon entfällt knapp die Hälfte auf das Sauenfutter, vgl. auch Abb. 1. Hier wird zudem deutlich, dass die gestiegenen Futterkosten nicht allein durch die Verbesserung der biologischen Leistungen verursacht wurden. FUTTER BLEIBT TEUER Erwarten wir von unseren Sauen hohe bzw. höhere Leistungen, müssen wir ihnen auch die entsprechenden Voraussetzungen schaffen, sprich Haltung und Management müssen stimmen. ABBILDUNG 1: VERTEILUNG DER DIREKTKOSTEN IN DER FERKELERZEUGUNG INKL. FERKELAUFZUCHT * * Schweinereport 2012, LWK Schleswig-Holstein Sonstiges, / Sau Tierzukauf, / Sau Veterinär, / Sau Ferkelfutter, / Sau Sauenfutter, / Sau Futter alle 25 % ökonomisch erfolgreiche 25 % ökonomisch weniger erfolgreiche zum Vergleich: 2011 alle % der Direktkosten Rund 30 Prozent der Direktkosten werden durch das Sauenfutter verursacht. Höhere biologische Leistungen (verkaufte Ferkel) spiegeln sich im höheren Anteil des Ferkelfutters wider. Im Vergleich zu 2011 sind die Gesamtfutterkosten um rund 9 Prozent gestiegen, wobei der Kostenblock»Sauenfutter«um 10 Prozent höher ausfiel, bedingt zum einen durch höhere Preise und zum anderen auch durch einen höheren Verbrauch je Sau Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 101
102 Darüber hinaus muss die Sau selbst die entsprechenden Vorraussetzungen mitbringen, um hohe Leistungen bei bestmöglicher Futtereffizienz zu erbringen. Wie viel Futter benötigen Ihre Sauen? Sind es nur 10 dt oder gar 13 oder mehr dt? Wie viel kg Sauenfutter müssen Sie je verkauftem Ferkel einsetzen? ABBILDUNG 2: ZUCHTZIEL- GEWICHTUNG PIC-CAMBOROUGH weil PIC s Fütterungsempfehlungen, insbesondere mit der verhaltenen Fütterung in der Trächtigkeit mit maximal 30 MJ ME pro Tag, Erstaunen und Zurückhaltung bei Praktikern hervorrufen, startete die PIC im September 2011 gemeinsam mit dem Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp (LVZ), Schleswig-Holstein, einen großangelegten Versuch zur»analyse von Managementaspekten der PIC-Sau«. Auf dessen Ergebnisse wollen wir im Folgenden näher eingehen. LVZ FUTTERKAMP: 150 PIC-SAUEN ÜBER ZWEI PRODUKTIONSZYKLEN GEMESSEN, GEWOGEN UND BONITIERT Im September 2011 wurde die erste 30er Gruppe PIC- Camboroughs aus dem PIC-Tochternukleus Podelzig in den Quarantänestall des LVZ eingestallt und ebenso wie die ihr nachfolgenden Gruppen nahezu lückenlos während ihrer ersten beiden Produktionszyklen verfolgt. Robustheit und Vitalität der Ferkel und Mastschweine Masteigenschaften Schlachtkörpereigenschaften Robustheit der Sauen Fruchtbarkeit ZUCHT AUF FUTTERWERTUNG IN DEN PIC-MUTTERLINIEN Eine Zielsetzung war, den Futterbedarf in den einzelnen Produktionsabschnitten von der Quarantäne über Eingliederung, Deckzentrum, frühe, mittlere und Hoch-Trächtigkeit sowie Säugezeit zu ermitteln und der Fruchtbarkeitsleistung gegenüber zu stellen. Nach zweieinhalbwöchiger Quarantäne und dreiwöchiger Eingliederungszeit wurden die Jungsauen je nach Altergruppe und der in Futterkamp üblichen Regumategabe im Deckzentrum belegt. Innerhalb von vier Tagen erfolgte die Umstallung in den Wartestall. Hier werden die Sauen in einer dynamischen Großgruppe gehalten und über Abrufstationen mit Futter versorgt. Der Fütterungsplan, siehe Tab. 1, enthielt die PIC-Vorgaben für die Versor- Bei der züchterischen Weiterentwicklung der PIC-Hybridsauen wird neben der stetigen züchterischen Steigerung der Fruchtbarkeit besonderer Wert auf eine hohe Futteraufnahme und -verwertung gelegt, siehe Abb. 2. Davon profitieren Ferkelerzeuger wie Mäster gleichermaßen durch effizientere Sauen und leistungsfähigere Mastferkel, die bekanntlich die Hälfte ihrer Gene von der Mutter erhalten. Wir wissen heute aus den Ergebnissen der Praxis, dass eine hoch fruchtbare PIC-Sau mit gut 10 dt Futter bei 3-wöchiger Säugezeit auskommt. Was darüber hinaus gefüttert wird, wirkt sich negativ aus sowohl auf Leistung als auch auf die Kosten. Damit unterscheidet sich die PIC- Sau durchaus in einer wesentlichen Eigenschaft von anderen Herkünften und sollte nicht pauschal nach allgemein praxisüblichen Empfehlungen gefüttert werden. Nicht nur Wartestall im LVZ Futterkamp: Platz für insgesamt ca. 250 Sauen. Dynamische Großgruppe (Altsauen), Jungsauen separat 102 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
103 PIC TABELLE 1: PIC-FÜTTERUNGSPLAN FÜR DIE VERSORGUNG DER ZUCHTLÄUFER BZW. JUNGSAUEN BIS ZUR ABFERKELUNG Produktionsabschnitt Energieversorgung, MJ ME / Tag Futtersorte Quarantäne und Eingliederung max. 35 Eingliederungs- / Trächtigkeitsfutter Deckzentrum max Trächtigkeitsfutter Deckzentrum bis Belegung max. 24 Trächtigkeitsfutter Wartestall: 1. bis 90. Trächtigkeitstag max. 24 Trächtigkeitsfutter Wartestall: ab 91. Trächtigkeitstag max. 30 Trächtigkeitsfutter Abferkelstall: ca bis 111. Trächtigkeitstag max. 30 Laktationsfutter Konditionsanpassung während der Trächtigkeit für dünne bzw. dicke Sauen mit + / 2 MJ ME TABELLE 2: WURFLEISTUNGEN NACH WURFNUMMER Würfe* 1. Wurf 2. Wurf Gesamt Erstbelegealter, Tage 233 Gewicht zur Belegung, kg 129,0 164,9 Gewicht bei Einstallung in den Abferkelstall, kg 198,4 225,4 Würfe, n leb. geb. Ferkel / Wurf 13,97 14,83 14,38 tot geb. Ferkel / Wurf 0,83 0,68 0,76 Geburtsgewicht, kg 1,3 1,4 1,4 abgesetzte Ferkel / Wurf 12,03 12,02 12,02 Absetzgewicht, kg 5,7 6,4 6,0 Säugetagszunahmen, g / Tag * Gruppe A gung der Jungsauen bis zur Abferkelung. Die Jungsauen wurden in zwei Gruppen eingeteilt, um zu überprüfen, ob bzw. inwiefern sich das Futteraufnahmeverhalten der PIC- Sau auf die Fruchtbarkeitsleistungen auswirkt. Die erste Gruppe (A) bekam während der Laktation eine geringere Futtermenge. Für die zweite Gruppe (B) wurden eine ad libitum Fütterung durch einen höheren Anspruch auf Futter während der Säugezeit nachgestellt. Im Gegensatz zu einer herkömmlichen trockenen ad libitum Fütterung mit der die PIC positive Erfahrungen gesammelt hat, war bei dieser Spot-Mix Variante Wasser beigemischt. Die Fruchtbarkeitsleistungen mit 14 im ersten und 14,8 lebend geborenen Ferkeln im zweiten Wurf bei praxisüblicher Fütterung nach PIC-Vorgabe während der Säugezeit spiegeln das hohe Leistungspotential der Camborough-Sau wider, siehe Tab. 2. Im Wesentlichen unterschieden sich die Leistungen beider Gruppen hinsichtlich der Wurfgröße im zweiten Wurf, woraus sich schließen lässt, dass die volumenmäßig deutlich höhere Futteraufnahme (Spot-Mix-Fütterung) während der Säugezeit negative Auswirkungen auf die Reproduktionsleistung im Folgewurf hatte. Im Gegensatz zu den gesammelten Erfahrungen hat wahrscheinlich der Wasseranteil des Futters und damit das gestiegene Volumen zu einem Überfressen geführt, was zum Teil eine völlige Futterverweigerung zur Folge hatte. Bei Jungsauen kann dies Überfressen laut Literatur eher als bei Altsauen zu Kreislaufund Stoffwechselüberforderungen führen, mit der Folge eines stärkeren Substanzverlustes während der Säugezeit. Die Praxiserfahrungen der PIC sowohl in Deutschland als auch international beruhen weitestgehend auf der Trockenfütterung als echte ad-libitum Fütterung Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 103
104 mit freiem Zugang zum Futter für die Sauen. So kann ein Überfressen und mögliche negative Auswirkungen verhindert werden. In den Geburtsgewichten bestanden zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede. Die Sauen der Gruppe A zeigten eine um im Mittel ca. 0,3 bessere Futterverwertung während der Säugezeit, wobei hier die Futterverwertung den Futteraufwand bezogen auf den Gesamtwurfzuwachs beschreibt. WENIGER ALS EINE TONNE FUTTER JE SAU BIS ZUM ABSETZEN DES ZWEITEN WURFES VERBRAUCHT Das entscheidende Kriterium zwischen den beiden Versuchsgruppen ist der Futterverbrauch während der Säugezeit. Im Wartestall wurden beide Gruppen identisch gefüttert. In der ersten Trächtigkeit fraßen die Sauen 2,19 kg (ca. 26 MJ ME) täglich, in der zweiten Trächtigkeit waren es 2,38 kg (ca. 28 MJ ME). Demzufolge haben die Sauen der Versuchsgruppe A von Anlieferung bis Absetzen des zweiten Wurfes 935 kg Futter benötigt. Lässt man den Zeitraum von Anlieferung bis zur ersten Belegung unberücksichtigt (70 Tage), so reduziert sich die benötigte Futtermenge auf 783 kg. TABELLE 3: OPTIMALE HERDEN- STRUKTUR ANTEIL SAUEN JE WURFNR. 1. Wurf 21 Prozent 2. Wurf 20 Prozent 3. Wurf 17 Prozent 4. Wurf 15 Prozent 5. Wurf 12 Prozent 6. Wurf 9 Prozent 7. Wurf u. höher 6 Prozent Das deckt sich mit den PIC-Erfahrungen, denn übertragen auf eine normale Herdenstruktur, siehe Tab. 3, und einen steigenden Futterverbrauch bis zum dritten Wurf aufgrund der Lebendmassezunahme der Sau, würde dies einen durchschnittlichen Futterverbrauch von 10 bis 11 dt / Sau und Jahr bedeuten. Oder auf ein Ferkel bezogen ca. 35 bis 37 kg Sauenfutter je abgesetztes Ferkel. Zusammen mit einem frühen Erstbelegealter (ab 210 Tagen) und einem Gewicht bei Erstbelegung von 135 bis 145 kg beeinflusst die PIC-Futtereffizienz die Ökonomie der Ferkelerzeugung damit nicht unerheblich. An dieser Stelle sei nur kurz auf eine Auswertung der Universität Wageningen verwiesen, die den ökonomischen Effekt eines höheren Erstbelegealters bzw. eines höheren Gewichts bei Erstbelegung verdeutlicht, siehe Tab. 4 auf Seite 105. Das heißt, eine um 30 Tage älter belegte Jungsau, die 20 kg schwerer ist (und bleibt), hat um 1,19 höhere Produktionskosten für jedes in ihrem Leben produzierte Ferkel! Mehr produzierte Ferkel reduzieren sicherlich die zusätzlichen Produktionskosten je Ferkel, aber später / schwerer zum ersten Mal belegte Sauen bleiben immer teurer. Deshalb gilt es, ein besonderes Augenmerk auf Aufzucht, Eingliederung sowie den ersten und zweiten Wurf zu haben. Sind dies doch die Lebensabschnitte, die einen besonders hohen Einfluss auf die Lebensleistung einer Sau haben. KONDITIONSBESTIMMUNG LEICHT GEMACHT Eine weitere Zielsetzung des Versuchs im LVZ Futterkamp bestand darin, Managementhilfen zur Konditionsbeurteilung auf ihre Verlässlichkeit und Praktikabilität überprüfen. Zuverlässigstes Messinstrument ist natürlich die Waage, die allerdings für den täglichen Gebrauch nicht ideal oder auch gar nicht in jedem Sauenstall vorhanden ist. Ein oft angeführtes Hilfsmittel ist das BCS-System (Body-Condition-Score), bei dem die Sau visuell in eine von fünf Klassen eingestuft wird. Die Rückenspeckdicke gilt ebenfalls als ein Konditionskriterium. PIC und die Kansas State University haben das so genannte Flank-to-Flank-Tape oder auch PIC-Gewichtsmaßband entwickelt, mit dem durch Messen von Flanke zu Flanke der richtige Gewichtsbereich zur Erstbelegung ermittelt werden kann. WELCHES DIESER HILFSMITTEL LIEFERT NUN DIE BESTE KORRELATION ZUM SAUEN- GEWICHT? Zwischen dem PIC-Gewichtsmaßband und dem Sauengewicht bestand eine sehr hohe Korrelation insbesondere im ersten Wurf, siehe Tab. 5. Auch im zweiten Wurf liefert das Gewichtsmaßband im Vergleich zu den übrigen Methoden hinreichend zuverlässige Werte. Die sehr niedrige Korrelation von Sauengewicht und BCS-Score im ersten Wurf und ihrem Anstieg im zweiten Wurf spricht dafür, dass die BCS-Bewertung erst bei älteren Sauen zuverlässiger wird. Die sehr gute Übereinstimmung der Sauengewichte mit den mit Hilfe des PIC-Gewichtsmaßbandes ermittelten Werten bestätigt die Zuverlässigkeit dieses doch verblüffend einfachen Hilfsmittels zur Konditionsbeurteilung. 104 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
105 PIC TABELLE 4: KOSTEN VERURSACHT DURCH 30 TAGE SPÄTERE ERSTBELEGUNG UND 20 KG SCHWERERE JUNGSAUEN * KOSTENFAKTOREN DURCH 30 TAGE HÖHERES ERSTBELEGEALTER / JUNGSAU zusätzliche Futterkosten 21,75 zusätzliche Haltungskosten 3,90 zusätzliche Kosten durch Abschreibung etc. 0,51 zusätzliche Kosten für Arbeit 0,51 zusätzliche sonstige Kosten (Strom, Wasser, Gülleentsorgung etc.) 2,40 zusätzliche Kosten pro Sauenleben durch 30 Tage höheres Erstbelegealter 29,07 KOSTEN DURCH 20 KG HÖHERES GEWICHT BEI ERSTBELEGUNG / SAU zusätzliche Futterkosten pro Jahr durch höheren Erhaltungsbedarf 19,71 zusätzliche Kosten pro Sauenleben durch 20 kg höheres Gewicht bei Erstbelegung 42,24 GESAMT (zusätzliche Kosten durch ältere und schwerere Sauen bei Erstbelegung) / SAU zusätzliche Kosten durch ältere und schwerere Sauen bei Erstbelegung 71,31 Lebensleistung je Sau, abgesetzte Ferkel 60 zusätzliche Kosten je Ferkel bezogen auf die Lebensleistung der Sau 1,19 * Daten: Landbouw-Economisch Instituut, Wageningen, NL TABELLE 5: KORRELATION DER SAUENKONDITIONSMASSET Korrelation Sauengewicht mit 1. Wurf 2. Wurf Gesamt Rückenspeck 0,668 0,562 0,659 BCS 0,112 0,513 0,114 PIC-Gewichtsmaßband 0,974 0,791 0,967 FAZIT PIC s Camborough-Sauen zeigen ein hohes Fruchbarkeitspotenzial gepaart mit einer sehr hohen Futtereffizienz. Das von der PIC empfohlene Sauengewicht von 135 bis 145 kg bei einem Erstbelegealter von ca. 235 Tagen hat sich als vorteilhaft für die Fruchtbarkeitsleistung erwiesen. Die Ergebnisse aus Futterkamp zeigen, dass eine Übertragung der trockenen adlibitum Fütterung nicht auf eine mit Wasser angereicherte Fütterung möglich ist. Bei der hier beschriebenen Fütterung muss beim Management der PIC-Sauen dafür gesorgt werden, dass sich die Sauen besonders Jungsauen in den ersten zwölf Säugetagen nicht überfressen können. Negative Auswirkungen auf die Wurfgröße im Folgewurf können die Folge sein. Bis zum Ende des zweiten Wurfes haben die Sauen weniger als eine Tonne Futter verbraucht. Negative Auswirkungen auf die Kondition konnten nicht festgestellt werden. Als zuverlässiges und äußerst praktikables Hilfsmittel zur Gewichts- und damit Konditionsbestimmung vor allem bei Jungsauen und mit Abstrichen für Sauen zum zweiten Wurf hat sich das PIC-Gewichtsmaßband erwiesen. Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 105
106 Dr. Jens Ingwersen ZDS WAS WILL DER VER- BRAUCHER WAS LEISTEN DIE ERZEUGER? Grundsätzlich sind die Schweinehalter es gewöhnt, sich im freien Markt zu bewegen, d. h.: Es wird produziert, was der Kunde verlangt und (angemessen) bezahlt. In erster Linie wurde bislang qualitativ hochwertiges, mageres Fleisch gewünscht, zu einem günstigen Preis. Seit einigen Jahren werden die Verbraucher zunehmend durch Vorwürfe verunsichert, die sich sowohl gegen eine angeblich einseitige Leistungszucht (»Qualzucht«) und leistungsmäßige Überforderung der Nutztiere richten, als auch gegen eine»agrarindustrielle Massentierhaltung«. Hiermit verbinden sich in der Regel diverse Unterstellungen, wie z. B. die Urwaldvernichtung zugunsten des Sojaanbaus, die Klimabelastung durch die»massentierhaltung«, die Vergeudung von Wasserreserven, ein zu hoher Fleischkonsum, und nicht zuletzt die Zerstörung kleinbäuerlicher Existenzen z. B. durch den Fleischexport nach Afrika. Bei den Kritikern der modernen Nutztierhaltung handelt es sich in erster Linie um Tier- und Umweltschutzorganisationen, aber auch um politische Parteien, kirchliche Gruppen sowie um Vertreter aus der Wissenschaft und der Verwaltung. Im Gespräch stellt sich oft heraus, dass die Vorwürfe durch nostalgische oder ideologische Wunschvorstellungen geprägt sind, auf Unkenntnis beruhen, oder dass Missstände im Einzelfalle verallgemeinert werden. Abgesehen davon wird der Tier- und Umweltschutz von speziellen Interessengruppen zunehmend als Instrument erkannt, sich zu profilieren und wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen, sei es durch Wählerstimmen, durch Mitgliedsbeiträge, durch Spenden oder durch lukrative Lizenzbzw. Kontrollvereinbarungen. Gerne wird hierbei übersehen, dass sich die Schweinehaltung ständig im Sinne des Tierschutzes weiterentwickelt, vom dunklen und zugigen Koben hin zu klimatisierten, modernen Ställen vielfach mit Hygieneschleuse und betrieblichem Tiergesundheitsmanagementsystem. Der deutsche Tierschutzstandard nimmt weltweit eine Spitzenposition ein und übertrifft die EU-Vorgaben deutlich. Die deutschen Schweinehalter brauchen sich nicht verstecken. Sie sind nahezu vollständig in die Kontrollen des wirtschaftseigenen QS-Programms eingebunden, auch sind sie Vorreiter für eine Selbstverpflichtung, die Ferkelkastration nur noch mit Schmerzbehandlung durchzuführen und sie bemühen sich intensiv um die Einführung der Jungebermast als Alternative zur chirurgischen Kastration. Darüber hinaus beteiligen sich die Schweinehalter aktuell an einer gemeinsamen Initiative mit dem LEH zur Verbesserung des Tierwohls in den Betrieben, über den gesetzlichen Standard hinaus. Generell wird die Notwendigkeit erkannt, Kritik und Wünsche der Kunden sehr sorgfältig zu sortieren und zu analysieren. Hierbei gilt es einerseits, dem Wertewandel in unserer Wohlstandsgesellschaft angemessen Rechnung zu tragen; andererseits sind die Landwirte dem harten Kostendruck und Wettbewerb des freien Marktes ungeschützt ausgesetzt. Sie können sich daher nicht auf Forderungen einlassen, für die es letztlich keine Käufernachfrage gibt bzw. die nicht angemessen honoriert werden. Sie würden dadurch die Existenz ihrer bäuerlichen Betriebe gefährden. Der Zentralverband der Deutschen Schweineproduktion e. V. (ZDS) nimmt die Vorwürfe ernst und bezieht klare Positionen. So ist grundsätzlich festzustellen, dass die Zuchtorganisationen sich ihrer Verantwortung im Sinne des Tierschutzes bewusst sind und entsprechend handeln. Herausragendes Beispiel hier für ist die züchteri- 106 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
107 ZDS sche Verdrängung einer Genmutation, die eng mit der Stressanfälligkeit (MHS) korreliert ist. Gleichzeitig wurde auf die Züchtung extrem ausgeprägter»muskel-typen«verzichtet. Weitere Beispiele sind die erfolgreiche Züchtung gegen die so genannte Bananenkrankheit und die Züchtung auf Gelenkstabilität. Aktuell richtet sich das besondere Augenmerk der Zuchtorganisationen u. a. auf das Sozialverhalten der Tiere (z. B. Mütterlichkeit und Aggressionsverhalten) sowie auf die Gesäugefunktion (Anzahl und Funktionsfähigkeit der Zitzen). Auch das Ferkel-Geburtsgewicht ist in diesem Zusammenhang als Zuchtziel zu nennen (Ausgeglichenheit der Würfe und Vitalität der Ferkel). Dank der modernen Hybrid- und Kreuzungszucht mit mehreren Ausgangslinien ist es möglich, verschiedene Zuchtziele gleichzeitig zu verfolgen, ohne die ökonomisch herausragenden Merkmale der Reproduktionsleistung sowie der Mastleistung und des Schlachtkörperwertes zu vernachlässigen. Die Zucht- und Besamungsorganisationen investieren jährlich erhebliche Summen in die Forschung, auf der Suche nach aussagekräftigen Parametern für die Selektion auf Robustheit, Gesundheit und auf weitere wichtige Merkmale zur Verbesserung des Tierwohls. Der Schutz und das Wohlbefinden der Tiere hängt von einer Vielzahl Einflussfaktoren ab, die im Wesentlichen durch das Management der Betriebe beeinflusst werden können. Abgesehen davon, dass die Wissenschaft noch nach Indikatoren sucht, die als eindeutiger und einfach messbarer Maßstab für den Tierschutz bzw. das Tierwohl herangezogen werden können, sind oftmals Kompromisse erforderlich. So kollidieren Vorstellungen zur tierschutzgerechten Haltung z. T. mit Ansprüchen des Umwelt- und Klimaschutzes sowie mit Vorgaben zur Lebensmittelsicherheit oder auch mit Anforderungen des Arbeitsschutzes. Das gilt z. B. für Staub- und Ammoniakemission durch Einstreu, für Infektionsrisiken bei Freilandhaltung und die Unfallgefahr mit Sauen in freier Abferkelung. Frei von Schmerz, Krankheit und Verletzung Frei von Angst und vermeidbarer Belastung Freiheit zur Ausübung artgemäßen Verhaltens Auch hierzu gibt es wie nicht anders zu erwarten unterschiedliche Auslegungen, bis hin zu der Forderung, das Verhalten von Wildschweinen zugrunde zu legen. Ziel der nationalen»initiative Tierwohl«ist es u. a., die verschiedenen Vorstellungen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen und mit Hilfe finanzieller Anreize über den gesetzlichen Standard hinaus weitere Verbesserungen zu erreichen. Letztlich werden das Einkaufsverhalten und die Wahrnehmung der Verbraucher über den Erfolg dieser Initiative entscheiden. Parallel besteht die Notwendigkeit, unberechtigte Vorwürfe zu entkräften sowie Transparenz und Verantwortungsbewusstsein zu demonstrieren. Nur so wird es gelingen, das Vertrauen der Gesellschaft zu sichern. Alle Schweinehalter sind betroffen und gefordert, sich entsprechend zu engagieren vor Ort und im bundesweiten Verbund. Der Zentralverband der Deutschen Schweineproduktion (ZDS) bietet gerne Hilfe und Unterstützung an. PIC-Camborough GesPICkt mit den erfolgreichsten Genen! 12 Ferkel ab- und weniger als 10 dt Futter eingesetzt! * Generell gilt 1 des Tierschutzgesetzes als Maßstab, wonach den Tieren keine vermeidbaren Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden dürfen. Allerdings gibt es hierzu recht unterschiedliche Interpretationen, wie die Diskussionen und Auslegungsdifferenzen zur Nutztierhaltungsverordnung zeigen. * Ergebnisse des Versuchs Analyse von Managementaspekten der PIC-Sau im LVZ Futterkamp Auf internationaler Ebene orientiert sich die Tierschutzdiskussion in der Regel an den so genannten 5 Freiheiten: PIC Deutschland GmbH Ratsteich Schleswig Tel.: Fax: pic.deutschland@genusplc.com Die Gene des Erfolgs Frei von Hunger, Durst und Fehlernährung Frei von ungeeigneter Unterbringung A Company Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 107
108 MITARBEITER MITGLIEDER DES VORSTANDES TELEFON FAX Welling, Gisbert (Vors.) Brakel-Hampenhausen Rotgeri, Ulrich (Stellv.) Geseke Heiming, Bernhard Dorsten-Lembeck Lödige, Werner Steinheim MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES aufsichtsrat@erzeugerring.com TELEFON FAX Hüppe, Franz-Josef (Vors.) Hörstel-Riesenbeck Schwienhorst, Georg (Stellv.) Warendorf-Hoetmar Dietz, Theo Möhnesee-Westrich Große Lutermann, Hubert Schöppingen Hölker, Stephan Velen Lohmann, Heinrich Ascheberg Rolf, Hubertus Delbrück-Westenholz Schulze zur Wiesch, Philipp Bad Sassendorf Streyl, Christian Dülmen ERZEUGERRING WESTFALEN EG info@erzeugerring.com TELEFON FAX Geschäftsstelle Senden Senden, Am Dorn Mitglieder des Vorstandes Mitglieder des Aufsichtsrates 108 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
109 Erzeugerring Westfalen MITARBEITER DER GESCHÄFTSSTELLE SENDEN: Freisfeld, Georg kom. Geschäftsführer Averesch, Stefan Brand, Ingrid Fauler, Nicole RINGBERATER: Hinken, Reinhard Berger, Markus M: Fax Bosse, Hans M: Fax Breuer, Martin M: Fax Brinkmann, Andreas M: Fax Debbert, Bernd M: Fax Eling, Franz-Josef M: Fax Fechler, Kristin M: Fax Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 109
110 RINGBERATER: Hagedorn, Heinz-Wilhelm M: Fax Husemann, Sebastian M: Fax Kemper, Rainer M: Fax Klüppel, Josef M: Fax Michel, Ann-Katrin M: Fax Münstermann, Sabrina M: Fax Raming, Josef M: Fax Schulze Westerath, Ute M: Fax Sprenker, Elisabeth derzeit in Elternzeit Strukamp, Johannes M: Fax Wernsmann, Christian M: Fax Winkelkötter, Werner M: Fax Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
111 Erzeugerring Westfalen NOTIZEN Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 111
112 NOTIZEN 112 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
113 Erzeugerring Westfalen Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 113
114 NOTIZEN IMPRESSUM Herausgeber: Erzeugerring Westfalen eg, Am Dorn 10, Senden-Bösensell verantwortlich für den Inhalt: Georg Freisfeld, kom. Geschäftsführer, Redaktion: Nicole Fauler, Erzeugerring Westfalen Bildnachweis: Autoren, ERW, Landwirtschaftliches Wochenblatt Konzeption, Entwurf und Realisation: VISUELLE KOMMUNIKATION Vera Schäper, Druck: Druckerei Limberg KG 2013 / 2014 Erzeugerring Westfalen. Nachdruck auch auszugsweise nur mit Genehmigung des Herausgebers / Autors. Die mit Autorennamen versehenen Beiträge geben die Meinung der jeweiligen Verfasser wieder und sind keine Texte des ERW. Bei Anregungen oder Diskussionsbedarf wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Autoren. 114 Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
115 Die Zukunft der Impfung IDAL Nadellose intradermale Impfung für Schweine Wissenschaftlich bewiesene Wirksamkeit und Sicherheit Keine Erregerübertragung bei der Impfung Bediener- und tierfreundlich Für die intradermale Impfung mit zugelassenen Impfstoffen von MSD Tiergesundheit IDAL Intradermal impfen Intervet Deutschland GmbH ein Unternehmen der MSD Tiergesundheit Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen 113 P-201
116 Wühlen, Lecken, Spielen Das Wohlwühl -Programm + Präventive Wirkung gegen Kannibalismus und Stress + Garantiert eine fortwährende Beschäftigung Zu beziehen bei Ihren Raiffeisen- Verbundpartnern, Genossenschaften und BayWa-Agrarbetrieben. 1. PIGLYX-Trog platzieren 2. PIGLYX einsetzen 3. Wohlwühlen! Hotline (gebührenfrei) Jahresbericht 2013 Erzeugerring Westfalen
Vergleich der Schweinemast in Stallungen konventioneller und alternativer Bauweise
 Februar 13 Vergleich der Schweinemast in Stallungen konventioneller und alternativer Bauweise Jürgen Mauer, LSZ Boxberg Zunehmende Ansprüche des Tier- und Verbraucherschutzes für eine nachhaltige Produktion
Februar 13 Vergleich der Schweinemast in Stallungen konventioneller und alternativer Bauweise Jürgen Mauer, LSZ Boxberg Zunehmende Ansprüche des Tier- und Verbraucherschutzes für eine nachhaltige Produktion
Fleischwerk EDEKA Nord GmbH. Zukünftige Schweineproduktion aus der Sicht des LEH
 Fleischwerk EDEKA Nord GmbH Zukünftige Schweineproduktion aus der Sicht des LEH Regionaler Auftritt und Kompetenz sind Stärken in der Vermarktung Regionalität Nähe schafft Vertrauen, zeigt her eure modernen
Fleischwerk EDEKA Nord GmbH Zukünftige Schweineproduktion aus der Sicht des LEH Regionaler Auftritt und Kompetenz sind Stärken in der Vermarktung Regionalität Nähe schafft Vertrauen, zeigt her eure modernen
Wirtschaftlichkeit der Schweinehaltung in verschiedenen Regionen
 Wirtschaftlichkeit der Schweinehaltung in verschiedenen Regionen KTBL Fachgespräch Emissionsminderung und Abluftreinigung 11.-12.09.2014 in Hannover Stefan Leuer, Landwirtschaftskammer NRW, FB 51 Gliederung
Wirtschaftlichkeit der Schweinehaltung in verschiedenen Regionen KTBL Fachgespräch Emissionsminderung und Abluftreinigung 11.-12.09.2014 in Hannover Stefan Leuer, Landwirtschaftskammer NRW, FB 51 Gliederung
Ferkel mit einem hohen Wachstumsvermögen benötigen höhere Gehalte an Aminosäuren
 Ferkel mit einem hohen Wachstumsvermögen benötigen höhere Gehalte an Aminosäuren Dr. Gerhard Stalljohann, LWK NRW, Münster Sybille Patzelt, LWK NRW, Landwirtschaftszentrum Haus Düsse, 59505 Bad Sassendorf
Ferkel mit einem hohen Wachstumsvermögen benötigen höhere Gehalte an Aminosäuren Dr. Gerhard Stalljohann, LWK NRW, Münster Sybille Patzelt, LWK NRW, Landwirtschaftszentrum Haus Düsse, 59505 Bad Sassendorf
Ebermast: Rechnen sich Alternativen besser?
 Ebermast: Rechnen sich Alternativen besser? Die Kastration ohne Schmerzausschaltung ist verboten. Doch welche Alternative rechnet sich am besten? Ist es das verfahren, die Ebermast oder doch die Impfung
Ebermast: Rechnen sich Alternativen besser? Die Kastration ohne Schmerzausschaltung ist verboten. Doch welche Alternative rechnet sich am besten? Ist es das verfahren, die Ebermast oder doch die Impfung
Gewinnerprojekt im Landeswettbewerb Ernährung.NRW. Antonia M. Riedl (Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband)
 Gewinnerprojekt im Landeswettbewerb Ernährung.NRW 3. Ringvorstandssitzung 2012 Antonia M. Riedl (Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband) Warum ist Tiergesundheit so wichtig? Export wichtig für Preis
Gewinnerprojekt im Landeswettbewerb Ernährung.NRW 3. Ringvorstandssitzung 2012 Antonia M. Riedl (Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband) Warum ist Tiergesundheit so wichtig? Export wichtig für Preis
Antibiotika in der Nutztierhaltung - Position der Schweineproduktion -
 Antibiotika in der Nutztierhaltung - Position der Schweineproduktion - Dr. Jürgen Harlizius Leiter Schweinegesundheitsdienst Landwirtschaftskammer NRW (Mitglied im Zentralverband der Deutschen Schweineproduktion
Antibiotika in der Nutztierhaltung - Position der Schweineproduktion - Dr. Jürgen Harlizius Leiter Schweinegesundheitsdienst Landwirtschaftskammer NRW (Mitglied im Zentralverband der Deutschen Schweineproduktion
Wie viel frisst ein Schwein? Bedarfsgerechte Fütterung als Grundlage des Erfolges
 Wie viel frisst ein Schwein? Bedarfsgerechte Fütterung als Grundlage des Erfolges Dr. Gerhard Stalljohann Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Münster Dr. Gerhard Stalljohann 1 02 51 / 23 76-8 60
Wie viel frisst ein Schwein? Bedarfsgerechte Fütterung als Grundlage des Erfolges Dr. Gerhard Stalljohann Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Münster Dr. Gerhard Stalljohann 1 02 51 / 23 76-8 60
Die Impfung gegen Salmonella Typhimurium Ein Bestandteil in der Salmonellenbekämpfung
 Die Impfung gegen Salmonella Typhimurium Ein Bestandteil in der Salmonellenbekämpfung IDT Biologika Dr. Monika Köchling, 18.01.2016 Salmonellenmonitoring QS aktuelle Situation Quelle: May 2015 2 Salmonellenmonitoring
Die Impfung gegen Salmonella Typhimurium Ein Bestandteil in der Salmonellenbekämpfung IDT Biologika Dr. Monika Köchling, 18.01.2016 Salmonellenmonitoring QS aktuelle Situation Quelle: May 2015 2 Salmonellenmonitoring
Wo stehen wir bei der Initiative Tierwohl in Deutschland, in Europa und in der Welt
 Interessengemeinschaft der Erzeugerzusammenschlüsse in Sachsen e.v. Limbach-Oberfrohna, 14.02.2014 Wo stehen wir bei der Initiative Tierwohl in Deutschland, in Europa und in der Welt Roger Fechler Deutscher
Interessengemeinschaft der Erzeugerzusammenschlüsse in Sachsen e.v. Limbach-Oberfrohna, 14.02.2014 Wo stehen wir bei der Initiative Tierwohl in Deutschland, in Europa und in der Welt Roger Fechler Deutscher
1. Lückentext. Aus dem Leben eines Schweins aus konventioneller Haltung (AB 01)
 1. Lückentext Aus dem Leben eines Schweins aus r (AB 01) Lies dir folgenden Text durch und fülle die Lücken aus. Besuche die Sau im virtuellen Schweinestall, um die fehlenden Informationen herauszufinden.
1. Lückentext Aus dem Leben eines Schweins aus r (AB 01) Lies dir folgenden Text durch und fülle die Lücken aus. Besuche die Sau im virtuellen Schweinestall, um die fehlenden Informationen herauszufinden.
Schweine bis 140 kg mästen?
 Schweine bis 140 mästen? Für weiter steiende Endewichte sprechen weder die Preismasken noch der zum Mastende überproportional zunehmende Futterverbrauch. Doch Ereinisse, wie z.b. die Dioxinkrise oder der
Schweine bis 140 mästen? Für weiter steiende Endewichte sprechen weder die Preismasken noch der zum Mastende überproportional zunehmende Futterverbrauch. Doch Ereinisse, wie z.b. die Dioxinkrise oder der
Wie werden Zahlungen im Rahmen der Initiative Tierwohl umsatzsteuerlich behandelt?
 Nachfolgend haben wir häufig gestellte Fragen und die entsprechenden Antworten zur Teilnahme an der Initiative Tierwohl für Schweinehalter zusammengestellt. Wie werden Zahlungen im Rahmen der Initiative
Nachfolgend haben wir häufig gestellte Fragen und die entsprechenden Antworten zur Teilnahme an der Initiative Tierwohl für Schweinehalter zusammengestellt. Wie werden Zahlungen im Rahmen der Initiative
Lämmer mit Rapsschrot mästen
 Lämmer mit Rapsschrot mästen Christian Koch und Dr. Franz-Josef Romberg, Dienstleistungszentum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz, Hofgut Neumühle Rapsextraktionsschrot hat sich in der Rinderfütterung als
Lämmer mit Rapsschrot mästen Christian Koch und Dr. Franz-Josef Romberg, Dienstleistungszentum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz, Hofgut Neumühle Rapsextraktionsschrot hat sich in der Rinderfütterung als
Actinobacillus pleuropneumoniae Infektion, Verbesserung der Diagnostik
 Actinobacillus pleuropneumoniae Infektion, Verbesserung der Diagnostik Dr. Sylvia Baier, LWK Niedersachsen, Schweinegesundheitsdienst, Dr. Jens Brackmann, LWK Niedersachsen, Institut für Tiergesundheit
Actinobacillus pleuropneumoniae Infektion, Verbesserung der Diagnostik Dr. Sylvia Baier, LWK Niedersachsen, Schweinegesundheitsdienst, Dr. Jens Brackmann, LWK Niedersachsen, Institut für Tiergesundheit
Qualität und Service für Ihren Erfolg!
 Qualität und Service für Ihren Erfolg! uverlässigkeit Zuverlässigkeit, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit: Wir liefern, Sie profitieren Wir haben einiges zu bieten: fruchtbare und stabile DanZucht-Sauen (fester
Qualität und Service für Ihren Erfolg! uverlässigkeit Zuverlässigkeit, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit: Wir liefern, Sie profitieren Wir haben einiges zu bieten: fruchtbare und stabile DanZucht-Sauen (fester
Gesunde Tiere gesunde Lebensmittel
 Fachhochschule Südwestfalen Wir geben Impulse Gesunde Tiere gesunde Lebensmittel SCHWEINETAG 2013 Mecklenburg-Vorpommern Güstrow 23. Oktober Marcus Mergenthaler Christiane Wildraut Fachbereich Agrarwirtschaft
Fachhochschule Südwestfalen Wir geben Impulse Gesunde Tiere gesunde Lebensmittel SCHWEINETAG 2013 Mecklenburg-Vorpommern Güstrow 23. Oktober Marcus Mergenthaler Christiane Wildraut Fachbereich Agrarwirtschaft
DIE ZEIT IST REIF- IMPFEN GEGEN DIE ÖDEMKRANKHEIT
 DIE ZEIT IST REIF- IMPFEN GEGEN DIE ÖDEMKRANKHEIT Schweinetag Sachsen-Anhalt Iden 28.10.2014 Dr. Kathrin Lillie-Jaschniski IDT Biologika GmbH Gliederung Diagnose Prophylaxe/Therapie Feldstudien Zusammenfassung
DIE ZEIT IST REIF- IMPFEN GEGEN DIE ÖDEMKRANKHEIT Schweinetag Sachsen-Anhalt Iden 28.10.2014 Dr. Kathrin Lillie-Jaschniski IDT Biologika GmbH Gliederung Diagnose Prophylaxe/Therapie Feldstudien Zusammenfassung
Wirtschaftlichkeit der Ferkelerzeugung Trends und Perspektiven
 ALB Fachtagung Ferkelerzeugung 13. März 2014 Wirtschaftlichkeit der Ferkelerzeugung Trends und Perspektiven, LEL Schwäbisch Gmünd ALB Fachtagung Ferkelerzeugung am 13.3.2014 Stuttgart-Hohenheim Folie 1
ALB Fachtagung Ferkelerzeugung 13. März 2014 Wirtschaftlichkeit der Ferkelerzeugung Trends und Perspektiven, LEL Schwäbisch Gmünd ALB Fachtagung Ferkelerzeugung am 13.3.2014 Stuttgart-Hohenheim Folie 1
Mast- und Schlachtleistung sowie Wirtschaftlichkeit von Ebern im Vergleich zu Sauen und Kastraten
 Mast- und Schlachtleistung sowie Wirtschaftlichkeit von Ebern im Vergleich zu Sauen und Kastraten Henrik Delfs, Winfried Matthes, Dörte Uetrecht, Annemarie Müller, Kirsten Büsing, Helmuth Claus, Klaas
Mast- und Schlachtleistung sowie Wirtschaftlichkeit von Ebern im Vergleich zu Sauen und Kastraten Henrik Delfs, Winfried Matthes, Dörte Uetrecht, Annemarie Müller, Kirsten Büsing, Helmuth Claus, Klaas
Gesundheitsprophylaxe bei Kälbern - eine Möglichkeit zur Bekämpfung der Paratuberkulose. Dr. Ulrike Hacker Rindergesundheitsdienst der TSK M-V
 Gesundheitsprophylaxe bei Kälbern - eine Möglichkeit zur Bekämpfung der Paratuberkulose Dr. Ulrike Hacker Rindergesundheitsdienst der TSK M-V Die Paratuberkulose ist eine Tierseuche und Zoonose mit wachsender
Gesundheitsprophylaxe bei Kälbern - eine Möglichkeit zur Bekämpfung der Paratuberkulose Dr. Ulrike Hacker Rindergesundheitsdienst der TSK M-V Die Paratuberkulose ist eine Tierseuche und Zoonose mit wachsender
Energieverbrauch und Einsparpotenzial im Sauenstall
 Energieeinsparung im Sauenstall ab 10 Uhr: Energieverbrauch und Einsparpotenzial im Sauenstall Bernhard Feller, Landwirtschaftskammer NRW Mit korrekter Einstellung der Regelgeräte die Luftraten dem Bedarf
Energieeinsparung im Sauenstall ab 10 Uhr: Energieverbrauch und Einsparpotenzial im Sauenstall Bernhard Feller, Landwirtschaftskammer NRW Mit korrekter Einstellung der Regelgeräte die Luftraten dem Bedarf
Fleischmärkte und Zukunftsstrategien Perspektiven aus Sicht der Tönnies Unternehmensgruppe. Clemens Tönnies,
 Fleischmärkte und Zukunftsstrategien Perspektiven aus Sicht der Tönnies Unternehmensgruppe Clemens Tönnies, 25.10.2016 Agenda 1. Unser Unternehmen 2. Markt- und Rahmenbedingungen 3. Unsere Antworten 4.
Fleischmärkte und Zukunftsstrategien Perspektiven aus Sicht der Tönnies Unternehmensgruppe Clemens Tönnies, 25.10.2016 Agenda 1. Unser Unternehmen 2. Markt- und Rahmenbedingungen 3. Unsere Antworten 4.
Bedarf für Schadenbewertung und Gutachten in der Tierproduktion
 Klauenerkrankungen in der Schweineproduktion Ökonomische Auswirkungen ALB Ba.-Wü., Uni Hohenheim, 28. Februar 2008 Dr. Günter Grandjot Landwirtschaftliches Sachverständigen- und Beratungsbüro Dr. Schulze
Klauenerkrankungen in der Schweineproduktion Ökonomische Auswirkungen ALB Ba.-Wü., Uni Hohenheim, 28. Februar 2008 Dr. Günter Grandjot Landwirtschaftliches Sachverständigen- und Beratungsbüro Dr. Schulze
Voraussetzungen Steuer- & Baurecht
 1 Voraussetzungen Steuer- & Baurecht Definition Landwirtschaft Im Steuerrecht (BewG) über die Vieheinheiten (VE) je produziertes MS 0,12 VE, wenn Ferkel über 30kg 0,10 VE für 1.000 Mastplätze ca. 35 ha
1 Voraussetzungen Steuer- & Baurecht Definition Landwirtschaft Im Steuerrecht (BewG) über die Vieheinheiten (VE) je produziertes MS 0,12 VE, wenn Ferkel über 30kg 0,10 VE für 1.000 Mastplätze ca. 35 ha
Futterkosten in der Schweinemast reduzieren
 Futterkosten in der Schweinemast reduzieren Jede Möglichkeit, die Futterkosten zu senken, sollte ausgeschöpft werden, um angesichts der aktuellen Futterpreise zurechtzukommen. Was bei der Schweinefütterung
Futterkosten in der Schweinemast reduzieren Jede Möglichkeit, die Futterkosten zu senken, sollte ausgeschöpft werden, um angesichts der aktuellen Futterpreise zurechtzukommen. Was bei der Schweinefütterung
Pressekonferenz. Referent: Dr. Alexander Hinrichs, Geschäftsführer Moderation: Marcus Arden, top agrar
 Pressekonferenz Referent: Dr. Alexander Hinrichs, Geschäftsführer Moderation: Marcus Arden, top agrar Initiative Tierwohl: Überblick Erstmalig in Deutschland: Das branchenübergreifende Bündnis von Unternehmen
Pressekonferenz Referent: Dr. Alexander Hinrichs, Geschäftsführer Moderation: Marcus Arden, top agrar Initiative Tierwohl: Überblick Erstmalig in Deutschland: Das branchenübergreifende Bündnis von Unternehmen
Bewertung der Abluftreinigung als Kostenposition in der Schweinehaltung
 Institut für Betriebswirtschaft Bewertung der Abluftreinigung als Kostenposition in der Schweinehaltung Berechnungen für das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Dr. Gerhard
Institut für Betriebswirtschaft Bewertung der Abluftreinigung als Kostenposition in der Schweinehaltung Berechnungen für das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Dr. Gerhard
Schweinefleischimporte im Jahre 2008
 Deutscher Ferkel- und Schweinemarkt Positionierung auf den internationalen Märkten Ulrich Pohlschneider ISN Interessengem. der Schweinehalter Deutschlands e.v. Aktuelle Situation Der Selbstversorgungsgrad
Deutscher Ferkel- und Schweinemarkt Positionierung auf den internationalen Märkten Ulrich Pohlschneider ISN Interessengem. der Schweinehalter Deutschlands e.v. Aktuelle Situation Der Selbstversorgungsgrad
Entwicklungsperspektiven landwirtschaftlicher Betriebe in Südoldenburg eine betriebswirtschaftliche Analyse vor dem Hintergrund der Standortwahl
 Entwicklungsperspektiven landwirtschaftlicher Betriebe in Südoldenburg eine betriebswirtschaftliche Analyse vor dem Hintergrund der Standortwahl Gliederung Struktur der Schweinehaltung in D und Niedersachsen
Entwicklungsperspektiven landwirtschaftlicher Betriebe in Südoldenburg eine betriebswirtschaftliche Analyse vor dem Hintergrund der Standortwahl Gliederung Struktur der Schweinehaltung in D und Niedersachsen
Tierbezogene Merkmale nach 11 (8) TierSchG: Gesetzliche Verpflichtung und hilfreiches Werkzeug
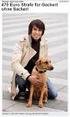 www.hfwu.de Seite 1 Tierbezogene Merkmale nach 11 (8) TierSchG: Gesetzliche Verpflichtung und hilfreiches Werkzeug Thomas Richter und Maxi Karpeles ALB, Schwäbisch Hall, 25.03.2015 Seite 2 TierSchG 11
www.hfwu.de Seite 1 Tierbezogene Merkmale nach 11 (8) TierSchG: Gesetzliche Verpflichtung und hilfreiches Werkzeug Thomas Richter und Maxi Karpeles ALB, Schwäbisch Hall, 25.03.2015 Seite 2 TierSchG 11
Rapsextraktionsschrot in Ergänzung zu Soja in der Jungebermast
 Rapsextraktionsschrot in Ergänzung zu Soja in der Jungebermast Erfahrungsbericht über eine rund 10- monatige Praxisbeobachtung in der Schweinmast der Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung H. Neumühle.
Rapsextraktionsschrot in Ergänzung zu Soja in der Jungebermast Erfahrungsbericht über eine rund 10- monatige Praxisbeobachtung in der Schweinmast der Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung H. Neumühle.
Managementtraining Sauenhaltung für zukünftige Führungskräfte
 Managementtraining Sauenhaltung für zukünftige Führungskräfte Zukunft der Schweinehaltung in Nordwestdeutschland vom 11. bis 15. August 2003 im Kardinal-von-Galen-Haus in Stapelfeld Detlef Breuer, Interessengemeinschaft
Managementtraining Sauenhaltung für zukünftige Führungskräfte Zukunft der Schweinehaltung in Nordwestdeutschland vom 11. bis 15. August 2003 im Kardinal-von-Galen-Haus in Stapelfeld Detlef Breuer, Interessengemeinschaft
Tierwohl in der Nutztierhaltung. Tierhaltung braucht gesellschaftliche Akzeptanz
 34 Tierhaltung braucht gesellschaftliche Akzeptanz Der Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV), Johannes Röring, und der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes (DTSB), Thomas
34 Tierhaltung braucht gesellschaftliche Akzeptanz Der Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV), Johannes Röring, und der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes (DTSB), Thomas
Eine hohe Zahl verkaufter Ferkel pro Sau und Jahr heißt vor allem, die geborenen Ferkel am Leben zu erhalten und die gesamt geborenen zu steigern.
 Ferkelzahl Eine hohe Zahl verkaufter Ferkel pro Sau und Jahr heißt vor allem, die geborenen Ferkel am Leben zu erhalten und die gesamt geborenen zu steigern. Ferkelanzahl pro ZS und Wurf durchschnittlicher
Ferkelzahl Eine hohe Zahl verkaufter Ferkel pro Sau und Jahr heißt vor allem, die geborenen Ferkel am Leben zu erhalten und die gesamt geborenen zu steigern. Ferkelanzahl pro ZS und Wurf durchschnittlicher
Schweineproduktion wächst weltweit Produktionskosten wesentlich. ist mehr getan als gedacht! aber. gesagt Herwig Grimm. Gesagt ist nicht getan,
 Schweineproduktion wächst weltweit Produktionskosten wesentlich Inhalt aber ist mehr getan als gedacht! Bereich Themen Gesagt ist nicht getan, gesagt Herwig Grimm Fleischproduktion Preise und Kosten Wer
Schweineproduktion wächst weltweit Produktionskosten wesentlich Inhalt aber ist mehr getan als gedacht! Bereich Themen Gesagt ist nicht getan, gesagt Herwig Grimm Fleischproduktion Preise und Kosten Wer
Puten werden in Deutschland in Bodenhaltung und getrennt nach Geschlecht gehalten.
 1 Haltungsformen Puten werden in Deutschland in Bodenhaltung und getrennt nach Geschlecht gehalten. Abb. 1: Puten in Bodenhaltung Quelle: S. Freiwald Auch die Aufzucht und Mast werden als getrennte Phasen
1 Haltungsformen Puten werden in Deutschland in Bodenhaltung und getrennt nach Geschlecht gehalten. Abb. 1: Puten in Bodenhaltung Quelle: S. Freiwald Auch die Aufzucht und Mast werden als getrennte Phasen
Unternehmerische Entwicklungsstrategien in der Ferkelerzeugung
 Praxis Unternehmerische Entwicklungsstrategien in der Ferkelerzeugung Marktchancen Der Schweinefleischmarkt wird in den kommenden Jahren für die Landwirte sowohl Chancen als auch Herausforderungen bereithalten.
Praxis Unternehmerische Entwicklungsstrategien in der Ferkelerzeugung Marktchancen Der Schweinefleischmarkt wird in den kommenden Jahren für die Landwirte sowohl Chancen als auch Herausforderungen bereithalten.
Redemittel zur Beschreibung von Schaubildern, Diagrammen und Statistiken
 Balkendiagramm Säulendiagramm gestapeltes Säulendiagramm Thema Thema des Schaubildes / der Grafik ist... Die Tabelle / das Schaubild / die Statistik / die Grafik / das Diagramm gibt Auskunft über... Das
Balkendiagramm Säulendiagramm gestapeltes Säulendiagramm Thema Thema des Schaubildes / der Grafik ist... Die Tabelle / das Schaubild / die Statistik / die Grafik / das Diagramm gibt Auskunft über... Das
Impfen wir zuviel? Dr. Ricarda Steinheuer Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
 Impfen wir zuviel? Dr. Ricarda Steinheuer Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Wie Wie oft oft wollen wollen Sie Sie denn denn noch noch impfen? impfen? Impfen Sie zuviel? Warum handelsüblich oder bestandsspezifisch?
Impfen wir zuviel? Dr. Ricarda Steinheuer Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Wie Wie oft oft wollen wollen Sie Sie denn denn noch noch impfen? impfen? Impfen Sie zuviel? Warum handelsüblich oder bestandsspezifisch?
Initiative Tierwohl: Vergleich der Wahlpflicht- und Wahlkriterien mit der österreichischen Gesetzeslage.
 Initiative Tierwohl: Vergleich der Wahlpflicht und Wahlkriterien mit der österreichischen Gesetzeslage. Einen LANDWIRT Fachartikel dazu finden Sie in der LANDWIRT Ausgabe 16/2015. Kriterium Wahlpflichtkriterien
Initiative Tierwohl: Vergleich der Wahlpflicht und Wahlkriterien mit der österreichischen Gesetzeslage. Einen LANDWIRT Fachartikel dazu finden Sie in der LANDWIRT Ausgabe 16/2015. Kriterium Wahlpflichtkriterien
Kosten 8,0 kg LG (25 abgesetzte Ferkel)
 Situation in der EU - () Moderne Management- und Fütterungsmethoden zur dauerhaften Realisierung von Spitzenleistungen! Durchschnittliche Betriebsgröße =, ha! % der Betriebe haben unter ha LN! Ökobetriebe:
Situation in der EU - () Moderne Management- und Fütterungsmethoden zur dauerhaften Realisierung von Spitzenleistungen! Durchschnittliche Betriebsgröße =, ha! % der Betriebe haben unter ha LN! Ökobetriebe:
FIREWALL COIN. Deckungsbeitrag einer Influenzaimpfung
 FIREWALL COIN Deckungsbeitrag einer Influenzaimpfung Influenzainfektionen wirken sich negativ auf das Betriebsergebnis aus Ermitteln Sie mit COIN - Calculate Online Individual Netprofit - den von der IDT
FIREWALL COIN Deckungsbeitrag einer Influenzaimpfung Influenzainfektionen wirken sich negativ auf das Betriebsergebnis aus Ermitteln Sie mit COIN - Calculate Online Individual Netprofit - den von der IDT
(um die Fragen schwieriger zu gestalten, einfach Antwortmöglichkeiten nicht vorlesen) A: Im Boden. A: Ja. B: 5 Ferkel C: 1 Ferkel.
 Fragekarten (um die Fragen schwieriger zu gestalten, einfach Antwortmöglichkeiten nicht vorlesen) Wie viel Liter Milch gibt eine Kuh täglich? A: 35 Liter B: 15 Liter C: 22 Liter Wo/wie helfen Regenwürmer
Fragekarten (um die Fragen schwieriger zu gestalten, einfach Antwortmöglichkeiten nicht vorlesen) Wie viel Liter Milch gibt eine Kuh täglich? A: 35 Liter B: 15 Liter C: 22 Liter Wo/wie helfen Regenwürmer
proagrarvet Tierärztegesellschaft mbh Marbecker Straße 6 46325 Borken Dr. Christoph Große-Kock
 Erfahrungen aus der angewanden Ultraschalldiagnostik proagrarvet Tierärztegesellschaft mbh Marbecker Straße 6 46325 Borken Dr. Christoph Große-Kock Anwendungsbereiche 1. 2. 3. Trächtigkeitsuntersuchungen
Erfahrungen aus der angewanden Ultraschalldiagnostik proagrarvet Tierärztegesellschaft mbh Marbecker Straße 6 46325 Borken Dr. Christoph Große-Kock Anwendungsbereiche 1. 2. 3. Trächtigkeitsuntersuchungen
Preisschwankungen am Futtermittelmarkt mit starkem Einfluss auf die Rendite in der Schweineproduktion
 LANDESBETRIEB LANDWIRTSCHAFT HESSEN Kassel, 18. Februar 2013 Preisschwankungen am Futtermittelmarkt mit starkem Einfluss auf die Rendite in der Schweineproduktion Seit einiger Zeit sind die Alleinfutterkosten
LANDESBETRIEB LANDWIRTSCHAFT HESSEN Kassel, 18. Februar 2013 Preisschwankungen am Futtermittelmarkt mit starkem Einfluss auf die Rendite in der Schweineproduktion Seit einiger Zeit sind die Alleinfutterkosten
Immer mehr Kinder kriegen Kinder Immer mehr Teenies treiben ab
 Immer mehr Kinder kriegen Kinder Immer mehr Teenies treiben ab Schwangerschaftsabbrüche bei Mädchen im Kindesalter haben auch 2002 in Deutschland weiter zugenommen Während die Zahl der Abtreibungen 2002
Immer mehr Kinder kriegen Kinder Immer mehr Teenies treiben ab Schwangerschaftsabbrüche bei Mädchen im Kindesalter haben auch 2002 in Deutschland weiter zugenommen Während die Zahl der Abtreibungen 2002
Stand Ferkelkastration Ebermast
 Stand Ferkelkastration Ebermast Dr.Th.Paulke 0 Gliederung Ausgangssituation Ebergeruch Methoden zur Vermeidung Praxisergebnisse Ebermast 1 rechtliche Situation EU - D EU EU Richtlinie 2001/93/EU --Kastration
Stand Ferkelkastration Ebermast Dr.Th.Paulke 0 Gliederung Ausgangssituation Ebergeruch Methoden zur Vermeidung Praxisergebnisse Ebermast 1 rechtliche Situation EU - D EU EU Richtlinie 2001/93/EU --Kastration
Neues aus der Vermarktung von Biofleisch bei Schwein und Rind
 Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG Neues aus der Vermarktung von Biofleisch bei Schwein und Rind Herrsching, 22.11.2016 Tomás Sonntag, Ressortleiter Tierische Produkte Marktgesellschaft der Naturland
Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG Neues aus der Vermarktung von Biofleisch bei Schwein und Rind Herrsching, 22.11.2016 Tomás Sonntag, Ressortleiter Tierische Produkte Marktgesellschaft der Naturland
Aktuelle Ergebnisse zur Ebermast
 Aktuelle Ergebnisse zur Ebermast Winfried Matthes, Dörte Uetrecht, Hanne Christina Schulz, Annemarie Müller und Henrik Delfs Schweinetag Mecklenburg-Vorpommern Güstrow, 23. Oktober 2013 Das Verbundprojekt
Aktuelle Ergebnisse zur Ebermast Winfried Matthes, Dörte Uetrecht, Hanne Christina Schulz, Annemarie Müller und Henrik Delfs Schweinetag Mecklenburg-Vorpommern Güstrow, 23. Oktober 2013 Das Verbundprojekt
Wirtschaftlichkeit von Weidehaltung, Kraftfuttermenge und Milchleistung auf Öko-Betrieben
 Wirtschaftlichkeit von Weidehaltung, Kraftfuttermenge und Milchleistung auf Öko-Betrieben Ökologische Milchviehbetriebe werden sehr unterschiedlich bewirtschaftet. So gibt es große Unterschiede beim Kraftfuttereinsatz,
Wirtschaftlichkeit von Weidehaltung, Kraftfuttermenge und Milchleistung auf Öko-Betrieben Ökologische Milchviehbetriebe werden sehr unterschiedlich bewirtschaftet. So gibt es große Unterschiede beim Kraftfuttereinsatz,
PRRS Kontroll- und Sanierungskonzepte für die moderne Schweineproduktion. Dr. Thomas Voglmayr
 PRRS Kontroll- und Sanierungskonzepte für die moderne Schweineproduktion Dr. Thomas Voglmayr Fortschrittlicher Landwirt-Agrarforum Schweinefachtage 2006 PRRS Porzine Reproduktive Respiratorische Syndrom.eine
PRRS Kontroll- und Sanierungskonzepte für die moderne Schweineproduktion Dr. Thomas Voglmayr Fortschrittlicher Landwirt-Agrarforum Schweinefachtage 2006 PRRS Porzine Reproduktive Respiratorische Syndrom.eine
Bioenergie Ergänzung oder Konkurrenz zur Schweineproduktion?
 NieKe Themenforum Bioenergie Ergänzung oder Konkurrenz zur Schweineproduktion? Franz Meyer zu Holte Vorsitzender ISN-Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands Vechta, 21. März. 2007 1. Warum
NieKe Themenforum Bioenergie Ergänzung oder Konkurrenz zur Schweineproduktion? Franz Meyer zu Holte Vorsitzender ISN-Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands Vechta, 21. März. 2007 1. Warum
Übungsaufgaben Prozentrechnung und / oder Dreisatz
 Übungsaufgaben Prozentrechnung und / oder Dreisatz 1. Bei der Wahl des Universitätssprechers wurden 800 gültige Stimmen abgegeben. Die Stimmen verteilten sich so auf die drei Kandidat/innen: A bekam 300,
Übungsaufgaben Prozentrechnung und / oder Dreisatz 1. Bei der Wahl des Universitätssprechers wurden 800 gültige Stimmen abgegeben. Die Stimmen verteilten sich so auf die drei Kandidat/innen: A bekam 300,
Ödemkrankheit? In meinen Augen ist Impfen zeitgemäß!
 Ödemkrankheit? In meinen Augen ist Impfen zeitgemäß! Shigatoxin: hinterlässt deutliche Spuren Shigatoxin: Auslöser der Ödemkrankheit Eine deutschlandweite Feldstudie belegt eine hohe Nachweisrate von E.
Ödemkrankheit? In meinen Augen ist Impfen zeitgemäß! Shigatoxin: hinterlässt deutliche Spuren Shigatoxin: Auslöser der Ödemkrankheit Eine deutschlandweite Feldstudie belegt eine hohe Nachweisrate von E.
Land- und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 2014
 Amt der Oö. Landesregierung Direktion Präsidium Information der Abt. Statistik Land- und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 2014 Land- und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 2014 1/2013 2/2016 In dieser
Amt der Oö. Landesregierung Direktion Präsidium Information der Abt. Statistik Land- und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 2014 Land- und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 2014 1/2013 2/2016 In dieser
Rohprotein und Aminosäure angepasste Fütterung in der Jungebermast Möglichkeiten und Grenzen
 Rohprotein und Aminosäure angepasste Fütterung in der Jungebermast Rohprotein und Aminosäure angepasste Fütterung in der Jungebermast Möglichkeiten und Grenzen Mechthild Freitag 1 Einleitung Da das Fleisch
Rohprotein und Aminosäure angepasste Fütterung in der Jungebermast Rohprotein und Aminosäure angepasste Fütterung in der Jungebermast Möglichkeiten und Grenzen Mechthild Freitag 1 Einleitung Da das Fleisch
NEUES für Fütterung & Management. SPEZIAL. Beispiele für Futtermischungen. von Mastschweinen
 www.proteinmarkt.de NEUES für Fütterung & Management SPEZIAL Beispiele für Futtermischungen von Mastschweinen I2I Beispiele für Futter mischungen von Mastschweinen 2011 Ein Wort vorweg: Dr. Manfred Weber,
www.proteinmarkt.de NEUES für Fütterung & Management SPEZIAL Beispiele für Futtermischungen von Mastschweinen I2I Beispiele für Futter mischungen von Mastschweinen 2011 Ein Wort vorweg: Dr. Manfred Weber,
VEREINIGTE TIERVERSICHERUNG
 VEREINIGTE TIERVERSICHERUNG Wir versichern Ihr Einkommen und erhalten Ihre Liquidität R+V/VTV-Ertragsschadenversicherung K O M P E T A G R A R E N Z Z E N R U M T Das Risiko, indirekt betroffen zu sein,
VEREINIGTE TIERVERSICHERUNG Wir versichern Ihr Einkommen und erhalten Ihre Liquidität R+V/VTV-Ertragsschadenversicherung K O M P E T A G R A R E N Z Z E N R U M T Das Risiko, indirekt betroffen zu sein,
Vorstellung VR AgrarMarkt Online. Johann Kalverkamp VR AgrarBeratung AG
 Vorstellung VR AgrarMarkt Online Johann Kalverkamp VR AgrarBeratung AG Dienstleistungen VR AgrarBeratung AG Beratung und Bewertung» Betriebs- und Risikoanalyse» Planungsrechnungen» Controlling» Wertermittlungen»
Vorstellung VR AgrarMarkt Online Johann Kalverkamp VR AgrarBeratung AG Dienstleistungen VR AgrarBeratung AG Beratung und Bewertung» Betriebs- und Risikoanalyse» Planungsrechnungen» Controlling» Wertermittlungen»
Dr. Wilhelm Pflanz Ferkelerzeugung 13. März 2014. Effizienter Energieeinsatz im Zuchtschweinebetrieb. ALB Tagung Hohenheim 13.03.
 Bildungs- und Wissenszentrum Schweinehaltung, Schweinezucht Boxberg Effizienter Energieeinsatz im Zuchtschweinebetrieb ALB Tagung Hohenheim 13.03.2014 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
Bildungs- und Wissenszentrum Schweinehaltung, Schweinezucht Boxberg Effizienter Energieeinsatz im Zuchtschweinebetrieb ALB Tagung Hohenheim 13.03.2014 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
Ausgewählte Erwerbstätigenquoten I
 Prozent 80 75 70 65 60 55 50 45 40 78,9 78,4 67,9 57,2 57,1 38,4 79,3 76,6 76,6 78,8 77,2 74,1 71,8 72,7 71,8 70,0 64,7 63,6 65,3 65,4 64,3 55,0 57,8 58,8 58,5 50,0 55,2 44,4 46,1 45,4 41,3 36,3 38,2 37,4
Prozent 80 75 70 65 60 55 50 45 40 78,9 78,4 67,9 57,2 57,1 38,4 79,3 76,6 76,6 78,8 77,2 74,1 71,8 72,7 71,8 70,0 64,7 63,6 65,3 65,4 64,3 55,0 57,8 58,8 58,5 50,0 55,2 44,4 46,1 45,4 41,3 36,3 38,2 37,4
Einsatz von Körnererbsen in der Schweinefütterung
 Einsatz von Körnererbsen in der Schweinefütterung Dr. A. Heinze und K. Rau TLL Jena, Ref. 530 TLL-Kolloquium 25.4.16, Heinze Anliegen Wohin mit den Erbsen? Reduzierung Sojaimporte gesellschaftlisches Anliegen
Einsatz von Körnererbsen in der Schweinefütterung Dr. A. Heinze und K. Rau TLL Jena, Ref. 530 TLL-Kolloquium 25.4.16, Heinze Anliegen Wohin mit den Erbsen? Reduzierung Sojaimporte gesellschaftlisches Anliegen
Senkung der Salmonellenprävalenz
 Senkung der Salmonellenprävalenz In Schweinezucht & Schweinemast Oliver Katzschke Göda Konkret Beispielhaft an: - derzeit 1400er Sauenanlage mit angeschlossener Teilmast - knapp 30 Ferkel/Sau und Jahr
Senkung der Salmonellenprävalenz In Schweinezucht & Schweinemast Oliver Katzschke Göda Konkret Beispielhaft an: - derzeit 1400er Sauenanlage mit angeschlossener Teilmast - knapp 30 Ferkel/Sau und Jahr
Ferkelerzeugung mit Eigenremontierung Gottfried Isler und Naomi Oliel Isler Winkel
 Ferkelerzeugung mit Eigenremontierung Gottfried Isler und Naomi Oliel Isler Winkel Betriebsspiegel Mastferkelerzeugung mit Eigenremontierung Kein Tierzukauf, auch keine Deckeber Herdbuchbetrieb in Zuchtstufe:
Ferkelerzeugung mit Eigenremontierung Gottfried Isler und Naomi Oliel Isler Winkel Betriebsspiegel Mastferkelerzeugung mit Eigenremontierung Kein Tierzukauf, auch keine Deckeber Herdbuchbetrieb in Zuchtstufe:
Handbuch Landwirtschaft Kriterienkatalog Sauenhaltung
 Handbuch Landwirtschaft Kriterienkatalog Sauenhaltung Gliederung 1 Grundanforderungen...2 1.1 Basiskriterien Tierhaltung, Hygiene, Tiergesundheit...3 1.2 Teilnahme am Antibiotikamonitoringprogramm...4
Handbuch Landwirtschaft Kriterienkatalog Sauenhaltung Gliederung 1 Grundanforderungen...2 1.1 Basiskriterien Tierhaltung, Hygiene, Tiergesundheit...3 1.2 Teilnahme am Antibiotikamonitoringprogramm...4
LANDESBETRIEB LANDWIRTSCHAFT HESSEN
 LANDESBETRIEB LANDWIRTSCHAFT HESSEN Kassel, 9. Februar 2010 Mit HP-Sojaextraktionsschrot Futterqualität verbessern und Kosten sparen Lassen sich bei der Verwendung von Hoch-Protein-Sojaextraktionsschrot
LANDESBETRIEB LANDWIRTSCHAFT HESSEN Kassel, 9. Februar 2010 Mit HP-Sojaextraktionsschrot Futterqualität verbessern und Kosten sparen Lassen sich bei der Verwendung von Hoch-Protein-Sojaextraktionsschrot
Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg
 Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg Universität Hohenheim Verfahrenstechnik der Tierhaltungssysteme Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg Gemeinschaftsprojekt Universität Hohenheim Landesanstalt für Schweinezucht
Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg Universität Hohenheim Verfahrenstechnik der Tierhaltungssysteme Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg Gemeinschaftsprojekt Universität Hohenheim Landesanstalt für Schweinezucht
Ihr Dachs. Ökologisch und ökonomisch sinnvoll. Jetzt kann jedes Haus beim Heizen Strom erzeugen. Der Dachs. Die Kraft-Wärme-Kopplung.
 Ihr Dachs Ökologisch und ökonomisch sinnvoll. Jetzt kann jedes Haus beim Heizen Strom erzeugen. Der Dachs. Die Kraft-Wärme-Kopplung. Ökologisch und ökonomisch sinnvoll. Der Dachs. Familie Reinhardt und
Ihr Dachs Ökologisch und ökonomisch sinnvoll. Jetzt kann jedes Haus beim Heizen Strom erzeugen. Der Dachs. Die Kraft-Wärme-Kopplung. Ökologisch und ökonomisch sinnvoll. Der Dachs. Familie Reinhardt und
Rapsextraktionsschrotfutter als wichtige Proteinquelle in der Schweinefütterung
 Thüringer Fütterungsforum zur Proteinversorgung bei Schweinen Rapsextraktionsschrotfutter als wichtige Proteinquelle in der Schweinefütterung 27.3.2014 Rapsextraktionsschrotfutter in der Schweinefütterung
Thüringer Fütterungsforum zur Proteinversorgung bei Schweinen Rapsextraktionsschrotfutter als wichtige Proteinquelle in der Schweinefütterung 27.3.2014 Rapsextraktionsschrotfutter in der Schweinefütterung
Eine lange Durststrecke für die Ferkelerzeuger
 Eine lange Durststrecke für die Ferkelerzeuger Ferkelimporte aus Holland und Dänemark führen zu Dumpingpreisen Bisher haben wir immer zum Jahreswechsel die ersten Jahresergebnisse in der Bullen- und Schweinemast
Eine lange Durststrecke für die Ferkelerzeuger Ferkelimporte aus Holland und Dänemark führen zu Dumpingpreisen Bisher haben wir immer zum Jahreswechsel die ersten Jahresergebnisse in der Bullen- und Schweinemast
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln
 Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Pharmaindustrie 12.03.2015 Lesezeit 3 Min Auf Wachstumskurs Sie gehört zu den innovativsten Branchen Deutschlands und bietet mehr als 110.000
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Pharmaindustrie 12.03.2015 Lesezeit 3 Min Auf Wachstumskurs Sie gehört zu den innovativsten Branchen Deutschlands und bietet mehr als 110.000
Schweineproduktion in Kolumbien
 Mai 13 Schweineproduktion in Kolumbien Dr. Jörg Heinkel, LSZ Boxberg Anlässlich des zweiten nationalen Kongresses zur Schweineproduktion in Medellín, Kolumbien, besuchte eine Delegation, bestehend aus
Mai 13 Schweineproduktion in Kolumbien Dr. Jörg Heinkel, LSZ Boxberg Anlässlich des zweiten nationalen Kongresses zur Schweineproduktion in Medellín, Kolumbien, besuchte eine Delegation, bestehend aus
eeeinfach MEHR. DIE VORTEILS-MODULE DER IBC SOLAR LINE. Exzellent. Effizient. Erfolgreich.
 eeeinfach MEHR. DIE VORTEILS-MODULE DER IBC SOLAR LINE. Exzellent. Effizient. Erfolgreich. EXZELLENT: IBC SOLAR seit über 30 Jahren Sonnenstrom mit System. Seit über 30 Jahren arbeiten wir erfolgreich
eeeinfach MEHR. DIE VORTEILS-MODULE DER IBC SOLAR LINE. Exzellent. Effizient. Erfolgreich. EXZELLENT: IBC SOLAR seit über 30 Jahren Sonnenstrom mit System. Seit über 30 Jahren arbeiten wir erfolgreich
Jungsauen SANO FÜTTERUNGSKONZEPT SCHWEIN
 Jungsauen SANO FÜTTERUNGSKONZEPT SCHWEIN HERZLICH WILLKOMMEN Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrter Interessent, wir freuen uns sehr, dass Sie sich für das Sano Fütterungskonzept für Jungsauen interessieren.
Jungsauen SANO FÜTTERUNGSKONZEPT SCHWEIN HERZLICH WILLKOMMEN Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrter Interessent, wir freuen uns sehr, dass Sie sich für das Sano Fütterungskonzept für Jungsauen interessieren.
Spannungsfeld Ei nachhaltige Alternativen für Mensch, Tier und Umwelt. Markus Dedl, CEO Delacon
 Spannungsfeld Ei nachhaltige Alternativen für Mensch, Tier und Umwelt Markus Dedl, CEO Delacon 1 kraftvolles Ei hat 5 Gramm Fett und 70 Kalorien. liefert 6 Gramm hochwertiges Protein, welches hilft Antikörper
Spannungsfeld Ei nachhaltige Alternativen für Mensch, Tier und Umwelt Markus Dedl, CEO Delacon 1 kraftvolles Ei hat 5 Gramm Fett und 70 Kalorien. liefert 6 Gramm hochwertiges Protein, welches hilft Antikörper
Ökonomische Auswirkungen höherer Haltungsstandards
 Ökonomische Auswirkungen höherer Haltungsstandards Winfried Matthes und Jörg Brüggemann Institut für Tierproduktion Dummerstorf und SKBR Schwerin Schweinetag Mecklenburg-Vorpommern Güstrow, 28. November
Ökonomische Auswirkungen höherer Haltungsstandards Winfried Matthes und Jörg Brüggemann Institut für Tierproduktion Dummerstorf und SKBR Schwerin Schweinetag Mecklenburg-Vorpommern Güstrow, 28. November
Einführung in die Schweineproduktion. Dr.Th.Paulke Ref.45
 Einführung in die Schweineproduktion Besonderheiten Schweinehaltung stark spezialisierte Produktion - Ferkel und Mast hoch technisiert Produktionsabläufe streng strukturiert/organisiert Eiweißfuttermittel
Einführung in die Schweineproduktion Besonderheiten Schweinehaltung stark spezialisierte Produktion - Ferkel und Mast hoch technisiert Produktionsabläufe streng strukturiert/organisiert Eiweißfuttermittel
Als Durchfall bezeichnet man eine Veränderung der Kotkonsistenz, der Absatzhäufigkeit sowie der Kotmenge.
 Durchfall (Diarrhoe) Als Durchfall bezeichnet man eine Veränderung der Kotkonsistenz, der Absatzhäufigkeit sowie der Kotmenge. Man unterscheidet zwischen akutem Durchfall, der meist spontan (innerhalb
Durchfall (Diarrhoe) Als Durchfall bezeichnet man eine Veränderung der Kotkonsistenz, der Absatzhäufigkeit sowie der Kotmenge. Man unterscheidet zwischen akutem Durchfall, der meist spontan (innerhalb
Lean Development Von Ruedi Graf, Senior Consultant und Partner der Wertfabrik AG
 Fachartikel Lean Development Von Ruedi Graf, Senior Consultant und Partner der Wertfabrik AG In der Entstehung neuer Produkte verfehlen eine Vielzahl von Projekten die definierten Qualitäts-, Termin- und
Fachartikel Lean Development Von Ruedi Graf, Senior Consultant und Partner der Wertfabrik AG In der Entstehung neuer Produkte verfehlen eine Vielzahl von Projekten die definierten Qualitäts-, Termin- und
Standardfehler: Stallklima 2007
 Standardfehler: Standardfehler bei Lüftungs- und Heizungsanlagen in der Tierzucht und Mast Beim Stallklima werden häufig Standardfehler beim Betrieb und der Errichtung der Anlagen festgestellt. Hier liegt
Standardfehler: Standardfehler bei Lüftungs- und Heizungsanlagen in der Tierzucht und Mast Beim Stallklima werden häufig Standardfehler beim Betrieb und der Errichtung der Anlagen festgestellt. Hier liegt
Initiative Tierwohl (ITW) Fragen & Antworten Stand: 16.03.2015
 Organisation 1. Müssen Betriebe bei der Anmeldung zur ITW bereits eine QS-Zulassung besitzen? Nein, zum Anmeldezeitpunkt des Betriebes ist noch keine QS-Zulassung notwendig. Spätestens am Tag des ITW-Erstaudits
Organisation 1. Müssen Betriebe bei der Anmeldung zur ITW bereits eine QS-Zulassung besitzen? Nein, zum Anmeldezeitpunkt des Betriebes ist noch keine QS-Zulassung notwendig. Spätestens am Tag des ITW-Erstaudits
Maisprodukte in der Schweinefütterung (Körnermais, Ganzkörnersilage, CCM)
 Maisprodukte in der Schweinefütterung (Körnermais, Ganzkörnersilage, CCM) Dr. H. Lindermayer, G. Propstmeier-LfL-ITE Grub Etwa 40 % der Schweine, v.a. Mastschweine, werden mit Maisrationen gefüttert. Dabei
Maisprodukte in der Schweinefütterung (Körnermais, Ganzkörnersilage, CCM) Dr. H. Lindermayer, G. Propstmeier-LfL-ITE Grub Etwa 40 % der Schweine, v.a. Mastschweine, werden mit Maisrationen gefüttert. Dabei
Welche Vermarktungschancen in der Schweineerzeugung nutzen Bayern?
 Welche Vermarktungschancen in der Schweineerzeugung nutzen Bayern? Veredlungstag des Deutschen Bauernverbandes (DBV) am 9. September 2015 in Essenbach Kurzporträt Gerhard Pfeffer 53 Jahre, verheiratet,
Welche Vermarktungschancen in der Schweineerzeugung nutzen Bayern? Veredlungstag des Deutschen Bauernverbandes (DBV) am 9. September 2015 in Essenbach Kurzporträt Gerhard Pfeffer 53 Jahre, verheiratet,
Gesunder Darm - Wohlbefinden fördern - Aggressionen verringern!
 Herausforderungen in der Schweinehaltung meistern 20. Rheinischer Schweinetag 3. Dezember 2013 Gesunder Darm - Wohlbefinden fördern - Aggressionen verringern! Dr. Gerhard Stalljohann Gliederung: Gesunder
Herausforderungen in der Schweinehaltung meistern 20. Rheinischer Schweinetag 3. Dezember 2013 Gesunder Darm - Wohlbefinden fördern - Aggressionen verringern! Dr. Gerhard Stalljohann Gliederung: Gesunder
Dein Name.
 Mach dich schlau! Du willst für dein Schnitzel, Kotelett und die Grillwürstel so wenig als möglich zahlen? Dann geht s dir so wie vielen KonsumentInnen. Sie wollen Fleisch möglichst billig kaufen. Welche
Mach dich schlau! Du willst für dein Schnitzel, Kotelett und die Grillwürstel so wenig als möglich zahlen? Dann geht s dir so wie vielen KonsumentInnen. Sie wollen Fleisch möglichst billig kaufen. Welche
Die 250 besten Checklisten für Unternehmenswachstum
 Die 250 besten Checklisten für Unternehmenswachstum Märkte erschließen und Vertrieb optimieren Effizient produzieren und Kosten senken Intelligent finanzieren und Umsatz steigern. Bearbeitet von Tatjana
Die 250 besten Checklisten für Unternehmenswachstum Märkte erschließen und Vertrieb optimieren Effizient produzieren und Kosten senken Intelligent finanzieren und Umsatz steigern. Bearbeitet von Tatjana
Betreiberschulung. Abluftreinigung. Wo entstehen die Kosten - Wie kann ich Kosten einsparen. Cloppenburg,
 Betreiberschulung Abluftreinigung Wo entstehen die Kosten - Wie kann ich Kosten einsparen Cloppenburg, 05.04.2016 Abluftreinigung Wo entstehen die Kosten? Betriebskostengliederung Strom: ca. 45 % (Pumpen
Betreiberschulung Abluftreinigung Wo entstehen die Kosten - Wie kann ich Kosten einsparen Cloppenburg, 05.04.2016 Abluftreinigung Wo entstehen die Kosten? Betriebskostengliederung Strom: ca. 45 % (Pumpen
Blockheizkraftwerke. Strom und Wärme selbstgemacht
 Blockheizkraftwerke Strom und Wärme selbstgemacht Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung Effizient Energie produzieren und nutzen Es gibt viele Methoden, die Primärenergien Öl und Gas in Strom, Wärme und Kälte
Blockheizkraftwerke Strom und Wärme selbstgemacht Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung Effizient Energie produzieren und nutzen Es gibt viele Methoden, die Primärenergien Öl und Gas in Strom, Wärme und Kälte
Fütterung der Zuchtsau Eine Gratwanderung
 Fütterung der Zuchtsau Eine Gratwanderung 1. Ziele 2. Genetik 3. Ferkel 4. Remonte 5. Eingliederung 6. 1. Trächtigkeit 7. Vor Abferkeln 8. Säugezeit 9. Absetzen - Decken 1 1. Ziele und Voraussetzungen
Fütterung der Zuchtsau Eine Gratwanderung 1. Ziele 2. Genetik 3. Ferkel 4. Remonte 5. Eingliederung 6. 1. Trächtigkeit 7. Vor Abferkeln 8. Säugezeit 9. Absetzen - Decken 1 1. Ziele und Voraussetzungen
Afrikanische Schweinepest
 Neue Schweineseuchen bedrohen Österreich Afrikanische Schweinepest Epizootische Virusdiarrhoe Dr. Wolfgang Schafzahl Fachtierarzt f. Ernährung u. Diätetik Fachtierarzt f. Schweine www.styriavet. at Afrikanische
Neue Schweineseuchen bedrohen Österreich Afrikanische Schweinepest Epizootische Virusdiarrhoe Dr. Wolfgang Schafzahl Fachtierarzt f. Ernährung u. Diätetik Fachtierarzt f. Schweine www.styriavet. at Afrikanische
Die Veredelung von Leinsamen erfolgt durch ein patentiertes mechanisch-thermisches Aufschlussverfahren hier in Deutschland.
 Die Herstellung des Extrulins erfolgt in Deutschland. Mittels eines definierten Aufschlussverfahrens werden die Eigenschaften des Leins positiv verändert. Das entstandene Produkt Extrulin zeichnet sich
Die Herstellung des Extrulins erfolgt in Deutschland. Mittels eines definierten Aufschlussverfahrens werden die Eigenschaften des Leins positiv verändert. Das entstandene Produkt Extrulin zeichnet sich
Saugferkeldurchfälle-
 Saugferkeldurchfälle- Impfstrategien heute und morgen IDT Biologika Dr. Sonja Hillen Das (darm)-gesunde Ferkel Kann 24-48 h nach der Geburt Antikörper über den Darm aufnehmen Darmschleimhaut ist mit vielen
Saugferkeldurchfälle- Impfstrategien heute und morgen IDT Biologika Dr. Sonja Hillen Das (darm)-gesunde Ferkel Kann 24-48 h nach der Geburt Antikörper über den Darm aufnehmen Darmschleimhaut ist mit vielen
NieKE: Welches ist die größte Herausforderung, vor der die Schweinehaltung in Deutschland steht?
 zum Thema Tierschutz in der Schweinehaltung Zunehmend wird die Kritik an der modernen Tier- und besonders der Nutztierhaltung lauter. Probleme wie das Schwanzbeißen, die betäubungslose Kastration bzw.
zum Thema Tierschutz in der Schweinehaltung Zunehmend wird die Kritik an der modernen Tier- und besonders der Nutztierhaltung lauter. Probleme wie das Schwanzbeißen, die betäubungslose Kastration bzw.
Factsheet Ferkelschutzkorb -Diskussion
 Verband Österreichischer Schweinebauern 1200 Wien, Dresdnerstr. 89/19 Tel.: 01/334 17 21-31, Fax: 01/334 17 13 e-mail: office@schweine.at, Homepage: http://www.schweine.at, DVR: 0956015; ZVR: 414658906
Verband Österreichischer Schweinebauern 1200 Wien, Dresdnerstr. 89/19 Tel.: 01/334 17 21-31, Fax: 01/334 17 13 e-mail: office@schweine.at, Homepage: http://www.schweine.at, DVR: 0956015; ZVR: 414658906
Einzelbetriebliche Bewertung von Tierwohlmaßnahmen
 Präkonferenz-Workshop im Rahmen der GEWISOLA-Jahrestagung 2014 in Kooperation mit dem Promotionsprogramm Animal Welfare in Intensive Livestock Production Systems Tierwohl zwischen Markt und Moral Einzelbetriebliche
Präkonferenz-Workshop im Rahmen der GEWISOLA-Jahrestagung 2014 in Kooperation mit dem Promotionsprogramm Animal Welfare in Intensive Livestock Production Systems Tierwohl zwischen Markt und Moral Einzelbetriebliche
Futterrationen und Fütterungsstrategien der Zukunft - Schweinehaltung -
 Neue Herausforderungen in der Nutztierfütterung Feed - Food - Fuel - Fibre Futterrationen und Fütterungsstrategien der Zukunft - Schweinehaltung - Dr. Hermann Lindermayer Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
Neue Herausforderungen in der Nutztierfütterung Feed - Food - Fuel - Fibre Futterrationen und Fütterungsstrategien der Zukunft - Schweinehaltung - Dr. Hermann Lindermayer Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
Wärme, Warmwasser und Strom Ökostrom. Einfach beim Heizen Strom produzieren. Weil wir nicht nur nachhaltig wirtschaften, sondern auch heizen.
 Ökologisch, ökonomisch, unabhängig. Einfach beim Heizen Strom produzieren. Eine Dachs Kraft-Wärme-Kopplung. Wärme, Warmwasser und Strom Ökostrom. Weil wir unsere Energiekosten selbst managen. Weil wir
Ökologisch, ökonomisch, unabhängig. Einfach beim Heizen Strom produzieren. Eine Dachs Kraft-Wärme-Kopplung. Wärme, Warmwasser und Strom Ökostrom. Weil wir unsere Energiekosten selbst managen. Weil wir
Danke. für über 10 Jahre Dachs. In Zukunft noch mehr vom Dachs profitieren.
 Danke für über 10 Jahre Dachs. In Zukunft noch mehr vom Dachs profitieren. Jetzt: Staatlich gefördert 2012 Von 2000 bis 2012 haben sich die Strompreise mehr als verdoppelt. Von 2000 bis 2012 haben sich
Danke für über 10 Jahre Dachs. In Zukunft noch mehr vom Dachs profitieren. Jetzt: Staatlich gefördert 2012 Von 2000 bis 2012 haben sich die Strompreise mehr als verdoppelt. Von 2000 bis 2012 haben sich
Kältemittel: Neue Studie zur Ökoeffizienz von Supermarktkälteanlagen
 Kältemittel: Neue Studie zur Ökoeffizienz von Supermarktkälteanlagen Andrea Voigt, The European Partnership for Energy and the Environment September 2010 Seit sich die EU dazu verpflichtet hat, die Treibhausgasemissionen
Kältemittel: Neue Studie zur Ökoeffizienz von Supermarktkälteanlagen Andrea Voigt, The European Partnership for Energy and the Environment September 2010 Seit sich die EU dazu verpflichtet hat, die Treibhausgasemissionen
