Monetäre Außenwirtschaft
|
|
|
- Nele Meinhardt
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Prof. Dr. Christian Prof. Dr. Bauer Herz Monetäre Europäische Außenwirtschaft Integration WS 2004/ /11 Folie 01 Folie 1
2 Termine: Vorlesungsbeginn: Di., 2.November, Uhr, HS 3 Abschlussklausur: wird noch bekannt gegeben Folien: Benutzername: student Passwort: mon-oek Sprechstunden: Prof. Dr. Christian Bauer: Fr 9-11 Uhr und nach Vereinbarung, Zi. C534 bauer@uni-trier.de Terminvereinbarung durch Frau Bürmann: buermann@uni-trier.de Folie 2
3 Prüfungsstoff Blockprüfung Volkswirte 1-5 andere Studienfächer 1-3 (verpflichtende Auswahl) 1 Geld, Kredit, Währung (WS) 2 3 Geld- und Kreditpolitik 4 Monetäre Märkte und Zinsbildung 5 Seminar zum Schwerpunkt GKF Folie 3
4 Warum monetäre Außenwirtschaft? Beurteilung der makroökonomischen Entwicklung Verständnis von Fiskal-, Geld- und Wechselkurspolitik Informierte wirtschaftspolitische Diskussion auf konsistenter theoretischer Basis. Beispiel für aktuelle Fragestellungen: Internationale Konjunkturentwicklung Erstellung makroökonomischer Prognosen (EU-Kommission) Wechselkurs und Wettbewerbsfähigkeit Die Geldpolitik der EZB Internationale Finanzkrisen Folie 4 Folie 4
5 Gliederung A Reale Außenwirtschaft I. Bestimmungsgründe des internationalen Handels 1. Unterschiede in der Produktivität Das Ricardo Modell 2. Unterschiedliche Faktorausstattungen (Heckscher-Ohlin-Modell) 3. Economies of Scale II. Instrumente der Handelspolitik III. Politische Ökonomie des Außenhandels B I. Wechselkurse und Devisenmarkt II. Wechselkursregime und Währungskrisen (Feste Wechselkurse und Devisenmarktinterventionen) III. Preisniveau und Wechselkurs in der langen Frist: Die Kaufkraftparität IV. Sozialprodukt und Wechselkurs in der kurzen Frist V. Wechselkursmodelle Folie 5
6 Wechselkursmodelle Kaufkraftparität Zinsparität Monetäres Modell Mundell Fleming Modell Dornbush Modell Allgemeine Gleichgewichtsmodelle Unvollständige Informationen: Markteffizienz, Rationale Erwartungen und News Marktmikrostruktur, Order Flow, Chartisten und Noise trader Überblick Überblick: Währungskrisen: 1., 2., 3. Generation, Spekulanten und Global Games (genauer: Geld- und Kreditpolitik im SS 2010) Folie 6
7 Der wichtigste Preis der Welt - Noch Folie 7
8 EUR-USD-Wechselkurs Folie 8
9 Wechselkurse: Preis- und Mengennotierung Prof. Dr. Christian Bauer Folie 9
10 Wechselkurse Preis eines Produkts einer Auslandswährung Preisnotierung: (früher üblich, in der Literatur heute noch) Wie viel kostet eine Einheit Auslandswährung? z.b. E /$ 0,68EUR 1USD Prof. Dr. Christian Bauer Mengennotierung: (heutzutage in der Presse und den Märkten üblich) Wie viel Einheiten Auslandswährung erhalte ich für einen Euro? z.b. 1,48USD E$/ 1EUR Mengennotierung ist die Inverse der Preisnotierung z.b. E /$ 0,68EUR 1 1,48USD 1USD E 1EUR $/ Umrechnung von Preisen 0,68EUR 50 USD * 34EUR 1USD Folie 10
11 Wechselkurse: Euro-Dollar Prof. Dr. Christian Bauer 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Folie 11
12 Wechselkurse USD zu DEM Prof. Dr. Christian Bauer 3,00 2,50 2,00 Plaza- Abkommen Auflösung der Sowjetunion Pesokrise in Mexico 1,50 1,00 0,50 Louvre- Abkommen Öffnung der DDR- Grenze Pfund und Lira verlassen EWS Beginn des Golf- Krieges Beginn der Asienkrise Euro Buchgeld / bar 0, Folie 12
13 Beginn des Irak-Krieges September 2008 Finanzkrise Bargeld Einführung Juli 2007 Subprime-Krise Dezember 2009 Euro Schuldenkrise Folie 13
14 Brainstorming: Wie entwickeln sich Wechselkurse? Folie 14
15 Nominaler und realer Wechselkurs Nominaler Wechselkurs: Umtauschverhältnis zweier Währungen Kaufkraftparität: Q=1 Bsp.: US Dollar zu Euro oder Euro zu US Dollar Prof. Dr. Christian Bauer Realer Wechselkurs: Verhältnis des Betrag an Inlandswährung, der in Auslandswährung umgetauscht werden muss, um einen repräsentativen ausländischen Warenkorb zu erwerben, zum Wert eines repräsentativen inländischen Warenkorbes in Inlandswährung q P Ausland S Q P Inland Achtung: richtigen nominalen Wechselkurs S nehmen (Preisnotierung, wie viel inländische Währung je Einheit ausländischer Währung) Folie 15
16 Determinanten des Wechselkurses: Kapitalmarkt Prof. Dr. Christian Bauer Zinsparitätentheorien: Die (erwartete) Rendite einer Anlage im Inland sollte der (risikoad-justierten) (erwarteten) Rendite einer Auslandsanlage entsprechen, sonst kommt es durch Arbitrage zu einer Wechselkurs- und/oder Zinsänderung. r Ausland r Inland E S Risikoprämie Die erwartete Wechselkursänderung kann viele Determinanten haben: Die Differenz der Inflationsraten (aus PPP), erwartete Unterschiede in den Entwicklungen der Volkswirtschaften, Charttechnik, spekulative Attacken Folie 16
17 Zinssätze für Einlagen in Dollar und DM Folie 17
18 Zwei One-Minute-Paper: 1)Was fällt Ihnen zum nominalen Wechselkurs ein? 2)Was fällt Ihnen zum realen Wechselkurs ein? Folie 18
19 Das magische Dreieck der Geldpolitik Prof. Dr. Christian Bauer Freiheit des Kapitalverkehrs Malaysia, Thailand (vor 1998) Schweiz?, Estland USA, Euroraum Stabilität des Wechselkurses Malaysia China, Indien unabhängige Geldpolitik Zielkonflikt Fix-WK + autonome GP kein freier Kap.-Verkehr Freier Kap.-Verkehr + autonome GP kein stabiler WK Folie 19
20 Wechselkursentwicklungen und Regime Prof. Dr. Christian Bauer Der nominale Wechselkurs bildet sich durch Angebot und Nachfrage an den beiden Währungen auf dem Devisenmarkt. Diese können durch reale Güterströme (geschätzter Anteil <10%) oder durch reine Anlageentscheidungen auf dem Kapitalmarkt (geschätzter Anteil >90%) induziert werden. Motive privater Akteure: Reale Transaktionen: Terms of Trade Anlage (Rendite, Diversifikation): Zinsen Spekulation: Erwartete Wechselkursänderung Folie 20
21 Devisenmarkt und Notenbank Der Devisenmarkt ist ein besonderer Markt. Die Notenbank als besonderer Akteur: - große Marktmacht Devisenbestand - kann Asset beliebig herstellen Geld drucken - kann Anreize ändern Zinsen - kann Handel regulieren Kapitalverkehrskontrollen Folie 21 21
22 Wechselkursregime Prof. Dr. Christian Bauer Floating: keine Steuerung durch die Notenbank Flexibel Managed Float: geringfügige Eingriffe der Notenbank Wechselkursband: Notenbank verpflichtet sich den Wechselkurs innerhalb einer bestimmten Bandbreite zu halten Peg: Notenbank fixiert den Wechselkurs Währungsunion: Übernahme der der anderen Währung Fix Je strikter das Regime, desto weniger Freiheiten hat die Notenbank. Folie 22
23 Wechselkursregime Ökonomische Vorteile von Wechselkursbindungen: Übernahme von Stabilität (Inflation) aus dem Ankerland Einfachere und günstigere Handels- und Wirtschaftsbeziehungen Nachteile: Aufgabe einer eigenen Geldpolitik Wechselkurs als Konjunkturmotor entfällt Wechselkursbindungen können attackiert werden und es kann zu Wechselkurskrisen kommen, wenn die Notenbank nicht genügend Devisenreserven hat, um den Wechselkurs stabil zu halten. Folie 23
24 Wechselkurse: Beispiel Fixkurssystem Prof. Dr. Christian Bauer Folie 24
25 y Wechselkurse: Beispiel Fixkurssystem Prof. Dr. Christian Bauer x Folie 25
26 Türkische Lira / Euro Wechselkurse: Beispiel Währungskrise Prof. Dr. Christian Bauer Folie
27 Wechselkurse: Beispiel Crawling peg Prof. Dr. Christian Bauer Folie 27
28 De facto Wechselkurregime Prof. Dr. Christian Bauer Levy-Yeyati und Sturzenegger (2004) Reinhard und Rogoff (2004, 2009(unveröff.)) 1 No separate legal tender 2 Pre announced peg or currency board arrangement 3 Pre announced horizontal band that is narrower than or equal to +/-2% 4 De facto peg 5 Pre announced crawling peg 6 Pre announced crawling band that is narrower than or equal to +/-2% 7 De factor crawling peg 8 De facto crawling band that is narrower than or equal to +/-2% 9 Pre announced crawling band that is wider than or equal to +/-2% 10 De facto crawling band that is narrower than or equal to +/-5% 11 Moving band that is narrower than or equal to +/-2% (i.e., allows for both appreciation and depreciation over time) 12 Managed floating 13 Freely floating 14 Freely falling 15 Dual market in which parallel market data is missing. Folie 28
29 De facto Klassifikation Bauer/Seitz Folie 29
30 De facto vs. De jure Floating Floating: EUR/USD Managed Floating: Thai Baht / USD 0,035 1,6 0,033 0,031 1,4 0,029 0,027 1,2 0,025 0, ,021 0,019 0,8 0,017 Folie 30 30
31 Zinsparität und Kaufkraftparität Folie 31
32 Kaufkraftparität Folie 32
33 Zinsparität und Kaufkraftparität Folie 33
34 Kaufkraftparität (purchasing power parity (PPP)) Prof. Dr. Christian Bauer Man versucht, anhand eines Menüs gemeinsamer Preise zu erfassen, zu welchem Wechselkurs der gleiche Warenkorb in allen Ländern gleich viel kostet. P USA USA Deutschland Güterkorb Güterkorb PGüterkorb Deutschland PGüterkorb Beim Kurs ε gilt Kaufkraftparität, deshalb hypothetischer Wechselkurs ε, so dass 1$ in den USA den gleichen Güterkorb kauft wie 1$ umgewandelt in Euro zum Kurs ε in Deutschland P Folie 34
35 PPP Hintergrund Das Gesetz des einheitlichen Preises mit Transaktionskosten National: P A = P B + C International: P A = SP B + C PPP: P=SP * p=s+p * Realer Wechselkurs: Q=SP * /P q=s+p * -p Realer Wk bei PPP: Q 1 q 0 Prof. Dr. Christian Bauer PPP mit Transaktionskosten: P=KSP * q=k+s+p * -p Differenzen: dp=ds+dp * oder ds=dp-dp * WK-Änderung = Unterschied der Inflationsraten (relative PPP) Folie 35
36 Handelbare und nicht handelbare Güter Prof. Dr. Christian Bauer Preisindex mit nicht handelbaren Gütern P P P oder in log-form p cp 1 c p c T 1 c NT mit c=c* (gleiche Konsumstruktur der Länder) und p T =p * T (PPP für handelbare Güter) folgt * dq ds dp dp ds c dp 1 c dp cdp 1 c dp * * * T NT T NT ds c dp dp * 1 NT NT T NT Folie 36
37 Harrod-Balassa-Samuelson 1 Sich entwickelnde Länder haben höhere Inflationsraten!? Balassa: Zwei Länder, zwei Sektoren (T und NT), vollständige Arbeitsmärkte, Produktivität in NT gleich, in T ist das Ausland produktiver Entlohnung nach Grenzprodukt, gleiche Löhne innerhalb eines Landes Ausland ist reicher, hat höhere Löhne und ein höheres Preisniveau (Penn-Effekt) Folie 37
38 Harrod-Balassa-Samuelson 2 Samuelson: LooP für handelbare Güter, Inland hat größeres Produktivitätswachstum bei T Löhne in T steigen Löhne in NT steigen Da Produktivität in NT konstant, muss der Preis in NT steigen Gesamtes Preisniveau steigt Folie 38
39 MPL nt,1 = MPL nt,2 = 1 w 1 = p nt,1 * MPL nt,1 = p nt,1 = p t * MPL t,1 w 2 = p nt,2 * MPL nt,2 = p nt,2 = p t * MPL t,2 MPL t,1 < MPL t,2 which implies that p nt,1 < p nt,2 So with a same (world) price for tradable goods, the price of nontradable goods will be lower in the less productive country, resulting in an overall lower price level. Folie 39
40 Empirische Evidenz zur Kaufkraftparitäten-Theorie PPP erklärt Wechselkursbewegung relativ gut für Länder mit Hyperinflation PPP aber für Länder mit niedriger Inflation nicht verifiziert Folie 40
41 Empirische Evidenz zur Kaufkraftparitäten-Theorie absolute Kaufkraftparität kann nirgendwo in der realen Welt beobachtet werden die relative Kaufkraftparität brach nach 1970 vollständig zusammen (Bretton Woods) Folie 41
42 Empirische Evidenz zur Kaufkraftparitäten-Theorie Rogoff: Gesetz einheitlicher Preise gilt empirisch nicht Schwache Beziehung zwischen Wechselkursänderung und Inflationsdifferenzen (sowohl kurz-wie mittelfristig) Starke Korrelation von realem und nominalem Wechselkurs Hohe kurzfristige Volatilität des realen Wechselkurses Folie 42
43 Erklärungen für die mangelhaften empirischen Belege der PPP Prof. Dr. Christian Bauer 1. Nur langfristige Beziehung wegen Preisrigiditäten 2. Nur approximativ, da a) Transportkosten (räumliche Distanz) und -hindernisse, b) nicht handelbare Güter, c) unterschiedliche Warenkörbe, d) Monopolistische oder oligopolistische Praktiken, e) Preisrigiditäten existieren und f) Nachfragepräferenzen relevante Dimensionen haben Volumen der kapitalmarktinduzierten Währungstransfers ist um ein vielfaches höher als das güterinduzierte Volumen systematisch häufige und größere kurzfristige Abweichungen von der Kaufkraftparität insb. bei frei floatende Wechselkursen Folie 43
44 Dollar Stronger -----> Prof. Dr. Christian Bauer PPP-the facts at a glance British pound French franc Swiss franc Japanese yen German deutschmark Year Figure 2.1 Real exchange rates, (consumer prices) (1995 = 100) Folie 44
45 Dollar Stronger -----> PPP-the facts at a glance Prof. Dr. Christian Bauer British pound 200 French franc Swiss franc 150 Japanese yen German deutschmark Year Figure 2.1 Real exchange rates, (consumer prices) (1980 = 100) Folie 45
46 Dollar Stronger -----> PPP-the facts at a glance (continued) Prof. Dr. Christian Bauer British pound French franc Swiss franc Japanese yen German deutschmark Year Figure 2.2 Real exchange rates, (producer prices) (1995 = 100) Folie 46
47 Dollar stronger > PPP-the facts at a glance (continued) Prof. Dr. Christian Bauer Figure 2.4 Purchasing power parity exchange rates (producer prices) 1995 = British pound French franc Sw iss franc Japanese yen German deutschmark Year Figure 2.3 PPP exchange rates, (consumer prices) (1995=100) Folie 47
48 Dollar stronger > PPP-the facts at a glance (continued) Prof. Dr. Christian Bauer British pound French franc Swiss franc Japanese yen German deutschmark Year Figure 2.4 PPP exchange rates, (producer prices) (1995=100) Folie 48
49 Determinanten des Wechselkurses: Gütermarkt Prof. Dr. Christian Bauer Gütermarkt: realer Wechselkurs = 1, sonst Güterarbitrage (Kaufkraftparitätentheorie, PPP) Law of one price angewendet auf den ganzen Warenkorb Einschränkungen: Nur langfristige Beziehung wegen Preisrigiditäten Nur approximativ, da Transportkosten und -hindernisse, nicht handelbare Güter, unterschiedliche Warenkörbe und Nachfragepräferenzen relevante Dimensionen haben Das Volumen der kapitalmarktinduzierten Währungstransfers ist um ein vielfaches höher als das güterinduzierte Volumen. Folie 49
50 Wechselkurse: Euro-Dollar: nominal vs. Real Prof. Dr. Christian Bauer USD / EUR Wechselkurs / $ 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 Jan 98 M ai 98 Sep 98 Jan 99 M ai 99 Sep 99 Jan 00 M ai 00 Sep 00 Jan 01 M ai 01 Sep 01 Jan 02 M ai 02 Sep 02 Jan 03 M ai 03 no minaler W K realer W K Folie 50
51 Wechselkurse: Euro-Dollar: Kaufkraftparität Prof. Dr. Christian Bauer Index nominaler Wechselkurs KKP (Großhandelspreise) KKP (Verbraucherpreise) KKP (Exportpreise) Quelle: IMF, International Financial Statistics, CD 2001/1 Folie 51
52 Folie 52 Prof. Dr. Christian Bauer
53 Folie 53 Prof. Dr. Christian Bauer
54 Quelle: Folie 54
55 Die vereinfachenden Annahmen Bisher: Einheit von Ort und Zeit Keine Transaktionskosten Eindeutigkeit und Durchsetzbarkeit von Zielen durch Verträge Fehlen strategischer Überlegungen Vollständige Information Homogenität der Agenten (Bsp.: keine Modellierung von Noise trader, Chartisten, Fundamentalisten o.ä. in Marktmikrostrukturmodellen) Folie 55
56 Neue Institutionenökonomie Transaktionskosten: Kosten (Zeit, Geld, Material/Personal) für Aktionen. Beispiel: PPP-Transportk. für Waren, Informationsk. für Käufer Property Rights: Die Ausgestaltung von Verträgen ist relevant. Beispiel: s. Coase-Theorem Principal-agent Problem: Die Ziele des handelnden (Agent) stimmen u.u. nicht mit denen des Auftraggebers überein. Beispiel: Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Arbeitsleistung Typische Annahme: Beschränkte Rationalität: Satisfizierung anstelle von Nutzen-Maximierung Folie 56
57 ZINSPARITÄT Folie 57
58 Zinsparität: Euro- vs. Dollar-Anlage Annahmen Euro-Dollar-Wechselkurs t 0 : 1,3791 $/ (vom ) -Zins: 3% $-Zins: 4% Euro-Dollar-Wechselkurs t 1 : 1,51701 $/ (10%ige Dollar-Abwertung) keine Transaktionskosten Folie 58
59 - versus $- Anlage 1,00 -Verzinsung??? Folie 59
60 1,3791 $ $-Verzinsung 1,4343 $ Umtausch - versus $- Anlage Rücktausch 1,00 -Verzinsung??? Folie 60
61 1,3791 $ 4% 1,4343 $ Eurorendite auf Dollareinlage r = 0,945 1,00 = - 5,5 % 1,00 0,945 1,00 3% 1, Folie 61
62 Euro-Ertrag des Dollar-Assets : e (3-1) E /$ E /$ R$ E /$ wobei R $ der heutige Zinssatz auf $-Einlagen E /$ der heutige /$ -Wechselkurs und E e /$ der erwartete /$ -Wechselkurs. Approximation Als Regel gilt: Die $-Verzinsung entspricht approximativ der -Verzinsung + der Abwertungsrate des $ gegenüber dem Folie 62
63 Gleichgewicht: Indifferenz zwischen Dollar- und Euro-Assets, d.h. die erwartete Rendite in einer Währung sind gleich: Zinsparität. Folie 63
64 Devisenmarktgleichgewicht Der Devisenmarkt befindet sich im Gleichgewicht, wenn die Einlagen in allen Währungen dieselbe erwartete Rendite bieten. Diese Gleichheit der erwarteten Renditen auf Einlagen in zwei beliebigen Währungen bezeichnet man als Zinsparität. Sie impliziert die Gleichwertigkeit sämtlicher Fremdwährungseinlagen in den Augen der Anleger. bzw. R R R $ R $ E E e /$ E /$ E /$ e $/ E$/ E $/ Folie 64
65 Zinsparität R R $ E e /$ E /$ E /$ bzw. R R $ E e $/ E$/ E $/ Folie 65
66 Zinsparität R R $ E e /$ E /$ E /$ bzw. R R $ E e $/ E$/ E $/ Wechselkursprognose E /$ 1 E R e /$ R $ Folie 66
67 Zinssätze für Einlagen in Dollar und DM DM/$ Wechselkurs Folie 67
68 Henne oder Ei? /$ Prof. Dr. Christian Bauer e /$ $ Frage: Wie ändert sich der Wechselkurs nach einer Zinserhöhung? Beispiel: Die EZB hebt den Zins um 0.5% an. Anwortmöglichkeiten: 1) Der Euro steigt, da er attraktiver wird. (s.o.) 2) Der Wechselkurs bleibt gleich, da die Zinserhöhung nur eine Änderung des erwarteten Wechselkurses kompensiert, d.h. die Zinsänderung wurde von den Marktakteuren erwartet und ist bereits eingepreist oder die Wechselkurserwartung hat sich aufgrund anderer Umstände geändert. 3) Der Euro fällt, da die Anleger die steigenden Zinsen als Indikator für eine Konjunkturschwäche deuten und der erwartete Wechselkurs übermäßig sinkt. 4)... Wechselkurserwartung und Zinsen beeinflussen den aktuellen Kurs! E E 1 R R Folie 68
69 Grundannahme: Der aktuelle Wechselkurs passt sich an. E /$ 1 E R e /$ R $ Folie 69
70 Zinssatzsteigerung im Inland (des Dollars) Folie 70
71 Zinssatzsteigerung im Ausland (des Euro) Folie 71
72 Erhöhung der ausländischen Geldmenge Folie 72
73 Wie verändert sich der Gleichgewicht-WK, wenn sich der die Ertrag eines der beiden Assets ändert? 'The $ is strong because interest rates are high': Senkung des WK, d. h. einer Aufwertung des $ gegenüber dem, um die Zinsparität wieder herzustellen. Bei festem erwarteten, zukünftigen WK: die $-Abwertungsrate Rate für die verbleibende Periode muß sich erhöhen, um die Zinsparität wieder herzustellen. Erhöhung des -Ertrags eines -Assets. Die zugehörige fallende Kurve verschiebt sich nach rechts. Der $/ -Wechselkurs erhöht sich (der $ wertet ab). Bei gegebenem, zukünftigen WK bedeutet eine Erhöhung der Erträge eines Assets (in eigener Währung), daß die Währung dieses Landes aufwertet. Folie 73
74 Häufig ist mit einer Zinssatzänderung auch eine Änderung des erwarteten, zukünftigen Wechselkurses verbunden. die Änderung der Erwartungen über den zukünftigen WK hängt von Grund der Zinssatzänderung ab. Effekt einer Erhöhung des der erwarteten $/ -Wechselkurses: Aus (3-2) sehen wir, daß es zu einer Verschiebung der fallenden Kurve für den $- Ertrag von -Assets kommt. C.P. führt also eine Erhöhung des zukünftigen WK zu einer Erhöhung des heutigen Wechselkurses. Folie 74
75 Uncovered Interest Parity UIP * ( 1 r) (1 r ) S e / S S / S 1 e s e * e (1 r) (1 r )(1 s ) 1 * e * e r s r s (3.1) (3.2) (3.3) Approximation: r s * e ist im Normalfall vernachlässigbar UIP-Regel: r r s * e (3.4) $-Verzinsung - -Verzinsung = erwartete Abwertungsrate des $ gegenüber dem Folie 75
76 Covered Interest Parity CIP Anstelle des erwarteten Wk S e wird die Forwardrate F verwendet f ist die forward premium F / S 1 f CIP-Regel: * r r f Folie 76
77 Risiko und Markteffizienz Eine Annahme der UIRP ist die Risikoneutralität der Anleger, sonst gilt * e r r s Risikoprämie Wobei die Richtung der Abweichung durch den Fluss des Kapitals gegeben ist. Bei effizienten Märkten gilt e f s Folie 77
78 Empirische Analyse Vier Hypothesen: UIRP, CIRP, Risikoneutralität, effiziente Märkte Jeweils drei bedingen die vierte. CIRP hält empirisch sehr exakt. Folie 78
79 Die internationale Fishergleichung Prof. Dr. Christian Bauer Fishergleichung: Nominalzins = Realzins + (erwartete) Inflation Inland r R dp Ausland r R dp e * * * e Internationale Fishergleichung: Annahme R=R * r r dp dp * e * e Nominalzinsdifferenz = Differenz der Inflation(serwartungen) Folie 79
80 e e * e Fisher UIRP: ds dp dp (PPP in Erwartung) e dq 0 q q e t 1 t Realer WK ist ein Martingal Random-Walk-Hypothese des realen Wechselkurses Falls unterschiedliche Realzinsen und UIRP e * * e e* ds r r ( R R ) ( dp dp ) e * dq R R Bei Wissen über p,p und s auch ohne " ". * e t+1 t 1 t+1 Folie 80
81 Prof. Dr. Christian Prof. Dr. Bauer Herz Monetäre Europäische Außenwirtschaft Integration WS 2004/ /11 Folie 01 Folie 81
82 Preisniveau und Wechselkurs in der mittleren Frist: Das AA-DD-Modell Folie 82 Folie 82
83 Das AA-DD-Modell Prof. Dr. Christian Bauer 1) AA-Kurve a) Geldmarkt b) Devisenmarkt 2) DD-Kurve: Gütermarkt 3) AA-DD-Model: Zusammenführung von AA und DD 4) Anpassungsprozesse Folie 83 Folie 83
84 Sozialprodukt und Wechselkurs in der kurzen Frist A. Geldmarkt Prof. Dr. Christian Bauer Folie 84 Folie 84
85 Erhöhung der Produktion / des Einkommens Preisnotierung E = Aufwertung E = Abwertung Folie 85 Folie 85
86 Erhöhung der Produktion / des Einkommens: Die AA-Kurve Prof. Dr. Christian Bauer Folie 86 Folie 86
87 Verschiebung der AA-Kurve M Abwertung Abwertung P M/P Zins Abwertung E e Auslandsrenditekurve Abwertung R* Auslandsrenditekurve Abwertung L Zins Abwertung Folie 87 Folie 87
88 Das AA-DD-Modell Prof. Dr. Christian Bauer 1) AA-Kurve a) Geldmarkt b) Devisenmarkt 2) DD-Kurve: Gütermarkt 3) AA-DD-Model: Zusammenführung von AA und DD 4) Anpassungsprozesse Folie 88 Folie 88
89 B. Gütermarkt Die DD-Kurve N Y C I G LB * P C( Y T ) I G LB( EP ) N N * EP Y Y ( Y T,, I, G) P Folie 89 Folie 89
90 Verschiebung der DD-Kurve G, I, T, P*, P N N * EP Y Y ( Y T,, I, G) P Folie 90 Folie 90
91 C. Güter- und Assetmarkt Folie 91 Folie 91
92 AA-DD-Modell: Gleichgewicht Folie 92 Folie 92
93 AA-DD-Modell: Ungleichgewicht Zuerst Anpassung auf den Assetmärkten (2 3) Dann auf den Gütermärkten (3 1) Folie 93 Folie 93
94 (Temporär wirkende) expansive Fiskalpolitik E e bleibt unverändert, ebenso P, P* und R* Folie 94 Folie 94
95 Zeitreihenentwicklung bei konstanten Preisen (AA-DD-Modell) Folie 95 Folie 95
96 (Temporär wirkende) expansive Geldpolitik (I) E e bleibt unverändert, ebenso P, P* und R* Folie 96 Folie 96
97 (Temporär wirkende) expansive Geldpolitik (II) Overshooting 1 Folie 97 Folie 97
98 Zeitreihenentwicklung bei konstanten Preisen (AA-DD-Modell) Prof. Dr. Christian Bauer Folie 98 Folie 98
99 Geld- und Fiskalpolitik im AA-DD-Modell Expansive Geldpolitik Expansive Fiskalpolitik P, E e konst dauer haft temporär Vollbeschäftigung M R (AA nach rechts) E (Abwertung) damit E- E e = R*-R G L R (DD nach rechts) E (Aufwertung) damit E- E e = R*-R Folie 99 Folie 99
100 Geld- und Fiskalpolitik im AA-DD-Modell Expansive Geldpolitik Expansive Fiskalpolitik P, E e konst dauer haft temporär Vollbeschäftigung M R (AA nach rechts) E (Abwertung) damit E- E e = R*-R R langfr. unverändert M P E e (langfr.) E (Abwertung) (E e wirkt verstärkend) G L R (DD nach rechts) E (Aufwertung) damit E- E e = R*-R Folie 100 Folie 100
101 Geld- und Fiskalpolitik im AA-DD-Modell Expansive Geldpolitik Expansive Fiskalpolitik P, E e konst dauer haft temporär Vollbeschäftigung M R (AA nach rechts) E (Abwertung) damit E- E e = R*-R R langfr. unverändert M P E e (langfr.) E (Abwertung) (E e wirkt verstärkend) G L R (DD nach rechts) E (Aufwertung) damit E- E e = R*-R P, M, R langfr. unverändert E e Ex (sonst dauerhaft Y>Y nat ) E (Aufwertung) (rel. PPP, da E=E e, = *=0) Folie 101 Folie 101
102 Einflussmöglichkeiten der Notenbank Der nominale Wechselkurs bildet sich durch Angebot und Nachfrage an den beiden Währungen auf dem Devisenmarkt. Diese können durch reale Güterströme oder durch reine Anlageentscheidungen auf dem Kapitalmarkt induziert werden. Außerdem kann eine Notenbank Angebot und Nachfrage beeinflussen: direkt, indem Sie als Anbieter oder Nachfrager auftritt, und indirekt durch Zins- oder Geldmengenänderungen und vor allem durch die Beeinflussung der Erwartungen der Marktteilnehmer. Folie 102
103 Devisenmarktinterventionen in einem Festkurssystem Prof. Dr. Christian Bauer Wie könnte die EZB reagieren, wenn Sie bei einem Anstieg der $- Nachfrage, den Wechselkurs innerhalb des Bandes halten will? Folie 103 Folie 103
104 Expansive Geldpolitik bei festen Wechselkursen Prof. Dr. Christian Bauer Folie 104 Folie 104
105 Expansive Geldpolitik bei festen Wechselkursen Prof. Dr. Christian Bauer Folie 105 Folie 105
106 Expansive Fiskalpolitik bei festen Wechselkursen Folie 106 Folie 106
107 Expansive Fiskalpolitik bei festen Wechselkursen Prof. Dr. Christian Bauer Folie 107 Folie 107
Prof. Dr. Christian Bauer Monetäre Außenwirtschaft WS 2009/10. ft Folie 33
 Kaufkraftparität ft Folie 33 Zinsparität und Kaufkraftparität Folie 34 Kaufkraftparität (purchasing power parity (PPP)) Prof. Dr. Christian Bauer Man versucht, anhand eines Menüs gemeinsamer Preise zu
Kaufkraftparität ft Folie 33 Zinsparität und Kaufkraftparität Folie 34 Kaufkraftparität (purchasing power parity (PPP)) Prof. Dr. Christian Bauer Man versucht, anhand eines Menüs gemeinsamer Preise zu
Monetäre Außenwirtschaft
 Prof. Dr. Christian Prof. Dr. Bauer Herz Monetäre Europäische Außenwirtschaft Integration 2004/05 Folie 01 Folie 1 Preisniveau und Wechselkurs in der mittleren Frist: Das AA-DD-Modell Folie 2 Folie 2 Das
Prof. Dr. Christian Prof. Dr. Bauer Herz Monetäre Europäische Außenwirtschaft Integration 2004/05 Folie 01 Folie 1 Preisniveau und Wechselkurs in der mittleren Frist: Das AA-DD-Modell Folie 2 Folie 2 Das
Monetäre Außenwirtschaft
 Prof. Dr. Christian Prof. Dr. Bauer Herz Monetäre Europäische Außenwirtschaft Integration 2004/05 Folie 01 Folie 1 Termine: Vorlesungsbeginn: Do., 29.Oktober, 12.00-13.30 Uhr, B21 Abschlussklausur: wird
Prof. Dr. Christian Prof. Dr. Bauer Herz Monetäre Europäische Außenwirtschaft Integration 2004/05 Folie 01 Folie 1 Termine: Vorlesungsbeginn: Do., 29.Oktober, 12.00-13.30 Uhr, B21 Abschlussklausur: wird
Kapitel 4: Wechselkursregime. Makroökonomik I - Wechselkursregime
 Kapitel 4: Wechselkursregime 1 Ausblick: Wechselkursregime Anpassung bei festen Wechselkursen Wechselkurskrisen Flexibler Wechselkurs Wahl des Regimes 2 Aggregierte Nachfrage (AD) bei festen Wechselkursen
Kapitel 4: Wechselkursregime 1 Ausblick: Wechselkursregime Anpassung bei festen Wechselkursen Wechselkurskrisen Flexibler Wechselkurs Wahl des Regimes 2 Aggregierte Nachfrage (AD) bei festen Wechselkursen
Wechselkursregime. Makroökonomik I - Wechselkursregime
 Wechselkursregime 1 Ausblick: Wechselkursregime Anpassung bei festen Wechselkursen Wechselkurskrisen Flexibler Wechselkurs Wahl des Regimes 2 4.1 Aggregierte Nachfrage (AD) bei festen Wechselkursen Unter
Wechselkursregime 1 Ausblick: Wechselkursregime Anpassung bei festen Wechselkursen Wechselkurskrisen Flexibler Wechselkurs Wahl des Regimes 2 4.1 Aggregierte Nachfrage (AD) bei festen Wechselkursen Unter
Internationale Ökonomie II. Vorlesung 4:
 Internationale Ökonomie II Vorlesung 4: Die Kaufkraftparitätentheorie: Preisniveau und Wechselkurs Prof. Dr. Dominik Maltritz Gliederung der Vorlesung 1. Ein- und Überleitung: Die Zahlungsbilanz 2. Wechselkurse
Internationale Ökonomie II Vorlesung 4: Die Kaufkraftparitätentheorie: Preisniveau und Wechselkurs Prof. Dr. Dominik Maltritz Gliederung der Vorlesung 1. Ein- und Überleitung: Die Zahlungsbilanz 2. Wechselkurse
Makroökonomik I - Wechselkursregime 1
 1 Wechselkursregime 2 Ausblick: Wechselkursregime Anpassung bei festen Wechselkursen Wechselkurskrisen Flexibler Wechselkurs Wahl des Regimes 3 4.1 Aggregierte Nachfrage (AD) bei festen Wechselkursen Unter
1 Wechselkursregime 2 Ausblick: Wechselkursregime Anpassung bei festen Wechselkursen Wechselkurskrisen Flexibler Wechselkurs Wahl des Regimes 3 4.1 Aggregierte Nachfrage (AD) bei festen Wechselkursen Unter
Makroökonomik für Betriebswirte
 Makroökonomik für Betriebswirte 9.3 Das Mundell-Fleming Modell Dr. Michael Paetz Universität Hamburg Fachbereich Volkswirtschaftslehre Januar 2018 Email: Michael.Paetz@wiso.uni-hamburg.de GÜTERMARKTGLEICHGEWICHT
Makroökonomik für Betriebswirte 9.3 Das Mundell-Fleming Modell Dr. Michael Paetz Universität Hamburg Fachbereich Volkswirtschaftslehre Januar 2018 Email: Michael.Paetz@wiso.uni-hamburg.de GÜTERMARKTGLEICHGEWICHT
Determinanten des Wechselkurses
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-WiWi Christian Peukert Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2009/2010
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-WiWi Christian Peukert Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2009/2010
Determinanten des Wechselkurses
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Filiz Bestepe, M.Sc. Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2015/2016 Übung
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Filiz Bestepe, M.Sc. Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2015/2016 Übung
Prof. Dr. Christian Bauer Monetäre Außenwirtschaft WS 2009/10. Wechselkursmodelle. Folie 1
 Wechselkursmodelle Folie 1 Das Monetäre Modell Wechselkurs und BoP Gleichgewicht Weit verbreitet in den 1970ern Ausgangspunkt für viele Weiterentwicklungen Viele empirische Probleme Aber klassisches Referenzmodell
Wechselkursmodelle Folie 1 Das Monetäre Modell Wechselkurs und BoP Gleichgewicht Weit verbreitet in den 1970ern Ausgangspunkt für viele Weiterentwicklungen Viele empirische Probleme Aber klassisches Referenzmodell
5.2. Das Mundell-Fleming-Modell
 5.2. Das Mundell-Fleming-Modell Erweiterung des IS-LM Modells für oene Wirtschaft Preisniveau ist x Nominalzins = Realzins, i = r. Weil sich relativer Preis P/P nicht ändert, können wir P = P setzen. Nominaler
5.2. Das Mundell-Fleming-Modell Erweiterung des IS-LM Modells für oene Wirtschaft Preisniveau ist x Nominalzins = Realzins, i = r. Weil sich relativer Preis P/P nicht ändert, können wir P = P setzen. Nominaler
Übungsfragen. Währungspolitik
 Übungsfragen Währungspolitik 4 Zahlungsbilanz und Wechselkurs 4.1 Was bestimmt das Angebot an und die Nachfrage nach Devisen? Erläutern Sie stichpunktartig die wichtigsten Posten der Zahlungsbilanz! Auf
Übungsfragen Währungspolitik 4 Zahlungsbilanz und Wechselkurs 4.1 Was bestimmt das Angebot an und die Nachfrage nach Devisen? Erläutern Sie stichpunktartig die wichtigsten Posten der Zahlungsbilanz! Auf
Eine durch Steuererhöhung finanzierte expansive Fiskalpolitik führt im Rahmen eines IS/LM-Modells einer geschlossenen Volkswirtschaft
 Makro-Quiz I Eine durch Steuererhöhung finanzierte expansive Fiskalpolitik führt im Rahmen eines IS/LM-Modells einer geschlossenen Volkswirtschaft [ ] zu einem höheren Zinsniveau sowie einem höheren Output.
Makro-Quiz I Eine durch Steuererhöhung finanzierte expansive Fiskalpolitik führt im Rahmen eines IS/LM-Modells einer geschlossenen Volkswirtschaft [ ] zu einem höheren Zinsniveau sowie einem höheren Output.
Internationale Wirtschaftslehre SS 2015, 2 St (2. Studienjahr) Prof. Dr. Karl Farmer, KFU Graz und BBU Klausenburg
 Internationale Wirtschaftslehre SS 2015, 2 St (2. Studienjahr) Prof. Dr. Karl Farmer, KFU Graz und BBU Klausenburg Terminplan und Inhaltsübersicht Internationale Mikroökonomik Dienstag Die Vermögensmarkttheorie
Internationale Wirtschaftslehre SS 2015, 2 St (2. Studienjahr) Prof. Dr. Karl Farmer, KFU Graz und BBU Klausenburg Terminplan und Inhaltsübersicht Internationale Mikroökonomik Dienstag Die Vermögensmarkttheorie
Tutorium Blatt 8 Offene Volkswirtschaft
 Tutorium Blatt 8 Offene Volkswirtschaft 1. Aufgabe Das einzige Gut in dieser Welt sei ein Hotdog. Ein Hotdog in den USA entspreche von seinen Produkteigenschaften exakt einem Hotdog im Euroraum. Gegeben
Tutorium Blatt 8 Offene Volkswirtschaft 1. Aufgabe Das einzige Gut in dieser Welt sei ein Hotdog. Ein Hotdog in den USA entspreche von seinen Produkteigenschaften exakt einem Hotdog im Euroraum. Gegeben
1.Übung zur Vorlesung. Analyse geldpolitischer Maßnahmen in komparativ statischen makroökonomischen Modellen
 1.Übung zur Vorlesung Geld und Währung Analyse geldpolitischer Maßnahmen in komparativ statischen makroökonomischen Modellen 1 Analyse im IS LM Modell 2 Der Gütermarkt und die IS Gleichung Auf dem Gütermarkt
1.Übung zur Vorlesung Geld und Währung Analyse geldpolitischer Maßnahmen in komparativ statischen makroökonomischen Modellen 1 Analyse im IS LM Modell 2 Der Gütermarkt und die IS Gleichung Auf dem Gütermarkt
Oene Volkswirtschaft III - Mundell Fleming Modell
 Oene Volkswirtschaft III - Mundell Fleming Modell Einführung in die Makroökonomie SS 2012 21. Juni 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Oene Volkswirtschaft III - Mundell Fleming Modell 21. Juni
Oene Volkswirtschaft III - Mundell Fleming Modell Einführung in die Makroökonomie SS 2012 21. Juni 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Oene Volkswirtschaft III - Mundell Fleming Modell 21. Juni
Nachholklausur zur Vorlesung Makroökonomik II Sommersemester Bitte auf dem Lösungsblatt angeben!
 Freiburg, 12.01.2015 Nachholklausur zur Vorlesung Makroökonomik II Sommersemester 2014 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (15 Punkte) 1. Das Solow-Modell bildet von den
Freiburg, 12.01.2015 Nachholklausur zur Vorlesung Makroökonomik II Sommersemester 2014 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (15 Punkte) 1. Das Solow-Modell bildet von den
Kapitel 14: Wechselkurse und Devisenmarkt: Ein Vermögensmarkt- Ansatz
 Kapitel 14: Wechselkurse und Devisenmarkt: Ein Vermögensmarkt- Ansatz 1 Kapitelübersicht Einführung Wechselkurse und internationale Transaktionen Der Devisenmarkt Die Nachfrage nach Fremdwährungsvermögenswerten
Kapitel 14: Wechselkurse und Devisenmarkt: Ein Vermögensmarkt- Ansatz 1 Kapitelübersicht Einführung Wechselkurse und internationale Transaktionen Der Devisenmarkt Die Nachfrage nach Fremdwährungsvermögenswerten
Internationale Ökonomie II. Vorlesung 4:
 Internationale Ökonomie II Vorlesung 4: Die Kaufkraftparitätentheorie: ft th i Preisniveau und Wechselkurs Prof. Dr. Dominik Maltritz Gliederung der Vorlesung 1. Ein- und Überleitung: Die Zahlungsbilanz
Internationale Ökonomie II Vorlesung 4: Die Kaufkraftparitätentheorie: ft th i Preisniveau und Wechselkurs Prof. Dr. Dominik Maltritz Gliederung der Vorlesung 1. Ein- und Überleitung: Die Zahlungsbilanz
Teil II: Die offene Volkswirtschaft
 Teil II: Die offene Volkswirtschaft Kapitel 1: Offenheit Makroökonomik I - Offenheit 1 To Do: Teil II Offenheit Gütermarkt Finanzmarkt Wechselkursregime Makroökonomik I - Offenheit 2 Ausblick Offenheit
Teil II: Die offene Volkswirtschaft Kapitel 1: Offenheit Makroökonomik I - Offenheit 1 To Do: Teil II Offenheit Gütermarkt Finanzmarkt Wechselkursregime Makroökonomik I - Offenheit 2 Ausblick Offenheit
Geld und Währung. Übungsfragen
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Prof. Dr. Werner Smolny Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Institutsdirektor Wintersemester
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Prof. Dr. Werner Smolny Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Institutsdirektor Wintersemester
ME II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser. Kapitel 3 Die offene Volkswirtschaft
 ME II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser Kapitel 3 Die offene Volkswirtschaft Version: 26.04.2011 3.1 Offene Gütermärkte Die Wahl zwischen in- und ausländischen Gütern Wenn Gütermärkte offen sind, dann müssen
ME II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser Kapitel 3 Die offene Volkswirtschaft Version: 26.04.2011 3.1 Offene Gütermärkte Die Wahl zwischen in- und ausländischen Gütern Wenn Gütermärkte offen sind, dann müssen
Makroökonomik II. Veranstaltung 2
 Makroökonomik II Veranstaltung 2 1 Ausgangspunkt 1. Das Keynesianische Kreuz konzentriert sich auf den Gütermarkt. Problem: Zinssatz beeinflusst Nachfrage. 2. Das IS LM Modell: fügt den Geldmarkt hinzu,
Makroökonomik II Veranstaltung 2 1 Ausgangspunkt 1. Das Keynesianische Kreuz konzentriert sich auf den Gütermarkt. Problem: Zinssatz beeinflusst Nachfrage. 2. Das IS LM Modell: fügt den Geldmarkt hinzu,
Das IS-LM-Modell in der offenen Volkswirtschaft II
 Das IS-LM-Modell in der offenen Volkswirtschaft II IK Einkommen, Beschäftigung und Finanzmärkte (Einheit 7 & 8) Friedrich Sindermann JKU 10.05. & 17.05.2011 Friedrich Sindermann (JKU) Offene VW 2 10.05.
Das IS-LM-Modell in der offenen Volkswirtschaft II IK Einkommen, Beschäftigung und Finanzmärkte (Einheit 7 & 8) Friedrich Sindermann JKU 10.05. & 17.05.2011 Friedrich Sindermann (JKU) Offene VW 2 10.05.
Klausur Internationale Wirtschaftsbeziehungen II
 Universität Bayreuth Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät PD Dr. Christian Bauer Klausur Internationale Wirtschaftsbeziehungen II Name: Vorname: Studiengang: Semesterzahl: Matrikel-Nummer:
Universität Bayreuth Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät PD Dr. Christian Bauer Klausur Internationale Wirtschaftsbeziehungen II Name: Vorname: Studiengang: Semesterzahl: Matrikel-Nummer:
Wechselkurssysteme im Vergleich
 Wechselkurssysteme im Vergleich Monika Haslinger Maria Spieß Überblick Einleitung Mundell s impossible trinity Geld- & Fiskalpolitik bei freien Wechselkursen Geld- & Fiskalpolitik bei fixen Wechselkursen
Wechselkurssysteme im Vergleich Monika Haslinger Maria Spieß Überblick Einleitung Mundell s impossible trinity Geld- & Fiskalpolitik bei freien Wechselkursen Geld- & Fiskalpolitik bei fixen Wechselkursen
Internationale Wirtschaft Kapitel 16: Preisniveaus und Wechselkurs in langer Frist Kapitel 16: Preisniveaus und Wechselkurs in langer Frist
 Kapitel 16: Preisniveaus und Wechselkurs in langer Frist 1 Kapitelübersicht Einführung Das Gesetz der Preiseinheitlichkeit Kaufkraftparität Ein langfristiges Modell des Wechselkurses auf der Grundlage
Kapitel 16: Preisniveaus und Wechselkurs in langer Frist 1 Kapitelübersicht Einführung Das Gesetz der Preiseinheitlichkeit Kaufkraftparität Ein langfristiges Modell des Wechselkurses auf der Grundlage
Grundbegriffe 3. Makroökonomie in einer offenen Volkswirtschaft
 Grundbegriffe 3 Makroökonomie in einer offenen Volkswirtschaft Offene Gütermärkte Exporte: Im Inland produziert Im Ausland nachgefragt Importe: Im Ausland produziert Im Inland nachgefragt Offene Gütermärkte
Grundbegriffe 3 Makroökonomie in einer offenen Volkswirtschaft Offene Gütermärkte Exporte: Im Inland produziert Im Ausland nachgefragt Importe: Im Ausland produziert Im Inland nachgefragt Offene Gütermärkte
Internationale Ökonomie II. Vorlesung 4:
 Internationale Ökonomie II Vorlesung 4: Die Kaufkraftparitätentheorie: Preisniveau und Wechselkurs Prof. Dr. Dominik Maltritz Gliederung der Vorlesung 1. Ein- und Überleitung: Die Zahlungsbilanz 2. Wechselkurse
Internationale Ökonomie II Vorlesung 4: Die Kaufkraftparitätentheorie: Preisniveau und Wechselkurs Prof. Dr. Dominik Maltritz Gliederung der Vorlesung 1. Ein- und Überleitung: Die Zahlungsbilanz 2. Wechselkurse
Übungsfragen. Währungspolitik
 Übungsfragen Währungspolitik 4 Zahlungsbilanz und Wechselkurs 4.1 Was bestimmt das Angebot an und die Nachfrage nach Devisen? Erläutern Sie stichpunktartig die wichtigsten Posten der Zahlungsbilanz! Auf
Übungsfragen Währungspolitik 4 Zahlungsbilanz und Wechselkurs 4.1 Was bestimmt das Angebot an und die Nachfrage nach Devisen? Erläutern Sie stichpunktartig die wichtigsten Posten der Zahlungsbilanz! Auf
Abschlussklausur zur Vorlesung Makroökonomik II Sommersemester 2013
 Freiburg, 25.07.2013 Abschlussklausur zur Vorlesung Makroökonomik II Sommersemester 2013 Teil I: Multiple Choice (15 Punkte) 1. Die Preissetzungsfunktion sei = 1+. Nehmen Sie an, der Gewinnaufschlag,,
Freiburg, 25.07.2013 Abschlussklausur zur Vorlesung Makroökonomik II Sommersemester 2013 Teil I: Multiple Choice (15 Punkte) 1. Die Preissetzungsfunktion sei = 1+. Nehmen Sie an, der Gewinnaufschlag,,
Einkommen, Beschäftigung und Finanzmärkte - Thema 4: Internationale Wirtschaft - Basics (Teil I).
 Einkommen, Beschäftigung und Finanzmärkte - Thema 4: Internationale Wirtschaft - Basics (Teil I). Mario Lackner JKU Linz, Abteilung für Finanzwissenschaft. 19. November 2009 Eine vernetzte Weltwirtschaft
Einkommen, Beschäftigung und Finanzmärkte - Thema 4: Internationale Wirtschaft - Basics (Teil I). Mario Lackner JKU Linz, Abteilung für Finanzwissenschaft. 19. November 2009 Eine vernetzte Weltwirtschaft
Monetäre Außenwirtschaft
 Monetäre Außenwirtschaft Von Prof. Dr. Karl-Heinz Moritz und Prof. Dr. Georg Stadtmann 2., vollständig überarbeitete Auflage Verlag Franz Vahlen München Inhaltsverzeichnis Vorwort V Abbildungsverzeichnis
Monetäre Außenwirtschaft Von Prof. Dr. Karl-Heinz Moritz und Prof. Dr. Georg Stadtmann 2., vollständig überarbeitete Auflage Verlag Franz Vahlen München Inhaltsverzeichnis Vorwort V Abbildungsverzeichnis
Teil I Einleitung 19. Teil II Die kurze Frist 83
 Inhaltsverzeichnis Vorwort 13 Teil I Einleitung 19 Kapitel 1 Eine Reise um die Welt 21 1.1 Ein Blick auf die makroökonomischen Daten................................... 23 1.2 Die Entstehung der Finanzkrise
Inhaltsverzeichnis Vorwort 13 Teil I Einleitung 19 Kapitel 1 Eine Reise um die Welt 21 1.1 Ein Blick auf die makroökonomischen Daten................................... 23 1.2 Die Entstehung der Finanzkrise
Geld, Zinssätze und Wechselkurse Dr. Marco Portmann
 Geld, Zinssätze und Wechselkurse Dr. Marco Portmann Aussenwirtschaft I Universität Freiburg i.ü. Herbst 2014 Geldmarkt und Wechselkurs Einführung Im letzten Kapitel wurden die Wechselkurserwartungen, die
Geld, Zinssätze und Wechselkurse Dr. Marco Portmann Aussenwirtschaft I Universität Freiburg i.ü. Herbst 2014 Geldmarkt und Wechselkurs Einführung Im letzten Kapitel wurden die Wechselkurserwartungen, die
IK: Einkommen, Beschäftigung und Finanzmärkte (Sommersemester 2011) Das IS-LM Modell in offenen Volkswirtschaften
 IK: Einkommen, Beschäftigung und Finanzmärkte (Sommersemester 2011) Das IS-LM Modell in offenen Volkswirtschaften Inhalt Ziel: Erweiterung der Güter- und Finanzmarktmodelle für offene Ökonomien Offene
IK: Einkommen, Beschäftigung und Finanzmärkte (Sommersemester 2011) Das IS-LM Modell in offenen Volkswirtschaften Inhalt Ziel: Erweiterung der Güter- und Finanzmarktmodelle für offene Ökonomien Offene
Cobb-Douglas-Produktionsfunktion
 Das Unternehmen // Produktion Cobb-Douglas-Produktionsfunktion Problem Die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion ist gegeben durch F (K, L) = K β L 1 β Für welche Werte von β zeigt sie steigende, konstante
Das Unternehmen // Produktion Cobb-Douglas-Produktionsfunktion Problem Die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion ist gegeben durch F (K, L) = K β L 1 β Für welche Werte von β zeigt sie steigende, konstante
Aufbau des Buches Einsatz in der Lehre
 Inhaltsverzeichnis Die Autoren Vorwort Inhaltsübersicht Symbole Kästen Einleitung Aufbau des Buches Einsatz in der Lehre VII IX XI XIX XXI XXIII XXIV XXV 1 Der Devisenmarkt 1 1.1 Einleitung 1 1.2 Charakteristika
Inhaltsverzeichnis Die Autoren Vorwort Inhaltsübersicht Symbole Kästen Einleitung Aufbau des Buches Einsatz in der Lehre VII IX XI XIX XXI XXIII XXIV XXV 1 Der Devisenmarkt 1 1.1 Einleitung 1 1.2 Charakteristika
5.3. Wechselkursregime Währungskrisen bei festem Wechselkurs
 5.3. Wechselkursregime 5.3.1. Währungskrisen bei festem Wechselkurs Was passiert, wenn Märkte eine Abwertung erwarten? Mögliche Gründe: 1. Bei xem nominalem WK und hoher Ination ist realer WK überbewertet
5.3. Wechselkursregime 5.3.1. Währungskrisen bei festem Wechselkurs Was passiert, wenn Märkte eine Abwertung erwarten? Mögliche Gründe: 1. Bei xem nominalem WK und hoher Ination ist realer WK überbewertet
Makroökonomie. Unterschiedliche Wechselkursregime. Dr. Michael Paetz. (basierend auf den Folien von Jun.-Prof. Dr. Lena Dräger)
 Makroökonomie Unterschiedliche Wechselkursregime Dr. Michael Paetz (basierend auf den Folien von Jun.-Prof. Dr. Lena Dräger) Universität Hamburg Email: Michael.Paetz@wiso.uni-hamburg.de 1 / 53 Outline
Makroökonomie Unterschiedliche Wechselkursregime Dr. Michael Paetz (basierend auf den Folien von Jun.-Prof. Dr. Lena Dräger) Universität Hamburg Email: Michael.Paetz@wiso.uni-hamburg.de 1 / 53 Outline
Kap. 8: Devisenmarkt und Wechselkurs
 Kap. 8: Devisenmarkt und Wechselkurs 1. Charakteristika des Devisenmarktes 2. Wechselkurskonzepte 3. Kaufkraftparität 4. Zinsparität 5. Wechselkurs und Quantitätstheorie Literatur Gebauer: Lehrbuch Geld
Kap. 8: Devisenmarkt und Wechselkurs 1. Charakteristika des Devisenmarktes 2. Wechselkurskonzepte 3. Kaufkraftparität 4. Zinsparität 5. Wechselkurs und Quantitätstheorie Literatur Gebauer: Lehrbuch Geld
Teil I Einleitung 19. Teil II Die kurze Frist 79
 Inhaltsverzeichnis Vorwort 13 Teil I Einleitung 19 Kapitel 1 Eine Reise um die Welt 21 1.1 Deutschland, Euroraum und Europäische Union................................ 22 1.2 Die Vereinigten Staaten....................................................
Inhaltsverzeichnis Vorwort 13 Teil I Einleitung 19 Kapitel 1 Eine Reise um die Welt 21 1.1 Deutschland, Euroraum und Europäische Union................................ 22 1.2 Die Vereinigten Staaten....................................................
Geld- und Kreditpolitik
 Prof. Dr. Christian Prof. Dr. Bauer Herz Europäische Integration WS SS 2004/05 2010 Folie 01 Folie 1 Warum beschäftigen wir uns mit Währungs- bzw. Finanzkrisen? Folie 2 Prof. Dr. Christian Bauer 1) König
Prof. Dr. Christian Prof. Dr. Bauer Herz Europäische Integration WS SS 2004/05 2010 Folie 01 Folie 1 Warum beschäftigen wir uns mit Währungs- bzw. Finanzkrisen? Folie 2 Prof. Dr. Christian Bauer 1) König
5. Die oene Volkswirtschaft
 5. Die oene Volkswirtschaft Lit.: Blanchard/Illing, Kap. 18-20; Romer, Kap. 5 In oener Wirtschaft kommt Groÿteil der Nachfrage aus dem Ausland bzw. Produktion erfolgt für ausländische Märkte. Wie beeinusst
5. Die oene Volkswirtschaft Lit.: Blanchard/Illing, Kap. 18-20; Romer, Kap. 5 In oener Wirtschaft kommt Groÿteil der Nachfrage aus dem Ausland bzw. Produktion erfolgt für ausländische Märkte. Wie beeinusst
Makroökonomie. Der Gütermarkt in einer offenen Volkswirtschaft II & Das Mundell-Fleming Modell. Dr. Michael Paetz
 Makroökonomie Der Gütermarkt in einer offenen Volkswirtschaft II & Das Mundell-Fleming Modell Dr. Michael Paetz (basierend auf den Folien von Jun.-Prof. Dr. Lena Dräger) Universität Hamburg Email: Michael.Paetz@wiso.uni-hamburg.de
Makroökonomie Der Gütermarkt in einer offenen Volkswirtschaft II & Das Mundell-Fleming Modell Dr. Michael Paetz (basierend auf den Folien von Jun.-Prof. Dr. Lena Dräger) Universität Hamburg Email: Michael.Paetz@wiso.uni-hamburg.de
Inhaltsverzeichnis. Vorwort 11. Teil 1 Einleitung 15
 Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 Teil 1 Einleitung 15 Kapitel 1 Eine Reise um die Welt 17 1.1 Deutschland, Euroraum und Europäische Union 18 1.2 Die Vereinigten Staaten 25 1.3 Japan 30 1.4 Wie es weitergeht
Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 Teil 1 Einleitung 15 Kapitel 1 Eine Reise um die Welt 17 1.1 Deutschland, Euroraum und Europäische Union 18 1.2 Die Vereinigten Staaten 25 1.3 Japan 30 1.4 Wie es weitergeht
a) Welche Annahmen über Güterangebot und Güternachfrage liegen dem Modell eines Branchenzyklus zugrunde?
 Aufgabe 1 (25 Punkte) Branchenzklen versus Konjunkturzklen a) Welche Annahmen über Güterangebot und Güternachfrage liegen dem Modell eines Branchenzklus zugrunde? Das Güterangebot wird bestimmt durch den
Aufgabe 1 (25 Punkte) Branchenzklen versus Konjunkturzklen a) Welche Annahmen über Güterangebot und Güternachfrage liegen dem Modell eines Branchenzklus zugrunde? Das Güterangebot wird bestimmt durch den
Übungsaufgaben zu Kapitel 6: Finanzmärkte und Erwartungen
 Kapitel 6 Übungsaufgaben zu Kapitel 6: Finanzmärkte und Erwartungen Übungsaufgabe 6-1a 6-1a) Welche Typen von Zinsstrukturkurven kennen Sie? Stellen Sie die Typen graphisch dar und erläutern Sie diese.
Kapitel 6 Übungsaufgaben zu Kapitel 6: Finanzmärkte und Erwartungen Übungsaufgabe 6-1a 6-1a) Welche Typen von Zinsstrukturkurven kennen Sie? Stellen Sie die Typen graphisch dar und erläutern Sie diese.
6 Das Mundell Fleming Modell
 6 Das Mundell Fleming Modell Literatur: Gandolfo [2003, Chapter II.10, II.11] Caves et al. [2002, Chapter 18 (bedingt),19.1, 22] Krugman & Obstfeld [2004, Kapitel 16, 17] Heijdra & van der Ploeg [2002,
6 Das Mundell Fleming Modell Literatur: Gandolfo [2003, Chapter II.10, II.11] Caves et al. [2002, Chapter 18 (bedingt),19.1, 22] Krugman & Obstfeld [2004, Kapitel 16, 17] Heijdra & van der Ploeg [2002,
Internationale Wirtschaft Kapitel 17: Produktion und Wechselkurs in kurzer Frist Kapitel 17: Produktion und Wechselkurs in kurzer Frist
 Kapitel 17: Produktion und Wechselkurs in kurzer Frist 1 Kapitelübersicht Determinanten der volkswirtschaftlichen Nachfrage in einer offenen Volkswirtschaft Die Gleichung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage
Kapitel 17: Produktion und Wechselkurs in kurzer Frist 1 Kapitelübersicht Determinanten der volkswirtschaftlichen Nachfrage in einer offenen Volkswirtschaft Die Gleichung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage
Olivier Blanchard Gerhard Illing. Makroökonomie. 4., aktualisierte und erweiterte Auflage
 Olivier Blanchard Gerhard Illing Makroökonomie 4., aktualisierte und erweiterte Auflage Inhaltsübersicht Vorwort 13 Teil I Kapitel 1 Kapitel 2 Einleitung Eine Reise um die Welt Eine Reise durch das Buch
Olivier Blanchard Gerhard Illing Makroökonomie 4., aktualisierte und erweiterte Auflage Inhaltsübersicht Vorwort 13 Teil I Kapitel 1 Kapitel 2 Einleitung Eine Reise um die Welt Eine Reise durch das Buch
Makro III: Elastizitätsansatz der Zahlungsbilanzanpassung
 Makro III: Elastizitätsansatz der Zahlungsbilanzanpassung Zur Relevanz des Elastizitätsansatzes der Zahlungsbilanzanpassung 1. Gütermärkte: Einfluss auf preisliche Wettbewerbsfähigkeit auf - und portgütermärkten
Makro III: Elastizitätsansatz der Zahlungsbilanzanpassung Zur Relevanz des Elastizitätsansatzes der Zahlungsbilanzanpassung 1. Gütermärkte: Einfluss auf preisliche Wettbewerbsfähigkeit auf - und portgütermärkten
Verfehlte Wirtschaftspolitik: Wechselkursmanagement. Rolf Kappel, NADEL, ETH Zürich
 Verfehlte Wirtschaftspolitik: Wechselkursmanagement Rolf Kappel, NADEL, ETH Zürich 19.3.2007 Einfluss des Wechselkurses auf Preise Die Veränderung des nominalen Wechselkurses (NWK) hat eine gleichmässige
Verfehlte Wirtschaftspolitik: Wechselkursmanagement Rolf Kappel, NADEL, ETH Zürich 19.3.2007 Einfluss des Wechselkurses auf Preise Die Veränderung des nominalen Wechselkurses (NWK) hat eine gleichmässige
Wahr/Falsch: Gütermarkt
 Wahr/Falsch: Gütermarkt Das Gütermarktgleichgewicht wird durch Y = a + b Y T dd mm beschrieben. Dabei ist a eine Konstante, b die marginale Konsumneigung, d die Zinsreagibilität der Investitionen und m
Wahr/Falsch: Gütermarkt Das Gütermarktgleichgewicht wird durch Y = a + b Y T dd mm beschrieben. Dabei ist a eine Konstante, b die marginale Konsumneigung, d die Zinsreagibilität der Investitionen und m
Jahreskurs Makroökonomik, Teil 2
 Professor Dr. Oliver Landmann SS 2011 Jahreskurs Makroökonomik, Teil 2 Wiederholungsklausur vom 12. Oktober 2011 Aufgabe 1 (25%) Die Produktionsfunktion einer Volkswirtschaft sei gegeben durch Y = K α
Professor Dr. Oliver Landmann SS 2011 Jahreskurs Makroökonomik, Teil 2 Wiederholungsklausur vom 12. Oktober 2011 Aufgabe 1 (25%) Die Produktionsfunktion einer Volkswirtschaft sei gegeben durch Y = K α
Ursachen von Inflation
 Ursachen von Inflation Vorjahresveränderung in % Vorjahresveränderung des LIK als Mass der Inflation (1990-2005) 6 5 4 3 2 1 0-1 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 Quelle: BfS 2 Welche Ursachen
Ursachen von Inflation Vorjahresveränderung in % Vorjahresveränderung des LIK als Mass der Inflation (1990-2005) 6 5 4 3 2 1 0-1 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 Quelle: BfS 2 Welche Ursachen
Makroökonomik II. Veranstaltung 2
 Makroökonomik II Veranstaltung 2 1 Ausgangspunkt 1. Das Keynesianische Kreuz konzentriert sich auf den Gütermarkt. Problem: Zinssatz beeinflusst Nachfrage. 2. Das IS LM Modell: fügt den Geldmarkt hinzu,
Makroökonomik II Veranstaltung 2 1 Ausgangspunkt 1. Das Keynesianische Kreuz konzentriert sich auf den Gütermarkt. Problem: Zinssatz beeinflusst Nachfrage. 2. Das IS LM Modell: fügt den Geldmarkt hinzu,
Geld- und Fiskalpolitik (2) und Währungsintegration. Aufgabe 1
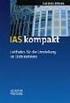 UNIVERSITÄT SIEGEN Theorie und Praxis für Karrieren von morgen Univ.-Professor Dr. Carsten Hefeker Dipl.-Volksw. Katja Popkova Fachbereich 5 Einführung in die Probleme der europäischen Wirtschaft Wintersemester
UNIVERSITÄT SIEGEN Theorie und Praxis für Karrieren von morgen Univ.-Professor Dr. Carsten Hefeker Dipl.-Volksw. Katja Popkova Fachbereich 5 Einführung in die Probleme der europäischen Wirtschaft Wintersemester
International Finance. Bearbeiten Sie alle sechs Aufgaben A1-A6 und eine der zwei Aufgaben B1-B2!
 Kursprüfung International Finance Schwerpunktmodul Finanzmärkte 6 Kreditpunkte, Bearbeitungsdauer: 90 Minuten SS 2012, 25.7.2012 Prof. Dr. Lutz Arnold Bitte gut leserlich ausfüllen: Name: Vorname: Matr.-nr.:
Kursprüfung International Finance Schwerpunktmodul Finanzmärkte 6 Kreditpunkte, Bearbeitungsdauer: 90 Minuten SS 2012, 25.7.2012 Prof. Dr. Lutz Arnold Bitte gut leserlich ausfüllen: Name: Vorname: Matr.-nr.:
Kapitel 17: Produktion und Wechselkurs in kurzer Frist
 Kapitel 1 Einführung Kapitel 17: Produktion und Wechselkurs in kurzer Frist Folie 16-1 17. Produktion und Wechselkurs in kurzer Frist Determinanten der volkswirtschaftlichen Nachfrage in einer offenen
Kapitel 1 Einführung Kapitel 17: Produktion und Wechselkurs in kurzer Frist Folie 16-1 17. Produktion und Wechselkurs in kurzer Frist Determinanten der volkswirtschaftlichen Nachfrage in einer offenen
Kapitel 6. Geld, Preise und Wechselkurse
 Burda & Wyplosz MACROECONOMICS 6 h edn Kapitel 6 Geld, Preise und Wechselkurse Oxford University Press, 2012. All rights reserved. Einführung und Übersicht Geld und das Neutralitätsprinzip Geld Geld und
Burda & Wyplosz MACROECONOMICS 6 h edn Kapitel 6 Geld, Preise und Wechselkurse Oxford University Press, 2012. All rights reserved. Einführung und Übersicht Geld und das Neutralitätsprinzip Geld Geld und
Inhaltsverzeichnis. eise um die Welt 17 utschland, Euroraum und Europäische Union 18 e Vereinigten Staaten e es weitergeht 34
 II eise um die Welt 17 utschland, Euroraum und Europäische Union 18 e Vereinigten Staaten 25 30 1e es weitergeht 34 ffßj / Eine Reise durch das Buch 41 wr ~' 2.1 Produktion und Wirtschaftswachstum - Das
II eise um die Welt 17 utschland, Euroraum und Europäische Union 18 e Vereinigten Staaten 25 30 1e es weitergeht 34 ffßj / Eine Reise durch das Buch 41 wr ~' 2.1 Produktion und Wirtschaftswachstum - Das
Gliederung Außenwirtschaftstheorie- und politik
 Gliederung Außenwirtschaftstheorie- und politik Prof. Dr. rer. pol. Martin Ehret Sommersemester 2015 1. Einleitung 2. Ursachen von Außenhandel 2.1. Verfügbarkeit 2.2. Unterschiedliche Marktbedingungen
Gliederung Außenwirtschaftstheorie- und politik Prof. Dr. rer. pol. Martin Ehret Sommersemester 2015 1. Einleitung 2. Ursachen von Außenhandel 2.1. Verfügbarkeit 2.2. Unterschiedliche Marktbedingungen
Internationale Ökonomie II Vorlesung 2: Wechselkurse und Devisenmarkt
 Internationale Ökonomie II Vorlesung 2: Wechselkurse und Devisenmarkt Prof. Dr. Dominik Maltritz Der Wechselkurs Der Wechselkurs zweier Währungen beschreibt das Austauschverhältnis zwischen diesen Währungen,
Internationale Ökonomie II Vorlesung 2: Wechselkurse und Devisenmarkt Prof. Dr. Dominik Maltritz Der Wechselkurs Der Wechselkurs zweier Währungen beschreibt das Austauschverhältnis zwischen diesen Währungen,
Makro III: Stabilisierungspolitik in kleinen offenen Volkswirtschaften
 Gliederung: Makro III: Stabilisierungspolitik in kleinen offenen Volkswirtschaften 7.1 Grundlagen und Problemstellung 7.2 Auswirkungen einer Erhöhung der internationalen Kapitalmobilität 7.3 Anpassung
Gliederung: Makro III: Stabilisierungspolitik in kleinen offenen Volkswirtschaften 7.1 Grundlagen und Problemstellung 7.2 Auswirkungen einer Erhöhung der internationalen Kapitalmobilität 7.3 Anpassung
Argumentieren Sie im Rahmen des IS/LM-Modells ohne explizite Berücksichtigung des Arbeitsmarktes. Gehen Sie von einem konstanten Preisniveau P aus.
 MC- Übungsaufgaben für die Klausur Aufgabe 1 (IS-LM) In einer geschlossenen Volkswirtschaft mit staatlichem Rentensystem besteht Unsicherheit darüber, ob auch in Zukunft der Staat eine Rente garantieren
MC- Übungsaufgaben für die Klausur Aufgabe 1 (IS-LM) In einer geschlossenen Volkswirtschaft mit staatlichem Rentensystem besteht Unsicherheit darüber, ob auch in Zukunft der Staat eine Rente garantieren
Kapitel 6. Geld, Preise und Wechselkurse
 Burda & Wyplosz MACROECONOMICS 5 th edn Kapitel 6 Geld, Preise und Wechselkurse Oxford University Press, 2009. All rights reserved. Einführung und Übersicht Geld und das Neutralitätsprinzip Geld Geld und
Burda & Wyplosz MACROECONOMICS 5 th edn Kapitel 6 Geld, Preise und Wechselkurse Oxford University Press, 2009. All rights reserved. Einführung und Übersicht Geld und das Neutralitätsprinzip Geld Geld und
Die Gleichung für die IS-Kurve einer geschlossenen Volkswirtschaft lautet:
 1. Die IS-Kurve [8 Punkte] Die Gleichung für die IS-Kurve einer geschlossenen Volkswirtschaft lautet: 1 c(1 t) I + G i = Y + b b Das volkswirtschaftliche Gleichgewicht eines Landes liegt in Punkt A. Später
1. Die IS-Kurve [8 Punkte] Die Gleichung für die IS-Kurve einer geschlossenen Volkswirtschaft lautet: 1 c(1 t) I + G i = Y + b b Das volkswirtschaftliche Gleichgewicht eines Landes liegt in Punkt A. Später
Das Mundell-Fleming-Modell
 Christine Brandt Wintersemester 2004/2005 Abteilung Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 01 Tel. 0731 50 24266 UNIVERSITÄT CURANDO DOCENDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Christine Brandt Wintersemester 2004/2005 Abteilung Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 01 Tel. 0731 50 24266 UNIVERSITÄT CURANDO DOCENDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Abschlussklausur vom 25. Februar 2013
 1 Abschlussklausur vom 25. Februar 2013 Teil 1: 10 Multiple-Choice-Fragen (15 Punkte) 1. Das BNE entspricht dem Volkseinkommen, sofern A Die Summe aus indirekten Steuern und Subventionen 0 ist. B Die indirekten
1 Abschlussklausur vom 25. Februar 2013 Teil 1: 10 Multiple-Choice-Fragen (15 Punkte) 1. Das BNE entspricht dem Volkseinkommen, sofern A Die Summe aus indirekten Steuern und Subventionen 0 ist. B Die indirekten
Volkswirtschaftslehre für WI ler, Bachelor 60 Pkt. SS Makroökonomik- Dr. Jörg Lingens
 Volkswirtschaftslehre für WI ler, Bachelor 60 Pkt. SS 2009 -Makroökonomik- Dr. Jörg Lingens Frage 1: Grundlagen (5 Punkte) (Falsche Antworten führen zu Minuspunkten!) Ein Anstieg der marginalen Konsumquote
Volkswirtschaftslehre für WI ler, Bachelor 60 Pkt. SS 2009 -Makroökonomik- Dr. Jörg Lingens Frage 1: Grundlagen (5 Punkte) (Falsche Antworten führen zu Minuspunkten!) Ein Anstieg der marginalen Konsumquote
Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft
 Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft Einführung in die Makroökonomie SS 2012 16. Juni 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012)Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft 16. Juni 2012 1
Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft Einführung in die Makroökonomie SS 2012 16. Juni 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012)Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft 16. Juni 2012 1
1 Mundell-Fleming model and open economy (10 points)
 Online Test 2 - auf English 1 Mundell-Fleming model and open economy (10 points) 1. Mark correct statements about the balance of payments (BoP). (a) BoP is always balanced, literally speaking, because
Online Test 2 - auf English 1 Mundell-Fleming model and open economy (10 points) 1. Mark correct statements about the balance of payments (BoP). (a) BoP is always balanced, literally speaking, because
Klausur zur BSc-Vorlesung Makroökonomik des WS Termin
 U N I V E R S I T Ä T H A M B U R G INSTITUT FÜR WACHSTUM UND KONJUNKTUR Prof. Dr. Bernd Lucke Institut für Wachstum und Konjunktur Von-Melle-Park 5, D-20146 Hamburg Fernsprecher: (040) 4 28 38 20 80 /
U N I V E R S I T Ä T H A M B U R G INSTITUT FÜR WACHSTUM UND KONJUNKTUR Prof. Dr. Bernd Lucke Institut für Wachstum und Konjunktur Von-Melle-Park 5, D-20146 Hamburg Fernsprecher: (040) 4 28 38 20 80 /
Grundlagen der Monetären Außenwirtschaft
 Grundlagen der Monetären Außenwirtschaft Von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Rubel 2., überarbeitete Auflage R.Oldenbourg Verlag München Wien Inhaltsverzeichnis VII Inhaltsverzeichnis Kapitel I Die Zahlungsbilanz
Grundlagen der Monetären Außenwirtschaft Von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Rubel 2., überarbeitete Auflage R.Oldenbourg Verlag München Wien Inhaltsverzeichnis VII Inhaltsverzeichnis Kapitel I Die Zahlungsbilanz
Unter fixen Wechselkursen sinkt das Einkommen vorrübergehen und das Preisniveau reduziert sich
 Aufgabe 26 Aus dem Mundell-Flemming-Modell ist bekannt, dass 1. bei Flexiblen Wechselkursen: - Ein Anstieg des Weltmarktzinses führt zu einem Überangebot an inländischer Währung (da i< i w ) - Um dieses
Aufgabe 26 Aus dem Mundell-Flemming-Modell ist bekannt, dass 1. bei Flexiblen Wechselkursen: - Ein Anstieg des Weltmarktzinses führt zu einem Überangebot an inländischer Währung (da i< i w ) - Um dieses
JK Makroökonomik I: Nachholklausur vom
 Prof. Dr. Oliver Landmann Dr. Stefanie Flotho Freiburg, WS 204/5 JK Makroökonomik I: Nachholklausur vom 20.07.205 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (5 Punkte). Wenn
Prof. Dr. Oliver Landmann Dr. Stefanie Flotho Freiburg, WS 204/5 JK Makroökonomik I: Nachholklausur vom 20.07.205 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (5 Punkte). Wenn
Kapitel 2: Gütermarkt. Makroökonomik I - Gütermarkt
 Kapitel 2: Gütermarkt 1 Ausblick: Gütermarkt IS-Funktion (offene VW) Handelsbilanz und Produktion im Gleichgewicht Änderung von in- und ausländischer Nachfrage Wirtschaftspolitik in der offenen Volkswirtschaft
Kapitel 2: Gütermarkt 1 Ausblick: Gütermarkt IS-Funktion (offene VW) Handelsbilanz und Produktion im Gleichgewicht Änderung von in- und ausländischer Nachfrage Wirtschaftspolitik in der offenen Volkswirtschaft
Makroökonomie II - Teil 1
 Fernstudium Guide Online Vorlesung Wirtschaftswissenschaft Makroökonomie II - Teil 1 Version vom 01.08.2016 Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Fernstudium Guide 2008-2016
Fernstudium Guide Online Vorlesung Wirtschaftswissenschaft Makroökonomie II - Teil 1 Version vom 01.08.2016 Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Fernstudium Guide 2008-2016
Der Devisenmarkt WECHSELKURSE, DERIVATE. Susanna Grubits
 Der Devisenmarkt WECHSELKURSE, DERIVATE Susanna Grubits Finanzmarkt Geldmarkt Kapitalmarkt Devisenmarkt Banken- Geldmarkt Unternehmens- Geldmarkt Börse Over the Counter Termin Kassa Telefonverkehr 2 /38
Der Devisenmarkt WECHSELKURSE, DERIVATE Susanna Grubits Finanzmarkt Geldmarkt Kapitalmarkt Devisenmarkt Banken- Geldmarkt Unternehmens- Geldmarkt Börse Over the Counter Termin Kassa Telefonverkehr 2 /38
IK: Einkommen, Beschäftigung und Finanzmärkte (Wintersemester 2011/12) Das IS-LM Modell in offenen Volkswirtschaften
 IK: Einkommen, Beschäftigung und Finanzmärkte (Wintersemester 2011/12) Das IS-LM Modell in offenen Volkswirtschaften Inhalt Ziel: Erweiterung der Güter- und Finanzmarktmodelle für offene Ökonomien Offene
IK: Einkommen, Beschäftigung und Finanzmärkte (Wintersemester 2011/12) Das IS-LM Modell in offenen Volkswirtschaften Inhalt Ziel: Erweiterung der Güter- und Finanzmarktmodelle für offene Ökonomien Offene
Makroökonomie. I 5., aktualisierte und erweiterte Auf läge. Mit über 260 Abbildungen
 Olivier Blanchard Gerhard llling Makroökonomie I 5., aktualisierte und erweiterte Auf läge Mit über 260 Abbildungen ein Imprint von Pearson Education München Boston San Francisco Harlow, England Don Mills,
Olivier Blanchard Gerhard llling Makroökonomie I 5., aktualisierte und erweiterte Auf läge Mit über 260 Abbildungen ein Imprint von Pearson Education München Boston San Francisco Harlow, England Don Mills,
Inhalt. Vorwort zur dritten Auflage
 Inhalt Vorwort zur dritten Auflage V Kapitel I - Die Zahlungsbilanz 1 1. Außenwirtschaftliche Beziehungen im Wirtschaftskreislauf einer Volkswirtschaft 1 2. Die Zahlungsbilanz 4 2.1 Leistungsbilanz 5 2.2
Inhalt Vorwort zur dritten Auflage V Kapitel I - Die Zahlungsbilanz 1 1. Außenwirtschaftliche Beziehungen im Wirtschaftskreislauf einer Volkswirtschaft 1 2. Die Zahlungsbilanz 4 2.1 Leistungsbilanz 5 2.2
Abschlussklausur zur Vorlesung Makroökonomik II Sommersemester Bitte auf dem Lösungsblatt angeben!
 Freiburg, 04.08.2014 Abschlussklausur zur Vorlesung Makroökonomik II Sommersemester 2014 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (15 Punkte) 1. Nehmen Sie an, die Geldmenge
Freiburg, 04.08.2014 Abschlussklausur zur Vorlesung Makroökonomik II Sommersemester 2014 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (15 Punkte) 1. Nehmen Sie an, die Geldmenge
Makro 2 Tutorium vom Uhr. Makro 1 Klausur SS '12 Lösung: Aufgabe 2 : AD: p = m by + h (i ^w + ε^e ) AS: p = p^e + 2 ( Y Y*)
 Makro 1 Klausur SS '12 Lösung: Aufgabe 2 : AD: p = m by + h (i ^w + ε^e ) AS: p = p^e + 2 ( Y Y*) a) positive Steigung der AS-Kurve: p steigt für gegebene Preiserwartunen p^e sinkender Reallohn (w/p) fällt
Makro 1 Klausur SS '12 Lösung: Aufgabe 2 : AD: p = m by + h (i ^w + ε^e ) AS: p = p^e + 2 ( Y Y*) a) positive Steigung der AS-Kurve: p steigt für gegebene Preiserwartunen p^e sinkender Reallohn (w/p) fällt
Makroökonomik. Übung 5 - Das Mundell-Fleming-Modell. 5.1 Einführung. 5.2 Reaktionen der Leistungsbilanz. 5.3 Märkte des Mundell-Fleming-Modells
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany M.Sc. Filiz Kilic Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2017/18 Makroökonomik
Universität Ulm 89069 Ulm Germany M.Sc. Filiz Kilic Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2017/18 Makroökonomik
11. Übung Makroökonomischen Theorie
 11. Übung akroökonomischen Theorie Aufgabe 28 Es seien b = 0,35 und r = 0,1. Außerdem steht die monetäre Basis B = 1.200 zur Verfügung. Die Produktion in der Volkswirtschaft betrage Y = 4.000. Die Nachfrage
11. Übung akroökonomischen Theorie Aufgabe 28 Es seien b = 0,35 und r = 0,1. Außerdem steht die monetäre Basis B = 1.200 zur Verfügung. Die Produktion in der Volkswirtschaft betrage Y = 4.000. Die Nachfrage
Entwicklungsländer in der Weltwirtschaft I: Verfehlte Wirtschaftspolitik: Wechselkursmanagement. Ivan Pavletic, NADEL/ ETH Zürich
 Entwicklungsländer in der Weltwirtschaft I: Verfehlte Wirtschaftspolitik: Wechselkursmanagement Ivan Pavletic, NADEL/ ETH Zürich 19.3.2007 1 Einleitung Wechselkursmanagement Wechselkursregime 21. November
Entwicklungsländer in der Weltwirtschaft I: Verfehlte Wirtschaftspolitik: Wechselkursmanagement Ivan Pavletic, NADEL/ ETH Zürich 19.3.2007 1 Einleitung Wechselkursmanagement Wechselkursregime 21. November
Makroökonomie. 4., aktualisierte und erweiterte Auflage PEARSON
 . Olivier Blanchard Gerhard Kling Makroökonomie 4., aktualisierte und erweiterte Auflage PEARSON ej.n Imprini von Pearson Educatten München Boston San Francisco Har;o iy, England Don Miiis, Ontario Syonuy
. Olivier Blanchard Gerhard Kling Makroökonomie 4., aktualisierte und erweiterte Auflage PEARSON ej.n Imprini von Pearson Educatten München Boston San Francisco Har;o iy, England Don Miiis, Ontario Syonuy
Das AS-AD Modell. Einführung in die Makroökonomie SS Mai 2012
 Das AS-AD Modell Einführung in die Makroökonomie SS 2012 18. Mai 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Das AS-AD Modell 18. Mai 2012 1 / 38 Was bisher geschah Mit Hilfe des IS-LM Modells war es
Das AS-AD Modell Einführung in die Makroökonomie SS 2012 18. Mai 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Das AS-AD Modell 18. Mai 2012 1 / 38 Was bisher geschah Mit Hilfe des IS-LM Modells war es
Internationale Beziehungen
 Internationale Beziehungen 1 Disclaimer Die im Folgenden zusammengestellten Informationen sind begleitend zum Unterricht des "geprüften Wirtschaftsfachwirt IHK" für das Unterrichtsfach Volkswirtschaftslehre
Internationale Beziehungen 1 Disclaimer Die im Folgenden zusammengestellten Informationen sind begleitend zum Unterricht des "geprüften Wirtschaftsfachwirt IHK" für das Unterrichtsfach Volkswirtschaftslehre
JK Makroökonomik I: Nachholklausur vom
 Prof. Dr. Oliver Landmann Dr. Stefanie Flotho Freiburg, WS 205/6 JK Makroökonomik I: Nachholklausur vom 20.06.206 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (0 Fragen, 5 Punkte)
Prof. Dr. Oliver Landmann Dr. Stefanie Flotho Freiburg, WS 205/6 JK Makroökonomik I: Nachholklausur vom 20.06.206 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (0 Fragen, 5 Punkte)
7. Geld und die Nachfrage nach Geld. 8. Geldangebot und Geldpolitik. Übung zur Makroökonomik BA im. Teil 3: Monetäre Aspekte
 Übung zur BA im Wintersemester 2010/11 Teil 3: onetäre Aspekte 7. Geld und die Nachfrage nach Geld 8. Geldangebot und Geldpolitik 1) Nennen Sie die Funktionen des Geldes. 1. Geld als Tauschmittel Vermeidung
Übung zur BA im Wintersemester 2010/11 Teil 3: onetäre Aspekte 7. Geld und die Nachfrage nach Geld 8. Geldangebot und Geldpolitik 1) Nennen Sie die Funktionen des Geldes. 1. Geld als Tauschmittel Vermeidung
Probeklausur 1: Währungstheorie WS 2008/09. Probeklausur 1 zur Vorlesung: Währungstheorie im Wintersemester 2008/09
 Probeklausur 1 zur Vorlesung: Währungstheorie im Wintersemester 2008/09 Dozent: Bearbeitungszeit: Maximale Punktzahl: 120 Minuten 120 Punkte Zugelassene Hilfsmittel: nicht programmierbarer Taschenrechner
Probeklausur 1 zur Vorlesung: Währungstheorie im Wintersemester 2008/09 Dozent: Bearbeitungszeit: Maximale Punktzahl: 120 Minuten 120 Punkte Zugelassene Hilfsmittel: nicht programmierbarer Taschenrechner
Geschlossene Volkswirtschaft: Ersparnis: S = I = 75 da geschlossene VW. b) Private und staatliche Ersparnis: c) Erhöhung der Staatsausgaben:
 Aufgabe 1: Geschlossene Volkswirtschaft: a) Y = C + I + G Y = Y T 10 r + 200 10r + G 1.200 = 1.200 100 10r + 200 10r + 150 20 r = 250 r = 12,5 I = 200 = Investitionen: 10 *12,5 75 Ersparnis: = I = 75 da
Aufgabe 1: Geschlossene Volkswirtschaft: a) Y = C + I + G Y = Y T 10 r + 200 10r + G 1.200 = 1.200 100 10r + 200 10r + 150 20 r = 250 r = 12,5 I = 200 = Investitionen: 10 *12,5 75 Ersparnis: = I = 75 da
ME II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser. Kapitel 11 Geldpolitische Transmission: das IS-MP-PC-Modell
 ME II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser Kapitel 11 Geldpolitische Transmission: das IS-MP-PC-Modell Version: 01.06.2011 Probleme des IS-LM-Modells Ziel der EZB: Preisniveaustabilität (in der Formulierung eines
ME II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser Kapitel 11 Geldpolitische Transmission: das IS-MP-PC-Modell Version: 01.06.2011 Probleme des IS-LM-Modells Ziel der EZB: Preisniveaustabilität (in der Formulierung eines
Ursachen von Inflation
 Ursachen von Inflation Makroökonomik 26.6.26 Vorjahresveränderung des LIK als Mass der Inflation (199-26) Vorjahresveränderung in % 6 5 4 3 2 1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 Quelle: BfS 2 Welche
Ursachen von Inflation Makroökonomik 26.6.26 Vorjahresveränderung des LIK als Mass der Inflation (199-26) Vorjahresveränderung in % 6 5 4 3 2 1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 Quelle: BfS 2 Welche
