Aus der Neurologischen Klinik des St. Josef Hospital Bochum Universitätsklinik der Ruhr Universität Bochum Direktor: Prof. Dr. med.
|
|
|
- Paulina Lehmann
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Aus der Neurologischen Klinik des St. Josef Hospital Bochum Universitätsklinik der Ruhr Universität Bochum Direktor: Prof. Dr. med. Ralf Gold Vorkommen und Wertigkeit von Oberfrequenzen in der 24-Stunden-Elektromyographie und Accelerometrie bei Parkinson und Essentiellem Tremor Inaugural Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Medizin einer Hohen Medizinischen Fakultät der Ruhr Universität Bochum vorgelegt von Gisa Ellrichmann aus Hagen 2007
2 Dekan: Referent: Korreferent: Prof. Dr. med. G. Muhr PD Dr. med. P. H. Kraus PD Dr. med. C. G. Haase Tag der Mündlichen Prüfung: 24. Januar 2008
3 Meiner Mutter in Dankbarkeit gewidmet
4 Inhaltsverzeichnis I Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung Geschichtlicher Überblick Epidemiologie Pathophysiologie Klassifikation Klinik des Morbus Parkinson Apparative Diagnostik Tremorformen Definition Tremor Entwicklung von Tremor-Messinstrumenten Klassifikation Tremor Parkinson Tremor Pathophysiologie des Parkinson-Tremors Essentieller Tremor Pathophysiologie des Essentiellen Tremors Differentialdiagnose Parkinson Tremor / Essentieller Tremor Tremordiagnostik Fragestellung und Ziel der Studie Methodik Patienten Einschlusskriterien Ausschlusskriterien Diagnosekriterien Essentieller Tremor Diagnosekriterien Morbus Parkinson Probanden Screening...32
5 Inhaltsverzeichnis II Short Parkinson s Evaluation Scale (SPES) Hoehn und Yahr Messtechnik und Datenaufbereitung, TREMORanalyser Umgebungsbedingungen Technische Daten Messdatenaufbereitung EMG Reliabilität Sensitivität, Spezifität Validität Accelerometrie (ACC) Datensichtung Statistische Analyse ERGEBNISSE Deskriptive Statistik Subgruppen Schweregrad der Erkrankung Phasenverteilung Frequenzen Analytische Statistik Oberfrequenzen Accelerometrie Oberfrequenzen EMG Co-Existenz von Oberfrequenzen in Accelerometrie und EMG Typisierung der Gruppe PT DISKUSSION Oberfrequenzen Physikalische Grundlagen Entstehung von Oberfrequenzen...66
6 Inhaltsverzeichnis III Tremor-Oberfrequenzen in EMG und Accelerometrie Oberfrequenzen als Hinweis von Oszillatoren Frequenzen Parkinson Tremor / Essentieller Tremor Phasenverteilung Parkinson Tremor / Essentieller Tremor Sonderfälle Zusammenfassung Literaturverzeichnis Anhang TREMORanalyser -Gerätekritik Anamnesebogen Tremoranalyser Zeitplaner Tremor-Report Danksagung 9 Lebenslauf
7 Inhaltsverzeichnis IV Verzeichnis der Abkürzungen ACC Accelerometrie bit binary digit bzw. beziehungsweise ca. circa CBG kortikobasale Degeneration CIT carbomethoxy-iodophenyl-tropane cm Zentimeter DLB Demenz vom Lewy-Körper-Typ EEG Elektroencephalogramm EMG Elektromyogramm ET Essentieller Tremor et al. et alii GABA Gammaaminobuttersäure (-acid) h hour = Stunde hpascal Hektopascal HIV human immunodeficiency virus Hz Hertz IBZM Iodbenzamid lat. lateinisch m. maskulin m metre mbar Millibar, gr. báros = Schwere, Gewicht MPTP 1-Methyl-4-Phenyl-1,2,3,6-Tetrahydopyridin MSA Multisystematrophie Ncl. nucleus PC personal computer PET Positronen-Emissions-Tomographie PSP progressive supranukleäre Blickparese PT Parkinson Tremor
8 Inhaltsverzeichnis V s Sekunde SNR signal-to-noise-ratio SPECT Single-Photonen-Emissions-Computertomographie SPES Short Parkinson Rating Scale UPDRS Unified Parkinson s Disease Rating Scale V Volt v.a. vor allem v. Chr. vor Christus z.b. zum Beispiel
9 Inhaltsverzeichnis VI Verzeichnis der Tabellen Tabelle 1.1: Differentialdiagnose Parkinson Tremor / Essentieller Tremor..24 Tabelle 2.1: Diagnosekriterien Essentieller Tremor und Typisierung...30 Tabelle 2.2: Diagnosekriterien Parkinson Tremor und Typisierung...31 Tabelle 2.3: Input Signal...38 Tabelle 3.1: Verteilung des Summenscores aus der Short Parkinson s Evaluation Scale...47 Tabelle 3.2: Einteilung der Patientengruppen in Hoehn & Yahr...48 Tabelle 3.3: t-test Frequenzen Parkinson und Essentieller Tremor in der Accelerometrie...51 Tabelle 3.4: Mittelwert der Frequenzen bei Parkinson- und Essentiellem Tremor im EMG...53 Tabelle 3.5: Anzahl der Oberfrequenzen in der Accelerometrie bei Parkinsonund Essentiellem Tremor unter Halte- und Ruhe-Bedingungen...54 Tabelle 3.6: Kreuztabelle Oberfrequenzen ACC Haltung links vertikal vs. Oberfrequenzen EMG linker Extensor...61 Tabelle 3.7: Chi-Quadrat-Test nach Pearson und Spearman Korrelation / Oberfrequenzen in EMG und Accelerometrie...62 Tabelle 3.8: Kruskal-Wallis-Test und Chi-Quadrat-Test am Beispiel der Oberfrequenzen in der Accelerometrie links vertikal in Haltung und Ruhe in Abhängigkeit vom Parkinson-Typ I-III links...64 Tabelle 3.9: Kruskal-Wallis-Test und Chi-Quadrat-Test am Beispiel der Oberfrequenzen in der Accelerometrie rechts vertikal in Haltung und Ruhe in Abhängigkeit vom Parkinson-Typ I-III rechts...64
10 Inhaltsverzeichnis VII Verzeichnis der Abbildungen Abbildung 1.1: Geschichtlicher Überblick... 2 Abbildung 1.2: Lokalisation der Substanzminderung beim Morbus Parkinson... 4 Abbildung 1.3: Basalganglienverschaltung... 5 Abbildung 1.4: Verlust der Dopaminproduktion in Abhängigkeit vom Krankheitsbeginn beim Morbus Parkinson... 6 Abbildung 1.5: Lewy-Körperchen... 6 Abbildung 1.6: Kardinalsymptome Morbus Parkinson... 8 Abbildung 1.7: Abbildung 1.8: Abbildung 1.9: 123 I-beta-CIT-SPECT bei Morbus Parkinson...11 Tremor manus...12 Edward Sphygmograph mit Negativen von sphygmographischen Aufzeichnungen von Tremor in 10-Sekunden-Intervallen...13 Abbildung 1.10: Übersicht Tremorformen...14 Abbildung 1.11: häufigste Tremorformen: Frequenzspektrum und klinisches Erscheinungsbild...16 Abbildung 1.12: Synopsis corticaler und subcortikaler Verschaltungen zur Pathophysiologie des Tremors...20 Abbildung 1.13: schematische Darstellung möglicher pathophysiologischer Mechanismen in der Entstehung des Essentiellen Tremors...22 Abbildung 2.1: Oberflächenelektroden TREMORanalyser...34 Abbildung 2.2: Muskeln zur Ableitung des 24-h-EMG TREMORanalysers...34 Abbildung 2.3: Abbildung 2.4: Abbildung 2.5: Abbildung 2.6: Zubehör zur Befestigung der Oberflächenelektroden TREMORanalyser...35 Anlage des TREMORanalysers am Patienten...36 signal-to-noise ratio...39 Beschleunigungsaufnehmer...41
11 Inhaltsverzeichnis VIII Abbildung 3.1: Krankheitsbeginn Morbus Parkinson / Essentieller Tremor...44 Abbildung 3.2: Verteilungsmuster der Parkinson-Subtypen in Gruppe PT...45 Abbildung 3.3: Abbildung 3.4: Abbildung 3.5: Einteilung der Diagnosewahrscheinlichkeit bei Parkinson Tremor und Essentiellem Tremor...45 Klinische Seitenbetonung des Tremors...46 Phasenverteilung, Beispiel gleichphasig...48 Abbildung 3.6: Phasenverteilung EMG Parkinson und Essentieller Tremor...49 Abbildung 3.7: Abbildung 3.8: Abbildung 3.9: Frequenzverteilung in der Accelerometrie bei Haltung und in Ruhe bei Parkinson und Essentiellem Tremor...50 Mittlere Frequenzen im EMG bei Parkinson und Essentiellem Tremor...52 Oberfrequenzen in der Accelerometrie bei vertikaler Auslenkung (Parkinson Tremor)...55 Abbildung 3.10: Oberfrequenzen in der Accelerometrie bei vertikaler Auslenkung (Essentieller Tremor)...56 Abbildung 3.11: Oberfrequenzen in der Elektromyographie (Parkinson Tremor)...58 Abbildung 3.12: Oberfrequenzen in der Elektromyographie (Essentieller Tremor)...59 Abbildung 3.13: Einteilung der Parkinson-Gruppe in die Subtypen I-III rechts und links...63 Abbildung 4.1: Überlagerung zweier Schwingungen...65 Abbildung 4.2: Schematische Darstellung der Eigenschwingung einer Saite...66 Abbildung 4.3: Intervalle am Beispiel von Noten...67 Abbildung 4.4: Accelerometrie Parkinson Tremor...68 Abbildung 4.5: Accelerometrie Essentieller Tremor...68 Abbildung 4.6: Zeitreihen für Beschleunigung, Geschwindigkeit und Ort...69 Abbildung 4.7: Oberfrequenzen mit Zwischenaktivität im 24-Stunden-Oberflächen-EMG...70 Abbildung 4.8: Oberfrequenzen im EMG / WJ / 17:50,06 h / rechter Flexor...71
12 Inhaltsverzeichnis Abbildung 4.9: Oberfrequenzen im EMG / LK / 08:41,46 h / linker Extensor...72 IX Abbildung 4.10: Oberfrequenzen EMG / WG / 16:02,17 h / rechter Extensor...73 Abbildung 4.11: Arm-Kraft-Modell...75 Abbildung 4.12: EMG-Ausschnitt einer 24-Stunden-Messung mit einem deutlichen Frequenzpeak unter 3,70 Hz im rechten Extensor...79 Abbildung 4.13: Punktdiagramm und Histogramm der Tremor-Frequenz im 24- Stunden-EMG-Report eines Parkinson-Patienten...80 Abbildung 4.14: Histogramm mit Überlagerung einer Normalverteilungskurve...80 Abbildung 4.15: Phasenverteilung in Abhängigkeit von der Muskelkontraktion...81 Abbildung 4.16: Vorkommen von 2 Frequenzspektren während einer 24-h-EMG- Aufzeichnung...83 Abbildung 7.1: Abbildung 7.2: Abbildung 7.3: Abbildung 7.4: Brumm-Artefakt während einer 24-h-EMG-Messung...98 Brumm-Artefakt im EMG mit Tremor-Erkennung...99 EKG-Artefakt im EMG Sekunden Zeitfenster während einer 24-h-EMG-Messung mit Doppelpeaks...101
13 Inhaltsverzeichnis X Verzeichnis der Formeln Formel 4.1: Formel 4.2: Gewichtskraft...75 Frequenz...76
14 Einleitung 1 1 Einleitung Tremor stellt ein Symptom verschiedener Erkrankungen dar, wobei die häufigsten Tremorformen der Tremor bei der Parkinson-Krankheit und der Essentielle Tremor sind. Um Unterschiede beider Formen zu verstehen und das Ziel der Messungen darzustellen, erfolgt zunächst ein kurzer Überblick der beiden Krankheitsbilder. 1.1 Geschichtlicher Überblick Bereits v. Chr. wurde in alten ayurvedischen Schriften erstmals ein Symptomkomplex, bestehend aus Zittern der Hände und körperlicher Steifheit beschrieben. Erasistratos sprach im 3. Jahrhundert v. Chr. von einer paradoxen Form der Lähmung, bei der die Kranken plötzlich zum Stehen kommen, nicht weitergehen können und es dann doch wieder können (Eckart, 2001). Nach Symptombeschreibungen bei Patienten mit Ruhezittern -Galen von Pergamon, 2. Jahrhundert v. Chr.- und einer Unterscheidung zwischen Ruhe- und Intentionstremor -Sylvius de la Boe, 17. Jahrhundert- (Schneider, 1997) war es jedoch James Parkinson, der 1817 in seinem Essay on the Shaking Palsy (Parkinson, 1817) die erste klinische Beschreibung des Parkinson-Syndroms veröffentlichte, das 1841 von Hall als Paralysis agitans deklariert wurde (Eckart, 2001). Tertiakoff entdeckte im Jahre 1919 die Degeneration der Substantia nigra als morphologisches Substrat des Morbus Parkinson. Im Laufe des 20. Jahrhunderts gelang es einer Vielzahl von Forschern, die medikamentöse Therapie des Morbus Parkinson weiterzuentwickeln. Sigwald setzte 1946 synthetische Anticholinergika als Behandlungsmethode ein, Schwab entdeckte 1962 das Amantadin und Birkmayer und Barbeau setzten 1961 erfolgreich L- Dopa ein, nachdem Ehringer / Hornykiewicz ein Jahr zuvor den Dopamin-
15 Einleitung 2 Mangel als biochemisches Substrat des Morbus Parkinson festgelegt hatten (nach Kuhn and Müller, 1998). Besonders während der vergangenen 20 Jahre wurde die Therapie des Morbus Parkinson neu und weiter entwickelt v. Chr Abbildung 1.1: Geschichtlicher Überblick
16 Einleitung Epidemiologie Das Hauptmanifestationsalter des Morbus Parkinson liegt in der zweiten Lebenshälfte bei durchschnittlich Jahren. Die Inzidenzrate in Europa beträgt 16 / Neuerkrankungen pro Jahr (Bower et al., 2000). Prävalenzen variieren in Abhängigkeit der untersuchten Population und der zugrundeliegenden Diagnosekriterien zwischen / (Europa) (Zhang and Roman, 1993). Eine Tür-zu-Tür Erhebung in Schleswig-Holstein ergab eine Zahl von 183 / Einwohner, so dass sich für Deutschland bei einer zugrundeliegenden Bevölkerungszahl von 80 Millionen Einwohnern eine Prävalenzrate von Parkinson-Erkrankten ergibt (Vieregge et al., 1990). Im Rahmen weltweiter Studien finden sich in Asien, besonders in China, die geringste, in Sizilien die höchste Zahl von Erkrankungsfällen. Weiterhin weisen einige Daten darauf hin, dass parkinson-typische Veränderungen in der schwarzen Bevölkerung seltener vorkommen, jedoch sind eindeutige Beweise aufgrund untereinander stark abweichender Untersuchungsmethoden nicht möglich (Rajput, 1984). 1.3 Pathophysiologie Grundlage des idiopathischen Morbus Parkinson bildet eine extrapyramidalmotorische Systematrophie. Pathophysiologisch existiert eine Degeneration der Substantia nigra, die zum Untergang melaninhaltiger dopaminerger, präsynaptisch lokalisierter Neuronen in der Pars compacta führt. Diese schon makroskopisch erkennbare Depigmentierung und Substanzminderung betrifft vor allem die ventrolateralen Anteile der Substantia nigra, Veränderungen manifestieren sich aber auch im Bereich des Locus coeruleus, des dorsalen Vaguskern und des Ncl. basalis Meynert.
17 Einleitung 4 a b Abbildung 1.2: a) Lokalisation der Substanzminderung beim Morbus Parkinson ( b) Makroskopischer Befund mit depigmentierter Substantia nigra (Gibb et al.,1991) Der Dopamin-Mangel ist somit als grundlegende Störung des Parkinson- Syndroms anzusehen und führt mit seiner an den Neuronen sowohl exzitatorischen als auch inhibitorischen Transmitterwirkung zu den Symptomen der Erkrankung. Aktivierungs- und Hemmmechanismen innerhalb der Basalganglienverschaltung (Abbildung 1.3) geraten aus dem Gleichgewicht.
18 Einleitung 5 Abbildung 1.3: Basalganglienverschaltung DA: Dopamin GABA: Gamma-Aminobuttersäure Glu: Glutamat VA/VL: Nucleus ventralis anterolateralis des Thalamus + / - : Angabe, ob Projektionen hemmend oder erregend sind (rot = hemmend / schwarz = erregend) (Trepel, 1999) Entscheidend ist, dass sich klinische Symptome erst ab einem Verlust von über 90 % des striatalen Dopamin-Gehaltes und nach dem Untergang von ca. 60 % neuronalen Gewebes in der Substantia nigra manifestieren (Abbildung 1.4).
19 Einleitung 6 Verlust der Dopamin- Produktion in Prozent 100 Ausbruch der Krankheit 60 Zeit Abbildung 1.4: Verlust der Dopaminproduktion in Abhängigkeit vom Krankheitsbeginn beim Morbus Parkinson Einen zweiten charakteristischen neuropathologischen Befund stellen die Lewy- Körperchen dar, bei denen es sich um eosinophile endozytoplasmatische Einschlusskörperchen handelt, die ein homogen verdichtetes Kernareal besitzen. Sie enthalten vor allem Ubiquitin, das in seiner Funktion als Protein neurogenen Stress widerspiegelt. In erster Linie treten die Lewy-Körperchen bei Parkinson- Patienten in der Substantia nigra auf, finden sich aber zusätzlich in vielen anderen Hirnbereichen, z.b. Cortex, Locus coeruleus, Ncl. basalis Meynert, dorsale Raphekerne, Hypothalamus, entorhinale Rinde. Da sie auch bei ca. 10 % der gesunden Menschen > 60 Jahre nachweisbar sind, bildet ihr Auftreten ein nicht spezifisches Diagnosekriterium (Gibb et al., 1991). Abbildung 1.5: Lewy-Körperchen (aus Gibb et al., 1990)
20 Einleitung Klassifikation Da es sich beim Morbus Parkinson um einen großen Komplex multipler Ätiologien und klinischer Erscheinungsformen handelt, erweist sich eine Einteilung in 3 Hauptgruppen als zweckmäßig (Oertel et al., 2005, Grehl et al., 2002): 1. das Idiopathische Parkinson-Syndrom (IPS) = Parkinson-Krankheit, das ca. 75 % aller Arten umfasst, wird hinsichtlich der klinischen Symptome in 4 Subgruppen gegliedert: Tremor-Dominanz-Typ Rigor-Akinese-Typ Äquivalenz-Typ monosymptomatischer Ruhe-Tremor (seltene Variante) 2. Symptomatische (sekundäre) Parkinson-Syndrome vaskuläres Parkinson-Syndrom medikamenteninduziertes Parkinson-Syndrom ( Parkinsonoid ) toxisches Parkinson-Syndrom postenzephalitische Parkinson-Syndrome posttraumatisches Parkinson-Syndrom metabolisch (z.b. Morbus Wilson, Hypoparathyreoidismus) Morbus Fahr tumorbedingt entzündlich (HIV-Enzephalopathie)
21 Einleitung 8 3. Atypische Parkinson-Syndrome Multisystematrophie (MSA) vom Parkinson-Typ (MSA-P) vom zerebellären Typ (MSA-C) progressive supranukleäre Blickparese (PSP) kortikobasale Degeneration (CBG) spinozerebelläre Atrophien (einige Subtypen) Demenz vom Lewy-Körper-Typ (DLB) Morbus Alzheimer Hallervorden-Spatz-Erkrankung juvenile (Westphal-) Variante der Chorea Huntington 1.5 Klinik des Morbus Parkinson Die Kardinalsymptome des Morbus Parkinson werden gebildet aus Rigor Tremor Akinese Abbildung 1.6: Kardinalsymptome Morbus Parkinson (Duale Reihe, 1998)
22 Einleitung 9 Hinzu kommen eine Vielzahl nicht-motorischer Veränderungen, die sich mit Fortschreiten der Krankheit, aber auch als Frühzeichen entwickeln können. Akinese als Minus-Symptomatik, primär verursacht durch Dopamin-Mangel, führt zu von Parkinson-Patienten häufig beklagten Einschränkungen wie Starthemmung, Freezing, Hypomimie oder Mikrographie. Die Körperhaltung erscheint gebunden und antevertiert, das Gangbild ist kleinschrittig mit reduzierter Armmitbewegung, Stellreflexe sind gestört (= posturale Instabilität). Bei passiver Gelenkbewegung fällt neben der wächsernen Tonuserhöhung (= Rigor) häufig eine rhythmische Unterbrechung des Dehnungswiderstandes (= Zahnrad-Phänomen) auf. Plus-Symptome äußern sich in erster Linie als Tremor, der initial oft als Tremor manus in Ruhe sichtbar wird. Die Diagnose Ruhetremor sollte nur gestellt werden, wenn das Zittern unter mentaler Belastung (zum Beispiel Kopfrechnen) progredient und die Amplitude während Willkürbewegungen regredient ist (Deuschl et al., 1998). Zum vegetativen Symptomkomplex zählen orthostatische Hypotonie, Seborrhoe, gastrointestinale Dysfunktionen (Gastroparese, Obstipation), Miktionsstörungen, sexuelle Funktionsstörungen mit erektiler Dysfunktion und Thermoregulationsstörungen. Sensorische Symptome umfassen Beeinträchtigungen des Geruchs- und Geschmackssinns, Schmerzen und Kontrast- / Farb-Wahrnehmungsstörungen. Unter den psychischen Funktionsstörungen sind insbesondere Depressionen, Halluzinationen und Schlafstörungen zu nennen. In der Literatur wird die Häufigkeit depressiver Symptome bei Parkinson mit ca % angegeben (Cummings, 1992, Gotham et al., 1986), wobei ein biphasischer Häufigkeitsgipfel zunächst in sehr frühen, dann in fortgeschrittenen Krankheitsstadien vorliegt.
23 Einleitung Apparative Diagnostik In erster Linie handelt es sich beim Morbus Parkinson um eine klinische Diagnose, gestützt auf Anamnese, neurologische Untersuchung und Beobachtung der Erkrankten. Trotzdem kann durch eine Vielzahl apparativer Hilfsmittel der Verdacht bestätigt und der Verlauf der Erkrankung kontrolliert werden. Die cerebrale Bildgebung stützt sich auf magnetresonanztomographische Untersuchungen. Die Entwicklung moderner funktioneller Imagetechniken wie der F-Dopa-Positronen-Emissions-Tomographie (PET) und des Dopamintransporter-Imagings führen zu immer höherer diagnostischer Treffsicherheit. Hinzu kommt eine erweiterte Diagnostik, die eine quantitative neurophysiologische Statuserhebung, ein Elektroencephalogramm, Doppler-/ Duplexsonographie cerebraler Arterien und die kardiale Diagnostik umfasst. Neuere Verfahren, wie die Messung der Hyperechogenität der Basalganglien, bieten weitere Möglichkeiten einer differentialdiagnostischen Abgrenzung bereits in frühen Stadien der Erkrankung. Staging-Einteilungen, die nach lang erprobten Skalen (Hoehn & Yahr, Unified Parkinson s Disease Rating Scale - UPDRS, Short Parkinson Rating Scale - SPES) erfolgen, dienen insbesondere der Verlaufskontrolle. Anhand eines L-Dopa- oder Apomorphin-Tests wird das Ansprechen auf Dopamin beurteilt. Ein positives Ergebnis liegt vor, wenn eine klinische Besserung eintritt, die mindestens 20 % in der UPDRS-Skala beträgt. Im Rahmen der Frühdiagnostik erweisen sich funktionelle bildgebende Verfahren wie das 123 I-beta-CIT-SPECT oder 123 I-IBZM-SPECT als hilfreich. In vivo lassen sich durch die Trägersubstanz Iodbenzamid (=IBZM) D 2 -Rezeptoren im Striatum markieren und im Folgenden durch eine Single-Photonen- Emissions-Computertomographie (=SPECT) darstellen (Brücke et al., 1991). Da bei Parkinson-Patienten die Anzahl der Bindungskapazität postsynaptischer D 2 - Rezeptoren im Wesentlichen unverändert bleibt, stellt sich die beschriebene
24 Einleitung 11 Bildgebung besonders im Bereich möglicher Differentialdiagnosen als nützlich dar. Abbildung 1.7: A B C 123 I-beta-CIT-SPECT bei Morbus Parkinson A Normalbefund B Hemiparkinson C Morbus Parkinson (Brücke et al., 1993) Nach den Kriterien der UK-Brain-Bank müssen folgende Punkte vorliegen, um mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Parkinson-Syndrom zu diagnostizieren (modifiziert durch Oertel et al., 2005): 1. Bradykinese 2. Vorliegen von mindestens einem der folgenden Symptome: Rigor Ruhe-Tremor Störung der Halte- und Stellreflexe Eine Parkinson-Krankheit liegt vor, wenn zusätzlich mehr als drei der folgenden Kriterien erfüllt werden: asymmetrischer Beginn der Symptomatik progredienter Verlauf gutes Ansprechen auf L-Dopa oder Apomorphin-Test positive L-Dopa-Wirkung länger als 5 Jahre klinischer Verlauf länger als 10 Jahre L-Dopa-induzierte Chorea Eine sichere Diagnose ist zur Zeit jedoch ausschließlich post mortem möglich.
25 Einleitung Tremorformen Definition Tremor Unter Tremor (lat. tremor, -oris, m. = das Zittern, Beben) versteht man nach der einfachen Definition eine rhythmische Hin- und Herbewegung eines Körperteils. Ähnlich beschrieb bereits Galen im 2. Jahrhundert Tremor als eine Veränderung, die durch eine Auf- und Ab-Bewegung charakterisiert ist (Sider and McVaugh, 1979). Tremor ist das häufigste neurologische Symptom und kommt bei ganz verschiedenen neurologischen Erkrankungen vor. Die beiden häufigsten Formen sind der Parkinson Tremor und der Essentielle Tremor. Abbildung 1.8: Tremor manus Entwicklung von Tremor-Messinstrumenten Im Laufe des späten 19. Jahrhunderts entwickelten Neurologen eine Vielzahl verschiedener Möglichkeiten, Tremor aufzuzeichnen. Zunächst beruhten die Messungen auf reiner Beobachtung. Erst später wurden Instrumente zu Hilfe genommen. Über eine Trommel wurden beispielsweise Luftbewegungen genutzt, um Bewegungen auf ein Messinstrument zu übertragen. Es folgten Versuche mit Sphygmographen (Abbildung 1.9), die unabhängig von Luftströmungen waren. Später konnte Tremor über graphische Messinstrumente visualisiert werden, so dass Unterschiede verschiedener Tremorformen bezüglich Frequenz und Amplitude nachgewiesen werden konnten (Douglas et al., 2001).
26 Einleitung 13 Abbildung 1.9: Edward Sphygmograph mit Negativen von sphygmographischen Aufzeichnungen von Tremor in 10-Sekunden-Intervallen (Lanska et al., 2001)
27 Einleitung Klassifikation Tremor Eine Einteilung des Tremors kann erfolgen nach (Deuschl and Bain, 2002) a) der klinischen Erscheinungsform oder b) der Ätiologie. Hierbei sind folgende Kriterien zu berücksichtigen Aktivierungsbedingungen (Ruhe, Aktion, Haltung, Zielbewegungen) Frequenz Dauer der Erkrankung Erblichkeit Topographie (Kopf, untere / obere Extremität, Rumpf) Auftreten sonstiger Symptome (Rigor, Bradykinese / Akinese, posturale Störung, Zeichen einer Dystonie, cerebelläre Zeichen, Pyramidenbahnzeichen, Polyneuropathie) Übersicht über die verschiedenen Tremorformen Ruhe-Tremor Aktions-Tremor Halte- Tremor kinetischer- Tremor isometrischer- Tremor Positions- Spezifischer- Tremor einfacher kinetischer Tremor Intentions- Tremor Abbildung 1.10: Übersicht Tremorformen
28 Einleitung 15 Bezogen auf das klinische Erscheinungsbild sind zwei Hauptgruppen des Tremors voneinander abzugrenzen (Deuschl et al., 1998). Der Ruhe-Tremor tritt definitionsgemäß an Gliedmaßen auf, die weder willkürlich innerviert noch aktiviert werden. Im Gegensatz dazu bezeichnet man ein Zittern, welches bei willkürlichen Muskelkontraktionen auftritt, als Aktions-Tremor. Die posturale Form des Aktions-Tremors ( = Halte-Tremor) umschreibt sämtliche Situationen, in denen das Zittern nach willkürlicher Einnahme einer bestimmten Körperposition entgegen der Schwerkraft auftritt. Werden rhythmische Bewegungen bei Willkürbewegungen beobachtet, so spricht man von kinetischem Tremor, wenn es sich hierbei um zielgerichtete Bewegungen handelt, von Intentions-Tremor. Entsteht Tremor nur bei Muskelkontraktionen, die keine sichtbare Bewegung nach sich ziehen (zum Beispiel beim Faustschluss, statischer Druck gegen eine Wand), bezeichnet man dies als isometrischen Tremor. Die zweite Möglichkeit der Klassifikation stellt eine Kombination aus ätiologischen und klinischen Kriterien dar, in deren Folge die nachstehenden Subtypen differenziert werden können: Parkinson Tremor (PT) Essentieller Tremor (ET) Physiologischer Tremor Verstärkter physiologischer Tremor Primär orthostatischer Tremor Aufgabenspezifischer Tremor Dystoner Tremor Medikamenteninduzierter Tremor Psychogener Tremor Flapping- Tremor Holmes- Tremor Neuropathischer Tremor Kleinhirn- / Intentions- Tremor Palataler Tremor
29 Einleitung 16 Diagnose Frequenz Aktivität cerebellärer Tremor dystoner Tremor Essentieller Tremor ET Gaumensegeltremor Holmes-Tremor medikamenten-induzierter Tremor Tremor bei Neuropathie Parkinson Tremor PT verstärkter physiologischer Tremor psychogener Tremor [Hz] Ruhe Haltung Ziel Spektrum (häufige Frequenz) Vorkommen entscheidend zur Diagnose mögliches Auftreten Abbildung 1.11: häufigste Tremorformen: Frequenzspektrum und klinisches Erscheinungsbild (Deuschl and Bain, 2002) 1.8 Parkinson Tremor Damit die Deklaration eines Tremors der Parkinson Form gerechtfertigt ist, muss definitionsgemäß eine Parkinson-Krankheit nach den oben angegebenen Kriterien der UK Brain Bank vorliegen. Sind diese Grundvoraussetzungen erfüllt,
30 Einleitung 17 lassen sich drei Subtypen des Parkinson Tremors voneinander abgrenzen (Deuschl et al., 1998): Typ 1: Ruhe-Tremor oder Ruhe-Tremor + posturaler / kinetischer Tremor ± 1,5 Hz Beide Tremores dürfen sich in ihren Frequenzen um maximal 1,5 Hz unterscheiden, wobei der mittlere Wert etwa 4 Hz beträgt. Im Übergang von der Ruhe- zur Halteposition sistiert das Zittern typischerweise für einen kurzen Moment, die eigentliche Bewegungsphase funktioniert dennoch störungsfrei. Diese Subgruppe zeichnet den klassischen Parkinson Tremor aus. Die Prävalenz eines kombinierten Auftretens von Ruhe- und Aktions- Tremor beträgt 92 % (Louis et al., 2001). Typ 2: Ruhe-Tremor + posturaler / kinetischer Tremor > 1,5 Hz Mit < 10 % macht diese Form einen relativ geringen Anteil aus. Der Aktions-Tremor schwingt um mehr als 1,5 Hz schneller und im Vergleich zum Ruhe-Tremor nicht harmonisch, zeichnet sich aber durch eine oft geringere Amplitude aus. Typ 3: Isolierter posturaler / kinetischer Tremor Eine differentialdiagnostische Abgrenzung zu anderen Tremorformen ist, abgesehen von den Begleiterscheinungen, schwierig, da zusätzlich durch unspezifische Frequenzspektren (4-9 Hz) richtungsweisende Faktoren fehlen.
31 Einleitung Pathophysiologie des Parkinson-Tremors Grundsätzlich sind vier Basis-Mechanismen im Rahmen der Entstehung von Tremor denkbar (Elble, 2000): Zentrale Oszillatoren (Deuschl et al., 1995) Mechanische Oszillatoren (Deuschl et al., 1995) Reflex-Oszillatoren (Deuschl et al., 1995) Abnormale Funktionen im Cerebellum (Wills et al., 1994) Vergleiche zwischen Patienten vom Akinese-Rigor-Dominanz-Typ mit denen vom Tremor-Dominanz-Typ ergeben deutliche Unterschiede der von Zell- Degeneration betroffenen zentralen Gebiete (Deuschl et al., 2000). Ein Abbau dopaminerger Zellen dominiert beim Tremor-Dominanz-Typ im medialen Anteil der Substantia nigra. Die akinetisch-rigide Form befällt hingegen eher den lateralen Bereich sowie den Locus coeruleus (Brooks et al., 1992, Remy et al., 1995). Die Vermutung liegt nahe, die pathophysiologische Ursache eines Ruhe- Tremors als Folge des nigrostriatalen dopaminergen Defizits anzusehen. Die Tatsache, dass eine Unterbrechung afferenter Bahnen zwar die Frequenz des Tremors ändert, ihn aber nicht unterdrückt, bestärkt die These zentraler Oszillatoren (Pollock and Davis, 1930). Kohärenzanalysen, in denen Eigenschaften des Zitterns verschiedener Muskelgruppen untersucht wurden, deuten darauf hin, dass in unterschiedlichen Extremitäten separate Oszillatoren als Trigger des Parkinson Tremors in Frage kommen (Raethjen et al., 2000). Lenz et al. wiesen die Aktivierung von Zellgruppen im Thalamus auf unterschiedliche Reize nach (Lenz et al., 1988). Diffizile Verfahren ließen eine Signalantwort solcher Zellen vor Auftreten eines Tremors erkennen, die Initiierung eines Reizes konnte jedoch nur selten nachgewiesen werden. Der Thalamus scheint demnach als eine Art Relais-Station im Verlauf der Tremor- Aktivierung zu existieren.
32 Einleitung 19 Eine geringe Aktivität von Zellen, unterteilt in tonic cells (Frequenz 49 Hz), pausing cells (Frequenz 30 Hz) und tremor cells (Frequenz 9,6 66 Hz) im Ncl. subthalamicus führt zu der Theorie, einen Beginn des Tremors auf vorgeschalteter Ebene anzunehmen (Deuschl et al., 2000). Überlegungen, den Stimulator von Tremor im Kleinhirn zu lokalisieren, ergaben sich aus Beobachtungen mit PET-Untersuchungen, die bei Patienten mit Parkinson Tremor einen reduzierten cerebellären Blutfluss nachweisen konnten (Deiber et al., 1993). Erfolgreiche operative Manipulationen des VIM (= ventral intermediate nucleus), der einen Teil der cerebello-thalamischen Bahn darstellt, unterstützen diese These (Lenz et al., 1994, Narabayashi, 1998). Gegenteilige Beweise liefert die Persistenz von Tremor nach vollständiger Kleinhirn- Entfernung (Deuschl et al., 1999). Die Bedeutung von Oszillatoren, die durch Reflexe getriggert werden, scheint für die Entstehung eines Tremors eher gering zu sein. Eine neurochirurgische Entfernung der hinteren Wurzel reduziert zwar die Amplitude, die Frequenz bleibt jedoch unverändert. Ein Sistieren des Tremors kann nicht erreicht werden (Pollock and Davis, 1930). Im Rahmen weiterer Studien, in denen Reflexe medikamentös (Novocain) oder durch Gewichte beeinflusst werden, zeigt sich ebenfalls eine nicht-signifikante Beeinflussung des Tremors (Deuschl et al., 2000). Völlige Bedeutungslosigkeit dieser Art der Oszillation besteht nicht, denn Unterbrechung der Pyramidenbahn oder Entfernung des Motorkortex hebt den Parkinson Tremor auf (Bucy, 1940, Putnam, 1940). Aufgrund der aktuellen Studienlage wird den Reflex-Mechanismen eine modifizierende Rolle in Bezug auf Tremorfrequenz und -amplitude zugeordnet. Zusammenfassend ist zur Zeit eine eindeutige Lokalisation von Oszillatoren als Ursache des Parkinson Tremors nicht möglich. Komplexe Strukturen und Verschaltungen der Basalganglien, insbesondere Thalamus und Striatum, werden nach aktuellem Kenntnisstand als Hauptgebiet rhythmischer Aktivität
33 Einleitung 20 angesehen, das durch multiple andere periphere und zentrale Faktoren beeinflusst wird. Motor- Kortex Prä-Motor- Kortex Diencephalon Kleinhirn Rückenmark Abbildung 1.12: Synopsis cortikaler und subcortikaler Verschaltungen zur Pathophysiologie des Tremors (modifiziert nach Timmermann et al., 2002) 1.9 Essentieller Tremor Der Essentielle Tremor stellt mit einer Prävalenz von 0,008 % bis 22 % die häufigste Form des Zitterns dar (Benito-León and Louis, 2006). Ca. 5 % der Gesamtbevölkerung der > 65-jährigen klagen über Symptome, die mit einem Essentiellen Tremor vereinbar sind. Das durchschnittliche Manifestationsalter beträgt 58 Jahre, prinzipiell ist jedoch jedes Alter der Erstdiagnose denkbar. Die Verteilung zwischen Männern und Frauen ist gleich. Vor allem von posturalem Charakter befällt er besonders die Hände (95 %) und den Kopf (34 %), kann aber auch untere Extremität (20 %), Stimme (12 %), Rumpf (5 %) und Gesicht (5%) betreffen (Elble and Koller, 1990a, Lou and Jankovic, 1991). Definitionsgemäß bleibt er monosymptomatisch, so dass weitere neurologische Veränderungen nicht vorliegen dürfen. Trotz meist
34 Einleitung 21 normalem Muskeltonus, kann in der Untersuchung ein zahnradähnliches Phänomen dominieren. Dieser palpable Tremor verstärkt sich bei willkürlicher Anspannung weiterer Muskelpartien (= Froment s Zeichen). Die klinische Symptomatik beginnt schleichend mit kontinuierlicher Progredienz. Liegt die anfängliche Frequenz bei etwa 4-12 Hz, so verringert sie sich mit zunehmenden Alter, gleichzeitig steigt die Amplitude (Elble, 2000, Connor et al., 2001). Es ist eine deutliche familiäre Häufung zu beobachten, so dass man in 50 % der Fälle eine autosomal-dominant vererbte Form annimmt (Elble, 2000a). Drei Gen-Loci wurden bereits entdeckt (Higgins et al., 1997, Gulcher et al., 1997, Shatunov et al., 2006). Untersuchungen von Cohen et al. haben gezeigt, dass bei einem von fünf Patienten mit Essentiellem Tremor ein isolierter Ruhe-Tremor vorliegt (Cohen et al., 2003) Pathophysiologie des Essentiellen Tremors Ähnlich der Pathophysiologie des Parkinson Tremors bestehen beim Essentiellen Tremor aufgrund unvollständiger Kenntnisse bezüglich seines Ursprungs mehrere theoretische Ansätze: zentraler Oszillator periphere Mechanismen Beeinflussung durch das GABAerge System
35 Einleitung 22 Globus pallidus Striatum Thalamus Substantia nigra / pars compacta Nucleus subthalamicus Nucleus ruber Nucleus olivaris inferior Pedunculus cerebellaris superior Kleinhirn Abbildung 1.13: schematische Darstellung möglicher pathophysiologischer Mechanismen in der Entstehung des Essentiellen Tremors (Vidailhet et al., 1998) Harmaline, ein Alkaloid der in Syrien, Persien, Nordtibet, Afghanistan und Zentralasien wachsenden St. Eppeurante (Peganum hermala), induziert einen feinschlägigen, generalisierten Tremor, der durch eine Frequenz von 8-12 Hz charakterisiert ist und dessen Ursprung im Bereich der unteren Olivenregion sitzt. Rhythmische, synchrone Entladungen von Neuronen der unteren Olive verursachen Signale, die über cerebello-thalamo-cortikale Bahnen fortgeleitet werden (Pennes and Hoch, 1957). Die Ähnlichkeit dieses medikamentösinduzierten Tremors zur essentiellen Variante verstärkt die Annahme eines zentralen Generators. Parallele Aufzeichnungen (Kohärenzanalysen) von EMG und EEG, durchgeführt von Hellwig et al., unterstützen die These unabhängiger, zentraler Oszillatoren (Hellwig et al., 2003). Beim Essentiellen Tremor lässt sich beobachten, dass im Anschluss an einen Störimpuls (Muskelaktivität / Nervenimpulse), der Rhythmus durch ein sensorisches Feedback getriggert wieder einsetzt. Es besteht eine Abhängigkeit der Amplitude des Tremors und der Stärke der Störung (Deuschl and Elble,
36 Einleitung ). Ein rein zentraler Oszillator, unbeeinflusst von sensorischen Rückkopplungen, würde einen durchgängigen Rhythmus, ganz unabhängig von jeglichen Störfaktoren, beibehalten. PET-Studien brachten eine Assoziation des Kleinhirns inklusive seiner Bahnen mit dem Auftreten von Essentiellem Tremor hervor (Wills et al., 1995). Ethanol führt zu einer geringeren cerebellären Durchblutung bei gleichzeitiger Steigerung des Blutflusses im Bereich der unteren Olive. Fokale Läsionen auf Hirnstamm-, Brücken-, Thalamus- und Kleinhirnebene sowie deren afferente und efferente Bahnen zogen eine Reduktion bzw. ein Aufheben des Essentiellen Tremors nach sich. Die therapeutische Wirksamkeit von Beta-Blockern eröffnet die Möglichkeit peripherer Regulationsmechanismen, da diese Substanz nur eingeschränkt die Blut-Hirn-Schranke passieren kann, jedoch signifikant das klinische Bild verbessert. Gleichzeitig ist ein vollständiges Fehlen zentraler Effekte nicht sicher auszuschließen (Connor et al., 2001). Somit scheint pathophysiologisch eine Vielzahl von Faktoren den Essentiellen Tremor zu modifizieren Differentialdiagnose Parkinson Tremor / Essentieller Tremor Die beiden häufigsten Tremorformen sind der Parkinson Tremor und der Essentielle Tremor, die deswegen differentialdiagnostische Schwierigkeiten bereiten. Folgende Tabelle zeigt typische Aspekte, durch die sich ein Essentieller vom Parkinson Tremor differenzieren lässt. Eine 100 %-ige Zuordnung in eine der beiden Gruppen ist hierdurch aber unmöglich. Erschwerend existieren Kasus mit kombiniertem Vorliegen beider Tremorformen, die mit Prävalenzen zwischen
37 Einleitung 24 6,1 % (Koller et al., 1994) und 20 % (Lou and Jankovic, 1991) beziffert werden. Tabelle 1.1: Differentialdiagnose Parkinson Tremor / Essentieller Tremor Parkinson Tremor Essentieller Tremor Frequenz 3-10 Hz 4-12 Hz Symmetrie initial Seitenbetonung fast immer Schriftbild kinetischer Tremor* oft normal Erkrankungsbeginn > 50. Lebensjahr selten > 60. Lebensjahr Vererbung möglich oft Alkoholsensitivität selten meistens Akinese sehr häufig nie Kinn-Tremor oft selten Ansprechen auf L-Dopa meistens nie Ansprechen auf ß-Blocker nein meistens *Mikrographie entspricht Akinese bei kinetischem Tremor 1.11 Tremordiagnostik Rasant fortschreitende Entwicklungen zur Quantifizierung, Analyse, Darstellung und Ursachenforschung bezüglich unterschiedlicher Tremorformen können die klinische Untersuchung ergänzen. Dabei stehen diverse Messverfahren, die einen Teil des komplexen Tremorschaltkreises analysieren, zur Verfügung.
38 Einleitung 25 EEG / MEG Elektroencephalographische Untersuchungen basieren auf der Annahme eines zentralen Oszillators. Theoretisch ist es denkbar, dass afferente und efferente Impulse erfasst werden können, deren Nutzen für die klinische Routine aber umstritten ist. Aussagekräftiger ist jedoch die Magnet-Encephalographie (MEG). EMG Eines der ältesten Verfahren zur Quantifizierung von Muskelbewegungen stellt die Elektromyographie (EMG) dar. Durchgeführt als Oberflächen-EMG bietet es eine einfache Methode, vor allem die Aktivität antagonistischer Muskelpaare zu messen, wodurch Angaben zu Rhythmus und Frequenz eines Tremors getroffen werden können (Deuschl et al., 1996, Hallett, 1998). Accelerometrie (Beschleunigungsmessung) In Ergänzung zur Frequenz erlaubt die Accelerometrie, meist durchgeführt als uniaxiale Messung, zusätzliche Angaben zur Tremoramplitude (Beschleunigung) (Deuschl et al., 1996, Hallett, 1998). Ultraschall Ultraschallmessungen ermöglichen Echtzeitaufnahmen des Tremors, die nach computergestützter Auswertung verarbeitet werden können (Walter et al., 2003). Videometrie Mithilfe der Videometrie (z.b. Infrarot-Videometrie) gelingen Echtzeitaufnahmen der verschiedenen Formen des Zitterns und der Bewegungsstörungen. Fortschritte in der elektronischen Verarbeitung erlauben genaue Analysen zur Ortsmessung und Auslenkung der jeweiligen Richtungsänderungen. Vorteil dieser Methode ist, dass Messungen beliebig gespeichert und dadurch jederzeit reproduziert werden können (Deuschl et al., 1996).
39 Einleitung Fragestellung und Ziel der Studie Trotz jahrzehntelanger Forschungen und technischer Entwicklungen bereitet die Differentialdiagnose zwischen Parkinson Tremor und Essentiellem Tremor große Schwierigkeiten. Da für dieses Problem die einfach erhältlichen Parameter Frequenz und Amplitude aufgrund von Überlappungen im Einzelfall nicht weiterhelfen, spielen instrumentelle Tremoruntersuchungen immer noch eine untergeordnete Rolle. Eine mögliche Vorgehensweise, mit der neue Informationen gewonnen werden können, ist die Analyse von Schwingungsformen. So konnten Deuschl und Timmer (Deuschl et al., 1995) zeigen, dass speziell Parkinson Tremor als Zeitreihe nicht identisch umkehrbar ist. Dies deckt sich mit den ersten eigenen Ergebnissen, dass Parkinson Tremor häufiger von der reinen Sinusform abweicht, was im Frequenzspektrum als Auftreten von harmonischen Oberfrequenzen imponiert. Mittels Kreuz-Spektral- und Kohärenz-Analysen wurden bereits verschiedene Formen der Tremormessung verglichen. So wurde ein Zusammenhang zwischen Muskelaktivität im Elektromyogramm (EMG) und Magnetencephalogramm (MEG) untersucht (Volkmann et al., 1996, Tass et al., 1998) sowie zwischen dem EMG und dem Elektroencephalogramm (EEG) (Jasper and Andrews, 1938, Schwab and Cobb, 1939, Hellwig et al., 2000). Das EMG wurde unter anderem von Fox, Elble, Pozos und Timmer mechanischen Messinstrumenten gegenübergestellt (Fox and Randall, 1970, Elble and Randall, 1976, Pozos and Iaizzo, 1991, Timmer et al., 1998). Weiterhin wurden EMG-Aufzeichnungen miteinander verglichen (Boose et al., 1996, Lauk et al., 1999).
40 Einleitung 27 Ziel dieser Arbeit war es, in EMG-Untersuchungen von Tremor nach einem Korrelat für die in Tremorspektren der Accelerometriedaten beobachtbaren Oberfrequenzen zu suchen. In dieser Studie wurde deshalb eine parallele Aufzeichnung des Tremors durch die Accelerometrie und eine 24-stündige EMG-Ableitung analysiert. Im Einzelnen sollten folgende Fragen untersucht werden: Hauptfragestellung: Können Oberfrequenzen von Parkinson und Essentiellem Tremor im EMG nachgewiesen werden? Nebenfragestellungen: Weist das Zittern bei Parkinson-Patienten mehr Oberfrequenzen auf, so dass eine Differenzierung zwischen Parkinson- und Essentiellem Tremor ermöglicht wird? Gibt es beim Tremor Frequenzunterschiede als Wegweiser zur Diagnose?
41 Methodik 28 2 Methodik 2.1 Patienten In die Studie wurden 56 Patienten im Alter zwischen 37 und 90 Jahren (das durchschnittliche Alter betrug 70 Jahre), aufgeteilt in zwei Untersuchungsgruppen PT und ET eingeschlossen. Untersucht wurden 29 Frauen und 27 Männer. Patienten, bei denen ein idiopathisches Parkinson- Syndrom diagnostiziert wurde, bildeten die Gruppe PT. Wurden Diagnosekriterien des Essentiellen Tremors erfüllt, so bildeten diese Patienten die Gruppe ET. Die Daten sämtlicher Patienten wurden unter Berücksichtigung der im Protokoll dokumentierten Aspekte im Rahmen einer Anamnese, körperlichen Untersuchung und dem Studium der Krankenakten erfasst (Anhang 7.2). Alle Patienten wurden über das Ziel und den wissenschaftlichen Charakter der Untersuchung aufgeklärt, erklärten sich schriftlich einverstanden und konnten jederzeit eine Fortsetzung der Untersuchung ablehnen Einschlusskriterien Alter der Patienten über 18 Jahre stationäre Behandlung in der Neurologischen Abteilung des Universitätsklinikum St. Josef-Hospital, Ruhr-Universität Bochum aktuelle Tremoranamnese im Bereich der Hände / Unterarme klinisch sichtbares Zittern diagnostische Zuordnung als Parkinson bzw. Essentieller Tremor Einverständniserklärung der Patienten, der gesunden Probanden und der behandelnden Ärzte
42 Methodik Ausschlusskriterien Vorliegen eines Morbus Parkinson vom reinen Rigor-Akinese-Dominanz- Typ ausgeprägte dementielle Entwicklung Psychose fehlende Compliance Verletzungen der oberen Extremität in der Vorgeschichte mit anschließender Defektheilung Pflasterallergie Tremor gesichert anderer Genese außer Parkinson Tremor oder Essentieller Tremor Ablehnung / Abbruch der Untersuchung Diagnosekriterien Essentieller Tremor In Anlehnung an die Empfehlungen der Movement Disorders Society erfolgte eine Graduierung der Diagnosesicherheit des Essentiellen Tremors in 3 Stufen (Deuschl et al., 1998): sicher wahrscheinlich möglich Um mit Sicherheit von einem Essentiellen Tremor sprechen zu können, muss eine minimale Krankheitsdauer von 5 Jahren vorliegen. Der Ruhe- und / oder Halte-Tremor muss beidseitig an Händen / Unterarmen vorliegen. Dieser ist sichtbar und beständig, führt aber nicht zwingend zu einer subjektiven Einschränkung. Die Kriterien zur Typisierung wahrscheinlich und möglich sind der Tabelle 2.1 zu entnehmen.
43 Methodik 30 Tabelle 2.1: Diagnosekriterien Essentieller Tremor und Typisierung Klassifikation Einschlusskriterien Ausschlusskriterien sicher wahrscheinlich möglich bilateraler posturaler oder kinetischer Tremor der Hände und/oder Unterarme sichtbar persistierend Dauer > 5 Jahre funktionelle Beeinträchtigung möglich siehe oben Dauer > 3 Jahre siehe oben Parkinsonismus Dystonie Myoklonus periphere Neuropathie Restless legs Syndrom Hypomimie vermindertes Mitschwingen der Arme beim Laufen Bradykinese monosymptomatischer und/oder isolierter Tremor unklarer Ätiologie andere neurologische Veränderungen bekannter verstärkter physiologischer Tremor tremorinduzierende Medikamente Trauma des peripheren oder zentralen Nervensystems innerhalb der vorausgegangenen 3 Monate Psychogener Tremor Isolierter Stimm-Tremor isolierter Zungen- oder Kinn- Tremor isolierter positions- oder aufgabenspezifischer Tremor Diagnosekriterien Morbus Parkinson Ebenso fand eine Gruppierung der Parkinson-Patienten statt, deren Grundlage die Leitlinien der UK Parkinson s Disease Society Brain Bank bildeten (Hughes et al., 1992).
44 Methodik 31 Tabelle 2.2: Diagnosekriterien Parkinson Tremor und Typisierung 1. Merkmale, die die Diagnose eines Morbus Parkinson unterstützen ( mindestens 3 Merkmale) 1 sicher Ruhetremor asymmetrischer Beginn der Symptomatik persistierende Asymmetrie mit Betonung der initial betroffenen Seite progredienter Verlauf gutes Ansprechen auf L-Dopa oder Apomorphin-Test ( %) positive L-Dopa-Wirkung länger als 5 Jahre klinischer Verlauf länger als 10 Jahre schwere L-Dopa-induzierte Chorea 2. 1 wahrscheinlich Bradykinese und mindestens eins der folgenden Kriterien Rigor 4-6 Hz Ruhetremor posturale Instabilität, die nicht primär visuell, vestibulär, cerebellär oder durch propriozeptive Dysfunktion hervorgerufen ist 3. Merkmale, die einen Morbus Parkinson als Ursache von Parkinsonismus unwahrscheinlich machen 1 möglich wiederholte Schlaganfälle mit schrittweiser Zunahme von parkinson-ähnlichen Symptomen wiederholte Kopf- / Schädelverletzungen anamnestisch gesicherte Encephalitis neuroleptische Therapie zu Beginn der Symptomatik mehr als 1 Verwandter mit gleicher Syptomatik anhaltende Rückbildung strikt einseitige Merkmale nach 3 Jahren supranukleäre Blickparese cerebelläre Zeichen frühes Auftreten schwerer autonomer Dysfunktionen frühe starke dementielle Entwicklung mit Beeinträchtigung von Gedächtnis, Sprache und exekutiven Funktionen Babinski Zeichen computertomographischer Nachweis einer cerebralen Raumforderung / eines Hydrocephalus negatives Ansprechen auf hohe L-Dopa Dosen (nach Ausschluß einer Malabsorption) regelmäßiger Kontakt mit MPTP
45 Methodik Probanden Zunächst wurden 10 Probanden mit klinisch relevantem Tremor zwecks Standardisierung des Messverfahrens untersucht, deren Daten nicht in die statistische Auswertung eingingen. Nach Messung der Patientengruppen PT und ET erfolgten die Tests an 5 Probanden ohne Tremor und ohne relevante Vorerkrankungen mit gezielten Provokationsmanövern, deren Alter in etwa mit dem durchschnittlichen Alter der Patienten übereinstimmte (Alter zwischen 60 und 72 Jahren, Durchschnittsalter 67,2 Jahre, 1 Mann, 4 Frauen). Entsprechend des Studienablaufes der Gruppen PT und ET mussten sich auch die Probanden vor Beginn der Messung einer eingehenden körperlichen Untersuchung, Anamnese und eines Screenings unterziehen. 2.2 Screening Short Parkinson s Evaluation Scale (SPES) Beide Gruppen wurden mit Hilfe der Short Parkinson s Evaluation Scale (SPES), einer multidimensionalen Fremdbeurteilungsskala beurteilt (Marinus et al., 2004). Die SPES wurde 1997 entwickelt und gliedert sich in 4 Teilabschnitte, deren Subgruppen in 4-Punkte-Skalen (0-3) unterteilt sind. Der erste Teil umfasst Beschreibungen der motorischen Funktion unter Berücksichtigung der Sprache, des Tremors (Ruhe / Haltung), des Rigors, der Diadochometrie und der Mobilität (Aufstehen vom Stuhl, Gangbild, posturale Instabilität). Anschließend folgen Fragen zu Komplikationen der Therapie. Die Beurteilung psychiatrischer Symptome und der Aktivitäten im alltäglichen Leben sind Inhalt des dritten und vierten Teilabschnittes. Neben dem Schweregrad der motorischen Symptome werden nicht-motorische Probleme der Patienten berücksichtigt, denen eine entscheidende Bedeutung im Krankheitsverlauf und der Krankheitsverarbeitung zugeschrieben wird. Hierunter fallen
46 Methodik 33 neuropsychiatrische Veränderungen (Depression, Demenz, Psychose), autonome Dysfunktionen und Behandlungskomplikationen. In Hinblick auf die Fragestellung der Arbeit wurde die Evaluation der Motorik aus der SPES in die Auswertung aufgenommen. Gegliedert in rechts und links korrelieren hohe Werte im Summenscore mit reduzierten motorischen Fähigkeiten Hoehn und Yahr Die modifizierte Version nach Hoehn und Yahr teilt die vorliegenden klinischen Veränderungen in 6 Stadien ein (Hoehn and Yahr, 1967): Stadium 0 keine Anzeichen der Erkrankung Stadium 1 einseitige Symptomatik ohne oder mit allenfalls geringer Beeinträchtigung Stadium 1,5 einseitige Symptomatik + axiale Beteiligung ohne oder mit allenfalls geringer Beeinträchtigung Stadium 2 beidseitige Symptomatik, keine Haltungsinstabilität Stadium 2,5 beidseitige Symptomatik mit Ausgleich beim Zugtest Stadium 3 geringe bis mäßige Behinderung mit leichter Haltungsinstabilität; Arbeitsfähigkeit (in Abhängigkeit vom Beruf) noch zum Teil erhalten Stadium 4 Vollbild mit starker Behinderung, Patient kann aber noch ohne Hilfe gehen oder stehen Stadium 5 Patient ist an Rollstuhl oder Bett gebunden und auf Hilfe Dritter angewiesen In der Studie wurden nur die Stadien 1-4 berücksichtigt, da die Übrigen infolge der Ein- und Ausschlusskriterien nicht aufgenommen werden konnten. Durch die grobe Einteilung liegt bei Hoehn und Yahr eine nur geringe Sensitivität vor, so dass diese Klassifikation einen rein ergänzenden Charakter erhält.
47 Methodik Messtechnik und Datenaufbereitung, TREMORanalyser Nach sorgfältiger standardisierter Anamnese, Screening und körperlicher Untersuchung erfolgte am ersten Studientag die Anlage der EMG-Elektroden des TREMORanalysers, dessen Messmethode auf einer Oberflächen- Elektromyographie von antagonistischen Unterarmmuskeln basiert. Abbildung 2.1: Oberflächenelektroden TREMORanalyser Die Sensoren befanden sich im Bereich des Musculus extensor carpi radialis und des Musculus flexor carpi ulnaris. Musculus extensor carpi radialis longus Musculus flexor carpi ulnaris Musculus extensor carpi radialis brevis Abbildung 2.2: Muskeln zur Ableitung des 24-h-EMG TREMORanalysers
48 Methodik 35 Über dem jeweiligen Muskelbauch war die differente Elektrode positioniert, 10 cm weiter distal befand sich die zugehörige indifferente Elektrode. Fixiert wurden sie mit Hilfe von Kleberingen, Klebepflastern und einem schützenden Schlauchverband. Das Messgerät wurde in einer Bauchtasche am Patienten befestigt. Abbildung 2.3: Zubehör zur Befestigung der Oberflächenelektroden TREMORanalyser Fiberglaskabel ermöglichten beim Start eine Kontrolle der Elektrodenlage über den angeschlossenen Computer im online-mode. Nach korrekter Lage begann die Aufzeichnung der Daten auf einem PC-Card -Speichermedium. Die Verbindung wurde dann getrennt und der Patient konnte und sollte sich ab nun frei bewegen.
Die vielen Gesichter des Parkinson
 Die vielen Gesichter des Parkinson Prof. Rudolf Töpper Asklepios Klinik Harburg Sylt Harburg (Hamburg) Falkenstein Ini Hannover Bad Griesbach Sichtweisen der Erkrankung Klinik Hamburg-Harburg typischer
Die vielen Gesichter des Parkinson Prof. Rudolf Töpper Asklepios Klinik Harburg Sylt Harburg (Hamburg) Falkenstein Ini Hannover Bad Griesbach Sichtweisen der Erkrankung Klinik Hamburg-Harburg typischer
M. Parkinson Ursache und Diagnose
 M. Parkinson Ursache und Diagnose Historisches Häufigkeit Diagnose Manifestationstypen Ähnliche Krankheiten Ursache(n) Zusatzuntersuchungen Prof. Dr. med. Helmut Buchner und klinische Neurophysiologie
M. Parkinson Ursache und Diagnose Historisches Häufigkeit Diagnose Manifestationstypen Ähnliche Krankheiten Ursache(n) Zusatzuntersuchungen Prof. Dr. med. Helmut Buchner und klinische Neurophysiologie
Wie können wir in Zukunft diese Fragen beantworten?
 Parkinson Krankheit: Diagnose kommt sie zu spät? Prof. Dr. med. Claudia Trenkwalder Mannheim (23. September 2010) - Die Frage, ob derzeit die Diagnosestellung einer Parkinson-Erkrankung zu spät kommt,
Parkinson Krankheit: Diagnose kommt sie zu spät? Prof. Dr. med. Claudia Trenkwalder Mannheim (23. September 2010) - Die Frage, ob derzeit die Diagnosestellung einer Parkinson-Erkrankung zu spät kommt,
Symptome und Diagnosestellung des Morbus Parkinson
 meine Hand zittert habe ich etwa Parkinson? Symptome und Diagnosestellung des Morbus Parkinson Dr. med. Sabine Skodda Oberärztin Neurologische Klinik Morbus Parkinson chronisch fortschreitende neurodegenerative
meine Hand zittert habe ich etwa Parkinson? Symptome und Diagnosestellung des Morbus Parkinson Dr. med. Sabine Skodda Oberärztin Neurologische Klinik Morbus Parkinson chronisch fortschreitende neurodegenerative
Cindy Former & Jonas Schweikhard
 Cindy Former & Jonas Schweikhard Definition Krankheitsbild Entdeckung Ursachen Biochemische Grundlagen Diagnostik Therapie Quellen Morbus Parkinson ist eine chronisch progressive neurodegenerative Erkrankung
Cindy Former & Jonas Schweikhard Definition Krankheitsbild Entdeckung Ursachen Biochemische Grundlagen Diagnostik Therapie Quellen Morbus Parkinson ist eine chronisch progressive neurodegenerative Erkrankung
. Frühe Anzeichen eines Parkinson-Syndroms... 5
 Die Parkinson-Krankheit Grundlagen... 3. Frühe Anzeichen eines Parkinson-Syndroms... 5 Riechvermögen.... 5 Schlafstörungen.... 5 Blutdruckregulationsstörungen... 6 Verdauung (Verstopfung, Obstipation)....
Die Parkinson-Krankheit Grundlagen... 3. Frühe Anzeichen eines Parkinson-Syndroms... 5 Riechvermögen.... 5 Schlafstörungen.... 5 Blutdruckregulationsstörungen... 6 Verdauung (Verstopfung, Obstipation)....
PARKINSON. Die Krankheit verstehen und bewältigen. Prof. Dr. med. Claudia Trenkwalder
 Prof. Dr. med. Claudia Trenkwalder PARKINSON Die Krankheit verstehen und bewältigen Unter Mitarbeit von: Dr. med. Manfred Georg Krukemeyer Prof. Dr. med. Gunnar Möllenhoff Dipl.-Psych. Dr. Ellen Trautmann
Prof. Dr. med. Claudia Trenkwalder PARKINSON Die Krankheit verstehen und bewältigen Unter Mitarbeit von: Dr. med. Manfred Georg Krukemeyer Prof. Dr. med. Gunnar Möllenhoff Dipl.-Psych. Dr. Ellen Trautmann
Neurologische/ Neurogeriatrische Erkrankungen des höheren Lebensalters
 Neurologische/ Neurogeriatrische Erkrankungen des höheren Lebensalters J. Bufler Neurologische Klinik des ISK Wasserburg Präsentation, Stand November 2008, Martin Spuckti Seite 1 Vier Giganten der Geriatrie
Neurologische/ Neurogeriatrische Erkrankungen des höheren Lebensalters J. Bufler Neurologische Klinik des ISK Wasserburg Präsentation, Stand November 2008, Martin Spuckti Seite 1 Vier Giganten der Geriatrie
Tiefe Hirnstimulation bei Bewegungsstörungen. Klinik für Neurologie Klinik für Neurochirurgie
 Tiefe Hirnstimulation bei Bewegungsstörungen Klinik für Neurologie Klinik für Neurochirurgie Bewegungsstörung Die Parkinson Krankheit (Morbus Parkinson) zählt zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen
Tiefe Hirnstimulation bei Bewegungsstörungen Klinik für Neurologie Klinik für Neurochirurgie Bewegungsstörung Die Parkinson Krankheit (Morbus Parkinson) zählt zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen
NRW-Forum Rehabilitation sensomotorischer Störungen. Bedeutung der Rehabilitation für Parkinson-Patienten
 NRW-Forum Rehabilitation sensomotorischer Störungen Bedeutung der Rehabilitation für Parkinson-Patienten Die Krankheit Parkinson ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, die progredient verläuft
NRW-Forum Rehabilitation sensomotorischer Störungen Bedeutung der Rehabilitation für Parkinson-Patienten Die Krankheit Parkinson ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, die progredient verläuft
INHALT TEIL 1 ALLGEMEINER TEIL... 17
 TEIL 1 ALLGEMEINER TEIL... 17 DEFINITION... 18 Was ist die Parkinson-Krankheit?... 18 Was sind die ersten Anzeichen?... 19 Wer diagnostiziert Parkinson?... 19 Seit wann kennt man Parkinson?... 20 SYMPTOME...22
TEIL 1 ALLGEMEINER TEIL... 17 DEFINITION... 18 Was ist die Parkinson-Krankheit?... 18 Was sind die ersten Anzeichen?... 19 Wer diagnostiziert Parkinson?... 19 Seit wann kennt man Parkinson?... 20 SYMPTOME...22
Tremor - Definition. Bewegungen eines oder mehrere Köperteile Rhythmisch Unwillkürlich Oszillatorisch
 Tremor PD Dr. med. M. Küper und klinische Neurophysiologie Recklinghausen Tremor - Definition Bewegungen eines oder mehrere Köperteile Rhythmisch Unwillkürlich Oszillatorisch Tremor - Semiologie Tremorform
Tremor PD Dr. med. M. Küper und klinische Neurophysiologie Recklinghausen Tremor - Definition Bewegungen eines oder mehrere Köperteile Rhythmisch Unwillkürlich Oszillatorisch Tremor - Semiologie Tremorform
Bild: Kurzlehrbuch Neurologie, Thieme
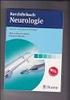 Morbus Parkinson 2 Morbus Parkinson Inhalt» Pathogenese» Symptome» Diagnostik» Therapie Bild: Kurzlehrbuch Neurologie, Thieme Eigene Bilder Morbus Parkinson 4 Morbus Parkinson 3 Was ist Parkinson?» Die
Morbus Parkinson 2 Morbus Parkinson Inhalt» Pathogenese» Symptome» Diagnostik» Therapie Bild: Kurzlehrbuch Neurologie, Thieme Eigene Bilder Morbus Parkinson 4 Morbus Parkinson 3 Was ist Parkinson?» Die
Parkinson - Die Krankheit verstehen und bewältigen
 Parkinson - Die Krankheit verstehen und bewältigen Unter Mitarbeit von Dr. med. Manfred Georg Krukemeyer, Prof. Dr. med. Gunnar Möllenhoff und Dipl.- Psych. Dr. Ellen Trautmann Bearbeitet von Claudia Trenkwalder
Parkinson - Die Krankheit verstehen und bewältigen Unter Mitarbeit von Dr. med. Manfred Georg Krukemeyer, Prof. Dr. med. Gunnar Möllenhoff und Dipl.- Psych. Dr. Ellen Trautmann Bearbeitet von Claudia Trenkwalder
in der industrialisierten Welt stark ansteigt und auch weiter ansteigen wird, ist mit einer weiteren Zunahme der Zahl der Betroffenen
 Vorwort Der Morbus Parkinson, also die Parkinson sche Krankheit (lat. Morbus = Krankheit), ist eine häufige neurologische Krankheit. Mit höherem Lebensalter steigt die Wahrscheinlichkeit, an dieser Erkrankung
Vorwort Der Morbus Parkinson, also die Parkinson sche Krankheit (lat. Morbus = Krankheit), ist eine häufige neurologische Krankheit. Mit höherem Lebensalter steigt die Wahrscheinlichkeit, an dieser Erkrankung
Rolle von PET und SPECT in der Differentialdiagnose von Parkinson- Syndromen
 Rolle von PET und SPECT in der Differentialdiagnose von Parkinson- Syndromen Rüdiger Hilker Neurowoche und DGN 2006 20.09.2006 1. Methodik nuklearmedizinischer Bildgebung 2. Biomarker-Konzept bei Parkinson-
Rolle von PET und SPECT in der Differentialdiagnose von Parkinson- Syndromen Rüdiger Hilker Neurowoche und DGN 2006 20.09.2006 1. Methodik nuklearmedizinischer Bildgebung 2. Biomarker-Konzept bei Parkinson-
PATIENTENINFORMATION. Caregiver Burden bei betreuenden Angehörigen schwer betroffener Parkinsonpatienten
 Version 1.2 Neurologische Klinik mit Klinischer Neurophysiologie Kommissarischer Direktor: Prof. Dr. med. M. Stangel PD Dr. med. F. Wegner Telefon: (0511) 532-3110 Fax: (0511) 532-3115 Carl-Neuberg-Straße
Version 1.2 Neurologische Klinik mit Klinischer Neurophysiologie Kommissarischer Direktor: Prof. Dr. med. M. Stangel PD Dr. med. F. Wegner Telefon: (0511) 532-3110 Fax: (0511) 532-3115 Carl-Neuberg-Straße
Morbus Parkinson Ratgeber
 Morbus Parkinson Ratgeber Impressum Zarenga GmbH, Bonn 2015 Zarenga GmbH, Pfaffenweg 15, 53227 Bonn Alle Rechte sind vorbehalten. Dieses Buch, einschließlich seiner einzelnen Teile ist urheberrechtlich
Morbus Parkinson Ratgeber Impressum Zarenga GmbH, Bonn 2015 Zarenga GmbH, Pfaffenweg 15, 53227 Bonn Alle Rechte sind vorbehalten. Dieses Buch, einschließlich seiner einzelnen Teile ist urheberrechtlich
Biologische Psychologie II
 Parkinson-Erkrankung: Ca. 0,5% der Bevölkerung leidet an dieser Krankheit, die bei Männern ungefähr 2,5 Mal häufiger auftritt als bei Frauen! Die Krankheit beginnt mit leichter Steifheit oder Zittern der
Parkinson-Erkrankung: Ca. 0,5% der Bevölkerung leidet an dieser Krankheit, die bei Männern ungefähr 2,5 Mal häufiger auftritt als bei Frauen! Die Krankheit beginnt mit leichter Steifheit oder Zittern der
Die Parkinson Krankheit. Diagnostik und Therapie
 Die Parkinson Krankheit Diagnostik und Therapie Was bedeutet eigentlich Parkinson? James Parkinson stellte bei seinen Patienten ein auffälliges Zittern der Hände fest und bezeichnete die Krankheit als
Die Parkinson Krankheit Diagnostik und Therapie Was bedeutet eigentlich Parkinson? James Parkinson stellte bei seinen Patienten ein auffälliges Zittern der Hände fest und bezeichnete die Krankheit als
Parkinson-Syndrome Parkinson-Syndrome Themen dieses Vortrags: 1.) Überblick über Parkinson-Syndrome 2.) Morbus Parkinson Pathophysiologie
 Parkinson-Syndrome Parkinson-Syndrome Themen dieses Vortrags: 1.) Überblick über Parkinson-Syndrome 2.) Morbus Parkinson - Pathophysiologie - Epidemiologie - Symptome - Diagnostik - Therapie 3.) Parkinson-plus
Parkinson-Syndrome Parkinson-Syndrome Themen dieses Vortrags: 1.) Überblick über Parkinson-Syndrome 2.) Morbus Parkinson - Pathophysiologie - Epidemiologie - Symptome - Diagnostik - Therapie 3.) Parkinson-plus
Grundlagen Neurogenetik und Bewegungsstörungen Ausblick 27. Krankheitsbilder Differenzialdiagnosen
 XI Grundlagen 1 1 Grundlagen der Bewegungserkrankungen 3 W. H. Oertel 1.1 Einleitung und Geschichte der Erforschung der Bewegungserkrankungen 3 1.2 Neuroanatomie und Neurophysiologie der Basalganglien
XI Grundlagen 1 1 Grundlagen der Bewegungserkrankungen 3 W. H. Oertel 1.1 Einleitung und Geschichte der Erforschung der Bewegungserkrankungen 3 1.2 Neuroanatomie und Neurophysiologie der Basalganglien
Inhaltsverzeichnis. 1 Einleitung Geschichtlicher Überblick Begriffsbestimmung... 5
 1 Einleitung................................................. 1 2 Geschichtlicher Überblick................................... 2 3 Begriffsbestimmung........................................ 5 4 Epidemiologie,
1 Einleitung................................................. 1 2 Geschichtlicher Überblick................................... 2 3 Begriffsbestimmung........................................ 5 4 Epidemiologie,
Die Parkinson Krankheit. Diagnostik und Therapie
 Die Parkinson Krankheit Diagnostik und Therapie Was bedeutet eigentlich Parkinson? James Parkinson stellte bei seinen Patienten ein auffälliges Zittern der Hände fest und bezeichnete die Krankheit als
Die Parkinson Krankheit Diagnostik und Therapie Was bedeutet eigentlich Parkinson? James Parkinson stellte bei seinen Patienten ein auffälliges Zittern der Hände fest und bezeichnete die Krankheit als
Beurteilung der striatalen Dopamin-D2-Rezeptorblockade durch Neuroleptika mit Hilfe der
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Nuklearmedizin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktorin: Frau Prof. Dr. med. habil. T. Mende Beurteilung der striatalen Dopamin-D2-Rezeptorblockade
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Nuklearmedizin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktorin: Frau Prof. Dr. med. habil. T. Mende Beurteilung der striatalen Dopamin-D2-Rezeptorblockade
Bewegungsstörungen. Demenzen. und. am Anfang war das Zittern. (movement disorders) und. Neuro-Geriatrie Fachtage in Haiger,,
 am Anfang war das Zittern Bewegungsstörungen (movement disorders) und Demenzen und Psycho-Neuro Neuro-Geriatrie Fachtage in Haiger,, 9.06.2009 Referent Alexander Simonow Neurologische Praxis, Herborn Bewegungsstörungen
am Anfang war das Zittern Bewegungsstörungen (movement disorders) und Demenzen und Psycho-Neuro Neuro-Geriatrie Fachtage in Haiger,, 9.06.2009 Referent Alexander Simonow Neurologische Praxis, Herborn Bewegungsstörungen
Bewegungsmuffel erkranken häufiger an Parkinson
 Körperliche Aktivität schützt die Nerven Bewegungsmuffel erkranken häufiger an Parkinson Berlin (11. Februar 2015) Körperliche Aktivität ist gut für die Gesundheit, senkt das Risiko für Schlaganfall und
Körperliche Aktivität schützt die Nerven Bewegungsmuffel erkranken häufiger an Parkinson Berlin (11. Februar 2015) Körperliche Aktivität ist gut für die Gesundheit, senkt das Risiko für Schlaganfall und
Parkinson: (differentielle) Diagnosis
 Parkinson: (differentielle) Diagnosis Professor Bastiaan R. Bloem Parkinson Center Nijmegen (ParC) Medizinisches Zentrum der Universität Radboud @BasBloem Teilnehmende Organisationen: Eine faszinierende
Parkinson: (differentielle) Diagnosis Professor Bastiaan R. Bloem Parkinson Center Nijmegen (ParC) Medizinisches Zentrum der Universität Radboud @BasBloem Teilnehmende Organisationen: Eine faszinierende
Parkinson-Syndrom Definition
 Definition Symptomkomplex aus Hypo- oder Akinese Rigor und Ruhetremor. Ätiologie Zwei Hauptformen des Parkinson-Syndroms werden unterschieden: Beim Morbus Parkinson (idiopathisches Parkinson- Syndrom,
Definition Symptomkomplex aus Hypo- oder Akinese Rigor und Ruhetremor. Ätiologie Zwei Hauptformen des Parkinson-Syndroms werden unterschieden: Beim Morbus Parkinson (idiopathisches Parkinson- Syndrom,
Früh- und Vorbotensymptome der Parkinsonerkrankung
 Früh- und Vorbotensymptome der Parkinsonerkrankung 5. Hiltruper Parkinson-Tag 20. Mai 2015 Referent: Dr. Christoph Aufenberg, Oberarzt der Klinik für Neurologie Herz-Jesu-Krankenhaus Münster-Hiltrup Westfalenstraße
Früh- und Vorbotensymptome der Parkinsonerkrankung 5. Hiltruper Parkinson-Tag 20. Mai 2015 Referent: Dr. Christoph Aufenberg, Oberarzt der Klinik für Neurologie Herz-Jesu-Krankenhaus Münster-Hiltrup Westfalenstraße
Paraklinische Befunde bei gemischten Episoden bipolar affektiver und schizoaffektiver Erkrankungen. Dissertation
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. Dr. h.c. Andreas Marneros) Paraklinische Befunde
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. Dr. h.c. Andreas Marneros) Paraklinische Befunde
TABELLE 5. Patienten und der Kontrollpatienten (Mann-Whitney)
 4. ERGEBNISSE Einleitend soll beschrieben werden, dass der in der semiquantitativen Analyse berechnete Basalganglien/Frontalcortex-Quotient der 123 Jod-IBZM-SPECT die striatale 123 Jod-IBZM- Bindung im
4. ERGEBNISSE Einleitend soll beschrieben werden, dass der in der semiquantitativen Analyse berechnete Basalganglien/Frontalcortex-Quotient der 123 Jod-IBZM-SPECT die striatale 123 Jod-IBZM- Bindung im
Gangstörungen in der Neurologie. Praxisseminar Bewegungsstörungen
 Gangstörungen in der Neurologie Praxisseminar Bewegungsstörungen 29.05.08 Inhalt Allgemeines Klassifikation Risikofaktoren Ganganalyse zur Diagnostik von Gangstörungen Therapie und Prävention vention Gangstörungen
Gangstörungen in der Neurologie Praxisseminar Bewegungsstörungen 29.05.08 Inhalt Allgemeines Klassifikation Risikofaktoren Ganganalyse zur Diagnostik von Gangstörungen Therapie und Prävention vention Gangstörungen
Parkinson-Syndrome und andere Bewegungsstörungen
 Parkinson-Syndrome und andere Bewegungsstörungen Bearbeitet von Wolfgang H. Oertel, Günther Deuschl, Werner Poewe 1. Auflage 2011. Buch. ca. 648 S. Hardcover ISBN 978 3 13 148781 0 Format (B x L): 19,5
Parkinson-Syndrome und andere Bewegungsstörungen Bearbeitet von Wolfgang H. Oertel, Günther Deuschl, Werner Poewe 1. Auflage 2011. Buch. ca. 648 S. Hardcover ISBN 978 3 13 148781 0 Format (B x L): 19,5
Bildgebende Verfahren zur Erkennung von Parkinsonsyndromen
 I N F O R M A T I O N S B R O S C H Ü R E Bildgebende Verfahren zur Erkennung von Parkinsonsyndromen 4 VORWORT 5 Liebe Patientin, Lieber Patient, Verantwortlich für den Inhalt dieser Informationsbroschüre:
I N F O R M A T I O N S B R O S C H Ü R E Bildgebende Verfahren zur Erkennung von Parkinsonsyndromen 4 VORWORT 5 Liebe Patientin, Lieber Patient, Verantwortlich für den Inhalt dieser Informationsbroschüre:
Ausbildungsinhalte zum Arzt für Allgemeinmedizin. Neurologie
 Ausbildungsinhalte zum Arzt für Allgemeinmedizin Anlage 1.B.8.5 Neurologie 1. Akut- und Notfallmedizin absolviert 1. Kenntnisse und Erfahrungen im Erkennen und Vorgehen bei akut bedrohlichen Situationen,
Ausbildungsinhalte zum Arzt für Allgemeinmedizin Anlage 1.B.8.5 Neurologie 1. Akut- und Notfallmedizin absolviert 1. Kenntnisse und Erfahrungen im Erkennen und Vorgehen bei akut bedrohlichen Situationen,
2 Der Einfluss von Sport und Bewegung auf die neuronale Konnektivität 11
 I Grundlagen 1 1 Neurobiologische Effekte körperlicher Aktivität 3 1.1 Einleitung 3 1.2 Direkte Effekte auf Neurone, Synapsenbildung und Plastizität 4 1.3 Indirekte Effekte durch verbesserte Hirndurchblutung,
I Grundlagen 1 1 Neurobiologische Effekte körperlicher Aktivität 3 1.1 Einleitung 3 1.2 Direkte Effekte auf Neurone, Synapsenbildung und Plastizität 4 1.3 Indirekte Effekte durch verbesserte Hirndurchblutung,
15. Informationstagung der Reha Rheinfelden. Pharmakotherapie des idiopathischen Parkinsonsyndroms
 15. Informationstagung der Reha Rheinfelden Pharmakotherapie des idiopathischen Parkinsonsyndroms Dr. med. Florian von Raison, assoziierter Arzt, Neurologische Klinik, Universitätsspital (USB) Donnerstag,
15. Informationstagung der Reha Rheinfelden Pharmakotherapie des idiopathischen Parkinsonsyndroms Dr. med. Florian von Raison, assoziierter Arzt, Neurologische Klinik, Universitätsspital (USB) Donnerstag,
Versorgung von Patienten mit Tiefer Hirnstimulation in Dülmen. Neurologische Klinik Dülmen - Christophorus-Kliniken
 in Dülmen Neurologische Klinik Dülmen - Christophorus-Kliniken 1 in der Neurologischen Klinik Dülmen 1.Einleitung 2.Der geeignete Patient für die Tiefe Hirnstimulation 3.Vorbereitung vor der Operation
in Dülmen Neurologische Klinik Dülmen - Christophorus-Kliniken 1 in der Neurologischen Klinik Dülmen 1.Einleitung 2.Der geeignete Patient für die Tiefe Hirnstimulation 3.Vorbereitung vor der Operation
Parkinson kommt selten allein
 Herausforderung Komorbiditäten Parkinson kommt selten allein Prof. Dr. Jens Volkmann, Würzburg Würzburg (14. März 2013) - Morbus Parkinson ist eine chronisch progrediente Erkrankung, für die noch keine
Herausforderung Komorbiditäten Parkinson kommt selten allein Prof. Dr. Jens Volkmann, Würzburg Würzburg (14. März 2013) - Morbus Parkinson ist eine chronisch progrediente Erkrankung, für die noch keine
DEFINITION. Seit wann kennt man Parkinson?
 DEFINITION Seit wann kennt man Parkinson? Der erste Arzt, der in moderner Zeit die Krankheit beschrieben hat, war Sir James Parkinson (1755 1824), praktischer Arzt, Apotheker, Geologe und Paläontologe
DEFINITION Seit wann kennt man Parkinson? Der erste Arzt, der in moderner Zeit die Krankheit beschrieben hat, war Sir James Parkinson (1755 1824), praktischer Arzt, Apotheker, Geologe und Paläontologe
Multiple Sklerose ohne oligoklonale Banden in Liquor: Prävalenz und klinischer Verlauf
 Aus der Klinik für Neurologie des Jüdischen Krankenhaus Berlin Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Fakultät der Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION Multiple Sklerose ohne oligoklonale
Aus der Klinik für Neurologie des Jüdischen Krankenhaus Berlin Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Fakultät der Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION Multiple Sklerose ohne oligoklonale
Demenz. Gabriela Stoppe. Diagnostik - Beratung - Therapie. Ernst Reinhardt Verlag München Basel. Mit 13 Abbildungen und 2 Tabellen
 Gabriela Stoppe 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Demenz Diagnostik - Beratung - Therapie Mit 13 Abbildungen
Gabriela Stoppe 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Demenz Diagnostik - Beratung - Therapie Mit 13 Abbildungen
Klinik für Neurologie und neurologische Intensivmedizin am Klinikum Lüdenscheid. Graphik entfernt
 Parkinson`s Definition: Involuntary tremulous motion, with lessened muscular power, in parts not in action and even when supported with a propensity to bend the trunk forwards and to pass from a walking
Parkinson`s Definition: Involuntary tremulous motion, with lessened muscular power, in parts not in action and even when supported with a propensity to bend the trunk forwards and to pass from a walking
Kein Hinweis für eine andere Ursache der Demenz
 die später nach ihm benannte Krankheit. Inzwischen weiß man, dass die Alzheimer-Krankheit eine sogenannte primär-neurodegenerative Hirnerkrankung ist. Das bedeutet, dass die Erkrankung direkt im Gehirn
die später nach ihm benannte Krankheit. Inzwischen weiß man, dass die Alzheimer-Krankheit eine sogenannte primär-neurodegenerative Hirnerkrankung ist. Das bedeutet, dass die Erkrankung direkt im Gehirn
Parkinson gezielter einsetzen
 Mehr Präzision weniger Nebenwirkungen Neurophysiologen wollen Hirnschrittmacher bei Parkinson gezielter einsetzen Tübingen (19. März 2015) Die Tiefe Hirnstimulation (THS) durch elektrische Impulse eines
Mehr Präzision weniger Nebenwirkungen Neurophysiologen wollen Hirnschrittmacher bei Parkinson gezielter einsetzen Tübingen (19. März 2015) Die Tiefe Hirnstimulation (THS) durch elektrische Impulse eines
1 Charakteristika in der praktischen Ausbildung am Patienten 3
 Inhaltsverzeichnis 1 Charakteristika in der praktischen Ausbildung am Patienten 3 Multiple Störungen 3 1.5 Spezifische Arbeitsfelder entsprechend Progredienz/Chronifizierung 5 dem Rehabilitationsfortschritt
Inhaltsverzeichnis 1 Charakteristika in der praktischen Ausbildung am Patienten 3 Multiple Störungen 3 1.5 Spezifische Arbeitsfelder entsprechend Progredienz/Chronifizierung 5 dem Rehabilitationsfortschritt
Gesundheitsbezogene Lebensqualität, körperliche Beschwerden, psychische Komorbidität und Interventionen bei Dyspepsie
 Medizinische Fakultät der Charité - Universitätsmedizin Berlin Campus Benjamin Franklin aus der Abteilung für Allgemeinmedizin mit Allgemeinpraxis Direktor: Prof. Dr. med. P. Mitznegg Gesundheitsbezogene
Medizinische Fakultät der Charité - Universitätsmedizin Berlin Campus Benjamin Franklin aus der Abteilung für Allgemeinmedizin mit Allgemeinpraxis Direktor: Prof. Dr. med. P. Mitznegg Gesundheitsbezogene
Auf der 84. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN), die noch bis zum 1. Oktober in
 Restless-Legs-Syndrom: Ein besseres Leben ist möglich Die Qual der ruhelosen Beine ist eine kaum bekannte Volkskrankheit Wiesbaden (29. September 2011) Bis zu zehn Prozent der Bevölkerung sind von einem
Restless-Legs-Syndrom: Ein besseres Leben ist möglich Die Qual der ruhelosen Beine ist eine kaum bekannte Volkskrankheit Wiesbaden (29. September 2011) Bis zu zehn Prozent der Bevölkerung sind von einem
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
 Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Die Behandlung der Parkinson-Erkrankung setzt sich aus mehreren Elementen zusammen. Dazu gehört zunächst eine Aufklärung
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Die Behandlung der Parkinson-Erkrankung setzt sich aus mehreren Elementen zusammen. Dazu gehört zunächst eine Aufklärung
Multiple Sklerose (MS)
 Bild: Kurzlehrbuch Neurologie, Thieme Multiple Sklerose 2 Multiple Sklerose (MS) Inhalt» Pathogenese» Symptome» Diagnostik» Therapie Multiple Sklerose 4 Multiple Sklerose 3 Definition und Pathogenese»
Bild: Kurzlehrbuch Neurologie, Thieme Multiple Sklerose 2 Multiple Sklerose (MS) Inhalt» Pathogenese» Symptome» Diagnostik» Therapie Multiple Sklerose 4 Multiple Sklerose 3 Definition und Pathogenese»
Das Prinzip Espenlaub Spielarten des Tremors. (PDF-Version ohne Videos)
 Das Prinzip Espenlaub Spielarten des Tremors (PDF-Version ohne Videos) Jonas Teubner, Neurologie, Spital Limmattal 31.01.2019 Populus tremula Video: Zitterpappel Was ist nu das für ein Geist, der dies
Das Prinzip Espenlaub Spielarten des Tremors (PDF-Version ohne Videos) Jonas Teubner, Neurologie, Spital Limmattal 31.01.2019 Populus tremula Video: Zitterpappel Was ist nu das für ein Geist, der dies
PARKINSON. Die Krankheit verstehen und bewältigen
 Prof. Dr. med. Claudia Trenkwalder PARKINSON Die Krankheit verstehen und bewältigen Unter Mitarbeit von Dr. med. Manfred Georg Krukemeyer, Priv.-Doz. Dr. med. Gunnar Möllenhoff und Dipl.-Psych. Dr. Ellen
Prof. Dr. med. Claudia Trenkwalder PARKINSON Die Krankheit verstehen und bewältigen Unter Mitarbeit von Dr. med. Manfred Georg Krukemeyer, Priv.-Doz. Dr. med. Gunnar Möllenhoff und Dipl.-Psych. Dr. Ellen
Logopädie in der Geriatrie
 Logopädie in der Geriatrie Kommunikations- und Schluckstörungen Bearbeitet von, 1. Auflage 2017. Buch inkl. Online-Nutzung. 296 S. Softcover ISBN 978 3 13 175401 1 Format (B x L): 17 x 24 cm Weitere Fachgebiete
Logopädie in der Geriatrie Kommunikations- und Schluckstörungen Bearbeitet von, 1. Auflage 2017. Buch inkl. Online-Nutzung. 296 S. Softcover ISBN 978 3 13 175401 1 Format (B x L): 17 x 24 cm Weitere Fachgebiete
Parkinson: Zunehmende Aufmerksamkeit für nicht-motorische Störungen eröffnet neue Therapieoptionen
 European Neurological Society (ENS) 2009: Neurologen tagen in Mailand Parkinson: Zunehmende Aufmerksamkeit für nicht-motorische Störungen eröffnet neue Therapieoptionen Mailand, Italien (22. Juni 2009)
European Neurological Society (ENS) 2009: Neurologen tagen in Mailand Parkinson: Zunehmende Aufmerksamkeit für nicht-motorische Störungen eröffnet neue Therapieoptionen Mailand, Italien (22. Juni 2009)
Multiple Sklerose (MS)
 Bild: Kurzlehrbuch Neurologie, Thieme Multiple Sklerose 2 Multiple Sklerose (MS) Inhalt» Pathogenese» Symptome» Diagnostik» Therapie Multiple Sklerose 4 Multiple Sklerose 3 Klinischer Fall..\3) Sammlung\Klinischer
Bild: Kurzlehrbuch Neurologie, Thieme Multiple Sklerose 2 Multiple Sklerose (MS) Inhalt» Pathogenese» Symptome» Diagnostik» Therapie Multiple Sklerose 4 Multiple Sklerose 3 Klinischer Fall..\3) Sammlung\Klinischer
Inhaltsverzeichnis. Bibliografische Informationen http://d-nb.info/992492254. digitalisiert durch
 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1.1 Die transkranielle Magnetstimulation (TMS) - allgemeine Einführung 1.1.1 Die TMS - technisches Prinzip 17-18 1.1.2 Einsatz der TMS in der neuro-psychiatrischen Forschung
Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1.1 Die transkranielle Magnetstimulation (TMS) - allgemeine Einführung 1.1.1 Die TMS - technisches Prinzip 17-18 1.1.2 Einsatz der TMS in der neuro-psychiatrischen Forschung
Einfluß von Ausdauertraining, Clomipramin und Placebo auf psychologische und physiologische Parameter bei Panikstörung
 Einfluß von Ausdauertraining, Clomipramin und Placebo auf psychologische und physiologische Parameter bei Panikstörung Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen
Einfluß von Ausdauertraining, Clomipramin und Placebo auf psychologische und physiologische Parameter bei Panikstörung Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen
Teil Methodische Überlegungen Zur Dysgrammatismus-Forschung... 17
 Inhaltsverzeichnis Dysgrammatismus EINLEITUNG Teil 1... 9 A Phänomen des Dysgrammatismus... 13 Methodische Überlegungen... 15 Zur Dysgrammatismus-Forschung... 17 B Die Sprachstörung Dysgrammatismus...
Inhaltsverzeichnis Dysgrammatismus EINLEITUNG Teil 1... 9 A Phänomen des Dysgrammatismus... 13 Methodische Überlegungen... 15 Zur Dysgrammatismus-Forschung... 17 B Die Sprachstörung Dysgrammatismus...
Innovative Neuro-Bildgebung unterstützt frühe Diagnose und maßgeschneiderte Therapiestrategien
 Kongress der European Neurological Society (ENS) 2009: Alzheimer, Kopfschmerzen, Multiple Sklerose Innovative Neuro-Bildgebung unterstützt frühe Diagnose und maßgeschneiderte Therapiestrategien Mailand,
Kongress der European Neurological Society (ENS) 2009: Alzheimer, Kopfschmerzen, Multiple Sklerose Innovative Neuro-Bildgebung unterstützt frühe Diagnose und maßgeschneiderte Therapiestrategien Mailand,
3.1 Dauerhafter Hochdruck versus temporärer. 3.1 Dauerhafter Hochdruck versus temporärer Hochdruck
 3.1 Dauerhafter Hochdruck versus temporärer 9 3.1 Dauerhafter Hochdruck versus temporärer Hochdruck A Grundsätzlich muss zwischen den dauerhaften und den temporären Blutdrucksteigerungen unterschieden
3.1 Dauerhafter Hochdruck versus temporärer 9 3.1 Dauerhafter Hochdruck versus temporärer Hochdruck A Grundsätzlich muss zwischen den dauerhaften und den temporären Blutdrucksteigerungen unterschieden
Supramaximal stimulierte A-Wellen beim N. tibialis
 Aus der Universitätslinik und Poliklinik für Neurologie der Martin- Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Professor Dr. S. Zierz Supramaximal stimulierte A-Wellen beim N. tibialis Habilitation
Aus der Universitätslinik und Poliklinik für Neurologie der Martin- Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Professor Dr. S. Zierz Supramaximal stimulierte A-Wellen beim N. tibialis Habilitation
Inhalt. Vorwort zur zweiten Auflage Grundlagen Demenzen... 24
 Inhalt Vorwort zur zweiten Auflage........................ 5 1 Grundlagen..................................... 13 1.1 Definition, Diagnostik und Klassifikation psychischer Störungen.......................
Inhalt Vorwort zur zweiten Auflage........................ 5 1 Grundlagen..................................... 13 1.1 Definition, Diagnostik und Klassifikation psychischer Störungen.......................
Tiefe Hirnstimulation
 Münster, 09.09.2015 Tiefe Hirnstimulation N. Warneke Klinik für Neurochirurgie Universitätsklinikum Münster Direktor: Prof. Dr. med. W. Stummer Morbus Parkinson Problem: Nach 5-6 Jahren entwickeln ca.
Münster, 09.09.2015 Tiefe Hirnstimulation N. Warneke Klinik für Neurochirurgie Universitätsklinikum Münster Direktor: Prof. Dr. med. W. Stummer Morbus Parkinson Problem: Nach 5-6 Jahren entwickeln ca.
Tremor Diagnose und Therapie
 Tremor Diagnose und Therapie Autor: Universitätsdozent Dr Willibald Gerschlager Neurologische Abteilung KH der Barmherzigen Brüder Große Mohrengasse 9 1020 Wien 1 Der Tremor stellt die häufigste Bewegungsstörung
Tremor Diagnose und Therapie Autor: Universitätsdozent Dr Willibald Gerschlager Neurologische Abteilung KH der Barmherzigen Brüder Große Mohrengasse 9 1020 Wien 1 Der Tremor stellt die häufigste Bewegungsstörung
Parkinson und Kreislaufprobleme
 Parkinson und Kreislaufprobleme Referent: Dr. Gabor Egervari Leiter der Kardiologie, Klinik für Innere Medizin Übersicht 1. Ursachen für Kreislaufprobleme bei M. Parkinson 2. Diagnostische Maßnahmen bei
Parkinson und Kreislaufprobleme Referent: Dr. Gabor Egervari Leiter der Kardiologie, Klinik für Innere Medizin Übersicht 1. Ursachen für Kreislaufprobleme bei M. Parkinson 2. Diagnostische Maßnahmen bei
Eine Analyse des Münchner Schlaganfallregisters: Diagnostik und Therapie bei Patienten mit Diabetes mellitus"
 Aus der Forschergruppe Diabetes e.v. am Helmholtz Zentrum München Vorstand: Professor Dr. med. Oliver Schnell Eine Analyse des Münchner Schlaganfallregisters: Diagnostik und Therapie bei Patienten mit
Aus der Forschergruppe Diabetes e.v. am Helmholtz Zentrum München Vorstand: Professor Dr. med. Oliver Schnell Eine Analyse des Münchner Schlaganfallregisters: Diagnostik und Therapie bei Patienten mit
Pathophysiologie 3 Möglichkeiten werden diskutiert: 1. Entzündung Dolor Rubor Tumor Calor Schmerz Rötung Schwellung Wärme 2. Sympathische Störungen
 Pathophysiologie 3 Möglichkeiten werden diskutiert: 1. Entzündung Dolor Rubor Tumor Calor Schmerz Rötung Schwellung Wärme 2. Sympathische Störungen ausgeprägte autonome Störungen beim CRPS 3. Maladaptive
Pathophysiologie 3 Möglichkeiten werden diskutiert: 1. Entzündung Dolor Rubor Tumor Calor Schmerz Rötung Schwellung Wärme 2. Sympathische Störungen ausgeprägte autonome Störungen beim CRPS 3. Maladaptive
Klinische Bedeutung der Vasopressinbestimmung im Urin bei der Differentialdiagnose der Symptome Polyurie/Polydipsie bei Erwachsenen
 Aus der Medizinischen Klinik IV und Poliklinik Endokrinologie und Nephrologie Bereich Endokrinologie und Diabetes (Abteilungsleiter: Prof. Dr. Wolfgang Oelkers) Klinische Bedeutung der Vasopressinbestimmung
Aus der Medizinischen Klinik IV und Poliklinik Endokrinologie und Nephrologie Bereich Endokrinologie und Diabetes (Abteilungsleiter: Prof. Dr. Wolfgang Oelkers) Klinische Bedeutung der Vasopressinbestimmung
Patienten können von früherem Behandlungsbeginn profitieren
 Morbus Parkinson Patienten können von früherem Behandlungsbeginn profitieren Düsseldorf (24. September 2015) - Erhaltung der Selbstständigkeit in den Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) und der gesundheitsbezogenen
Morbus Parkinson Patienten können von früherem Behandlungsbeginn profitieren Düsseldorf (24. September 2015) - Erhaltung der Selbstständigkeit in den Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) und der gesundheitsbezogenen
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin II an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin II an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Prof. Dr. med. habil. Bernd Osten Bedeutung der Osteodensitometrie mittels Ultraschall
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin II an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Prof. Dr. med. habil. Bernd Osten Bedeutung der Osteodensitometrie mittels Ultraschall
1 Einleitung Morbus Huntington (HD) Epidemiologie Klinik Pathophysiologie... 4
 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 1 1.1 Morbus Huntington (HD)... 1 1.1.1 Epidemiologie... 2 1.1.2 Klinik... 2 1.1.3 Pathophysiologie... 4 1.1.3.1 Genetische Grundlagen und Erkrankungsbeginn... 4 1.1.3.2
Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 1 1.1 Morbus Huntington (HD)... 1 1.1.1 Epidemiologie... 2 1.1.2 Klinik... 2 1.1.3 Pathophysiologie... 4 1.1.3.1 Genetische Grundlagen und Erkrankungsbeginn... 4 1.1.3.2
Manometrie des Ösophagus mit heliumperfundierten Kathetern im Kindesalter
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Kinderchirurgie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Prof. Dr. med. habil. R. Finke Manometrie des Ösophagus mit heliumperfundierten
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Kinderchirurgie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Prof. Dr. med. habil. R. Finke Manometrie des Ösophagus mit heliumperfundierten
Naturprodukt AtreMorine kann Parkinsonpatienten. Spanische Wissenschaftler finden heraus!
 Naturprodukt AtreMorine kann Parkinsonpatienten helfen? Spanische Wissenschaftler finden heraus! Datum : 18/11/2016 Ramón Cacabelos, Experte für neurodegenerative Erkrankungen und genomische Medizin, und
Naturprodukt AtreMorine kann Parkinsonpatienten helfen? Spanische Wissenschaftler finden heraus! Datum : 18/11/2016 Ramón Cacabelos, Experte für neurodegenerative Erkrankungen und genomische Medizin, und
Kasuistische Beiträge zur modernen Pharmakotherapie mit Quetiapin
 Kasuistische Beiträge zur modernen Pharmakotherapie mit Quetiapin Hans-Peter Volz Siegfried Kasper Hans-Jürgen Möller Inhalt Vorwort 17 A Allgemeiner Teil Stürmiücn (I l.-.l. 1.1 Extrapyramidal-motorische
Kasuistische Beiträge zur modernen Pharmakotherapie mit Quetiapin Hans-Peter Volz Siegfried Kasper Hans-Jürgen Möller Inhalt Vorwort 17 A Allgemeiner Teil Stürmiücn (I l.-.l. 1.1 Extrapyramidal-motorische
Vorwort. Abkürzungsverzeichnis. 1 'Anatomie und Physiologie der Gedächtnisfunktion. 1.1 Anatomische Grundlagen des Gedächtnisses 2
 i Inhaltsverzeichnis Vorwort Abkürzungsverzeichnis V XIII TEIL A Demenz 1 'Anatomie und Physiologie der Gedächtnisfunktion 1.1 Anatomische Grundlagen des Gedächtnisses 2 1.2 Funktionen des Gedächtnisses
i Inhaltsverzeichnis Vorwort Abkürzungsverzeichnis V XIII TEIL A Demenz 1 'Anatomie und Physiologie der Gedächtnisfunktion 1.1 Anatomische Grundlagen des Gedächtnisses 2 1.2 Funktionen des Gedächtnisses
kontrolliert wurden. Es erfolgte zudem kein Ausschluss einer sekundären Genese der Eisenüberladung. Erhöhte Ferritinkonzentrationen wurden in dieser S
 5.8 Zusammenfassung Auf der Grundlage der dargestellten Ergebnisse dieser Studie erscheint die laborchemische Bestimmung der Transferrinsättigung zur Abklärung einer unklaren Lebererkrankung und Verdacht
5.8 Zusammenfassung Auf der Grundlage der dargestellten Ergebnisse dieser Studie erscheint die laborchemische Bestimmung der Transferrinsättigung zur Abklärung einer unklaren Lebererkrankung und Verdacht
Aus der Klinik und Poliklinik für kleine Haustiere der Freien Universität Berlin
 Aus der Klinik und Poliklinik für kleine Haustiere der Freien Universität Berlin Klinische Doppelblindstudie über den präoperativen Einsatz von Methylprednisolonsuccinat beim thorakolumbalen Bandscheibenvorfall
Aus der Klinik und Poliklinik für kleine Haustiere der Freien Universität Berlin Klinische Doppelblindstudie über den präoperativen Einsatz von Methylprednisolonsuccinat beim thorakolumbalen Bandscheibenvorfall
Vom Tremor zum Parkinson
 Vom Tremor zum Parkinson Videos und Literaturnachweis: Neurologie compact: Für Klinik und Praxis herausgegeben von Andreas Hufschmidt, Carl Hermann Lücking, Sebastian Rauer, Franz Xaver Glocke Parkinson-Syndrome
Vom Tremor zum Parkinson Videos und Literaturnachweis: Neurologie compact: Für Klinik und Praxis herausgegeben von Andreas Hufschmidt, Carl Hermann Lücking, Sebastian Rauer, Franz Xaver Glocke Parkinson-Syndrome
Die Meßwerte der Aktionspotentialdauern sind in Tabelle 1 und Abb. 4 bis 6 zusammengefaßt.
 4 ERGEBNISSE 4.1 Aktionspotentialdauer Die Meßwerte der Aktionspotentialdauern sind in Tabelle 1 und Abb. 4 bis 6 zusammengefaßt. Die Werte für die Aktionspotentialdauer aller Muskeln waren normalverteilt.
4 ERGEBNISSE 4.1 Aktionspotentialdauer Die Meßwerte der Aktionspotentialdauern sind in Tabelle 1 und Abb. 4 bis 6 zusammengefaßt. Die Werte für die Aktionspotentialdauer aller Muskeln waren normalverteilt.
Multiple Systematrophie (MSA)
 1 Multiple Systematrophie (MSA) MSA vereint begrifflich folgende historisch früher beschriebene neurodegenerative Erkrankungen: - Olivopontocerebellare Atrophie - Striatonigrale Degeneration - Shy-Drager-Syndrom
1 Multiple Systematrophie (MSA) MSA vereint begrifflich folgende historisch früher beschriebene neurodegenerative Erkrankungen: - Olivopontocerebellare Atrophie - Striatonigrale Degeneration - Shy-Drager-Syndrom
Phase 1: Das Geschehen rund um die Diagnosestellung 14
 Vorwort von Manfred Rommel 9 Vorwort der Autorinnen 12 Vorwort von Prof. Dr. Claudia Trenkwalder 11 1 Phase 1: Das Geschehen rund um die Diagnosestellung 14 Wie die Krankheit entsteht 16 Eine alte Nervenkrankheit
Vorwort von Manfred Rommel 9 Vorwort der Autorinnen 12 Vorwort von Prof. Dr. Claudia Trenkwalder 11 1 Phase 1: Das Geschehen rund um die Diagnosestellung 14 Wie die Krankheit entsteht 16 Eine alte Nervenkrankheit
Aufmerksamkeit und Belastung von Notärzten während des Dienstes
 Universitätsklinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ( Direktor: Prof. Dr. med. J. Radke) Aufmerksamkeit und Belastung von Notärzten während
Universitätsklinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ( Direktor: Prof. Dr. med. J. Radke) Aufmerksamkeit und Belastung von Notärzten während
Ich habe Vorhofflimmern! Was nun?
 Ich habe Vorhofflimmern! T. Meinertz Universitäres Herzzentrum Hamburg Klinik und Poliklinik für allgemeine und interventionelle Kardiologie Überblick I. Was ist Vorhofflimmern? II. Welche Prävalenz hat
Ich habe Vorhofflimmern! T. Meinertz Universitäres Herzzentrum Hamburg Klinik und Poliklinik für allgemeine und interventionelle Kardiologie Überblick I. Was ist Vorhofflimmern? II. Welche Prävalenz hat
Der Torticollis Trainer: Therapieprinzip und Stellenwert der Physiotherapie
 Der Torticollis Trainer: Therapieprinzip und Stellenwert der Physiotherapie Wissenschaftliche Grundlagen für die Wirksamkeit des visuellen Biofeedback Trainings mit dem Torticollis Trainer bei Patienten
Der Torticollis Trainer: Therapieprinzip und Stellenwert der Physiotherapie Wissenschaftliche Grundlagen für die Wirksamkeit des visuellen Biofeedback Trainings mit dem Torticollis Trainer bei Patienten
Schlucken / Verdauung und Darm. Aufmerksamkeit / Gedächtnis
 Parkinson-Tagebuch: Untersuchung Ihrer Symptome Um das Parkinson-Tagebuch auszufüllen, folgen Sie bitte den Anweisungen der vorherigen Seite. Schlafstörungen abe Probleme, nachts einzuschlafen abe Probleme,
Parkinson-Tagebuch: Untersuchung Ihrer Symptome Um das Parkinson-Tagebuch auszufüllen, folgen Sie bitte den Anweisungen der vorherigen Seite. Schlafstörungen abe Probleme, nachts einzuschlafen abe Probleme,
Das Lennox-Gastaut-Syndrom
 Das Lennox-Gastaut-Syndrom Diagnose, Behandlung und Unterstützung im Alltag von Ulrich Stephani 1. Auflage Das Lennox-Gastaut-Syndrom Stephani schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG
Das Lennox-Gastaut-Syndrom Diagnose, Behandlung und Unterstützung im Alltag von Ulrich Stephani 1. Auflage Das Lennox-Gastaut-Syndrom Stephani schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG
Vorwort. 2 Epidemiologie Inzidenz Mortalität Prävalenz Prognose 7
 Inhalt Vorwort V 1 Definition von Krankheitsbildern 1 1.1 Stadium I (asymptomatische Stenose) 1 1.2 Stadium II (TIA) 1 1.3 Stadium III (progredienter Schlaganfall) 2 1.4 Stadium IV (kompletter Schlaganfall)
Inhalt Vorwort V 1 Definition von Krankheitsbildern 1 1.1 Stadium I (asymptomatische Stenose) 1 1.2 Stadium II (TIA) 1 1.3 Stadium III (progredienter Schlaganfall) 2 1.4 Stadium IV (kompletter Schlaganfall)
Einfluss viszeraler osteopathischer Interventionen bei Kindern mit funktionellen Bauchschmerzen : Eine experimentelle Pilotstudie
 Einfluss viszeraler osteopathischer Interventionen bei Kindern mit funktionellen Bauchschmerzen : Eine experimentelle Pilotstudie Abschlussarbeit zur Erlangung des Titels: Bachelor of Science vorgelegt
Einfluss viszeraler osteopathischer Interventionen bei Kindern mit funktionellen Bauchschmerzen : Eine experimentelle Pilotstudie Abschlussarbeit zur Erlangung des Titels: Bachelor of Science vorgelegt
Ultraschalldiagnostik ermöglicht Früherkennung der Parkinson-Krankheit
 Der neue Blick in das Gehirn Ultraschalldiagnostik ermöglicht Früherkennung der Parkinson-Krankheit Hamburg (23. Juni 2009) - Manchmal hilft der Zufall der Wissenschaft. So hat sich der Ultraschall in
Der neue Blick in das Gehirn Ultraschalldiagnostik ermöglicht Früherkennung der Parkinson-Krankheit Hamburg (23. Juni 2009) - Manchmal hilft der Zufall der Wissenschaft. So hat sich der Ultraschall in
männlich 75,7% Abb.1: Geschlechtsverteilung der PAVK Patienten
 5. Ergebnisse 5.1. Alters- und Geschlechtsverteilung Das untersuchte Krankengut umfasste 325 Patienten. 246 (75,7 %) waren männlichen, 79 (24,3 %) weiblichen Geschlechts (Abb. 1). Das Durchschnittsalter
5. Ergebnisse 5.1. Alters- und Geschlechtsverteilung Das untersuchte Krankengut umfasste 325 Patienten. 246 (75,7 %) waren männlichen, 79 (24,3 %) weiblichen Geschlechts (Abb. 1). Das Durchschnittsalter
1 Implantat-Akupunktur Einführung Die klassische Ohrakupunktur Die Suche nach Langzeitstimulation Implantat-Akupunktur 6
 Inhalt 1 Implantat-Akupunktur 2 1.1 Einführung 2 1.2 Die klassische Ohrakupunktur 4 1.3 Die Suche nach Langzeitstimulation 5 1.4 Implantat-Akupunktur 6 2 Die Implantate 10 2.1 Titan-Implantate 10 2.2 Resorbierbare
Inhalt 1 Implantat-Akupunktur 2 1.1 Einführung 2 1.2 Die klassische Ohrakupunktur 4 1.3 Die Suche nach Langzeitstimulation 5 1.4 Implantat-Akupunktur 6 2 Die Implantate 10 2.1 Titan-Implantate 10 2.2 Resorbierbare
Bachelorarbeit Sport mit Schlaganfallpatienten: Ein neuer Ansatz - Der Gehweg von SpoMobil
 Universität Paderborn Fakultät der Naturwissenschaften Department Sport und Gesundheit Angewandte Sportwissenschaften Betreuer: Prof. Dr. med. Weiß Zweitprüfer: PD Dr. med. Baum Bachelorarbeit Sport mit
Universität Paderborn Fakultät der Naturwissenschaften Department Sport und Gesundheit Angewandte Sportwissenschaften Betreuer: Prof. Dr. med. Weiß Zweitprüfer: PD Dr. med. Baum Bachelorarbeit Sport mit
Die Blutversorgung des Gehirns. Figure 21-24a
 Die Blutversorgung des Gehirns Figure 21-24a Die Blutversorgung des Gehirns Figure 21-22 Die Blutversorgung des Gehirns A. cerebri media A. cerebri anterior A. basilaris A. cerebri posterior A. carotis
Die Blutversorgung des Gehirns Figure 21-24a Die Blutversorgung des Gehirns Figure 21-22 Die Blutversorgung des Gehirns A. cerebri media A. cerebri anterior A. basilaris A. cerebri posterior A. carotis
Anlage zur Vereinbarung gemäß 118 Abs. 28GB V vom
 Anlage zur Vereinbarung gemäß 118 Abs. 28GB V vom 30.04.2010 Spezifizierung der Patientengruppe gemäß 3 der Vereinbarung: 1. Einschlusskriterien für die Behandlung Erwachsener in der Psychiatrischen Institutsambulanz
Anlage zur Vereinbarung gemäß 118 Abs. 28GB V vom 30.04.2010 Spezifizierung der Patientengruppe gemäß 3 der Vereinbarung: 1. Einschlusskriterien für die Behandlung Erwachsener in der Psychiatrischen Institutsambulanz
Leitlinien orientierte Parkinson-Therapie
 Leitlinien orientierte Parkinson-Therapie Auf was muss man achten? Prof. Dr. Wolfgang Greulich Leitlinien orientierte Parkinson-Therapie 2016 Leitlinien 2016 Parkinson-Syndrome Klassifikation 1. Idiopathisches
Leitlinien orientierte Parkinson-Therapie Auf was muss man achten? Prof. Dr. Wolfgang Greulich Leitlinien orientierte Parkinson-Therapie 2016 Leitlinien 2016 Parkinson-Syndrome Klassifikation 1. Idiopathisches
REM Schlafverhaltensstörung
 REM Schlafverhaltensstörung Prof. Dr. W. H. Oertel, Prof. Dr. G. Mayer, Prof. Dr. F. Rosenow, PD Dr. V. Ries, Dr. D. Vadasz, Frau E. Sittig-Wiegand, Frau M. Bitterlich Klinik für Neurologie Philipps Universität
REM Schlafverhaltensstörung Prof. Dr. W. H. Oertel, Prof. Dr. G. Mayer, Prof. Dr. F. Rosenow, PD Dr. V. Ries, Dr. D. Vadasz, Frau E. Sittig-Wiegand, Frau M. Bitterlich Klinik für Neurologie Philipps Universität
REM-Schlafverhaltensstörung RBD
 RBD-Patiententag 20.07.2012 REM-Schlafverhaltensstörung RBD RBD Formen und diagnostische Probleme Prof. Dr. W. H. Oertel, Prof. Dr. G. Mayer, Prof. Dr. F. Rosenow, PD Dr. V. Ries, Dr. D. Vadasz Frau E.
RBD-Patiententag 20.07.2012 REM-Schlafverhaltensstörung RBD RBD Formen und diagnostische Probleme Prof. Dr. W. H. Oertel, Prof. Dr. G. Mayer, Prof. Dr. F. Rosenow, PD Dr. V. Ries, Dr. D. Vadasz Frau E.
